
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Jedes Kind ist ein Dichter. Es bewältigt die grosse Welt, in die sein Leben hineingestellt ist, durch dichterische Verzauberung, indem es lebendige Beziehungen zu Sonne, Baum und Hund schafft, indem es sich seine kleine Welt neu schöpft, wie der Dichter es tut, im Märchen der subjektiven Wirklichkeit.
Über diese Erfassung und Bewältigung der Wirklichkeit hinaus aber wirkt kindliche Phantasie schöpferisch, indem sie erfindet und gestaltet, was nicht ist. Vom kleinen Rudi erzählt sein um acht Jahre älterer Bruder, er habe sich schon früh, sobald ihm der Gebrauch der Sprache einigermassen geläufig gewesen sei, im Erzählen der abenteuerlichsten Geschichten gefallen. Doch habe er sich diese nicht abnötigen lassen. Wenn ihn seine Mutter und die Geschwister wiederholt um eine Geschichte gebeten hatten, konnte er nach langem Zögern etwa die lakonische Antwort geben: «Es Ross etrünnt . . .» Wahrlich eine Kurzgeschichte! Aber was mochte für die kindliche Einbildungskraft an Bewegung, 47 Farbe und Geschehen hinter dem geheimnisvoll geballten Stichwort lebendig sein! Und die ungeduldigen Zuhörer mussten sich damit eben zufrieden geben.
Als Jüngster in einem Haushalt, der seine ausgeprägten Gewohnheiten schon besass, hatte er sich in manchem Tun und Lassen frühzeitig nach den Älteren zu richten, glich sich wohl auch früher, als es seinen Jahren entsprochen hätte, ihren Gebräuchen an. Sprachen die Geschwister am Samstagvormittag mit den Wochenzensuren und dem Ausgabenbüchlein, zu dessen genauer Führung sie verpflichtet waren, bei dem Vater vor, um das wöchentliche Taschengeld zu erbitten, so schloss sich Rudolf diesem Gange an, auch als er noch nicht schulpflichtig war. Man bemerkte ihm, dass er ebenfalls eine Zensur vorweisen müsse, wenn er auf seinem Bittgang Erfolg haben wolle. Da begab er sich zu seiner ältesten Schwester, die ihm gelegentlich eine Stunde erteilte, und ersuchte sie um ein Zeugnis. «Ja, was soll ich da schreiben», sagte Marie, «vielleicht, Rudi hat nicht Schule haben wollen?» Auf das Geheul des Enttäuschten erbarmte die Schwester sich seiner und schrieb mit vorsichtiger Logik: «Rudi war fleissig, wenn er Schule hatte.» Mit diesem Orakelspruch trat Rudolf vor den Vater, 48 und wir haben keinen Grund anzunehmen, dass er seinen Batzen nicht erhielt.
Es mag dies der erste Orakelspruch gewesen sein, den ihm die Schule spendete, und dass er nur durch tiefen kindlichen Schmerz überhaupt zu erlangen war, hätte dem kleinen Mann ein bedeutungsvolles Zeichen sein müssen; aber noch ahnte er damals nicht die Sorgen, die seiner auf dem Gang durch die Schule warteten. Noch war ihm das Leben ein Spiel, und zum Spielen taugte alles, was ihm gehörte, nicht bloss die Uniform der Totenkopfhusaren oder die Arche Noah, sondern auch sein stolzer, dreifacher Vorname, als er an einem Abend, nachdem er bereits artig Gutenacht gesagt hatte und zu Bett gebracht worden war, wieder am elterlichen Tisch erschien, im tiefsten Negligé, und auf erstauntes Befragen, was er da wolle, ernsthaft erklärte, er sei nicht der Rudi, sondern der Otto. Man liess es gelten, die anwesenden Gäste fanden es drollig, und die Mutter steckte ihm abermals Süssigkeiten zu und hiess ihn verschwinden. Als er aber nach wenigen Minuten neuerdings auftrat, diesmal unter dem Namen Friedrich, wurde ihm bedeutet, dass auch Witze sich durch Wiederholung abnutzen.

Die alte Schosshalde
Man mag solchen Einfällen eines Kindes nicht mehr Gewicht geben, als sie verdienen. 49 Dennoch sind sie flüchtige Zeugnisse eines Geistes, dem schon früh das schöpferische Spiel der Verwandlung gelingt und der daran Gefallen findet. Dass der Dichter selber später hinter den Spielzeugfiguren seiner Jugend tiefere Beziehungen zu den Gestalten seiner schöpferischen Phantasie suchte und fand, zeigt uns eine «Erinnerung us der Chinderstube», die er mit seiner festen Schrift auf graues, starkes Papier niederschrieb und am Schluss mit einem zarten zeichnerischen Schnörkel versah:
Noah und Napoleon
Im Gfätterzüügschaft vo der Gramama lige zwo ehrwürdigi Reliquie us em guldige Zytalter vo myr zartischte Juged. Di einti isch es fingerlängs Mandli vo Papier-maché i mene bruune Kapuzinerchittel. Das Mandli het e länge graue Bart, und syni blutte Füess standen uf mene spinetgrüene, runde Brättli. Das isch der Erzvater Noah gsi us der Arche. D'Archen isch o no da; aber si isch der reinscht Tierspittel worde, vowägen allne Tierli fählt entweder es Bei oder der Stil oder gar der Chopf.
Er isch Wittlig, der Noah. D'Frou isch scho lang gstorbe. Der Unggle Fritz het se vertrappet, wo-n-er einisch isch cho Visite mache, und 50 mir hei ihri Trümmer i mene Zündhölzlidruckli uf em Vögelitotehof im obere Bosquet beärdiget. Di anderi Reliquie isch der Napoleon. Dä isch vo Blei und öppis chlyner als der Noah. Beidi trage Spure vo mene bewegte Läbe. Dem Noah syni blutte Bei stecken i dicke rotbruune Sigellackstrümpf, und der Näpi het e kei Brosme Farb meh im Gsicht. Und di Verschönerunge verdanke si sech gägesytig.
Das isch so zuegange. Einisch – mer sy scho i den obere Klasse gsi und hei längschtes nümme mit der Arche gfätterlet, nid emal meh mit de Soldate – het is d'Gramama i d'Ferien yglade gha, und mer sy mit nere-n-a menen Aben im Sääli gsässe. Da brichtet si, es gäb jitz de ne Basar für di zerstreute Proteschtante, und si heig derfür vo menen armen Italiäner es luschtigs Hüsi vo Zemänt gkouft. Si het das Ding uf e Tisch gstellt, und mir hei's nid gnue chönne bewundere. Aber bald het men afah dischputiere, was es eigetlech söll vorstelle. Di Einte hei gfunde, es glychi a mene sarazenische Castell, di Andere hei welle ha, es syg es Chloschter, di Dritte, es syg e römischi Villa. Afin, es hätti o chönne ds Modäll sy zum zuekünftige Casino. Jitz het me du sölle rate, was me für ne Staffage söll druuf tue. Ds Fanny het für Mönchen oder Nunne gstimmt, wil es gar fridliebend isch 51 gsi. Dem Fränzi hätte natürlech Ritter besser gfalle, und d'Gramama het gseit: «Kei Red, da ghöre Kanone druuf und Soldate!» Si het äbe vo Juged uuf gar viel uf schönem Militär gha; das gseht me doch am Porträt vom Grampapa sälig, wo i junge Jahre z'Naples gsi isch. Der Moritzli, wo juscht dennzumal zum Herr Blösch i d'Sunntigschuel gangen isch, chunnt uf d'Idee, das wär jitz es Huus für e Noah, geit ne ga reichen im Schaft und stellt nen uf d'Zinne vo däm Hüsi, und Alli hei gfunde, er mach sech gar möhrig i sym bruune Röckli uf däm wysse Schlössli. Bi der Glägeheit isch du neue der Napoleon o vüregschleipft worde und isch näbe der Lampen uf em Burgerbuech blybe ligen und vergässe worde.
Wo men i ds Bett gangen isch, het men o der Noah uf syr Zinne la stah.
Wil mer gar mängs im Huus gsi sy, het me mir uf em Ruehbett im Sääli bettet. Me het sech guet Nacht gseit, und i bi i ds Bett gschloffe. Es isch e wundervolli Mondnacht gsi, so dass me schier ohni Liecht hätti chönne läse. Lang, lang han i nid chönne schlafe und ha allergattig Ferieplän gspunne. Derby han i uf e Tisch übere gluegt und no einisch so Freud gha a däm luschtige Modäll, wo sech im glahrige Mondschyn no viel nätter gmacht het als im Lampeliecht.
52 Plötzlech gsehn i, dass sech uf em Burgerbuech öppis bewegt, und wo-n-i necher luege, spaziert my Napoleon uf em Tisch ume, d'Händ uf em Rügge und der Fäldstächer i der Hand. Er isch geng dem Rand vom Tisch nah gloffe, vo Zyt zu Zyt blibe stah, het mit em Fernröhrli i der Stuben ume gluegt, ungeduldig gstämpferlet und töubbelet, und de isch er de wieder wyter gloffe, es paarmal um e Tisch ume. Ändlech setzt er sech wieder uf ds Burgerbuech und seit vor sech ane: «Vraiment, ils ont oublié celui qui les a rendus si grands. O cette ingratitude!» Ändlech fallt sy Blick uf ds Castell, und er steit uuf: «A! qu'estce que c'est? Il n'y a personne là-haut?»
I der süesse Hoffnung, das alte Mandli da obe syg eine vo syne vieux grognards, geit der Näpi uf ds Castell zue, und wahrschynlich het er im Stägen-uufgah scho wieder e Fäldzugsplan etworfe. «Dis donc», räblet er der Noah mit em impertinäntischte Gsicht vo der Wält a, «comment t'appelles-tu, vieux camarade? Quelles batailles? Jena, Wagram, Austerlitz, Eylau, Leipsic, Dennewitz?»
«Verzieht, Herr Amperör», seit der Noah bescheide, «Dir trumpieret Ech allwäg. I bi der Noah. I bi äbe z'Nürebärg worden und bi leider nie im Wältsche gsi, geng nume hie z'Bärn.»
53 «A, tu t'appelles Noé, c'est toi qui a sauvé la race humaine? Faudrait te décorer.» Der Näpi het i allne Gilet-Täschli na mene Chrüz vo der Ehrelegion gsuecht.
«Leut Dir das nume sy», seit der Noah, «i ha's ja nid Euch z'lieb ta.»
«Wo esch du jitze dyne grosse Schiff?» fahrt der Napoleon furt, «lue, wenn mer ne ätte da, mer chönnte fahre ga Toulon pour y recommencer. Es isch so längwylig da à St. Hélène.»
«I gloub, es isch gschyder, mer heig es nid da», antwortet üses alte Mandli, «sünsch würdet Dir no einisch d'Wält z'underobe rüehre!»
Das het du der Näpi verdrosse, und er het du o agfange der Noah stichle: «Schwyg nume, Noé, wenn i wär gsi a dym Platz, i ätt emel nid gmacht so dumm. Alli gruusige Tier i dyne Schiff tue anstatt se la sech ertrinke, alle Schlang und Chrott und Mousquito und puces und punaises.»
«I ha drum nid chönnen usläse», erklärt ihm der Noah, «i ha se-n-alli müesse näh. Sünsch wär's de scho am gschydschte gsi, i hätt das dahinde gla, vo däm du abstammisch.»
So uverschant isch dem Näpi syr Läbtig no niemer cho. Er zieht sy Däge – es isch e Gufe gsi us em Plomb vo der Gramama – und faht a der Noah gusle dermit. Aber dä het e kei Gspass verstande, nimmt sy Stäcken und hout dem Näpi eis über d'Nase, dass d'Farb vom ganze Gsicht abspringt. Im Handgmäng aber erwütscht der Näpi der Noah bim Bart und wirft ne vom Castell uf e Tisch abe. Erschrocke rönnt er d'Stägen ab, für ga z'luege, öb er no läbi. Wo-n-er du gseht, dass der Noah beidi Bei broche het, isch er wieder uf ds Burgerbuech ga sitze. I gloub er heig ghüület.
I däm Momänt bin i erwachet vo mene Grüüsch, und i gloub, es syg e Muus vom Tisch abegumpet und hinder en Umhang gschosse.
Afin, am Morgen isch emel der Noah mit brochene Bei dagläge. D'Gramama het ne du uf ds Verlange vom Fanny mit Sigellack dokteret. Der Näpi hingäge het me la sy, wie-n-er gsi isch. Und wo-n-i ne du my Troum erzellt ha, wie wenn's di purlötigi Wahrheit wär, het der Moritzi schier briegget, so het ne der Noah duuret, und er isch der Napoleon am Schlüssel vo der Chiffonnière ga erhänke.
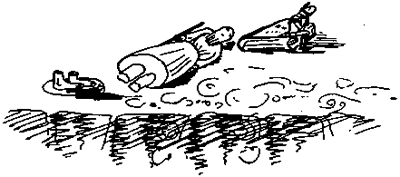
55 Die Vignette, mit der Rudolf von Tavel diese Jugenderinnerung beschloss, lässt ein ungewöhnliches Geschick der zeichnenden Hand erahnen. Früh hat er sich in dieser Kunst geübt. Auf den Blättern eines Schulheftes finden wir Federzeichnungen: Schlachten, Kriegsgerichtsverhandlungen, Lagerleben, Bombardement der Stadt München, einen zwölfköpfigen Generalstab in lauter verschiedenen Uniformen, alles zierlich hingekritzelt, doch nicht ohne Schwung in den Bewegungen von Soldat und Pferd, und offenbar von Menzelscher Zuverlässigkeit bis auf den letzten Gamaschenknopf! In diesen Liebhabereien traf sich Rudolf von Tavel mit dem früh verwaisten Alphons von Steiger, dem Spielgefährten aus Kinderstubentagen, der später in deutschen Diensten als Husar den Weltkrieg mitgemacht hat und 1915 in Polen verwundet wurde und gestorben ist. Ihm widmete Rudolf von Tavel ein Gedenkwort, in dem die gemeinsame Jugendzeit heraufbeschworen wird:
«Lasst mich noch einmal einen Blick zurückwerfen auf die sonnigen Tage unserer Kindheit. Ob wir uns in der Schule kennen lernten, oder ob man uns ausserhalb derselben zusammenführte, weiss ich nicht mehr. Deutlich steht mir noch in Erinnerung, dass ich 56 einmal zu meinem Freund eingeladen wurde bei seiner Tante, einer sehr freundlichen, achtunggebietenden Dame, die meinen Freund und seinen jüngeren Bruder in Pflege hatte. Dass wir in manchem ganz ähnlich empfanden, zeigte sich alsobald – unter anderem hatten wir beide einen stark ausgeprägten Sinn für das Seltsame, uns komisch Erscheinende an anderen Leuten – aber ebenso schnell wurde mir der Unterschied bewusst, den unsere beiderseitige Lebensstellung in allerhand kleinen Dingen mit sich brachte. Das Bedauern mit dem so früh Verwaisten führte dazu, dass er von den Verwandten mit sehr schönem Spielzeug bedacht wurde, während in meinen eigenen Beständen die pädagogisch strengen Grundsätze meines Vaters sich deutlich ausprägten. Da besass z. B. mein Freund wunderhübsche mit Fell überzogene Pferdchen, ein pickfeines Coupé aus glanzvoll firnisiertem Blech und einen Livreekutscher. Ich dagegen besass vier jener rohhölzernen Gäule vom «Besenmärit» mit eingebrannten Tupfen und Rosshaarringelschweifen, dazu einen ebenso unverwüstlichen Lastwagen. Und Geschirre sollte ich mir aus Packschnüren herstellen. Die Kinderstubenpoesie, die um ein so primitives Gespann schwebt, vermochte ich damals noch nicht zu empfinden und verging fast vor Neid. Diese 57 Differenz blieb für unser ganzes Leben charakteristisch. Aber sie tat unserer Freundschaft keinen Abbruch.
Wir entdeckten in unserer kleinen Welt immer neue Gebiete, die unser beider Interesse in Anspruch nahmen. Neben die Rösslein traten die Soldaten, dann Zeichnen und Malen. Diese Dinge wuchsen mit uns, und zwischen ihnen nisteten sich bei uns beiden allerhand zunächst noch harmlose jugendliche Leidenschaften ein, die immerhin Keime zu Schlimmerem enthielten und uns schon früh zu quälen anfingen. Deutlich empfanden wir das Unvereinbare zwischen dem, was uns der Geist der Lerberschule, unterstützt durch die Gesinnung unserer Nächsten lehrte, und dem, was die natürlichen Neigungen von uns wollten. Zunächst aber genossen wir harmlos, und unsere kleinen Laster kamen uns interessant vor. Wenn Sonntags meine Eltern und Geschwister in die Kirche gegangen, kam mein Freund zu mir, und wir schwelgten dann im Rest des vom Frühstück übrig gebliebenen schwarzen Kaffees, den wir stark zuckerten, und spielten Karten, bis es Zeit war – zur Sonntagsschule . . .»
Das Leben in freier Luft, das ungebundene Streifen durch die Weiten der Schosshalde und des Murifeldes, Pirsch- und 58 Holzfrevelgänge, auf denen man sich vor dem gestrengen Onkel Forstmeister von Wittikofen hüten musste, der «den patentlosen Neffen nicht glimpflicher vornahm als den Mätteler», und später das soldatische Spiel im Steigercorps, das am Kalcheggweg im Hof unter der grossen Linde seine Kaserne hatte – dies alles bildete ein gesundes Gegengewicht zu den immer schwereren Lasten und Sorgen, die das Gymnasium dem Jüngling aufbürdete. Reisen und Wanderungen, oft zusammen mit dem Vater, brachten willkommene Abwechslung; so im Jahre 1876 die Fahrt durch den Jura nach Belfort, wo die Befestigungswerke auf den militärbegeisterten Rudolf den grössten Eindruck machten, oder zwei Jahre später eine Fussreise ins Berner Oberland auf das Hohtürli, wobei man sich im Gewitter mit einem des Wegs nicht kundigen Träger auf dem Blümlisalpgletscher verirrte, dann nach dem Abstieg über den Öschinensee in Kandersteg den weiblichen Teil der Familie wieder traf und andern Tags gemeinsam in Kutschen talauswärts nach Spiez fuhr und von da über den See nach Sigriswil, wo man den Rest der Ferien zubrachte. «Diese Fahrt von Kandersteg nach Spiez ist mir unvergesslich», notiert Rudolf sechs Jahre später in seinen «Memoiren», «denn selten habe ich meine lieben 59 Eltern in solchem Masse fröhlich und vergnügt gesehen wie damals.»
Was war denn jenes Freicorps Steiger, das auch in den Erinnerungen des Freundes Paul von Greyerz eine so hervorragende Rolle spielt? Die «Memoiren» geben erschöpfende Auskunft; sie schildern ein Bubenidyll, in dem die Abenteuerlust wie der unbewusste Drang zur militärischen Disziplin nicht zu kurz kamen. «An einem stillen Spätsommerabend wurde der Entschluss gefasst, eine Art von freiwilligem Kadettencorps zu gründen. Es wurde vorausbestimmt, dass das Kommando in die Hände Oswald von Steigers kommen solle. Er war ein ausgezeichneter Führer, wenn auch oft despotisch und hartköpfig gegen die Räte wohlmeinender Offiziere. Für den Anfang wurden acht bis zehn Mann, darunter meine Wenigkeit, angeworben, die dunkle Waffenröcke mit roten Aufschlägen und graue Beinkleider trugen. Als Waffen hatten sie das Vorderlader-Kadettengewehr. Später trug man eine schwarze Feldbinde mit weissem Kreuz am linken Arm. Die Kopfbedeckung war die sog. Polizeimütze. Weisse Metallknöpfe zierten den Waffenrock. Die Achselklappen waren weiss und schwarz. Nicht lange nachher wurde noch eine Schützenkompagnie errichtet . . .», die eine andere Uniform und einen 60 Hut mit Hahnenfederbusch trug und der Rudolf vorerst zugeteilt wurde. Als er sich jedoch anerbot, eine Artillerieabteilung aus eigenen Mitteln zu errichten, winkte ihm die Beförderung zum Lieutenant. Er hatte Glück, denn eines Tages beobachtete ein älterer Herr, der offenbar von Artillerie etwas verstand, die Schar beim Exerzieren, rief Rudolf zu sich und versprach ihm «ein nach den Modellen der eidgenössischen Armee gearbeitetes Geschütz, das er vollständig selbst angefertigt hatte. Der Lauf war aus reiner Bronze gegossen, von einzolligem Kaliber. Die Bedienungsmannschaft zählte vier bis sechs Köpfe . . .»
Die Gefechte, in denen sich das Steigercorps mit andern Konkurrenzunternehmen wie dem sog. Eschercorps mass, erfahren eine liebevolle Schilderung, in der an Pulverdampf und Strategie nicht gespart wird. Der Freund und Kanonierkorporal Paul von Greyerz bringt sogar aus, dass man hin und wieder die Sonntagsschule geschwänzt und «droben bei Rudi in der Schosshalde auf der Terrasse mit Pulver und alten Schulheften Patronen für das Kanönchen fabriziert» habe. Welch herrliches Gefühl, wenn man nach siegreicher Schlacht heimkehrte: «Inmitten unserer Infanteristen marschierten die Gefangenen. Unser Geschütz war mit eroberten Waffen 61 beladen. In Brunnadern angelangt, machte man ein Joch, d. h. man nahm unsere Fahne, ein Mann musste sie beim Spitz, ein andrer am untern Ende auf die Schulter nehmen, und dann wurden alle Gefangenen drunter weggejagt. Von diesem Tag gewann das Freicorps von Steiger einen grossen Namen. Es lebte, wuchs und blühte schöner als je.»
Warum wir so lange bei diesem Spiel verweilen, das allerdings die Taten der Erwachsenen mit leidenschaftlichem Eifer nachahmte? Weil es in den «Memoiren», dieser Niederschrift von selbstbesinnlicher Art des Achtzehnjährigen, einen ungemein breiten Raum einnimmt, also offenbar eine wichtige Episode in jenen Entwicklungsjahren darstellt. Rudolf bekennt es sogar ausdrücklich, wenn er schreibt: «Diese Geschichten interessierten mich mehr und mehr, so dass ich von gar nichts anderem mehr sprechen wollte als vom Corps und Militär. Mein Vater fand dies gefährlich, wegen meiner ohnehin schwachen Stellung in der Schule! Er gebot mir, mich weniger damit abzugeben. Deshalb gab ich meine Stelle als Lieutenant der Artillerie auf und stellte mich als Feldwebel an die Spitze der Unteroffiziere . . . Im Frühling 1881 bestand ich zwar das Promotionsexamen, wollte aber um keinen Preis die bevorstehende 62 Klasse durchmachen . . . Die Lerberschule war mir so verleidet, dass ich nichts mehr von ihr wissen wollte.»
So steht es also mit dem Freicorpsführer! Der Schritt aus dem Glanz jugendlichen Ruhms in das Düster der Schulmisere ist kurz. «Mein Vater gebot mir . . .» Er war ein strenger, aber gerechter Vater, der seine Kinder nicht pedantisch erzog – was ihm sein Sohn Albert in einer schönen, auch kulturhistorisch interessanten Biographie bestätigt. Aber er mochte sich seine berechtigten Sorgen machen über das so gar nicht schulgemässe, scheinbar zerfahrene und unaufmerksame, in Wahrheit wohl vorwiegend phantasiegeprägte und langsam aufnehmende und verarbeitende Wesen seines Jüngsten. Er selber, der im Nebenamt als Journalist eine scharfe Feder führte, hatte zwar Verständnis für Extratouren in das Reich der Kunst, der Phantasie, der Unwirklichkeit; ebenso war er ein Freund gesunder Leibesübungen und billigte das militärische Spiel, dem die jungen Leute oblagen und das sie übrigens ganz aus eigener Tasche bestreiten mussten; aber die Schule durfte unter diesen Ablenkungen doch nicht leiden. Dass er Direktionspräsident des Gymnasiums war, machte den Fall für Vater und Sohn nicht einfacher.
Wie er ihn zu lösen verstand, stellt seiner 63 erzieherischen Einsicht ein treffliches Zeugnis aus. Lassen wir darüber den Sohn selber berichten, der, als er auch ein Schulpräsident geworden war, von jenem wichtigen Sommer 1881 (in den Mitteilungen aus der Neuen Mädchenschule) erzählte:
Wie-n-i zum Herr Dumermueth cho bi
I gar mängem Pfarrhuus, landuuf, landab, findt me Chinder, die men us irged mene Grund het müessen aparti tue, wie men öppe nes Meiestöckli, wo särblet, a nes bsunders Plätzli stelle muess, damit es wieder zwägchunnt. Di meischte vo dene Chinder sy settigi, die z'viel Ufgabe gmacht hei und uf de Närve schwach worde sy. I weiss aber e Bueb, dä me so i nes Pfarrhuus ta het, wil er juschtemänt z'wenig Ufgabe gmacht und gar keini Närve söll gha ha. Dä Bueb isch nid zwangswys, sondere schröcklech gärn i sys Pfarrhuus gange, wil er vo de Lehrer i der Stadt zum mindischte so gnue gha het, wie si vo ihm. Und derby isch er doch gar kei untane Kärli gsi. Ds Einzige, was ihm im Wäg gstanden isch, isch sy unbändigi Phantasie gsi. Und das het offebar vo syne Lehrer keine gmerkt. Stundelang hei si doziert und brichtet und sech e Hundsmüej gä mit ihrer Klass. Und derby isch üse Bueb glücksälig da gsässe – z'vorderscht 64 vorne – und hätti am Schluss vo der Stund mängisch chuum chönne säge, öb me Wältsch oder Geometrie gha heigi. So isch me sech gägesytig verleidet, und hätti me nid dä unglücklech Klasseschleipftrog i mene schöne Früehlig uf sys eigete flähetleche Verlangen us der Schuel gnoh und dem Pfarrer Dumermueth i Pänsion gä, so hätti di Neui Mädcheschuel hütt no einisch kei Presidänt, vowäge dä arm Bueb isch äbe dä gsi, wo hie schrybt, mit der süesse Hoffnung, das chlyne Bitzli Läbesgschicht dieni alle Lehrgotten und Lehrgöttine zum warnenden Exämpel.
E, was isch mir ds sältmal di Schuel verleidet gsi! I gloub, wenn Eine cho wär und hätt mer gseit, i chönn mit ihm zu de Kannibale ga Schaf hüete, wenn i uf eim Bei bis ga Neueburg well hopse, i hätt's gmacht. Aber da isch Eine gsi, wo's besser mit mer gmeint het, my liebe, unändlech geduldige Vater. «So syg's!» het's gheisse, «me muess dä Bueb öpperem i d'Kur gä und no-n-es halbs Jahr Geduld ha. Villicht git's de glych no öppis us ihm.»

Die Mutter mit Rosalie und Rudolf
Das isch du e Früehlig gsi, wie-n-i no nid mänge ha erläbt gha, so heiter und schön. Der Herr Dumermueth, dä fründlech Herr, mit sym schöne, blunde Bart und de lieben Ouge, isch mer vo nes paar Ushülfsstunde, wo-n-er is einisch gä het, i gar guetem Andänke gsi. 65 Erscht woni zwüsche Papa und Mama der Bürestutz uuf gwanderet bi, der Ysebahn zue, sy mer du Bedänke cho. Eigetlech so zu mene Pfarrer, so ganz und gar zue-n-ihm, under ds glyche Dach mit ihm, und de geng under synen Ouge z'sy! I der Schuel isch me doch höchschtes sibe Stunde täglech i der Gwalt vo de Lehrer gsi. Und de äbe, öb de so-n-e Pfarrer nid eigetlech nätter wär vo wytem? – I bsinne mi no, wie wenn's geschter gsi wär, dass i z'oberscht am Stutz myne Gedanke mit der unbeholfene Frag Luft gmacht ha: «Chan er ächt de o mängisch chly lache?» (Der Herr Pfarrer nämlech.)
Myni Eltere sy viel z'zartfüehlend gsi, als dass si mi hätte la gspüre, dass di verrateni Angscht se-n-amüsieri. Si hei wohl glachet, aber nume, für mi z'tröschte. Und wieder hätti sech's my Papa nid erloubt, mer d'Nase druuf z'stosse, dass d'Pfarrer o Möntsche syge, was ja so nach gläge wär und was my Papa läbhaft sälber epfunde het.
Z'Chise sy mer sälbdritt i nes heimeligs gääls Pöschtli gsässen und – glung glung gling gling – am Schlossbärg vorby über Oppligen und Herblige gäge Diessbach zue gfahre. I der üppig grüene Talmulde zwüsche Falkeflueh, Glasholz und der Huben isch my neui Heimet vor is gläge, ds stattleche Dorf Diessbach, 66 so schön und heimelig. Aber mitts us em Wirrwarr vo breite Schüüredecher und heitergrüene Boumchrone het sech – für mi wie-n-e warnende Zeigfinger – der schlank Chilchsturm mit sym glänzige Schindelhälm ufgreckt und es ärnschts Wort mit mer afah rede. Um so tröschtlecher het am Dorfygang zur Linggen e Chramlade mi aglachet. Aber es paar Schritt wyter, rächter Hand – wär i statt dem alte roschtigtüpflete Schümmel vorgspannet gsi, hätt's ohni Zwyfel e Sytesprung und en Usläärete gäh – hei die lääre Stube vom Sekundarschuelhuus is us breite Bogefänschter agrännet, und wie Fangarme hei sech verdolggeti Schuelbänk vor em Huus bis a d'Strass vüre greckt. 's isch Putzete gsi, und Burewyber hei d'Tische vorusse gfägt.
Am stattleche «Leue» vorby isch me, hert under der Chilchhofmuure düre, zum primitive Poschtbureau cho, wo der Herr Pfarrer is erwartet het. Ohni bsunderi Ufforderung het er mer bewise, dass er o chly het chönne lache, und mer hei später no mängisch rächt härzhaft zsäme glachet. Me isch du sälbander i ds Pfarrhuus ufe, wo gar verwändt heimelig übere höche Läbhag vom Vorplätzli übere gluegt het. D'Frou Pfarrer het is mit mene währschafte Café ufgwartet. Die neui Vizemama het mi mit grosser Fründlechkeit und 67 Liebi i ihri Obhuet gnoh und grad welle wüsse, ob mer o albeneinischt öppis fähli und weler Gattig men öppe müessti doktere. Si het e so allerwälts nüt Rässes a sech gha, dass i grad dänkt ha, hie wärd's mer wohl sy. Und i ha mi nid trumpiert.
Im erschten Etage hindenuse het me mer my Stuben agwise, e wahri Allmänd mit mene Kamin und vier Fänschter, drüü gäge d'Hoschtet und eis gäge Gköchgarte. Si hätte nere no meh gha. Im Dach obe sy emel no zwo oder drei prächtigi Stube gsi mit bruun gröuktem, tannigem Täfel. Aber si hei söllen unghüürig sy, und i wär nid für viel Gäld dert ufe ga schlafe.
Hinder myr Stuben isch e Loube gsi, e Loube, sägen ig ech, wie si numen i menen alte Bärner Pfarrhuus chönne sy. Es Eldorado vo nere Grümpelchammere mit mene Gstelli voll uröppige Büecher. Dert han i doch mängisch gschnouset.
Es isch es eigets Gfüehl gsi, wo mi ds Herr Pfarrers am Abe, nam Abschid vo den Eltere, i my Stube gfüehrt und gfragt hei, öb mer jitz nüt meh fähli. Nei, es het mer nüt gfählt als der Übermuet. Und doch bin i zfride gsi. I bi i ds Bett gschloffe, und dert han i du no d'Bekanntschaft gmacht vom ehrwürdige Schutzpatron vom Pfarrhuus. Als einzige 68 Wandschmuck isch nämlech zu myne Höupten in effigie der Samuel Lucius ghanget, e kuriosi Helge. Ds eigetleche Porträt het d'Umschrift treit: «Jesus nimmt sich der Sünder an. – Samuel Lucius, Pfarrherr zu Ansoldingen. aetatis 55». Und drunder isch es Landschäftli gsi mit nere strahlende Sunnen über de Bärge. Vor mene Brunne weidet es Schäfli, und vis-à-vis dervo chunnt e grässleche Leu us nere Höhli und wott's cho frässe. Aber us nere Wulke chunnt e Hand, wo der Leu a nere Chetti het. I der Umrahmung heisst es: «Gott zäumet meinen Feind, der so erbosst und wild. Sonst wär ich längst dahin! Der Herr ist Wonn und Schild».
I ha denn natürlech no nüt gwüsst vo däm Ma. Aber es isch mer hütt, wie wenn er my Schutzgeischt gsi wär. Und warum wär er's nid gsi? Dä Gloubesheld het ja dert inne gwohnt und isch Anno 1750 dert gstorbe.
He nu, wenn i scho e Söubueb gsi bi, so bsinnen i mi doch, dass i o damals flyssig zu mym Heiland bättet ha und dass der Spruch vom Sünder-Heiland nid für nüt ob mym Bett ghanget isch.
Zmorndrisch het für mi d'Schuel wieder agfange, aber wie anders als z'Bärn! Es het scho ganz anders gschmöckt als a der Schouplatzgass. Wahreddäm i mit dem Herr Pfarrer 69 am Schrybtisch gsässe bi und er mi i Caesaris bellum gallicum umegsprängt het, het der Sigerischt vor den offene Fänschter Bschütti usta, und d'Güggle hei gchräjt, und me het d'Bure ghört d'Sägesse wetze, für di erschti Grasig z'näh. I der Zwüschezyt het's allerhand luschtigi Arbeit im Garte gä, und dernäbe han i ghulfe goume. I ha der erscht und damals no einzig Suhn vom Herr Pfarrer im Wägeli dasume gstosse.
I ha o bald Bekanntschaft gmacht mit de pfarrherrleche Trabante. Das sy originelli Chuze gsi. Der Organischt, e steialte Primarschuelmeischter, het einisch, wo e frömde Prediger a mene kirchleche Bezirksfescht es ungwahnets Lied agä het, vom Lättner zur Chanzlen übere grüeft: «Herr Pfarrer, das geit nid; es isch es molligs».
Der Sigerischt het ei Tag e chly z'stark z'Nüüni gnoh, göb dass er het welle ga elfi lüte. Und wil's no nid ganz nache gsi isch, het er uf mene Stäg under de Glogge no-n-es Nückli gnoh. Na anderthalb Stunden isch er erwachet und het, i der Meinung, es wärd jitz angähnds nache sy, afah lüte, bis die vo Äschle mit der Füürsprütze sy cho z'fahre.
Na de Früehligsferien isch mer wieder e neui Wält ufgange. Für di ordinäreri Wüsseschaft nämlech het me mi i d'Sekundarschuel 70 gschickt. Dert bin i zum erschten und einzige Mal i der glyche Stube mit de «Modeni» i d'Schuel gange. Die sy hinde gsi, d'Buebe vorne. Und wettige Huufen i der glyche Klass! I der Freistund isch men uf e Turnplatz use gange, und da sy si um mi umegstande, hei mi tschärbis agluegt, d'Buebe no dümmer als d'Meitscheni. Und ändlech seit Eine, wo scho einisch z'Bärn inne gsi isch, zue mer: «Wie hiissisch?» Und wo-n-ig ihm my ehrleche Chrischtename säge, antwortet er mer: «Du luegsch grad wie Nordmann z'Bärn». Es het mi o, so lang i z'Diessbach gsi bi, keine vo myne Kamerade bi mym Name gnennt; sondere für si bin i «ds Pfarrers Bueb» gsi und blibe, und so han i im ganze Dorf gheisse. I gloub, das heig mir besser gfallen als dem Pfarrer. O der Lehrer het nid sy rächte Name bhalte. Flückiger hätt er gheisse; aber si hein ihm «Flügu» gseit. I der Underwysig hei si mi no gspässiger agluegt. Wil i z'hinderscht gsässe bi, het der Pfarrer di ganzi Zyt müesse schmähle: «Was heit der aber hinderez'luege? Passet uuf! Marlisi Schüpbech, was isch dein einziger Troscht im Läben und im Stärbe? – Lue, du weisch es nid! So geit's, we me geng hindere gaffet.»
Es isch nid lang gange, so han i mer myni Fründen usegläse gha, nid geng mit dem beschte 71 Gschick; aber der Herr Pfarrer het de scho gwüsst z'verhüete, dass i mi a di Lätze ghänkt ha. Am nächschte bin i de Buebe vo der Leuewirti cho, und dür die han i du o vieli Erwachseni glehrt kenne. I dänke vorewäg a d'Leuewirti, e stattlechi, guethärzigi, aber energischi Witfrou, die näben allne Wirtschaftssorge geng Zyt gfunde het für ihri Chinder und für di vielen andere Lüt, wo dert ihres Brot gfunde hei. Ihren Eltischte, der Hans, isch öppis jünger gsi als i, aber zächemal elter i allne Sache, wo ds praktische Läben i Huus und Hof agange sy. Mer sy bald rächt guet befründet gsi, aber nie ganz intim worde. Der Hans isch der Buresuhn blibe – im beschte Sinn vom Wort – i der Stadtfisel. Näbem jüngere Brueder, dem Hermann, het de der Suhn vom Lächema e bedütendi Rolle bi üsnen Undernähmunge gspilt. Er het Louis gheisse, uf dütsch Ludi oder «Lüdu». I menen Abou a Leuen isch e chlyni Schaal etabliert gsi, und dert han i i aller Form glehrt metzge. Der Gwunder het mi dert ynegfüehrt, einisch im Ougeblick, wo der Metzger – e grosse, schwäre Ma, wo langsam i brodierte Pantofflen und mit mene guetmüetige Gsicht um ds Huus umetrappet isch – juscht es Chalb het uf em Schrage gha. Es het der Chopf la abehange, und der ganz flüssig Inhalt het sech dür sys 72 Muul etläärt. Da seit der Metzger zue mer: «Häb mer da chly der Cring!» (nämlech nid dem Metzger syne, sondere der Chalbschopf). Dienschtfertig bin i zuechegsprungen und ha dä Chalberchopf über ne Züber gha, und der Metzger isch furtgloffe, vermuetlech, für eis ga z'näh i d'Gaschtstuben übere. Das isch du öppis anders gsi als Cäsar und Cicero; aber i ha dem Metzger sy Bosheit nid übel gnoh, sondere bin ihm treu bliben und ha nah-ti-nah ganz e guete Begriff übercho vo der Metzgerei. Näbem gwunderigen alte Poschthalter isch de no es stumms Faktotum da gsi, wo sech überall nützlech gmacht het und – das muess i säge – nid öppen als halbwärtige Möntsch verachtet, sondere geng mit mene gwüsse fromme Respäkt behandlet worden isch.
Wo der Heuet cho isch, bin i mit allne dene Lüten uf ds Fäld. Es git doch nüt Schöners i der Landwirtschaft als so ne Heuet bi guetem Wätter. Es isch der Inbegriff vo nere luschtigen Arbeit, und müesst me no so grüüslech schwitze. Aber ei Tag hätt' es lätz chönne gah. Üser drei Buebe sy mit mene lääre Leiterwage der Hubestutz ufgfahre. Der Hans het gfüehrt. Da chunnt oben am Stutz es chlys schwarzes Hündli cho z'springen und schnellt ds einte Ross i d'Nase. Wägeliryten isch sünscht e schöni Sach; aber sältmal wär i lieber z'Fuess 73 gange – das chan ig ech säge. Im rasende Galopp i mene lotterige Leiterwage, uf mene holperige Charrwäg, isch en eigeti Art Reise! Mer hei nüt gwüsst z'machen als brüele. Und z'gueterletscht hei d'Ross i mene gäje Rank vom Wäg abbogen und sy mit is dür ne Hoschtet ab gfahre, mer hei schier nümme dörfe luege. Aber mer sy ganz ohni Schade dervo cho. Ds Heuervolk het is gseh cho z'chessle, isch is etgäge cho und het du uf freiem Fäld usse der Jagd chönnen es Änd mache.
Der Heuet het sy Abschluss gfunde i der sogenannte Heuete. Der Herr Pfarrer het mer erloubt d'Yladung derzue az'näh, wenn i de zur Zyt well hei cho. I ha's natürlech versprochen und bi gange.
I nere ziemlech dumpfe Burestube bim Lächema vom Leue hei sech Meischterlüt, Chnächte, Tauner, Jungfrouen und e grossi Trybete Chinder um mehreri Tische gschaaret und mit lüüchtender Feschtstimmung uf ds Ässe gwartet.
Zum erschtemal i mym Läbe han i vo «Vorässe» ghöre brichte und bi nid wenig verwunderet gsi, wo men es chüschtigs Ragout under däm Namen uftreit het.
Was me sünsch no alles gha het, bsinnen i mi nid, aber viel isch es gsi. Und me het's mit 74 wyssem Wy bschüttet, so sträng me möge het. Zwüschenyne het men eis über ds andere gsunge. Unvergässlech blybt mer, was der Stumm zum Beschte gä het. Uf eis mal het's gheisse: «Still, Buebe! Der Stumm wott singe». Alles isch müüslistill gsi, und ärnscht sy si alli blibe, wie währed mene Tischgebätt. Me het e grosse Meje vor e Stumm häregstellt, und du het er dä Meje mit verliebten Ouge gschouet, ne hie und da e chly dräjt und gestikuliert, wie wenn er mit dene Blueme zärtlech würdi rede, und derzue in unartikulierte Tönen es längs, chindlechs Lied gsunge. I bi sicher, Stadtchinder hätte ds Lache nid chönne verha; aber di Burelüt sy, wieni säge, still und andächtig blibe.
Nachhär isch d'Luscht wieder losbroche, und «ds Pfarrers Bueb» het nid a ds Heigah dänkt, bis vo de chlynere Chinder eis um ds andere vor Schlaf ab em Stuehl trohlet isch. Ändlech het mi es dunkels Gfüehl doch heizoge.
Wo-n-i i ds Pfarrhuus chume, steit oben a der Stäge di längi Gstalt vom Herr Pfarrer, i der einte Hand es Liecht, i der anderen en Uhr. Ohni uf d'Uhr z'luege, bin i an ihm vorbygstürmt, i my Stuben und i ds Bett. «Aber, aber!» het der Samuel Lucius gseit, und i ha d'Dechi über d'Ohre zoge, für nid wyterz'lose.
75 Viel und oft han i vom Wunderdokter z'Bränzikofe ghört brichte. Me het nen o mängisch uf sym Rytwägeli gseh vorbychessle. Wenn er Sprächstund gha het, so sy si Tagreise wyt cho z'fahren und z'loufe, und er het ne für Möntschen und Vieh ghulfe. Albeneinisch het ne de der Regierungsstatthalter nachegnoh wäge Kurpfuscherei. Aber im Ougeblick, wenn si ne z'Schlosswyl hei wellen i Turm tue, het er ne de albe gseit: «I ha ne Notfall. Leut mi gah, süscht stirbt er!» Und de hei si ne de la loufe.
Meh und meh han i Land und Lüt glehrt kenne, vo der gueten und böse Syte. I ha emel o um Chüneli ghandlet mit de Burebuebe, und i müesst mi trumpiere, wenn si mer nid d'Chüneli, wo-n-ig nen abkouft ha, verschleikterwys wieder us der Pfruendschüüre heigreicht hätte. Es isch, wenn men us so verschidene Verhältnissen use gwachsen isch, nid liecht, ängeri Fründschafte z'schliesse. Derzue chunnt de no es gwüsses Misstroue, wo näben alle gueten Eigeschaften üser Landbevölkerung ahaftet. E modus vivendi findt me mit de Bure nid schwär, aber ihres Vertroue gwinnt me langsam.
Als «ds Pfarrers Bueb» han i de frylech wieder mängi Fründlechkeit gha z'quittiere, die me sech dem frömde Stadtbueb gägenüber vermuetlech erspart hätti.
76 Ei Tag han i bi mene Burehuus müesse ga schärme. Si hei dinne juscht z'Vieri gnoh. Da het's bald gheisse: «Chumm yhe!» und «Hock zueche!» I ha nid gwüsst, wär di Lüt sy, bis i dinnen i der Stuben eine vo myne Schuelkamerade gseh ha. D'Familie – im alt römische Sinn, denn es isch alles bi-n-enandere gsi vom Buur bis zum Hüeterbueb – isch fridlech und schwygsam um ne blank gwäschene Tisch ume gsässe. Niemer het nüt gseit, am allerwenigschte my Schuelkamerad, dä mi mit de grüüslechschte Glotzouge verfolget het. D'Büüri het mer us menen unerchannt grosse Heimbärghafen e Tasse voll Milchcafé ygschänkt und mer es aghoues vierpfündigs Brot zuegschobe: «Nimm ume!» – Ja, nimm ume! Chönne wär no besser gsi. Der Café isch e so füürig gsi, dass i ne schier nid ha dörfen aluege, gschwyge de arüehre. Und mit däm Brot han i ohni Mässer erscht rächt nüt gwüsst az'fah. Wo si my Verlägeheit gmerkt hei, isch mer ändlech der Mälcher z'Hülf cho und het mer sy Sackhegel etlehnt.
Es het o nie lang hinderenand a Visite gfählt, wo Abwächslung i üses stille Läben im Pfarrhuus bracht het. Schuderhaft luschtig het's mi dunkt, wenn albe ds Herr Pfarrers Brueder vo der Langenegg cho isch, e währschafte Burema i mene blaue Burgunder. Kei Möntsch hätti 77 dra gsinnet, dass das Brüeder wäre, der eint e so fyn, schlank und schier dürsichtig und der ander so bürsch. Und doch het me de bald gmerkt, dass si us der glyche, gsunde Wurzle gwachse sy und sech brüederlech verstanden und gärn gha hei.
Einisch sy anderi Verwandti vom Herr Pfarrer cho z'chaisle. Wo die wieder hei wellen aspanne, het der Bschüttilochdechel under ihrem Schümmel la gah. Das isch du-n-e Gschicht gsi, wohl, bis me das guete Tier wieder het dusse gha!
O vo Bärn sy öppe Lüt cho. Einisch het mi der Herr Oberscht vo Büre mit zweenen andere vo synen unzählige Göttibuebe greicht und isch mit is um die ganzi Falkeflueh umen uf e Stauffe, wo-n-er es Landguet gha het. Da sy viel Lüt us der ganzen Umgäged zsämecho, und me het e so en Art es religiöses Fescht veranstaltet. Aber es sy nid nume Lüt vo der evangelische Gsellschaft derby gsi. I bsinne mi emel a ne Pfarrer us em Ämmetal – i will ne nid mit Name nenne – dä het zum Etsetze vo üsem verehrte Herr Oberscht zum Beschte gä, ihm syg's grad glych, wenn d'Lüt, statt zue-n-ihm z'Predig z'cho, daheim vor em Huus blybe sitze. I hätt ihm am liebschte g'antwortet, si wärde wohl wüsse warum und heige villicht no rächt. Aber der Oberscht het ihm sys Missfallen uf ne milderi, wenn o bestimmti Art kundgä. Wenn i nid irre, het du di unglücklechi Gmeind vo däm Mietling, wo si na ihm en ärnschte Pfarrer übercho het, dä gar nid mögen erlyden und het ne na nes paar Jahre gflämmt.
Es anders mal het mi e Fründ vom Herr Pfarrer mitgnoh i ds fründleche Pfarrhuus vo der Schwarzenegg, wo-n-ig es paar Tag bi der Familie Rohr herrlech und i Freude gläbt und a nüt meh wyters dänkt ha, bis es Telegramm vom Herr Dumermueth cho isch: «Wo bleibt unser Rudolf?» Hals über Chopf bin i Diessbach zuegreiset. D'Frou Pfarrer het mer welle ds Mösch putze, wil i so lang furtblibe bi. Im Gköchgarte, zwüsche de Buchshegleni, het si mi z'Red gstellt. Die gueti Seel het sech uf ds Ufbegähre schlächt verstande, und doch het mer ihri sanfti Schmählete viel meh Ydruck gmacht als mängs vo de grossartigschte Kathedergwitter.
Nume z'gschwind isch di herrlechi Zyt verstriche. Was si für mys ganze Läbe bedütet, han i erscht lang, lang nachhär afah begryfe. Dert, im stille Pfarrhuus, han i der Grund gleit zu mym erschte schriftstellerische Produkt. Es uralts Büechli übere Tiroler Freiheits-Chrieg vo anno nüüni isch my liebschti Lektüre gsi, und da druus isch später der «Sandwirt von 79 Passeyer» worde. Der Houptwärt vo mym Diessbacherufethalt ligt aber im Blick, wo-n-i damals mit eifältige Chinderougen i ds Härz vo Land und Lüt ta ha. Was i dert ahnungslos i mi ufgnoh ha, isch mer hütt en unerschöpflechi Quelle für ds Schaffen us der Erinnerung.
Und wenn i e pädagogische Rat us myr Pfarrhuuszyt darf ableite, so isch es dä: Heit Geduld mit de Sorgechinder! Versetzet se, wenn's nümme wott gah, i nes anders Gschirrli und stellet se-n-a d'Sunne vo geduldiger, chrischtlecher Liebi; die macht mängs ume guet.
Als Rudolf aus Diessbach zurückkehrte, war er guter Vorsätze voll. Der regelmässige Unterricht hatte ihn gefördert, das spürte er selbst, und frühere Lücken ausgefüllt. Zwar sind seine Briefe und Karten noch immer recht unregelmässig geschrieben: auf dem Umschlag steht in fast gemalter Zierschrift die Adresse des Herrn Burgerratsschreibers, der Brief selber aber schliesst mit den kecken Zeilen: «Zürne mir nicht wegen Sudelei und Flüchtigkeit; denn ich schreibe in ganz Blücherschem Styl, denn ich bin ein alter Soldat und die lieben's ausnehmend so.» Der alte Soldat bequemte sich immerhin, im Steigercorps den weniger auffälligen Rang des Auditors zu 80 übernehmen und an den Sonntagen nach der Predigt den Offizieren Vorträge über Kriegsgeschichte mit Betrachtungen über die Fortschritte in der Bewaffnung und Gefechtsführung der europäischen Armeen seit Anfang des 19. Jahrhunderts zu halten.
Vielleicht hatten der ländliche Frieden und der tägliche Umgang mit der trefflichen Familie in Diessbach den wilden jungen Mann doch zu einer Einkehr geführt, für die er offenbar inzwischen reif geworden war. Nicht ohne innere Bewegung lesen wir, dass schon dort und damals in ihm die dichterische Saat zu keimen begann, mit jenem Andreas Hofer-Drama, das ihn unvollendet noch jahrelang begleiten sollte, ehe es durch Ernst von Wildenbruch die fachmännisch entscheidende Kritik erfuhr. Stand es nicht im Mittelpunkt endloser Gespräche, denen sich ein Freundeskreis der letzten Schuljahre mit jener begeisterungsfähigen Unermüdlichkeit hingab, wie sie nur Gymnasiasten zu den letzten weltanschaulichen und ästhetischen Problemen hinreisst? Bei ihnen fand Rudolf von Tavel nach einem kürzeren Intermezzo im «Mutzenleist», der eine etwas altkluge Nachahmung echter Leistsitten und als Bestes ein paar gesellige Fusswanderungen und Bergbesteigungen mit sich gebracht hatte, jene geistige Atmosphäre 81 wahrer Freundschaft, die Jahrzehnte und Schicksale überdauerte und auch durch die verschiedensten Entwicklungen nie mehr ganz ausgeschaltet wurde.
Doch diesem, für die Reife des Tavelschen Charakters unermesslich wichtigen Freundschaftsbunde ging eine neue Verdunkelung des Schulhimmels voran, ein Zwischenfall, der leicht zur Katastrophe hätte werden können, wenn nicht der «unendlich geduldige» Vater noch einmal das bereits bewährte Mittel angewendet und den Sohn vorübergehend aus der städtischen Schule genommen und einem ländlichen Einpauker überlassen hätte. Das Tagebuch meldet knapp, aber vielsagend: «Im Frühling des Jahres 1884 fiel ich beim Examen ins Gymnasium durch, weshalb ich nach Rapperswil geschickt wurde zu Herrn Pfarrer Lenz.» Aber schon bald nachher hiess es: «Von Rechts wegen hätte mir der Aufenthalt im Pfarrhaus zu Rapperswil eine Strafe sein sollen, und in Wirklichkeit wurde er mir zu einer Zeit der Freuden und Wonne. Es geht eben oft so, und ich denke mir immer dabei: Der Mensch denkt und Gott lenkt.»
Offenbar war das Pfarrhaus von Rapperswil bekannt als Nothafen für Lebensschifflein, die an den Riffen und Klippen der Schule zu zerschellen drohten oder vorübergehend auf 82 einer Sandbank der Trägheit gestrandet waren. Denn der Postillon, mit dem Rudolf von Münchenbuchsee abfuhr, hatte bald erraten, dass auch er «einer von den vielen sei, die in jedem Frühjahr nach Rapperswil pilgerten, gewöhnlich zu denselben Zwecken». Aber der mit spürbaren Vorbehalten angetretene Aufenthalt erwies sich alsobald als jene Mischung von geduldiger Arbeit und ungebundenem Freiluftleben, wie sie Rudolf schätzte, und das Tagebuch seiner zweiten «Verbannung» bezeugt in mannigfachen Erlebnissen und Schilderungen, wie heimisch er sich dort fühlte. Mit den zwei Söhnen und dem zehnjährigen Töchterchen des Hauses und den andern Pensionären durchstreift er die nahe und ferne Umgebung bei jedem Wetter, ein Brand bei Wierezwil hinterlässt starken Eindruck und zeigt zum erstenmal, wie empfänglich er, der spätere Feuerwehroffizier, für Sensationen dieser Art war; der lebhafte und noch jugendliche Pfarrherr schliesst sich gelegentlich von den Spielen der Jugend nicht aus, und die Frau ist ihm «das wahre Musterbild einer Pfarrerin, sie wurde mir, mit einem Wort, zur zweiten Mutter». Bezeichnend für Rudolfs inneren Zustand dünken uns zwei Eintragungen. Bei einem Ausflug nach Frieswil geraten die jungen Wanderer in ein 83 heftiges Gewitter und sind erschrockene Zeugen eines Blitzschlages, der in den Wald bei Kallnach bricht, als sie sich eben entschlossen haben, diesen Wald nicht zu betreten, sondern der Landstrasse nach Bargen zu folgen; Rudolf glaubt an eine Mahnung Gottes, die ihnen zuteil geworden sei, und beschliesst den denkwürdigen Tag in Dankbarkeit gegen den Allmächtigen. Am Jakobstag aber, nachdem ihr Holzstoss niedergebrannt ist, liest er am späten Abend noch in den Biographien bernischer Generale. «Dabei dachte ich mir, möchte Gott mir einst Gelegenheit geben, in solcher Stellung meinem Vaterland gute Dienste zu leisten. Unmöglich ist am Ende nichts!»
Die kurzen Ferien verbrachte er zu Hause, folgte an einem Tag einer hitzigen Gefechtsübung des elften Infanterieregiments bei Worb und Wil – wir besitzen eine Federzeichnung von ihm, die eine ausführliche Schilderung im Tagebuch illustriert – und beschäftigte sich wiederum mit Plänen zu einem neuen Leist, in dem auch das Schiess- und Jagdwesen gepflegt werden sollte. Denn inzwischen hatte er auch reiten gelernt, und das Rapperswiler Tagebuch verzeichnet mehr als einmal, dass er «vor dem Gottesdienst einen Habicht gejagt» habe. Und wie er dann, nach gehöriger Vorbereitung durch seinen 84 Mentor, am 13. Oktober in Bern sein Eintrittsexamen in die Tertia bestanden hatte, ritt er zwei Tage später nach Rapperswil hinaus, um dem pfarrherrlichen Ehepaar den Bericht über das glückliche Ereignis zu bringen.
«Unsre Bekanntschaft und unsre bis zu seinem Tod andauernde Freundschaft gehen auf die Zeit zurück, wo Rudolf von Tavel im Frühling 1885, nach seiner Verbannung nach Rapperswil, in unsre Klasse eintrat», schreibt Professor Dr. med. Fritz de Quervain in einer liebevollen und scharfsinnigen Studie, die den wichtigsten Beitrag zur Darstellung der Entwicklungskrise in des Dichters Leben liefert. Da Professor de Quervain mit alt Pfarrer Hermann Rohr und Dr. Franz Thormann jenem engsten Kreise angehört, dem sich Rudolf von Tavel seit den Schul- und Studienjahren verbunden fühlte, sind uns seine Ausführungen in ihrer intimen Unmittelbarkeit des Verstehens und Abwägens von besonderm Wert. Hören wir, wie er die Schule schildert, in der sich Rudolf dem letzten Examen entgegenarbeitete, und wie sich ihm – wohl eher heute in der Rückschau als damals im Miterleben – die Wandlung vom Knaben zum Mann darstellt, in ihrer Art wohl nichts Aussergewöhnliches, aber in diesem Fall doch eine glückliche Lösung von nicht ganz 85 alltäglich gelagerten Konflikten. Prof. de Quervain schreibt:
«Die Lerberschule war im Sinne ihres Gründers vor allem ein Literargymnasium. Das hinderte aber nicht, dass – zum Leidwesen des Direktors und der Philologen – Mathematik und Physik dank der Tätigkeit von J. H. Graf sehr stark in den Vordergrund traten. Damit war für unsern Freund ein erster schwerwiegender Gegensatz zwischen Neigung und Pflicht geschaffen. Rudolf von Tavel lebte in einer ganz andern Sphäre als derjenigen der trockenen Zahlen und konnte sich mit dieser nicht befreunden. Dies hinderte übrigens nicht, dass er in der Zeit der Examennöte in Graf eine kräftige Stütze fand und das auch dankbar anerkannte. Auch in den sprachlich-geschichtlichen Fächern kam ein vor allem dichterisch und psychologisch veranlagter Schüler nicht immer auf seine Rechnung. Wenn in der Lateinstunde die deutsche Übersetzung Virgils sich dem Buche des Lehrers entwand und sich vor uns auf dem Boden ausbreitete, und wenn der Unglücksmann – Gott hab' ihn selig – gestützt auf seinen deutschen Zettel einen Ausdruck erklärte, der im lateinischen Text gar nicht stand, dann ging das Vertrauen dahin, und man konnte es uns nicht verargen, wenn wir während der 86 Unterrichtsstunde mit Freilassen von jungen Fröschen und ähnlichen Protestäusserungen unserer Missbilligung Ausdruck gaben.
Unser Griechischlehrer war ein gerader, ehrlicher Mann, und wir hüteten uns, ihn zu verletzen. Er war aber zu gelehrt. Bei den schönsten Stellen von Homer erfuhren wir nur, dass der Philologe Böckh eine andere Lesart vertrete. Dass es in Homer noch anderes gab als Lesarten, das entdeckten wir erst, wenn etwa der Deutschlehrer für ihn einsprang und mit Begeisterung in Wort und Gebärde die trojanischen Helden vor unserm geistigen Auge vorbeiziehen liess. Darum war auch die Deutschstunde der Ruhepunkt für unser Gemüt, freilich nicht ein Ruhepunkt im gewöhnlichen Sinn. Im Frag- und Antwortspiel mit dem immer beweglichen Basler – es ist kaum nötig, den vorzüglichen Daniel Huber mit Namen zu nennen – war schon die zweite Frage da, bevor ein bedächtiger Berner die Antwort auf die erste bereit hatte. "Ziehen, ziehen!" rief dann etwa Daniel Huber, um die Klasse an das Seil der Antwort zu spannen. Diesen Stunden verdankt mancher Schüler, wenn es ihm damals auch nicht zum Bewusstsein kam, etwas Wertvolles, die Beherrschung der Muttersprache. Dass die deutsche Literatur bei Huber mit Goethe abschloss, tat nichts zur 87 Sache. Die Romantiker, Heine, die damaligen Zeitgenossen Scheffel und die beiden grossen Zürcher Dichter wusste man sich zu verschaffen und erfreute sich privat an ihnen.
Mit Befriedigung sahen wir in den obersten Klassen den Lateinunterricht an Huber übergehen. Arbeiten musste man freilich, aber man tat es mit Interesse, wenn es galt, die Oden des Horaz metrisch zu übersetzen, und wenn sich dann die Gelegenheit bot, über die richtige Deutung des carpe diem zu diskutieren. Unsre Deutung entsprach, nebenbei gesagt, wahrscheinlich mehr derjenigen des Horaz als die Deutung Hubers.
Bei Huber fand von Tavel grösseres Verständnis als bei den meisten Lehrern, aber auch hier kam es gelegentlich zu Meinungsverschiedenheiten in sprachlichen Dingen. Eine aus solchem Grunde erteilte schlechte Aufsatznote empfand er als pedantisch, und sie betrübte ihn tiefer als eine Schlappe in irgendeinem andern Fache.
Dass wir vor Huber einen Deutschunterricht genossen hatten, der nicht auf der gleichen Höhe stand, das sei hier nur angedeutet. Wenn der ganze "Wilhelm Tell" von Schweizerschülern in ein Schema mit Unterabteilungen von I bis zu aa gepresst und bis zur Unkenntlichkeit zerstückelt wurde – und das noch von einem Landsmann Schillers – so wird man darüber nachträglich den Mantel der Liebe decken. Wir Schüler verfügten aber, obwohl Lerberschüler, nicht über so viel christliche Liebe und äusserten unsere Missbilligung in jeder uns zugänglichen Form. Der Religionsunterricht, der das Fundament der Schule sein sollte, lief oft auf ein Auswendiglernen von Namen und Daten hinaus, und die Könige von Juda und Israel musste man wie ein Kirchenlied können. Nicht jeder zur Religionsstunde befohlene Lehrer verfügte über den Geist des genialen Theologen Schlatter, dem dieser Unterricht während einiger Zeit übertragen war.
Hingerissen wurden wir durch den naturgeschichtlichen Unterricht des spätern Politikers und Tagblattredaktors Gottlieb Beck – freilich mit dem Hintergedanken, dass auch er sich gelegentlich durch seine Phantasie hinreissen lasse.
Auf diesem Untergrunde entwickelte sich bei Rudolf von Tavel die Krise, welche ihn während der drei Gymnasialjahre vom Knaben zum Mann führte. Auf der einen Seite stand, wie er sich selbst ausdrückte, die unbotmässige Phantasie, die ihn in den Schulstunden auf Schlachtfeldern, Bergspitzen, Ratsälen, Leiststuben herumzerrte, wobei das 89 Häuflein Energie, welches in ihm wohnte, durch das Gefecht mit einem unbändigen Stolz in Anspruch genommen worden sei. Auf der andern Seite stand die durch den strengen Vater verkörperte Familientradition, standen die Anforderungen des Schulbetriebes und das Gespenst des Maturitätsexamens. Die Familientradition war, wie ein Lehrer dem ungefügigen Schüler ehrfurchtsvoll einzuprägen versuchte, hochkonservativ und dabei streng religiös, und die Schule war, wie von Tavel selbst 50 Jahre später am 75. Gedenktage der Schulgründung hervorhob, auf die Bibel und das Kirchenlied gegründet.
Ein weniger fest in der Tradition verankerter Charakter konnte in diesem Konflikt entweder zugrunde gehen oder ganz aus der Art schlagen. Er tat weder das eine noch das andere, sondern er mauserte sich, überwand das Knabenhafte, behielt seine poetischen Ideale und begann tüchtig zu arbeiten. Freilich fragte er sich oft: Warum bin ich, was Vergnügungen und Geistesbefriedigung anbetrifft, nicht so genügsam und anspruchslos wie meine Kameraden? Die Antwort fand er im "Kennenlernen anderer Leute" und im "Begreifen seiner eigenen Lebensaufgabe". Er wurde unbewusst ruhiger und geduldiger. "Nach heftigem Kampf", sagte er, "empfand 90 ich, es sei in mir ein alter Mensch abgestorben. Ein eisernes Vertrauen auf Gottes Hilfe erfassend, ging ich mutig vorwärts."
Diese wenigen Zitate aus seinen in jenen Jahren niedergeschriebenen Erinnerungen zeigen, dass das religiöse Moment, wie es durch Familie und Schule gegeben war, der Grundton blieb. Einen Konflikt zwischen Glaube und Wissen, wie er gerade in jener Zeit beim Aufeinanderprallen einer starr dogmatischen Tradition mit voraussetzungsloser Forschung oft entstand, gab es für ihn nicht, und damit auch keine das Innere aufwühlende Problematik. Die religiöse Überzeugung war für ihn etwas Gegebenes und blieb es sein ganzes Leben hindurch, nicht als eine dogmatische Frömmigkeit, sondern als ein Christentum der Tat, das in seiner Weitherzigkeit bestes Menschentum war.
Von den Kämpfen, in denen er sich im höchsten Sinne selbst gefunden, merkten selbst wir Studienkameraden nicht viel. Er schrieb: "Wenn ich grollenden Herzens aus der Schule heimkam, so schwand gewöhnlich der Unmut bald." Auf dem Heimwege gab es noch einige Kraftausdrücke, und dann verarbeitete er das Weitere im stillen, mit sich selbst. Über den allmählich aus der Tradition in sein geistiges Besitztum übergehenden religiösen 91 Untergrund äusserte er sich nie, der blieb Privatsache. So entwickelte sich aus dem zerstreuten und unbotmässigen Schüler der bedächtige Mann der Ordnung und der Arbeit, als den wir ihn sein ganzes späteres Leben hindurch kannten, und wenn er in der ersten Hälfte seiner Schulzeit mehr egozentrisch eingestellt war, so gilt von seiner ganzen spätern Laufbahn das Gegenteil, er wurde zum ausgesprochenen Altruisten.
Er selbst hat später öfter hervorgehoben, dass ihm jene schwierigen Zeiten dadurch in besonderer Weise erleichtert worden seien, dass seine Freunde zu ihm gestanden seien. Ohne das treue Zusammenhalten unter seinen Freunden wäre es ihm schwer geworden, diese Zeiten zu überstehen.
Mehr und mehr traten in seiner Gymnasialzeit, sozusagen parallel zu seiner Krise, dichterische Pläne den knabenhaften Interessen gegenüber in den Vordergrund. Sie bildeten neben den Schulerlebnissen den Hauptgegenstand unserer Unterhaltung. Tag für Tag trafen wir auf dem Schulweg zusammen und trennten uns abends an der Kreuzung von Muristalden und Schosshaldenstrasse wieder, wenn nicht der Plan des "Andreas Hofer" Rudolf von Tavel veranlasste, im Schatten der Muriallee noch ein Stück weiterzupilgern und 92 uns seine Projekte und Entwürfe auseinanderzusetzen.
Als Ausfluss der literarischen Bedürfnisse unseres Kreises wurde eine hektographierte Klassenzeitung gegründet. Ferner wurde am Ende unserer Gymnasialzeit eine Wandermappe für literarische Beiträge der Klassengenossen angelegt, dem griechischen Namen des Gründungsmonates entsprechend als "Elaphebolion"[ἐλαφηβολιών = zweite März- und erste Aprilhälfte] bezeichnet. Die Freude am Wohlklang der griechischen Sprache und die Vorliebe unseres Griechischlehrers für diese Monatsbenennung halfen bei der Wahl des Namens mit.»
Soweit unser Gewährsmann, dessen klaren Worten wir höchstens beizufügen hätten, dass nach Tavels eigenem Zeugnis von allen Lehrern den nachhaltigsten Einfluss auf ihn der Gründer und alte Direktor der Schule, Theodor von Lerber, ausgeübt habe. Ihm hat er später in einer Biographie ein pietätvolles Denkmal errichtet.
Offen liegen nunmehr die seelischen Elemente da, mit denen Rudolf von Tavel das Fegfeuer der Schule verliess. Hatte es sie nicht geläutert und ihre Kräfte gestärkt? Hatte sich nicht auch an ihm bewährt, dass unter einem oft sehr schweren äussern Druck die Geburt des Dichters vor sich geht? Was aber ahnten 93 davon die Lehrer, ja auch die Familienglieder, die begreiflicherweise in ihm nur den Kandidaten des drohenden Maturitätsexamens sahen? Und es nahte, nahte unerbittlich und war plötzlich da.
Die letzten Wochen und Monate des Winters hatten im Zeichen übermässiger Arbeit gestanden, die Kräfte hatten abgenommen, der Blick zu den nächtlichen Sternen empor durch das schmale Giebelfenster, wenn er sich spät müde hingelegt hatte, war einziger und starker Trost. Und eines Abends fuhr die kleine Schar nach Burgdorf, wo die Lerberschule damals ihre Matura zu absolvieren pflegte. Wie ins letzte Gefecht ging es, nachdem man dem Direktor vorher noch den Fahneneid geschworen hatte, sich jeder Anwendung unerlaubter Hilfsmittel zu enthalten. Rudolf von Tavel beschrieb diese tagelange Schlacht in einem Aufsatz, dem er die aufatmende Überschrift gab:
Das Ende meines Schülerlebens
Wir quartierten uns, dem alten Gebrauch der Schule gemäss, im Gasthof zu Metzgern in Burgdorf ein. Nach dem Abendessen repetierte jeder noch etwas für sich, und dann legten wir uns zur Ruhe. Die Zimmer und die Betten waren kalt, und daher schlief man 94 noch eine Weile nicht ein. Es war ein düsterer und banger Abend. Ich malte mir noch vor, was für mich vom Gelingen der Prüfung abhing. Der Zufall wollte es, dass ich in meinem Nachttisch die Karte eines Schülers unseres Gymnasiums fand, welcher vor zwei Jahren beim Examen in Burgdorf durchgefallen war. Aber dieser kleine Zwischenfall vermochte mich nicht zu entmutigen; ich wusste, dass meine Lieben daheim und die Lehrer unser in Fürbitte gedachten. Wir Kameraden taten ein Gleiches unter uns. Wir hielten treu zusammen.
Was uns an jenem trüben Abend ärgerte, das war eine Blechmusik, die sich bis nachts 12 Uhr im untern Saale des Gasthofes abmühte, ein Potpourri zu üben. Es war wirklich geduldraubend, als diese eifrigen Trompeter unendlich viele Male hintereinander ein und dasselbe melancholische «thurututuh» hören liessen.
Am andern Morgen begannen die schriftlichen Prüfungen. Die Tage waren lang und unheimlich. Nach jeder Fachprüfung irrten wir umher, um irgendwie zu erfahren, ob die Arbeit, die wir geliefert, etwas wert war, ob wir hoffen durften. Die einen fanden die Ruhe, welche ich gewöhnlich an den Tag legte, sonderbar. Wahrscheinlich hielten sie mich 95 für gleichgültig. Andere sahen darin ein gutes Zeichen und bestärkten mich im Vertrauen. Am Ende der schriftlichen Prüfungen kehrte ich, das Herz voll guter Hoffnungen, nach Bern zurück.
Ungefähr eine Woche später fuhren wir zum zweitenmal nach Burgdorf zu den mündlichen Prüfungen. Diese waren peinlicher als die ersten, und es erging mir dabei weniger gut. In der Mathematik erlitt ich eine bedenkliche Niederlage, die mich sehr einschüchterte. Aber ich verlor die Hoffnung nicht. Es überkam mich vielmehr eine Art Galgenhumor. Abends sank der Mut wieder, nachdem ich nachgerechnet, dass nun der Entscheid des Ganzen von den Prüfungen des folgenden Morgens abhinge. Es blieben noch Physik und Geschichte zu bestehen. Ruhig und gelassen ging ich in diese letzten Gefechte. Mit dem wenigen, was mir in diesen Fächern zu Gebote stand, wehrte ich mich verzweifelt. Als ich am Mittwoch vom Gymnasium wegging, hatte ich den Eindruck, als ob es gewonnen wäre!
Beim Mittagessen hingegen gaben die Lehrer mir gegenüber schon den schlimmsten Befürchtungen Ausdruck. Aber selbst als Dr. Graf mich trösten wollte mit einem zweiten glücklicheren Examen im Herbst, gab ich die Hoffnung auf ein diesmaliges Durchschlüpfen 96 nicht auf. Als Dr. Graf fortging, um das Resultat zu erfahren, sagte er mir: «Wenn ich beim Verlassen des Gymnasiums lachen werde, dann gilt dieses Lachen Ihnen.»
Die Übrigen gingen auch weg, und bald war ich allein im Zimmer. Was ich in dieser Stunde, wo die Professoren über mein Schicksal berieten, gedacht und getan habe, das brauche ich hier nicht mitzuteilen. Schliesslich liess mir die bange Erwartung nicht länger Ruhe, ich eilte auf die Strasse, wo ich einige Kameraden fand, welche zum Gymnasium hinunter wollten, um den Entscheid zu vernehmen. Ich schloss mich ihnen an. Kaum waren wir um eine Strassenecke gebogen, als in grossen Sprüngen meine Freunde angerannt kamen. Auf einmal fiel der schwere Alp, der mich so lange gedrückt, von meinem Herzen. Er begann schon zu rutschen, als ich die Kameraden anrennen sah. Mit sausender Schnelligkeit verbreitete sich der Ruf: «Alle durch!» im ganzen Städtchen. Von allen Seiten eilten die Abiturienten herbei. Und Herr Dr. Graf, ach, er hatte sich mir zulieb unter die Türe des Gymnasiums gestellt und herzlich gelacht – und ich war nicht einmal zugegen. Es tut mir heute noch leid.

Der Schüler
Beim Rektor erfuhren wir die offizielle Mitteilung vom allgemeinen Gelingen. Die 97 Freude! Wir stürmten das Telegraphenbureau, um Eltern und Kameraden zu benachrichtigen. Unser Direktor versammelte uns um sich, um Gott mit uns zu danken. Die Worte aus den Psalmen: «Keiner wird zu Schanden, der deiner harrt» hat er mir nicht nur in mein Losungsbüchlein, sondern ins Herz geschrieben.
Das war eine glückliche Heimfahrt. Am Bahnhof empfingen uns mit stürmischer Freude die Kameraden. Wie gerne eilte ich heim! Das war ein anderes Heimkommen, als ich es seit Jahren erlebte, wenn ich von der Schulbank seufzend heimging. So war ich denn frei, ganz frei von den Schulsorgen. Der Kampf war endlich zu Ende. Nun durfte ich anders anfangen.
Aber eines lernte ich dabei wieder: dass, um frei zu werden, man sterben können muss, seinen Leidenschaften, Freuden und seinem Stolz absterben!