
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Einige Zeit war dahingegangen.
Die redselige Resi stand immer schon mit einem Sack Neuigkeiten bereit, wenn der Herr Franz mittags oder nachmittags aus seinem Amt heimkam. Sie hatte die vertrauliche Art oder Unart alter, treuer Dienstboten, alles haarklein zu berichten, was ihr durch die Hausmeisterin zugetragen wurde, die allwissender war als der liebe Gott. Während Herr Franz ablegte, oder schon an seinen Schreibtisch trat und nach den Briefen sah, stand sie noch lange zwischen der halb offenen Tür und ließ sich durch kein Zeichen der Ungeduld beirren, bis sie nicht ihr mitteilungsbedürftiges Herz ausgeschüttet hatte.
»Das wird wieder eine schöne Leich übermorgen in der Stefanskirchn,« berichtete sie, »ich freu mich schon so drauf.«
Zu den begehrtesten Genüssen Resis gehörte eine »schöne Leich«. Nie hatte sie bei einer solchen Gelegenheit unter den müßigen Zuschauern gefehlt, und wenn sie stundenlang im Schnee, im Regen oder in der Sonnenhitze stehen mußte. Große Hochzeiten gehörten zwar auch zu ihrer Spezialität, aber schon weniger.
»Es ist so eine eigene Sach mit der Hochzeit,« philosophierte sie, »die Leute freuen sich und jubeln, und hinterher kommen meistens die Enttäuschungen. Hochzeiten müßten eigentlich ganz still gefeiert werden, weil man ja doch nicht weiß, ob sich das Erhoffte auch wirklich erfüllt. Man kann doch immer erst hinterher wissen, ob man mit der Heirat das große Los zogen hat, oder obs eine Niete war. Und da treiben die Leut gerade das Verkehrteste, sie jubilieren, eh sie noch wissen, ob sie wirklich den Haupttreffer g'macht habn. Das mußt man doch erst abwarten, meinetwegen bis zur silbernen Hochzeit, oder noch besser bis zur goldenen; wenn man sich dann noch ehrlich g'freut, dann meinetwegen!«
Eine »schöne Leich« dagegen erschien ihr als ein wahres Seelenfest. Die Rechnung ist abgeschlossen, es kann keinen Irrtum mehr geben. Man weiß, woran man ist, und hat alles sicher. Auch die Feierlichkeit ist viel ergreifender. Man kann sein Gesätzlein weinen, wird dann durch die Orgel wieder wunderbar getröstet, die Trauerrede des Pfarrers ist gewöhnlich auch viel ergreifender als eine Hochzeitsrede, und vor allem kann man erbauliche Betrachtungen über die Hinfälligkeit und Misere des Daseins, über die Tugenden und Vorzüge des Abgeschiedenen und über die Aussichten auf das ewige Leben anstellen.
»Der in der Truchen liegt, hats überstanden und ist gut aufghoben. Ihm kann nix mehr geschehen, ihm gehts besser wie unsereins.«
Mit diesem Trost kehrt man heim, fühlt sich für den Alltag gestärkt und mit dem Schicksal mild versöhnt.
»Wenn ein alts Leutl stirbt, da kann man denken, daß es gnug ghabt hat vom Leben, es ist erlöst,« ging die Alte ihren eigensinnigen Gedankengang, »aber eine so junge Person! Stellen Sie sich vor, Herr Franz, eine so junge Person! Das is wohl ein bissel hart. Was der noch alles geblüht hätt im Leben! Vielleicht aber is ihr auch viel derspart blieben. Ja, weiß man's denn? Ein junges Mädchen aus reichem Haus, das schon den Himmel auf Erden hat! Aber ich denk, der Herrgott weiß schon, was er tut.«
»Nun wie heißt denn das Mädchen aus reichem Haus?« fragte Herr Franz gleichgültig und machte sich an seinen Sachen zu schaffen.
»Je sehens, Herr Franz, den Namen hat s' mir gsagt, aber vergessen hab ich ihn, mein Gedächtnis laßt mich halt schon im Stich!«
»Wer hat's Ihnen gsagt?« Der Dichter drängte schon auf den Abschluß des Gewäsches.
»Die Frau Butterstößel hat's unserer Hausmeisterin erzählt, die weiß es genau.«
»Diese Markt-Tratschen,« schnitt Herr Franz ungeduldig ab. »Dann wird das junge Fräulein aus reichem Haus wahrscheinlich ein altes Weib aus dem Versorgungshaus sein. Lassens Ihnen nicht so anplauschen von diesen Leuten, Resi!«
»Aber Herr Franz, die Frau Kanzleidirektorsubstitutenwitwe Butterstößel ist doch keine Markt-Tratschen, das is eine feine Frau, die in dem reichen Haus verkehrt!«
Der Dichter antwortete nicht; kopfschüttelnd und unwillig schloß Resi die Tür, als sie sah, daß die Audienz zu Ende war.
Es war ein Brief da, die Tante Sonnleithner machte ihm freundliche Vorwürfe, daß er sich so wenig blicken ließ; er beschloß, sie an diesem Abend zu besuchen. Zu den Fröhlichs wollte er heute nicht kommen und auch die folgenden Tage nicht. Er hatte gestern wieder einen kleinen Zank mit Kathi gehabt, zwar um ein lächerliches Nichts, um nichts weniger, als um die Vorzüge und Mängel einer neuen Sängerin am Kärnthnertor-Theater. Franz fand sie gut, Kathi erklärte sie für unzulänglich. Die anderen verhielten sich ziemlich gleichgültig zur Frage, und machten wie gewöhnlich den Schiedsrichter. Aber die Parteien ließen nicht einen I-Punkt von ihrer Meinung nach und verhärteten sich in ihrem Eigensinn. Sie trotzte, jetzt trotzte er. Er würde nicht früher kommen, bis sie nicht zugab, daß sein Urteil richtig war.
Trotzdem langweilte er sich bei der Tante Sonnleithner und war in Gedanken immer bei den Fröhlichs. Jetzt könnte man singen und Klavier spielen und guter Dinge sein, anstatt hier zu sitzen und langweilige Dinge anzuhören, die einen schließlich gar nichts angehen. Seine Gedanken kreisten immer um die eine Achse: Warum muß man sich so im eigenen Licht stehen? Es könnte alles so schön sein! Mit ein bißchen Nachgeben war aller Streit für immer geschlichtet. Ja, zum Teufel, warum gibt sie denn nicht nach! Jetzt grad nicht!
Er war froh, daß der totgeschlagene Abend herum war, und daß er mit seinen selbstquälerischen Gedanken allein sein konnte. Beim Abschied sagte noch die Tante Sonnleithner: »Du weißt doch, daß die arme Marie von Piquot plötzlich gestorben ist. Übermorgen ist das Leichenbegängnis. Die armen Eltern!«
Er horchte gleichgültig hin wie auf etwas Selbstverständliches und Alltägliches, wunderte sich zwar im stillen ein wenig, daß es gar keinen Eindruck auf ihn mache und hatte es schon auf dem Heimweg wieder vergessen.
Aber schon am anderen Tag begegneten ihm zufällig der Vater und der Bruder der so früh Verstorbenen. Das war ihm unangenehm. Er hatte seit längerer Zeit das Haus nicht mehr besucht, war zwar hie und da noch eingeladen worden, hatte immer unter einem Vorwande abgelehnt, und seit seinem Verhältnis zu Kathi war der Verkehr gänzlich eingestellt. Das war ja so weit in Ordnung, trotzdem konnte er sich jetzt eines unsicheren Gefühls nicht erwehren. Er wollte sie nicht anreden, sondern nur grüßend vorübergehen, war aber nicht wenig betreten, als der Bruder zur Seite sah, und der Vater ihm einen halb vorwurfsvollen, halb ergrimmten Blick zuwarf.
Am folgenden Tag saß er schon in der Stefanskirche und wartete auf den Leichenzug. Das Gotteshaus war kühl und dämmerig; wie ein großes treues Weltherz war es von süßer Andacht, von phantasiereichen Träumen und frommen Schöpfergedanken erfüllt. Die Tiere des Waldes sprangen steingeworden in den gemeißelten Hohlkehlen, spukhafte Fabelwesen krümmten sich um die Sockel der Säulen, und die Kapitale hoch an den Wölbungen waren steinbelaubt von den Blumen und Blättern des Wienerwaldes. Die Vöglein saßen lobpreisend in dem Geranke, über das sich wie ein Himmelsdach die mächtige Decke spannte. Die Kerzen flimmerten am Altar wie ein Sternenreigen, die Kränze atmeten einen betäubenden Duft, der silberne Sarg mit blauen Schleifen schwankte vorüber wie ein heiliger Schrein, ein schwarzes Gewoge drängte nach und erfüllte den Dom mit Trauer und halb ersticktem Schluchzen.
Vom Chor, unter dem er saß, stieg mit klarer Schönheit eine Kantilene auf. Franz erkannte die Stimme sofort, es war die der Bognerin, die den Kirchengesang pflegte und sich jeden Sonntag zum Hochamt hören ließ. Nun mußten die Stimmen der anderen Schwestern kommen. Die jetzt einsetzte, war Pepi. Dann kam Netty und zum Schluß Kathi. Deutlich unterschied er die Schwestern an dem Klang, die nun zu Ehren ihrer gewesenen Schülerin auf dem Chor sangen, himmlisch schön, daß es in linden Wogen herabströmte, wie die Stimmen der Seligen aus jenseitigen Gefilden. Da breitete auch die Orgel ihren dunklen schweren Glanz aus, aber sie sprach nicht mit Donnergewalt, die wie Gottes Zorn in die erbebenden Herzen fährt, sondern wie die gütige, verheißende und tröstende Stimme eines allmächtigen Vaters.
Franz hatte sehr aufmerksam auf alle äußeren Vorgänge geachtet, wobei ihm besonders ein alter Diener des Hauses Piquot auffiel, der gewöhnlich unwirsch und grob gewesen, jetzt aber ganz in Tränen und Schmerz aufgelöst war über den Tod des schönen jungen Fräuleins und sich hinter dem Sarg kaum einherschleppen konnte. Das gab dem Dichter, der stark zur Selbstbeobachtung und Selbstzerfaserung neigte, wieder Anlaß, über sich nachzudenken. Es verdroß ihn, daß er bei all diesen ergreifenden Vorgängen nicht eigentlich Rührung oder Schmerz empfinden, sondern fast nur ein gegenständliches Interesse aufbringen konnte, als ob der ganze Anlaß für ihn nur zum Zweck eines poetischen Studiums vorhanden wäre, das sich später einmal irgendwie als bedeutsam erweisen dürfte. Er ärgerte sich ein wenig über sich, schickte dann zum Trost seine Gedanken zu jenen auf dem Chor hinauf, die ihm so nahe standen und jetzt so fern dünkten. Aber er war nicht gesonnen, den Trotz aufzugeben, und fühlte sich nun erst im Recht, weil ihm noch immer kein Liebeszeichen zugekommen war.
Die Sehnsucht wuchs gewaltig in seinem Herzen und in dieser Bedrängnis nahm er den begonnenen Entwurf seiner »Hero und Leander« hervor und umwob die Priesterin, die Kathis Züge trug, mit glühenden Versen. Nie sprudelte der dichterische Quell so stark als jetzt in dieser Zeit der Zerrissenheit, der Unruhe und der Sorge. Pläne über Pläne, und mit dem Gedanken stoßweise auch schon die Ausführung. Ein neues vaterländisches Stück »Ottokars Glück und Ende« wuchs schnell unter der Hand; »Hero und Leander« reifte indessen langsam, eine volle süße Traube aus dem Garten der Liebe. Und dazu die Angst vor den Störungen und Aufregungen, die sich häuften, und die Furcht, daß der Strom so unerwartet schnell versiegen könne, als er hervorgebrochen war.
Aber das Schicksal ersparte ihm keine Prüfung. Da kam schon eine dringende, ja eigentlich flehentliche Aufforderung der Frau von Piquot, sie zu besuchen. Trotz seines heftigen Widerstrebens konnte er nicht ausweichen. Da sitzt er nun ungeduldig und unduldsam auf dem Sofa neben der schwarzgekleideten Dame, die ihm unter reichlich vergossenen Tränen die Leidensgeschichte ihrer Tochter erzählt. Ein Testament habe sich vorgefunden, darin die Verewigte ihres Tasso freundlich gedenkt und bittet, ihm sein Bildnis zu übergeben, das sie eigenhändig aus dem Gedächtnis gemalt habe.
Franz erblickt es und erkennt sein eigenes, nicht übel getroffenes Porträt. Er ist in Verlegenheit, weil er sich den ganzen Hergang nicht erklären kann und ruft mit geheucheltem Bedauern aus: »Hätt' sie mir doch ein Bildnis von ihr hinterlassen!«
»Auch das hat sie getan, ich soll es Ihnen übergeben, wenn Sie es ausdrücklich von selbst begehren.«
Dabei kommt zutage, daß das Mädchen eine stille aber unverlöschliche Liebe zu ihm gehegt und von dem Zeitpunkt an, als er sich mit Kathi verlobte, alle Lebenshoffnung verloren habe. Sie hatte von ihrem nahen Tode geträumt, davon ihrer Umgebung erzählt, die dem blühenden Mädchen den unseligen Gedanken lachend ausredeten. Sie wurde krank, träumte wieder diesen Traum, erholte sich, wurde wieder krank und verschied plötzlich. Aber sie war bis an ihr Ende, das sie ganz genau gewußt hatte, heiter und guter Dinge gewesen und schien mit der Hoffnung auf eine spätere Seligkeit beglückt.
Der Dichter stürzt aus einer Verlegenheit in die andere, der erzählte Hergang, der ihm gewissermaßen eine Gewissensschuld an dem Tode des Mädchens auflädt, berührt ihn eher peinlich als ergreifend. Er würde viel opfern für eine Träne, für ein Zeichen aufrichtigen Schmerzes. Aber es ist, als ob jedes Gefühl in ihm erstorben wäre. Schließlich ist er froh, daß die Unterredung ein Ende hat und etwas eilig nimmt er Abschied, eiliger, als es unter solchen Umständen schicklich gewesen wäre. Er hat die Empfindung, als ob er eine ganz fremde Geschichte hätte anhören und Teilnahme heucheln müssen, die er nicht aufzubringen imstande war.
Noch am selben Abend geht er ins Theater, um wieder die Sängerin zu hören und sich nochmals zu überzeugen, daß er gegen Kathi im Recht ist. Jetzt findet er, daß sie in noch viel größerem Grade mangelhaft und unzulänglich ist, als selbst Kathi es behauptet hatte. Der Zustand in diesen Tagen ist ihm unerträglich geworden, und er kann die Stunde nicht erwarten, wo er seinen Bußgang antreten wird.
Die Ereignisse der letzten Tage sind im Hause Fröhlich nicht ohne Eindruck vorübergegangen und haben eine von Trauer und Mitgefühl bewegte Stimmung erzeugt. Dabei gab es auch viel zu tun, so daß die eigenen kleinen Schmerzen ein wenig in den Hintergrund gedrängt wurden. Trotzdem befand sich Kathi in keiner guten Haut, sie litt schwer unter der Pein und hätte längst geschrieben, wenn nicht die zwingenden äußeren Umstände hemmend dazwischen getreten wären. Jetzt aber war schon alle Fassung dahin. Eben wollte sie sich hinsetzen und einen Zettel mit zürnend liebevollen Worten bekritzeln, da kam der Langentbehrte zur Tür herein, ein unsicheres, etwas verlegenes Lächeln auf dem Gesicht.
Statt allen Grußes rief er sofort: »Du hast recht, die Sängerin heißt wirklich nichts!«
Kathi wollte bei seinem Anblick schon die Oberlippe trotzig aufwerfen, indem ihre Hand den Zettel verbarg und zerknüllte, aber seine nachgiebigen Worte hatten in diesem Augenblick ihren Widerstand gebrochen.
Jetzt flog sie ihm an den Hals, tätschelte ihm sanft auf die Wange und wollte auch ihrerseits die eigene schroffe Meinung zurücknehmen, indem sie sagte: »Na, na, so schlecht ist sie aber auch nicht, wie du glaubst!«
»Himmel!« nun wurde er ernstlich wild. »Sag ich weiß, sagt sie schwarz, sag ich schwarz, sagt sie weiß! Man kann ihr's halt nöt recht machen!«
Fast schien es, als ob der Augenblick der Versöhnung sich mit einem neuen Mißverständnis umwölken würde. Aber da griffen schon tapfer die Schwestern ein, um die Liebenden gegenseitig aufzuklären, die es so schwer miteinander hatten.
Natürlich kam man alsbald auf den Tod der armen Piquot zu sprechen. Die Schwestern, besonders aber Kathi, waren noch ganz wund und wehe von Trauer und Mitgefühl, als ob ihnen die liebste Freundin oder gar eine nächste teure Verwandte entrissen worden wäre. Sie überboten sich in Lobpreisungen der Verstorbenen.
»Jammerschad um das große Talent, das mit ihr verloren gegangen ist,« klagte die Netty.
»Und der schöne aufrichtige Charakter,« beeilte sich Pepi zu sagen.
»Und das hübsche Gsichtl,« rühmte die Kathi.
Darauf Grillparzer: »Hübsch? Na, gerade hübsch hab ich sie nie finden können.«
Worauf Kathi sich schon in Positur warf. »Was? War sie vielleicht nicht hübsch? Diese herrliche Figur!«
»Figur? Na, ja, meinetwegen!« brummte Franz. »Ich laß ja alles gelten, aber ein geziertes, geschraubtes Wesen haben beide gehabt, die Mutter und die Tochter, das hat mir nicht gepaßt. Ich bin darum schon seit langer Zeit nicht mehr hingegangen, trotzdem sie mich öfters eingeladen haben.« Er verschwieg dabei den letzten Besuch, den er notgedrungen bei Frau von Piquot gemacht hatte und die Enthüllungen, die ihm bei dieser Gelegenheit geworden waren.
Kathi aber bestritt es und behauptete fest und steif, der Dichter müsse zu schwarz gesehen haben, vielleicht war er damals nicht bei Laune und trüge der Armen etwas nach, woran diese gar nicht schuld wäre. Sie dichtete zu den schon gerühmten Tugenden, die genügt hätten, einen Engel aus der Piquot zu machen, noch neue hinzu und hatte ganz vergessen, daß sie erst vor ganz kurzer Zeit das Gegenteil behauptet hatte. So sehr war sie vom Augenblick beherrscht.
»Weiberlogik! Weiberlogik! Zur Verzweiflung könnts einem bringen!« So erging sich der Dichter händeringend in drolliger Wehklage. Er erzählte sodann seine Eindrücke in der Kirche, wie er unter dem Chor gesessen und den Stimmen der Schwestern gelauscht habe, die wie in einer schwebenden Wolke hoch über seinem Haupt erklungen waren. Dann beschrieb er haarklein die stimmungsvollen Einzelheiten: die flimmernden Lichter, die schwer atmenden Blumenlasten, das Vorüberschwanken des silbernen Sarges, das Zusammenbrechen des alten groben Dieners, die wunderlichen Phantastereien, die er an der Steinmetzkunst des Domes entdeckt habe, und die viel zu wenig beachtet würden; wie es ihm aber gar nicht möglich gewesen wäre, einen inneren Anteil an der Trauerfeierlichkeit zu nehmen, oder gar Rührung oder Schmerz zu empfinden. Eher habe er sich gefürchtet, daß ihm die Tote in der Nacht als Gespenst erscheinen könne; diese Furcht habe er noch von der »Ahnfrau« her.
»Nein, wie herzlos!« entsetzte sich Kathi. »Dieser Mensch ist ja ein Ungeheuer! Geh weg, ich fürcht mich vor dir!«
»Was? Ich? Ungeheuer? Herzlos?« zeterte wieder Franz mit anscheinender Lustigkeit, aber doch ein bißchen pikiert im Gefühle seiner gekränkten Eitelkeit. »Ich, herzlos! Und das sagt sie! Netty, Pepi, gehts her da! Dieser Fratz nennt mich herzlos. Justament dieser Fratz! Mich, dessen größter Fehler ist, zuviel Herz zu haben, besonders mit einer gewissen Mamsell Katharina Fröhlich! Ist's nicht so?«
»Freilich ist's so,« riefen zwei Stimmen.
»Nöt wahr ist's!« schmetterte hell die dritte Stimme in dem Allegretto. »Ein Egoist ist er! Ein Gefühlsegoist!«
Eine plötzliche Pause entstand. Auch der gescheiteste Mensch wußte jetzt nichts darauf zu sagen, besonders wenn er Dichter war. Denn er mochte empfinden, daß etwas Wahres daran ist. Ein ahnungsloser Mund hatte eine tiefe Wahrheit im Scherz ausgesprochen. Franz biß sich auf die Zunge und schwieg. Jetzt war an ihm die Reihe zu schmollen.
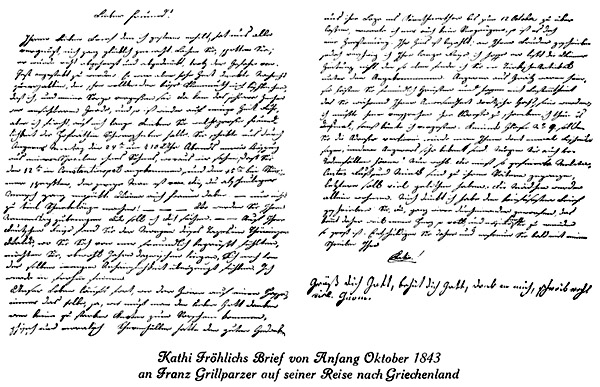
Aber das ließ sie nicht aufkommen. Sie lachte ihm die Gekränktheit, die sich wie ein giftiger Pilz auf die gute Laune legte, mit heiterer Unbekümmertheit weg und rief: »Wär schon recht, wenn sie dir als Ahnfrau erscheinen und dir dein Sündenregister vorhalten würde. Das wär dir ganz gesund.«
»Nur das nicht!« Abwehrend hielt der Dichter die Hände vor sich hin, wie um einen Geist zu beschwören. »Die Toten sollen ruhen!« –
Der Zufall wollte es, daß einige Zeit darauf Schubert eine neue Liederkomposition brachte, die auf die Verse von Claudius gestellt waren »Der Tod und das Mädchen«, und von Josefine, die der Tondichter am Klavier begleitete, mit großer Kraft und Innigkeit gesungen wurden. War es Zufall?
In zwei Sätzen bewegte sich das Lied wie ein kleines Drama, das wilde Angst und Verzweiflung, das Nahen des Fürchterlichen und Unabwendbaren, und zugleich die Umkehrung, die schmerzstillende Macht der Erlösung enthielt, die den Tod als sanften Freund erscheinen läßt. Jede Note fiel als schwerer Tropfen aus dem Becher der Gnade lindernd in den Aufruhr der Seele und verwandelte alles Weh in leidentrückte Seligkeit. Die schöne dunkle Stimme entfaltete den Flor der Trauer, die zugleich Trost war.
Vorüber! Ach vorüber! Geh, wilder Knochenmann!
Ich bin noch jung, geh lieber!
Und rühre mich nicht an,
Und rühre mich nicht an!
Gib deine Hand, du schön und zart Gebild!
Bin Freund und komme nicht zu strafen.
Sei guten Muts! Ich bin nicht wild,
Sollst sanft in meinen Armen schlafen!
Während Josefine sang, wähnte Franz Grillparzer sich plötzlich wieder in die Stefanskirche versetzt, wo er damals unter den schwarz wehenden Tüchern aus dem Staub und der Hitze des von der Sonne geblendeten Alltags in das dunkle, dämmernde Haus der ewigen, zu Gott erhobenen Gedanken einging. Jede Einzelheit stand nun in seiner Erinnerung wieder klar auf, als ob sie sich eben jetzt zum erstenmal begeben würde. Und doch war es ganz anders. Die Härte war nun von der Seele abgefallen und die Verstocktheit des Herzens gelöst. In wilden Wogen drängte der Schmerz hervor, der damals, ohne daß er es ahnte, in seinem Inneren gefesselt lag. Es war, als ob ihm Marie als liebliche Ahnfrau erschienen und mit zarten Geisterfingern den Fels seiner Brust berührt hätte, aus dem befreit der Strom von Tränen hervorbrach. Jetzt erst konnte er um die arme Piquot weinen. Er saß im Nebenzimmer auf dem Sofa und klagte sich in bitteren Selbstvorwürfen als den Zerstörer dieses jungen Lebens an. Daß es doch immer sein trauriges Schicksal sein mußte, das Unglück über jene zu bringen, die ihn am meisten liebten! Aber das Bild der Betrauerten floß alsbald in die Erscheinung einer anderen über, die er enger mit seinem Dasein verflochten hatte, und er wußte nicht, über wen er mehr weinte, über die Piquot, oder über Kathi.
Sie war es, die nun wirklich vor ihm stand und über seinen stummen Schmerz selbst in Tränen ausbrach, obschon sie nicht wußte, warum sie weinte. Sie legte ihre Wange sanft an seine Wange und vereinte ihre Tränen mit seinen Tränen. So genossen sie ihr Glück.