
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wenn man Morgenempfänge, von der Regierung veranstaltete Festlichkeiten und Bälle der Handelskreise nicht beachtet, sondern geradeaus seinen Weg wandelt, so wird man – weit hinaus über alles und jedes, was man jemals in seinem respektablen Leben erfahren hat, – sehr bald an die Grenzlinie kommen, wo der letzte Tropfen »weißen Blutes« endet, und der volle Strahl des »schwarzen« einsetzt. Es wäre leichter, mit einer neugebackenen Herzogin über Vorfahren zu sprechen, als mit diesen Grenzbewohnern, ohne eine ihrer Eigentümlichkeiten zu beleidigen oder ihre Gefühle zu verletzen. Weiß und schwarz vermischt sich in ihren Sitten in ganz eigentümlicher Weise. Zuweilen zeigt sich das Weiß in Spuren hitzigen, kindischen Stolzes – was verkrüppelter Rassenstolz ist –, und manchmal tritt das Schwarz in noch heftigerer Erniedrigung und Demütigung, halb heidnischen Gewohnheiten und seltsamen, unberechenbaren Neigungen zum Verbrechen hervor. Eines Tages wird dieses Volk – man bemerke wohl, daß sie tiefer stehen als die Klasse der Derozio, der Byron kopierte, entstammte – einen Schriftsteller oder Dichter hervorbringen, und dann werden wir erfahren, wie sie leben, denken und fühlen. Bis dahin können keinerlei Geschichten über sie – weder in Thatsachen noch in Schlußfolgerungen – absolut richtig sein.
Miß Vezzis kam von der Grenzlinie, um die Erziehung der Kinder einer Dame zu übernehmen, bis dieselben einer regelrechten Bonne anvertraut wurden. Die Dame sagte, Miß Vezzis wäre eine schlechte, schmutzige und unaufmerksame Bonne. Es fiel ihr nicht ein, daß Miß Vezzis ihr eigenes Leben zu leiten und für ihre eigenen Angelegenheiten zu sorgen hatte, und daß diese Angelegenheiten für Miß Vezzis das Wichtigste auf der Welt waren. Sehr wenige »Madames« lassen solche Gründe gelten. Miß Vezzis war so schwarz wie ein Stiefel und nach unserm Geschmack schrecklich häßlich. Sie trug bedruckte Kattunkleider und zerrissene Schuhe. Und wenn ihr bei den Kindern die Geduld riß, dann schimpfte sie sie in der Grenzsprache aus, die zum Teil englisch, zum Teil portugiesisch und zum Teil der Dialekt der Eingeborenen ist. Sie war nicht anziehend, doch sie hatte ihren Stolz und hielt darauf, Miß Vezzis genannt zu werden.
Jeden Sonntag putzte sie sich auf das prächtigste heraus, um ihre Mama zu besuchen, die fast fortwährend auf einem alten Rohrstuhl in einem fettigen Tussur-Seidenkleid in einem großen Kaninchengehege von Haus lebte, in welchem es von Vezzis, Pereiras, Bibieras, Lisboas, Gonsalvez und einer ungeheuren Bevölkerung von Landstreichern wimmelte; außerdem erblickte man hier noch Reste von dem täglichen Markt, Knoblauch, Weihrauch, alte Kleider, die an der Erde lagen, Unterröcke, die an Schirmständern hingen, alte Flaschen, Kruzifixe aus Zinn, vertrocknete Immortellenkränze, Pariahunde, Gipsmodelle der Jungfrau Maria und Hüte ohne Krempen. Miß Vezzis bezog für ihre Thätigkeit als Bonne 20 Rupien monatlich, und zankte sich jede Woche mit ihrer Mama wegen des Prozentsatzes, den sie ihr zur Bestreitung des Haushaltes abliefern sollte. Wenn der Zank vorüber war, pflegte Michele D'Cruze über die niedrige Lehmmauer des Hauses zu klettern und Miß Vezzis nach der Manier der Grenzlinie die Cour zu schneiden, was mit vielen Zeremonien verknüpft ist. Michele war ein armer, kränklicher Mensch und dabei tiefschwarz, aber er hatte seinen Stolz. Um keinen Preis der Welt würde er sich haben sehen lassen, wenn er eine »Huqa« rauchte; und er sah auf die Eingeborenen herab, wie es nur ein Mann thun kann, der zu ⅞ Eingeborenen-Blut in den Adern hat. Auch die Familie Vezzis hatte ihren Stolz. Sie leiteten ihre Abstammung von einem mythischen Schienenleger ab, der auf der Sone-Brücke gearbeitet hatte, als die Eisenbahnen in Indien noch neu waren, und schätzten ihren englischen Ursprung sehr hoch ein. Michele war Telegraphenwächter mit 35 Rupien monatlich. Die Thatsache, daß er in Diensten der Regierung stand, stimmte Mistreß Vezzis gegen den Mangel seiner Ahnen nachsichtig.
Es war nämlich eine kompromittierende Legende im Umlauf – der Schneider Dom Anna hatte sie von Poonani mitgebracht – daß ein schwarzer Jude von Cochin einmal in die D'Cruze Familie hineingeheiratet hatte; ferner war es ein offenes Geheimnis, daß ein Onkel der Mistreß D'Cruze zur selben Zeit in einem Club in Südindien häusliche Arbeiten, das Kochen mit eingerechnet, verrichtet hatte. Er schickte Mistreß D'Cruze jeden Monat sieben Rupien und 8 Annas; doch sie empfand die der Familie angethane Schmach trotzdem sehr schmerzlich.
Dennoch gewann es Mistreß Vezzis nach einigen Sonntagen über sich, diesen Makel zu übersehen, und so gab sie denn ihre Einwilligung zur Verheiratung ihrer Tochter mit Michele unter der Bedingung, daß dieser mindestens 50 Rupien monatlich haben sollte, wenn er ins eheliche Leben trat. Diese wunderbare Klugheit mußte wohl von dem Blut des mythischen Schienenlegers aus Yorkshire zurückgeblieben sein, denn die Leute von der Grenzlinie setzen sonst ihren Stolz darein, sich zu verheiraten, wenn sie wollen, nicht aber, wenn sie können.
Hinsichtlich seiner Stellung als Beamter hätte Miß Vezzis ebenso gut verlangen können, Michele sollte weggehen und mit dem Monde in der Tasche zurückkommen. Doch Michele war sterblich in Miß Vezzis verliebt und das verlieh ihm Zähigkeit. Er begleitete Miß Vezzis Sonntags zur Messe, und nach der Messe, wenn er durch den heißen Staub mit ihr Hand in Hand nach Hause ging, schwor er bei mehreren Heiligen, deren Namen den Leser nicht interessieren würden, Miß Vezzis nie zu vergessen; sie dagegen schwor bei ihrer Ehre und den Heiligen – der Eid lautete sehr merkwürdig: In nomine Sanctissimae (hier folgte nun der Name der Heiligen) und so fort, – Michele nie zu vergessen, was stets mit einem Kuß auf die Stirn, einem Kuß auf die linke Wange und einem Kuß auf den Mund besiegelt wurde.
In der nächsten Woche wurde Michele versetzt, und Miß Vezzis vergoß an dem Fenster des Coupees bittere Thränen, als er die Station verließ.
Wenn man die Telegraphenkarte von Indien betrachtet, so wird man eine lange Linie bemerken, die die Küste von Backergange bis Madras einschließt. Michele war nach Tibasu beordert, einem kleinen Nebenamte, das etwa ein Drittel unter dieser Linie liegt, um Nachrichten von Berhampor nach Chicacola zu senden, und außerhalb seiner Amtsstunden an Miß Vezzis und seine Aussichten, 50 Rupien im Monat zu verdienen, zu denken. Er hatte das Toben des bengalischen Meerbusens und einen bengalischen »Babu« zur Gesellschaft, sonst nichts weiter. Er schickte verrückte Briefe mit Kreuzen auf den Couvertklappen an Miß Vezzis.
Als er fast drei Wochen in Tibasu gewesen war, stellte sich das ersehnte Glück ein.
Man vergesse nicht, daß nur, wenn die äußeren sichtbaren Zeichen unserer Autorität dem Eingeborenen stets vor Augen stehen, dieser im stande ist, zu begreifen, was Autorität überhaupt heißt, oder worin die Gefahr besteht, ihr nicht zu gehorchen. Tibarsu war ein weltvergessener kleiner Ort mit wenigen Orissa-Mohammedanern. Da diese von dem »Steuereinnehmer-Sahib« einige Zeit nichts hörten, und den »Hindu-Unterrichter« von Herzen verabscheuten, so veranstalteten sie auf eigene Faust einen kleinen »Mohurum-Aufstand«. Doch die Hindus wandten sich gegen sie, und zerschlugen ihnen die Köpfe; da sie aber die Gesetzlosigkeit amüsant fanden, so erregten auch sie mit den Mohammedanern eine zwecklose Empörung, um nur zu sehen, wie weit sie gehen konnten. Sie raubten sich gegenseitig die Läden aus, und erledigten ihre Privatzwistigkeiten in der üblichen Weise. Es war ein häßlicher, kleiner Aufstand, der aber nicht wert war, in den Zeitungen erwähnt zu werden. Michele arbeitete gerade in seinem Bureau, als er den Schrei vernahm, den ein Mensch in seinem Leben nie vergißt, das »Ah-yah« einer erregten Menge. (Wenn dieser Laut drei Töne umfaßt und sich in ein dickes, dröhnendes »Ut« verwandelt, so thut der Mann, der es hört, besser, sich, wenn er allein ist, davon zu machen.) Der eingeborene Polizeiinspektor kam herbeigestürzt und sagte Michele, die Stadt wäre in Aufruhr, und man würde das Telegraphenbureau zerstören. Der »Babu« setzte seine Mütze auf und sprang ruhig aus dem Fenster; dagegen sagte der Polizeiinspektor, der sich zwar fürchtete, aber doch dem alten Rasseninstinkt gehorchte, der einen Tropfen weißen Blutes erkennt, so verdünnt dasselbe auch sein mag:
»Was befiehlt der Sahib?«
Dieses Wort »Sahib« übte auf Michele eine bestimmende Wirkung aus. Obwohl er schrecklich ängstlich war, so fühlte er doch, daß er, der Mann mit dem Juden aus Cochin und dem häusliche Arbeiten verrichtenden Onkel in seiner Verwandtschaft, der einzige Vertreter der englischen Autorität am Platze war. Dann dachte er an Miß Vezzis und die 50 Rupien und nahm die Situation auf sich. Es befanden sich in Tibasu 7 eingeborene Polizisten, die vier altersschwache, glattläufige Musketen besaßen. Alle waren leichenblaß vor Angst, ließen sich aber doch leiten. Michele zog den Schlüssel des Telegraphenapparates ab und trat an der Spitze seiner Armee dem Pöbel entgegen. Als die brüllende Menge um die Straßenecke bog, blieb er stehen und gab Feuer, und die Männer hinter ihm knallten instinktiv zu gleicher Zeit los.
Die ganze Schar drehte sich um, schrie auf und rannte davon. Einen Mann ließen sie tot zurück, während ein anderer sterbend auf der Straße lag. Michele schwitzte vor Furcht, doch er bemeisterte seine Schwäche und zog nach, der Stadt hinunter an dem Hause vorüber, wo der »Unterrichter« sich verbarrikadiert hatte. Die Straßen waren leer. Tibasu war noch erschrockener als Michele, denn der Mob war noch zur rechten Zeit eingeschüchtert worden.
Michele kehrte nach dem Telegraphenbureau zurück und schickte eine Depesche nach Chicacola ab, in der er um Hilfe bat. Bevor eine Antwort eintraf, empfing er eine Deputation der Aeltesten von Tibasu, die ihm erklärte, der Unterrichter hätte ihnen gesagt, seine Handlungsweise wäre im allgemeinen »unkonstitutionell« und ihn einzuschüchtern versuchten. Doch Michele D'Cruzes Herz schlug stark und weiß in seiner Brust, sowohl aus Liebe zu Miß Vezzis, dem Kindermädchen, als auch aus dem Grunde, daß er zum erstenmal Verantwortlichkeit und Erfolg kennen lernte. Diese beiden Gefühle wirken wie ein berauschender Trunk und haben mehr Leute zu Grunde gerichtet, als es der Whisky je gethan. Michele erwiderte, der Unterrichter könne sagen, was er wolle, doch bis der Assistent des Steuereinnehmers käme, wäre der Telegraphist die indische Regierung in Tibasu, und die Aeltesten der Stadt würden für weiteren Aufruhr haftbar gemacht werden. Darauf neigten sie die Häupter und sagten: »Sei barmherzig« oder etwas ähnliches und gingen in großer Furcht von dannen, indem jeder den andern anklagte, den Aufruhr begonnen zu haben.
Frühzeitig in der Morgendämmerung ging Michele, nachdem er mit seinen 7 Polizisten eine Nachtpatrouille abgehalten, mit der Muskete in der Hand, die Landstraße hinunter dem Assistenten entgegen, der herangeritten kam, um Tibasu zur Ruhe zu bringen. Doch in Gegenwart dieses jungen Engländers fühlte Michele, daß er mehr und mehr sich wieder zum Eingeborenen zurückverwandelte, und die Erzählung von dem Aufruhr in Tibasu endete, so sehr der Sprecher sich auch dagegen stemmte, in einem hysterischen Weinkrampf; er war tief bekümmert, daß er einen Menschen getötet hatte, schämte sich, daß er sich nicht so frei fühlen konnte, wie er sich die ganze Nacht gefühlt, und empfand einen kindischen Aerger, daß seine Zunge seinen großen Thaten nicht Gerechtigkeit widerfahren lassen konnte. Ohne daß er es wußte, war der Tropfen weißen Blutes uns Micheles Adern verschwunden.
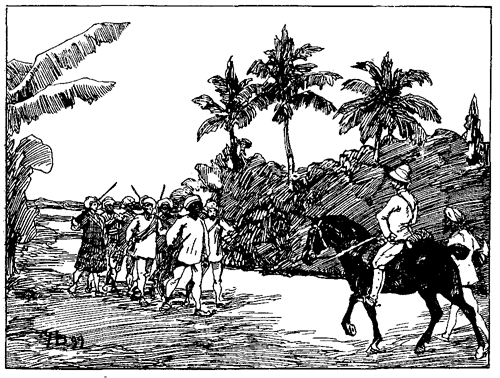
Doch der Engländer verstand ihn, und nachdem er die Leute aus Tibasu gemaßregelt und mit dem Unterrichter konferiert hatte, bis dieser vortreffliche Beamte grün wurde, fand er Zeit, einen amtlichen Bericht aufzusetzen, in welchem er Micheles Verhalten schilderte. Dieser Brief machte die üblichen Instanzen durch, und bewirkte die nochmalige Versetzung Micheles mit dem kaiserlichen Gehalt von 66 Rupien monatlich.
So verheiratete er sich mit Miß Vezzis unter großem Gepränge und Feierlichkeiten, und jetzt springen mehrere kleine D'Cruzes auf der Veranda des Zentral-Telegraphenbureaus herum.
Doch wenn das ganze Einkommen des Departements, in dem er dient, ihm zufallen sollte, so könnte Michele doch nie, nie wieder erzählen, was er damals in Tibasu für Miß Vezzis, das Kindermädchen, gethan.
Das beweist, daß, wenn ein Mann eine gute That ausübt, die in keinem Verhältnis zu seinem Gehalt steht, in sieben von neun Malen ein Weib dahinter steckt.
Die zwei Ausnahmen müssen wohl am Sonnenstich gelitten haben.
´