
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
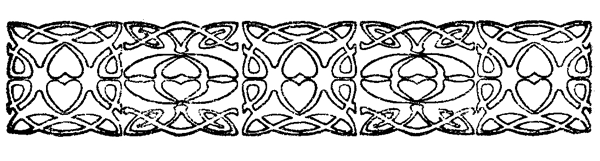
Nur so lange Bodo noch innerhalb des Hofes war, trabte er rasch dahin, um einer ihm lästigen Beobachtung, die man ihm ohne Zweifel zuteil werden ließ, so schnell wie möglich zu entgehen; sobald er jedoch das Hoftor hinter sich gelassen, zog er die Zügel an, ritt im langsamen Schritt über den Knüppeldamm zwischen den Weiden fort und gab sich willig der Gedankenflut über die Störung hin, die seit wenigen Stunden über ihn hereingebrochen war und nun sein friedliches Stilleben eben so unerwartet wie gewaltsam beeinträchtigt hatte. Niemanden hat er dabei in sein Herz blicken lassen, das ungestüm, fast unwillig über das seltsame Gebahren schlug, von dem er soeben Zeuge gewesen; er hatte sich selbst bezwungen, wie er es so wohl vermochte aber jetzt, da er allein und ungestört war, ging er mit sich über das Erlebte zu Rate, wobei er sehr bald einen ziemlich klaren Blick in die Absichten und Bestrebungen gewann, die man fernerhin fast zweifellos gegen ihn in Ausführung bringen würde.
Aber diese Betrachtungen, so ungerufen sie kamen und so aufdringlich sie sich erwiesen, stimmten ihn nicht etwa trübe, machten ihn nicht traurig; dazu war sein männlicher Geist zu regsam, seine Willenskraft zu stark, und höchstens gestand er sich ein, daß der letzte Wille seines Vaters, falls er denselben zu erfüllen suchen wollte, ihm doch mehr Klippen in den Weg werfen könnte als er anfänglich erwartet, selbst wenn er seine persönlichen Empfindungen dabei noch gar nicht mit in das Spiel brächte.
Als er mit diesen Gedanken zu Ende gekommen, fühlte er plötzlich eine ungewöhnliche Schwüle; die Hitze war drückend geworden, und es war ihm zu Mute, als ob eine düstere Last auch von außen her sich auf seine Schultern lege. Er blickte rasch von dem Hals seines Pferdes auf und hob unwillkürlich die Augen zum Himmel. Da hatte er mit einemmale die Ursache der unbequemen Wirkung vor sich, denn der bisher so goldklare Horizont hatte sich mit schweren Gewitterwolken umzogen, die Sonne war verschwunden, und Felder und Auen ringsum lagen in jenem trüben geheimnisvollen Schleier, den ein rascher Wechsel der Witterung so häufig über die Erde zu breiten pflegt.
»O, o,« sagte der einsame Reiter mit einem halblauten Seufzer zu sich, »wo ist mein blauer Himmel geblieben! Heute morgen war noch alles frisch und neu in mir und um mich her, und jetzt liegt tiefer Schatten auf allem, was ich sehe, was ich denke. Aber halt! Nicht verzagt vor der Zeit! Die Sonne wird wieder aus jenen Wolken treten, und der Atem Gottes wird Schatten und Nebel vertreiben. Vorwärts, Brauner, wir haben lange genug geträumt, sonst werden wir noch naß vor unserm ersten Ziele.«
Er drückte seinem Pferde die Sporen ein, und das gutwillige Tier sprengte im Galopp über den staubigen Landweg. Als der Reiter aber eben die Chaussee erreichte und links umbog, um dem Meierhofe zuzueilen, fielen schon schwere und dichte Tropfen vom Himmel, und ein fernes Wetterleuchten blitzte am südlichen Horizonte auf. Schnell flog das Pferd die Chaussee entlang, aber schon nach wenigen Minuten zog sein Reiter die Zügel wieder an, denn der heftige Regenguß hörte ebenso plötzlich auf, wie er gekommen war, und es wurde allmählich wieder heller ringsum, indem ein frischer Oberwind das finstere Gewölk seitwärts jagte.
Bodo war etwa eine Viertelstunde unterwegs, als er sein Pferd im langsamsten Schritt gehen ließ; er hatte sich bereits dem Meierhofe genähert und sah die gewaltigen Dächer der großen Gebäude schon durch die Wipfel der sie umkränzenden Eichen und Buchen ragen.
Wer die großen Meierhöfe im Teutoburger Walde zum ersten Male sieht, erstaunt gewiß, nicht allein über den Umfang der zahlreichen Baulichkeiten, sondern auch über das altertümliche, ehrwürdige und doch behagliche Gepräge, welches dieselben tragen. Gewöhnlich liegen die Hauptställe und Scheunen, in der Mitte die ungeheure Tenne bergend, mit dem Herrenhause unter einem und demselben Dache, und nur da, wo der Viehstand ein ungewöhnlich großer ist, hat man sich genötigt gesehen, noch abgesonderte Ställe und Scheunen zu errichten, die das Hauptgebäude wie die Trabanten ein größeres Gestirn umgeben, an welche sich dann noch kleinere Niederlassungen – Sterne viel geringerer Größe, – die Wohnungen der zum Meierhofe gehörigen Kolonnen und Heuerlinge, in näherer oder weiterer Ferne anschließen.
So war es auch hier. Der Hof des Meiers zu Allerdissen gehörte zu den umfangreichsten und großartigsten dieser Gegend. Das Hauptgebäude war in Kreuzesform gebaut, so daß die Tenne mit ihren Stallungen den längeren Fuß und das Herrenhaus den Querbalken des heiligen Zeichens bildete. An letzteres aber, da sein Raum für die Bedürfnisse des gegenwärtigen Besitzers nicht ausreichte, war zu beiden Seiten und nach dem Garten hinaus ein neuer Anbau gefügt, der sowohl durch die Festigkeit seines Mauerwerks, wie durch seinen modernen Anstrich angenehm in die Augen fiel, obwohl er den Stil des älteren Mittelgebäudes beibehalten und das patriarchalische Ansehen des Ganzen dadurch treu bewahrt hatte. Uralte Bäume, in mächtigen Gruppen zusammenstehend, umschlossen und verschönerten den Hof fast ringsum, und nach drei Seiten hin war derselbe von einer mannshohen Weißdornhecke umfaßt, während die Gartenseite nach den Äckern, Wiesen und fernen Waldungen hin völlig offen lag.
Durch das ganze Besitztum des Meiers schlängelte sich in vielfachen Windungen ein munterer Bach, die Aller genannt, der von dem höheren, blau herüberschimmernden Gebirge herabfloß und in der Nähe des Hofes sich unter einer kleinen gemauerten Brücke in verschiedene Kanäle teilte, die sich über die benachbarten Grundstücke verbreiteten und endlich in den Wiesen an den Ufern der Weser verloren, wo sie ihre Feuchtigkeit mit dem Wasser des größeren Flusses mischten.
Dieser Bach, so geschwätzig, so kristallklar, wie je ein unruhiges Kind des Gebirges, barg die herrlichsten Forellen, war fast in seinem ganzen meilenlangen Lauf mit üppigem Gebüsch umwachsen und kündigte dadurch schon von weitem den mäandrischen Lauf an, den die silberklare Woge nahm. Aber dieser Bach begnügte sich nicht allein damit, zu murmeln und zu plätschern, er war auch fleißig und machte sich mehrfach nutzbar, indem er bald ein rasselndes Mühlwerk trieb, bald zum Besprengen und Bleichen der kostbaren Leinwand diente, welche in diesen Gegenden so reichlich und künstlich wie fast nirgends gewebt wird.
Was bedeutet aber das Wort Meier? wird mancher Leser fragen, der nie in den westfälischen Landen gewesen ist und den Ursprung der Namen, Sitten und Gebräuche jenes merkwürdigen Landes nicht kennen gelernt hat.
Das Wort Meier ist aus dem Worte Meister entstanden, und die wenigen Männer, die diesen Namen führen, führen ihn mit Stolz und gerechtem Selbstbewußtsein. Sie sind mit die urältesten Bewohner des Landes und leiten ihren Ursprung aus den dunklen Zeiten her, wo der berühmte Sachsenherzog Wittekind mit Karl dem Großen blutige Kämpfe um den Sieg des Heiden- und Christentums führte. Die alten sogenannten Sattelmeister waren Wittekinds erste Vasallen, seine Saalgenossen, und bildeten sein nächstes Gefolge. Sie führten als Reiterhäuptlinge die gewaltigen Scharen seiner Reisigen, fochten seine Schlachten und zierten seinen Hof, wie ihn so groß und reich selten ein deutscher Fürst seitdem besessen hat.
Über das ganze ehemalige Westfalen sind noch hier und da die Nachkommen dieser Männer zerstreut, sie wohnen noch an denselben Orten wie zu Wittekinds Zeiten, bewahren viele ihrer geheiligten Sitten und stehen geachtet und geehrt in der Meinung des Volkes da, zumal sie die reichsten ländlichen Grundbesitzer des Landes sind.
Älter und länger – dabei sehr wenig verzweigt – ist fast kein Stammbaum in den deutschen Gauen als der ihre, in sorgfältig gehüteten Dokumenten bewahren sie die untrüglichen Beweise ihrer Abstammung, die Namen und Verhältnisse ihrer Vorfahren auf, aber zu sogenannten Rittern hat man keinen von ihnen geschlagen, und das verlangten sie auch nicht, denn sie waren und sind mit Recht stolz auf ihre unter den Bauern hervorragende Stellung, die ja den Kern unseres ganzen Volkes bilden. Ritter waren sie ehemals in der Tat, und in gewisser Beziehung sind sie es noch, wenn man dem Namen seine eigentliche Bedeutung läßt, aber das Trachten nach dem modernen Adelsstand und seinen Privilegien – obwohl sie selbst noch die ihrigen haben – hat ihr biederes, echt deutsches Wesen und Herz nie gekannt, und sie haben nie etwas anderes und mehr sein wollen, als was sie wirklich sind: die echten Nachkommen vaterländischer Helden, die fleißigen Bebauer des vaterländischen Bodens, Männer und Menschen im edelsten und herzigsten Sinne des Worts. So rollt noch in ihren Adern das alte unverfälschte Sachsenblut, nur der wilde, unbändige Kämpengeist, von Generation zu Generation durch ein Jahrtausend forterbend, aber dem Fortschritt des Zeitgeistes in Kultur und Bildung folgend, hat sich zur modernen männlichen Tatkraft und zum modernen Aufschwung des menschlichen Geistes nach allen Richtungen hin bei ihnen veredelt. –
Bodo hielt, als er den Hof erreicht, sein Pferd an der grünen Umfassungsmauer desselben an und schaute eine Weile hinüber. Der Regen tröpfelte langsam von den Blättern der Bäume nieder, der Rasen dampfte und der von neuem erfrischte reiche Humusboden strömte einen köstlichen Wohlgeruch aus.
In diesem Augenblick brach die Sonne durch das rasch vorüberziehende Gewölk, streute ihr blitzendes Gold auf den samtnen Teppich und ließ die Blätter der Bäume in noch frischerem Grün aufleuchten.
Es war ein lieblicher Anblick, der sich hier dem in stille Betrachtung Versunkenen bot, und der Gedanke, der ihm eben kam: daß seine Sonne ihm so bald wieder aufgegangen, mochte dazu beitragen, ihm alles, was er sah, noch schöner erscheinen zu lassen.
Da man auf dem Hofe das heraufziehende Gewitter fürchtete, hatte man Pferde, Kühe und Stiere von der Weide herbeigetrieben, und diese Herden des Meiers schritten soeben brüllend und zwischendurch hell mit ihren Glocken läutend über das weite Gehöft. Es waren meist herrliche Tiere reinster und bester Zucht, stark und schön, und dabei vortrefflich gepflegt, wie man es von der Fürsorge eines Mannes, wie der Meier zu Allerdissen es war, nicht anders erwarten konnte.
Vor allem aber zogen Bodos Blicke die Pferde seines Nachbars an. Er war ein Kenner und liebte das schönste und edelste Tier der Welt, fast wie der Orientale es liebt. Als er aber diese glatten, feinadrigen Rassepferde sah, die mutig wiehernd im Galopp durch die Büsche stürmten und in gewaltigen Sätzen und mit fliegenden Schweifen und Mähnen dem gemütlichen Stalle zueilten, schlüpfte unwillkürlich ein Seufzer über seine Lippen, und sein Auge folgte ihnen begierig, bis sie in der Tenne verschwunden waren.
Er wußte nicht, daß er selbst schon in diesem Augenblick von dem Besitzer aller dieser Herrlichkeiten beobachtet wurde, denn der Meier sah eben aus dem Fenster seiner Stube, um sein rückkehrendes Vieh zu betrachten, und sein scharfes Auge fiel sogleich durch eine kleine Lichtung im Gebüsch auf den Fremden, der still auf seinem Pferde saß, nur mit dem Kopfe über die grüne Hecke hervorragte und unverwandt die springenden Rosse verfolgte.
Als er sich satt gesehen, konnte er ein freudiges Lächeln nicht unterdrücken, und mit höchster Befriedigung, die sich seinen Mienen mitteilte, setzte er sein Pferd wieder in Gang und ritt endlich in das große Tennentor ein, dessen breiter und hochragender Fries in Holz geschnitzte Sprüche der heiligen Schrift zeigte, wie wir sie fast vor jedem alten Hause in den Tälern des Teutoburger Waldes finden.
Als Bodos Pferd die Schwelle mit den drei festgenieteten Hufeisen überschritten hatte, hielt er es abermals erstaunt an, denn die ungeheuer lange und breite Tenne, die vor ihm lag, machte einen gewaltigen Eindruck auf ihn. Blank und rein, von jeglichem Staube und Unrat gesäubert, erstreckte sich der freie Mittelraum weit nach hinten bis zu der Riesenküche, die am Ende derselben und nur durch einen kolossalen Herd davon getrennt, unmittelbar vor dem eigentlichen Herrenraume lag. Weithin blitzten die an zahllosen Riegeln aufgehangenen, blank gescheuerten Kupfer- und Zinngefäße, und die Schränke voll weißen und buntbemalten Porzellans ließen durch die Glasscheiben schon von ferne ihren seit langen Zeiten aufgespeicherten Reichtum erkennen.
An den Seiten der Tenne aber rasselte, brüllte und stampfte die eben eingetretene Schar der von der Weide geholten Tiere. Links wurden soeben die Kühe an die funkelnden Ketten gelegt, und rechts wieherten die schönen, feinschenkligen Rosse, unter denen sechs prachtvolle Hengste standen, die der reiche Meier zu Allerdissen nur für seine eigene Person teils zum Fahren, teils zum Reiten benutzte.
Als Bodo noch nach beiden Seiten verwunderungsvolle Blicke warf und seinen Braunen schon wieder in Gang gesetzt hatte, trat ein Knecht auf ihn zu, um ihm beim Absteigen am Ende der Tenne behilflich zu sein. Kaum aber berührte er mit den Füßen den Boden, so begrüßte ihn ein lauter Willkommensruf vom Herrenraume her, aus dessen Tür zur rechten Hand soeben ein großer, breitschultriger, einige fünfzig Jahre alter Mann trat, der in seiner bequemen Kleidung und in seinen festen, kernigen Zügen, sowie in der sonnenverbrannten Gesichtsfarbe den praktisch tätigen Landwirt nicht verkennen ließ.
Diese Hünengestalt mit dem Ausdruck unantastbarer Redlichkeit und Biederkeit, sowie des gesunden Menschenverstandes in den treuherzigen, wunderbar großen blauen Augen, war der Meier zu Allerdissen selber. In der Eile hatte er seinen Strohhut im Zimmer liegen lassen und trat mit im Zugwinde der Tenne flatterndem dunkelblonden Haar dem Ankommenden entgegen.
»Kann ich mich irren,« sagte er mit etwas langsamer, aber sogleich den gebildeten Mann verratender Sprache und trat näher an den Fremden heran, dem er die große Hand entgegenstreckte und damit die feine hingereichte warm schüttelte, »kann ich mich irren, wenn ich Sie für Herrn von Sellhausen halte? Nein, ich glaube es nicht!«
»Nein, mein lieber Meier,« entgegnete Bodo mit lächelnder Miene und herzlichem Händedruck, »Sie irren sich nicht. Ich bin wirklich meines Vaters Sohn und komme endlich, um mich zu entschuldigen, daß ich nicht schon früher meinen nächsten Nachbar aufsuchte, aber – –«
»Still, still, mein junger Herr,« unterbrach mit einer Freudigkeit, der man es ansah, daß sie aus dem Herzen kam, der Meier seinen Gast und führte ihn, seinen Arm fest ergreifend, in das erste Zimmer zur Rechten, »nichts von Entschuldigungen, wenn man zum ersten Mal unter mein Dach tritt, wo man stets mit Dank empfangen wird, wenn man kommt. Hier wird nichts übel genommen und alles vergeben, was Gott der Herr uns selber vergibt. Genug, Sie sind da, und das genügt mir. So, treten Sie ein, und nun heiße ich Sie noch einmal von ganzem Herzen willkommen!«
Das erste Zimmer, in welches der Meier seinen Gast führte, war offenbar sein Wohn- und Arbeitszimmer, von wo aus er durch ein kleines verhangenes Fenster die ganze Tenne und das Treiben darin überschauen konnte. Es war sehr geräumig und hoch und brachte durch seine geschmackvolle Ausstattung einen wohltuenden Eindruck auf den Beschauer hervor. Hauptsächlich gründete sich dieser Eindruck auf die Solidität des Ganzen, verbunden mit einer leicht ins Auge fallenden Bequemlichkeit, die, wenn man nicht zu wählerisch sein wollte, in manchen Punkten an eine nicht gesuchte, vielmehr natürliche Eleganz streifte, die für Bodo von Sellhausen etwas Überraschendes hatte, da er sie in dem Grade hier nicht zu finden erwartet.
Das ganze Zimmer war mit glänzend poliertem Eichengetäfel ausgekleidet, das sich bis zur Decke erstreckte, welche drei schwere Balken von demselben Holze und mit schönem Schnitzwerk verziert trugen. Sämtliche Möbel waren ebenfalls von poliertem Eichenholz, massiv und schwer, aber dennoch gefällig gearbeitet. Das mit Rohrgeflechtsitzen versehene Sofa, sowie die hohen Lehnstühle waren mit Kissen belegt, und diese mit ungebleichtem dicken Linnendamast überzogen. Am Fenster stand ein großes Zylinderbureau, auf dessen geöffneter Platte die Haushaltungsbücher und verschiedene Quittungen lagen, womit der Meier noch vor kurzer Zeit beschäftigt gewesen zu sein schien. An der Wand daneben ragte ein mächtiger eiserner Geldschrank, dessen feiner Lacküberzug dem Gefüge und der Farbe des Eichenholzes sehr geschickt nachgeahmt war. Vor dem Sofa sah man einen runden Tisch, worauf Zeitungen und verschiedene Bücher ihren Platz gefunden. Dem Spiegel in künstlich geschnitztem Eichenholzrahmen gegenüber, bis zum Sofa hinabreichend hing ein altes, aber gut restauriertes Ölbild, das Meierhaus darstellend, wie es vor hundert Jahren ausgesehen.
Durch dieses Zimmer führte der Wirt seinen Gast gemächlichen Schrittes hindurch in ein dahinter liegendes kleineres, aber viel kostbarer ausgestattetes Gemach, dessen Fenster in den Blumengarten sahen und teilweise von blühenden Obstbäumen gegen die Strahlen der Sonne geschützt wurden. Weiße gestickte Tüllgardinen reichten fast bis auf den Boden herab, den ein weicher wollener Teppich bis in die äußersten Ecken bekleidete. Die Wände waren mit einer blütenreichen, hell wie Silber schimmernden Tapete überzogen und mit vortrefflichen Kupferstichen in goldenen Rahmen geschmückt. Alle Möbel darin waren von dunklem Nußbaumholz und reichlicher verziert als die in dem vorderen Zimmer. Dem Spiegel mit mattem Goldrahmen gegenüber stand an einer breiten Wand ein schöner geöffneter Wiener Flügel; am Fenster ein zierlicher Nähtisch. Darauf lag ein geöffnetes Buch – Schillers Maria Stuart, wie Bodo später erkannte – und daneben hing ein schwebender Bücherschrank, in welchem Schillers, Uhlands und anderer deutscher Dichter Werke ihren Platz gefunden hatten. Das Sofa, einige große und mehrere kleinere Sessel waren mit dunkelgrünem Plüsch überzogen und auf dem mit einem gleichfarbigen Teppich bedeckten Tisch vor dem Sofa lagen die neuesten Journale, eine Damenmusterzeitung und eine eben angefangene Tapisseriearbeit – fast alles Zeichen der Anwesenheit eines weiblichen Wesens, was Bodo einigermaßen auffiel, da er wußte, daß der Meier Witwer war und bisher niemand ihm von einer Frau in der Nähe desselben gesprochen hatte.
Als der Meier seinen Gast in dieses Zimmer geleitet, bat er ihn, auf dem Sofa Platz zu nehmen und setzte sich dann gemächlich neben ihn. Je länger er aber nun, was er redlich tat, den jungen Mann betrachtete, den er seit vielen Jahren nicht gesehen, um so fester und eindringlicher wurzelten seine Augen auf ihm, und um so ernster, nachdenklicher und beinahe wehmütiger wurde der Ausdruck seines eigenen Gesichts. Bodo bemerkte die ihm geschenkte Aufmerksamkeit nicht, seine Blicke flogen vielmehr hastig von einem Gegenstand zum andern in dem Zimmer umher, wobei er selbst nicht wußte, daß seine Miene eine sichtbare Verwunderung zeigte, die dem Meier nicht entging, der zuletzt kaum ein behagliches Schmunzeln unterdrücken konnte, das wie eine leichte Wolke über seine wettergebräunten Züge glitt.
Dies alles ging jedoch überaus rasch vor sich, und Bodo saß kaum auf seinem weichen Platz, so trafen die Blicke der beiden Männer aufeinander, und beide lächelten sich freundlich an, indem jeder von ihnen ein gewisses Wohlbehagen an dem andern empfand.
»Sie wohnen hübsch hier, mein lieber Meier,« begann Bodo das Gespräch, »und ich habe mir kaum vorgestellt, daß sich auf dem Lande so geschmackvoll eingerichtete und wohnliche Zimmer finden lassen.«
»Ah, Herr von Sellhausen, ich verstehe Sie wohl, Sie haben nicht gedacht, daß ein Bauer wie ich die modernen Bedürfnisse des Städters sich zu eigen zu machen versteht.«
»Nein, mein lieber Meier, das ist es nicht, was ich meine, und am wenigsten habe ich Sie für einen Bauer gehalten.«
Die breite Brust des Meiers dehnte sich bei diesen Worten weit aus, sein Auge blickte stolz und feurig auf den jüngeren Mann und seine Wangen sprühten von einem edlen inneren Feuer, als er mit etwas erhobenem Tone und doch mit unverkennbarer Bescheidenheit sagte: »Da haben Sie unrecht, Herr Legationsrat, und ich sage Ihnen das so offen und ehrlich, wie ich Ihnen bei Gelegenheit auch stets das Gegenteil sagen werde. Nein, ich bin nichts als ein Bauer und will nichts anderes sein, obgleich Sie nicht denken mögen, daß das ein sogenannter dummer Bauernstolz von mir ist. Nein, nein, Herr, was meine Vorfahren waren, war genug, und das bin ich auch; nur lebe ich nach ihnen und das ist der einzige Unterschied zwischen ihnen und mir, wie auch der einzige Vorteil, den ich vor ihnen voraus habe. Ach ja, die Zeiten ändern Dinge und Menschen in der Welt, man muß mit dem großen Schwungrade mitrollen und auch der Bauer darf nicht zurückbleiben, wenn die Kultur des menschlichen Geistes eine Kultur der menschlichen Verhältnisse verlangt. Sehen Sie sich nur um auf unserer schönen Erde, ob Sie meine Worte nicht tausendfältig bewahrheitet finden. Wer einmal ins Stocken und Hemmen gerät, bleibt bald im Sumpfe der Verkommenheit stecken, und das Schlimmste dabei ist, daß die Leute es nicht einmal merken, wenn sie bis über die Ohren darin sitzen. Ich aber will nicht darin sitzen, nicht bis zum kleinen Zehen, und wie ich es für mich nicht will, soll es auch meine Umgebung nicht. Ich liebe keinen Sumpf, in dem sich das kriechende Gewürm glatten Schlaraffen- und Schmarotzerlebens erzeugt, nirgends, in keinem Dinge, bei mir muß jeder Tropfen Wassers lebendig und frisch fließen, wie das Blut in und aus dem Herzen strömt, wenn es den Leib im ordentlichen Gange erhalten will. Doch – wir kommen da mit einem Mal auf ein ganz anderes Thema, als sich für den ersten Besuch eines mir so werten Gastes eignet. Ach, Sie glauben gar nicht, wie ich mich freue, daß ich Sie endlich bei mir sehe, und noch dazu auf diesem Platz da, der –« er stockte einen Augenblick – »der für mich etwas Geheiligtes und zugleich Rührendes hat.«
Seine Stimme sank bei diesen Worten, nachdem sie sich vorher etwas gehoben hatte, in einen milderen Ton zurück und seine Blicke flogen rasch über Bodos Gesicht und senkten sich dann wehmütig zur Erde hernieder.
»Wie meinen Sie das, ich verstehe Sie nicht,« entgegnete Bodo. »Warum hat dieser Platz etwas Geheiligtes und zugleich Rührendes für Sie?«
»Herr Legationsrat,« sagte der Meier, rückte dem jungen Manne näher und legte seine große Hand gewichtig auf seinen Arm, »der Platz, auf dem Sie jetzt sitzen, ist mir durch die Erinnerung an einen nie wiederkehrenden Freund geheiligt. Gerade da – in dieser Ecke – Sie verzeihen, daß ich davon beginne, denn man muß den Toten ihre Ruhe, auch in unsern schmerzbewegten Herzen gönnen – hat Ihr guter Vater drei Tage vor seinem Ende gesessen.«
»Wie? Also so kurz vor seinem Tode war er noch bei Ihnen?«
»Ja. Er war am Tage vorher auf der Jagd beim Baron Grotenburg gewesen und hatte sich erkältet. Er litt an einem heftigen Schnupfen, mit Kopfschmerzen verbunden. Ich verzieh dem sechsundsiebzigjährigen Manne kaum, daß er unter diesen Umständen sein Zimmer verlassen, aber er war doch zu mir gekommen, weil eine große Sorge sein Herz von Tage zu Tage mehr belastete, von der er sich bei mir vielleicht freisprechen wollte.«
Bodos Blicke wurzelten fest auf des Meiers Antlitz, das, wie ihm schien, einen bedeutungsvolleren Ausdruck angenommen hatte. »Welche Sorge?« fragte er endlich, von einer natürlichen Neugierde dazu angeregt.
Der Meier schlug sein blaues ehrliches Auge voll gegen den jungen Mann auf und sagte mit Nachdruck, aber fast erschütternder Milde: »Ach, er hatte Sorge um Sie –«
»Um mich? Sprechen Sie weiter. Ich bin ein Mann, dem man alles sagen kann.«
»Ich glaube das wohl, aber eigentlich weiß ich nicht, ob ich Ihnen das sagen soll, noch dazu gleich heute, am Tage, wo ich Sie sehe!«
Bodo dachte einen Augenblick nach, dann versetzte er lächelnd: »Wenn es Ihnen schwer wird, von diesem Gegenstande zu sprechen, oder vielmehr damit zu beginnen, so will ich Ihnen helfen. Ich weiß, Sie sind einer der besten Freunde meines Vaters gewesen, das hat er mir selbst in seinem letzten Schreiben gesagt, und Sie werden also auch wissen, was ihn meinetwegen in Bezug auf die Familie seines Schwagers in Unruhe versetzte. Nicht wahr, das ist es, was Sie meinen?«
»Ja, bei Gott, das ist es, und darüber zu sprechen, kam Ihr Vater zu mir, obgleich er sich krank fühlte und einen schlimmen Ausgang ahnen mochte. Er erzählte mir noch einmal alles, was er getan, geschrieben, unternommen. Ihret- und einer anderen Person wegen –«
»Nun, fahren Sie fort – und Sie stimmten ihm in allem bei?«
»Nein, das tat ich nicht. Jedoch – davon lassen Sie mich jetzt schweigen, wir haben wohl noch einmal später und zu gelegener Zeit Veranlassung, darüber zu reden. Und da – gerade zur rechten Zeit – kommt der Kaffee. Das ist recht, Marie, schenk ein, mein Kind!« sagte er zu der rotwangigen und überaus sauber gekleideten Magd. »Und ich, ich will uns eine Zigarre holen. Sie rauchen doch?«
»Ja, lieber Meier, ich rauche gern und bitte um eine Zigarre, wenn sie bei der Hand ist, sonst habe ich selbst welche bei mir.«
»O bitte, das wäre mir recht! Bei mir ist alles bei der Hand, was ich brauche. Da – darf ich bitten?« Und er reichte ihm ein feines Kistchen hin, welches er rasch aus dem Nebenzimmer geholt hatte.
Ohne daß es ihr geheißen ward, zündete die flinke Magd eine Wachskerze auf einem kleinen Porzellanleuchter an, stellte ihn auf den Tisch vor die sitzenden Männer und huschte unhörbar zur Tür hinaus, nachdem sie den Kaffee aus der Kanne von Britannia-Metall eingeschenkt und den Rahmtopf und einen Teller mit kleinen Kuchen vor den Gast gerückt hatte.
Dieser fühlte das Bedürfnis nach einer Tasse Kaffee, aß aber nicht, und nachdem er von dem vortrefflich bereiteten Getränk gekostet, zündete er die Zigarre an und blies den Rauch langsam wie ein Kenner vor sich hin.
Der Meier saß ruhig daneben und beobachtete den so genau Prüfenden, der gewiß an gute Zigarren gewöhnt war. Als derselbe aber befriedigt lächelte und dem Meier zunickte, sagte er: »Na, Herr Nachbar, wie schmeckt sie?«
»Vortrefflich, es ist eine echte Havanna!«
»Das soll sie wenigstens sein, so sagte man mir in Hamburg, wo ich sie kaufte. Mir schmeckt sie auch und ich rauche sie gern. Ja, das hat auch die Zeit auf dem Gewissen, daß man soviel Geld – freilich hat man's dazu – für dergleichen Dingerchen hingibt, wo unsre guten Alten eine patriarchalische Pfeife dampften. So fällt ein Stückchen Tradition nach dem anderen ab und ich habe in meiner Jugend nicht daran gedacht, daß ich sogar einst meinen bequemen Bauernrock ausziehen würde, wenn ich nach der Stadt führe, wo man ja doch mit Leuten verkehrt, die auch ihre ausgedienten Moden abgelegt. Aber freilich, wenn man Kinder hat, die andere Sitten mit ins Haus bringen, muß man auch hierin mit, denn von den Kindern – seltsam genug – müssen die Alten manchmal viel lernen. Du lieber Gott! Mein Vater hat es sich gewiß in seinem langen Leben nicht träumen lassen, daß sein Sohn ein paar Tausend Taler nach England schicken würde, um sich Maschinen kommen zu lassen, die seine Äcker verbessern, sein Wasser schnell treiben und seinen Heuerlingen die schwere Arbeit verkürzen. Das muß jetzt alles geschehen, denn wer mit gutem Winde segeln will, darf die Leinwand nicht sparen.«
»Sie haben wohl recht. Aber Sie sprachen da eben von Kindern. Daß Sie einen Sohn haben, weiß ich, aber haben Sie noch mehr?«
»O, wissen Sie das nicht? Gottlob, ich habe zwei, eine Tochter und einen Sohn, die mir, ich sage es mit Stolz, viele Freude machen, denn es sind gute und strebsame Kinder. Meine Tochter, in deren Zimmer wir hier sitzen, werden Sie heute wahrscheinlich noch sehen, jetzt ist sie draußen noch beschäftigt. Mein Sohn aber ist außer dem Hause. Er hat das Gymnasium in Detmold besucht, sein Abiturientenexamen gemacht und wird natürlich Landwirt wie seine Väter. Zu diesem Behufe studiert er in Eldena, soll dann Reisen machen und mich einmal von der Arbeit ablösen, wenn ich müde bin. Der Junge ist brav und seiner Vorfahren Blut fließt unverfälscht in ihm. Doch was schwatze ich so lange von mir und den Meinigen allein und ich habe doch so viel von Ihnen zu hören. Und das soll jetzt geschehen. Sie haben also den Rock des Diplomaten ausgezogen und sind in die Heimat zurückgekehrt. Na, da werden Sie einen kleinen Unterschied finden. Berlin, Wien, Paris, London, Konstantinopel und Athen auf der einen Wage – und das kleine Sellhausen auf der anderen. Haha! Es ist fast zum Lachen. Sie werden da manches in sich zu bekämpfen haben.«
»Nicht im geringsten, mein lieber Meier. Sie stellen sich die weltlichen Genüsse da draußen vielleicht zu glänzend und verführerisch und die stillen Freuden in der Heimat zu alltäglich vor. Nein, nein, da sind Sie im Irrtum. Es ist wahr, ich habe viel Schönes gesehen und bin um manche bedeutende Erfahrung in der großen Welt reicher geworden, aber, mein Lieber, ich habe mitunter so viel sehen und erfahren müssen, daß ich mit Vergnügen meinen Horizont sich verkleinern sehe. Da tun mir nicht so leicht Augen und Herz weh, und überdies kann ich beides von dem Punkt abwenden, den ich vermeiden will. Draußen, da ging das nicht, da riß mich die Kette der Pflicht in die Schranken, und selbst wenn ich keine Lust zum Kämpfen hatte, mußte ich oft einen schwachen Gegner erbarmungslos niederschlagen. Das tat mir oft weher als ihm. Ach ja! Politik zu treiben, das heißt, in seinem bequemen Zimmer zu Hause sitzen und sie aus den Zeitungen lesen und bekritteln, ist unter Umständen eine ganz hübsche Sache; aber wie der Soldat im Feuer der Schlacht standhaft auszuhalten, so an der großen heißen Esse zu sitzen, wo die Politik geschmiedet wird, die Finger in die glühenden Kohlen zu stecken und sich oft dabei selbst zu verbrennen, nein, lieber Meier, das ist mitunter eine recht fatale Sache. Immer und immer zu bauen und doch kein vernünftiges Werk zustande zu bringen, macht selbst dem leidenschaftlichsten Baumeister keine Freude. Man wird mürbe, matt und mißgestimmt dabei. Man lernt die Menschen zu leicht verachten, die man lieben möchte, und das verbittert und vergällt alle Lebensfreude. So erging es mir, und damit ich mich nicht ganz verlöre, und das letzte beste Stück meiner Seele rechtfertigte, bin ich müde nach Hause zurückgekehrt, um mich zu ruhen. Wo konnte ich das auch besser, als unter dem stillen Dache meines Vaters – meinen Sie nicht?«
»O ja, das kann ich mir wohl denken und ich billige es auch, wie Ihr Vater es billigte. Aber Sie sind nun an den höheren Flug der Politik gewöhnt und hier erwartet Sie ein ganz winziger irdischer Krimskrams. Wo Sie mit Fürsten, Ministern und Grafen verkehrt, sollen Sie mit kleinen Menschen und Landjunkern leben – wird Ihnen das auf die Dauer behagen?«
Bodo schauderte unwillkürlich zusammen und sein Blick suchte vertrauensvoll den des wackeren Landmanns. »Mein lieber Meier,« erwiderte er, »welches Glück ich in jenem sogenannten höheren Elemente gefunden, wollen wir unerörtert lassen, aber glauben Sie mir, auch der Flug jener höheren Politik wird häufig mit lahmen Flügeln begonnen und man ist nur zu oft froh, wenn man ihn mit heiler Haut beendigt. Ich habe meinen Flug beendigt und meine Haut ist heil geblieben. Lassen Sie mich jetzt ruhig und gelassen mit leichten Füßen neben Ihnen und anderen auf ebener Erde gehen und wirklich erreichbare Ziele erstreben.«
»O ja, gewiß, recht gern!« versetzte der Meier wie in Gedanken, denn das moderne Giftwort »Politik« hatte seinen lebhaften Geist ergriffen und entzündet und er konnte sich so leicht nicht wieder davon losmachen. »Aber was halten Sie denn von unserer gegenwärtigen politischen Lage?« fragte er plötzlich.
Bodo seufzte. »Ach, lieber Meier,« entgegnete er, »das läßt sich nicht gut mit zwei Worten sagen, und man kann Stunden darüber sprechen, ohne sich das volle Herz frei zu machen. Im ganzen habe ich überall, wohin ich gekommen, die Welt und die Menschen so gefunden, wie sie bei uns sind. Kein Fürst wird es jemals seinem Volke ganz recht machen können und so wird auch niemals ein Fürst mit seinem Volke ganz zufrieden sein. Aber daran ist weder der Fürst noch das Volk schuld.«
»Wer denn?« fragte der Meier mit offenem Munde und starrem Blick, da er nicht wußte, wohin die Meinung seines Gastes sich neigte.
»Diejenigen, die sich zwischen Fürst und Volk drängen, die sie beide auseinanderhalten, die sie verfeinden, die sie verhetzen und gegenseitig betrügen, weil sie das gedruckte und ungedruckte Gesetz der Pflicht und der Sitte nicht als die Richtschnur ihres Handelns anerkennen wollen. Um von den Privilegien des einen so wenig wie möglich zu haschen und von den Lasten der anderen so wenig wie möglich zu tragen, stellen sich diese Herren in die Luft und vergessen, daß ein Luftschiff noch immer nicht lenkbar ist und so leicht nicht lenkbar werden wird. Schaffen Sie also dieses Hindernis zwischen Fürst und Volk beiseite, machen Sie es unschädlich, legen Sie es brach – so werden Sie nicht allein Ruhe und Frieden im Lande haben, die Frucht der neuen Saat wird nicht nur reicher werden, sondern Sie werden die sogenannte Politik ruhig im Sande verlaufen sehen, und Fürsten und Völker werden sich brüderlich vertragen und glücklichere Lebenstage denn je genießen. Soll ich Ihnen nun noch etwas über meine Ansicht von der Politik der Gegenwart sagen, so gehen wir, alles in allem erwogen, einer besseren Zeit entgegen. Das deutsche Volk ist aus seinem Traumleben erwacht und hat seine Ziele erkennen gelernt. Es denkt logisch, es handelt gesetzlich, es will nur das Mögliche, Erreichbare verwirklicht sehen. Die Fürsten ahnen und fühlen das bereits und in kurzem werden sie es auch bedenken müssen. Daß es also besser bei uns werde, glaube ich nicht nur, weil ich es wünsche und hoffe, sondern weil die Vernunft endlich und überall siegt, und ein solcher Sieg bringt und ist selbst das Gute. Haben wir also Geduld, Ausdauer und Gottvertrauen! Wir sind schon in schlimmeren Lagen gewesen und die Krisis, in der wir uns jetzt befinden, wird günstig enden; die gute Natur des Deutschen wirft nach und nach alle schädlichen Stoffe aus, wie die See die modernden Leichen Ertrunkener. Da haben Sie mein politisches Glaubensbekenntnis und hoffentlich wird es auch das Ihrige sein.«
»Ja, o ja, das ist es und ich stimme Ihnen vollkommen bei. Ach ja, so ist es, hier bei uns und überall, nur kommt das Gute bei dem einen rascher und früher, bei dem anderen langsamer und später. Sehen Sie einmal da nach unserm großen Nachbarstaate hinüber – da sträuben die Herren zwischen König und Volk sich auch gegen das sausende Rad der Zeit. Aber sie müssen am Ende doch mit fort, wie der ewig schaffende Menschengeist es einmal will, und wehe dem, der gewaltsam in die Speichen des Rades greift, es geht über ihn fort und rennt doch an sein Ziel. Bei uns, Herr von Sellhausen, sind auch manche so töricht zu glauben, unser winziges Karrenrad aufhalten zu können, aber auch diese kleinen Herren werden ihre Täuschungen erfahren, es wird weiter trudeln und ihnen die podagrischen Zehen zerquetschen, wenn sie sie nicht beizeiten wegziehen.«
Bodo lächelte herzlich über das treffende Bild des Meiers. »Lieben denn viele Herren hier herum nicht überaus den Fortschritt?« fragte er.
»O ja, in höheren Genüssen des Lebens, in Ehre und Ruhm und namentlich in Besitz und Reichtum möchten sie alle Tage fortschreiten, darin sind sie radikal, aber den gesunden Menschenverstand, das Recht, das angeborene Menschenrecht sich weiter entwickeln zu lassen und dem Gesetz und Menschenwohl Geltung zu verschaffen, dazu haben sie nicht die geringste Lust. Freilich, man muß gerecht sein, es gibt auch unter unseren Nachbarn vortreffliche Männer, die von der Zeit lernen und mit der Zeit mitgehen, aber ihrer sind doch nur wenige. Die meisten können die Tage noch nicht vergessen, wo sie mit dem Stock oder der Peitsche über die Felder schritten und ihre denken und reden wollenden Hörigen fuchtelten nach Herzenslust. Wenn Sie wissen wollen, was diese Herren tun und treiben, gehen Sie in ihre Häuser, was sie leisten, auf ihre Felder und sehen Sie diese an. Da werden Sie die Faulen von den Fleißigen, die Langsamen von den Raschen, die rückwärts von den vorwärts Gehenden sehr bald unterscheiden lernen. Na, das werden Sie bald weghaben – Namen hab' ich ja nicht genannt –, wenn Sie nur erst ringsum zu Besuch gewesen sind. Oder haben Sie Ihre Rundreise vielleicht schon vollbracht?«
Bodo atmete auf; das Gespräch wandte sich jetzt einem Gegenstande zu, der ihm zurzeit näher am Herzen lag, als die so gern und schon halb vergessene Politik. »Nein,« sagte er, »ich habe sie noch gar nicht angetreten – heute erst beginne ich sie und Sie sind der erste gewesen, dem ich die Hand drücken wollte.«
»Da, drücken Sie sie mir noch einmal, ich fühle das Bedürfnis, sie Ihnen wieder zu drücken. So, und ich bedanke mich schön. Wir werden uns verstehen können. – Wer wird denn aber der zweite sein?«
»Der Justizrat Möller in B..., zu dem ich noch heute gehen werde.«
Der Meier zuckte unwillkürlich zusammen, sein Auge glitt langsam von dem Gesichte des Redenden fort und senkte sich sinnend zu Boden. »Grüßen Sie ihn von mir!« sagte er halblaut, als denke er an etwas ganz anderes. »Ich habe ihn auch lange nicht gesprochen – er war in England. – Aber Sie wollten mir noch etwas sagen, glaube ich!« fügte er hinzu, mit freierem Blick zu seinem Gaste zurückkehrend.
Bodo lächelte. »Ja, ich will Ihnen noch erzählen, was mir heute in Sellhausen begegnet ist.« Und er berichtete, was wir im vorigen Kapitel mitgeteilt haben, wobei er ein aufmerksamer Beobachter der Miene des Meiers war, die der ehrliche Mann niemals verstellen konnte. Aber diesmal schwieg er hartnäckig und verzog keine Muskel, nur wurde sein braunes Gesicht allmählich dunkelrot und sein Auge schien in Licht getaucht, als Bodo mit seiner Erzählung zu Ende war.
»Was sagen Sie dazu?« fragte dieser nun, nachdem er zu seinem gewöhnlichen ruhigen Ernste zurückgekehrt war.
»Was soll ich dazu sagen?« rief der Meier mit lauterer Stimme als zuvor und mit lebhaft funkelndem Auge. »Ich tue nicht gerne jemanden zu viel, aber hier möchte man ihm leicht zu wenig tun, wenn man dergleichen loben wollte. Wofür betrachten Sie es denn?«
»Aufrichtig gesagt, für eine seltsame Aufforderung, mich recht bald nach dem Befinden Fräulein Klotildens zu erkundigen.«
»Aha! Ja! Sie verstehen, sich milde auszudrücken. Und Sie werden das doch als echter Kavalier nächstens tun?«
Bodo lächelte wieder. »Ja,« sagte er mit ernsterer Miene, »das werde ich; wenn auch nicht als Kavalier, doch als Mann. Aber ich werde meine Rundreise zu den Schwägern und Vettern meines Vaters so einrichten. daß ich bei den Kranenbergs beginne und mit den Grotenburgs endige.«
»Aha! Sie lieben die allmähliche Steigerung und wollen nicht sogleich in den obersten Himmel gelangen. Na, viel Glück auf den Weg und recht viel Vergnügen dabei! Ich bin froh, daß ich Sie nicht zu begleiten brauche.« Er nickte schelmisch dazu und rieb sich eifrig die Hände. »Aber halt,« fuhr er plötzlich sehr ernst werdend fort, »bis dahin wird die alte Dame auf der Cluus auch zurück sein – die dürfen Sie auf keinen Fall vergessen.«
»Das will ich auch nicht; auch darin hat mir mein Vater einen Wunsch ausgesprochen, den ich erfüllen werde. Aber sagen Sie, die alte Dame lebt also noch? Mein Vater schrieb mir nämlich, daß sie bisweilen kränkle, und da sie sehr alt ist, könnte sie der feindseligsten Krankheit von allen erlegen sein.«
»Beruhigen Sie sich darüber. Sie ist wieder ganz gesund, so viel ich weiß – zum Ärger ihrer einstigen Erben – ich meine nämlich die, die sich selbst dafür halten. Na, ich mache mir selbst aus dem Leben nicht allzu viel – bei Gott muß es auch ganz angenehm sein – aber so lange möchte ich doch in Wahrheit leben, bis die alte Birkenfeld – der grüne Pelz, wie sie sie nennen – einmal stirbt, denn die Katzbalgerei, die dann unter den lieben Vettern und Schwägern hereinbrechen wird, mit anzusehen, muß ein Hauptspaß sein.«
»Sie ist also reich?«
»O, wissen Sie das nicht?«
»Viel weiß ich davon nicht mehr, denn es ist lange her, daß ich davon gehört, und mir sind seitdem so viele andere Dinge durch den Kopf gegangen, daß ich manches vergessen habe. Aber da fällt mir ein, mein Vater hat mich an Sie gewiesen, um näheres über das Birkenfeld'sche Ehepaar zu erfahren, und Sie täten mir einen Gefallen, wenn Sie mir das Wichtigste über sie mitteilen wollten.«
Der Meier machte ein seltsam bedenkliches Gesicht, legte seine Zigarre weg und seufzte. Dann nach kurzem Nachdenken aber drückte er seine Hand auf Bodos Arm, sah ihm tief in die aufmerksamen Augen und sagte: »Ja, ich will es und ich finde selbst einen großen Genuß darin von diesen beiden seltsamen Menschen zu sprechen und mir ihr Leben und Wirken in das Gedächtnis zurückzurufen. Auch bin ich, nachdem Ihr Herr Vater gestorben ist, der einzige Mann auf der Welt, der sie so genau kennt, wie man zwei Menschen kennen kann. Denn wir drei, Ihr Vater, der alte Birkenfeld und ich, der bei weitem Jüngste unter ihnen, waren Freunde, wie es selten welche auf Erden gibt und wie sie nur der Tod auseinander zu reißen vermag.
So hören Sie denn. Wenn man je von einem Menschen sagen kann, daß er klein angefangen und groß aufgehört hat, so ist es dieser Birkenfeld. Er stammt aus der Gegend hier und sein Vater war ein kleiner Colone, der ärmlich lebte und in ärmlichen Verhältnissen starb. Da Reinhold Birkenfeld nichts zu erben hatte, verdingte er sich auf irgend eine Bleiche und wurde in sehr jungen Jahren Knecht daselbst. Da hat der arme Junge sich herzhaft quälen müssen und er hat mir oft genug erzählt, wie die große Schiebkarre mit so und so viel Dutzend Linnenstücken ihm bisweilen so schwer geworden sei, daß er seine bitterlichen Tränen darüber vergossen. Aber dieses Leben, die Knechtschaft genügte dem Strebsamen und überaus gern geistig tätigen Jungen nicht und er ging bei einem Kaufmann in unserer Nachbarstadt B... in die Lehre, wo er ordentlich lesen, schreiben und rechnen lernte – ordentlich, sage ich mit Absicht, denn er selbst hat diese drei Elemente menschlicher Bildung als die Grund- und Strebepfeiler seines künftigen Glücks bezeichnet.
Seine Lehrjahre gingen außerdem nicht ungenutzt vorüber; sein spekulativer Kopf, das Bessere und Höhere überall erspähend, hatte ein Ziel gefunden und auf dieses Ziel ging er mit unglaublicher Ausdauer und Energie los. Er wollte selbständig werden, das war sein nächstes Bestreben, und frei von aller sklavischen Unterordnung, die nur den fortstrebenden Geist beschränkt und unterdrückt.
Nachdem er daher vier oder fünf Jahre für seinen ersten Prinzipal gearbeitet, fing er einen kleinen Leinwandhandel auf eigene Rechnung an und damals schon heiratete er die Grete, seine Frau, aus purer Liebe und weil er wußte daß diese wie er zu streben und zu wirken verstand. Die beiden jungen Leute, denen der erste Verdienst verteufelt sauer wurde, arbeiteten um die Wette, um vorwärts zu kommen. Der Mann reiste und die Frau spielte den Kaufherrn zu Hause, führte die Bücher, kassierte Geld ein und versah, mit einem Wort, das ganze Geschäft. Von dieser Zeit schreibt sich ihre jetzige Fähigkeit her, das Geld nicht allein zu verrechnen, sondern auch fruchtbar zu machen und nutzbar anzulegen.
Als der Mann von seiner ersten Reise zurückkam, wunderte er sich über die Leistungen seiner Frau und von jetzt an schenkte er ihr immer mehr und mehr Vertrauen; sie ihrerseits aber feuerte ihn zu noch größeren Unternehmungen an. Da kam der große Krieg, den wir gegen die Franzosen fochten. Aber anstatt die beiden Leutchen einzuschüchtern, machte er sie kühner und kühner und es gelang Birkenfeld, Lieferant, erst für kleine Truppenabteilungen, dann endlich für ganze Armeen zu werden. Was er in diesem Geschäfte unternahm, glückte ihm, und am Ende des Krieges hatte er so viel gewonnen, daß er sich mit Recht selbst einen reichen Mann nennen konnte, ohne – wie er sich stolz ausdrückte – einen Pfennig zu besitzen, den er nicht ehrlich und gerecht verdient hätte.
Endlich hatte er es so weit gebracht, daß er sich in B... als Großhändler niederlassen konnte und von nun fing er an, seine Geschäfte bis über das Meer auszudehnen, was einen wunderbar günstigen Erfolg hatte. Er wurde ein sehr reicher Mann, was er niemals, wie so viele übrigen, zur Schau trug, und da er nicht einmal seine Zinsen verzehrte, so wuchs das Kapital immer mehr an, bis er, wenn nicht ein Millionär, doch nahe daran war, es zu werden, was seinen einzigen Schmerz, keinen Erben zu hinterlassen, denn seine Ehe mit Grete war kinderlos geblieben, unendlich vergrößerte.
Von Charakter war mein braver Freund tadelfrei; in seiner Moral fast puritanisch rein, ich sage fast, denn irren und fehlen kann einmal jeder Mensch. Auch zahllose andre gute Eigenschaften besaß er, namentlich ein warmes, menschliches Herz, und geben und schenken zu können, um Leid zu vertreiben und Freude zu bereiten, machte ihn überaus froh und glücklich. So ward er der Wohltäter der ganzen Gegend; er gab mit vollen Händen, jedermann, – leider oft, ohne zu prüfen, ob er Gutes damit tat, und darum ward seine Güte nur zu oft mißbraucht.
Schon vor vielen Jahren kaufte er drüben die kleine Cluus, baute sie aber nicht prächtig aus, wie es viele bei solchem Vermögen getan haben würden, sondern wohnte bescheiden und anspruchslos in den winzigen Räumen, wie er sie vorgefunden, nachdem er sie nur etwas wohnlicher hergestellt. Nur auf den Garten verwandte er ansehnliche Mittel, denn für die Blumen- und Obstzucht hatte er eine wahrhaft leidenschaftliche Vorliebe. Im Winter lebte er im Süden, im Sommer hier, wie es jetzt noch seine Frau aus alter Gewohnheit und wegen ihrer Gesundheit tut. In den letzten zehn Jahren zog er sich ganz vom Geschäft zurück und beschenkte damit seinen ältesten Buchhalter, der ihm lange treu und redlich gedient. So wohnte und wirkte er hier ganz in unsrer Nähe, und Ihr Vater und ich waren fast sein einziger Umgang, da er sich aus den adligen Verwandten seiner Frau sehr wenig machte und wußte, daß sich diese noch weniger um ihn bekümmern würden, wenn er nicht ein Millionär gewesen wäre. Er haßte sie zwar nicht, wie sie jetzt seine Frau haßt, aber er hielt sie für das, was sie waren, für leichtsinnig lebende und eigentlich wertlose Menschen, die der liebe Gott geschaffen hat, wie er neben den nützlichen Tieren auch Raubtiere geschaffen. Dieser Ausdruck, Herr von Sellhausen, ist der seinige, nicht der meinige, denn er liebte es, sich treffend und verständlich in guter alter deutscher Weise auszusprechen.
In den letzten zwanzig Jahren trat mehr und mehr eine Verkehrsstockung zwischen Ihrem Vater und ihm oder vielmehr zwischen jenem und seiner Frau ein. Aus welchem Grunde, das gehört nicht hierher. Genug, Frau Grete stand mit Ihrem Vater nicht auf bestem Fuße – sie ist eben eine seltsame Frau und hat wunderbare vorgefaßte Zu- und Abneigungen. Jedoch sahen sich die beiden Männer um so öfter bei mir, oft auch an anderen Orten, und nur selten betrat Birkenfeld Ihres Vaters Haus, was seine Frau nie erfahren durfte, wenn der gewohnte Frieden zwischen beiden erhalten bleiben sollte.
Vor sechs Jahren starb er ganz plötzlich und unerwartet, zum Schmerz für uns und seine Frau, der ewig dauern wird, und zur Freude der vornehmen Verwandten, die aber nur sehr kurze Zeit dauern sollte.«
»Wie so?« fragte Bodo, da der Meier eine kurze Pause eintreten ließ und dabei seinen Gast lächelnd ansah.
»Nun, sie glaubten alle, er habe ein Testament gemacht, und einem jeden von ihnen einige hundert Tausend Taler hinterlassen. Aber sie irrten sich. Wie gesagt, er starb plötzlich und ohne ein eigentliches Testament gemacht zu haben, worin er allerdings, wenn er es gemacht, manchem viel ausgesetzt hätte, denn auch er hegte eine Vorliebe für gewisse Leute. Genug, er hatte vor seinem Tode nur soviel Zeit, in Gegenwart zweier Zeugen, des Sachwalters Backhaus und meiner Person, seinen letzten Willen auszusprechen, und dieser lautete dahin, daß er seine Frau, die treue Gefährtin seines langen Lebens, zur Universalerbin ernenne und daß er von ihrem edlen, christlichen Herzen und ihrem Gerechtigkeitsgefühl erwarte, sie werde den besten Gebrauch von seinem Vermögen machen und einst, nach ihrer vollsten Einsicht, den Würdigsten zum Erben desselben einsetzen.
Da hatten nun der vornehme Herr, der seiner Frau Schwestertochter einst aus Spekulation geheiratet, und dessen Schwäger, die den guten Birkenfeld bei seinen Lebzeiten Onkel genannt und nur Honig für ihn im Munde gehabt, nichts, und die alte Tante Grete, die sie zu allen Teufeln wünschten, hatte alles. Ach! das gab ein Toben und ein Schimpfen, daß es in der ganzen Runde herum im donnernden Echo wiederhallte, aber was half es? Sie hatten nichts und die Grete hatte alles! Und in Wahrheit, niemand hätte dies große Vermögen mit größerer Sorgsamkeit und Umsicht verwalten können, als sie. Während ihres Besitzes hat es sich unglaublich vermehrt, denn sie hat kaum den zwanzigsten Teil der Zinsen verbraucht, und gespart und gespart, als ob sie zehn Kinder zu reichen Leuten zu machen habe. Wenn sie nun aber einmal stirbt, so können Sie sich den Spektakel denken, der dann losbricht. Weder sie, noch ihr Mann hat Verwandte am Leben, die das Vermögen beanspruchen könnten, und so beanspruchen es allein die lieben Vettern, vor allen die Grotenburgs, die die nächsten sind und die – weiß es Gott! ein hübsches Sümmchen gebrauchen könnten, um ihre leeren Kassen zu füllen. Doch still – ich vergesse, daß sie auch Ihre Verwandten sind.«
»O, genieren Sie sich nicht, die Wahrheit zu sprechen – aber sagen Sie mir, hat denn Frau Birkenfeld ein Testament gemacht?«
»So viel ich bis jetzt weiß, nein! Die alte schnurrige Dame, glaube ich, fürchtet sich vor dem Tode, der, wie man hier sagt, unmittelbar auf einen solchen Akt folgt.«
Bodo lächelte wieder und zündete sich eine neue Zigarre an, die er wiederholt zur Freude des Meiers lobte. »Dann muß der alte Birkenfeld,« sagte er nach einer Weile, »aber doch ein großes Vertrauen und eine ebenso große Liebe zu seiner Frau gehabt haben, wenn er ein so bedeutendes Vermögen allein in ihre Hände legte?«
»Ah, das soll wohl sein, Herr von Sellhausen. Gewiß hat er diese Liebe oder eigentlich Verehrung, wie auch das Vertrauen gehabt, obgleich die teuren Vettern seine Handlungsweise als die Folge einer großen Verblendung bezeichnen. Aber die beiden alten Leute haben immer in großer Eintracht gelebt, fast wie zwei Kinder, und wenn einmal in ihrem Leben Zwietracht ausgebrochen, wie das ja in allen Ehen wohl mal bei irgend einer Veranlassung geschieht, so hat Zeit, Überlegung und christlicher Sinn sie ausgeglichen und – und es ist gewiß keine Spur davon bis auf den heutigen Tag zurückgeblieben,« fügte der Meier langsamer hinzu, indem er die Augen wie beschämt niedersenkte, als sei er nicht ganz gewiß, ob er hiermit die volle Wahrheit sage.
»Wie lebt denn aber nun die alte Frau,« fragte Bodo mit neu gewecktem Anteil, »was tut sie mit dem großen Vermögen? Wendet sie es denn an, wie ihr Mann es von ihr erwartet hatte?«
»Nun,« erwiderte der Meier etwas zögernd, »wenn sie es auch nicht gerade genau in ihres Mannes Weise verwendet, so macht sie doch sicher einen edlen Gebrauch von einem Teil desselben. Sie läßt arme Kinder erziehen, kleidet und nährt sie; sie unterstützt bedürftige Lehrer, Witwen und Waisen. Auch wohltätige Anstalten bedenkt sie und tut überhaupt alles, was eine alte Frau in dieser Beziehung tun kann. Allein, sie hat eine ganz eigene Art, dies zu tun und überhaupt zu geben. Niemand darf erfahren, wem und wie viel sie ihm gegeben. Sie wägt mit haarscharfer Genauigkeit das Verdienst ab und während sie gute Menschen im Stillen belohnt, bestraft sie die schlechten Subjekte mit Verachtung und Spott – denn spöttisch kann sie sein wie kein anderer, weshalb sich auch viele ungeheuer vor ihr fürchten. Dabei gibt sie sich das Ansehen, als sei sie geizig und hart, was sie in der Tat nicht ist. Überhaupt zeigt sie sich gern kälter und herzloser als sie ist, aber es verursacht ihr große Freude, wenn sie jemanden, der es ihrer Überzeugung nach verdient, mit einer heimlichen Gabe erfreuen kann. Für sich selbst braucht sie am wenigsten: sie lebt einsam und fast zu sparsam; und stellt man sie darüber scherzhaft zur Rede, so wagt sie es jedermann geradezu ins Gesicht zu sagen: Mein Herr, was geht Sie das an? Glauben Sie, daß ich für mich eine vermögende Frau bin? Mit nichten. Allerdings habe ich ein großes Vermögen zu verwalten, aber verschleudern, wie so viele Hunderte und vielleicht auch Sie es tun, darf ich keinen Groschen.
Hier haben Sie die höchst einfache Geschichte dieser beiden alten Leute, und nun rate ich Ihnen, wie Ihr Vater es getan: besuchen Sie die alte Frau, wenn sie kommt, sie hat es – ja, ich sage es gerade heraus – um meinen Freund Sellhausen verdient, daß Sie ihr einige Aufmerksamkeit erweisen.«
Bodo saß eine Weile sinnend auf seinem Platze, als ließe er das Gehörte in seinem Geiste nachsummen. Dann stand er auf, tat ein paar Schritte in das Nebenzimmer und kam bald wieder daraus hervor, beinahe mit einer Miene, als beabsichtige er demnächst seinen Abschied zu nehmen.
»Nun,« fragte ihn der Meier, »Sie wollen doch nicht fort? Ich denke, Sie werden bei mir zu Abend speisen?«
»Nein, mein lieber Meier, das kann ich nicht. Sie wissen ja, ich will noch nach der Stadt. Indessen wollte ich Sie eigentlich jetzt noch nicht verlassen, ich habe vielmehr noch eine Bitte auszusprechen, um deren Erfüllung ich Sie freundlichst ersuchen möchte.«
»Eine Bitte? Oho! Nur frisch heraus, ich erfülle sie gern, wenn ich kann.«
»O, Sie können es leicht, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich sehe, Sie haben da einen Geldschrank, und der hat mich soeben zu meiner Bitte veranlaßt. Ich bin so töricht gewesen und habe mein Geld in Barem mit auf die Reise genommen, wo ich es doch unmöglich gebrauche, und schon jetzt fängt es mir an unbequem zu werden. Sehen Sie, da ist es!«
Bei diesen Worten zog er einen Geldbeutel aus der Tasche, der Goldstücke erklingen ließ, als er ihn auf den Tisch legte. Gleich darauf fuhr er zu reden fort, während der Meier sein Tun mit lächelndem Gesicht betrachtete:
»Beiläufig gesagt, es ist alles, was ich von meiner amtlichen Stellung übrig behalten und was ich mir also verdient; so bildet es denn auch einstweilen mein ganzes bares Vermögen. Wollen Sie es mir aufheben, bis ich wieder zurückkomme und es mir abhole?«
»Ganz gewiß will ich das – geben Sie her.«
Bodo händigte es ihm ein und glaubte, der Meier werde es sogleich forttragen und verschließen, aber dem war nicht so.
»Nun,« fragte Bodo, »was sehen Sie mich so an? Haben Sie sich anders besonnen?«
»Nein, mein lieber junger Freund,« erwiderte der Meier mit einer höchst bedächtigen, doch von innerem Wohlwollen strahlenden Miene, »das geht nicht so rasch, wie Sie es sich denken. Ich bin in meiner Art auch ein Geschäftsmann und gehe als solcher gern sicher zu Werke. Wir müssen doch wissen, wieviel Geld in der Börse ist, und ich muß Ihnen einen Schein darüber ausstellen.«
»Einen Schein? Herr Meier! Glauben Sie, daß ich Ihnen kein Vertrauen schenke?«
»Oho! Gewiß glaube ich das, und ich finde es auch sehr natürlich, da ich auch zu Ihnen Vertrauen habe, aber in Geldsachen, wissen Sie ja, hört die Gemütlichkeit auf. Haha! Ich für meine Person bin Ihnen sicher, wie Sie mir, aber ich könnte ja sterben, während Sie fort sind und dann würden meine Erben nicht wissen, daß das Geld Ihr Eigentum ist. Darum Vorsicht, mein Lieber, und nun – zählen wir.«
Bodo nahm die Sache wie sie lag, ging mit dem Meier in dessen Arbeitszimmer, trat an sein Bureau und schüttete die Börse auf dessen Platte aus. Die beiden Männer zählten nun jeder für sich eine Summe ab, und als sie damit fertig waren, addierten sie und fanden, daß es dreihundert und neun Pistolen waren.
»Lassen wir es eine runde Summe sein,« sagte Bodo, »also dreihundert; die übrigen neun werde ich mit auf die Reise nehmen. So.«
Der Meier rollte drei Röllchen, jedes zu hundert Stück, zusammen, versiegelte sie, schrieb darauf: Herrn Bodo von Sellhausens Eigentum, und schloß sie dann in den Geldschrank, alles mit einer Schnelligkeit, die bewies, wie bewandert er in dergleichen Dingen war. Darauf schrieb er zwei Zeilen auf ein Blatt Papier, daß er das Geld von seinem Gast empfangen, reichte es hin und sagte mit zufriedenem Lächeln:
»So, nun erst ist die Sache abgemacht. Ich habe mein Recht gehabt und Sie das Ihre.«
Er blieb einen Augenblick vor Bodo stehen, sah ihm noch einmal fest ins Gesicht und sagte dann nach einigem Besinnen, gleichsam sich selbst Mut einsprechend: »Gut, ja, ich will es versuchen. Nun,« fuhr er fort, seine Hand auf Bodos Schulter legend, »Sie haben mir eben Vertrauen bewiesen; und da man eine gute Sache nicht schnell genug erwidern kann, so will ich Ihnen auch gleich mein Vertrauen beweisen. Kommen Sie wieder da hinein – hier stört das Gelärme da draußen zu sehr, wenn man nicht daran gewöhnt ist – und dort plaudert es sich so gemütlich.«
Und nachdem er einen schnellen Blick durch das kleine Fenster in die Tenne geworfen, kehrte er mit dem Gaste wieder in seiner Tochter Zimmer zurück und beide nahmen nochmals ihre alten Plätze ein.
»Sehen Sie,« begann der Meier mit etwas zaghafter Stimme, nachdem er sich eine Weile gleichsam auf die passendsten Worte besonnen, »ich habe Ihnen schon vorher gesagt, daß ich eine Tochter habe. Sie ist beinahe zwanzig Jahre alt und mein ältestes Kind. Meine ganze Seele hängt an dem Mädchen, denn es ist brav, gut und das treue Abbild meiner einzigen Liebe, meiner verstorbenen Frau, die des Meiers zu Jerrendorf Tochter war. Ich habe das Kind nicht verzogen, wie Sie wohl glauben könnten, nein, aber ich habe sie lernen lassen, was Kinder lernen wollen und müssen, um mit Ehren und ohne auszugleiten oder anzustoßen durch die bald zu glatte, bald zu holperige Welt zu kommen. Bis zum zehnten Jahre war sie bei uns im Hause, denn so lange lebte mein gutes Weib; dann aber gab ich sie dem Pfarrer in Breitingen, wo auch Sie einst gewesen sind, aber es ist das nicht mehr, wie Sie wissen, der alte Herr, der Sie erzogen hat. Bei dem Pfarrer und seiner prächtigen jungen Frau hat meine Gertrud nun recht was Hübsches und Vielerlei gelernt, was die jungen Mädchen heutzutage zu lernen pflegen, und es ist vielleicht auch manches darunter, was eigentlich nicht für ein Mädchen vom Lande passend ist und wodurch sie etwas über ihre Sphäre hinausgerückt worden. Na, es mag immer hingehen, es gehört einmal dazu und die Welt kommt ihr selbst größer und schöner vor, wenn sie alles kennt, was darinnen vorgeht.«
Er hielt inne, als verschnaufe er sich ein wenig, denn er hatte ungewöhnlich rasch gesprochen, und daß es ihm aus dem Herzen kam, bewies seine Stimme, die leise dabei zu beben begonnen hatte.
»Gewiß,« nahm Bodo das Wort auf, da der Meier noch länger schwieg, als besinne er sich, wie er die Fortsetzung einleiten sollte, »ganz gewiß, man kann in der Welt nie zu viel lernen und kein Mensch weiß, wo und wie er das scheinbar überflüssig Gelernte noch einmal gebrauchen kann.«
»Nun, sehen Sie,« fuhr der Meier erleichtert aufatmend fort, »so betrachte ich es auch. Die Gertrud hat nun alles mögliche gelernt, sticken, nähen und alle die feinen Arbeiten der Damen, deren Namen ich nicht weiß, und dabei hat der wackere Pfarrer gewiß nicht ihren Geist vernachlässigt, noch weniger die vernünftige Pension in Detmold, wohin ich sie später zwei Jahre lang geschickt. Ich will mein eigen Kind nicht loben, aber mehr wie ich weiß es, so viel ist gewiß. Na, seitdem sie aus Detmold zurückgekehrt, hat sie teils bei mir, teils bei dem Pfarrer in Breitingen, dessen Frau sie zärtlichst liebt, zugebracht und erst seit vier Wochen ist sie ganz bei mir, um mir die Wirtschaft zu führen. – Sie werden sich wundern, warum ich Ihnen das sage,« unterbrach er sich, »aber geben Sie Acht, die Hauptsache kommt nun erst. Ja, die Gertrud hat nun eigentlich alles gelernt, was sie für ihre Zukunft gebraucht, aber Eins hat sie beim besten Willen doch nicht kennen gelernt und das ist gerade die Hauptsache für sie.«
Er schwieg und warf einen Blick voller Spannung, mit einer seltsamen Zaghaftigkeit gemischt, auf den jungen Mann an seiner Seite.
»Nun,« sagte dieser lächelnd, »was ist denn das? Ich kann es mir nicht denken.«
»Ha, ha! Das ist die Art und Weise, wie man, nicht einem großen, denn das versteht sie, sondern einem, wie soll ich sagen, einem feineren Haushalt vorsteht, verbunden mit dem Wissen einer guten Köchin, denn diese Künste muß ja doch eine gute Hausfrau am Schnürchen haben, nicht wahr?«
»Ei gewiß,« versetzte Bodo lächelnd, der nicht die geringste Ahnung hatte, wohin der Meier wollte und warum er so zaghaft war.
»Ah, also! Sie verstehen mich, nun, das freut mich. Ja, eine sogenannte feine Wirtschaft, die hat sie noch nicht gesehen, denn bei mir und dem Pfarrer, selbst in der Pension, herrschte mehr oder weniger das Hausbackene vor. Gertrud hat nun große Lust und Neigung, eine gute Köchin zu werden und sich die Manieren eines, ich will nicht sagen vornehmen – Gott behüte mich davor – doch eines geleckteren Hauswesens anzueignen – und, um das zu erreichen, habe ich so meine eigenen Gedanken gehabt.«
»Nur immer weiter, teilen Sie mir auch diese Gedanken mit!« bat Bodo, da der Meier wieder schwieg.
»Nun ja, ich teile sie Ihnen mit, darum belästige ich Sie ja mit dieser Angelegenheit. Ich habe also einen Gedanken darüber gehabt, aber für die Ausführung desselben hat sich, namentlich seit dem Tode Ihres Vaters, noch immer keine passende Gelegenheit finden wollen. Mit einem Worte, ich wollte mein Mädchen eine Zeitlang einen kleinen Kursus in einer solchen Wirtschaft durchmachen lassen, aber dazu bedurfte es eines Hauses, dem ich die Gertrud mit getrostem Mute anvertrauen kann. Es gibt nun zwar vornehme Häuser in der Nähe genug, wo lecker gekocht und fein angerichtet wird, aber alles das – mit einem Wort – paßte mir nicht, am wenigsten aber bei den Herren Baronen, die unsere nächsten Nachbarn und Bekannte sind.«
»Ach ja, das begreife ich,« sagte Bodo lebhafter als vorher, »und darin stimme ich Ihnen gewiß bei.«
»Nun also! Da habe ich aber ein feines und gutes Haus entdeckt,« fuhr er schmunzelnd fort, »und dahin gebe ich mein Kind getrosten Mutes – ja, und gern.«
»Was ist das für ein Haus?«
»Das ist das Ihre, Herr von Sellhausen.«
»Das meine? O, Sie täuschen sich wohl. Bei mir gibt es keine feine Küche, wir essen allein, wir haben wenig Besuch – und dann – und dann, offen gesagt, bin ich ja bis zum August nicht Herr in meinem Hause, wie Sie wohl wissen.«
»Ja, ja, das weiß ich recht gut, aber alles ist doch nicht so, wie Sie sagen, mein lieber Herr von Sellhausen. Sie werden nicht lange mehr allein sein, Sie werden Gesellschaft genug im Hause haben und – vor allen Dingen, mein lieber Freund, Sie haben ja meine alte Cousine, die Treuhold, bei sich und die allein bildet schon als Hausfrau und Oberaufseherin der Küche eine ganze Universität. Haha! Ja, ich habe auch schon früher mit ihr darüber gesprochen und die gute Seele hat mir willig ihren Beistand zugesagt – jetzt aber haben doch auch Sie darüber zu bestimmen. Und nun frage ich Sie, ob Sie gegen meinen Gedanken etwas einzuwenden haben, daß die Gertrud unserer Treuhold überwiesen wird?«
»Ei, mein lieber Meier, was sollte ich dagegen einzuwenden haben, wenn Sie und die Treuhold es zweckmäßig finden? Ich bitte Sie! Meine Bedenken habe ich Ihnen genannt und weiter habe ich keine. Kann mein Haus – ich wollte sagen, kann meines Vaters Haus Ihnen das Gewünschte gewähren, wohlan, tun Sie nach Belieben. So viel ich darüber zu sagen habe, steht Ihnen Alles daselbst zu Diensten.«
Der Meier machte ein überaus erfreutes Gesicht und sprach seine herzliche Dankbarkeit für Bodos Zusage aus. »Alles übrige wird sich schon finden,« sagte er schließlich, »nur möchte ich bald den Anfang machen. Darf ich also in diesen Tagen nach Sellhausen fahren und mit der Treuhold sprechen?«
»Ohne Frage, tun Sie ganz nach Belieben. Aber, wie gesagt, ich zweifle, ob Ihre Tochter finden wird, was sie daselbst sucht.«
»O, das lassen Sie Ihrer Wirtschafterin Sorge sein, der vertraue ich sie allein an. Ich weiß, wie die Tafel bei Ihrem Vater bestellt war, und das war der guten Alten alleiniges Werk. Wenn die Gertrud so viel vom Hauswesen und der Küche lernt, wie Jene weiß, dann mag sie zufrieden sein und ihre Lehrjahre für beendet halten. Aber wie – Sie machen jetzt wirklich Anstalt, um aufzubrechen? Ich habe Sie doch nicht mit meinem Geschwätz über die Gertrud gelangweilt?«
»Gott bewahre, lieber Meier, aber meine Zeit ist abgelaufen.«
»Gut, so will ich Ihr Pferd herbeiführen lassen.«
Er ging an das kleine Fenster, rief einem der Knechte einige Worte zu und gleich darauf kehrte er zu Bodo zurück, der schon Hut und Reitpeitsche in der Hand hielt.
»Mein lieber Meier,« sagte dieser, dem biederen Landwirt die Hand hinstreckend und die dargebotene Rechte herzlich drückend, »so habe ich denn unsre alte Bekanntschaft erneuert und damit nicht allein den Wunsch meines Vaters erfüllt, sondern auch meinem Herzen Genüge geleistet. Ich bin aber gewiß nicht das letzte Mal bei Ihnen gewesen und hoffe Sie nächstens und dann recht oft bei mir zu sehen. Gönnen Sie mir etwas von der Freundschaft, die Sie meinem Vater bewiesen, und seien Sie überzeugt, daß ich wirkliche und aufrichtige Freunde schätzen gelernt habe. Leben Sie wohl und Gott behüte Sie!«
»Leben Sie wohl, mein lieber Herr von Sellhausen!« erwiderte der Meier treuherzig und legte dabei, während er die Rechte des Gastes noch immer hielt, die linke Hand auf dessen Schulter, was seinem Benehmen etwas ungemein Trauliches und Herzliches verlieh. »Sie haben mir heute eine große Freude bereitet und ich habe einmal wieder, seit Ihres Vaters Tode zum ersten Mal, meine Seele frei plaudern können. Kommen Sie oft und gern wieder, darum bitte ich; mein Haus und mein Herz stehen immer für Sie offen, und daß dies eine Wahrheit ist, denke ich Ihnen noch beweisen zu können.«
Beide schüttelten sich noch einmal die Hand und traten nun in den großen Küchenraum hinaus, der eben leer und still war und wo vor dem großen Herde das Pferd Bodos stand, welches ein Knecht des Meiers am Zügel hielt.
Der Strahl der Sonne, die draußen wieder auf ihrem Abendwege am klar gewordenen Himmel thronte, fiel durch ein großes Fenster gerade auf das Pferd und beleuchtete es eben nicht zu seinem besonderen Vorteil. Der Meier hatte auch kaum einen Blick darauf geworfen, so stand er still, lächelte den Legationsrat an und sagte:
»Aber wie denn, wer hat diesen alten Braunen, den Ihr Vater vor Jahren von mir kaufte, zu Ihrem Reitpferd gestempelt?«
Bodo ließ durchaus keine beschämte Miene sehen, als er heiter antwortete: »Ich selbst, lieber Meier, es war noch das schmuckeste auf dem Hofe. Bedenken Sie, daß ich noch nicht ganz der Erbe von Sellhausen bin und daß ich mich einstweilen mit meinen Mitteln beschränken muß. Haha! Sie wissen ja, wie groß mein ganzes Privatvermögen in diesem Augenblick ist. Übrigens verrichtet der alte Braune seinen Dienst ganz gut, er hat seine Anhänglichkeit an Sie bewiesen und mich zuerst zu Ihnen getragen. Auch greift er tüchtig aus und ist willig – was will man von einem Tiere mehr? Die Menschen sind oft nicht so gefällig und man muß sie doch als Abkömmlinge »von Rasse« behandeln.«
Der Meier lachte herzlich und sagte: »Na, Sie wissen das Leben von der rechten Seite zu fassen – aber ein besseres Reitpferd könnten Sie sich doch wohl anschaffen. Was werden Ihre Herren Vettern dazu sagen? Sehen Sie mal da, solch einen Grauschimmel müssen Sie sich zulegen – wie gefallen Ihnen diese vier?
»O ja, das wäre recht hübsch, lieber Meier, und künftig kann es vielleicht geschehen. Ihre vier gleichfarbigen großen Hengste aber habe ich schon vorher bewundert – sie sind von der echten Sennerrasse, nicht wahr?«
»Gewiß, und ganz und gar eigne Zucht, weshalb ich auch stolz darauf bin. Nun, sie sollen auch einmal, wie ich hoffe, meine Gertrud in die Kirche zur Trauung fahren, und darum nennen sie meine Leute schon jetzt die Brauthengste. Nächstens werde ich sie Ihnen vorführen und Sie sollen Sie laufen sehen, es ist eine Freude, Herr. Ich glaube kaum, daß irgend ein Mann in unserer Gegend schnellere und bessere Tiere hat.«
Bodo nickte ihm seine Beistimmung zu und wollte sich eben zu seinem Pferde wenden, als er, in einer kurzen Pause des Kettengerassels um sich her, ein seltsames Geräusch vernahm, das von der andern Seite des Herrenhauses herüberdrang und dessen Ursprung er sich im ersten Augenblick nicht zu erklären vermochte. Er stand daher still, wandte das Ohr nach der Gegend des Hauses hin, woher das Geräusch kam, lauschte und sagte dann: »Was war das für ein seltsames Gesurre dort hinten?«
Der Meier lächelte, faßte seinen Gast unter den Arm und führte ihn der kleinen Treppe zu, die zu einem Zimmer emporstieg, aus dem das Geräusch sich hatte vernehmen lassen. »Kommen Sie,« sagte er, »und sehen Sie sich das Ding an. Es ist die Spinnstube, und meine Gertrud unterrichtet eben die Kinder meiner Colonen und Heuerlinge in unserer besten häuslichen Kunst. Da – steigen Sie nur hinauf, durch das kleine Fenster dort können Sie die ganze Schule überschauen.«
Bodo befolgte die Aufforderung und blickte nun durch ein kleines Fenster in ein großes weißgetünchtes Gemach, in welchem mehrere lange Bänke in weiteren Zwischenräumen hinter einander standen, die von einer Schar niedlicher, sechs- bis zwölfjähriger Mädchen besetzt waren, von denen jedes ein zierliches Spinnrad vor sich stehen hatte.
Es war ein wunderbar lieblicher Anblick, diese kleinen Mädchen bei so eifriger Arbeit zu sehen und weiter nichts wie das Gesumme und Gesurre zu hören, welches die wie im Wirbelwind herumschwirrenden Räder verursachten. Die kleinen gesunden und freundlichen Kindergesichter, fast alle von langen, wohlgekämmten, bald lockigen, bald schlichten, hellblonden Haaren umflossen, blickten ernst und emsig vor sich hin, als wären sie sich der Wichtigkeit ihres Fleißes bewußt. Die Kleider aller waren sauber und stimmten in Farbe und Schnitt fast vollkommen überein. Was aber das Eigentümlichste dabei war, sie machten alle zu gleicher Zeit dieselbe Bewegung, indem sie mit ihren kleinen Fingerchen den Faden geschickt aus dem Wocken zogen und zwischen den Fingerspitzen so fein wirbelten, wie die Füßchen in gleichem Takt das schnurrende Rad in Schwingung setzten.
Bodo blieb, von diesem Anblick überrascht, eine Weile stehen und konnte sich an den rotwangigen Kindergesichtern mit den blauen Augen nicht satt sehen, die alle unverwandt auf ihre Arbeit gerichtet waren, wenn sie nicht gelegentlich ein anderes Ziel verfolgten, nach dem alle, wie nach dem einzigen Hauptbrennpunkt ihrer Tätigkeit, von Zeit zu Zeit blickten.
Aber so interessant und lieblich dies Schauspiel und so hübsch die kleinen fleißigen Mädchen waren, jener allgemeine Brennpunkt mußte noch anziehender selbst für den älteren Mann sein, denn nachdem er seine Aufmerksamkeit erst einmal darauf gerichtet, war sie so leicht nicht wieder davon abzuleiten.
Etwas zur Rechten im Zimmer nämlich, dem Fenster nahe, stand ein erwachsenes junges Mädchen, das soeben von seinem Schemel aufgestanden war, wo es gesponnen hatte, wie alle übrigen, und sich nun niederbeugte, um einem der kleinen Mädchen irgend etwas bei seiner Arbeit zu zeigen oder zu helfen.
Dieses erwachsene junge Mädchen mußte die Lehrerin der Kleinen, also des Meiers Tochter, Gertrud, sein.
Sie war groß, schlank, kräftig und doch überaus zierlich gebaut und trug jene seltsame Tracht, die, schon von den Frauen Wittekinds angeblich getragen, sich bis auf die heutigen Tage erhalten, indessen mit der Zeit modernisiert hat, so daß sie nur noch halb ländlich und schon halb städtisch erscheint, namentlich bei den Töchtern der begüterten und gebildeten Meier, bei denen überdies der Stoff nicht mehr aus Wolle und grobem Drell, vielmehr aus der besten Seide und dem feinsten Linnen besteht.
Ist die Person schön und etwas hoch gewachsen, die sie trägt, bewegt sie sich rasch und anmutig, so kleidet diese Tracht außerordentlich gut, und gerade für die Gestalt, die wir hier vor Augen haben, schien sie eigens erfunden oder ausgesucht zu sein.
Gertrud trug ein schwarzseidenes Kleid, das am Halse halb ausgeschnitten war und eine Hand breit über den Fußknöcheln endigte. Vom Knie an war der weite Rock bis nach unten hin drei oder vier Mal mit breitem Sammetband besetzt und hing in ungemein zierlichen und reichen Falten von den vollen Hüften hernieder. Unter ihm sahen reizende Füßchen in ausgeschnittenen feinen Lederschuhen hervor, deren blitzendes Schwarz mit den schneeweißen Strümpfen darin einen bemerkenswerten Gegensatz bildete.
Der Schnitt der Taille des Kleides stimmte fast mit dem der modernsten städtischen Dame überein, aber sie war glatt und umschloß fest die herrliche Büste, ohne daß irgend ein fühlbarer oder unbequemer Zwang dabei sichtbar ward.
Über den Ausschnitt des Kleides fiel eine breite schneeweiße Halskrause von Mull, gesteift und getollt, bis zur Schulter herab. Um den blendenden Hals selbst trug sie eine Kette mächtiger und fast undurchsichtiger weißer Bernsteinperlen, die vorn durch ein großes massives Schloß von geschmackvoller Goldarbeit zusammengehalten wurde.
Der schmuckste und zugleich zierlichste Teil dieser Kleidung aber, der ihr den anmutigsten Reiz verlieh, war der Kopfputz, der sich auch hier noch ganz in seiner ursprünglichen Weise darstellte. Er bestand aus einem kleinen schwarzen Seidenkäppchen, reich gestickt und mit blitzenden Flittern besäet, welches nur den äußersten Teil des Hinterkopfes bedeckte und eine Fülle schwarzer breiter Seidenbänder bis weit über die Taille herabfallen ließ. Die üppigen, tiefblonden, fast kastanienbraun schimmernden Haare lagen zu beiden Seiten der Stirn glatt gescheitelt an, hinten aber hingen sie in zahllosen dichten Flechten bis tief in den Nacken unter dem Käppchen herab, das sie mit seinen schweren Bändern leicht zu tragen schienen.
Der heimliche Beobachter dieser Gestalt konnte, da sie ihm zur Seite stand und dabei halb den Rücken zudrehte, das Gesicht derselben nur im Profil sehen. Nur einmal auf kurze Zeit, während sie sich anmutig niederbeugte und ein kleines Mädchen in irgend einer Verrichtung unterwies, gewann er den beinahe vollen Anblick ihres Gesichts, aber es war dies nur ein so flüchtiger Moment, daß er die Züge desselben nicht genauer entziffern, noch viel weniger seinem Gedächtnis einprägen konnte. Allein schon das Profil war anziehend genug, um seine Blicke länger zu fesseln, als er selber wußte, und unbestreitbar erlangten die feine edle Nase, die runde warm angehauchte Wange, das kleine Ohr und der blendende Hals mit seiner über alles anmutigen Biegung seinen vollen Beifall, wobei er sich eingestand, daß, so groß die Verschiedenheit zwischen diesem zarten Wesen und der athletischen Gestalt und dem kräftigen, männlichen Gesichtsausdruck des Meiers war, doch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Beider Zügen stattfand. Zuletzt blieb sein Auge aber auf der kleinen zierlichen Hand haften, welche die Finger des jüngsten Zöglings sanft leitete, und Bodo, obwohl er gewiß viele vornehme und schöne Damen gesehen, mußte bekennen, daß er eine solche wohlgeformte, weiße und zierliche Hand lange nicht betrachtet hatte, ein Erbteil der aus altsächsischem Blut stammenden Frauen, die freilich, selbst auf dem Lande, selten eine schwere Handarbeit verrichten, da sie sich hauptsächlich mit Spinnen und Weben beschäftigen.
Bodo, nachdem er das schöne Ebenmaß dieser Glieder und ihre graziösen Bewegungen, die gewiß in diesem Augenblick die natürlichsten waren, lange genug gemustert und sich an dem liebevollen Wesen gegen die Kinder erfreut hatte, stieß, als er sich endlich umwandte, einen seufzerartigen Laut, sei es der Überraschung, sei es der inneren Befriedigung aus und bewegte sich dann dem Meier zu, der erwartungsvoll und seinen jungen Freund im stillen beobachtend, ruhig am Fuße der Treppe stehen geblieben war.
»Ah, mein lieber Meier,« sagte er leise, als besorge er, die Lehrerin da drinnen möchte von seinen Worten in ihrem Unterricht unterbrochen werden, »das ist also Ihre Tochter! Ja, sie sieht Ihnen ähnlich, so viel ich wahrnehmen konnte, aber warum trägt sie, die eine städtische Erziehung genossen, noch immer das ländliche Kleid? Das habe ich mir nicht gedacht, und darum war mir der Anblick doppelt neu.«
»Ja, mein lieber Herr von Sellhausen,« erwiderte der Meier freundlich, »darüber mag sich ein Mann aus der großen Welt, wie Sie, mit Recht wundern, allein es läßt sich auch manches dafür sagen. Wenn Gertrud in die Stadt geht, mit mir eine Reise unternimmt oder irgendwo ihre Freundinnen besucht, legt sie so wenig die ländlichen Kleider an, wie ich meine Wasserstiefel und meinen bequemen Hofkittel. Aber hier, auf dem Hofe, inmitten einer rein ländlichen Bevölkerung, ist das doch etwas ganz anderes. Die Leute haben einmal vor der üblichen Tracht ihrer Altvordern Respekt und lieben sie, und das muß man wohl billigen, und selbst meine Tochter, wenn sie sich unter ihnen darin hin- und herbewegt, genießt augenscheinlich mehr Achtung und Ansehen. Die Bauern lieben einmal nicht, großstädtisch geputzte Damen unter sich zu sehen, und was diese ihnen sagen und raten, hat nicht den halben Wert, als wenn es ein Weib tut, das sie schon dem Äußern nach als Ihresgleichen erkennen.«
Bodo war während dieser Erklärung ganz still geworden, stimmte ihr aber vollkommen bei, da er sie sehr natürlich fand. Er reichte dem Meier nur noch einmal die Hand und stieg dann auf seinen Braunen, der stolz auf seine ältere Würde ruhig zwischen den neugierig ihn anstarrenden Rassepferden des Meiers dahinschritt. Dieser ging neben dem Reiter bis zum Ausgang der Tenne her und begleitete ihn noch bis auf die Landstraße, wo endlich das letzte Lebewohl gesprochen wurde, Bodo dem Pferde die Zügel frei ließ und in raschem Trabe seinem noch fernen Ziele entgegenflog.
![]()