
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
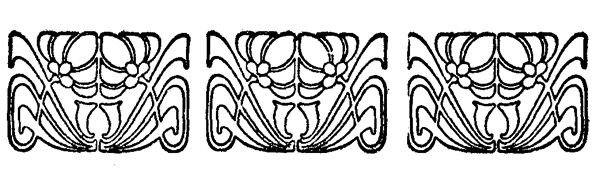
Wie wir schon wissen, war Bodo von Sellhausen seit seiner frühesten Jugend nur selten und stets nur auf kurze Zeit auf dem väterlichen Gute gewesen, es war also natürlich, daß er sich demselben einigermaßen entwachsen fühlen, viel natürlicher aber noch, daß sein Wesen und Charakter den Bewohnern und Nachbarn desselben ziemlich unbekannt geblieben sein mußte. Seitdem er jedoch in Griechenland gelebt, hatte er die Heimat gar nicht wiedergesehen und schon dadurch, daß er allmählich eine höhere amtliche Stellung eingenommen, war – gewiß ohne seine Schuld – eine sowohl innere wie äußere Entfremdung zwischen ihm und den dort Wohnenden eingetreten.
Was zunächst die benachbarten Freunde und Verwandten des alten Herrn von Sellhausen betrifft, so gehörten dieselben größtenteils jener Art von Leuten an, die sich immer gern mehr um andere Menschen Angelegenheiten, als um ihre eigenen bekümmern, daher war es kein Wunder, daß der so lange abwesende Sohn und Erbe des gastlichen Gutsherrn schon oft genug ihre Aufmerksamkeit erregt und ihre Neugierde in Spannung versetzt hatte, womit ohne Zweifel eine Kritik des Abwesenden verbunden ward, die eben nicht die liebreichste war.
Namentlich die umwohnenden Junker – von denen wir die interessanteste Gruppe noch kennen lernen werden – konnten ihm vor allen Dingen nicht verzeihen, daß er außer Landes gegangen, in den Dienst einer fremden Macht getreten war und sich unter der Ägide derselben zu einer Stellung emporgeschwungen, wie sie niemals einer der Ihrigen erreicht hatte. Derartige Neigungen und Bestrebungen mußte, ihrer Meinung nach, kein unter ihnen geborener Landedelmann haben, er gehörte auf sein Gut, unter seine Pferde, Kühe und Schafe, er mußte frei bleiben von allen äußeren Einflüssen und sich mit dem begnügen, was ihm der liebe Gott zwischen seinen vier Pfählen beschieden.
Sodann waren ihnen der höhere Grad der Bildung, sein Wissen, seine Kenntnisse von jeher ein Dorn im Auge gewesen, eine Bildung, die sie ebenfalls nur aus den Lobpreisungen »beschränkter Menschen« kannten und die ein Landedelmann von echtem Schrot und Korn nun und nimmer zu besitzen braucht. » Der bildet sich viel auf sein bißchen Weisheit ein,« pflegten sie bei jeder Gelegenheit zu sagen, »und er sollte doch nie vergessen, daß er seines Vaters Sohn ist, der nichts zu wissen braucht und darum doch und darum erst recht als ritterlicher Herr leben und sterben kann, wie wir.«
Daß er sie ferner nie aufgesucht, wenn er einmal nach Hause gekommen, daß er ihnen sogar überall aus dem Weg gegangen, wenn er mit ihnen hätte zusammentreffen können, legten sie ihm als einen dummen Stolz aus, den er bei den albernen Engländern, den verkommenen Griechen oder Gott weiß sonst wo aufgeschnappt; er solle nur erst auf längere Zeit nach Hause zurückkehren, dann würden sie ihm schon die ausländischen Manieren abgewöhnen und ihm zeigen, was bei ihnen feine Sitte sei.
Dergleichen kavaliermäßige Redensarten konnte man jeden Tag und überall in der Runde von Sellhausen hören, nur drückte man sie in einzelnen Familien noch viel »verständlicher« aus. Mochte man jedoch sagen, was man wollte, ein gewisser Neid ging wie ein gelber Faden durch alle diese Gespräche hindurch, der Neid gegen den »abtrünnigen Landessohn«: nicht allein ein bedeutendes Stück von der Welt gesehen und in der großen Welt gelebt, sondern auch eine Rolle darin mitgespielt zu haben, ein Vorzug, den bekanntlich Leute von einem gewissen Schlage ewig zu bespötteln, aber niemals zu verzeihen geneigt sind.
Viel weniger lieblos bekrittelt und grundlos gescholten wurde Bodo von den Bewohnern seines einsamen väterlichen Gutes; unter diesen gab es sogar zwei, die ihm, solange sie ihn kannten, mit warmem Herzen zugetan waren und ihn auch jetzt gegen jene ungerechten Beschuldigungen nach Kräften in Schutz nahmen.
Diese Personen waren der Verwalter und die Oberwirtschafterin, welche letztere uns noch so sehr oft in diesen Blättern begegnen wird; wir müssen aber auch auf den ersteren einen kurzen Blick der Betrachtung fallen lassen.
Herr Hinz war schon seit fünfzehn Jahren Verwalter bei Herrn von Sellhausen gewesen und hatte sich in dieser Zeit als ein überaus treuer und gewissenhafter Mann bewiesen, dem die Interessen des Gutsherrn warm am Herzen lagen. Er stand in den Vierzigen, war ein umsichtiger und dabei bescheidener, stiller Mensch und wusste in allen Winkeln zu schalten und zu walten, ohne sich im geringsten das Ansehen zu geben, als sei er es vorzugsweise, der die Maschinerie in Ordnung halte, die das ganze äußere Hauswesen in Bewegung setzte.
Eine noch bevorzugtere Stellung auf dem Hofe und im Hause, als er, hatte von jeher die Oberwirtschafterin, Fräulein Treuhold, auf Sellhausen eingenommen, auch war sie schon länger in der Familie und hatte dem alternden Gutsherrn in mancher trüben Stunde mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Sie war eine Verwandte des schon genannten Meiers zu Allerdissen und von diesem dem Freunde als zuverlässig und »treu wie Gold« empfohlen worden, was derselbe auch in allen Punkten länger als zwanzig Jahre hindurch bestätigt gefunden. Jetzt war sie ein fast sechzigjähriges Fräulein von jener angenehmen Bildung, die in den Formen des geselligen Lebens sehr gut Bescheid wußte, so daß sie mit ebensoviel Anstand wie Geschick die Honneurs des Hauses machen konnte, mochte zu Gaste kommen wer wollte.
Auch ihre äußere Erscheinung war stattlich und würdevoll: man sah ihr an, daß sie sich wohlgepflegt, und daß die kleinen Sorgen des Lebens weder ihrer Gesundheit, noch ihrem rührigen Tun und Treiben irgend einen merklichen Abbruch getan hatten.
Von Gemüt war sie das sanfteste und bescheidenste Wesen der Welt. Ihr Geist, keineswegs auf das Hauswesen allein beschränkt, hatte sich weit über die Grenzen ihrer Pflichterfüllung hinausbewegt, und so war sie wohl geeignet gewesen, die Gefährtin und Freundin des entschlafenen Herrn zu sein, dessen Vertrauen sie in jeder Richtung besessen hatte. Vor allen Dingen aber zeichnete sie eine treue Anhänglichkeit an die Familie aus, deren Brot sie nun schon so lange aß, und sie wäre gewiß die letzte gewesen, die auch nur den kleinsten Stein auf das Haupt des abwesenden Erben hätte fallen lassen, selbst wenn sich eine Gelegenheit dazu geboten hätte.
Sie hatte Bodo zum ersten Mal als zehnjährigen Knaben gesehen, zu einer Zeit, als er noch Zögling des jetzt verstorbenen Landgeistlichen war; und schon damals hatte sie den mutterlosen Knaben mit seinen braunen langwogenden Locken, der so fröhlich und unbewußt, was ihm das Leben bieten würde, aus dem väterlichen Hause schritt, liebgewonnen. Diese Zuneigung hatten die späteren Jahre nicht zerstört, im Gegenteil, sie war gewachsen, denn Bodo begegnete ihr stets mit herzlicher Teilnahme, mit wohlwollender Aufmerksamkeit, so oft er ihr nahe kam, und nur in den letzten Jahren, seitdem sie den Herrn Legationsrat nicht gesehen, war ihre Neigung mit einer gewissen Besorgnis verschwistert: ob der junge Herr – wie er noch immer genannt wurde – auch wohl noch ihrer eingedenk sein werde, ihrer, die doch so wenig würdig sei, von einem so vornehmen Herrn, der nur mit Fürsten und Ministern verkehre, der fast »die ganze Welt« gesehen und so viele Erfahrungen gesammelt, beachtet zu werden.
Und nun, nun war er mit einemmal Herr des ganzen großen Gutes und aller Besitztümer seines guten Vaters geworden! Ob ihm das nicht stolz und kalt gegen sie machen würde? Diese Besorgnis ängstigte sie mehr, als sie eingestehen mochte, und fast keine Nacht verging, ohne daß sie sich die Reden einstudierte, die sie ihm halten wollte, wenn er zurückkehrte, um ihn nur ja nicht auf irgend eine Weise zu verletzen und ein Lächeln von seinem Munde zu erobern, das ihm schon in der Jugend so schön gestanden, zumal er meist ernst gewesen und still vor sich hin gelebt hatte.
Ähnliche Gedanken beschäftigten sie seit dem Begräbnis des alten Herrn fast jede Stunde. Sie zählte wohl zehnmal täglich die Tage, die der Legationsrat zur Reise in die Heimat gebrauchen könnte, denn daß er bald kommen würde, hatte sie bereits aus den Zeitungen erfahren, die sie sehr eifrig las, und in welchen die gewünschte Entlassung desselben und seine demnächstige Rückkehr nach Deutschland angezeigt war. Da er aber gewiß über M... nach Hause kam, um dort erst seine dienstlichen Obliegenheiten zu beseitigen, so kannte sie den Tag seines Eintreffens nicht, und so erwartete sie ihn schon, bevor er noch kommen konnte, täglich, je mehr der Dezember seinem Ende entgegenging, und je tiefer der Schnee Land, Hof und Haus unter seine weiße Decke begrub.
*
Der Dezember schritt immer weiter vor. Schon war das Weihnachtsfest – das traurigste, was man je auf Sellhausen begangen – vorüber, und das neue Jahr kam näher und näher, und immer noch nicht war der junge Herr gekommen, um den Hausbewohnern die Spannung ihres Herzens zu benehmen und frisches Leben in das totstille Haus zu tragen.
Es war ein Sonntag, der gerade zwei Tage vor den Schluß des Jahres fiel, und dabei recht bitter kalt, obgleich die Wintersonne klar und fröhlich vom Himmel schien. Vormittags waren fast alle Hausbewohner, Fräulein Treuhold mit eingerechnet, in der nächsten Dorfkirche zum Gottesdienste gewesen, nachmittags war der Verwalter in die Stadt geritten, und die Knechte hatten ihre Bekannten in der Nachbarschaft aufgesucht. Nur zwei Mägde saßen unten in der Küche am warmen Herde und spannen, eine Arbeit, die man auf Sellhausen selbst Sonntags zu verrichten für keine Sünde hielt. So war es überall still, und ein wahrer Trauergeist schien auf Haus und Hof zu ruhen.
Fräulein Treuhold saß allein in ihrer Stube, die dicht neben dem Hausflur im unteren Stockwerke gelegen war, und die Aussicht über den langen öden Hof bot. Es war ein mit Bildern und Teppichen, hübschen Möbeln und bequemem Sofa freundlich geschmücktes Stübchen und dabei gemütlich warm, denn die Bewohnerin hatte noch soeben frische Kohlen auf den Rost des glänzend polierten eisernen Ofens geworfen.
Auf dem ovalen Tische vor dem Sofa brodelte über Kohlen der Kaffee in einer Kanne von Britanniametall, soeben von einer der Mägde hereingebracht, und eine Tasse, noch unangerührt, stand auf dem kleinen Tische am Fenster, vor dem in einem glänzenden Sessel die alte Hausdame saß und an einem wollenen Strumpfe strickte.
Wie es die Trauerzeit erheischte, war sie ganz schwarz gekleidet, und das lange schwerwollene Kleid und die düstere Tüllhaube standen dem vollen, noch immer frischen Gesicht nicht übel, welches von einem dichten Lockengeringel silberschimmernder Haare eingefaßt war. Daß die alte Dame, obgleich wohlbeleibt, doch so rüstig und schnell in der Wirtschaft und beim Gehen und Treppensteigen sein konnte, sah man ihr in diesem Augenblick gewiß nicht an. Nachlässig in ihren Stuhl zurückgelehnt, bewegte sie nur mechanisch und langsam die metallenen Nadeln; ihr Geist war keineswegs mit der Arbeit beschäftigt, die sie in den Händen hielt, und ihr Auge schaute trübsinnig ins Freie hinaus, wo nichts sich regte, denn der zugefrorene Teich war von seinen geflügelten Bewohnern verlassen, und selbst die beiden großen Hofhunde in der Mitte des großen Raumes waren vor Frost bebend in ihre warmen Hütten gekrochen. Nur die schönen weißen Tauben flogen unruhig hin und her, pickten hier und da ein entfallenes Körnchen auf und schwangen sich dann mit laut klatschenden Flügeln in die Luft, um weit über die Felder hin einen lustigen Ausflug zu unternehmen und sich so den langweiligen Winternachmittag nach bestem Vermögen zu vertreiben.
Unaufhaltsam rückte die Zeit vor und allmählich ging das grelle Licht des Tages in linde abendliche Dämmerung über. Aber die alte Dame bemerkte es nicht, sie seufzte nur dann und wann leise auf und fing von Zeit zu Zeit wieder rascher zu stricken an. Ihre Gedanken schweiften in alte Zeiten zurück und kehrten zur Gegenwart wieder, je nachdem sie bald an den gestorbenen Vater, bald an den lebenden Sohn und vielleicht auch an etwas anderes dachte, was, ihr selbst nicht recht klar bewußt, wohl zwischen beiden lag.
»Ja,« sagte sie endlich halblaut zu sich, »wenn er noch lebte, dann würde es heute hier nicht so still und traurig sein, dann würden wir das Haus voller Gäste haben und ich mich vor Arbeit und Hast nicht lassen können. Doch nein, es sollte nicht sein, Gott hat es so gewollt, und man muß damit zufrieden sein? Aber der junge Herr – ach! wo er nur bleibt? ob er wohl schon in M... gewesen sein mag? Doch gewiß – er ist uns am Ende schon ganz nahe – mein Gott, wie erschreckt mich der Gedanke, trotzdem er so angenehm ist! Wenn er nur heute nicht kommt, wo ich ganz allein bin! Und die Zimmer oben sind nicht geheizt – gestern freilich waren sie es – nur die kleinen Stuben, die der junge Herr immer am liebsten wegen der schönen Aussicht bewohnte, sind warm – ha, wie bewegt mich die Vorstellung, daß er nun so plötzlich kommen könnte! Na, die Angst will ich nicht noch einmal ausstehen; morgen soll das ganze Haus von oben bis unten warm sein, denn es wäre doch niederschlagend, wenn er in die großen Zimmer gehen wollte und sie so eisig fände! – Aber nein, er wird nicht kommen,« fuhr sie, still vor sich hin lächelnd, fort, »ich glaube immer noch, daß er vorher schreibt. O, wie begierig bin ich, ihn zu sehen, nachdem er beinahe vier Jahre nicht hier gewesen ist! Wenn er nur nicht zu vornehm und schweigsam ist – denn still war er fast immer, besonders wenn er mit seinen großen dunklen Augen –«
Da unterbrach sie ein Geräusch, das sie bis in das Mark vor Schreck erbeben ließ. Die beiden großen Hunde sprangen plötzlich wütend und zu gleicher Zeit aus ihren Hütten und stürzten, so weit ihre Ketten reichten, nach dem fernen Hoftor hin, indem sie ein furchtbares Geheul ausstießen. Dann waren sie wieder einen Augenblick still und horchten mit gesträubtem Haar und gespitzten Ohren in dieselbe Richtung.
Fräulein Treuhold fuhr von ihrem Sitze empor, riß einen Fensterflügel auf und lauschte mit angehaltenem Atem hinaus. Da war es ihr, als ob sie in der eben eingetretenen Pause ein fernes Schellengeläute vernähme, das sich rasch dem Hoftor näherte.
»Mein Gott!« rief sie. – »Ein Schlitten – ha, da ist er schon – eben fährt er in das Tor – und so wahr ich lebe, ein Herr sitzt darin – ohne Diener aber – sollte er es sein?«
Sie sollte nicht lange in Zweifel bleiben. Ein einfacher Schlitten, ohne Prunk und Zier, von zwei mageren Pferden aus der nächsten Stadt gezogen, die sie zu kennen glaubte, kam rasch mit weithin tönendem Geläute auf den Hof gefahren, nun erst recht von den wachsamen Hunden begrüßt. Hinter dem Kutscher, halb in einen weiten Biberpelz vergraben, saß ein einzelner Herr, der mit neugierig vorgestrecktem Kopfe ringsum schaute, als wolle er irgend einen Bekannten auf dem leeren Gehöft ausfindig machen.
Schnell kam der Schlitten näher, schon hatte er den Teich hinter sich gelassen, und gleich darauf fuhr er mit lautem Peitschenknall die glatte Rampe herauf – und richtig, der so lange erwartete, jetzt beinahe mit Besorgnis erblickte Erbe war es in der Tat.
»Mein Gott, mein Gott!« rief die alte Dame, das Fenster zuschlagend und halb bewußtlos in ihren Stuhl sinkend, als versagten ihre zitternden Kniee den Dienst. »Und nun bin ich ganz allein – meine Schlüssel – wo sind sie nur gleich – ach! muß mir denn heute alles verkehrt gehen!«
Aber gleich darauf hatte sie sich gefaßt. Mit einer fast leidenschaftlichen Heftigkeit riß sie sich aus ihrer halben Betäubung empor und sprang dann wie ein junges Weib dem soeben aus dem Schlitten gestiegenen Gaste entgegen.
Als sie die Haustür mit bebenden Händen geöffnet und ganz bleich vor Schreck auf die Außentreppe trat, fuhr sie zurück, denn in demselben Augenblick schritt ihr der Sohn ihres verstorbenen Herrn entgegen, streckte ihr, mit leuchtenden Augen ihre ganze Gestalt überfliegend, beide Hände entgegen und rief:
»Meine liebe Treuhold! Da bin ich, ja, ja! Aber wie, ich habe Sie wohl gar erschreckt?«
»Gnädigster Herr!« stammelte sie, seine Hände erfassend und den Zögernden in den wärmeren Flur ziehend, »ja, ich bin so erschrocken, daß ich Sie nicht anders empfangen kann – denn ich bin ganz allein – alle andern sind fort und – ich habe Sie gewiß nicht so unangemeldet erwartet.«
»Das tut nichts, meine Liebe,« erwiderte er rasch. »Aber gehen Sie hinein, es ist kalt, und ich komme gleich.«
Und nun trat er noch einmal zurück und gab dem Kutscher Geld und einige Anweisungen, der dann einen kleinen Koffer einer soeben herbeigeeilten Magd überreichte und darauf sein Gefährt bestieg und wieder langsam den Rückweg antrat.
Unterdessen war das alte Fräulein in die warme Stube zurückgetreten, die Hände ringend und das verlegene Gesicht von glühendem Rot übergossen, denn das vorher zum Herzen getriebene und da festgehaltene Blut strömte jetzt ungestüm wieder in den Kopf zurück. Gleich nach ihr trat auch der Legationsrat ein, reichte ihr noch einmal die Hände und sagte:
»Ja, ich komme unangemeldet, meine liebe alte Freundin, aber ich liebe es nicht, meinetwegen viele Umstände machen zu lassen, und so kam ich, so rasch ich konnte.«
»Aber ohne alles Gepäck und ohne Diener?« fragte die zitternde Dame halblaut, als ob sie zu sich selber spräche.
»O, ich brauche keine Diener bei meiner Rückkehr, hier gibt es dienstbare Hände genug, und meine Sachen kommen nach – was ich augenblicklich gebrauche, habe ich bei mir.«
»Aber, mein Gott, nun sind die Zimmer oben nicht geheizt!« rief sie, ihm dienstfertig den Pelz ausziehen helfend, den er eben ablegte, und nun stand er vor ihr in einem fest zugeknöpften Reiserock und schaute sie wirklich mit seinen großen dunklen Augen lächelnd an, wie sie es vorher gedacht.
Er war ein großer, mehr schlanker als wohlbeleibter Mann mit dunklem, starken Haar, leuchtenden Augen und einer mattbleichen, doch gesunden und von der Sonne des Südens leicht gebräunten Gesichtsfarbe, die durch einen vollen Backen- und Schnurrbart von glänzendem Tiefbraun mehr belebt als beeinträchtigt wurde. In seinem freundlichen Blick, dem warmen Herzenston, mit dem er sprach, und überhaupt in der ganzen Art und Weise, wie er seine wenigen Worte kundgab und sich dabei ruhig und fast unhörbar bewegte, lag eine gewisse siegreiche Geistesgewalt, die sich auf der Stelle fühlbar machte und doch zum Herzen sprach, wie sie auch sogleich ihre Wirkung auf die alte Dame übte, zumal durchaus nichts Gekünsteltes, absichtlich Vornehmes damit verbunden war. So stand sie denn auch jetzt und sah ihn fast erstaunt an. Sie schien in seinen wohlwollenden Zügen irgend eine Ähnlichkeit mit seinem Vater zu suchen, aber noch nie wie in diesem Augenblick war ihr aufgefallen, daß Bodo von Sellhausen seinem Vater fast in keiner Weise glich.
Indessen, er ließ ihr nicht lange Zeit, diese Betrachtungen weiter zu verfolgen. Er hielt noch immer eine ihrer Hände gefaßt, zog sie mit leiser, aber unwiderstehlicher Gewalt in das Sofa und sah sie dann lange sprachlos vom Kopfe bis zu den Füßen an, als wollte er die alte Bekannte in jedem Zuge wiederfinden.
»Meine gute alte Treuhold,« sagte er warm, »ja, da bin ich. Und wenn auch die Zimmer oben nicht geheizt sind – das schadet nichts – hier bei Ihnen ist es so behaglich warm und freundlich, daß ich mich gern den Abend über hier aufhalten werde, wenn Sie es erlauben, und für die Nacht wird doch mein altes Zimmer in Ordnung zu bringen sein.«
»O, das ist schon lange in bester Ordnung, gnädigster Herr – Gott sei Dank!«
»Nun, warum denn so atemlos, Liebe? dann ist ja alles gut und – Sie werden mich doch auch ferner wohnen lassen, wo ich immer so gern gewohnt? Doch lassen wir das jetzt, wir haben Wichtigeres zu sprechen – zuerst das Allerwichtigste – also – mein guter Vater ist tot?«
Er sprach das mit einem herzlichen innigen Tone, der der alten Dame sogleich die Tränen in die Augen lockte. So ergreifend und gefühlvoll hatte sie sich die ersten begrüßenden Worte des Erben doch nicht vorgestellt und ihre ganze Seele flog dem so unerwartet Zurückgekehrten gleichsam mit Sturmeseile entgegen.
»Ja,« sagte sie schluchzend – »Ihr guter Vater ist tot – und er hat nicht mehr das Glück gehabt, Sie so frisch und gesund in der Heimat zu sehen, wonach er in den letzten Monaten sich so herzlich gesehnt.«
Der Legationsrat senkte die Augen und beschattete sie eine Weile mit der Hand. Sie waren feucht geworden und er mußte sich große Gewalt antun, die jählings ausbrechende Rührung zu unterdrücken. Aber sich rasch zusammennehmend, legte er seine rechte Hand leise auf die Schulter der alten Dame und sagte mit weichem Tone: »Sprechen Sie alles aus, was über diesen Punkt gesagt werden muß. Erzählen Sie mir von meinem Vater, von seiner Krankheit, – seinem Tode und was alles dabei vorgefallen ist.«
Bei Gelegenheiten, wie die vorliegende, mangelt es alten Damen selten an einer Fülle heißer Zähren, und auch hier dauerte es etwas lange, bis Fräulein Treuhold sich fassen und im Zusammenhange die Vorfälle der letzten Monate erzählen konnte. Dann aber tat sie es mit einer Umständlichkeit, die nichts zu wünschen übrig ließ, und alle Einzelheiten berichtete sie der Reihe nach, wie ihr gutes Gedächtnis sie treulich aufbewahrt.
Bodo hörte sie schweigend, aufmerksam und von der innigsten Teilnahme ergriffen an. Selbst als sie fertig war, schwieg er noch immer und hielt den Kopf auf die Hand gestützt, während er den Arm auf die Kissen des Sofas gelehnt hatte. Er mochte mit seinen innersten Gedanken beschäftigt sein und nur mit Mühe seinen Schmerz bekämpfen. Nach geraumer Zeit aber tat er wieder einige Fragen, die seine alte Freundin stets rasch und mit der größten Bereitwilligkeit beantwortete.
Darüber war eine ziemlich lange Zeit vergangen und in dem Zimmer war es noch dunkler als draußen geworden, was die Redenden kaum zu beachten schienen. Beide sprachen eben einen Augenblick lang nicht, als die Tür aufging und eine Magd den Kopf durch den Spalt steckte und fragte, ob sie kein Licht bringen solle.
»Ja, ja,« rief das Fräulein, »gewiß Licht – aber warte – und was sonst noch, Herr Legationsrat?«
Bodo von Sellhausen stand von seinem Platze auf und stellte sich an den Ofen. »Wenn Sie eine Tasse Kaffee haben,« sagte er fast bescheiden, »so geben Sie sie mir.«
»Gleich, gleich, Herr!« und »Entschuldigen Sie einen Augenblick!« rufend, war sie rasch zur Tür hinausgeschlüpft, um draußen der wartenden Magd schnell einige Befehle zu geben. Aber sie versprach oder widersprach sich dabei oft, so daß die Magd aus der sonst so ruhigen Dame kaum klug werden konnte.
Der Grund dieser Zerstreutheit war ein ganz besonderer, und um ganz treu in unsern Berichten zu sein, wollen wir ihn wenigstens andeuten.
Wir haben schon gesagt, daß Fräulein Treuhold das Gesicht ihres jetzigen Herrn mit scharfem weiblichen Auge durchforscht und in Wahrheit nicht darin gefunden hatte, was sie zu finden erwartet. »Er sieht mir ganz anders aus als sonst,« sagte sie sich wiederholt im Stillen, »oder kommt das vielleicht daher, daß ich mir ihn noch nie so genau angesehen habe? Gewiß, er ist viel männlicher und noch viel ruhiger geworden, als er früher war. Aber seinem Vater sieht er gar nicht mehr ähnlich und doch – doch ist etwas Bekanntes in diesem Gesicht, was mich an – o, an wen, an wen doch erinnert? – Nein, nein, ich kann es nicht finden, jetzt nicht, aber das ist ja auch nicht nötig, ein andermal wird es sich schon erklären. – Aber Rieke, ich bitte dich,« wandte sie sich plötzlich zu der in der Küche hin- und herfahrenden Magd, die vor lauter Hast alles verkehrt anfaßte, »tummle dich doch – rasch – du weißt jetzt alles, Kaffee, Kuchen, Butter und was sonst dazu gehört – ich habe keine Zeit, mich hier länger aufzuhalten.«
Sie huschte aus dem Erdgeschoß, worin die Küche lag, wieder die Treppe hinauf und, die Hand auf das noch immer laut pochende Herz gedrückt, trat sie in ihr Zimmer ein, wo der Legationsrat wieder in der Sofaecke saß und mit ruhigster Geduld die Zurückkehrende erwartete.
Bald darauf kam der Kaffee und alles, was die umsichtige Magd zu einem Vesperbrot für geeignet hielt, und nach der langen kalten Fahrt ließ es sich der Sohn des Hauses trefflich schmecken, was die alte Dame so überaus beruhigte, daß sie zuletzt ihm dabei half und zwischendurch die Fragen beantwortete, die er noch zahllos in Vorrat zu haben schien.
So war es allmählich und unbemerkt Abend geworden und immer noch saß Bodo von Sellhausen unbeweglich auf derselben Stelle bei der alten Hausdame und machte keine Miene sie zu verlassen, als fühle er instinktmäßig, daß noch nicht alles zwischen ihnen abgetan sei.
Als sie nun aber nach einer etwas längeren Gesprächspause fragte, ob er sich nicht in sein Zimmer begeben, sich ruhen und später zum Abendessen herunterkommen wolle, erwiderte er:
»O nein, ich esse überhaupt abends selten und heute habe ich nicht den geringsten Appetit. Lassen Sie uns um neun Uhr eine Tasse Tee trinken und gestatten Sie mir, heute abend bei Ihnen zu bleiben. Wer weiß, wann wir wieder so gemütlich beieinander sitzen und ungestört plaudern können!«
Natürlich stimmte die alte Dame freundlich bei, und man setzte, wiewohl etwas weniger lebhaft, das unterbrochene Gespräch fort. Immer wieder kam Bodo, wie von einer unbekannten Gewalt dazu getrieben, auf das alte Thema zurück, als erwarte er, noch etwas ganz besonderes zu hören, und Fräulein Treuhold mußte ausführlich das ganze Leben schildern, wie es innerhalb der letzten Jahre sich im Hause abgewickelt hatte.
Während sie ihre Erzählung, mitunter dabei strickend, vortrug, war Bodo ein überaus scharfer Beobachter und glaubte schon lange eine gewisse Befangenheit, dann und wann sogar ein verlegenes Stocken an der Erzählenden bemerkt zu haben, als überlege sie insgeheim etwas ihr Peinliches oder als suche sie irgend eine Gelegenheit, das Gespräch auf einen andern Gegenstand zu leiten. Endlich wurde sie sichtlich unruhig und blickte verstohlen hin und her, und um ihrer Pein ein Ende zu machen, sagte Bodo endlich mit milder Stimme:
»Meine liebe Treuhold, Sie haben mir nun alles erzählt, was für mich für den Augenblick interessieren kann. Ich weiß, womit mein Vater sich in den letzten Tagen beschäftigt, was er in seinen letzten Stunden gesprochen und gewünscht hat. Aber, sprechen Sie aufrichtig, hat er Ihnen nichts weiter über mich selbst gesagt oder Ihnen sonst noch einen Auftrag an mich übergeben?«
Die alte Dame fuhr fast erschrocken zusammen, denn ihr junger Herr schien den häßlichen Punkt, der sie schon lange heimlich beschäftigte und dessen Abwicklung sie möglichst schnell herbeisehnte, erraten zu haben.
»Ach, lieber Gott,« sagte sie, tief aufseufzend, »ist mir doch, als ob Sie in meinem Herzen lesen könnten; ich habe es Ihnen schon lange sagen wollen, und doch wünschte ich Sie nicht gleich bei Ihrem Eintritt ins Haus damit zu behelligen.«
»Wieso, meine Liebe, – ist es denn etwas Unangenehmes, was Sie mir zu sagen haben?«
Die Alte stockte und zwar so lange, daß es augenscheinlich war, sie könne ihre Gefühle nicht in den richtigen Ausdruck kleiden, daher fuhr Bodo zu reden fort:
»Ich bitte Sie,« sagte er mit feierlichem Ernst, der etwas Unwiderstehliches hatte, »was Sie zu sagen haben, mir rasch und ohne Umschweife mitzuteilen. Ich bin ein Mann, der alles hören kann, was mein Vater mich durch eine Person wissen läßt, die, wie ich wohl weiß, sein ganzes Vertrauen besaß und der ich auch das meine zu schenken bereit bin, wenn sie es besitzen will.«
»O Gott!« rief die alte Dame tiefbewegt, »wie dankbar bin ich Ihnen für dies Wort, und ich hoffe wirklich auch Ihr Vertrauen zu verdienen, wenn Sie mich damit beehren wollen. Aber zu hören haben Sie über Ihren Herrn Vater von mir weiter nichts, vielmehr nur etwas –«
»Nun was?« unterbrach sie der Legationsrat mit ermunterndem Blick, da sie innehielt.
»Zu lesen, was er selbst geschrieben hat.«
»Ah! Einen Brief etwa an mich?«
»Ja!« sagte ihr nickendes Haupt, obgleich ihre Lippe stumm blieb, und sogleich erhob sie sich, trat hurtig an ihren Schreibtisch und holte einen dreifach versiegelten großen Brief hervor, dessen von der Hand des Verstorbenen geschriebene Adresse lautete:
»An meinen Sohn Bodo, durch meine treue Pflegerin Treuhold nach meinem Tode in seine Hände zu legen.«
Bodo erhob sich, als sie mit dem Briefe an ihn herantrat und mit feierlichem Nachdruck sprach:
»Da haben Sie ihn. Es ist der einzige und letzte Auftrag, den mir Ihr sterbender Vater für Sie gab, und ich habe mich desselben auf seinen und Ihren Wunsch jetzt entledigt.«
»Ich danke Ihnen!« erwiderte Bodo ruhig und trat an den Tisch, um beim Scheine der großen Lampe die Aufschrift zu lesen. Er las sehr lange daran, obwohl sie sehr kurz war, und endlich wiederholte er die Worte laut, als habe die alte Dame sie bis jetzt noch nicht gekannt.
Endlich drehte er den Brief herum, betrachtete ihn genau und legte ihn dann still auf den Tisch, worauf er sich wieder auf seinen vorigen Platz niederließ. »Es ist gut,« sagte er, »ja, Sie haben Ihren Auftrag erfüllt. Der Brief selbst aber soll mich begleiten, wenn ich nachher zur Ruhe gehe, denn was mir mein Vater zu sagen hat, kann und wird nicht imstande sein, meinen Schlummer zu verscheuchen.«
Fräulein Treuhold erwiderte nichts auf diese mit tiefem Gefühle gesprochenen Worte, aber sie sah beklommen aus und betrachtete mit seltener Aufmerksamkeit ihr wieder zur Hand genommenes Strickzeug, als hafte etwas außerordentlich Merkwürdiges daran. Plötzlich aber erhob sie sich ganz leise, bat um Entschuldigung, daß sie ihn verlasse, und schützte als Grund ihres Weggehens eine Wirtschaftsangelegenheit vor.
Nach einer halben Stunde kam sie wieder, und gleich darauf wurde der Teetisch in Stand gesetzt. Das Gespräch der daran Sitzenden war fast verstummt, wenigstens wurden nur gleichgültige Dinge verhandelt, nachdem das Hauptthema beendet und der Stein von der Brust der alten Dame hinweggenommen war.
So verging ihnen die Zeit, und allmählich wich der Abend der Nacht, was die kleine Stutzuhr im Zimmer mit ihren zehn lauten Schlägen verkündete.
Kaum hatte sie ausgeschlagen, so stand Bodo auf und reichte seiner Gefährtin die Hand. »Es ist zehn Uhr,« sagte er, »und ich weiß, daß Sie stets um diese Zeit zu Bett gehen. Durch meine Anwesenheit sollen Ihre Gewohnheiten in keinerlei Weise beeinträchtigt werden. Ich danke Ihnen für alles, was Sie mir so treulich berichtet haben, und ein ander Mal wollen wir mehr darüber reden. Für heute mag es genug sein. Schlafen Sie wohl und bemühen Sie sich weiter nicht um mich. Ich nehme das Licht hier, und mein Zimmer weiß ich zu finden.«
Er verbeugte sich freundlich und nahm das von ihr angezündete Licht. Dann streckte er langsam die freie Hand nach dem auf dem Tische liegenden Briefe aus, nahm ihn, nickte zutraulich und schritt zum Zimmer hinaus.
Die alte Dame stand eine Weile in horchender Stellung mitten im Zimmer und lauschte auf die Schritte des Fortgehenden. Als sie aber die Treppe unter seinen Füßen krachen hörte, atmete sie tief auf, faltete die Hände, erhob sie zum Himmel und sagte: »Gott sei Dank, das ist vorüber, er hat ihn! Hab ich mich doch lange genug vor diesem Moment geängstigt, aber jetzt, ja, ja, jetzt ist er vorüber! O, mein lieber junger Herr, der Brief enthält gewiß viel Seltsames für dich, und wer weiß, ob die Worte des Vaters wirklich nicht imstande sind, den Schlummer seines Sohnes zu stören! Doch, wir werden es ja hören, wie er den Inhalt ausgenommen hat. Er ist eine offene Natur, die nichts in sich verschließen kann, und dabei – zu meinem Troste – ein Mann, der ertragen können wird, was ihm das Schicksal aufgebürdet hat.«
*
Trotzdem unser Freund ein ruhiges Temperament und eine noch größere Selbstbeherrschung besaß, so war doch durch die letzte Unterredung mit der alten Gefährtin seines Vaters und ihr eigentümliches Benehmen dabei sein Blut in eine leichte Wallung geraten; je näher er aber der alten lieben Wohnung kam, umsomehr besänftigte es sich wieder, und als er endlich die Tür aufstieß, die wohnlichen Räume, in denen er früher sein Haupt so oft zur Ruhe gelegt, wiedersah und die gefälligen Anordnungen bemerkte, die Fräulein Treuhold schon lange mit fürsorgender Umsicht hatte treffen lassen, war er wieder der sorglose, gegen alles äußere Ungemach gestählte Mann, und das Bewußtsein, eine so friedliche heimatliche Stätte zu haben, tat seinem Herzen unendlich wohl.
Das geräumige, mit heller Tapete verzierte Wohnzimmer, woran sich ein kleines bequemes Schlafkabinett schloß, war durch zwei große Lampen behaglich erleuchtet; die alten Nußbaummöbel standen in gefälliger Ordnung, neue Vorhänge und Teppiche schmückten es freundlich, und überall, wohin sein Auge fiel, nahm er die liebenswürdige Absicht wahr, ihm ein wohltuendes Willkommen auch in diesen Räumen zu bieten.
Ach, und das waren nicht die hauptsächlichsten Vorzüge, die seine einfache Wohnung besaß. Erschien sie ihm schon jetzt, im Winter, einladend und behaglich, so war sie im Frühjahr, Sommer und Herbst, inbezug auf die herrliche Aussicht, die sie bot, unvergleichlich.
Da wir von der Hinterfront des großen Hauses noch nicht in die Ferne geschaut, so müssen wir jetzt dieses Versäumnis nachholen. Von dem hochgelegenen Zimmer, welches wir eben beschrieben, hatte man das lachende Wesertal in einer großen Ausdehnung vor Augen. Zunächst schloß sich dicht an das Haus der reizende Garten und an diesen der Park an, der terrassenförmig von dem hohen Felsrücken allmählich in das blühende Tal hinabstieg. Diese breiten Terrassen, in fünffacher Reihe übereinander getürmt, waren die letzten Überbleibsel der ehemaligen Befestigungswerke des alten Schlosses und die Kunst hatte hier weislich zur Freude der Menschen benäht, was die Notwendigkeit in unruhigeren Zeiten zu ernsteren Zwecken geschaffen.
Dicht am Fuße der untersten Terrasse brach die Weser, heftig strömend und rauschend, durch einen Engpaß von rotem Felsgestein, und während ihr rechtes Ufer eine meilenweit fortlaufende, bis dicht an das Flußbett reichende, anmutig bewaldete Felswand zeigte, dehnte sich das linke Ufer weit nach Westen und Süden aus, indem die Berge hier in kaum erkennbare Ferne zurücktraten und dem fruchtbaren Lande zu Wiesen und Äckern, Wegen und Gehöften Raum in Fülle boten.
Dicht an der untersten Terrasse nun strömte die blaugraue Weser vorüber und schlängelte sich in vielfach gewundenem Laufe durch hell leuchtende, grüne Wiesen hin, die zur Rechten sich bis zu derselben Landstraße erstreckten, die wir befuhren, als wir uns nach Sellhausen begaben.
Während nun zur Linken nichts als bewaldete Felsrücken sichtbar blieben, deren ausgesprengte rote Steinmassen nur an ihrer untern Hälfte zutage traten, die nächste Baulichkeit in dieser Richtung aber ein alter, halbverfallener Wartturm war, an dessen Fuß sich ein mit hoher Mauer umgebenes Landgut, die Cluus genannt, anschloß, zeigte sich in größerer Nähe zur Rechten, die Chaussee berührend, ein umfangreiches schönes Gut, welches dem Meier zu Allerdissen gehörte, von dem nur schon wiederholt gesprochen haben. Das rote Dach seines neuerbauten Wohnhauses und der damit verbundenen ungeheuren Tenne lugte freundlich winkend aus den uralten Eichen und Buchen hervor, die es beschatteten, und dahinter breiteten sich weit die fruchtbaren Äcker aus, die der reiche Mann als angestammtes Eigentum einer uralten Familie von seinem Vater geerbt hatte.
Weiter nach Westen und Süden hin zog die Weser, allmählich stiller und stiller brausend und wie ein silberner Faden im grünen Teppich schimmernd, ihren glänzenden Schlangenpfad, und an dem Punkt, wo sie den Augen verschwand, tauchten die Häuser eines netten Landstädtchens auf, dessen zwei spitze Türme mit ihrer gotischen Architektur malerisch den Endpunkt des reichen Naturgemäldes abschlossen.
Ringsum aber, aus den Höhen wie im Tale, streckten bald dunkle Tannen, bald saftgrüne Buchen und graue Eichen ihre vollen Wipfel hervor, und dazwischen sah man aller Orten eine Fülle von Obstbäumen eingestreut, deren Anordnung und Pflege den praktischen Sinn der umwohnenden Landwirte bekundeten.
So war die Aussicht, die sich von Bodos Fenstern bot, im Sommer beschaffen: im tiefsten Winter aber war von dem Allen nur wenig oder gar nichts zu sehen, zumal in dunkler, nur vom fahlen Mondlicht beschienener Nacht, wie wir sie diesmal vor uns haben.
Nichtsdestoweniger öffnete unser Freund, sobald er einen Blick durch die beiden Zimmer geworfen, ein Fenster und blickte froh bewegt auf die schweigende Landschaft hinaus, die nur hier und da aus den bewohnten Gebäuden in der Ferne einzelne Lichter herüberschimmern ließ, sonst aber keine Spur von Leben und Bewegung zeigte, denn selbst der geschwätzig rauschende Fluß war vom Froste erstarrt, und über seiner Eisfläche lag, wie auf allem Übrigen, eine dichte Schneedecke, unter der sich die müde Erde zu neuer späterer Kraftentwicklung rüstete.
»O,« sagte der einsame Beschauer dieser Landschaft, »auch jetzt ist meine alte Heimat schön und lieblich. Wie friedlich ruht sie in stiller Nacht, und wie hoffnungsvoll darf man an den goldenen Morgen denken, wenn die Sonne ihren weithin leuchtenden Purpur darüber ausstreut und Ferne und Nähe in ihren schimmernden Mantel hüllt. Sollte man es wohl glauben, daß dieser himmlische Gottesfriede so viel Unruhe und Leid verbirgt? Doch die Natur schafft die Unruhe nicht, der leidenschaftliche Mensch allein trägt den Unfrieden, das Weh, den Schmerz in sie hinein. Wie glücklich könnte man auf solcher Erde leben, wenn, ja, wenn keine Zwietracht in der Welt wäre, wenn die Menschen überhaupt untereinander einig wären. Wenn nicht Haß, Neid, Eifersucht und das ganze zahllose Heer aller übrigen bösen Leidenschaften sich darin niedergelassen hätte! Doch still, heute nichts mehr von Zwietracht und Leidenschaft – nur in der Ruhe und dem Frieden gedeiht das menschliche Herz mit seinen stillen Wünschen und Bestrebungen, und das wollen auch wir bedenken, indem wir uns jetzt zu dem letzten Willen des Verstorbenen wenden. Gute Nacht also, morgen begrüße ich euch wieder, Wald, Flur und Strom, und dann wollen wir uns mit offenen Augen und klaren Sinnen von neuem wie alte Freunde zusammen vertragen.«
Er schloß das Fenster, schnallte seinen kleinen Koffer auf, zog einen bequemen Rock daraus hervor und schüttete noch einmal frische Kohlen in den eisernen Ofen, bevor er an seinen alten Schreibtisch trat, der, dank der Fürsorge der guten Treuhold, nach wie vor sein volles Tintenfaß zeigte und überhaupt so aussah, als wäre sein Besitzer niemals von ihm so viele Meilen entfernt gewesen.
Nachdem Bodo ihn eine Weile mit Rührung betrachtet – gelehrte Leute haben von jeher eine besondere Vorliebe für ihren Schreibtisch gehegt – rückte er seinen alten Lehnstuhl davor zurecht, stellte eine der Lampen auf die Platte und setzte sich dann leise auf den Platz, wo er so lange nicht gesessen und an den er so oft gedacht, wenn er in weiter, weiter Ferne in glänzenderen Lebenslagen gewesen war, und größere Geschicke im Geist erwogen hatte, als ihm jetzt zu erwägen oblagen.
Wenn unser Freund auch manche Fehler und Gebrechen hatte, wie ja kein Mensch ganz ohne dieselben ist, so war er doch am wenigsten Egoist, wie es so viele Seinesgleichen sind. Selten nur, fast nie hatte er sich mit sich allein und mit dem beschäftigt, was seinen eigenen Vorteil, sein eigenes Wohlergehen betraf. Seine Gedanken und Bestrebungen waren immer auf erhabene Dinge gerichtet gewesen, die Geschichte der ganzen Menschheit hatte ihn bisher in Anspruch genommen und das Wohl und Weh der Nationen und Völker hatte ihm warm am Herzen gelegen. Jetzt aber, jetzt war er genötigt, einen Blick in die kleine Welt seines eigenen Ichs zu werfen, und fast zagend ging er an die neue Arbeit, die ihm, eben weil er ihrer ungewohnt war, viel schwieriger dünkte, als sie manchem andern erscheinen mag.
Da lag nun der kleine Brief vor ihm, der den letzten Willen seines verstorbenen Vaters umschloß, und daß darin etwas Ernstes enthalten war, hatte sein scharfes Auge schon an dem seltsamen Benehmen der alten Dame entdeckt. Aber was konnte es Großes sein, fragte er sich, wie wäre das möglich? Was hätte sein Vater ihm denn so Bedeutungsvolles mitzuteilen, was ihn beunruhigen oder gar besorgt machen könnte?
Ach! Bodo ahnte oder bedachte in diesem Augenblick nicht, daß auch in dem Geschick des Einzelnen Dinge vorgehen können, wovon sich der erhabene Geist des Denkers und des sich nur mit größeren Dingen beschäftigenden Menschen nichts träumen läßt. Er hatte ja eben noch gesagt: wie glücklich könnte der Mensch in diesem friedlichen Tale sein! und nun hatte er schon vergessen, daß nach seinem eigenen Ausspruch es eben die menschlichen Leidenschaften sind, die den Himmel auf Erden trüben und den Genuß des Schönen verkümmern.
Daran dachte er nun inbezug auf sich nicht mehr, vielmehr war er allmählich etwas neugierig angeregt, was der Brief enthalten könne; und nachdem er noch einmal die Aufschrift gelesen, brach er rasch die drei Siegel und öffnete das Schreiben, das aus mehreren Bogen bestand.
Nach seiner Gewohnheit blickte der Lesende zuerst nach der Unterschrift und dem Datum, und da gewahrte er denn, daß der größte Teil des Briefes schon einige Monate vor dem Tode seines Vaters geschrieben war, daß der Sterbende ihn nur in den letzten Tagen seines Lebens noch einmal unterzeichnet und daran die Bemerkung geknüpft: der Lesende möge den Inhalt wohl beherzigen, der Schreiber denke noch am Tage und in der Stunde seines Todes so, wie er in den frischen Tagen blühendster Gesundheit gedacht, und daher sei sein Wille ein wohlgeprüfter und überlegter, und Bodo möge nach seinem Gewissen danach handeln und nicht leichtfertig darüber fortgehen, wie es die Jugend so oft bei ernsten Gelegenheiten tut, indem sie nicht bedenkt, daß der Mensch im starren Alter ein Anderer ist, als in den Tagen rosiger Unschuld und Harmlosigkeit.
»Nein, nein,« sagt der Lesende zu sich, »ich bin kein Jüngling mehr, mein Vater, und Leichtfertigkeit hat nie zu meinen Eigenschaften gehört. Sprich was du willst, ich werde es beherzigen. Dein Wille sei mein Gebot, und ich würde der Letzte sein, der deinen in der Todesstunde gehegten leisesten Wünschen auch nur um eines Haares Breite entgegenträte.«
Er nahm sodann das erste Blatt und fing folgende Zeilen zu lesen an:
»Mein lieber guter Bodo!
Diese Zeilen schreibe ich schon heute, bei voller Gesundheit und ungebrochener Lebenskraft, aber aus wohlgemeinter Vorsicht für den Fall nieder, daß mir nicht mehr das Glück zu teil werden sollte, Dich wieder in der Heimat zu sehen, denn ein Mann von meinem hohen Alter muß jeden Augenblick vorbereitet sein, von seinem Schöpfer zur ewigen Ruhe abgerufen zu werden. Wenn sie daher vor Deine Augen gelangen, so bin ich nicht mehr am Leben, und da es mir also nicht vergönnt war, Dich mündlich von meinen Wünschen in Kenntnis zu setzen, muß ich es schriftlich tun, durch die Vermittlung meiner braven Treuhold, die ich Dir als Muster ihrer Gattung von ganzem Herzen empfehle und die Du, gleich mir, nach allen Richtungen erprobt finden wirst, weshalb Du ihr Dein Vertrauen schenken kannst, wie ich es ihr fast in vollkommenem Maße geschenkt habe.
Wenn ich hier sage: fast, so meine ich nicht damit, daß sie mein Vertrauen nur bis zu einem gewissen Grade verdient hat, sondern daß es in meinem Herzen doch noch einige kleine Winkel gab, die ich für mich behielt, wie auch Du gewiß einige Falten in der Seele haben wirst, in die Du niemand schauen lässt. Dir allein aber sollen die meinigen, auch die verborgensten, ohne Rückhalt offenbar werden, wenn Du nur die Zeit dazu abwarten willst.
Vor allen Dingen aber, mein lieber Bodo, will ich Dir Lebewohl sagen und Dir meinen Wunsch aussprechen, daß es Dir auf Deiner Lebensbahn nach Verdienst ergehen möge. Wenn ich diese Worte wähle, so magst Du daraus entnehmen, wie hoch ich Deinen moralischen und geistigen Wert anschlage, denn Dein Verdienst ist meiner Meinung nach dergestalt beschaffen, daß es Dir gut gehen muß, wenn Du danach belohnt werden sollst. Und das ist ein väterlicher Wunsch meinerseits, denn selten nur wird ein guter Mensch auf dieser Welt belohnt, während die Schlechten oft weit darüber ausgezeichnet werden. Das ist einmal der Welt Lauf, und wir können denselben weder aufhalten, noch in eine bessere Richtung lenken. Wenn Dir aber an dem Segen eines alten Mannes etwas gelegen ist, der es, nach seinem besten Wissen und Gewissen, von Deiner Geburt an gut mit Dir gemeint hat, so nimm ihn hin, ich gebe ihn Dir willig und freudig, aus freien Stücken und mit ganzer Seele.
So stehst Du denn an dem Platze, den ich so viele Jahre mit dem Gefühle vollster Befriedigung und, wie ich mit Stolz hinzufüge, mit Ehren behauptet habe. Ja, ich bin glücklich gewesen, das kann ich nicht leugnen, und mir ist bis jetzt so ziemlich alles unter den Händen gediehen, was ich damit angefasst. Möge es Dir auch so ergehen, das wünsche ich von ganzem Herzen, vor allen Dingen aber traure nicht zu sehr, daß ich von Dir gegangen bin. Wir müssen scheiden, wenn unsere Zeit gekommen, und dürfen nicht neidisch sein, daß ein Anderer an unsere Stelle tritt. Wohl dem, der, wenn er geht, weiß, daß ein Besserer oder wenigstens ebenso Guter seinen Platz einnimmt, und diese Meinung habe ich zu meinem Troste von Dir.
Zunächst nun fühle ich die Verpflichtung in mir, mit Dir über mein Vermögen zu sprechen, da Du vielleicht in dem Wahne gestanden, dasselbe sei sehr bedeutend. Dies ist nicht der Fall, mein lieber Bodo, und Du und andere sind darüber im Irrtum gewesen, wenn sie es geglaubt und große Pläne darauf gebaut haben. Überlaß Dich also keinen unangenehmen Täuschungen inbezug auf das, was Du als Mann von Stande damit leisten kannst, bescheide Dich vielmehr mit weiser Mäßigung, und wenn Du dann vielleicht mehr erhältst, als Du gebrauchst, wird der Vorteil um so größer für Dich sein. Höre nun, wie es in dieser Beziehung mit mir steht.
Mein Vater hinterließ mir allerdings ein hübsches Vermögen und ein schönes Gut, auf letzterem aber standen gegen meine Vermutung nicht unansehnliche Schulden, die ich trotz aller Bemühungen und trotzdem ich gesegnete Jahre erlebte, nicht tilgen konnte.
Die Gründe hiervon will ich Dir in Folgendem zu entwickeln versuchen.
Zunächst weißt Du, daß ich meine erste kinderlose Ehe mit einer älteren Schwester des noch jetzt lebenden Barons Grotenburg schloß, der eine große Verwandtschaft in der Umgegend hat und jederzeit ein gewisses Ansehen in unserm kleinen Lande genoß. Auch ich gelangte durch diese Verbindung zu einigem Ansehen und bin der Familie meiner ersten Frau somit vielfachen Dank schuldig geworden. Dadurch, daß ich denselben schon in früheren Jahren mit einem Teile meines Einkommens abzutragen suchte, geriet ich selbst bisweilen in Verlegenheit, aus welcher mich nur ein verstorbener Freund, von dem ich noch sprechen werde, mit seinen reichen Mitteln befreite. Baron Grotenburg nämlich, wie seine Schwäger, die Barone Haasencamp und Kranenberg, zogen von ihren Gütern nie den erhofften Gewinn, sie brauchten zur Erhaltung des Glanzes ihrer alten Familie viel, und somit war es eine Ehrensache für mich, die Verwandten meiner Frau mit meinen Mitteln zu unterstützen, so viel in meinen Kräften stand.
Ich empfehle Dir diese drei Familien auf das angelegentlichste und werde nachher Gelegenheit nehmen, auf die Grotenburgs wenigstens umständlicher zurückzukommen, da das künftige Schicksal dieser Familie mit dem Deinigen inniger verbunden sein wird, als Du es in diesem Augenblicke vielleicht vermutest.
Eine zweite Abzugsquelle meines Vermögens war die notwendige Verbesserung meines großen und in der Kultur etwas zurückgebliebenen Gutes, die nicht unbedeutende Summen verschlang. Ich lebte in einer Zeit, wo die erfinderischen Engländer und Amerikaner unsere Augen auf sich zogen und uns zwangen, der Kultur unseres Bodens eine größere Aufmerksamkeit zu schenken als bisher. Ich habe mit dem sich fort und fort entwickelnden Zeitgeiste immer gern gleichen Schritt gehalten, und so rissen auch mich diese Neuerungen zu weitläufigen Unternehmungen hin. Vieles gelang, manches dagegen mißlang im Anfange, schließlich aber und, wie gesagt, mit namhaften Opfern, habe ich den Sieg fast in allem davongetragen, und Dir wird hoffentlich in Zukunft zum Glück gereichen, was ich in dieser Beziehung in die Erde vergraben.
Eine dritte und fast die bedeutendste Ausgabe veranlaßte der Neubau meines Hauses und Hofes. Die alten Gebäude waren baufällig geworden, und ich mußte an zeitgemäße Restaurationen denken. Es wurden Pläne gemacht und ausgeführt, aber es wurde alles viel kostbarer und teurer, als ich gedacht.
Diese drei Ursachen waren es, die mich hinderten, die alten Schulden des Gutes abzutragen, und mich leider zwangen, aus Mangel an barem Gelde noch neue dazu zu machen. Allerdings erreicht die Summe beider zusammen noch nicht die Hälfte des Wertes meines Besitzes, allein sie ist doch umfänglich genug, um einem Anfänger einiges Herzeleid zu verursachen.
Um Dir mit einem Worte diese Summe zu nennen, so beträgt sie 80 000 Taler, die sich in zwei Händen befinden, wie Dir mein Sachwalter, der Justizrat Möller in B..., mitteilen wird, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo Du genauere Einsicht in diese Verhältnisse nehmen darfst, ein Zeitpunkt, den ich Dir nachher genau bezeichnen werde, sowie den Grund, der mich zu der Hinausschiebung desselben bewogen hat.
Meine Gläubiger sind übrigens Personen, von denen ich voraussetzen darf, daß sie Dich auf keine Weise drücken werden, obwohl die zwischen uns pro forma verabredeten Kündigungsfristen kurz sind; im Notfall jedoch, den ich keineswegs voraussehe, könntest Du bei Deinen zahlreichen Bekanntschaften mit vermögenden Leuten leicht Mittel und Wege finden, die notwendigen Summen aufzunehmen. Jedoch, ich wiederhole es, beschäftige Dich mit diesen Gedanken vor der Hand nicht, ich bin sicher, daß Dir in den ersten Jahren niemand darin zu nahe treten wird. Auch über diese Verhältnisse wird Dir mein treuer Sachwalter Rechenschaft ablegen, sobald der Zeitpunkt, wo Du alles in allem, was ich hinterlasse, übernehmen wirst, gekommen ist.
Nach allem diesem besitzest Du, wenn Du willst, noch ein hübsches Vermögen, selbst wenn Du Deiner staatsmännischen Laufbahn gänzlich entsagen und als Landwirt auf Sellhausen leben wolltest, was mir allerdings das Liebste wäre, wozu ich Dich aber keineswegs bestimmen will, da ich es für eben so überflüssig wie töricht halte, in die Neigungen eines vernünftigen Mannes mit störender Gewalt einzugreifen und ihn zu Unternehmungen zu treiben, in denen er nicht heimisch ist.
Ich komme aber jetzt zu dem Wichtigsten in meinen letzten Wünschen und bitte Dich, mir in dem folgenden Deine ganze Aufmerksamkeit zu schenken.
Mein lieber Bodo! Wir sind im Leben nicht oft und im ganzen nicht überaus lange beisammen gewesen, und doch kennen wir uns ganz wohl und lieben uns herzlich, wie es für zwei Menschen unseres Verhältnisses so natürlich ist. Du hast mir mit Deinem Fleiße, Deinem Talente, Deiner bescheidenen Anspruchslosigkeit immer Freude gemacht und ich bin in allen Punkten von Anfang bis zu Ende mit Dir zufrieden gewesen. Ob dies auch bei Dir mit mir der Fall ist, weiß ich nicht, indessen hoffe und glaube ich es.
Wie Du weißt, habe ich Dich nie zu etwas überreden oder gar zwingen wollen, stets habe ich Deinem Verstande, Deiner Einsicht und schließlich Deiner Ehre überlassen, zu handeln, wie Dir recht und billig schien. Auch jetzt will ich Dich nicht überreden, noch weniger zwingen, etwas zu tun, was ich, meinem Gefühle und meiner Ueberzeugung nach, als etwas Ersprießliches für Dich und Freudiges für mich halte, aber dennoch bin ich genötigt, eine Forderung an Dich zu stellen, oder vielmehr einen Wunsch auszusprechen, über den Du Dich vielleicht nicht freuen, ja, über den Du wohl gar im ersten Augenblick zürnen wirst, an den Du aber dennoch mit Überlegung herantreten und ihn wenigstens, mir zuliebe, prüfen mußt.
Eigentümliche Verhältnisse, die Du jetzt noch nicht zu kennen brauchst, wenn Du sie überhaupt jemals kennen lernst, walten über mir, über Dir und zwischen uns, und von mir wenigstens verlangen sie gebieterisch, daß ich handle, wie ich Dir jetzt eröffnen will.
Wie Du weißt, habe ich stets mit meinem Schwager Grotenburg in kameradschaftlicher Freundschaft gelebt. Er, oder vielmehr seine Familie, die mich, den in der Welt alleinstehenden Mann, einst wohlwollend bei sich aufnahm und mir eine heimische Stellung unter sich bereitete, umschließt die einzigen Verwandten, die ich noch auf Erden habe. Hätte ich nun keinen Sohn, so wäre diese Familie mein Erbe, und alles, was Dir jetzt bestimmt ist, würde in ihre und ihrer Nachkommen Hände übergehen.
Nach einem alten, wohlerwogenen Übereinkommen zwischen dem Baron von Grotenburg und mir ist es nun mein besonderer Wunsch, den ich Dir warm ans Herz lege, daß unsere Familien auch fortan in verwandtschaftlichem Verhältnis bleiben und auf daß dieses Verhältnis noch ein innigeres und unzerreißbareres werde, haben wir einen Plan gebaut, zu dessen Ausführung sich nach Deiner Rückkehr die herrlichste Gelegenheit bieten wird.
Baron Grotenburg hat eine einzige Tochter und ich habe einen einzigen Sohn. Hiermit ist eigentlich alles gesagt. Wenn dieser Sohn und diese Tochter, also Klotilde von Grotenburg und Bodo von Sellhausen, sich miteinander verbinden, so stört nichts unsere alte Freundschaft und beider Familien Vermögen und Ansehen fließt in eine neue Quelle, die Gott reich segnen und mit einem langen Fortgange erfreuen möge. Klotilde ist die Tochter eines alten Geschlechts, sie ist hübsch, und so viel ich weiß und denke, mit einer Liebenswürdigkeit begabt, die jedes Mannes Herz beglücken, jedes Mannes Haus zieren muß.
Gegen diese Verbindung an und für sich wirst und kannst Du nicht viel einzuwenden haben, falls, wie ich glaube, Dein Herz noch frei ist. Denn Du bist nie ein glühender Verehrer des weiblichen Geschlechts gewesen und hast mir oft gesagt, daß Du in Deinen Verhältnissen ohne Frau Dich leichter emporschwingen und gemächlicher behaupten kannst, als mit einer solchen.
Heiratest Du nun die Baronesse, so ist und bleibt alles, wie es ist und wie ich Dir eben gesagt. Bis zum nächsten ersten August, wo jene ihr einundzwanzigstes Jahr erreicht haben wird, mußt Du aber Deine Entscheidung getroffen und öffentlich ausgesprochen haben, denn auf jenen Tag fällt der Termin, wo mein Sachwalter angewiesen ist, Dir mein Gut zu übergeben und überhaupt alle Eröffnungen zu machen, die ich Dir jetzt mitzuteilen für überflüssig erachte.
Bis zum ersten August 18.. also hast Du Zeit, Dir meine Wünsche zu überlegen, Deine von mir ausgewählte und bestimmte Braut kennen zu lernen und danach Deine Entschließungen zu treffen. Am ersten August aber begibst Du Dich zu meinem Sachwalter, Justizrat Möller, auf das Gericht zu B... und er wird zu demselben Tage vier von mir ernannte Zeugen laden, vor denen Du Dich zu erklären hast, ob Du Klotilde von Grotenburg zu Deiner Gattin gewählt oder nicht. Hast Du sie gewählt und stimmt Deine Entschließung, wie ich keinen Augenblick zweifle, mit der ihrigen überein, so bist Du der unangefochtene Universalerbe meiner Besitztümer. Hast Du dagegen Klotilde von Grotenburg nicht zu Deiner Gattin gewählt – und ich flehe Gott an, daß er dies nicht geschehen lasse – so muß ich Dir erklären, daß ich ein Testament gemacht habe, welches über meine Hinterlassenschaft anderweitig nach meinem letzten Willen bestimmen wird.
Nennst Du nun Clotilde von Grotenburg vor den geladenen Zeugen als Deine Braut, so hat das von mir auf dem Gericht niedergelegte Testament keine Gültigkeit, es soll Dir vielmehr nur gezeigt und sofort uneröffnet vor Deinen und der Zeugen Augen vernichtet werden, denn dann brauchst Du und braucht die Welt nie zu erfahren, was darin enthalten war. Nennst Du aber eine Andere oder Clotilde von Grotenburg nicht als Deine Braut, so geschehe, was nicht zu ändern ist: mein Sachwalter öffne das Testament und lese es Dir und den Zeugen laut und buchstäblich vor. –
Gott sei Dank, daß ich soweit bin, denn es hat mir nie eine Arbeit so viel Schweißtropfen gekostet, wie diese Mitteilung an Dich, eine Mitteilung, die ich, wie die Sachen einmal zwischen uns liegen, nicht umgehen konnte. Zürne mir also nicht, grüble nicht über Ursache und Wirkung nach, betrachte es als ein Verhängnis, das Du nicht vermeiden kannst – Du wirst hoffentlich ergebungsvoll genug sein, Dich als verständiger Mann einem solchen zu unterwerfen.
Rüste Dich also, so bald wie möglich die Bekanntschaft der Familie Grotenburg zu machen oder vielmehr zu erneuern, denn Du kennst sie ja schon. Lerne die junge Dame kennen, die schon so viel Beifall in unserer kleinen Welt gefunden hat, prüfe sie, prüfe Dein Herz und dann – tue, was Du Deinem innersten Empfinden und Urteilen nach tun mußt.
Natürlich ist mein Schwager von dieser Angelegenheit genau unterrichtet, denn ich habe alles mit ihm Punkt für Punkt überlegt und schließlich den genannten Termin so weit hinausgerückt, damit Du Zeit habest zur Überlegung und nicht sagen kannst, wir hätten Dich überstürzt. Auf mein Gesuch hat mir der Baron versprochen, und ich will hoffen, daß der leichtblütige Mann sein Wort halten wird – seiner Familie unser Übereinkommen zu verschweigen, bis Du es selber erwähnst, damit Du derselben gegenüber in keinerlei falsche Stellung oder gar in einen persönlichen Zwang gerätst.
Sprich jedoch auch Du mit ihm nicht darüber, bevor Du Deinen Entschluß gefaßt hast, er wird Dir darin gern entgegenkommen. Er ist ein alter Edelmann, zwar von heißem Blut und stolzem Sinn, aber trotz seiner etwas junkerlichen Außenseite doch ein echter Kavalier – und das sei des Lobes über ihn genug gesagt. –
Willst Du nun noch weitere Winke und Ratschläge von mir vernehmen? Ja, ich will Dir noch von zwei Männern sprechen, die es wert sind, daß man ihrer in seinem letzten Willen gedenkt.
Es sind dies eigentlich meine zwei besten Freunde auf der Welt, oder sie waren es, denn nur der eine von ihnen lebt noch, während der andere schon vor mehreren Jahren gestorben ist.
Von dem noch Lebenden laß mich zuerst reden. Er war der bei weitem Jüngere von beiden, und sein Alter und seine Leibeskonstitution ist von der Art, daß er auch Dir noch lange Zeit ein Freund wird bleiben können, wenn Du es mit Deinem Stande, Deiner Bildung und Deinen Lebensansichten verträglich findest, mit einem Manne zu verkehren, der weiter nichts sein und vorstellen will, als was er wirklich ist – ein Landmann, dessen Familie seit einem Jahrtausend auf einer und derselben Scholle sitzt und deren jüngster Sproß er ist.
Ich rede hier von dem Meier zu Allerdissen, meinem nächsten Nachbar. Er ist nicht das, was man insgemein »von Adel« nennt, aber seine Familie ist uralt, wie Du weißt, denn seine Vorfahren haben unter Wittekind, dem Sachsenherzog, ihre Sporen verdient. Einen redlicheren, biederen, hülfsbereiteren Ehrenmann als ihn gibt es in der ganzen Runde nicht, obgleich er niemals die Miene annimmt, als sei er ein solcher. Nie hat es einen Menschen mit wenigeren Ansprüchen gegeben, er ist mit Gott und sich völlig einverstanden, und weiter verlangt er nichts auf dieser Welt.
Wenn Du mich lieb hast und meine Wünsche ehrst, wirst Du diesen Mann bald nach Deiner Rückkehr aufsuchen und Dich ihm als den Sohn eines Mannes vorstellen, der tief bedauert, ihm nicht mehr die Hand drücken zu können. Wenn Du vielleicht einmal des Rates eines Uneigennützigen bedarfst, suche ihn nirgends anders, sondern gehe gerades Wegs zu ihm, und was aus seinem Munde kommt, wird die Ansicht eines Mannes von Ehre, von Gewissen, von Rechtsgefühl sein. Dafür bürge ich Dir auf meine eigene Ehre und mit meinem Gewissen.
Der zweite Freund, von dem ich hier reden will, ist, wie gesagt, leider tot, er starb viel zu früh für alle diejenigen, die das Glück hatten, ihm im Leben nahe zu stehen. Es ist dies der Dir schon bekannte Besitzer der Cluus drüben an der Weser, Reinhold Birkenfeld, der sich immer so liebevoll gegen Dich erwies, als Du noch ein Knabe warst, und der mich jedesmal besuchte, wenn Deine Ferien Dich nach Hause führten. Er war der Krösus unserer Gegend, der stille Wohltäter der Armen und Bedrängten, der Freund in jeder Not, der Mann der Tat und – des Glücks, denn ihm gelang alles, was er ins Leben führen wollte. Da er hinübergegangen ist in das Reich der Ewigkeit, kann er Dir von keinem Nutzen mehr sein, doch ich muß wenigstens einige Bemerkungen über ihn und seine Witwe machen, die die Erbin seines ungeheuren Vermögens ist und damit schalten und walten kann, wie sie will.
Willst Du näheres über ihn erfahren, falls es Dich interessiert, so frage den Meier nach ihm, er war ja der Dritte in unserm Bunde und kennt ihn so genau wie ich. Seine alte Frau, die im Sommer noch immer unter ihren Bienen und Blumen auf der Cluus wohnt, zeigte sich mir schon von jeher feindlich gesinnt, und das war eigentlich das Störende in unserm Verhältnis, darum konnten wir uns nicht so oft sehen, als wir wohl beide gewünscht hätten.
Warum sie mir grollte, mag Gott wissen, ich habe ihre Feindschaft wahrlich nicht verdient. Aber sie ist eine seltsame Frau und vergißt nie das Gute und nie das Böse, was man ihr zugefügt, und auf wen sie einmal ihren Groll geworfen hat, ob mit Grund oder nicht, der hüte sich. Da Du mein Sohn bist, wird sie Dir auch nicht allzu hold sein. Aber stelle Du Dich, so viel an Dir ist, auf keine Weise in eine persönlich feindselige Lage zu ihr, es gibt Gründe, die dies notwendig machen, wenn ich sie Dir jetzt auch nicht nennen mag. Bei allen ihren Eigenheiten, ihrer äußerlichen Härte und Rauheit, ist sie von Herzen ein gutes Weib, hülfsbereit gegen ihre Freunde, aber freilich – ich kann Dir das nicht verbergen – verhängnisvoll für ihre Feinde – im ganzen ein unerforschlicher, unergründlicher Charakter in ihren Neigungen und Abneigungen.
Kannst Du sie Dir zur Freundin machen, um so besser, – wo nicht, so suche Dich mit ihr zu stellen, so gut es geht. Zusammentreffen wirst Du jedenfalls einmal irgendwo und irgendwie mit ihr, ja, ich wünsche sogar, daß Du ihr bald nach ihrer Ankunft auf der Cluus – was gewöhnlich im Mai geschieht – einen Besuch machst. Versuche also Dein Heil. Du wirst ja sehen, wie sie Dich empfängt, und Du wirst klug genug sein, ihr auszuweichen oder entgegenzukommen, je nachdem es zu Deinem Vorteil ist.
Diese Ratschläge und Winke meinerseits nimm nicht allzu leicht, ich bitte Dich darum, sie wiegen schwerer als Du denkst. Beachte vor allen Dingen die alte Dame. Sie ist in der letzten Zeit oft kränklich gewesen, und da sie betagt genug zum Sterben ist, könnte es leicht kommen, daß Du sie trotz aller Eile, ihr einen Besuch abzustatten, nicht mehr am Leben findest. Die Menschen werden oft schnell wie die Fliegen vom unsichtbaren Schicksal hinweggerafft.
Hiermit nun glaube ich Dir alles gesagt zu haben, was ich Dir sagen muß, um Dir zu beweisen, daß mir Dein Wohl am Herzen liegt. Verkenne meine Absicht nicht, wenn Du mich im Augenblick nicht zu begreifen vermagst. Und nun bleibt mir nichts übrig, als Dir Lebewohl zu sagen. Gott behüte Dich auf allen Wegen! Handle immer edel, gerecht und menschlich, was Du auch unternimmst – alles übrige aber, was Dir in den Weg treten mag, betrachte als Schickung von oben her, gegen die der Mensch wohl anstreben, aber nicht murren darf, denn er versteht das geheimnisvolle Walten der Vorsehung nicht. Lebe wohl, mein Sohn, sei tätig und glücklich und erinnere Dich in allen Lebenslagen Deines alten Vaters mit versöhnlichem Geiste, wenn Du auch seine durch die Notwendigkeit gebotenen Anordnungen nicht immer für die natürlichsten hältst. Noch einmal, ich segne Dich und wünsche Dir ein so zufriedenes Leben, wie Du es verdienen wirst.
Sellhausen, im Sommer des Jahres 18..
Dein treuer Vater
Valentin von Sellhausen.«
![]()