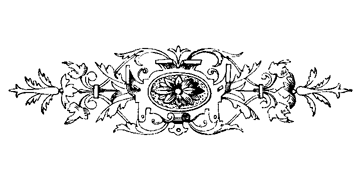|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Sonne durchschimmerte die süßen Beeren der Traubenhügel und färbte dies reiche Gelände des Rheines mit bunten Farben. Geschäftig arbeiteten die Winzer und trugen den Wein zur Kelter; blutrot floß der Most heraus, und die munteren Zecher sangen ihr Lied auf Rhein und Wein. Aber die Morgennebel stiegen schon auf und verhüllten die herrliche Gegend, bis die Sonne siegreich den dicken Mantel zerriß und die Reihen von Burgen auf den Felsen in die Welt hereinschauten. Bunte Ritterzüge, gemischt mit Edelfrauen auf geschmückten Zeltern, zogen zur Jagd; das Horn erklang lustig, und mancher Falke stieg in die Luft empor.
Heinrich zog mit gereiftem Wesen, gestählt in seinem Charakter durch Erfahrungen jeder Art, durch den Verkehr mit edlen Menschen gebildet, der Heimat entgegen. Gott hatte seine Fahrt gesegnet, und er brachte nicht nur das nötige Geld zum Aufbau seines Hospizes nach Hause, sondern auch viele Einzeichnungen für jährliche Beiträge, um das Werk zu unterhalten.
Es war an einem sonnigen Herbsttage, als Heinrich an St. Goar vorüberzog, und nicht weit davon das Echo an der Felswand weckte. Immer aufs neue ließ er seinen Ruf erschallen und freute sich über den Gegenruf. Als er lange verweilt hatte, sah er auf seinem zurückgelegten Wege einen Trupp Reiter langsam einherziehen. Allmählich entwirrte sich derselbe vor seinen scharf hinblickenden Augen, und er unterschied deutlich eine Karawane von Kaufleuten mit bepackten Pferden. Sie mochten sich in dieser Gegend, wo Burg an Burg sich reihte, und die Strauchritter hinter manchem Felsen lauerten, zu gegenseitigem Schutze vereinigt haben. Heinrich bangte ebenfalls mit Recht in jenen Tagen des Faustrechtes um seinen Schatz, den er in einem Gurte unter dem Wamse trug. Auch war er seit geraumer Zeit einsam dahingezogen, und er sehnte sich nach Reisegefährten. Er stellte sich also dem Zuge entgegen und bat den ersten höflich, sich anschließen zu dürfen. Der Zug stockte, Frage und Antwort wechselten, und Neugierige ritten an die Spitze, um nach der Veranlassung zu forschen. Unter diesen trabte ein Reiter hervor, ein kleiner Mann auf einem kleinen Rößlein, und des Mannes Augen fuhren neugierig herum, bis sie den Fremden entdeckt hatten. Plötzlich blitzte freudige Verwunderung durch dessen ganzes Gesicht; er gab seinem Pferde so scharf die Sporen, daß es einen Satz machte und ihn beinahe abwarf. Der Reiter aber zügelte es, dann streckte er beide Arme aus, zappelte mit den Füßen, und hopste auf seinem Rößlein, als ob er voll des süßen Weines wäre. Alle sahen verwundert auf ihn und ihre Verwunderung stieg, als jener schrie: » Heinrich Findelkind! er ist's leibhaftig! Hoho! alter Kamerad!« –
Als Heinrich seinen Namen hörte und die Stimme an sein Ohr schlug – rief er aus Leibeskräften im vollen Jubel des Wiedersehens: » Sebastian Mossatti!« und dabei lachte er, daß der Fels widerhallte.
Wer kennt nicht die Freude, in der Fremde unversehens einen treuen, munteren Freund wieder zu sehen! Das ist ein Sonnenschein, heller und feuriger, als der vom klarsten Himmel herab. Ja, es war der kleine, lustige Italiener, es war Sebastian leibhaftig, nur zu Roß, nicht zu Fuß, mitten in der glänzenden Landschaft, die er ihm früher so enthusiastisch geschildert und die Sehnsucht danach erregt hatte.
Als die beiden sich gegenüber hielten, drehte Sebastian den linken Fuß gegen rechts, schwang sich aus dem Sattel und stand auf der Erde. Ein kalter Gruß zu Rosse genügte ihm nicht. Auch Heinrich that das gleiche und streckte dem Freunde beide Hände entgegen. Der aber packte ihn um den Leib, tanzte im Kreise herum, betrachtete Heinrich von Kopf bis zu Fuß und rief seinen Gefährten zu: »Schaut ihn nur an, das ist er! das ist Heinrich Findelkind, mein Retter! Hat mich großen Burschen auf dem Rücken durch den Schnee getragen. Wenn Ihr auf dem Arlberg stecken bleibt, thut nichts, der zieht Euch, Mann und Roß, heraus! Aber nun wieder aufs Pferd! Sollst mit allen Bruderschaft machen beim besten Glas Wein in der Herberge.«
Der ganze Zug hatte sich um die beiden geschart, und alle lachten über Sebastians laute Freudenäußerungen. Bald war Heinrich in ihrer Mitte, Sebastian dicht an seiner Seite, mit Fragen unablässig, ohne die Antwort völlig abzuwarten; denn stets erweckte der Name einer bekannten Burg, die Heinrich besucht hatte, eine neue Frage. Erst in der Herberge konnte er seine Erlebnisse im Zusammenhange erzählen, und auch hierbei unterbrachen ihn oftmals Sebastians lebhafte Ausrufungen des Staunens, der Freude oder Entrüstung.
Nun folgte für Heinrich ein vergnügliches Weiterziehen. Eine Burg nach der anderen winkte von den Bergen; Schiffe und Boote durchschnitten den Strom und ließen die lange, silberglänzende Wasserstraße zurück; einsame Fischerhütten, mit Netzen behangen, standen am Ufer; dort sah beim heranziehenden Gewitter ein Weib forschend nach dem Strom, wo der Mann und der Sohn mit den Wogen kämpften; hier harrte sie mit dem Kindlein auf dem Arme beim Sonnenlichte des heimkehrenden Vaters, um ihn zu begrüßen; das Lied der Winzer und Fischer klang über die Traubenhügel und den Fluß, unzählige Reisebilder wechselten miteinander, und Heinrich hatte Muße, sie zu betrachten, denn der Zug bewegte sich langsam. Nicht selten zogen die Kaufleute mit ihren Waren vor die Burg; dann war Sebastian Heinrichs treuer Begleiter. Eh' er noch seine Kettlein, Spitzen und Bänder auskramte, pries er den Edelfrauen Heinrichs Lob, daß dieser oftmals errötend den Blick senkte. Bei Rittern und Knechten, bei Pagen und Zofen vermischte er seinen Scherz mit dem verborgenen Ernste; er zeigte seinen Retter gleich einer seltenen Ware, welche er nicht genug erheben konnte; er sprach manch schmeichelndes Fürwort, daß Heinrichs Wappenbilder sich vermehrten und die Pergamentblätter sich anhäuften.
Seit mehreren Tagen war Heinrich mit der Karawane gezogen. Der Abend brach herein und sie hatten noch eine ziemliche Strecke bis zur Herberge zurückzulegen. Sie beschleunigten ihren Ritt und hielten sich dichter zusammen; denn oftmals verengte sich der Weg zwischen Felsen und Gebüschen, welche einen Hinterhalt für Strauchritter gewährten, denen die Schätze der Kaufleute eine gute Beute sein konnten. Schweigend und vorsichtig ritten sie dahin, und ihre Furcht zeigte sich nur zu bald begründet, denn plötzlich brachen sechs Reiter durch das Dickicht und überfielen die Karawane mit lautem Geschrei. Ihre wilden Rosse drangen in die Schar, daß diese anfangs erschrocken auseinanderstob, und jeder nur an die Rettung seines eigenen Lebens und Besitzes dachte; der Zweck ihrer Vereinigung war durch den Schrecken vernichtet. Im Mondschein blitzten die gezogenen Schwerter: an den Felsen widerhallte das Geschrei und vermehrte täuschend die Zahl der Angreifenden; das Stampfen der Hufe drang dazwischen, und das bleiche Mondlicht machte den Angriff noch verwirrender. Nur einer unter der bedrohten Schar hatte schnell wieder die Geistesgegenwart gewonnen; es war Heinrich. Rasch überschaute er die Zahl der Räuber, verglich sie mit der fast doppelten seiner Begleiter, und der mutige Bergsohn fühlte in seiner Seele die Kampflust und Entrüstung gleich Feuerfunken sprühen. Er zog den Zügel seines Rosses an; dieses bäumte sich hoch auf; die Erinnerung an manchen bestandenen Strauß in des Herzogs Diensten mochte es instinktartig erfassen. Mann und Roß übernahm nun die Anführung im Gegenkampfe; Heinrichs Schwert blitzte und er rief: »St. Christoph, zu Hilfe! Kameraden, zusammengehalten! Zwei Mann gegen einen; drauf los! es gilt Gut und Blut.«
Sein Ruf war von einem so kräftigen Schwertstreiche begleitet, daß im plötzlichen Angriffe einer der Feinde wankte, und nun wehrten sich die Kaufleute tapfer. Schlag auf Schlag erklang; Funke auf Funke fuhr aus dem Stahle; Heinrich tummelte sein Roß mit der Leidenschaft und Kraft der Jugend; wo einer seiner Gefährten in Gefahr schwebte, war er an dessen Seite mit dem Schrei: »St. Christoph, zu Hilfe!« und alle seine Gefährten stimmten ein in den Ruf. Bald schien der Sieg auf der einen, bald auf der anderen Seite, bald die Raublust, bald die Verteidigung des Lebens die Kraft zu verstärken; dort blutete ein Arm, hier erlahmte ein anderer; Blut und Schweiß vermengten sich; die Wagschale schwankte, lauter klangen die Flüche der Räuber, verzweiflungsvoller der Ruf: »St. Christoph, zu Hilfe!« Da sprengten plötzlich zwei Reiter einher, und nun entsank auch Heinrich die Hoffnung; er senkte für einen Augenblick sein Schwert, aber sogleich zuckte es wieder auf, denn er hörte die Worte: »Sankta Maria für uns!« Das war ein Erkennungszeichen der Hilfe, und mit seinem eigenen Losungswort gesellte sich Heinrich zu den Ankommenden. Aufs neue entbrannte der Kampf, die Feinde begannen zu weichen; einer nach dem anderen verschwand im Walde; nur vereinzelte Schwertstreiche schallten nach, endlich verstummten auch diese und kein fremder Ritter, als die beiden Helfer, befand sich mehr auf dem Platze.
Es trat eine fast schauerliche Stille ein nach dem Lärm des Kampfes, nur vom Stöhnen eines Verwundeten unterbrochen. Man scharte sich, sammelte die bepackten Tiere und kam demselben zu Hilfe. Da rief der eine der beiden Fremden: »Benützt den günstigen Augenblick! der Wald und die Burg dort oben möchten noch mehrere Räuber im Horste tragen, und die wilde Schar verstärkt zurückkehren.«
Es war eine tiefe, aber doch sanft klingende Stimme, welche also mahnte; dennoch bebte Heinrich von einer unerklärlichen Regung. Die Stimme verstummte; aber er hörte sie immer noch, wie Kirchenglocken eines heiligen Festes, nachdem es längst vorüber. Wo und wann hatte er diese Stimme schon gehört? Keine deutliche Erinnerung löste diese Frage. Sie waren schon auf dem Weiterzuge, die Pferde stampften auf dem harten Boden, aber die Stimme klang immer noch durch seine Seele. Bald war sie wie der begleitende Orgelton zu frommen Liedern, und alle jene aus seiner Knabenzeit drängten sich hervor; eh' er's wußte, quoll es von seinen Lippen:
Heil'ger, starker Gott!
Verschmäh' uns nicht, wenn die Kraft gebricht –
und die beiden Fremden stimmten ein in das Lied; alle waren davon ergriffen und sangen es mit zum Dank ihrer Rettung, daß es feierlich durch die Nachtluft klang und der Strom dazu melodisch rauschte.
Als das Lied verstummte, sah sich Heinrich in Mitte der beiden Fremden; aber in seiner Seele war es klar geworden; die Vergangenheit stand in hellem Schimmer vor ihm; Wort und Töne hatten das Geheimnis gelöst und er rief: » Bruder Anselm! Bruder Balthasar!«
» Heinrich Findelkind!« klang es entgegen.
Das war ein Wiederfinden, noch herrlicher, als bei Sebastian, nur weniger laut; aber Heinrichs Augen waren feucht von der Freude; er ließ den Zügel fallen, streckte beide Hände nach rechts und links; er drückte die eine Hand und zog die andere an seine Lippen. Nein, er konnte nicht reden; der Strom neben ihnen warf keine so hohen Wellen, wie sein bewegtes Gemüt, und ob seine Tiefe auch den ganzen Nibelungenschatz verbarg, einen so reinen und goldenen Schatz der Dankbarkeit, wie Heinrichs Seele umschloß, hatte er doch nicht.
Jetzt nahten sie sich Mainz, dieser alten, ehrwürdigen Stadt mit ihren Türmen und Kuppeln, im Halbzirkel am Strome gelagert. Der Mond versilberte die Kreuze des Domes, und in den Herzen der Kaufleute lebte das Gefühl der Sicherheit auf; denn hier hatte ja der Städtebund zum Schutz des Handels gegen die Raubritter seinen festen Knoten geschlungen; hier konnten sie sicher ruhen und sich dann einzeln ihrem Ziele zuwenden. Sie suchten gemeinsam eine Unterkunft, und auch Ritter Wolfegg mit Balthasar zogen dort ein.
Als sich die Reisenden in ihren Kammern verteilt hatten und alle im Schlummer lagen, brannte noch in einem Gelasse die Lampe. Dort saß der Ritter mit seinem wiedergefundenen Schützlinge, der vor ihm auf die Kniee gesunken war und ihm in Kürze seine Erlebnisse erzählte. Dann verabredeten sie, daß Heinrich mit dem Ritter ziehen solle auf die Burgen des Schwabenlandes, wo Ritter Wolfegg selber zu Hause war.
Am nächsten Morgen trennte sich Heinrich dankend, sowie Dank und Gaben empfangend, von den Kaufleuten und dem ehrlichen Sebastian, der ein baldiges Wiedersehen auf dem Arlberge verhieß, und zog mit seinem Freund und Beschützer dem neuen Ziele entgegen.
Jetzt waren es wieder die gleichen Personen, welche vor achtzehn Jahren sich vereint hatten; wie ganz verschieden nach außen! und doch merkten sie es kaum. Wir können von jemand lange getrennt sein, sogar in der wichtigen Zeit der geistigen Entwickelung und dennoch beim Wiedersehen uns innerlich erkennen, wenn nur das erste Erkennen ein richtiges gewesen und die Entwickelung naturgemäß vor sich gegangen ist. Es mußte so kommen wie es kam. Heinrich war nicht von der Außenwelt in seiner geistigen Entfaltung, gestört. Zwischen den hohen Wänden des Arlberges war die Saat der Pilger in seiner Seele aufgesproßt, gleich den Blüten im Klostergarten, über welche von der Kirche herüber die Gebete ziehen. Lawinendonner, das Rauschen der Bergstürze, das rollende Ungewitter, der Hilferuf eines Verunglückten: dies war der heilige Orgelton, der ihm stets das Lied der Barmherzigkeit vorsang und Gottesdienst mit Menschendienst vereinigt predigte. So war Heinrich geworden, wie ihn Bruder Anselm wiederfand auf der zweiten Pilgerfahrt. Mit innigem Wohlgefallen betrachtete er den Jüngling. Jetzt war an ihm das Fragen, und er horchte begierig auf alle Einzelnheiten, die, vom Zauber einer demütigen Einfalt umweht, von Heinrichs Lippen flossen.
So ritten sie in gegenseitigem Austausche ihrer Erlebnisse des Weges. Wie ehemals fiel aus dem Geiste des Ritters mancher helle Strahl auf die Ereignisse. Er ließ Heinrich seine Vergangenheit erkennen mit den verschlungenen Wegen, die ihn Gottes Hand geführt, vom ersten Lebenstage, bis zum gegenwärtigen. Er zeigte ihm, wie alles in enger Gliederung zusammenhänge, wie nichts fehlen durfte, kein Leid, keine Thräne, keine Freude, damit die Ereignisse zur festen Kette wurden, wie also Gottes Pläne und Fügungen weise und väterlich seien, wie er in dieser erhebenden Erfahrung sich auch künftig getrost dieser Führung überlassen könne.
Ritter Wolfegg führte seinen Schützling nun auf viele Burgen. Ueberall wurden sie freundlich aufgenommen, und sowohl das Almosen, wie das Wappenbuch vergrößerten sich. Einmal hielten sie, wie früher, unter einem Baum die Mittagsrast, und betrachteten dabei die Pergamentblätter. Sie waren in groß Quart und gaben nun ein Buch, fast so dick als lang. Aus allen Teilen von Deutschland, Ungarn, Polen, waren die Wappenschilde verzeichnet und so schön gemalt und vergoldet, daß man sie selbst heutzutage nicht schöner machen könnte.
Da prangten unter den vorgenannten Wappen jene der Grafen v. Montfort, Sargens, Sulz, Hardeck, Hager, Horneck, Liechtenstein, von der Linden, Windischgrätz, Zinzendorf. Alle die edlen Geschlechter hatten sich mit dem armen Heinrich verbrüdert und sich zu einem jährlichen Beitrage verpflichtet.
Als sie dieses farbige Buch betrachteten, dachten sie an das erste Buch, welches die Veranlassung zu Heinrichs Leseübungen gewesen war. Sie sprachen viel darüber, wie der Mensch nur ausharren dürfe in einem guten Vorsatze, um das Ziel zu erreichen. Ritter Wolfegg aber dachte im stillen: »Nun ist sein eigen Leben zu einem Buche geworden, an dem die Engel schreiben und malen, an jedem Tage neue Blätter mit rührender Inschrift.« –
Heinrich war mit seinen Gefährten zwei Wochen auf der Reise; nachdem er sie noch auf Ritter Wolfeggs Burg begleitet und das Versprechen erhalten hatte, daß sie zur Einweihung des Hospizes kommen würden, verabschiedete er sich und ritt der Heimat zu.