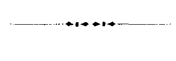|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Heinrich Findelkind – war des Knaben erster Gedanke beim Erwachen und er sagte sich diesen Namen in einem fort, wo er ging und stand. Er drängte die Mutter mit stets neuen Fragen über die ersten Tage seiner Kindheit, bis sie ungeduldig sagte: »Nun laß mich in Fried', ich weiß nichts mehr und will nichts weiter wissen;« als sie merkte, daß Heinrich ein trauriges Gesicht machte, fügte sie sogleich beschwichtigend bei: – »als daß du mein guter Bub' bist.«
Heinrich wandte sich hierauf mit seinen Fragen an Bärbele und Annaliese. Da hörte er nun, besonders von der letzteren, wie sie sich alle über ihn gefreut hätten, und wie es zugegangen war an seiner und Jakobs Wiege; er hörte so viel, bis er selbst eine Freude hatte über das kleine Kindlein mit den blauen Augen und fast ganz vergaß, daß er's selber gewesen sei.
In den ersten Tagen nach der gemachten Entdeckung geberdete sich das arme Findelkind ganz eingeschüchtert; er saß kaum fest auf seinem Platze, als ob er nicht hierher gehöre, rückte vor jedem auf die Seite, und wenn beim Essen sein Schüsselein schon zum Einfüllen vorgeschoben war, ein anderes aber auch etwas begehrte, zog er es eilig wieder zurück. Die Mutter gewahrte es sogleich und lächelte ihm ermunternd zu, während der Vater in seiner derben Weise darein rief: »In der Reih' geblieben, eins nach dem anderen! 's hat kein's ein besseres Recht als das andere!«
Nach dem Essen sagte Heinrich aus innerstem Antriebe nun jedesmal: »Vergelt's Gott!« und als Jakob es ein paarmal gehört hatte, sagte er es nach. Die Geschwister flüsterten untereinander, was vorgegangen sei. Für die Kleinen war es eine Neuigkeit, für Jakob ein halbes Wunder; alle kamen miteinander überein, daß sie Heinrich nun fast noch lieber hätten, als zuvor. Es entstand ein Wettstreit unter ihnen, dieses zu zeigen; Heinrich hingegen that, was er jedem an den Augen absehen konnte. So erwärmte er aufs neue in der Meierei, und sein Gefühl des Heimatsrechtes kehrte in die junge Brust zurück; nur gesellte sich dazu eine kindliche Dankbarkeit, welche in seinen blauen Augen leuchtete; die gemachte Entdeckung veredelte sein ursprünglich schon so gutes Herz.
Der Herbst blieb noch lange schön und milde, so daß die Schafe, Ziegen und Schweine immer noch auf die Weide getrieben werden konnten. Jakob und Heinrich versahen bereits dieses Geschäft, wozu Brummer, der Schäferhund, ihnen treulich half. Die beiden Knaben waren stets sehr vergnügt dabei gewesen. Die Natur bot ihnen die größte Mannigfaltigkeit von Spielzeug. – Da waren die unzähligen Tiere im Grase, welche es zu beobachten, zu fangen galt; da waren kleine Fallen zu stellen und anzufertigen; da liefen und huschten die Mäuslein vorüber und spitzten die Köpfe aus ihren versteckten Höhlen hervor; da waren es die zu hütenden Tiere selber, besonders die munteren Geißen, welche ihnen Vergnügen machten; da war irgend ein Vogelnest, das sie belauschten; da war die Iller mit ihrem schönen, oft hell blinkenden Wasser, die Steine am Ufer zum Einsammeln und die großen Steine zum Schleudern, daß sie weit in den Fluß hineinflogen, drauf hüpften in kleinen Absätzen, oder plätschernd hinein fielen, daß davon das Wasser emporsprang.
Nun aber trat dabei eine kleine Veränderung ein. Heinrich hatte ein so übervolles Herz, daß er mit seinem Gefährten davon plaudern mußte, und die Geschichte war für Jakob so neu, wie für seinen Kameraden; es kam diesem so spassig vor, daß Heinrich ein Findelkind sei, und er horchte gerne darauf. Einmal sagte er nach solchen Gesprächen plötzlich: »Du! gehörst vielleicht gar einem Ritter?« Heinrich fuhr bei dieser ganz neuen Anschauung der Dinge zusammen. Erst besann er sich, dann rief er: »Warum nicht gar! Ein Ritter ist ja reich, der hätt' mich schon behalten und nicht unter den Baum gelegt.«
»Ja, aber vielleicht hat dich ein böser Ritter seinem Feind geraubt und dich im Zorn weggeworfen.« –
Die Knaben wußten natürlich allerlei von den Rittern und meist nur etwas Schlimmes, denn sie hatten große Furcht vor ihnen, wenn sie von der nahen Burg dahersprengten und auf nichts im Wege acht gaben. Der Vater fürchtete sie auch, weil ihre Rosse schon einige Male seine schönen Kornfelder zerstampft hatten, und so war dieser Gedanke des Knaben eben kein unnatürlicher. Nach einer Weile fuhr Jakob fort: »Wart' nur! vielleicht holt dich einmal so eine schöne Rittersfrau in rotem Kleide, wie sie auf den Pferden daher reiten, einen Vogel auf der Hand. O, die ist viel schöner, als unsere Mutter.«
Heinrich fuhr zornig auf: »Was red'st! Ich will mich aber nicht holen lassen und mag sie nochmal so schön sein! Eine bessere Mutter, als die unsere, gibt's auf der ganzen Welt nicht!«
Jakob aber gingen nun die Ritter und die Edelfrauen gar nicht mehr aus dem Kopfe; stets fing er davon wieder aufs neue an, bis Heinrich ganz traurig wurde. Plötzlich erlitt ihr Gespräch eine Unterbrechung. Sie hüteten nicht weit vom Flußufer und sahen einen Mann daherkommen, der etwas im Arme trug, an dem Ufer innehielt und sich niederbeugte. Sogleich standen sie an dessen Seite. Der Mann hatte eben einen großen Stein aufgehoben und war beschäftigt, denselben an den Hals eines kleinen Hundes zu binden.
»Was thust?« riefen sie wie aus einem Munde.
»Den Hund ersäufen,« war die ruhige Antwort des Mannes.
In Heinrichs Gesicht stieg eine glühende Röte auf und das Erbarmen zitterte in seiner Seele. Er näherte sich dem armen Tiere und sagte: »Ist er krank?«
Der Mann schüttelte den Kopf, indem er in seiner Beschäftigung fortfuhr, und entgegnete: »Nein, krank ist er nicht; aber wir haben Hunde genug, können nicht all das Vieh am Leben lassen, fressen uns sonst noch das Brot vom Munde weg.«
»Schenk' mir den Hund!« rief nun in mitleidsvoller Aufwallung der Knabe.
Der Mann sagte lachend: »O, den kannst du schon haben! Mir ist's einerlei, ob er versauft oder verhungert. Wem gehörst?«
Heinrich wurde aufs neue rot, aber Jakob erwiderte rasch statt seiner: »Wir gehören dem Meier von Kempten und der hat schon noch Futter für den kleinen Hund.«
Der Mann lachte wieder, indem er rief: »O er wird schon größer; aber meinethalben!« Damit warf er das Tier ihnen zu und ging von dannen. Heinrich nahm den Hund liebevoll in seinen Arm, als ob er ein kleines Kind wäre,, streichelte ihn, Jakob that ein gleiches und sie kehrten zu ihrer Herde zurück.
Jetzt kam hintendrein freilich die Sorge, was der Vater dazu sagen würde. Jakob beruhigte den Bruder mit den Worten: »Weißt, ersäufen kann ihn der Jörg gerade so gut, wie der Mann, wenn's der Vater nicht leiden will, daß wir ihn behalten.«
Das war nun freilich für Heinrich ein schlechter Trost, denn er hatte den Hund bereits liebgewonnen, weil er unwillkürlich dabei an sich selbst denken mußte, daß er verlassen unter dem Eichbaum gelegen sei. Sie spielten nun mit dem Hunde. Als sie jedoch gegen Abend nach Hause zogen, sank auch dem Jakob der Mut vor dem strengen Vater, und er sagte bittend: »Trag' du den Hund.«
Heinrich nahm ihn an sein klopfendes Herz und verbarg, ihn sorgfältig. Nachdem die Herde im Stalle war, trat er schüchtern mit dem Hunde in die Stube, und man hätte dabei gemahnt werden können, wie vor Jahren der Meier auch etwas Kleines unter seiner Decke heimgetragen hatte. Als der Knabe den Hund zeigte und erzählte, wie sie zu ihm gekommen seien, that er's in so mitleidiger Weise, daß der Meier sagte: »Meinethalben! aber du mußt ihn selbst aufziehen und mich laß ungeschoren; in die Stube darf er mir nicht, so lang er noch ein so kleines Vieh ist.«
Heinrich hatte eine unbeschreibliche Freude, lange nicht so sehr an dem Hunde, als weil dieser nun nicht umkommen mußte. Er richtete ihm ein warmes, weiches Plätzlein im Stalle zurecht, fütterte ihn mit der Milch, die er selber noch gerne gegessen hätte, und Jakob stand ihm dabei getreulich bei; er war ihr Spielzeug für den ganzen langen Winter.
Das Leben in der Natur gab Heinrich immer neue Nahrung für seine Empfindung: daß er ein mitleidig gerettetes Findelkind sei; das Erbarmen und die Dankbarkeit schossen daraus hervor, wie der Halm aus der guten Saat. Der Meier konnte ihm die ganze Herde ohne Besorgnis anvertrauen; er war aufmerksamer und klüger geworden, denn in seinen Kopf war ein Licht gekommen und in sein Herz eine Wärme, die alles beleuchteten. Früher hatte er wenig an Wind und Wetter gedacht; je mehr es sauste und brauste, um so lustiger war's ihm erschienen. Jetzt aber dachte er dabei an das erstarrende Kindlein unter dem Eichbaume, wozu er flüsterte: »ich Heinrich Findelkind« – und die gefährdete Herde. Dann rief er: »Du, Jakob, schau', es zieht ein Wetter am Himmel auf; wir wollen heimtreiben, daß kein Tier Schaden leidet!« –
Im darauffolgenden Sommer wäre es zwischen den beiden Knaben fast zu einem Streite gekommen. Heinrich, welcher der beste Kletterer war, hatte im Walde das Nest einer Singdrossel entdeckt und sagte es Jakob. Oft schauten sie auf die kleinen Eier und waren auf die ausschlüpfenden Vöglein begierig. Als sie nun eines Tages am Waldrande hüteten, war Jakob allein hineingegangen und bald darauf vernahm Heinrich dessen Ruf. Er beauftragte Brummer, die Herde zusammenzuhalten, und lief auch hinein. Was sah er hier! Jakob stand unter dem wohlbekannten Baum und hielt das Nest mit den kahlen Jungen in der Hand, die er jubelnd seinem Bruder zeigte. Aber Heinrich schrie mit zorniger Stimme: »Was fangst an? Laß die kleinen Vögel in Ruh'!«
Jakob entgegnete verblüfft und murrend: »Ich will sie aber haben; sie sollen mir daheim was vorsingen.«
»So, – und an die armen Tiere, welche umkommen, weil sie noch keine Federn haben und nicht selber fressen können, denkst nicht?«
»Sie werden schon Federn kriegen und ich will sie füttern.«
»Und an die Alten denkst auch nicht? Hörst, wie sie voller Angst mit den Flügeln schlagen und um den Baum fliegen?«
»Meinethalben! schrie Jakob; sie sollen nur neue Eier legen! Ich will einen Vogel haben, so gut wie du einen Hund hast.«
»Aber den Hund haben wir vom Tode gerettet und die Vögel werden sterben. Jetzt gleich gibst sie her; ich thu' sie wieder hinauf!« –
»Ich mag nicht, ich will einen Vogel haben!« –
Heinrich hatte gute Lust, dreinzuschlagen; aber es stieg wieder in ihm die Erinnerung auf, wie er auch so mutterlos unter einem Baume gelegen sei, und er sagte bittend: »Thu' den Vögeln kein Leid. Guck! gerad so elendiglich bin ich dagelegen, und der Vater hat mich heimgetragen und die Mutter hat mich zu dir ins Nest gelegt.«
Da kam dem Jakob auch das Erbarmen und die Reue. Er gab seinem Bruder die Vögel samt dem Neste. Dieser schob sie vorsichtig in seine Hirtentasche, kehrte dieselbe auf den Rücken, kletterte behende den Baum hinauf, fügte das Nest sorgfältig zwischen die Aeste, und als er wieder herunten war, versteckten sich die beiden Knaben im Dickicht. Bald sahen sie die Alten näher flattern, sahen die großen, kahlen Köpfe der Vöglein, hörten ihr Gekreisch und die Alten saßen wieder bei ihnen. Jetzt kehrten die Knaben seelenvergnügt zu ihrer Herde zurück.
Zu dieser Zeit war auch der gerettete Hund tüchtig herangewachsen. Es war ein brauner, bärenhafter Rattenfänger, dessen zottige Haare ihm über die hellen, klugen Augen herabhingen, ein liebes, drolliges Tier. Heinrich hatte ihm den Namen Schnuffl gegeben, weil er überall herumkroch, und die Knaben nahmen ihn mit auf die Weide. – Es war, als ob der Hund in Heinrich seinen Lebensretter erkenne, denn er folgte besonders ihm auf Schritt und Tritt. Viele Stunden lang war der Knabe damit beschäftigt, ihn abzurichten, und Jakob sah ihm dabei höchlich belustigt zu. Schnuffl mußte aufwarten, über den Stock springen, apportieren, für Annaliese den Korb tragen, sich auf den Rücken legen, sich tot stellen, wieder lustig bei seinem Befehl aufspringen und überhaupt alle die einfachen, üblichen Kunststücke erlernen. Dies war eine große Freude, und Heinrich fühlte einigen Stolz, wenn der Hund bewundert wurde und ihm folgte.
So verstrich noch ein Jahr, Heinrich wuchs immer mehr heran und hatte immer mehr Gelegenheit, allen zu dienen und dankbar zu sein. Jedem stand er bei, ohne zu fragen, und er war immer bei der Hand, wo man ihn brauchte. Am treuesten war er aber doch seinem Jakob, neben dem er in der Wiege gelegen und nun auch auf einem Lager ruhte. Einmal hatte der Vater demselben aufgetragen, einen Holzstoß zu schichten; Jakob hatte jedoch etwas anderes im Sinne; er wollte bald fertig sein und that es so schlecht, daß Heinrich voraussah, der Stoß werde mitten in der Nacht herunterstürzen. Dieser sagte kein Wort; als aber Jakob des Nachts an seiner Seite fest schlief, stieg er aus dem niederen Fenster und beugte vorsichtig in aller Stille den Holzstoß aufs neue, worauf er wieder in sein Bett schlich. Jakob merkte nichts davon und war des anderen Tages sehr verwundert, als ihn der Vater lobte, daß er's so gut gemacht habe. Heinrich aber fühlte sich an diesem Tage vergnügt wie nie zuvor. Solche Vorkommnisse lösten sich häufig ab und ein Geist der Liebe und des Friedens umschloß die Geschwister; mittendrin aber stand mit seinen fröhlichen, blauen Augen Heinrich Findelkind.