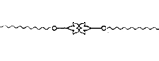|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es war ein Sonntag, ein stiller, friedlicher Sonntag auf dem Lande, so recht grundverschieden von den anderen Wochentagen, wo Menschen und Tiere arbeiten, wo der Boden bearbeitet wird, wo der Sonnenschein, die Luft oder der Regen zu arbeiten scheinen, und die abgetragenen Kleider der Leute von Arbeit Zeugnis geben. Heute aber war alles frei davon, war alles gewaschen und geputzt, die Kinder, die Erwachsenen, die Kühe im Stalle, und selbst die ganze Natur schien im Sonnenschein gewaschen und gefirnißt zu sein. Der Himmel leuchtete blau und die Wiesen waren stellenweise noch ganz jugendlich grün. Dennoch war es Herbst, wie damals, als das fremde Kind unter der Eiche lag, ja, es jährte sich gerade zum sechsten Male. Aber wie anders war's heute.
Damals sauste der Wind und die graue Decke des Horizonts drohte mit dem nahen Winter, als sollte der Herbst nicht freundlich weilen dürfen; heute war helllichter Sonnenschein, als ob der Sommer sich nicht trennen könne von der Erde. Damals lag ein heimatsloses, halb sterbendes Kind unter dem Baume, und jetzt spielte dasselbe Kind als frischer, munterer Knabe in einem Kreise von ebenso frischen, munteren Kindern, die ihn Bruder nannten, und die Meierei, der Baum, das Feld, der Wald, alles, alles ringsumher war so gut seine Heimat, wie die Heimat der anderen.
Ja, dort drüben, nicht sehr weit von der Eiche, wo der Meier von Kempten einen Baumgarten angelegt hatte, spielten die Kinder, die kleinen und die großen, gelehnt an die kleinen und großen Stämme und die ausgewachsenen Bäume, welche bereits Frucht getragen hatten. Sie jagten sich abwechselnd umher, um den Platz zu tauschen, und es gab Neckereien in Menge, die alle belustigten.
Heinrich war der Hurtigste darunter. Wenn Viktörle ihn schon zu erhaschen meinte und die Hand nach ihm ausstreckte, entwischte er doch, war außer ihrem Bereich und saß droben in den Zweigen, wie ein Spottvogel pfeifend, oder lachte von oben herab. Schmollte sie, dann lachten alle; eine neue Neckerei umdrängte sie, daß sie am Ende am lautesten lachte auf Kosten eines anderen, denn der Scherz lief im Kreise herum und weilte nie lange bei dem einen. Es ging an ein Springen und Fangen, als ob es die allergrößte Lust der Welt wäre, außer Atem zu kommen und müde zu werden. Mancher derbe Wettkampf entstand, und die Püffe, welche es dabei absetzte, waren ebenso gut wie Liebkosungen und wurden ebenso heiter aufgenommen.
So ging es bereits den ganzen Nachmittag, als der Abend heranrückte und die Meierin auch herauskam, sich unter den Eichbaum setzte und dem Spiele zusah. Die seltene Ruhe that ihr wohl, der frohe Anblick noch wohler und alles um sie her stimmte sie absonderlich weich. Da schaute zwischen den schwarzen und braunen Köpfen ihrer Kinder der blonde, krause Lockenkopf herüber, sie vernahm Heinrichs silberhelles Lachen und das ihres Jakobs tönte darein, und die anderen bildeten den Chor, daß es ihr wie ein Glockengeläute vorkam. Sie mußte unwillkürlich an jenen schaurigen Abend vor sechs Jahren denken, und wie es weder sie noch den Vater auch nur eine Stunde lang gereut hatte, was die menschliche Barmherzigkeit sie thun hieß, und wie Gottes Segen darauf lag, wie das Brot nie fehlte für alle miteinander. Sie faltete wie im Gebet ihre Hände und eine rechte Sonntagsstimmung bemächtigte sich ihrer.
Als ob diese Gedanken den Knaben anzögen, kam Heinrich im jagenden Spiele in die Nähe des Eichbaumes. Er hatte das festgesetzte Ziel übersprungen; ein anderer mußte statt seiner springen, und er wurde in der lustigen Schar nicht vermißt. Beim Erblicken der Mutter war für einen Augenblick das Spiel vergessen, er sprang auf sie zu und sank keuchend, mit geröteten Wangen und glänzenden Augen in ihren Schoß. Da war ihr's, als ob die Blätter in dem alten Baum rauschten und die Geschichte seiner verflossenen Kindheit erzählten. Sie sprach in der Eingebung des Augenblicks: »Komm', setz' dich zu mir auf die Bank, wo du vor sechs Jahren so elendiglich gelegen bist.« –
Heinrich erhob den Lockenkopf von ihrem Schoße und blickte mit seinen hellen Augen neugierig auf die Mutter, indem er rasch frug: »Was hat mir denn gefehlt?«
Sie nahm ihn näher und sagte: »Was dir gefehlt hat? Gar alles, armer Tropf! Wärst fast erfroren und verhungert da auf dem harten Bänklein.«
»Aber warum denn, Mutter?«
»Warum? meinst, so ein kleiner, armseliger Wurm, kaum einige Tage alt, könn' es in Wind und Wetter aushalten eine ganze Nacht lang?« –
»Aber warum hast du mich denn da draußen liegen lassen?«
»Ich hab' dich ja nicht hingelegt und kein Sterbenswörtlein davon gewußt! Gott steh' mir bei, wie hätt' ich so was thun können!«
»Hat's am End' das Bärbele gethan? Wart' nur, die werd' ich beim Schopf nehmen!« rief Heinrich entrüstet.
»Das Bärbele! Gott verzeih' dir's, du weißt's nicht besser. Das Bärbele und die Annaliese haben dir abgewartet. wie 's eine Kindsfrau im Schloß drüben nicht besser thun könnt', als dich der Vater, in die Decke gewickelt, uns gebracht hat und du bei Jakob in der Wiege gelegen bist.«
»Aber wer hat's denn gethan?«
»O, Kind, armes Kind, deine eigene, unbarmherzige Mutter und ich kann nur sagen, Gott verzeih' ihr das Unrecht.« –
Heinrich sah ganz verwirrt darein; es kam ihm die Angst, als ob er gerade jetzt in Wind und Wetter unter dem Baum liege und am Erfrieren sei. Er rief weinend: »Bist du denn nicht meine Mutter?«
»Nein, nein, ich bin's so recht nicht, Heinrich, aber ich bin deine Pflegemutter und will's sein alleweil, ohne Aufhören.«
»Und der Vater ist auch nicht mein Vater?«
Die Meierin schüttelte verneinend den Kopf, während Heinrich weiter forschte: »Und der Jakob, der Christel und die Hanne?«
»Alle sind nicht deine rechten Geschwister. Aber sei nur zufrieden, sie wissen's gar nicht anders, als daß du uns gehörst.«
»Wem gehör' ich denn?« rief Heinrich, in ein lautes Schluchzen ausbrechend.
»Man hat dich hier unter den Baum hingelegt und ist fortgegangen. Solch ein Kind heißt man Findelkind! Ja, Findelkind hat der Pfarrherr ins Taufbuch geschrieben, das ist dein Name. Nun, wein' nicht so, höre auf, du bist doch unser Bub' und ein guter Bub', das muß ich sagen.«
Die Meierin sagte ihm viele besänftigende Worte und immer aufs neue; aber die kleine Brust wogte in Stößen, und je mehr Thränen die Mutter abtrocknete, desto mehr flossen nach, als ob sein Herz ein Quell geworden wäre.
»Heinrich, Heinrich! wo bleibst?« tönte es vom Spielplatz herüber; er hörte es nicht. »Heinrich, Heinrich, komm'!« er hörte es, aber seine Thränen flossen aufs neue. Da sprang Jakob herbei. Er sah den weinenden Bruder und meinte, es hätte etwas abgesetzt. Er teilte es mit einer schlagenden Bewegung den anderen mit; sie rieten hin und her, was es wohl sein könne, hielten sich aber, wie bei ähnlichen Gelegenheiten, scheu in der Ferne, als ob es ansteckend wäre. Sogleich endete das fröhliche Spiel. Jedes schlich sich von dannen und die Schar verlor sich im Haus, Hof, Stall und Garten. Die Größeren hatten bei dem herannahenden Abende ohnedem etwas zu thun und die Kleinen fanden überall leicht eine Beschäftigung.
Die Meierin und das Findelkind waren nun allein und unbeachtet. Sie erzählte Heinrich seine kleine Geschichte im Zusammenhange, ermahnte ihn, Gott zu preisen für seine Lebensrettung, es sein lebenlang nicht zu vergessen und Gott jetzt gleich auf den Knieen zu danken, weil es am nämlichen Platz und auch ein Sonntag sei, der dem Beten gehöre. Und der Knabe kniete mit gefalteten Händen vor der Bank. Es war nur ein Schluchzen, das die vorgesprochenen Worte verschlang, es stieg jedoch aus einer unschuldsvollen Kindesseele zum Vater im Himmel auf, zu jenem mächtigen und erbarmenden Vater, der auch sein ersterbendes Wimmern schon gehört hatte.
Jetzt nahm die Meierin den Knaben an der Hand und ging schweigend mit ihm zum Hause. Der Meier sah sie mit Verwunderung; er furchte die Stirne, denn er schloß auf einen Streit, und es war ihm nichts ärgerlicher, als ein Verdruß am Sonntage. Das Weib nahm ihn auf die Seite und sagte: »Mach' kein böses Gesicht; ich hab's ihm nur gesagt.«
»Was denn?« sagte er immer noch finster.
»Nun, daß er ein armes Findelkind ist, wissen muß er's doch einmal, über kurz oder lang.«
Der Meier sah nun mit seiner ganzen Gutmütigkeit auf den Knaben, zog ihn auf seine Kniee und sagte: »Willst alleweil brav sein?«
Wieder wollte der Knabe in Thränen ausbrechen, aber der Vater wehrte ab und gab ihm einen sanften Klaps als Liebkosung.
Jetzt schluchzte Heinrich die Worte heraus: »Vater, ich dank' dir, daß mich nicht hast verfrieren und verhungern lassen.«
Der Meier lachte und entgegnete: »Sollst nie verfrieren oder verhungern, so lang ich leb'; aber jetzt lach' einmal wieder.«
Heinrich gab sich Mühe; es wollte nicht recht gelingen; dennoch mischte er sich unter die anderen, blieb aber den ganzen Abend sehr stille. Er setzte sich nur halb auf die Bank, als ob er das Gefühl hätte, nicht her zu gehören. Vater und Mutter gaben ihm an diesem Tage nochmal so viel Suppe, als sonst und lachten ihn freundlich an. Dann gingen die Kinder zu Bette; Heinrich schlief bald ein, aber er träumte die ganze Nacht von Heinrich Findelkind, als ob er's nicht selber wäre. –