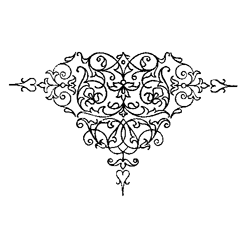|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es schien, als ob St. Christoph seinem Schützlinge den Weg bahnen und die Hindernisse beseitigen wolle, denn der gute Anfang hatte auch einen ebenso guten Fortgang. Gräfin Adelheids buntes Wappenbild verschaffte Heinrich bei manchem, dem Hause Cilley verwandten Geschlechte eine freundliche Aufnahme. Er bereiste ganz Steiermark, Kärnten, Krain und Oesterreich; die Burgen der Edlen und Grafen v. Peckau, v. Urle-Waldeck, v. Runa, v. Henneburg, Pfannenberg, Löben, Epstein, und wie sie alle heißen, die alten Geschlechter. Die Wappenschilde und Namensunterschriften auf Gräfin Adelheids Pergamente vermehrten sich, wo immer eine des Malens kundige Hand war. Wenn das Blatt sich gefüllt hatte, kam ein anderes an die Reihe, und Heinrich sah im Geiste schon daraus ein Buch entstehen.
Aber auch manche Gefahren drängten sich ihm entgegen und er dankte oftmals im stillen dem guten Herzoge Leopold für das starke und schnelle Roß. Der wohlberittene und mutig aussehende Bursche konnte schon einem wilden Gesellen Trotz bieten; wenn ihn jedoch ein Trupp von Reisigen anhielt, zeigte er des Herzogs Paß und Urkunde.
Was ihm jedoch nicht minder gut zu statten kam, war sein offenes, treuherziges Wesen, vermischt mit keckem Mute und einer von Witz belebten Heiterkeit, welche die finsteren Gesichter im Burghofe nicht selten zu schallendem Gelächter zwang und ihm auch manch Fürwort der Zofe bei ihrer Herrin einbrachte. Stand er aber vor der Schloßgebieterin oder dem Burgkaplan, dann siegte die fromme Einfalt seiner begeisterten Seele.
Tage waren in Wochen und Monate übergegangen, seitdem sich Heinrich auf der Reise befand. Er hatte die Stürme und den Frost des Winters, den sich wild kreuzenden Regen, jedes Ungestüm der Witterung ertragen, oftmals ohne schützende Herberge; er hatte mit Durst und Hunger gekämpft, rauhe Behandlung erlitten; gleich dem Aprilwetter hatte die Gunst der Menschen gewechselt, aber unverdrossen zog er nun in den hellen, schönen Frühling hinein. Dieser sproßte jetzt aus der Erde und den Zweigen, wiegte sich in den Lüften, feierte seine Glorie im Sonnenschein und zog auf den Silberwölklein am blauen Himmel dahin. Da kamen auch neue, selige Gefühle in sein Herz, daß es drin wogte, wie in der Erde selber, die ihre Blumen und Gräser emporsandte. Jetzt endlich hatte er ja den Wunsch seiner Kindheit erreicht und sah die Welt vor sich liegen. Das war ein rasches, buntes Vorüberziehen von Bildern und die neubelebte Schöpfung bot ihm tausend Wandergrüße.
So friedlich und ungestört sollte jedoch seine Pilgerfahrt nicht immer verlaufen. Heinrich hatte nun die österreichische Grenze verlassen und befand sich in Ungarn, dem fremden Lande, dessen Sprache er nicht verstand, und wo des Herzogs Urkunde die Geltung verlor. Da waren auch die Menschen anders und seltsam mit den dunklen, bärtigen Gesichtern, den blitzenden Augen, dem schwarzen, niederwallenden Haare, der fremden Kleidung, über welche selbst an warmen Tagen der Schafspelz sich schlang, um dem raschen Wechsel von Kälte und Hitze zu trotzen. Auf flinken Rossen jagten die Reiter pfeilschnell an ihm vorüber und blickten ihn stolz und finster an. Da galt es, mit Vorsicht aus dem Wege zu reiten, oder mit unbefangener Miene das pochende Herz zu verbergen.
Jetzt kannte er auch nicht mehr, wie in der Heimat, wo ihm Auskunft geworden war, die Burgen und Namen derer Besitzer; er mußte sich schon auf sein gutes Glück verlassen.
Als er eines Tages aufs ungewisse dahinritt, sah er eine stattliche Burg in der Ferne. Er beschloß, dahin sein Pferd zu lenken, und zuerst in der Nähe eine Herberge zu suchen. Als dies geschehen war, ging er auf sein Ziel los, und erreichte bald die Feste. Sie hatte nichts weniger als ein freundlich einladendes Aussehen; ihre grauen Mauern erhielten keinen Schmuck durch ein buntes, im Winde flatterndes Banner; auf dem Söller gewahrte man weder Edeldame, noch Zofe; kein geschmückter Zelter sprengte durch die Frühlingslandschaft; kein flinker Page prangte in bunter Tracht: alles trug nur das wüste Gepräge jener kriegerischen Zeit. Aber Heinrich ließ den Mut nicht sobald sinken; seine Reiseerfahrungen hatte alle Zaghaftigkeit abgestreift; wie oft war er schon vom Scheine betrogen worden, und hatte bei glänzender Pracht nichts gesammelt, während die rauhe Umhüllung oftmals eine freundliche Seele barg.
Zwei Gruppen hatten sich im Hofraume gebildet. Zur Linken von dem Portale waren die Zecher auf die Erde gelagert; in ihrer Mitte befand sich ein großes Faß mit feurigem Ungarwein gefüllt, und dieser trieb bereits seinen losen Spuk in den geröteten Köpfen. Die Becher klirrten in der Runde, rohe Scherze brachten ein schallendes Gelächter hervor, der Uebermut zeigte sich in jeder Bewegung und dann ertönte ein Lied, in welches der ganze Chor einfiel. Weniger fröhlich war die Gruppe zur Rechten. Ueber dem steinigen Boden lag ein Teppich; die Ritter, denn aus solchen bestand die ganze Gesellschaft, hatten einen Kreis gebildet, und mitten drin rollten die Würfel aus dem Becher. Noch mehr als der feurige Ungarwein, brachten diese eine wilde Glut in die Köpfe. Statt der rauhen Lieder schallten Flüche nach jedem schlechten Wurfe; die Goldfüchse rollten aus der Tasche auf den Teppich; höhnendes Gelächter drang aus manchem Munde, wenn auf das letzte Goldstück ein Kettlein oder eine kostbare Schwertzier folgte, und nicht selten ballte sich dann ingrimmig die Faust, oder sie fuhr an den Schwertgriff. Daneben saß auf seinem Stuhle der Burgherr und schaute dem Spiele zu. Sein flammender Blick gebot Friede und gleich einem Blitze zuckte es über das narbige Angesicht, wenn seine Befehle nicht beachtet wurden.
Heinrich hatte dieses alles kaum bemerkt, als er sogleich erkannte, daß es Stegreifritter unter des Burgherrn Anführung sein müßten. Hier von der Barmherzigkeit etwas erwarten wollen, wäre Thorheit gewesen, obwohl das blinkende Gold ihm zu winken schien, es aus so unwürdiger Haft zu befreien. Er wollte sich entfernen, als ein neuer Anblick ihn fesselte. Einer der Ritter hatte nun sein Wehrgehänge verspielt. Im heftigen Zorne schleuderte er es von sich und ein wilder Fluch über falsches Spiel brauste hervor. Augenblicklich blitzten zwei Schwerter gegeneinander; der Burgherr fuhr dazwischen und donnernd schallte sein Wort durch den Hof: »Spart Eure Stöße für die Feinde da draußen! nieder mit den Waffen; wir sind geschworene Kampfbrüder, und wer das vergißt, soll uns alle zum Gegner haben.«
In verhaltenem, finsterem Grolle traten nun die Streitenden auseinander; aber ihr Blut war in Wallung und ihre Wut suchte ein anderes Ziel. Eben wollte sich Heinrich unbemerkt von dannen schleichen, als der eine dieser Ritter ihn gewahrte und nun schrie: »Ein Spion! ergreift ihn! dort lauert er am Thore!«
Sogleich trat er gegen Heinrich, der es am geratesten fand, furchtlos stand zu halten. Die Ritter sprangen ebenfalls empor, und der Burgherr ergriff rasch die Gelegenheit, den vorigen Auftritt zu verwischen, indem er seinen Knechten gebot, den Fremden herbeizuführen.
Hier galt ruhige Besonnenheit als einzige Waffe. Heinrich näherte sich also dem Stuhle, wo der Burgherr gleich einem Richter saß und ihm mit finsterem Blicke drohte. Die beiden Gruppen hatten sich zu einer verschmolzen, und sich um ihren Führer geschart. Da stand nun Heinrich wie ein angeklagter Verbrecher. Er verneigte sich vor dem Burgherren, blickte ihm frei und furchtlos ins Gesicht, der Anrede harrend. Diese ließ nicht lange auf sich warten; im rauhesten Tone sprach der Ritter: »Was führt dich hierher in unseren Burghof, frecher Geselle?«
Heinrich nahm des Herzogs Urkunde hervor und indem er sie dem Ritter hinreichte, entgegnete er ohne Zittern in der Stimme: »Der Herzog Leopold von Oesterreich.« –
Aber kaum war dieser Name erklungen, als der Ritter von seinem Stuhle aufsprang, an sein Schwert griff und in höchster Wut schrie: »Mord und Tod! der Herzog Leopold! Wie wagst du es, diesen Namen hier zu nennen! Hier bin ich der Herr, und dort sind meine Burgverließe, tiefer als in Wien, Graz oder Innsbruck. Sag' ihm, wie man seinen Abgesandten hier empfängt! Los mit den Hunden, sie sollen mit ihm die Hetzjagd halten, wie es für solchen Herrn und solchen Knecht gebührt. Meint er, bis hierher reiche seine Macht? Er hat uns aus seinem Land vertrieben und schlechter noch soll es seinem Spion und Abgesandten hier ergehen!«
Schon hatten sich mehrere Knechte um Heinrich gedrängt;: man vernahm aus der Ferne das wilde Geheul der anstürmenden Meute, und jetzt brannte auch ein Feuer in Heinrichs Augen, indem er rief: »Ich bin kein Spion, ich ziehe im Frieden umher von Burg zu Burg, von Land zu Land, um das heilige Almosen zu sammeln!«
Er konnte den Satz nicht vollenden: ein höhnendes Gelächter unterbrach ihn und man hörte die Worte: »Leopolds Bettelknecht!«
»Der Schweizerkrieg hat seinen Säckel geleert! Gebt ihm einen Heller!«
»Ja, ein Almosen dem Herzog!« und die Kupfermünzen flogen gegen Heinrich, der sich nicht zu erwehren vermochte, und dessen Stimme in dem wilden Ruf verklang: »Ins Burgverließ mit dem Spion!«
»Nein, die Hunde auf ihn, damit er seinem Herrn sage, wie wir ihn ehren!«
»Ja, die Hunde! die Hunde!« erscholl es von allen Seiten.
Da machte sich Heinrich mit seinen beiden Armen einen Raum; mit all seiner jugendlichen Körperkraft schlug er um sich und eilte aus dem Hofe. Aber ihm nach rasten und heulten die Hunde, von dem Geschrei der Ritter zur Wut angefeuert. Wie ein gehetztes Wild jagte Heinrich von dannen, übersprang Grüben und Wälle, die Meute ihm nach, jetzt ihm auf dem Fuße, jetzt wieder in kurzer Entfernung. Dort stand ein hoher Baum; wie ein Eichhorn kletterte er empor und saß nun gesichert auf seiner Feste, unten die kläffenden Tiere. Immer wilder heulten sie, bis endlich der Ruf ihrer Herren sie zurückrief.
Nun ward es wieder stille in der Gegend, aber es drängte Heinrich fort, und er stieg hernieder, eilte rastlos von dannen, bis die Burg nur mehr in der Ferne zu sehen war. Aber seine Kraft schwand; der Schweiß rann von seiner Stirne, das Herz pochte zum Zerspringen, Entrüstung und Beschämung tobte in seinem jungen Blute. Da setzte er sich auf einen Stein am Weg und allmählich löste sich der innere Sturm in Schwäche auf. Wie in den Tagen seiner Kindheit stürzte eine Flut von Thränen aus seinen Augen. Eine Mutlosigkeit bemächtigte sich seiner und sein Herz schrie nach dem stillen Frieden der Heimat. Warum auch war er fortgezogen und hatte sich nicht genügen lassen an dem kleinen Werk! Warum wollte er sich vermessen, Großes zu vollbringen, er, das verstoßene Kind, mit dem Brandmal der Schande und Verlassenheit schon auf der jungen Stirne! Hatten ihn nicht seine eigenen Eltern schon hinausgestoßen in die Welt, wie die Räuberbande! War er der rechte Mann, um sich einzudrängen in die Burgen der stolzen Ritter – er, er, Heinrich Findelkind! Nein, er wollte umkehren und seine Verhöhnung zurücktragen in die verborgene Einsamkeit! er wollte sich nicht fürder der Gefahr aussetzen, wie ein Wild gehetzt zu werden; er war ja auch ein Mensch, und berechtigt zu menschlicher Achtung.
So dachte Heinrich; er hatte alles verloren, Zuversicht, Ehre, ja sich selbst. Sinnend und ganz verwirrt in all seinen Gedanken und Gefühlen saß er lange auf dem Steine; Stunde um Stunde verfloß, und immer noch saß er da. Plötzlich schrak er auf vom dröhnenden Klange eines Hufschlages: ein wild schäumendes Pferd rast einher; es schleppt den Reiter nach sich, und das quellende Blut färbt die Erde. – Augenblicklich ist auch Heinrichs Geistesgegenwart und sein Drang, zu retten, zurückgekehrt. Er springt auf, stürzt dem wilden Roß entgegen, greift in die Zügel, kämpft mit dem rasenden Tiere in gewaltiger Manneskraft; es stutzt und steht; Heinrich blickt ihm mit dem Bann des Geistes in die Augen und das Tier fühlt die Macht seines Herrn – es ist gebändigt und steht ruhig wie eine Mauer.
Heinrich eilt von dem Pferde zum Reiter und löst dessen Fuß aus dem Bügel. Dann überläßt er das Tier seinem freien Willen und sieht es ruhig die Straße hinziehen. Hierauf trägt er den bewußtlosen Reiter zum Rasen neben dem Steine, wo er selbst solange gesessen war. Das Blut quillt aus der tiefen Kopfwunde und er sucht es mit seinem Tuche zu stillen. Endlich kehrt Leben in den Verunglückten zurück; er erwacht an der Brust seines Retters.
Es war ein Jüngling seines eigenen Alters und Heinrich entnahm bald aus abgebrochenen Worten, daß er des Burgherrn Sohn sei. Da zuckte noch einmal das bittere Gefühl durch sein Herz, seine Stirne verfinsterte sich, und als ob des Jünglings Blut sein Gesicht gefärbt hätte, glühte es. Verwundert und erschrocken gewahrte es der Junker, aber bei diesem Blicke war auch Heinrichs erregte Seele besänftigt. Mit emsiger Sorgfalt pflegte er nun den Verwundeten, holte aus dem nahen Bächlein das kühlende Wasser, wusch das gestockte Blut von der Stirne, und benetzte die brennenden Lippen.
Als der gerettete Jüngling sich wieder etwas erholt hatte, überschüttete er den Fremdling mit Worten des Dankes und schloß dann: »Kommt mit mir auf die Burg! mein Vater wird Euch lohnen, was Ihr an mir, seinem einzigen Sohne, gethan habt.«
Ein bitteres Lächeln zog nun über Heinrichs Lippen, indem er entgegnete: »Euer Vater mich lohnen? – Ich zur Burg zurückkehren? – Sie haben mich mit Hunden gehetzt, wie ein Wild. Ja, seht mich nur erstaunt an, Junker! Das haben sie an mir gethan vor wenigen Stunden! Meint Ihr, weil ich arm und niedrig bin, es fließe nicht auch wallendes Blut in meinen Adern, wie in den Euren? Meint Ihr, so ein armer Bursch hätt' nicht auch ein Flämmchen Ehre im Leibe? – Seht! sie haben es fast ausgelöscht, aber Euer rieselndes Blut da hat es wieder angezündet. Wie Euer Roß Euch fast das Leben nahm, haben Eure Hunde mir's auch fast genommen; ich meine nicht das leibliche Leben, sondern das, was dem Manne Kraft verleiht, sein Selbstbewußtsein. Aber St. Christoph ist mir zu Hilfe gekommen, daß ich in Eurer Rettung die Schande in mir selber austilgen konnte, und ich segne Euch, Junker, deshalb.« –
Im Innersten erschüttert hatte der Jüngling auf Heinrichs Worte gehört; er senkte das Haupt und seufzte tief; eine heilige Bluttaufe mochte in diesem Augenblicke den Sohn des ritterlichen Räubers zu einem besseren Leben weihen. Heinrich bemerkte dessen Bewegung und sprach freundlich: »Kommt, Junker, stützt Euch auf meinen Arm, ich will Euch zum Schlosse führen. Das ledige Pferd wird drinnen Schrecken verbreitet haben; wir dürfen nicht länger säumen.«
Schweigend folgte der Junker dem Geheiße und sie schritten langsam der Burg zu. Unter dem Thore standen bereits mehrere Ritter und der Burgherr stürzte nun in ihre Reihen. Da zitterte seines Sohnes Arm in jenem des Führers und er wandte flehend das bleiche Gesicht zu Heinrich. Dieser machte sanft seinen Arm los, übergab seine Bürde einem Herbeieilenden, und ohne nur einmal rückwärts zu sehen, oder auf den lauten Ruf zu horchen, eilte er von dannen, fort nach der Herberge, wo er sein Pferd gelassen, sattelte und bestieg es und ritt weiter, immer weiter in die milde Frühlingsnacht hinein, ohne Rast, bis die Ruhe der Schöpfung auch seine erregte Seele einwiegte und er den Hauch Gottes um und in sich verspürte.