
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
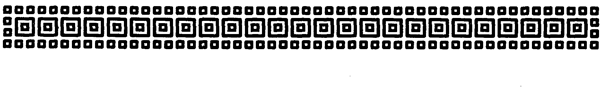
Abgedruckt aus: Nylander, Seevolk. Leipzig bei Georg Merseburger.
Der finnländische Schriftsteller John William Nylander erzählt in seinem »Seevolk« aus seinem Seemannsleben. Er, der sich vom Schiffsjungen bis zum Steuermann emporgearbeitet und fast alle Meere des Erdballs befahren, hat viel gesehen und erlebt. Natürlich gebraucht er, wenn er erzählt, die Fachausdrücke, die ihm als Seemann geläufig sind; für »Landratten«, besonders, wenn es sich um jugendliche Leser handelt, bedürfen die nautischen Ausdrücke der Erklärung.
Reling = die Brustwehr, die um das ganze Schiff herumgeht.
Schanzbekleidung = die an den Relingstützen befestigten Bretter.
Back = Erhöhung des Vorderschiffes.
Vorluke = Luke zum vorderen Schiffsraum.
Rigg = Takelwerk, Tau- und Segelwerk des Schiffes.
Vollrigger = Vollschiff.
Backbord = vom Steuer aus die linke Seite eines Schiffes.
Steuerbord = vom Steuer aus die rechte Seite.
Luvseite = die dem Winde zugewandte Seite.
Topp = oberste Spitze der Masten.
Registertonne = Maß für die Tragfähigkeit eines Schiffes.
Schute = Leichterfahrzeug (d. i. ein kleines Schiff zum Erleichtern größerer), das vorn und hinten spitz ist.
Jacht = Lustfahrzeug, zum Schnellsegeln eingerichtet.
Schonerjacht = 2-mastige Jacht; Schoner = 2mastiges Schiff.
Jolle = kleines Ruderboot.
Logis = Wohnraum der Matrosen auf dem Schiffe.
Rahe = Segelstangen, die quer vor dem Maste hängen und an denen die Segel befestigt sind.
Gordingen = Taue des Takelwerkes.
Pardunen = lange, starke Taue, die vom oberen Teil der Masten nach den beiden Seiten der Schiffe gehen.
Wanten = Seitentaue an den Masten.
Fockwanten = Seitentaue am Vorder- oder Fockmast.
Seising = kurzes, plattgeflochtenes Tau.
Fallreep = Taue, die an beiden Seiten der Fallreepstreppe angebracht sind und zum Anhalten beim Hinaufsteigen dienen.
Davit = drehbarer Kran für die Schiffsboote.
Persenning = Schutzdecke aus geteertem Segeltuch.
Sahling = Hölzer zur Befestigung der Stengen, d. s. die oberen beweglichen Teile der Masten.
Roof = eine Art Hütte auf dem Verdeck.
Gieren = von der geraden Fahrrichtung abweichen.
Dünung = Wellenbewegung des Meeres gegen die Windrichtung.
Pütze = Eimer.
Aus: Westermanns Monatsheften, Dezemberheft 1910. Braunschweig.
Der Erzählung liegt, wie die Verfasserin versichert, eine wahre Begebenheit zugrunde. Der Schauplatz ist Südwestafrika zur Zeit des Hottentottenaufstandes.
Die Hottentotten, die den Süden dieser deutschen Kolonie bewohnen, sind Nama-Hottentotten, zu denen der Witboistamm gehört. Sie sind von den Negern grundverschieden, schon ihre Hautfarbe ist nicht schwarz, sondern schmutzigolivengelb. – Bambuse = Diener; Pad = Pfad.
Hermann Kurz (1813–1873) ist in der württembergischen Stadt Reutlingen, die aber bis zum Jahre 1803 freie Reichsstadt war, geboren. Hier in Reutlingen hebt seine spannende, an Überraschungen und wunderlichen Zufällen reiche Familiengeschichte an. Zu wunderlich will uns manches dünken, was er mit behaglicher Breite berichtet, aber wir wissen, er erzählt nach dem Leben, so, wie sich die Geschichte zugetragen und wie sie von Geschlecht zu Geschlecht in seiner Familie überliefert worden ist. Auch das Leben schreibt Romane.
Das Ganze ist um die verhältnismäßig lange Einleitung gekürzt, in der Kurz vor allem die glorreiche Vergangenheit seiner Vaterstadt schildert; diese Kürzung ist berechtigt, da der Dichter selbst sich diese Einleitung zu mehreren aufeinanderfolgenden Geschichten gehörig gedacht hat. – Nuster bedeutet eigentlich Korallenhalsband; hier = Halsband.
Aus: Wilh. v. Polenz, Luginsland. Fontane & Co., Berlin.
v. Polenz, ein genauer Kenner seiner Heimat, der sächsischen Lausitz, und ein scharfer Beobachter, führt uns in das Heim eines Lausitzer Handwebers, und zwar eines Leinewebers.
Das Weben der Leinewand geschieht auf dem Webstuhle. Auf dem Stuhl befindet sich, wagrecht aufgespannt, die Kette, eine Reihe paralleler Garnfäden, die die Länge des Gewebes bilden sollen. Quer durch die Kette führt der Weber andere Garnfäden, den Einschuß oder Schuß. Der Schußfaden wickelt sich von der Spule eines kleinen Schiffchens, des Weberschiffchens oder Schützen, ab. Der Schützen wird in einem freihängenden, rahmenartigen Gestell, der Lade, mit Schwung seitwärts hin- und herbewegt; die Kettenfäden werden dabei, damit der Schußfaden eingewebt werden kann, durch Treten der im Webstuhl angebrachten Tritthebel in senkrechter Richtung auseinandergesperrt. Das Hin- und Herwerfen des Schützen, das Vor- und Rückschieben der Lade und das Treten des Trittschemelgeschlinges verursacht das dem Weben eigentümliche Geräusch, dem die Lausitzer in Hinblick auf den geringen Verdienst der Handweber die Worte untergelegt haben:
»'s wär besser, 'ch ging batteln« (betteln).
Das Weben verlangt verschiedene Vorbereitungsarbeiten, wie das Treiben und Spulen. Beides hat den Zweck, das zum Gewebe notwendige Garn auf Spulen aufzuwickeln. Mit dem Treibrad wird das Garn, das die Kette bilden soll, auf große Spulen, sog. Pfeifen, gewickelt, und mit dem Spulrad windet man das Garn des Einschusses auf kleinere Spulen. Meist wird diese Arbeit von der Frau und den Kindern des Webers geleistet. Das Scheren bezweckt, die auf den Pfeifen aufgewickelten Fäden wieder zu sammeln und sie auf dem Scherrahmen zweckmäßig zu ordnen, sodaß die Kette dadurch entsteht. Die Kette wird dann fest und gleichmäßig auf die hierzu bestimmte Walze des Webstuhls aufgewickelt. Da diese Walze auch Kettenbaum heißt, so nennt man diese letzte Vorbereitungsarbeit das Aufbäumen.
Die wenigen Proben des Lausitzer Dialekts sind leicht zu verstehen, das Wort » ack« wird als Flickwort gebraucht und heißt soviel als »doch«; Huchz = Hochzeit, hiefrig = schwächlich.
Die Erzählung spielt im Jahre 1809 zur Zeit des Tiroler Freiheitskampfes. Das Stubaiertal und das Wipptal sind zwei bekannte Täler südlich von Innsbruck; wo die beiden zusammenstoßen, liegt ungefähr Schönberg. – Der Scharnitzpaß bildet die alte Grenze zwischen Tirol und Bayern, die Nachbarsleute »von jenseit der Scharnitz« sind also die Bayern. – St. Maria Waldrast ist eine berühmte Wallfahrtskapelle in den Stubaier Alpen.
» Zu letz und langweilach« = zu gering und zu langweilig; » Sprugg« = Abkürzung für Innsbruck.
Aus: Walther Siegfried, Gritli – Ein Wohltäter. Hirzel, Leipzig.
Eine Erzählung aus des Dichters Heimat, der Schweiz! Sie ist so einfach und schlicht wie das Leben der bescheidenen Hausnähterin, von welchem sie handelt. » Tuyahecke« muß wohl besser heißen » Thujahecke«. ( Thuja = Lebensbaum.) Damaszierte Tischtücher = Tischtücher mit eingewebten Mustern, Blumen, Früchten, Menschen- und Tierfiguren usw., abgeleitet von Damast. (Damaskus.)
Im Kanton Waadtland, besonders an den Ufern des Genfer Sees, gedeiht guter Wein.
Aus: Wilhelm Fischer-Graz, Murwellen. Georg Müller, München.
Keine Erzählung für stoffgierige Leser, die bloß wissen wollen, »wie es weiter geht«, sondern mehr für solche, die beim Lesen sinnend verweilen können, die sich auch am Kleinen erfreuen, die Natur und Menschenleben mit Augen betrachten, wie sie der Dichter hat, und mitträumen können von der himmelblauen Stadt, dem Schönen, der Kunst!
Fischer versetzt uns in seine steirische Heimat, in das schöne Graz. Was die im breiten Tale der Mur malerisch gelegene Hauptstadt Steiermarks besonders anziehend macht, sind ihre Anlagen und Gärten, die herrlichen Parkanlagen auf dem Schloßberg, um den sich der Hauptteil der Stadt gruppiert, der Stadtpark, der botanische Garten, »der Wundergarten der Stadt«, wie ihn der Dichter nennt, u. a.
Das Wort » Sech« bedeutet Pflugeisen (verwandt mit Sichel).
Entnommen aus: Wiesbadener Volksbücher, Heft 96. Verl. des Volksbildungsvereins zu Wiesbaden.
Die kleine Humoreske von Charlotte Niese, der bekannten holsteinischen Dichterin, spielt in Blankenese, einem beliebten Ausflugsort der Hamburger, der stromabwärts am rechten Elbufer liegt. Vom Süllberg bei Blankenese hat man einen besonders schönen Blick auf die Elbe. – Othmarschen, ebenfalls am rechten Elbufer, liegt mehr nach Hamburg zu, in unmittelbarer Nähe von Hamburgs preußischer Schwesterstadt Altona. – Die Mundart, die die meisten Personen in der humoristischen Erzählung sprechen, ist ein Gemisch von Plattdeutsch und Hochdeutsch. Kumme = tiefe Schale, hängt zusammen mit Kumpen, Gumpe. Bort = Brett; Kate = Tagelöhnerwohnung, gräsig = grausig, schauderhaft.
Druck von Oscar Brandstetter in Leipzig.
Bilder: Druck V. A. Loës, Leipzig.
