
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nanni Lasca erinnerte sich aus seiner Kinderzeit an nichts anderes als an seinen Vater, den Gevatter Cosimo, der das Seil der kleinen Fähre auf dem Simatoflusse zog, gemeinsam mit Mangialerba, Ventura und dem »Blinden«; er selbst stand mit ausgestreckter Hand da, um den Fuhrlohn für die Überfahrt in Empfang zu nehmen. Karren kamen vorbei, Fuhrmänner zogen vorüber, Leute zu Fuß und zu Pferde, aus allen Gegenden, und sie zogen hinaus in die Welt, stromaufwärts und stromabwärts. –

Früher war Gevatter Cosimo Maultiersänftenträger gewesen. Und Nanni hatte den Vater auf seinen Wanderungen begleitet, über Straßen und Saumpfade, immer mit dem fröhlichen Gebimmel der Maultierglocken in den Ohren. Aber eines Tages, am Abend vor der heiligen Christnacht – ein denkwürdiger Tag – erfuhr Gevatter Cosimo, mit der leeren Sänfte aus Licodia heimkehrend, an der Wegscheide die Nachricht, daß sein Weib in Geburtswehen liege.
»Gevatterin Menica wird Euch diesmal ein schönes Mädel schenken,« sagten ihm alle in der Schenke. Und er war seelenvergnügt und beeilte sich, die Maultiere einzuspannen, damit er noch vor einbrechender Nacht nach Hause käme. Der Braune, der heimtückische Maulesel, der ihn stets scheelen Auges ansah, gewisser Peitschenhiebe halber, die er nicht vergessen hatte, spitzte verräterisch die Ohren, da er bemerkte, wie sein Herr sich gedankenversunken bückte, um ihm, vor sich hinsummend, den Bauchriemen anzuschnallen; und mit einem Male versetzte er ihm einen heftigen Huftritt.
Nanni war im Stalle geblieben, um das bißchen Gerste zusammenzukehren, das im Futtertrog zurückgeblieben war. Als er den Vater erblickte, der auf der Tenne lang ausgestreckt dalag, sich das Knie mit beiden Händen hielt und kreidebleich im Gesicht war, wollte er zu schreien anfangen. Doch Gevatter Cosimo stammelte: »Geh lieber frisches Wasser holen. Geh den Onkel Carmine holen, damit er mir beistehe.«
Der Schenkbursch kam atemlos herbeigeeilt.
»Was ist denn geschehen, Gevatter Cosimo?«
»Nichts, Misciu. Ich fürchte, ich habe das Bein gebrochen. Geh lieber deinen Herrn holen, damit er mir beisteht!«
Onkel Carmine geriet jedesmal in Wut, wenn man ihn rief.
»Was ist denn? was ist passiert? Nicht einen Augenblick hat man Ruhe, heiliger Gottseibeiuns!«
Endlich erscheint er gähnend an der Türe, die Kapuze bis auf die Augen herabgesenkt.
»Was ist denn passiert? Was wollt Ihr? Laßt mich nur machen, Gevatter Cosimo.«
Der Ärmste ließ ihn ruhig gewähren, während sein Bein herabbaumelte, wie wenn es gar nicht mehr sein eigen gewesen wäre.
»Das ist eine sehr böse Sache; da kann nur die alte Gagliana helfen,« meinte der Onkel Carmine, indem er das Bein behutsam wieder hinlegte.
Da fuhr Cosimo entsetzt zusammen und fiel auf das Stroh zurück, schreckensbleich mit weit aufgesperrten Augen.
»Sei doch still, zum Teufel! Du bringst deinem Vater Unglück mit deinem Geflenne!« rief Onkel Carmine aus, dem das Winseln Nannis, der ihm an den Fersen saß, lästig zu werden begann.
Und so brach der Abend herein, grau, totenstill. Dann hörte man von ferne die Glocken der Kirche von Francofonte, die eben zu läuten begannen.
»Eine schöne Weihnacht hat mir der liebe Gott geschickt!« stammelte Gevatter Cosimo, der vor Entsetzen kaum ein Wort hervorbrachte.
»Hört, mein Freund,« sagte endlich der Onkel Carmine, der verspürte, wie ihm die Feuchtigkeit des Biviere-Flusses in die Knochen drang, »hier können wir nichts tun. Um Euch von da fortzubringen, wie Ihr da jetzt liegt, dazu brauchte man mindestens zwei Ochsen.«
»Wollt Ihr mich denn da liegenlassen, mitten auf der Straße?« begann Cosimo zu jammern.
»Nein, nein, wir sind ja Christenmenschen, Gevatter Cosimo. Wir müssen bloß warten, bis Onkel Mommu kommt, damit er uns mithilft. Inzwischen werde ich Euch ein Bündel Heu schicken und auch die Decke des Maultieres, wenn Ihr wollt. Die Abendkühle ist bösartig hier am Fluß, mein Freund. Seit dreizehn Jahren schon kaufe ich Medizinen!«
»Der Herr hat Malaria,« sagte dann Misciu, der Stallbursche, der mit dem Heu und der Decke zurückkehrte. »Er tut nichts als schlafen, den ganzen lieben Tag.«
Inzwischen war über den Bergen der erste Stern am Firmament erschienen, dann ein zweiter, ein dritter. Gevatter Cosimo lag da, den kalten Schweiß auf der Stirne, die Nase aufwärts gerichtet, zählte die Sterne der Reihe nach und fing von neuem zu jammern an: »Kommt denn der Gevatter Mommu noch immer nicht? Laßt ihr mich denn die ganze Nacht hier liegen, ihr Christenmenschen?«
»Er wird schon kommen, er wird schon kommen; seid nur unbesorgt,« erwiderte Misciu, der auf einem Stein zusammengekauert dasaß, das Kinn auf die Hände gestützt. »Er ist auf die Jagd gegangen. Manchmal vergehen Monate und Wochen, ohne daß ihn eine lebende Seele zu Gesicht bekommt; aber jetzt zur Weihnacht muß er ja kommen, um seine Sachen zu holen.«
Und der Knabe fing, während Misciu ins Blaue hineinredete, nach und nach zu schlummern an, gleich ihm das Kinn auf die Hände gestützt, in seine Lumpen eingehüllt.
»Er kommt in der Nacht, er kommt am Tage, je nachdem die Jagd ausfällt. Wenn er den Enten auflauert, legt ihm der Onkel Carmine den Schlüssel unter die Haustüre. Dann schläft er am Tage oder er geht da- und dorthin, das Wild verkaufen; aber seine Sachen hat er immer hier im Stall; sie hängen über seinem Bett: auf dem einen Holznagel die Flinte, auf dem anderen der Jagdsack, alles an seinem Platze, soviel Jahre als er hier wohnt. Der Onkel Carmine sagt, daß er noch jung war …«
Als Gevatter Cosimo wieder zu wehklagen anhub, schreckte der Knabe zusammen, wie wenn er jäh aus dem Schlafe geweckt worden wäre, und dann fuhr er fort, vor sich hinzubrummen, wie im Traume. Nanni, der des Schluchzens müde war, sperrte die Augen in der Finsternis weit auf. Plötzlich lief ein Huhn davon, laut gackernd.
»O, Onkel Mommu!« schrie Nanni mit erhobener Stimme.
Dann breitete sich eine große Stille aus in der Nacht.
»Ich weiß,« sagte endlich Misciu, »er antwortet nicht, um nicht die Enten zu schrecken; denn er hat sich an dieses Leben gewöhnt und spricht nie ein Wort.«
Man hörte aber schon das Rauschen dürrer Binsen und das Glucksen der großen Schuhe Onkel Mommus, der den Kiesgrund durchwatete.
»Hierher, Onkel Mommu! Gevatter Cosimo ist da; es ist ihm ein Unglück zugestoßen.«
Der Onkel Mommu besah sich den Verwundeten beim matten Schein der Laterne Gevatter Carmines, ganz starr vor Kälte, mit zuckenden Augenwimpern, und mit seiner unheimlichen Habichtsnase umherschnüffelnd. Dann hoben sie den Sänftenträger empor, so wie Onkel Carmine anordnete, der eine bei den Schultern, der andere bei den Füßen.
»Donnerwetter, habt Ihr aber schwere Knochen, Gevatter Cosimo!« pfauchte der Wirt, um ihm durch irgendeinen Scherz Mut zu machen.
Und der Onkel Mommu, der nicht allzu kräftig gebaut war, wankte wirklich wie ein Trunkener unter seiner Last.
»Ach, was für ein Christfest hat mir der liebe Herrgott geschickt!« wiederholte von neuem Gevatter Cosimo, der endlich wie ein Toter auf den Strohsack hingelegt worden war.
»Macht Euch weiter keine Gedanken, Gevatter Cosimo; die alte Gagliana macht Euch im Handumdrehen wieder gesund. Man muß sie holen lassen. Gevatter Mommu, Ihr geht ja ohnehin nach Lentini, um Eure Ware zu verkaufen; auf dem Wege dorthin ruft Ihr die Gagliana.«
Der Alte nickte zustimmend mit dem Kopfe, und während er sich anschickte, sich auf den Weg zu machen, und das Tuch um den Kopf band und den Ranzen über die Schulter warf, fuhr der Wirt fort: »Die Gagliana ist jedenfalls besser als ein Chirurg! Ihr werdet sehen, sie heilt Euch in kürzerer Zeit, als Ihr braucht, um ein Ave-Maria zu beten. Nur nicht den Kopf verlieren, Gevatter Cosimo! Und wenn Ihr jetzt nichts weiter braucht, so will auch ich meine Christnacht feiern mit meinen paar Maccheroni!«
»Und du? Willst du nicht auch einen Bissen essen?« fragte der Sänftenträger, sich an seinen Knaben wendend, der sich nicht vom Flecke rührte, bleich, die Hände in den Taschen, das Gesicht noch benetzt von den Tränen, die er geweint hatte.
»Nein,« antwortete Nanni, »nein, ich habe keinen Hunger mehr.«
»Mein armer Sohn! was für ein trauriges Weihnachtsfest ist auch dir beschieden!«

Die Gagliana kam bei Tagesanbruch, als der Onkel Cosimo schon glutrot im Gesicht und sein Bein schon angeschwollen war wie ein Schlauch, so daß man ihm die Hosen aufschneiden mußte, um sie ihm abzunehmen. Und während die Gagliana diskret auf die andere Seite sah, mit gesenkten Augen, bereitete sie schön langsam alles Nötige vor, Binden, Holzschienen und Pflaster aus gewissen Kräutern, die nur sie kannte. Dann begann sie das Bein zu ziehen und zu strecken wie ein Scharfrichter. Vorerst sagte Gevatter Cosimo kein Wort; große Schweißperlen standen ihm auf der Stirn, und er keuchte, wie wenn er eine schwere Arbeit verrichtete. Aber dann entfuhr ihm plötzlich ein so furchtbarer Schrei, daß allen Anwesenden die Haare zu Berge standen.
»Laßt ihn nur schreien, das tut ihm gut!«
Gevatter Cosimo heulte und brüllte tatsächlich wie ein Vieh, das man niederknallt. Und so hatte sich auch der Onkel Carmine erhoben, um mit seinen schlaftrunkenen Augen zu sehen, was denn los sei. Und Nanni kreischte, wie wenn man ihn umbrächte.
»Ihr kommt mir vor wie ein Knabe, Gevatter Cosimo,« sagte ihm der Wirt. »Hat man Euch denn nicht gesagt, daß Ihr Euch ruhig verhalten sollt? Was würdet Ihr denn erst tun, wenn Euch, Gott behüte, ein Chirurg in der Arbeit hätte?«
»Na, das fehlte ihm noch!« fuhr die Alte auf, wie wenn man sie gestochen hätte. »Der hätte ihm zumindest das Bein abgenommen, dem Armen! Ich habe in meinem Leben noch niemals geschnitten, Gott sei Dank! Das ist alles Gottes Gnade, die mir zuteil wird! Seid nur unbesorgt, Gevatter Cosimo, Ihr braucht jetzt gar nichts mehr!«
Sie spuckte das Pflaster, das sie im Munde gekaut hatte, auf das geschwollene Knie, legte die Schienen an das Bein und zog die Binden fest an, ohne auf die Wehrufe des Kranken zu achten, und schnatterte dabei unaufhörlich gleich einer Ente. Und als sie damit fertig war, reinigte sie sich die Hände an ihrem struppigen, grauen Haar, das gleich einer schmutzigen Haube ihren Kopf umhüllte.
»Wie ein Teufel sieht die Hexe aus!« flüsterte der Schenkwirt dem Onkel Mommu zu, der mit schwermütigem Antlitz der Operation zugesehen hatte und an seinem Schwarzbrot kaute.
Der Onkel Cosimo hatte sich von neuem ausgestreckt; schweißtriefenden, fahlen Gesichts, hatte er die Hand seines Knaben gestreichelt und dabei gestammelt, es sei nichts!
»Wer bezahlt mich aber jetzt?« fragte endlich die Gagliana.
»Seid nur getrost, Ihr werdet bezahlt werden,« antwortete der Ärmste, mehr tot als lebendig. »Ich werde meinen Maulesel verkaufen, und mit Gottes Hilfe werde ich Euch bezahlen, liebe Schwester!«
Da es ein schöner Weihnachtstag war und die Sonne bis in den Stall hineinschien, wo die Hühner einige Brotkrumen aufpickten, da machten die Leute, die von der Messe aus der Kirche zu Primosole kamen, ein wenig halt, um auf halbem Wege einen Schluck zu trinken. Und als sie Gevatter Cosimo auf dem Strohlager des Stalles liegen sahen, wollten sie wissen, wieso und woher und warum. Dann warfen sie rasch einen Blick auf die Maultiere im Hintergrunde des Stalles. Der Schenkwirt, der sofort ein Geschäftchen witterte, machte sich nach vorne und sagte: »Schöne, gute Tiere! Gute Gattung! Gold wert für den, der sie kauft, wenn, was Gott verhüte, Gevatter Cosimo lahm bleiben sollte.«
Der Maulesel wendete seinen Kopf nach rückwärts, wie wenn er verstanden hätte, und kaute dabei weiter an seinem Bündel Heu.
»Nein, nein, so weit ist es mit mir noch nicht!« stöhnte Gevatter Cosimo auf seinem Krankenlager.
»Ich meinte ja bloß so, Gevatter Cosimo. Habt nur keine Angst. Kein Mensch wird sich an Euerm Gut vergreifen, wenn Ihr es nicht selber veräußern wollt. Stroh und Heu ist genug da für Eure Maultiere, und Ihr könnt sie noch hundert Jahre behalten.«
Der Unglückliche überdachte, was wohl seine Maultiere verzehren würden, und seufzte: »Diesmal schaffe ich keine Mitgift mehr für mein jüngstes Mädel, das mir eben geboren wurde!«
»Wir werden Euerm Weibe Nachricht schicken, sobald der Onkel Mommu nach Licodia gehen wird, um dort seine Ware zu verkaufen.«

Und so brachte der Onkel Mommu dem Weibe Gevatter Cosimos die schlimme Nachricht, indem er die Worte langsam hervorstieß und bald auf einem, bald auf dem anderen Bein stand. Vorerst begriff das Weib kein Wort von dem, was er sagte. Das Haus war voller Nachbarinnen, die mit der Taufe so lange warteten, bis der Mann nach Hause käme. Gevatterin Menica, die Ärmste, wollte in der ersten Rage im bloßen Hemd aus dem Bett springen und zum Biviere-Fluß laufen. Der Arzt aber hielt sie zurück und schrie sie an: »Wie die Tiere seid ihr Bauern! Wißt Ihr denn nicht, was ein Kindbettfieber ist?«
»Guter Don Batista, wie kann ich denn den Ärmsten da draußen so liegen lassen, in fremden Händen, in einem solchen Zustand? …«
»Ihr dürft Euch vor allem nicht rühren,« fügte Gevatterin Stefana hinzu, »Euern Mann könnt Ihr später aufsuchen. Fürchtet Ihr etwa, daß er Euch davonläuft?«
»Hört auf den Arzt,« ließ sich die Chilona vernehmen. »Gevatter Cosimo befindet sich in Christenhänden. Ihr seht doch, daß der Arme hier eigens hergekommen ist, um Euch das zu berichten.«
Und Onkel Mommu nickte bejahend mit dem Kopfe und stand da vor dem Bett, mit blinzelnden Augen, und wußte nicht, was er tun sollte, um endlich da herauszukommen und seinen Geschäften nachgehen zu können.

Nun kam die Rekonvaleszenz, das Stillen des Säuglings, das Betreuen der Kinder, und so ging die Zeit vorüber …
Gevatter Cosimo saß nun, nachdem ihm die Gagliana gesagt hatte, er könne aufstehen, auf einem Stuhl an der Tür der Stallung, mit einem Bein, das kürzer war als das andere.
»Ihr könnt von Glück sagen, daß es so gekommen ist. Wärt Ihr dem Bader in die Hände gefallen, so hätte es noch viel ärger aussehen können,« sagte ihm die Gagliana, um ihn zu trösten.
Als der arme Lahme von der Schenktüre aus Nunzio von der »Roten« vorübergehen sah, der seine Sänfte forttrug, da begann er zu seufzen: »Diese Glocken werde ich nicht mehr läuten hören!«
Und der Onkel Carmine sagte ebenfalls: »Was Teufel beklagt Ihr Euch denn? Wegen dieses nichtswürdigen Maulesels, der Euch so zugerichtet hat?«
Inzwischen mußte er aber daran denken, sich sein Brot zu verdienen. Er und sein Junge. Jetzt, wo er lahm war, mußte er sich eine leichte Arbeit suchen. Aber wo wenig Mühe ist, da ist auch wenig Brot. Sein Wunsch nach leichter Arbeit sprach sich herum. Onkel Carmine, der ein guter Kerl war, sprach mit dem und mit jenem, und als er erfuhr, daß einer von der Barke, der Nachbar, an Malaria gestorben war, da sagte er sofort zu Gevatter Cosimo: »Das ist das, was für Euch paßt.«
Und der Wirt von Primosole, in der Nähe des Sineto, ließ sich die Sache derart angelegen sein, daß es ihm gelang, mit Hilfe des Onkel Antonio, dem Aufseher der Fähre so lange zuzureden, bis dieser ja und Amen sagte. Von da an hatte Gevatter Cosimo die Aufgabe, das Seil zu ziehen, das die Leute von einem Ufer des Flusses zum anderen brachte. Und durch jeden Bekannten, den er fuhr, ließ er immer seinem Weibe sagen, daß er sie bald einmal aufsuchen würde, sie und auch das Kind. Bald versprach er, zu Ostern zu kommen, bald zu Weihnachten. Immer ließ er dasselbe sagen, so daß Gevatterin Menica gar nicht mehr daran glauben konnte. Und Nanni sah jedesmal dem Vater in die Augen, um herauszulesen, ob er wahr gesprochen oder nicht.
Zu Ostern und zu Weihnachten gab es immer eine Menge Leute ans andere Ufer zu bringen. Und manchmal kamen mehr als fünfzig Wagen, die vor der Schenke von Primosole warteten. Der Aufseher der Fähre fluchte über den Südwind und über den Ostwind, die ihm das Brot vom Munde raubten. Und seine Leute lungerten beschäftigungslos umher: Mangialerba schlief mit gekreuzten Armen und schnarchte, Ventura saß im Wirtshaus, und der »Blinde« sang den ganzen Tag vor der Türe seiner Hütte und blickte mit seinen glanzlosen Augen zum grauen Himmel empor, aus dem der Regen unablässig herniederfiel.
Gevatterin Menica wäre sehr gerne selbst nach Primosole gegangen, um ihren Mann zu sehen und ihm das Kind zu bringen, das seinen Vater noch nicht kannte – und er war ja doch wirklich der Vater.
»Ich werde hingehen, sobald ich das Geld für meine Webarbeit bekommen haben werde,« sagte sie.
Dann, ein andermal wieder: »Ich werde nach der Olivenernte hingehen, wenn ich ein paar Soldi erübrige.«
So verging die Zeit.
Dann erkrankte Gevatterin Menica sehr schwer, so daß sogar Don Battista, der Arzt, sich nicht mehr zu helfen wußte.
»Euer Weib ist auf den Tod krank,« erzählten dem armen Lahmen Onkel Cheli und Gevatterin Lanzara und alle anderen, die aus Licodia kamen. Und Gevatter Cosimo wollte diesmal wirklich zu Fuß zu ihr hinhumpeln.
»Leiht mir zwei Lire als Reisegeld, Padron Mariano.«
Aber der Vorstand antwortete: »Wartet's doch nur ab; es werden schon bessere Nachrichten kommen. Wenn Euer Weib gesund wird, während Ihr auf dem Wege seid, dann habt Ihr das Reisegeld zum Fenster hinausgeworfen.«
Der »Blinde« dagegen riet ihm, für die Madonna von Primosole eine Messe lesen zu lassen; denn die hatte schon oft Wunder gewirkt.
Da kam endlich die Nachricht, daß die Gevatterin Menica mit den Sterbesakramenten versehen worden war.
»Na, da seht Ihr doch, daß ich recht hatte!« rief Padron Mariano aus. »Was nützt Euch der weite Weg, wenn Ihr ihr nicht helfen könnt!«

Gevatterin Stefana hatte die kleine Waise aus Erbarmen zu sich genommen, und Gevatter Cosimo blieb in Primosole mit seinem Knaben allein als Witwer zurück. Und der Blinde tröstete ihn damit, daß er sagte, er könne mit Gottes Hilfe ebenso wie er bei der Fähre leben und sterben; auch er äße dort seit fünfzig Jahren sein Brot; und er hätte schon so manchen da vorüberziehen sehen, Bekannte und Unbekannte, von denen niemand wußte, woher sie kamen und wohin sie gingen, zu Fuß, zu Pferd, aus allen Himmelsgegenden. Und der Fluß trug sie stromaufwärts und stromabwärts, in die Welt hinaus. Geradeso wie das Wasser des Flusses ins Meer floß, und doch an jener Stelle immer dasselbe Aussehen hatte, zwischen den beiden ausgehöhlten Felsenriffen, hinter denen am rechten Ufer die kahlen Hügel von Valsavoia lagen, am linken Ufer das große rote Dach der Kirche von Primosole, das oft tage- und wochenlang kaum sichtbar durch den Nebel hindurchschimmerte. Dann heiterte sich das Wetter wieder auf, das Grün brach da und dort hervor, zwischen den Felsen von Valsavoia und in der Ebene, so weit das Auge blickte. Dann kam der Sommer, und man sah die grünen Wiesen, die Feldblumen, das blaue Wasser im Fluß und die Trauerweiden an den Ufern, bedeckt mit Staub.

Sonntags änderte sich das Bild. Der Onkel Antonio, der die Schenke von Primosole leitete, ließ den Geistlichen kommen, damit er die Messe lese, und schickte Filomena, seine Tochter, das Kirchlein scheuern und die Soldi einsammeln, die die Gläubigen durch das Fensterchen für die armen Seelen des Fegefeuers in die Büchse warfen. Von allen Seiten kamen sie herbei, zu Fuß und zu Pferd, und die Schenke füllte sich mit Menschen. – Hie und da kam auch Zanno, der jedes Übel heilte, mit seinen Tiegeln und Schachteln und Fläschchen. Und Don Tinu, der Hausierer, kam mit einem großen roten Sonnenschirm, und breitete seine Ware auf den Stufen der Kirche aus: Scheren, Federmesser, Bänder, Zwirn, alles bunt durcheinander. Nanni kam mit den anderen Knaben herbeigeeilt, das alles anzustaunen. Aber sein Vater sagte ihm immer: »Nein, mein Sohn, das gehört nur für Leute, die Geld ausgeben können.«
Die anderen dagegen kauften allerhand ein: Knöpfe, Tabaksdosen, Beinkämme; und Filomena steckte ihre schmierigen Hände überall hinein, ohne daß ein Mensch ihr irgend etwas zu sagen wagte, denn sie war ja die Tochter des Gastwirtes. Eines Tages schenkte ihr sogar Don Tinu ein schönes, gelbrotes Schultertuch, das von Hand zu Hand ging.
»Die Unverschämte,« sagten die Gevatterinnen, »mit allen liebäugelt sie, nur damit sie was geschenkt bekommt!«
Eines Tages überraschte Nanni die beiden, wie sie einander hinter dem Hühnerhof umarmt hielten. Filomena, die sich vor ihrem Vater sehr fürchtete, bemerkte sofort die Späheraugen. Sie sprang hinter der Hecke hervor, den Holzschuh in der Hand.
»Was suchst du da, du Spion? Wehe dir, wenn du erzählst, was du gesehen hast!«
Aber Don Tinu sprach ihr beschwichtigend zu: »Scheltet ihn nicht, den Knaben, Gevatterin Mena; denn sonst muß er ja Schlechtes denken.«
Aber Nanni konnte den Gedanken an das rote Gesicht Filomenas und an die derben Umarmungen Don Tinus nicht loswerden. Als man ihn um Wein in die Schenke schickte, und er vor das Mädchen trat, das vor dem Schenktisch stand, da füllte ihm diese mit finsterer Miene den Krug und zankte ihn tüchtig aus:
»Seht nur einmal den Burschen da! Ein grüner Junge! Ein Milchbart! Und schon guckt ihm die Bosheit aus den Augen!«

Nanni wollte es ebenso machen. Und als er mit Grazia, der kleinen Schenkmagd, Kräuter für die Minestra am Flusse holen ging, da versuchte er sie zu umfassen. Aber das Mädchen erwiderte: »Nein, nein, du gibst mir nie was.«
Sie dagegen brachte ihm, unter dem Brusttuch verborgen, Käserinden, die die Gäste unter den Tisch hatten fallen lassen, oder irgendein Stück Brot, das sie den Hühnern entwendet hatte. Sie zündeten zwischen zwei Steinen ein Feuer an und spielten da miteinander »häuslichen Herd«. Und das Spiel endete stets damit, daß Nanni die ganzen Sachen zusammenpackte und davonlief. Und das Mädchen blieb mit offenem Munde zurück und kratzte sich den Kopf. Und am Abend mußte sie sich die Kopfstücke Filomenas gefallen lassen, die sie häufig mit leeren Händen heimkommen sah. Nanni tat sich inzwischen an den geraubten Kräutern gütlich.
Dann am nächsten Tage schwur er bei allen Heiligen, daß er es nie wiedertun werde. Und die Ärmste lief ihm wieder nach, wenn sie seinen roten Kopf nur von weitem in den gelben Stoppelfeldern erspähte; und ganz leise näherte sie sich ihm und wich ihm nicht mehr von den Fersen. Und dann beklagte sie sich bei ihm über die Schläge, die sie in der Schenke eingeheimst hatte. Nanni sagte ihr, um sie zu trösten:
»Warum läufst du ihr nicht davon und kehrst nach Hause zurück?«
Und dann erzählte er ihr, daß auch er da unten wohne im Dorf und dort Verwandte habe und allerlei. Dort, jenseits der blauen Berge. Einen ganzen Tag brauchte man, um dahin zu gelangen. Und eines Tages würde er auch dahin gehen.
»Laß deinen Herrn und die Schenke im Stich und lauf davon und nach Hause!«
Das Mädchen hörte ihm mit weit aufgerissenem Munde zu. Sie saß da, zusammengekauert auf dem dürren Boden, und blickte verklärten Auges nach der Gegend, von der ihr Nanni so viel Schönes erzählt hatte, da unten, jenseits der blauen Berge. Dann kratzte sie sich am Kopf und antwortete:
»Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Ich habe ja keinen Menschen auf der Welt.«
Und inzwischen belustigte er sich damit, daß er die Steine über die Wasserfläche tanzen ließ, oder er neckte Grazia, indem er sie scherzhaft zum Flusse hinzog oder sie kitzelte. Dann lief sie vor ihm davon, und er folgte ihr und warf ihr Händevoll Erde nach. Und dann gingen sie Grillen fangen oder Glühwürmer. Darin war nun Nanni sehr erfinderisch, ein wahrer Meister. Zu Dutzenden fielen ihm die Tierchen in die Hände, und das gab nun ein Summen und Surren und Leuchten, daß es eine Art hatte.

Der Fluß brach in die Ebene ein wie in eine ungeheure Schlucht. Und manchmal geschah es, daß arme Teufel ihr Glück damit versuchten, den Fluß zu durchwaten. Und die nahmen nun den anderen armen Teufeln, die den ganzen Tag mit dem Seil in der Hand in der Sonne standen, das Brot vom Munde weg. Und oftmals brach ein Streit zwischen ihnen aus. – Und wegen einer Geringfügigkeit zog sich Nanni Fußtritte von seinem hinkenden Vater zu.
Von Zeit zu Zeit kam eine Schar Schnitter vorüber, die zum Meere zurückkehrten, staubbedeckt, und sich barfüßig auf dem Kiesgrund niederließen; und in ihrem fremden Dialekt hörte man Männer und Weiber miteinander plaudern. Dann sah man in der Sonnenglut von ferne Staubwolken hinter einem herankommenden Leiterwagen aufsteigen; hie und da tauchte auch irgendein Saumtier auf, mit seinem Führer. Der »Blinde«, der keinen Menschen auf der Welt hatte und überall herumgekommen war, sagte dann immer:
»Der da kommt aus Catania, der da aus Syrakus.«
Und dann erzählte er den Männern, die ausgestreckt dalagen, von den Wundern, die er in der Ferne gesehen. Und Nanni hörte aufmerksam zu, geradeso, wie Grazia seinen Erzählungen zugehört hatte, die er ihr vorgeschwätzt hatte. Und in den müden Augen, die gewohnt waren, immer und ewig nichts anderes zu sehen als die rauchende, düstere Schenke des Onkels Antonio, leuchtete so etwas auf wie die Halluzination eines Landstreichers!

Aber wer ihm den größten Floh ins Ohr setzte, das war der Zanno, als man diesen eines Tages zum Onkel Carmine gerufen hatte. Die Fußgänger, die nachts bei der Scheune vorübergingen und ihn nicht wie gewöhnlich das Heu in den Stall tragen sahen, fragten:
»Was ist mit Gevatter Carmine?«
Onkel Mommu deutete mit dem Kopf auf ihn hin, wie er ausgestreckt auf dem Strohlager ruhte unter einem Haufen von Lumpen, und Misciu, die Kapuze über den Kopf gezogen, vom Fieber geschüttelt, fügte hinzu:
»Diesmal geht's ihm auch an den Kragen!«
Und wenn er irgendeinen Bekannten an der Stimme erkannte, dann antwortete Onkel Carmine mit einem Röcheln:
»Ich bin hier! Ich bin noch alleweil hier!«
Immer sah man dieselben müden Gesichter vorüberziehen, vor dem matten Licht, das die an einem Pfahl hängende Laterne ausstrahlte; und dem Rucksack entnahmen die Leute das spärliche Essen, das sie langsam verzehrten. Der Onkel Carmine murrte nicht mehr, er rührte sich nicht mehr auf seinem Lager und gab keinen Laut von sich. Bloß wenn er vor der Tür einen Wagen halten hörte, dann hob er ein wenig den Kopf, so schwer ihm dies auch fiel, und in der Hoffnung, ein paar Soldi zu verdienen, rief er:
»Misciu!«
Aber die Leute konnten ihn doch nicht so dahinsterben lassen wie einen Hund. Ventura, Mangialerba und oft auch Gevatter Cosimo, der den kranken Fuß nachzog, kamen eigens aus Primosole herbei und sahen Gevatter Carmine mit leichenfahlem Antlitz ausgestreckt daliegen wie einen Toten. Endlich entschlossen sie sich, die Gagliana zu rufen, das alte Weib, das im Umkreis von zwanzig Meilen Wunder wirkte.
»Ihr werdet sehen, daß Euch die Gagliana im Handumdrehen heilen wird,« sagten sie ihm. »Dieses Teufelsweib kann mehr als ein Arzt. Was meint Ihr, Gevatter Carmine?«
Gevatter Carmine sagte weder ja noch nein, denn er dachte an das viele Geld, das die Gagliana kosten würde. Als ihn aber das Fieber heftiger schüttelte, da fing er an zu ächzen:
»Ruft mir nur die Gagliana. Mag sie kosten, was sie will! Laßt mich nicht ohne Hilfe sterben, ihr guten Leute!«
Als die Gagliana kam, da meinte sie, daß das Fieber schon so weit vorgeschritten sei, daß ihr nichts mehr übrig bliebe, als den Geistlichen zu rufen.
Es war gerade Sonnabend, und die Leute kamen und gingen … Alles das machte nun auf Nanni, der auch herbeigeeilt war, einen großen Eindruck: die Neugierigen, die sich an der Türe die Hälse nach dem Sterbenden ausreckten; die Gagliana, die fluchend in ihren Taschen nach dem richtigen Heilmittel suchte; der Kranke, der einen nach dem anderen mit erlöschenden Augen anblickte, und der Blinde, der sich über die Gagliana lustigmachte, die das richtige Mittel nicht finden konnte, und sie fragte:
»Habt Ihr am Ende auch ein Mittel bei Euch, um mich wieder sehend zu machen?« …
Der Onkel Carmine starb in derselben Nacht. Schade! Denn am Sonntag kam zufällig Zanno vorüber, der in seinen Schachteln das richtige Mittel gegen alle Übel hatte. Sie führten ihn vor den Toten. Er betastete ihm den Leib, den Puls, die Zunge, und kam schließlich zu dem Ergebnis:
»Wäre ich gestern hier gewesen, der Onkel Carmine wäre sicher nicht gestorben!«
Er erzählte eine Menge Wunder, die er getan, genau so, wie die Gagliana, und von Ländern, die er gesehen; und da Nanni ihm mit offenem Munde zuhörte, klopfte er dem Knaben, der ihm gefiel, auf die Schultern, fuhr ihm liebkosend über die roten Haare und sagte ihm:
»Willst du mit mir kommen? Du kannst mir den Sack nachtragen, und du wirst ein Mann werden!«
»Der hat eine ganz andere Last zu tragen,« seufzte Gevatter Cosimo. Und er dachte daran, daß, wenn ihm ein ähnliches Unheil zustoßen würde wie Gevatter Carmine, sein Sohn verlassen und hilflos in der Welt stehen müßte.
Auch der Schenkwirt von Primosole war dabei, der Filomena mit Lanzise verheiratete, einem wohlhabenden Mann, der natürlich von nichts wußte; sie waren alle aus Lentini zurückgekommen, wo man handelseinig geworden war: die Brautleute, Gevatter Antonio und noch andere. Lanzise hatte, was man brauchte, um anständig leben zu können; ein Stückchen Feld, Rinder und einen kleinen Weinberg in Savona, so erzählte man sich.

Die Hochzeit wirbelte viel Staub auf. Auch Don Tinu kam herbei, um seine Ware zur Brautausstattung anzubringen. Am Abend saß er in der Schenke, wie gewöhnlich. Man weiß nicht, wie es geschah – höchstwahrscheinlich handelte es sich um einen Fehler in der Rechnung – kurz, er geriet in einen Streit mit Onkel Antonio, und Don Tinu ließ sich hinreißen, ihn »Hahnrei« zu nennen.
Gevatter Antonio war ein kleines, unscheinbares Männchen, blind auf einem Auge, und wenn man ihn so sah, würde man nicht einen Soldo für ihn gegeben haben. Man sagte ihm aber trotzdem nach, daß er mehr als einen Totschlag auf dem Gewissen habe, und auf zwanzig Meilen im Umkreise brachte man ihm großen Respekt entgegen. Als ihm von Don Tinu, der ohnehin ein aufreizendes Aussehen hatte, jenes häßliche Wort ins Gesicht geschleudert wurde, da nahm er seine Flinte von der Wand, um sich auf seine Weise Recht zu schaffen, während sein Weib, das schon seit Jahren durch die Malaria ans Bett gefesselt war, im bloßen Hemd sich aufrichtete und kreischte: »Hilfe! Hilfe! Er bringt ihn um! Herbei, ihr Christenmenschen!«
Und Filomena warf, um die beiden Männer zu trennen, Teller und Gläser auf Don Tinu, indem sie wie eine besessene schrie: »Schuft! Dieb! Gottloser!«
»Ist das eines Ehrenmannes würdig, was Ihr da tut, Gevatter Antonio?« erwiderte Don Tinu, noch aschfarbener im Gesicht, als er ohnehin schon war. »Ich habe keine andere Waffe bei mir als dieses Federmesser.«
»Ihr habt recht,« sagte Onkel Antonio. »Ich werde Euch auf gleiche Weise Rede stehen.«
Und er legte die Flinte beiseite, ohne ein Wort weiter hinzuzufügen. Später, als Nanni in die Schenke Wein holen ging, begegnete er Don Tinu, verzerrten Antlitzes, und bemerkte, wie dieser sich argwöhnisch umsah.
»Da sind zwei Soldi für dich,« sagte er ihm. »Geh jetzt zu Gevatter Antonio und sage ihm, daß ich ihn hier erwarte; er weiß schon warum. Aber laß dich vor niemand blicken. Verstehst du?«
Am Abend fand man Gevatter Antonio der Länge nach ausgestreckt hinter einer Kaktushecke, mit seinem Hund zur Seite, der ihm die Wunde leckte.
»Was ist denn geschehen, Gevatter Antonio? wer hat Euch den Messerstich versetzt?«
Gevatter Antonio wollte es nicht sagen.
»Tragt mich jetzt nach Hause und legt mich ins Bett. Wenn ich am Leben bleibe, weiß ich, was ich zu tun habe. Und wenn ich sterbe, dann weiß es der liebe Gott.«
»Das ist Don Tinu, der mir ihn umgebracht hat!« kreischte sein Weib. »Er hat ihn rufen lassen durch Nanni, des Lahmen Sohn!«
Und Filomena fuhr fort zu fluchen: »Schuft! Dieb! Gottloser!« – – –
Gevatter Cosimo, der eine große Angst vor den Gerichten hatte, zankte seinen Knaben tüchtig aus, weil er sich in Dinge gemischt habe, die ihn nichts angingen.
»Wenn ich dich erwische, dann setzt es Hiebe, die du dir merken wirst!«
Nanni bekam daher Angst und flüchtete sich auf das andere Ufer des Flusses, ohne einen Bissen zu sich genommen zu haben, wie ein wildgewordenes Tier. Grazia sah ihn von ferne, mit seinen roten Haaren, hinter dem Buschwerk, und eilte ihm nach.
»Jetzt geh ich mit Zanno,« sagte er, »und zur Fähre kehre ich nie mehr zurück.«
Dann, als er sich nach und nach versichert hatte, daß der Onkel Cosimo hinter dem Buschwerk nicht sichtbar wurde, mit seinem Stock, und nachdem er sich mit Hilfe von großen Steinen, die er dann nach und nach wieder beiseite schleuderte, einen Übergang geschaffen hatte, wobei ihm das Mädchen staunenden Blickes gefolgt war, bemerkten beide plötzlich, daß die Sonne bereits untergegangen und der Nebel hereingebrochen war und Fluß und Ebene einhüllte.
»Horch!« rief Grazia, »Onkel Cosimo ruft dich!«
Nanni rannte schnurstracks davon, ohne ein Wort zu erwidern, und sie lief ihm, barhäuptig und bloßfüßig, keuchend nach, wobei ihr kurzes Röckchen im Winde flatterte. So waren sie ein Stück Weges dahingeeilt, und nun befanden sie sich ganz allein inmitten der finsteren Ebene, lautpochenden Herzens, weit entfernt von der Fährenhütte, von wo noch, kaum hörbar, des Blinden Gesang herüberklang. Es war eine schöne, sternenhelle Nacht, und die Grillen zirpten ringsum in den Stoppelfeldern. Als Nanni stehenblieb, bemerkte er erst Grazia, die ihm gefolgt war.
»Ja, wohin gehst denn du da?« fragte er sie.
Sie antwortete nicht. Und ringsum begannen die Grillen von neuem zu zirpen, und sonst hörte man keinen Laut. Bloß in den Ährenfeldern rauschte es ein wenig, und sobald sie stehenblieben, um zu lauschen, trat eine große Stille ein, fast wie wenn die Finsternis sich ihrer hätte bemächtigen wollen. Von Zeit zu Zeit blies der heiße Südwind, und es war, wie wenn ein Schatten über die Ährenfelder hinweghuschte. Da fing Grazia zu weinen an.
Kurz darauf kam ein Fuhrmann mit seinen Maultieren vorüber, und die Kleine jammerte:
»Bringt uns ins Dorf, Euer Gnaden! habt Erbarmen! –«
Der Fuhrmann murmelte, halb eingeschlummert, einige unverständliche Worte und zog seines Weges weiter. Und die beiden Kinder trabten hinterher. Sie langten bei einer Stallung an und kauerten sich hinter die Mauer, um den Tag abzuwarten.
Endlich begann der Morgen zu grauen, und ein Hahn hub auf dem Mist zu krähen an. Auf einem Pfad tauchte ein altes Männchen auf, mit einem Ranzen auf dem Rücken. Er hatte ein gutmütiges Aussehen, und Grazia fragte ihn: »Wo geht der Weg ins Dorf? Bitte, sagt es uns, Euer Gnaden!«
Der Onkel Mommu nickte bloß mit dem Kopfe und setzte seinen Weg fort, ohne aufzublicken. Sie gingen hinter ihm her, und als sie auf dem Dorfplatz anlangten, wo er seine Ware feilbieten wollte, da war es heller Tag geworden. Ein in ein weißes Mäntelchen fest eingehülltes Weibchen saß bereits da, um Obst und Gemüse zu verkaufen, andere Weiber sah man zur Kirche gehen, vor der Stallung wurde ein Maulesel geschröpft, und mehrere Bauern sahen fröstelnd zu, das Tuch um den Kopf gebunden und die Hände in den Taschen. Vom Kirchturm her, der schon in der Sonne glänzte, läutete die Glocke zur Messe.
Sie setzten sich traurig auf einen Rinnstein neben dem Alten, mit dem sie gekommen waren, der Enten und Hühner feilbot, die keiner kaufte, und warteten auf Zanno, der nicht kam. Die Zeit ging vorüber, und es erschienen Leute, die bei dem kleinen Weibchen Gemüse kauften, indem sie jedes einzelne Stück in den Händen abwogen. Auf einem Seitenpfad tauchten zwei Herren auf, mit hohen Hüten; langsam schritten sie heran und blieben lange vor den Waren stehen, betasteten alles mit ihren Stöcken und gingen dann wieder ihres Weges, ohne etwas gekauft zu haben. Dann kam die Schenkmagd, um eine Schürze voll Tomaten zu kaufen. Auf dem Platze führte man den geschröpften Maulesel auf und ab. Endlich schloß der Drogist seinen Laden, während es zu Mittag läutete.
Da zog der Onkel Mommu aus seinem Ranzen ein Schwarzbrot und eine Zwiebel hervor und begann langsam an beiden zu kauen. Als er bemerkte, wie die beiden Kinder ihm hungrig zusahen, schnitt er jedem ein großes Stück herunter, ohne ein Wort zu reden. Dann nahm er seine Ware wieder auf und ging gesenkten Hauptes wieder weiter, so wie er gekommen war.
Nun blieben sie allein und verzagt zurück. Sie nahmen einander bei der Hand und gingen zum Brunnen. Auf dem Wege dahin begegneten sie vielen Leuten. Weiber kamen, um Wasser zu holen, Fuhrleute, um ihre Maultiere zu tränken, und Bauernpaare, die von den Feldern kamen und mit lauter Stimme schwatzten und ihren leeren Ranzen am Handgriff der Karste angebunden trugen. Dann erschien ein Rudel Schafe, in eine Staubwolke eingehüllt. Ein Kapuziner kam vom Almosensammeln, sprang von einem schönen Maulesel herab und beugte sich zum Ausflußrohr hinab, um, ganz rot im Gesicht, Wasser zu trinken, das ihm über seinen langen, struppigen und staubigen Bart herabrieselte. Und wenn niemand vorüberging, dann kamen Bachstelzen auf die Steine gehüpft, die inmitten des Straßenkotes mit den Schwänzen umherschlugen, von ferne hörte man den eintönigen Gesang der Drescher in den Tennen. Und die endlose Ebene war schon eingehüllt in den abendlichen Hitznebel. Und im Hintergrund lag der Fluß gleich einem mattleuchtenden Spiegel.
»Sieh nur, wie ferne er liegt,« sagte Nanni, und es schnürte ihm das Herz zusammen.
Die Sonne war untergegangen, aber sie wußten noch nicht, wohin sie ihre Schritte lenken sollten, und sie saßen da in banger Erwartung, eines neben dem anderen, an einer Mauer, im Dunkeln. Dann endlich nahmen sie einander bei der Hand und gingen wieder gegen das Dorf zu. In den Häusern schimmerte noch hie und da ein Fenster im matten Lampenlicht; aber sobald die beiden vor irgendeinem Häuschen stehenblieben, begannen die Hunde zu bellen, und im Hause erhob sich eine drohende Stimme: »Wer ist da?«
Das Mädchen warf, völlig entmutigt, Nanni die Arme um den Hals. Dieser wehrte jedoch ab und sagte mit tränenerstickter Stimme: »Nicht, nicht! Laß mich in Ruhe!«
Unter dem Schutze des hervorspringenden Daches einer Bauernhütte verbrachten sie die Nacht und hielten einander fest umschlungen, um sich zu wärmen. Das Feiertagsglockengeläute weckte sie, und die Sonne stand schon hoch. Während sie ihres Weges gingen und die Leute im Festtagsgewande an ihnen vorüberzogen, entdeckten sie auf dem Platze Don Tinu, den Krämer, mit seinen unter dem roten Schirm ausgebreiteten Schachteln.
»O, Don Tinu,« sagte Grazia, ganz freudig erregt. »Schön willkommen, Euer Gnaden.«
Don Tinu aber antwortete stirnrunzelnd: »Wer bist du? Ich kenne dich nicht.«
Das Mädchen entfernte sich, ganz eingeschüchtert. Aber Don Tinu erblickte den Knaben, der ängstlich von ferne auf ihn sah und sagte ihm: »Du bist der von der Schenke. Ich weiß.«
»Ja, Euer Gnaden,« antwortete Nanni mit dem gewissen Lächeln eines Betteljungen.
Und den ganzen Tag umkreiste er ihn, schon halb verhungert. Als er sah, daß Don Tinu seinen Kram wieder zusammenpackte und im Begriffe war, seines Weges zu gehen, da faßte er sich Mut und sagte ihm: »Wenn Ihr mich haben wollt, Euer Gnaden, so werde ich Euch Eure Sachen tragen.«
»Es ist gut,« antwortete Don Tinu. »Aber deine Gefährtin laß ihrer Wege gehen; denn Brot für zwei habe ich nicht.«
Grazia entfernte sich ganz verzagt, langsamen Schrittes, mit den Händen unter der Schürze. Und dann sah sie traurig von der anderen Ecke zu Nanni hinüber, der, mit unter der ungewohnten Last tief gebeugtem Rücken, hinter dem Krämer einhertrottete.

Ein guter Kerl war er, der Don Tinu. Immer lustig, auch wenn er irgendeinen Fußtritt oder ein Kopfstück einheimste. Auf dem Wege erzählte er dem Knaben allerhand lustige Geschichten, um ihn aufzuheitern und um die Langeweile des Marsches zu verscheuchen. Oder er lehrte ihn Messer werfen auf Stellen, die außerhalb des Weges lagen.
»Auf diese Weise wirst du ein Mann,« sagte er ihm.
So gingen sie von Dorf zu Dorf, überall dorthin, wo gerade Jahrmarkt war. Es gab da Höker, Hausierer, Vieh und festlich gekleidete Menschen. Und Zanno, der den Leuten allerlei Hokuspokus vormachte und sich die Arme ausrenkte, um Pflaster und geweihte Münzen zu verkaufen, Zähne zu ziehen und die Zukunft zu weissagen, keuchte und schwitzte, daß es eine Art hatte. Die Neugierigen umstanden ihn mit weit aufgerissenem Munde, unbekümmert um die Sonne, die auf sie herabbrannte. Dann kam der Heilige, den man in der Prozession umhertrug, und die Musikbande folgte. Und die Weiber standen den ganzen Tag vor ihren Türen, mit all ihrem Schmuck bedeckt, und gähnten vor Langerweile. Des Abends wurden überall Kerzen und Lampions angezündet, und die Leute lustwandelten auf den Gassen.
Und Don Tinu sagte: »Wenn du bei deinem Vater auf der Fähre geblieben wärst, so hättest du doch alle diese schönen Dinge nicht gesehen, was?«

So kamen sie einmal auch in Nannis Heimat. Dieser fand sich nach so langer Zeit dort gar nicht mehr zurecht. Und als er bei seinem Hause vorüberkam, sah er eine Scheune, die damals gar nicht dagewesen war, und Leute, die er nicht kannte, die ihrer Arbeit nachgingen und sich nicht um ihn kümmerten. Er forschte auch nach seinen Verwandten. Der Bruder Pierantonio war Schnitter geworden, da unten in der Nähe des Meeres, und die Schwester Benedetta hatte einen Mann geheiratet, den ihr die Gevatterin Stefana zugeführt hatte. Und sie bewohnten alle miteinander ein ganz neues, schönes Haus, mit einer kleinen Veranda und mit einem Himmelbett, und sie wollten den Landstreicher gar nicht aufnehmen. Aber die Gevatterin Stefana war, als sie erfuhr, wer er sei und woher er käme, sehr neugierig, von ihm etwas Neues zu hören, und sie kochte ihm eine Suppe und gab ihm ein Stück Brot und ein Glas Wein; aber er lehnte dankend ab, denn es machte ihm den Anschein, als ob die beiden Weiber ihm das bißchen Essen nicht vergönnten. Seine Schwester stand an der Türe, mit gekreuzten Armen, und spähte lauschend hinaus, ob ihr Mann nicht etwa käme, wobei sie der Gevatterin Stefana durch Blicke zu verstehen gab, daß sie auf glühenden Kohlen stände … Er wußte nicht, wie ihm geschah. Er wußte nicht, sollte er essen, sollte er erzählen, und er saß da, schüchtern und mit offenem Munde, und hörte zu, was ihm die beiden in kurzen, abgebrochenen und unzusammenhängenden Worten vom Vater und vom Bruder mitteilten. Es war sonderbar, daß die beiden ihm nach so langer Zeit, da sie ihn nicht gesehen, so wenig zu berichten hatten. Benedetta war übrigens nur seine Milchschwester; ihren wirklichen Vater hatte sie gar nicht gekannt.
»Das arme Waisenkind,« sagte laut Gevatterin Stefana, »hat ja keinen Menschen auf der Welt gehabt, weder Freunde noch Verwandte! Sag du selbst, mein liebes Kind, was hättest du getan, wenn ich nicht gewesen wäre?«
Benedetta nickte bloß mit dem Kopfe und warf ihr einen dankbaren Blick zu. Dann warf sie einen verstohlenen Blick auf den Bruder und senkte den Kopf. Endlich fragte sie ihn, ob er lange dazubleiben gedenke, wobei sie ihn immer mit »Ihr« ansprach, ohne ihn anzusehen. Gevatterin Stefana dagegen heftete die Blicke fest auf ihn, wie wenn sie in sein Innerstes hätte eindringen wollen. Aus ihren Mienen sprach dabei so viel Argwohn, daß es dem armen Nanni ganz unheimlich zumute wurde.
Kaum war er wieder draußen auf der Straße, da hörte er, wie hinter ihm heftig der Riegel zugeschoben wurde.
»Das ist schon einmal nicht anders,« sagte später Don Tinu, als er von dem Besuch bei der Schwester erfuhr. »Die Welt ist groß, und ein jeder hat für sich selbst zu sorgen.«

So zogen die beiden in der Welt umher, dahin und dorthin, in alle Dörfer und Gastwirtschaften, wo es Jahrmärkte und Messen gab; überall boten sie ihre Ware aus. Und eines Tages kamen sie auch nach Primosole, nach so langer, langer Zeit.
»Jetzt sollst du auch einmal deinen Vater sehen, wenn er noch am Leben ist,« sagte Don Tinu.
Nanni wollte nicht, halb aus Scham, halb aus Angst; aber der Hausierer fügte hinzu:
»Laß mich nur machen. Was ich tue, ist gut getan.«
Und er ging vorerst allein zu Gevatter Cosimo, der noch immer bei der Fähre beschäftigt war und immer noch sein gelähmtes Bein nachzog.
»Euer Sohn Nanni ist hier, Gevatter Cosimo. Er ist eigens gekommen, um Euch die Hände zu küssen.«
Onkel Cosimo hatte das Wechselfieber und saß da in der Sonne, an das Seil gelehnt, den Kopf eingebunden. Er nickte bloß. Und als dann Nanni kam, da sagte er:
»Der liebe Gott sei mit dir, mein Sohn, und stehe dir bei!«
Und während er das sagte, traten Tränen in seine Augen, als er sah, was für ein schöner Bursche sein Nanni geworden war. Dann erzählte er ihm von Benedetta und vom Bruder, die er besucht habe, und dabei schüttelte der alte Mann den Kopf und sah geistlos ins Leere. Auf der Fähre, sagte er, gäbe es nichts Neues. Immer dasselbe Elend! Ventura sei ausgewandert; Mangialerba stände ganz unter dem Pantoffel seines Teufelsweibes, das ihm die Hörner aufsetze und ihn obendrein noch schlüge, und der »Blinde« sei immer noch der gleiche, hänge an seinem Seil wie die Auster an der Schale, sei lustig wie ein Vogel und singe in der Stille, die Augen gegen den Himmel gerichtet, den er nicht sehen konnte.
»Euer Sohn wird mit mir auch fernerhin in der Welt umherziehen und wird ein Mann werden,« wiederholte Don Tinu.
Auch der Onkel Antonio, der Ärmste, war nicht mehr der von ehemals. Er war paralytisch geworden und saß auf seinem Stuhl, blödsinnig vor sich hinstarrend, und alle Leute, die vorbeikamen, mit demselben stieren Lächeln begrüßend.
»Gott zum Gruß, Euer Gnaden! Kennt Ihr mich denn nicht mehr, Onkel Antonio?« fragte ihn der Hausierer.
Onkel Antonio nickte automatisch mit dem Kopfe. Da zog Don Tinu eine schöne Zigarre aus der Tasche und steckte sie ihm in die ewig zitternde Hand, die auf den Knien lag. Aber der Alte schüttelte verneinend das Haupt. Don Tinu fragte ihn aus Höflichkeit nach seinem Weibe und nach der Gevatterin Filomena, die in der verlassenen Schenke nicht sichtbar wurde. Und der Alte deutete mit zitternden Händen dahin und dorthin, nach dem Friedhof und nach der fernen Stadt. – Dann ließ Onkel Antonio ihnen durch einen schmierigen Jungen Wein auftischen. Diesen Jungen hatte er sich als Beihilfe genommen, sonst hätte er die Schenke zusperren müssen. Sie mußten lange und laut rufen, bis der zerlumpte Bursche, ganz verschlafen, herbeigeschlichen kam.
»Wir haben ein gottgefälliges Werk getan,« bemerkte Don Tinu, als er den Wein bezahlte. »Lebt wohl, Gevatter Antonio.«

Don Tinu war wirklich im Grunde ein guter Kerl. Er gab gerne, wo er konnte; er lachte und amüsierte sich gerne, und er hatte Freunde und Bekannte überall, wohin er kam. Manchmal entfernte er sich von Nanni und eilte da oder dort irgendeiner drallen Gevatterin nach; denn auch solche Bekanntschaften hatte er überall, wohin er kam. Wenigstens sagte er es. Und nicht selten kam es vor, daß man ihn irgendwohin heimlich holen ließ, wenn der gestrenge Gatte oder Liebhaber außer Hause war.
Eines Tages brachte man Don Tinu, an einem hohen Feiertage, in Spaccaforno, über einen steilen Steg, in ein entlegenes Haus.
Es war Grazia, die ihn holen kam.
»Euer Gnaden, Don Tinu, Ihr werdet erwartet, dort, wo Ihr ohnehin schon wißt.«
Don Tinu zögerte und kraute sich den Bart. Nicht, daß er Furcht gehabt hätte. Nein. Aber dieses spindeldürre, ausgehungerte Mädel müßte ihm Unglück bringen, dachte er. Er hätte darauf gewettet. Das Mädchen blieb als Wache vor der Türe stehen, das Köpfchen in ihr geflicktes Mäntelchen eingehüllt, und lächelte verlegen.
Nanni, der sie seit so langer Zeit nicht gesehen, fragte sie:
»Wie kommst du denn hierher?«
»Ich bin zu Fuß hergekommen,« antwortete Grazia, ganz glücklich darüber, daß er das Wort an sie richtete. »Ich bin zu Fuß aus Scordia und Carlentini hierhergekommen, denn da unten wäre ich Hungers gestorben. Jetzt leiste ich allen jenen Dienste, die mich rufen.«
Sie war groß geworden, und das zerlumpte Röckchen ließ ihre mageren Beine frei. Sie hatte ein ernstes und bleiches Gesicht, und man sah ihr an, daß sie Hunger gelitten. Ihre Augen waren tief gerändert.
Nanni, der mit dem Brot den Rest von Don Tinus Teller auftunkte und sich daran gütlich tat, fragte sie: »Da! Willst du auch was davon?«
Aber Grazia schämte sich »ja« zu sagen.
»Ich ziehe mit Don Tinu umher und bin ein Hausierer,« fügte Nanni hinzu.
Plötzlich wurde er sehr ernst und sah sie fest an.
»Tritt ein!«
Das Mädchen zögerte, eingeschüchtert durch diese Blicke.
Nanni wiederholte:
»Tritt ein, sag' ich dir! Dummes Mädel!«
Dann zog er sie am Arm hinein und schloß die Türe. Sie gehorchte, am ganzen Körper erbebend. Dann warf sie ihm die Arme um den Hals.
»Seit so langer Zeit hab' ich dich gerne!«
Und sie begann die Geschichte ihres elenden Landstreicherlebens zu erzählen: Hunger und Kälte hatte sie gelitten, und viele Nächte hatte sie, obdachlos, im Freien verbracht, und gekämpft hatte sie, und Brutalitäten hatte sie erdulden müssen! … So saß sie jetzt da, auf Nannis Rucksack, ganz zusammengekauert, die Arme über die Knie herabhängend, und ihre Augen leuchteten jetzt glückselig auf, und eine unsagbare Freude erfüllte ihr Herz und breitete sich über ihr ganzes Wesen aus, so daß sich ihr fahles Gesichtchen zu röten begann.
»So lange schon hab' ich dich gern! Weißt du es? Erinnerst du dich? Denkst du noch daran, wie wir beide Kräuter suchen gingen da unten am Fluß, in Primosole? Und wie wir auf den Steinen umherhüpften, wenn Dürre eingetreten war? Und erinnerst du dich jener Nacht, da wir beide hinter einer Mauer schliefen, auf der Straße nach Francofonte? Dann bist du fortgegangen mit Don Tinu. Und ich wußte nicht, was tun, wohin gehen … Jenes Weib, das Kaktusfeigen verkaufte, gab mir, als sie mich fortwährend im Kehricht wühlen und nach Speiseresten suchen sah, bald eine Brotrinde, bald einen Löffel Minestra. Aber als die Zeit der Früchte zu Ende war, da mußte auch sie ihrer Wege gehen, und ich schloß mich den Leuten an, die zur Olivenernte zogen, da unten am Leonefluß. Ich erkrankte am Fieber und wurde ins Spital geschickt. Als ich wieder herauskam, wollte keiner mehr etwas von mir wissen; alle behaupteten, ich äße ihnen das Brot weg, ohne es zu verdienen. Dann nahm ich an den Arbeiten der Urbarmachung teil, als der große Weinberg bei Boschitello bebaut wurde. Und auch bei Straßenarbeiten wurde ich beschäftigt. Und ich wäre noch immer dort und fände dabei mein Brot, wenn nicht der Oberaufseher gewesen wäre …«
Sie unterbrach sich, wurde feuerrot im Gesicht und sah ängstlich zu Nanni empor. Auf den schien das aber keinen besonderen Eindruck zu machen. Er sagte bloß: »Geh jetzt; denn mein Padron wird gleich zurückkommen.«
Die Ärmste ließ sich zur Türe hinausdrängen. Ihr Gesicht in das geflickte Mäntelchen eingehüllt, stammelte sie:
»Ich schwöre dir, ich bin nicht schuld daran! Bei der gebenedeiten heiligen Jungfrau schwöre ich dir's! Was hätte ich denn tun sollen? Er war ja doch mein Vorgesetzter! … Du warst nicht mehr da. Ich wußte ja nicht einmal, wo du bist …«
»Ja, ja, schon gut. Geh nur jetzt. Don Tinu kommt,« wiederholte er, indem er wie ein Dieb, der ertappt zu werden fürchtet, auf die Straße hinausspähte.
Endlich schlich sich das Mädchen, langsam und gesenkten Hauptes, davon.

Kurz nachher trug man den Hausierer mit zerschlagenen Rippen heim; der Onkel Cheli nämlich war zufälligerweise vor der gewohnten Stunde nach Hause gekommen und hatte Don Tinu mit seinem Weibe überrascht.
Zanno wurde gerufen, der den Hausierer heilen sollte. Und als er ihm die Pflaster auflegte, da las er ihm die Leviten.
»Ja, mein lieber Don Tinu, bei den Bauern heißt's aufpassen! Die sind schlimmer als die Bestien! Und besonders vor den Fuhrleuten bewahre einen Gott! …«
Jedesmal, wenn Don Tinu so ein heimlicher Besuch fehlging, ließ er seine Wut an dem Knaben aus und gab ihm Fußtritte und Maulschellen. Und als der Knabe auch diesmal wieder das Bad ausgießen mußte und vor Schmerz laut aufheulte, da kamen der Wirt und einige Vorübergehende herbeigeeilt, und Zanno sagte ihm:
»Mach dir nichts daraus, mein Junge! Dein Padron hat eben nur ein bißchen über den Durst getrunken!«
Zanno war ganz anders geartet. Wenn er sich betrinken wollte, dann schloß er sich mit seiner Flasche in sein Stübchen ein. Er schrie nicht, er schlug niemand, und auf seinem mageren Gesicht lag stets ein schlaues Lächeln. Er war klug und machte es umgekehrt. Er ließ die Weiber zu sich kommen. Und wenn es Abend wurde, da sah man nicht selten ein in ihr Mäntelchen dicht eingehülltes Weibchen zu ihm hineinhuschen, und wenn sie drinnen war, schob er rasch den Riegel vor. Er war immer gut gelaunt. Schmerzlos zog er die Zähne, verkaufte seine Mixturen und strich die Gelder ein.
Wenn Nanni ihm auf den Dorfplätzen oder in den Dorfschenken begegnete, da sagte er ihm stets: »Erinnert Ihr Euch noch, Euer Gnaden, als Ihr mich fragtet, ob ich mit Euch durch die Welt ziehen wolle, damals, als der Onkel Carmine in der Stallung am Biviere-Fluß dahinstarb?«
Zanno tat, als verstände er ihn nicht, denn er wollte sich's mit Don Tinu nicht verderben.
Aber endlich, als der Knabe eindringlicher wurde, da ließ er sich die Worte entschlüpfen:
»Nun gut, wenn dein Padron dich fortschickt, dann will ich dich ganz gerne in meine Dienste nehmen.« …
Nanni merkte sich das, und das nächstemal, als der Hausierer sich den Riemen abschnallte, um damit den Knaben zu bearbeiten, da sagte dieser ihm barsch:
»Don Tinu, laßt den Riemen, wo er ist. Denn diesmal wird es Euch übel ergehen!«
»O, du Hund du! Frech wirst du auch noch? Ich werde dir gleich zeigen, wem es übel ergehen wird! …«
»Ich wiederhole Euch, Don Tinu, laßt den Riemen, wo er ist, oder bei Gott, Ihr werdet's bereuen!« wiederholte Nanni sehr energisch.
Und er steckte die Hand in die Tasche.
Don Tinu, der ja sein Meister gewesen war und das zornbleiche Antlitz des Knaben bemerkte, wußte sofort, daß es da für ihn nichts zu lachen geben würde. Und er sattelte rasch um.
»Ah, so benimmst du dich gegen deinen Herrn und Meister? Nun gut, von mir aus magst du Hungers sterben! Nimm deinen Ranzen und geh deiner Wege!«
Nanni ließ sich das nicht zweimal sagen, packte seine dürftigen Habseligkeiten in ein Taschentuch und sagte nichts als: »Gott zum Gruß, Euer Gnaden!«
Und dann ging er auf die Suche nach Zanno.
Dieser sagte ihm vor allem: »Merk dir, mein Sohn, bei mir hört und sieht man alles, aber man weiß von nichts! Und den Mund hat man bei mir nur zum Schweigen. Wenn du gescheit bist, wird es dir gut gehen. Wenn du aber plauderst, dann wird es dir schlecht gehen. Ich mache nicht viel Redensarten. Ich bin ganz anders als Don Tinu. Also merke dir's! Gehorcht wird auf den Wink! Wenn es heißt: kehrt Euch, marsch, dann hast du zu verschwinden, und kein Mensch darf dich dann finden!«
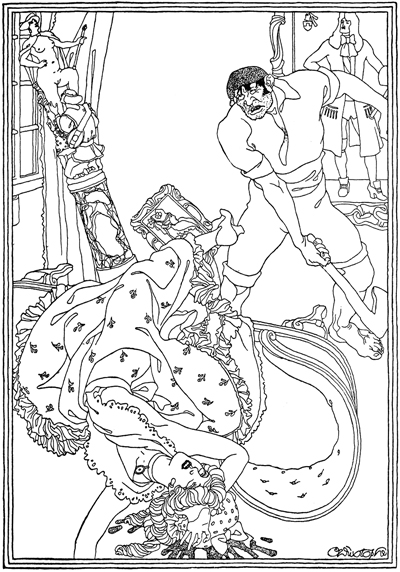
Sie führten ein heiteres Leben, waren aber immer auf der Hut. Nachts, wenn sie an eine Türe anklopften, gab es immer ein langes Umherwirtschaften, ein Geflüster hinter der Türe, und ein Kommen und Gehen, ehe der Riegel zurückgeschoben wurde. Dann hörte Nanni, wie sein Herr leise im andern Zimmer sprach und in seinem Mörser etwas zerrieb. Nicht selten hörte er auch lautes Aufkreischen oder unterdrücktes Winseln. Einmal in der Nacht, als er kein Auge schließen konnte, sah er durch das Schlüsselloch, wie Zanno Geld einstrich, und es war ihm, als sähe er Grazia kreidebleich davonwanken.
Und als er Zanno fragte, ob es Grazia gewesen sei, da geriet dieser in rasende Wut.
»Du bist viel zu neugierig, mein Sohn! Wenn das so fortgeht, wird es eines Tages mit dir ein böses Ende nehmen!«

Und ein böses Ende nahm es wirklich. Aber die Ursache war eine andere. Eines Tages, es war gerade Mariä Empfängnis – der Altar wurde auf dem Platze von Spaccaforno aufgerichtet –, kamen die Polizeisoldaten und ergriffen alle beide, nahmen ihnen die Tiegel und Schachteln und Fläschchen weg und schleppten sie vor Gericht, wo sie des Kindesmordes beschuldigt wurden. Aber als Zanno auf der Anklagebank auch Grazia erblickte, da schwur er einen heiligen Eid, daß er dieses Weib nicht kenne und nie im Leben gesehen habe, so wahr ein Gott im Himmel sei!
Aber es waren Zeugen da, die das Mädchen mit Nanni vor einiger Zeit gesehen hatten, als dieser wieder einmal nach Spaccaforno mit Don Tinu, dem Hausierer, gekommen war; es war in der heiligen Woche gewesen, und man hatte ihn die Türe öffnen und schließen gesehen.
Grazia, mehr tot als lebendig, stammelte: »Herr Richter, lassen Sie mich köpfen, denn ich bin eine Gottlose! Erst sündigte ich, und dann tat ich nicht Buße!«
Es war aus Verzweiflung geschehen; denn alle hatten sie ja davongejagt, wie einen räudigen Hund … Und auch aus Scham … Warum auch nicht? Nachdem Nanni sie fortgeschickt hatte, begann sie erst zu begreifen, was sie getan … Es war in einer Nacht, in einer verlassenen Hütte, hinter der kleinen Brücke! … Kurz vorher hatte sie noch die Straßenarbeiter bedient … Es war eine trübe, regnerische Nacht … Ihr war, als müßte sie sterben, da unten, allein und verlassen … Und sie wußte nicht, was beginnen mit diesem kleinen Geschöpfchen, das so arm und verlassen war wie sie selbst … Dann, als sie das kleine Wesen nicht mehr atmen sah und es ganz weiß wurde, da schleppte sie es hinunter zum Fluß, wickelte es in ihre Schürze, legte einen Stein hinein und warf es hinab in die Fluten – das arme, zarte, unschuldige Wesen! … Aber Nanni wußte von nichts, so wahr es einen Gott gibt! Sie hatten einander nicht mehr gesehen …
So wurde Grazia ins Zuchthaus geschickt, und Zanno und sein Gehilfe kamen mit der bloßen Angst davon. Sie hatten sich schon am Galgen hängen gesehen! Aber Zanno legte vor Gott und allen Heiligen in Spaccaforno ein Gelübde ab, nie im Leben wieder in ähnlicher Absicht salbadern zu wollen!

Nanni zog noch eine Zeitlang dahin und dorthin, bis er endlich, vom Hunger getrieben, nach Primosole zurückkehrte, wo er doch wenigstens noch jemand hatte. Dort hörte er, daß sein Vater bereits im Grabe läge und der Blinde die Fähre leitete, hagerer und dürrer als je.
Filomena begann schon ein wenig zu altern, und niemand wollte von ihr etwas wissen, wegen der Geschichte mit Don Tinu und mit noch anderen, wie sich später herausgestellt hatte. Und Filomena sprach zu ihm:
»Ich habe, Gott sei Dank, was ich brauche. Und wenn mich einer zum Weibe nähme, so könnte er leben wie ein Fürst!«
Der Blinde machte um den Preis eines Glases Wein den Vermittler und sagte:
»Mein Wort, es ist so, wie sie sagt.«
Und Nanni erwiderte endlich: »Von mir aus! Wenn Ihr zufrieden seid, bin ich's auch!«
Und so kroch er endlich in ein warmes Nest. – Die Landstreicherei hatte er wahrhaftig schon satt; und so aß er und trank er und lebte gut, und die Gäste kamen in die Schenke und waren fröhlich und guter Dinge, und sein Geldbeutel füllte sich. Hie und da brachte man ihm Nachrichten ins Haus; daß seinem Bruder ein Unglück zugestoßen sei, oder daß seine Schwester wieder einen Knaben bekommen habe …
Und bald kam er sich fast vor wie sein Vater, zur Zeit, als dieser gelähmt worden war und man ihm von allen Seiten die Nachrichten ins Haus gebracht hatte …
So waren die Jahre vorübergegangen. Und eines Tages erblickte er inmitten einer Schar von Schnittern ein altes Weiblein, das der Teufel nicht wiedererkannt hätte, so verhungert und abgehärmt sah es aus. Das Weiblein sagte ihm:
»Erkennt Ihr mich nicht mehr, Gevatter Nanni? Ich bin die Grazia, erinnert Ihr Euch noch?«
Er aber schickte sie sofort weg, aus Furcht vor Filomena, die in solchen Dingen keinen Spaß verstand. Ihm war jetzt nur daran gelegen, sein Leben in Ruhe zu genießen und der Vorsehung dankbar zu sein für das brave Weib, das ihm Wohlhabenheit und Frieden verschafft hatte.
Und wenn es einmal geschah, daß Zanno oder Don Tinu vorbeikamen und bei ihm einkehrten – denn jetzt schätzten und achteten auch sie ihn und gaben ihr Geld bei ihm in der Schenke aus –, da pflegte er seinem Weibe oder irgendeinem der Gäste zu sagen:
»Arme Teufel, die zwei! Ziehen noch immer in der Welt umher, um sich ihr Brot zu verdienen!«