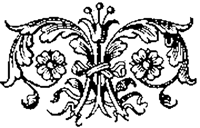|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Nach einigen Tagen kamen die Leute des Grafen mit der Räuberbande, die sie glücklich in der Höhle beisammen gefunden hatten, in Eichenfels an. Die Räuber waren alle zu zwei und zwei mit Ketten zusammen geschlossen. Ein Wagen mit Kisten, worin sich lauter geraubte Kostbarkeiten befanden, folgte dem Zuge, und zu oberst auf dem Wagen saß die alte Zigeunerin. Die Räuber hatten den entronnenen Knaben gar nicht aufgesucht; denn da sie die eiserne Thüre fest verschlossen fanden, und der Felsenriß, durch den er entkam, ihnen unbekannt war, weil ein höchst baufälliger, gefährlicher Gang, in den sie sich nie hinein gewagt hätten, dahin führte, so glaubten sie, Heinrich sei entweder in einen der unermeßlich tiefen Abgründe des alten Bergwerkes gefallen, oder von einem eingestürzten Gange lebendig begraben worden.
Die Räuber waren daher sehr erstaunt, als sie bei ihrem Einzige in Eichenfels den jungen Grafen neben seinem Vater unter dem Schloßthore stehen sahen, und sie konnten gar nicht begreifen, wie er durch die eiserne Thüre heraus gekommen. »Wie glaubten,« brummte der Hauptmann voll Verdruß, »kein Mensch in der Welt sei uns an List gewachsen, und nun muß uns sogar ein Kind überlisten, und uns in Ketten und Bande bringen. Das ist sehr ärgerlich. Nun sehe ich es aber doch ein, was ich niemals glauben wollte: Wenn der Dieb reif ist, so holt ihn ein hinkender Büttel ein.« Jener Musikant mit dem Hackbrette, der sich auch unter ihnen befand, sprach bei sich selbst: »Wir raubten dieses Kind, damit es uns dereinst zur Rettung dienen möge; allein, nun gereicht gerade dieses Kind uns zum Untergange. Die Leute mögen wohl recht haben, die da sagen: Wer Böses thut, findet am Ende immer, daß er sich verrechnet habe.« Wilhelm, der Jüngling, der gegen den kleinen Heinrich immer so freundlich und gefällig gewesen, und kein ganz verdorbenes Gemüt hatte, sagte: »Das hat Gott so gefügt, daß der Kleine entkam, und ich freue mich, daß er lebt, obwohl das mein Tod sein wird. Gott zeigt auch hier wieder seine Macht, die Unschuld zu retten und die Schuldigen zu strafen. Nun geht an uns allen in Erfüllung, was einmal mein seliger Vater gesagt und was mir meine Mutter oft wiederholt hat: Wenn sich der Böse auch in den Mittelpunkt der Erde verkriechen könnte, so wüßte ihn Gottes strafende Gerechtigkeit doch zu finden und ihn zur verdienten Strafe zu ziehen.«
Als Heinrich den armen Wilhelm in seinen Ketten unter den Räubern erblickte, ging es ihm sehr zu Herzen, und er bat seinen Vater inständig, den armen Menschen, der ihm so viel Gutes erwiesen habe, doch kein Leid zu thun. Der Graf sagte, er könne für jetzt noch nichts versprechen; er werde ihn aber so gelinde behandeln, als es in seiner Macht stehe. Da sich bei dem Verhöre fand, daß der junge Mensch niemals Blut vergossen, und mehr der Diener der Räuber, als selbst ein Räuber gewesen sei, so wurde er zwar nicht hingerichtet, aber dennoch zum lebenslänglichen Gefängnisse verurteilt. Der Graf milderte aber die Strafe dahin, daß er so lange, bis er hinreichende Beweise von aufrichtiger Besserung gegeben habe, in ein Arbeitshaus geschickt werden solle, dann aber zu den Seinigen zurückkehren dürfe. »Sieh,« sagte der Graf zu ihm, als man ihn abführte, »wie nichts Böses unbestraft bleibt, so wird alles Gute belohnt. Die Linderung deiner Strafe hast du deiner Freundlichkeit gegen meinen Sohn zu danken. Ja, was du meinem Kinde gethan hast, will ich dir an deiner armen Mutter vergelten. Halte dich gut und mache, daß ich dich bald zu ihr zurück senden könne.«
Die übrigen Räuber bekamen indes alle den blutigen Lohn, den sie durch ihre blutigen Thaten verdient hatten. Die Zigeunerin kam auf immer in das Zuchthaus. Das geraubte Gut wurde den Eigentümern, die man noch entdecken konnte, zurückgegeben; das übrige wurde zur Stiftung eines Waisenhauses verwendet. Der Graf gab dazu, aus Dankbarkeit gegen Gott, eine große Summe Geldes und die fromme Gräfin all ihren Schmuck.
Margareta blieb in den Diensten der Gräfin, wie vorher, und hatte nun nach langem Leiden auch wieder frohe Tage. Den Gärtnerjungen Görge hatte man wegen seines Leichtsinnes und seiner Nachlässigkeit längst fortjagen müssen; er hatte sich überdies noch dem Trunke und andern Schlechtigkeiten ergeben, und war in seinen schönsten Jugendjahren bereits an der Auszehrung gestorben. Der Jüngling aus dem Gebirge reiste, von dem Grafen reichlich beschenkt, wieder zu seinen Eltern zurück.
Den guten Vater Menrad hätte der Graf gern für immer auf seinem Schlosse behalten. Er blieb zwar einige Zeit; allein er ließ sich nicht bewegen, seine Einsiedelei ganz mit dem gräflichen Schlosse zu vertauschen. »Ich will den Rest meiner Tage vollends Gott widmen,« sagte er, »und das glaube ich am besten in der Einsamkeit thun zu können. Ich habe lange genug in der Welt gelebt, und weiß aus Erfahrung, was an ihr ist. Sich auf die bessere Welt vorbereiten, ist das beste, was wir in dieser Welt thun können.« Der ehrwürdige Greis segnete bei dem Abschiede, der sehr traurig war, den Grafen, die Gräfin, und den kleinen Heinrich, der sich fast nicht von ihm wollte trennen lassen. Die gräfliche Familie begleitete den guten Mann herab unter das Schloßthor an den Wagen. Er stieg ein, blickte alle noch einmal liebreich an, und sprach noch, bevor der Wagen abfuhr: »Lebet wohl und der Friede Gottes sei mit euch. Im Himmel sehen wir uns wieder.«