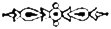|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Jane saß in ihrem schwarzen, einfachen Kleide zwischen fünf oder sechs Damen in gleichfalls schwarzen, einfachen Kleidern, alle andern Anwesenden in dem mäßig großen runden Raume strahlten und blitzten in bunten Uniformen. Excellenzen und Generale mit schimmernden Orden standen im Vordergrund neben Albrecht von Heidenstamm, während hinter ihnen Kopf an Kopf Offiziere sich drängten. Alles leuchtete von Gold und Rot, Silber und Blau; die ganze Skala der Farben schob sich in hundertfachen Wiederholungen durcheinander. Im Anfang herrschte eine Totenstille in der Versammlung, als aber die Rede des Geistlichen weit ausholte, begann diese eintönige Bewegung, wenn jeder einzelne ermüdet von Zeit zu Zeit sich von dem einen Fuß auf den andern lehnt. Die Sporen tönten, die Säbel klirrten, immer nur leise, in ihrer Gesamtheit aber doch laut und unfeierlich.
Nur zwei waren anwesend, die in ihrer düsteren Kleidung sich scharf von der bunt strahlenden Versammlung abhoben: der Pastor und Joseph. Aber der Pastor befand sich gesondert von allen auf der erhöhten Stufe neben dem von Blumen überdeckten Sarge, während Joseph in seinem schwarzen Anzuge einsam vor den glitzernden Uniformen stand.
Eine Zeitlang saß Jane still, geradeaus vor sich hin schauend auf die Blumen und die sechs großen Wachskerzen, deren dünne Flammen in den voll hereinfallenden Sonnenstrahlen zerflimmerten. Sie fühlte die Blicke dieser hundert Offiziere auf sich gerichtet, neugierige, spöttische, begehrliche Augen; aber sie war nicht in der Stimmung, auch nur einen dieser Blicke zu beachten.
Sie war traurig. Die schweren Krankheitstage, das Sterben und die dumpfe, feierliche Stimmung des Todes hatten sie bewegt. Es war alles so rasch gekommen, sie hatte kaum einen Augenblick Zeit gefunden, über sich selbst und Joseph nachzusinnen und über das, was nun werden sollte.
Ja, was sollte werden?
Sie schaute einen Moment empor auf Joseph, der mit einem blassen, versteinerten Gesicht drüben stand, vor seinem Bruder durch fast die ganze Breitseite der Kapelle getrennt.
Der Geistliche sprach in einem feierlichen, gleichmäßigen Tone; Jane gab sich Mühe, ihm zu folgen, aber ihre Gedanken irrten ab.
Was das für eine seltsame Leichenfeier war! Offiziere, Uniformen, Säbel, als ob es sich um ein kriegerisches Fest gehandelt hätte und nicht um das Zugrabetragen einer zerbrochenen Frau! Mußten diese Herren, wenn sie kommen wollten, in ihren bunten Kleidern erscheinen?
Sie als Amerikanerin begriff das nicht.
Oder konnten sie nicht wenigstens die Waffen draußen lassen?
Sie schüttelte leise den Kopf, und ein sarkastisches Lächeln huschte über ihre Lippen.
Vorn vor allen andern stand Albrecht, den Kopf geneigt und starr vor sich hinblickend. In seinen goldenen Uniformknöpfen blitzte die Sonne. Nur sein Gesicht war blaß und trübe, alles andre strahlte an ihm in der tadellosen Vollendung der Offizierskleidung.
Wieder ging es wie ein bitteres Lächeln um Janes Mund. Sie dachte an den Nachmittag vor Maries Sterben, als drinnen am Bett der Todkranken Joseph saß.
Sie und Albrecht standen damals nebenan im Eßzimmer am Fenster, dicht nebeneinander: zwei Betrogene! Zwei, über die hinweg die Sterbende und Joseph sich wiedergefunden hatten!
Albrecht nahm ihre Hand und sagte:
»Jane! Sie sind unglücklich, ebenso wie ich.« Und mit stammelnden, halbverhüllten Worten sprach er von allem, was sie selbst längst wußte, von seinem Bruder, von seiner eignen, liebeleeren Ehe, von Jane, die in diesen fürchterlichsten Tagen wie ein tröstender Stern für ihn erschienen sei, – banale Vergleiche, schwächliche Andeutungen seiner Liebe, ein jämmerlicher Versuch, für sein Betrogensein einen schöneren Ersatz zu finden.
›Ein gutes Geschäft zu machen,‹ dachte sie. Selbst in dieser feierlichen Stunde ging bei der Erinnerung daran ein grimmiger Spott über ihr Gesicht. Es hatte einen Rollentausch geben sollen wie in der Komödie.
Dann war jemand hereingestürzt mit verstörtem Gesicht, ein Dienstmädchen oder eine Wärterin:
»Sie ist tot!«
Vor dem Bett, das Gesicht in den Händen, saß Joseph. Jane trat an das Fußende und blickte auf die Tote, die Siegerin geblieben war im Kampfe um Joseph. Sie lag ganz still und friedlich; sie hatte einen schönen Tod gehabt. In den Armen des Geliebten. Den schönsten Tod . . .
Immer noch dauerte die Rede des Geistlichen. Er hatte einen Absatz gemacht, so daß jeder glaubte, die Ansprache sei beendet. Ein Aufatmen ging durch die Reihen und ein Klirren von Säbeln, aber gleich darauf trat wieder tiefe Stille ein, denn die Rede begann von neuem.
Niemand horchte mehr, man wurde unruhig, in den hinteren Reihen beugten sich Köpfe zu einander und flüsterten.
Nur einer stand wie zuvor und schaute mit großen, starren Augen auf den Geistlichen, der jetzt von dem Kinde Marie erzählte, das er getauft und dem er das erste Abendmahl gereicht hatte.
Jane blickte ihren Mann an: er weinte. Große, schwere Tropfen rannen ihm über das Gesicht, das unverwandt auf den Geistlichen gerichtet war.
Der einzige Mensch, der weinte!
Einen Augenblick war es ihr, als ob diese Tränen ihr das Herz zerschnitten, als ob damit das Letzte ausgelöscht würde, was ihr Herz noch an diesen Mann band, aber da kam es über sie mit tiefer, weicher Bewegung. Der einzige, der weinte! Der einzige, der fühlte! Der den Mut gehabt hatte, über seinen Bruder, über sie, Jane, über die geifernde Welt fort zu seiner Liebsten zurückzueilen! Der einzige Mann!
Ja, der einzige Mann!
Und während sie ihn unverwandt anstarrte, schien er zu wachsen, schien alles Bunte hinter ihm zu verschwimmen, zu verschwinden, stand er ganz allein mit seinem schmalen, blassen Gesicht – der einzige Mensch.
Da fuhr sie auf. Die Rede war beendet. Die Herren traten zur Seite, die Damen erhoben sich.
Verwirrt tastete Jane nach ihrem Tuch, denn ihr Gesicht war, sie hatte es selbst nicht gefühlt, von Tränen naß.
Aus der Halle hinaus ging es auf den weiten, sonnigen Kirchhof.
In der heißen Sommernacht war ein Regen über Stadt und Felder niedergegangen, nun glitzerten die Tropfen in den Büschen, im Grase und an den Eisengittern der Gräber.
In den Händen der Sargträger schwankte der Sarg langsam und schwer hin und her, er hatte zum letzten Male vor der Ruhe im Grabe etwas Bewegtes, Lebendes.
Man wandelte durch endlose Alleen, über dieses ganze weite Totenfeld des Döhrener Kirchhofs. Jenseits der Sandsteinmauern sah man grüne Wiesen, die sich lustig in die Ferne ziehen und die eines Tages vielleicht auch von den Sandsteinquadern umfriedigt und dann aufgebrochen werden, um in ihrer Tiefe Särge und Särge aufzunehmen.
Der Blick in die sonnige Weite hatte etwas Beruhigendes. Am Horizont sah man die blauen Gebirge, die zur Weser hinüberleiten. Man atmete wieder freier. Es war, als ob der Tod auf diesen großen Flächen von Feldern und Wiesen seine Schrecken verloren hätte.
Das Gras verwelkt, die Bäume vergehen. Staub wird wieder zu Staub. Man kehrt zurück zur Erde, und der müde Wanderer legt sich hier draußen nieder zur Ruhe. Ueber sein Grab wird der Wind rauschen und der Regen fallen, wird die Sonne scheinen und es Nacht werden und wieder Tag. Ueber diesen Friedhof, der nach allen Seiten hin sich immer weiter ausdehnt, breiten sich nicht die Schatten alter Bäume, und es gibt da nichts von der feinen Stimmung einer Kirche, deren Turm mitten zwischen den Gräbern emporragt und seine Abendglocken hoch oben ertönen läßt. Es ist der Friedhof einer großen Stadt, planmäßig angelegt mit schnurgeraden Alleen und Gräberreihen. Es ist alles sehr sauber und vieles sehr prunkvoll. Gärtnerburschen harken die Wege, und der Totengräber, ein Mann mit dem Einkommen eines Ministers, ist ein organisatorisches Talent, das darauf Bedacht zu nehmen hat, diese Totenstadt ordnungsgemäß zu verwalten.
Und doch liegt auch über dem immensen Kirchhofe einer neuen praktischen Zeit Frieden. Hoch oben wölbt sich die Weite des Himmels, durch keine ragende Kirche und keinen hohen Baumstamm für das Auge geteilt, wie ein großer blauer, erzener Schild, der gewaltiger an die Allmacht und Unendlichkeit erinnert als die feine, wehmütige Enge eines Dorfkirchhofs. Mit weit ausgebreiteten Armen nimmt diese Riesenstätte Tausende und Hunderttausende zur letzten Ruhe entgegen, legt sie dicht bei einander, als ob der große Allgleichmacher Tod die weite, eintönige Fläche als sein Wahrzeichen geschaffen hätte.
Die glänzende Gefolgschaft der Generale und andern Offiziere, die wie eine schillernde Kette hinter dem Sarge gewandert war, bildete einen weiten Halbkreis, in dessen Mitte Albrecht von Heidenstamm stand, dicht hinter dem Pfarrer.
Wo war Joseph?
Janes Augen suchten ihn, bis sie ihn schließlich sah. Er lehnte unbeachtet in der letzten Reihe an dem Gitter eines Grabes, zwanzig Schritt von seinem Bruder entfernt und ganz von den Uniformen der vor ihm Stehenden verdeckt.
Eine lange, feierliche Stille.
Man hörte nur dumpf die Erdschollen aufschlagen und bisweilen das Klingen eines Spatens, der gegen einen Stein stieß.
Die Leichenträger schleppten Kränze herbei, die sie in solchen Massen auf den schmalen Hügel häuften, daß die zu unterst liegenden Blumen erstickten. Nur auf die breiten Seidenbänder gaben sie Obacht, und die ermüdeten Umstehenden versuchten die einzelnen Inschriften zu lesen, glänzende Inschriften mit prunkvollen Namen; Prinzen, Regimenter, Rennvereine, Excellenzen, Generale. Die kleineren und bescheideneren Kränze von den Schulfreundinnen und dem Hauswirt und andern, wenig bedeutenden Leuten, die irgendwann mit Marie im Leben zusammengetroffen waren und sie gern gehabt hatten, wurden von den Trägern zu unterst verborgen.
Noch einmal begann der Pastor, aber er sprach nur noch wenige Worte. Er segnete das Grab und segnete die Umstehenden: »Der Herr halte seine Hand über euch und gebe euch Frieden.«
Mau atmete tief auf, die Zeremonie hatte über eine Stunde gewährt. Und jeder einzelne trat heran zu Albrecht von Heidenstamm und schüttelte ihm stumm die Hand.
Dann ging man, langsam, ohne Eile, würdevoll. Bis man am Ausgange den Wagen fand und dem Kutscher zurief: »Was die Gäule laufen können!«
Wie ein pompöser Hetzkorso jagte die Masse der Wagen die Hildesheimer Straße entlang zur Stadt zurück, so daß alle Leute stehen blieben und das glänzende Schauspiel betrachteten. Offiziere, Offiziere, nichts als Offiziere! Es war wie bei einer Heimfahrt vom Rennen! Großartig!
Albrecht von Heidenstamm fuhr mit dem Pastor. Ihr Wagen war der einzige, der in gemessenem Tempo und guter Haltung zur Stadt rollte.
*
Joseph stand an dem Grabe, das setzt ganz still und einsam lag. Ein paar Bekannte hatten ihm, ehe sie gingen, die Hand gedrückt, – nun waren sie alle fort.
Er konnte nichts denken, eine bleischwere Müdigkeit preßte ihn nach diesen vielen durchwachten Nächten nieder. Er legte die Hände um zwei der Grabgitterspitzen und beugte den Kopf darauf.
Was nun?
Marie dort vor ihm tief im Grabe und er ganz allein.
Er richtete den Kopf in die Höhe und blickte nach dem fernen Horizont und versuchte seine Gedanken zu sammeln.
Er zuckte mechanisch die Achseln, als wollte er sich selbst sagen: ›Es ist zu Ende, du hast niemand mehr und nichts.‹
Grab an Grab lag vor ihm, Grab neben Grab. Die Sonne breitete ihre Lichter über alle die Rosenbüsche und blühenden Sträucher, auf einem Marmorkreuz saß ein Vogel und zwitscherte – es war wohl viel Wehmut aus diesem Totenfelde, aber nichts Trauriges. Alles sagte: »Hier ist die Ruhe und hier ist der Frieden – komm – bleib.«
Eine seltsame, halbvergessene Erinnerung kam ihm in den Sinn, wie Marie so oft gesagt hatte:
»Joseph, halt dich gerade.«
Und er richtete sich aus seiner gebeugten Haltung empor und lächelte.
Aber nur einige Sekunden stand er so, dann legte er den Kopf wieder auf die Hände, die immer noch die Gitterstäbe umspannt hielten, und schloß die Augen. Sie schmerzten, das helle Licht tat ihnen weh.
Er fühlte keine Trauer mehr, es war ja gut so für Marie, das Beste: er fühlte nur eine Leere in sich und um sich. Wie jemand, der das dumpfe Bewußtsein hat: ›irgend etwas muß geschehen, irgend etwas mußt du tun,‹ aber nicht weiß, was.
›Du gehst jetzt hinaus aus dem Kirchhofe, ‹ dachte er, ›und kommst auf die Hildesheimer Straße, wie sollst du dann weitergehen? Links nach der Stadt oder rechts in die Felder? Und dann? Was dann?‹
Er sann darüber nach. Wenn er jetzt ein Pferd hätte, so würde er irgendwohin reiten und das Pferd laufen lassen. Er brauchte nicht auf den Weg zu achten und Fuß vor Fuß zu setzen, er hätte gewissermaßen jemand, der ihn führen, der schon auf den Weg achtgeben würde.
Oder wenn er seinen kleinen Terrier hier hätte. Der würde vor ihm her laufen, und er konnte einfach hinterher gehen. Bisweilen würde er ihn rufen: »Fox, hier!« und würde ihn streicheln. Irgend jemand muß man haben, mit dem man sprechen kann.
Vielleicht könnte man einen Jungen in die Stadt schicken nach dem Hotel und Fox holen lassen. Aber Fox wird den Jungen beißen. Und vielleicht gibt Jane den Hund gar nicht her, denn er gehört eigentlich ihr.
Jane – was sie jetzt anfangen mag – Sie wird heute abreisen oder ist schon abgereist, – arme Jane! Sie hat es nie böse gemeint. Sie würde mir Fox schicken, wenn ich darum bitte, selbstverständlich. Sie war nie kleinlich.
›Nie kleinlich‹ – er sann über die zwei Worte nach und hielt sie fest. Er hatte in diesen letzten Wochen so viel Kleinliches gesehen, auf Schritt und Tritt.
»Joseph!«
Er fuhr auf und starrte sie an.
Jane hatte ihn ganz leise gerufen. Sie stand einige Schritte von ihm entfernt, ebenso wie er an das Gitter gelehnt, ihre beiden Hände ebenso wie seine Hände um die Eisenspitzen gelegt.
»Du? Noch hier?«
Sie antwortete nicht gleich und blickte ihn auch nicht an. Sie schaute auf die Kränze und Seidenschleifen, und erst nach einer langen, minutenlangen Pause begann sie leise zu sprechen, immer ohne Joseph anzusehen:
»Du hast sie sehr lieb gehabt, Joseph, und sie ist sicherlich dieser Liebe auch wert gewesen. Für mich war sie eine Fremde, und ich war es für Marie. Wir sind uns auch fremd geblieben, wie es natürlich war. Ich habe geglaubt, als wir herkamen, deine Liebe für mich sei größer als die Erinnerung an deine Jugendliebe, aber es war nicht so.« Sie suchte nach Worten, aber sie fand sie nicht in dem immer hastigeren Reden, und nun begann sie, erst abgebrochen, dann im Zusammenhang englisch zu reden. »Denn es war nur Erinnerung, was dich zu ihr zurückgeführt hat. Jede andre Frau wäre außer sich gewesen, ich war es nicht, Joe. Man soll jedem Menschen seine Freiheit lassen, auch im Denken und Fühlen; ich habe kein Wort zu dir gesagt, ich habe dir alle Freiheit gelassen, – habe ich nicht, Joe?« Ihre Stimme zitterte ein wenig. Sie wollte aufschauen, aber sie tat es nicht. Sie fühlte, daß er sie anblickte. »Ich bin unglücklich geworden, Joe, aber ich zürne dir nicht. Du hast mich nicht verraten mit einer andern, du bist ihr treu gewesen, das war es. Nicht weil sie noch schön war, sondern weil du und sie, weil ihr beide – weil –« ihre Stimme versagte einen Augenblick, aber sie überwand den Schmerz: »Sie hat dich lieb gehabt, Joe, aber ich habe dich auch lieb gehabt. Nicht damals, als wir uns kennen lernten, oder doch, auch da schon, aber nicht so wie, wie jetzt, wie – und – und«
»Jane!« Er löste ihre beiden Hände von den Gitterstäben und zog sie an sich.
Und zum erstenmal in ihrem klaren und ruhigen Leben verlor sie die Fassung, schluchzte sie auf, verbarg sie zitternd, hilfesuchend ihren Kopf an der Brust eines andern.
Lange blickte Joseph stumm zur Seite auf das Grab, als ob er auf jemand horchte, der von dort her zu ihm spräche.
Dann nickte er dem Grabe zu: »Ja.«
Er legte die Hand auf Janes Arm und sagte müde: »Komm.«
So gingen sie die lange, gerade Allee entlang, und nur an der Biegung hielt er noch einmal an und wandte den Kopf rückwärts.
Mit schweren, langsamen Schritten ging er dann weiter an Janes Seite durch die Reihen, durch die hohe Halle am Eingang hinaus.