
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
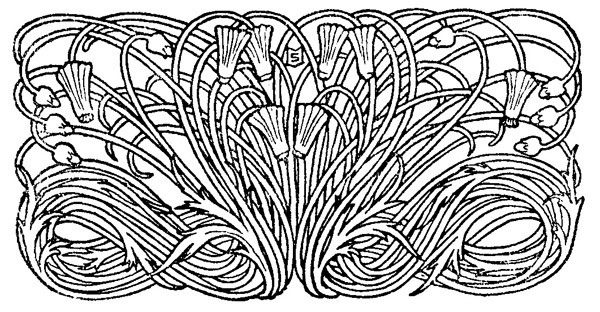
Ehe ich dieses Buch schliesse, wie wir den Bienenstock über dem Schweigen der Winterstarre geschlossen haben, möchte ich noch einem Einwand begegnen, der fast immer erhoben wird, wenn man die Wunder des Bienenstaates, seinen politischen Sinn und Gewerbfleiss, dem Beschauer vor Augen führt. Ja, heisst es gewöhnlich, das alles ist wunderbar, aber unveränderlich und starr. Seit abertausenden von Jahren leben sie unter bemerkenswerten Gesetzen, aber diese Gesetze sind seit abertausenden von Jahren die gleichen geblieben. Von Urbeginn an bauen sie ihre wunderbaren Waben, denen man nichts nehmen und nichts hinzusetzen kann, und in denen sich das Wissen des Chemikers mit dem des Mathematikers, Architekten und Ingenieurs in gleicher Vollendung paart; aber diese Waben sind genau dieselben, wie in den Sarkophagen, oder in den Darstellungen auf Steinen und in den Papyrusrollen Ägyptens. Man nenne uns eine Thatsache, die den geringsten Fortschritt bedeutet, eine Einzelheit, in der sie eine Neuerung getroffen, einen Punkt, wo sie von ihrer Jahrhunderte alten Gewohnheit abgewichen wären, und wir werden uns beugen, wir werden anerkennen, dass in ihnen nicht nur ein wundervoller Instinkt lebt, sondern auch ein Verstand, der ein Recht hat, sich dem des Menschen zu nähern und mit ihm auf irgend ein höheres Geschick zu hoffen, als das der unbewussten, unterjochten Materie.
Es sind nicht nur die Laien, die so reden. Auch Entomologen vom Range Kirbys und Spences haben dasselbe Argument gebraucht, um den Bienen jeden Verstand abzusprechen, ausser dem, der sich in dem engen Kerker eines wunderbaren, aber unveränderlichen Instinktes verworren kundgiebt. »Man zeige uns«, sagen sie, »einen einzigen Fall, wo sie unter dem Drucke der Verhältnisse darauf gekommen sind, an Stelle von Wachs oder Propolis z. B. Thon oder Mörtel zu verwerten, und wir werden zugeben, dass sie der Überlegung fähig sind.«
Dieses Argument, das Romanes »the question begging argument« nennt – man könnte es auch das unersättliche Argument nennen – gehört zu den allergefährlichsten und würde uns, auf den Menschen angewandt, sehr weit führen. Wohl betrachtet, stammt es von jenem gesunden Menschenverstande, der oft Schaden genug stiftet und der dem Galilei antwortet: »Die Erde bewegt sich nicht, denn ich sehe die Sonne am Himmel wandeln, des Morgens emporsteigen und des Abends untergehen, und nichts kann das Zeugnis meiner Augen widerlegen«. Der gesunde Menschenverstand ist als Grundlage unseres Geistes vortrefflich und notwendig, aber nur, wenn ein höherer Zweifel ihn stets überwacht und ihm seine unendliche Unwissenheit nach Bedarf vorhält; anderenfalls ist er nichts als eine Fertigkeit der unteren Stufen unseres Verstandes. Aber die Bienen haben die Einwendung von Kirby und Spence selbst beantwortet. Sie war kaum gemacht worden, als ein andrer Naturforscher, Andrew Knight, der die kranke Rinde gewisser Bäume mit einer Art Zement aus Wachs und Terpentin bestrichen hatte, die Beobachtung machte, dass seine Bienen kein Propolis mehr eintrugen und nur dieses unbekannte Material benutzten, das sich bald bewährte und angenommen wurde, da sie es vollständig fertig und in grossen Mengen in der Nähe ihrer Wohnung fanden.
Überdies läuft die Hälfte aller Bienenkunde und Bienenzucht darauf heraus, der Initiative der Bienen Vorschub zu leisten und ihrem praktischen Verstande Gelegenheit zu geben, sich zu üben und wirkliche Entdeckungen, wirkliche Erfindungen zu machen. Wenn z. B. wenig Pollen in der Natur vorhanden ist, so streut der Bienenwirt zur Auffütterung der Brut, zu der viel Pollen nötig ist, in der Nähe des Bienenstockes Mehl aus. Im Naturzustande, im Schosse der Urwälder oder asiatischen Thäler, in denen sie vor der Tertiärzeit wahrscheinlich gelebt haben, ist ihnen ein derartiger Stoff jedenfalls nicht begegnet. Trotzdem braucht man nur einige darauf aufmerksam zu machen, indem man sie in das Mehl setzt, und sie werden es betasten, kosten und seine dem Blütenstaub verwandten Eigenschaften erkennen, sie werden in den Stock zurückkehren, ihre Schwestern von ihrer Entdeckung benachrichtigen, und alsbald wird ein ganzer Schwarm erscheinen, um dies unerwartete und unbegreifliche Nahrungsmittel einzuernten, das in ihrem anererbten Gedächtnis von den Blumenkelchen unzertrennlich ist.
 Es ist kaum hundert Jahre her, dass man nach Hubers Vorgang die Bienen ernstlich zu beobachten und die ersten Fundamentalwahrheiten zu entdecken begonnen hat, die ein erfolgreiches Studium erlauben. Etwas mehr als fünfzig Jahre ist es her, dass sich durch die Erfindung der beweglichen Waben und Kastenstöcke des Pfarrers Dzierzon eine rationelle und praktische Bienenzucht anbahnt, dass der Bienenstock nicht mehr ein unverletzliches Haus ist, wo alles ins Mysterium gehüllt bleibt, bis der Tod es entschleiert, wenn es nicht mehr ist. Schliesslich ist es weniger als fünfzig Jahre her, seit durch Vervollkommnung des Mikroskops und des Handwerkszeuges der Entomologen das Geheimnis der Hauptorgane der Arbeitsbienen, der Königin und der Drohnen blossgelegt ist. Ist es da erstaunlich, dass unser Wissen nicht weiter reicht, als unsere Erfahrung? Die Bienen leben seit Jahrtausenden, und wir beobachten sie seit zehn oder zwölf Lustren. Und wenn es auch bewiesen wäre,
dass sich im Bienenstocke nichts verändert hat, seit wir ihn geöffnet haben, so haben wir doch noch kein Recht, daraus zu folgern, dass sich nie etwas darin geändert hat, bevor wir ihn befragten. Wissen wir nicht, dass in der Entwickelung einer Gattung ein Jahrhundert wie ein Regentropfen ist, der sich im Strom verliert, und dass im Leben der Materie die Jahrtausende ebenso schnell vergehen, wie die Jahre im Leben eines Volkes?
Es ist kaum hundert Jahre her, dass man nach Hubers Vorgang die Bienen ernstlich zu beobachten und die ersten Fundamentalwahrheiten zu entdecken begonnen hat, die ein erfolgreiches Studium erlauben. Etwas mehr als fünfzig Jahre ist es her, dass sich durch die Erfindung der beweglichen Waben und Kastenstöcke des Pfarrers Dzierzon eine rationelle und praktische Bienenzucht anbahnt, dass der Bienenstock nicht mehr ein unverletzliches Haus ist, wo alles ins Mysterium gehüllt bleibt, bis der Tod es entschleiert, wenn es nicht mehr ist. Schliesslich ist es weniger als fünfzig Jahre her, seit durch Vervollkommnung des Mikroskops und des Handwerkszeuges der Entomologen das Geheimnis der Hauptorgane der Arbeitsbienen, der Königin und der Drohnen blossgelegt ist. Ist es da erstaunlich, dass unser Wissen nicht weiter reicht, als unsere Erfahrung? Die Bienen leben seit Jahrtausenden, und wir beobachten sie seit zehn oder zwölf Lustren. Und wenn es auch bewiesen wäre,
dass sich im Bienenstocke nichts verändert hat, seit wir ihn geöffnet haben, so haben wir doch noch kein Recht, daraus zu folgern, dass sich nie etwas darin geändert hat, bevor wir ihn befragten. Wissen wir nicht, dass in der Entwickelung einer Gattung ein Jahrhundert wie ein Regentropfen ist, der sich im Strom verliert, und dass im Leben der Materie die Jahrtausende ebenso schnell vergehen, wie die Jahre im Leben eines Volkes?
 Aber es ist unbewiesen, dass sich in den Gewohnheiten der Bienen nichts verändert haben soll. Prüft man sie ohne vorgefasste Meinung und ohne das kleine Feld unserer heutigen Erfahrung zu verlassen, so wird man im Gegenteil sehr merklicher Veränderungen gewahr. Und wer nennt die, welche uns entgehen? Ein Beobachter, der etwa einhundertfünfzigmal unsere Grösse und siebenhunderttausendmal unseren Umfang hätte (es sind dies die Zahlenverhältnisse zwischen unserer Statur und Schwere und denen der kleinen Honigbiene), ein Beobachter, der unsere Sprache nicht verstünde und mit ganz anderen Sinnen begabt wäre, als wir, würde vielleicht entdecken, dass sich in den zwei letzten Dritteln des verflossenen Jahrhunderts recht sonderbare materielle Veränderungen vollzogen haben, aber von unserer moralischen, sozialen, religiösen, politischen und ökonomischen Entwickelung könnte er sich keinen Begriff machen.
Aber es ist unbewiesen, dass sich in den Gewohnheiten der Bienen nichts verändert haben soll. Prüft man sie ohne vorgefasste Meinung und ohne das kleine Feld unserer heutigen Erfahrung zu verlassen, so wird man im Gegenteil sehr merklicher Veränderungen gewahr. Und wer nennt die, welche uns entgehen? Ein Beobachter, der etwa einhundertfünfzigmal unsere Grösse und siebenhunderttausendmal unseren Umfang hätte (es sind dies die Zahlenverhältnisse zwischen unserer Statur und Schwere und denen der kleinen Honigbiene), ein Beobachter, der unsere Sprache nicht verstünde und mit ganz anderen Sinnen begabt wäre, als wir, würde vielleicht entdecken, dass sich in den zwei letzten Dritteln des verflossenen Jahrhunderts recht sonderbare materielle Veränderungen vollzogen haben, aber von unserer moralischen, sozialen, religiösen, politischen und ökonomischen Entwickelung könnte er sich keinen Begriff machen.
Eine höchst wahrscheinliche wissenschaftliche Hypothese wird uns sogleich erlauben, unsere Hausbiene an den grossen Stamm der Apinen zu knüpfen, der alle wilden Bienen umfasst, und in dem vielleicht ihre Vorfahren zu suchen sind. In der wissenschaftlichen Einteilung nimmt die Hausbiene (Apis mellifica) folgenden Platz ein. Klasse: Insekten. Ordnung: Immen (Hymenoptera). Familie: Eigentliche Bienen (Apidae). Sippe: Apis. Art: Mellifica. Die Bezeichnung Mellifica stammt aus der Linné'schen Einteilung. Sie ist nicht sehr glücklich gewählt, denn alle Bienen, mit Ausnahme einiger Parasiten, sind Honigbienen. Scopoli sagt cerifera, Réaumur domestica, Geoffroy gregaria. – Apis ligustica, die italienische Biene, ist nur eine Abart von Apis mellifica. Wir werden dann physiologischen, sozialen, ökonomischen, architektonischen und industriellen Wandelungen beiwohnen, die selbst unsere menschliche Entwickelung in Schatten stellen. Zunächst jedoch wollen wir uns an unsere Hausbiene halten, deren man etwa sechzehn Arten zählt. Aber ob Apis dorsata, die grösste, oder Apis florea, die kleinste, die man kennt, es ist immer dasselbe Insekt, durch Klima und Umstände, denen es sich hat anpassen müssen, mehr oder minder verändert. Alle diese Arten sind sich nicht viel unähnlicher, als ein Engländer einem Russen oder ein Japaner einem Europäer. Indem wir unsere Vorbemerkungen dermassen beschränken, wollen wir hier nur das feststellen, was wir mit eigenen Augen und zu dieser Stunde sehen können, ohne unsere Zuflucht zu irgend einer Hypothese zu nehmen, mag sie noch so wahrscheinlich und unabweislich sein. Wir wollen auch nicht auf all die Thatsachen Bezug nehmen, die man hier heranziehen könnte. Einige der bezeichnendsten mögen in schneller Aufzählung genügen.
 Die wesentlichste und radikalste Verbesserung, die einer ungeheuren Arbeitsleistung in der Menschenwelt entsprechen würde, ist zunächst der Schutz des Gemeinwesens nach aussen.
Die wesentlichste und radikalste Verbesserung, die einer ungeheuren Arbeitsleistung in der Menschenwelt entsprechen würde, ist zunächst der Schutz des Gemeinwesens nach aussen.
Die Bienen wohnen nicht wie wir in Städten unter offenem Himmel, die den Launen von Wind und Wetter ausgesetzt sind, sondern ihre Siedelungen sind ganz und gar mit einer schützenden Hülle umgeben. Im Naturzustande und in einem idealen Klima ist das nicht der Fall. Wenn sie nur den Tiefen ihres Instinktes Gehör gäben, so würden sie ihre Waben offen bauen. In Indien sucht die Apis dorsata nicht allzubegierig hohle Bäume und Felshöhlen auf. Der Schwarm legt sich an einen Astwinkel an und die Wabe entsteht, die Königin legt Eier, die Vorräte häufen sich ohne ein anderes Obdach, als die Leiber der Arbeitsbienen. Man hat bisweilen beobachtet, dass unsere nördlichen Bienen sich durch einen zu milden Sommer täuschen liessen und diesem Instinkt wieder Gehör gaben, und man hat Schwärme gefunden, die so im Freien im Buschwerk lebten. Der Fall tritt auch bei Nachschwärmen häufig genug ein, denn sie sind weniger erfahren und vorsichtig, als der Vorschwarm. An ihrer Spitze befindet sich eine junge, leichtsinnige Königin, und sie bestehen meist aus ganz jungen Bienen, in denen der ursprüngliche Instinkt um so lauter spricht, weil sie die Strenge und Wetterwendigkeit unseres nordischen Himmels noch nicht kennen. Übrigens lebt keiner dieser Schwärme über die ersten Herbststürme hinaus, und sie vermehren die unzähligen Opfer der langsamen und dunklen Versuche der Natur.
Aber selbst in Indien hat diese anscheinend eingeborene Gewohnheit oft unangenehme Folgen. Sie verdammt einen Teil der Arbeitsbienen zur Unbeweglichkeit. Die nötige Wärme für die am Wachsbau und an der Errichtung von Brutzellen thätigen Bienen zu erzeugen, ist ihre einzige That, und infolge dessen baut die Apis dorsata, die an den Ästen hängt, nur eine Wabe. Das bescheidenste Obdach erlaubt ihr vier oder fünf und noch mehr anzulegen, und um soviel hebt sich auch die Bevölkerungszahl und der Wohlstand des Volkes. Darum haben auch alle Bienenrassen der kalten und gemässigten Zone diese ursprüngliche Methode aufgegeben. Augenscheinlich hat die natürliche Auslese die kluge Initiative des Insektes geheiligt, indem sie nur die volkreichsten und geschütztesten Stämme den nordischen Winter überdauern lässt; und was zuerst nur ein Gedanke war, der dem Instinkte zuwiderlief, ist allmählich zur instinktiven Gewohnheit geworden. Aber darum steht es doch fest, dass es zuerst ein kühner und wahrscheinlich an Beobachtungen, Erfahrungen und Überlegungen reicher Gedanke war, dem weiten, angebeteten, natürlichen Lichte Valet zu sagen und sich in den Höhlen eines Baumes oder Felsens zu bergen. Man möchte fast sagen, diese Erfindung war für die Geschicke der Hausbiene ebenso bedeutungsvoll, wie die Entdeckung des Feuers für das Menschengeschlecht.
 Neben diesem grossen Fortschritte, der, obwohl alt und erblich, doch jedesmal neu errungen werden muss, finden wir eine Fülle von unendlich veränderlichen Einzelheiten, die uns beweisen, dass Politik und Gewerbfleiss des Bienenstaates nicht in eherne Formen gegossen sind. Wir erwähnten schon den klugen Ersatz von Pollen durch Mehl und den von Wachs durch eine künstliche Zementmasse. Wir haben gesehen, wie geschickt sie die oft verzweifelt ungastlichen Wohnungen, in die man sie einschlägt, ihren Bedürfnissen anzupassen wissen. Wir haben gleichfalls gesehen, mit welcher unmittelbaren, überraschenden Gewandtheit sie sich die Kunstwaben, die ihnen der erfinderische Sinn des Menschen darbot, zu Nutze gemacht haben. Hier ist die sinnreiche Ausnutzung eines wunderbar brauchbaren,
aber unvollständigen Dinges geradezu staunenswert. Sie haben den Menschen mit seinen halben Andeutungen thatsächlich verstanden. Man stelle sich vor, wir bauten unsere Städte seit Jahrhunderten nicht mit Kalk, Steinen und Ziegeln, sondern mit einer dehnbaren Substanz, die wir mit Hilfe von besonderen Organen mühsam aus unserem Körper ausschieden, und eines Tages setzt uns ein allmächtiges Wesen mitten in eine fabelhafte Stadt. Wir erkennen, dass sie aus einem ganz ähnlichen Stoffe besteht, wie wir ihn ausscheiden, aber im übrigen ist es ein Traum, der just durch seine Logik, eine verzerrte und gewissermassen reduzierte und konzentrierte Logik, mehr verwirrt, als die Zusammenhangslosigkeit selbst. Unser gewöhnlicher Bauplan findet sich darin wieder, alles ist so, wie wir es erwarten können, aber nur potenziell und sozusagen durch eine eingeborene feindliche Macht erdrückt, im Entstehen aufgehalten und nicht zur vollen Entfaltung gediehen. Die Häuser, die vier oder fünf Meter hoch sein sollen, bestehen nur aus kleinen Anschwellungen von Handbreite. Tausend Mauern sind durch einen Strich angedeutet, der ihr Schicksal und zugleich das Baumaterial, aus dem sie gebaut werden sollen, in sich schliesst. Dazu findet sich manche grosse Unregelmässigkeit, die zu verbessern bleibt, Lücken müssen ausgefüllt und mit dem Ganzen in Übereinstimmung gebracht, weite lockere Flächen befestigt werden. Denn das Werk ist unverhofft brauchbar, aber unfertig und in seinem jetzigen Zustande geradezu gefährlich. Es scheint von einer überlegenen Vernunft ersonnen,
die unsere meisten Wünsche erraten hat, aber durch ihre eigene Riesenhaftigkeit behindert wurde, sie anders als ganz grob zu verwirklichen. Es handelt sich also darum, das alles zu entwirren, sich die geringsten Absichten des übernatürlichen Gebers zu Nutze zu machen, in wenigen Tagen das zu bauen, was sonst Jahre in Anspruch nehmen würde, auf seine organischen Gewohnheiten zu verzichten und seine Arbeitsmethoden von Grund aus umzuwerfen. Ganz gewiss bedürfte es aller unserer Anspannung, um die auftauchenden Probleme zu lösen und nichts von den Vorteilen zu verlieren, die eine grossmütige Vorsehung uns darböte. Aber dies ist ungefähr dasselbe, was die Bienen in unseren modernen Mobilstöcken thun.
Da wir uns hier zum letzten Male mit den Bauten der Bienen beschäftigen, wollen wir eine Eigentümlichkeit der
Apis florea nicht unerwähnt lassen. Einzelne Drohnenzellen sind bei ihr cylindrisch, statt sechseckig. Es scheint also, dass sie noch nicht dauernd von der einen Form zur anderen übergegangen ist und endgültig die bessere angenommen hat.
Neben diesem grossen Fortschritte, der, obwohl alt und erblich, doch jedesmal neu errungen werden muss, finden wir eine Fülle von unendlich veränderlichen Einzelheiten, die uns beweisen, dass Politik und Gewerbfleiss des Bienenstaates nicht in eherne Formen gegossen sind. Wir erwähnten schon den klugen Ersatz von Pollen durch Mehl und den von Wachs durch eine künstliche Zementmasse. Wir haben gesehen, wie geschickt sie die oft verzweifelt ungastlichen Wohnungen, in die man sie einschlägt, ihren Bedürfnissen anzupassen wissen. Wir haben gleichfalls gesehen, mit welcher unmittelbaren, überraschenden Gewandtheit sie sich die Kunstwaben, die ihnen der erfinderische Sinn des Menschen darbot, zu Nutze gemacht haben. Hier ist die sinnreiche Ausnutzung eines wunderbar brauchbaren,
aber unvollständigen Dinges geradezu staunenswert. Sie haben den Menschen mit seinen halben Andeutungen thatsächlich verstanden. Man stelle sich vor, wir bauten unsere Städte seit Jahrhunderten nicht mit Kalk, Steinen und Ziegeln, sondern mit einer dehnbaren Substanz, die wir mit Hilfe von besonderen Organen mühsam aus unserem Körper ausschieden, und eines Tages setzt uns ein allmächtiges Wesen mitten in eine fabelhafte Stadt. Wir erkennen, dass sie aus einem ganz ähnlichen Stoffe besteht, wie wir ihn ausscheiden, aber im übrigen ist es ein Traum, der just durch seine Logik, eine verzerrte und gewissermassen reduzierte und konzentrierte Logik, mehr verwirrt, als die Zusammenhangslosigkeit selbst. Unser gewöhnlicher Bauplan findet sich darin wieder, alles ist so, wie wir es erwarten können, aber nur potenziell und sozusagen durch eine eingeborene feindliche Macht erdrückt, im Entstehen aufgehalten und nicht zur vollen Entfaltung gediehen. Die Häuser, die vier oder fünf Meter hoch sein sollen, bestehen nur aus kleinen Anschwellungen von Handbreite. Tausend Mauern sind durch einen Strich angedeutet, der ihr Schicksal und zugleich das Baumaterial, aus dem sie gebaut werden sollen, in sich schliesst. Dazu findet sich manche grosse Unregelmässigkeit, die zu verbessern bleibt, Lücken müssen ausgefüllt und mit dem Ganzen in Übereinstimmung gebracht, weite lockere Flächen befestigt werden. Denn das Werk ist unverhofft brauchbar, aber unfertig und in seinem jetzigen Zustande geradezu gefährlich. Es scheint von einer überlegenen Vernunft ersonnen,
die unsere meisten Wünsche erraten hat, aber durch ihre eigene Riesenhaftigkeit behindert wurde, sie anders als ganz grob zu verwirklichen. Es handelt sich also darum, das alles zu entwirren, sich die geringsten Absichten des übernatürlichen Gebers zu Nutze zu machen, in wenigen Tagen das zu bauen, was sonst Jahre in Anspruch nehmen würde, auf seine organischen Gewohnheiten zu verzichten und seine Arbeitsmethoden von Grund aus umzuwerfen. Ganz gewiss bedürfte es aller unserer Anspannung, um die auftauchenden Probleme zu lösen und nichts von den Vorteilen zu verlieren, die eine grossmütige Vorsehung uns darböte. Aber dies ist ungefähr dasselbe, was die Bienen in unseren modernen Mobilstöcken thun.
Da wir uns hier zum letzten Male mit den Bauten der Bienen beschäftigen, wollen wir eine Eigentümlichkeit der
Apis florea nicht unerwähnt lassen. Einzelne Drohnenzellen sind bei ihr cylindrisch, statt sechseckig. Es scheint also, dass sie noch nicht dauernd von der einen Form zur anderen übergegangen ist und endgültig die bessere angenommen hat.
 Selbst die Politik des Bienenstaates ist wahrscheinlich nicht stets dieselbe geblieben, sagte ich. Es ist dies der dunkelste und am schwersten nachzuweisende Punkt. Ich will mich nicht bei der veränderlichen Behandlungsweise der Königinnen aufhalten, noch bei den jedem Volke eigenen Gesetzen des Schwärmens, die sich von Geschlecht zu Geschlecht zu vererben scheinen. Neben diesen Thatsachen, die nicht ganz fest umschrieben sind, giebt es noch andere, die weder schwankend noch unbestimmt sind und deutlich beweisen, dass nicht alle Arten der Hausbiene auf derselben Stufe politischer Gesittung stehen, dass es solche giebt, deren politischer Geist noch tastet und vielleicht nach einer andern Lösung des Problems der Königin trachtet. Die
syrische Biene z. B. zieht gewöhnlich einhundert und zwanzig Königinnen auf und mehr, wogegen unsere Apis mellifica höchstens bis auf zehn oder zwölf kommt. Cheshire berichtet von einem syrischen Volke, das keineswegs abnorm war und bei dem sich einundzwanzig tote Königinnen und neunzig lebende und freie befanden. Dies ist der Ausgangs- oder Endpunkt einer recht seltsamen sozialen Entwickelung, und es verlohnte sich, ihr mehr auf den Grund zu gehen. Übrigens steht die cyprische Biene in Bezug auf die Aufziehung der Königinnen der syrischen sehr nahe. Ist dies ein tastender Rückfall vom monarchischen Prinzip zur Oligarchie, zur vielfachen Mutterschaft nach der erprobten einzigen? Jedenfalls war die syrische und cyprische Biene, die der ägyptischen und italienischen nahe verwandt ist, wohl die erste, die der Mensch unter seine Botmässigkeit gebracht hat. Zum Schluss noch eine Beobachtung, die noch deutlicher zeigt, dass die Sitten und die weitblickende Organisation des Bienenstaates nicht das Ergebnis eines ursprünglichen Triebes sind, der sich mechanisch von Jahrhundert zu Jahrhundert und von Klima zu Klima forterbt, sondern dass der Geist, der diese kleinen Gemeinwesen lenkt, den veränderten Umständen Rechnung trägt, sich ihnen fügt und daraus Vorteil zieht, wie er den früheren Gefahren vorzubeugen wusste. Wird unsere schwarze Biene also nach Australien oder Californien gebracht, so verändert sie ihre Gewohnheiten vollständig. Vom zweiten oder dritten Jahre an, d. h. sobald sie gemerkt hat, dass ewiger Sommer herrscht und nie
Blumenmangel eintritt, lebt sie in den Tag hinein, begnügt sich damit, soviel Pollen und Honig einzutragen, als zum täglichen Gebrauche nötig ist, und da ihre neue, verstandesmässige Beobachtung über ihre erbliche Erfahrung Herr wird, so trägt sie keinen Wintervorrat mehr ein. Man erhält sie sogar nur dadurch in Thätigkeit, dass man ihr die Früchte ihrer Arbeit fortnimmt.
Etwas ähnliches berichtet Büchner: Auf der Insel Barbados, wo viele Zuckersiedereien sind und die Bienen das ganze Jahr hindurch Zucker in Überfluss finden, befliegen sie keine Blüte mehr. Ein Beweis mehr, dass die Anpassung an die Umstände nicht langsam, etwa im Laufe von Jahrhunderten stattfindet oder unbewusst und fatalistisch ist, sondern dass sie unmittelbar eintritt und auf Überlegung beruht.
Selbst die Politik des Bienenstaates ist wahrscheinlich nicht stets dieselbe geblieben, sagte ich. Es ist dies der dunkelste und am schwersten nachzuweisende Punkt. Ich will mich nicht bei der veränderlichen Behandlungsweise der Königinnen aufhalten, noch bei den jedem Volke eigenen Gesetzen des Schwärmens, die sich von Geschlecht zu Geschlecht zu vererben scheinen. Neben diesen Thatsachen, die nicht ganz fest umschrieben sind, giebt es noch andere, die weder schwankend noch unbestimmt sind und deutlich beweisen, dass nicht alle Arten der Hausbiene auf derselben Stufe politischer Gesittung stehen, dass es solche giebt, deren politischer Geist noch tastet und vielleicht nach einer andern Lösung des Problems der Königin trachtet. Die
syrische Biene z. B. zieht gewöhnlich einhundert und zwanzig Königinnen auf und mehr, wogegen unsere Apis mellifica höchstens bis auf zehn oder zwölf kommt. Cheshire berichtet von einem syrischen Volke, das keineswegs abnorm war und bei dem sich einundzwanzig tote Königinnen und neunzig lebende und freie befanden. Dies ist der Ausgangs- oder Endpunkt einer recht seltsamen sozialen Entwickelung, und es verlohnte sich, ihr mehr auf den Grund zu gehen. Übrigens steht die cyprische Biene in Bezug auf die Aufziehung der Königinnen der syrischen sehr nahe. Ist dies ein tastender Rückfall vom monarchischen Prinzip zur Oligarchie, zur vielfachen Mutterschaft nach der erprobten einzigen? Jedenfalls war die syrische und cyprische Biene, die der ägyptischen und italienischen nahe verwandt ist, wohl die erste, die der Mensch unter seine Botmässigkeit gebracht hat. Zum Schluss noch eine Beobachtung, die noch deutlicher zeigt, dass die Sitten und die weitblickende Organisation des Bienenstaates nicht das Ergebnis eines ursprünglichen Triebes sind, der sich mechanisch von Jahrhundert zu Jahrhundert und von Klima zu Klima forterbt, sondern dass der Geist, der diese kleinen Gemeinwesen lenkt, den veränderten Umständen Rechnung trägt, sich ihnen fügt und daraus Vorteil zieht, wie er den früheren Gefahren vorzubeugen wusste. Wird unsere schwarze Biene also nach Australien oder Californien gebracht, so verändert sie ihre Gewohnheiten vollständig. Vom zweiten oder dritten Jahre an, d. h. sobald sie gemerkt hat, dass ewiger Sommer herrscht und nie
Blumenmangel eintritt, lebt sie in den Tag hinein, begnügt sich damit, soviel Pollen und Honig einzutragen, als zum täglichen Gebrauche nötig ist, und da ihre neue, verstandesmässige Beobachtung über ihre erbliche Erfahrung Herr wird, so trägt sie keinen Wintervorrat mehr ein. Man erhält sie sogar nur dadurch in Thätigkeit, dass man ihr die Früchte ihrer Arbeit fortnimmt.
Etwas ähnliches berichtet Büchner: Auf der Insel Barbados, wo viele Zuckersiedereien sind und die Bienen das ganze Jahr hindurch Zucker in Überfluss finden, befliegen sie keine Blüte mehr. Ein Beweis mehr, dass die Anpassung an die Umstände nicht langsam, etwa im Laufe von Jahrhunderten stattfindet oder unbewusst und fatalistisch ist, sondern dass sie unmittelbar eintritt und auf Überlegung beruht.
 Soviel können wir mit unseren Augen sehen. Wie man zugeben wird, sind dies ein paar ausschlaggebende Thatsachen und ein gutes Argument gegen die Ansicht derer, die da meinen, dass aller Verstand unbeweglich und in eherne Formen gegossen ist, ausgenommen der menschliche.
Soviel können wir mit unseren Augen sehen. Wie man zugeben wird, sind dies ein paar ausschlaggebende Thatsachen und ein gutes Argument gegen die Ansicht derer, die da meinen, dass aller Verstand unbeweglich und in eherne Formen gegossen ist, ausgenommen der menschliche.
Wenn wir die Hypothese der Entwickelung aber einen Augenblick zugeben, so wird das Schauspiel grösser, und sein unbestimmter, gewaltiger Schein reicht bis an unsere eigenen Geschicke. Es ist nicht augenscheinlich, aber wer sich ernstlich damit beschäftigt, für den ist es nicht mehr zweifelhaft, dass in der Natur ein Wille herrscht, der danach trachtet, einen Teil der Materie auf eine höhere, vielleicht auch bessere Stufe zu erheben und ihre Oberfläche allmählich mit jenem geheimnisvollen Fluidum zu überziehen, das wir zuerst das Leben, dann den Instinkt und kurz danach den Verstand nennen, ein Wille, der die Existenz alles dessen, was einem unbekannten Ziele zustrebt, zu sichern, zu organisieren und zu erleichtern trachtet. Es steht nicht fest, aber viele Beispiele, die wir um uns haben, laden zu der Annahme ein, dass die Materie, die sich von Urbeginn an dergestalt erhoben hat, gesetzt dass man sie wägen und zählen könnte, nicht aufgehört hat, zuzunehmen. Ich wiederhole es: die Annahme steht auf schwachen Füssen, aber sie ist die einzige über die verborgene Kraft, welche uns lenkt, zu der wir ein Recht haben, und das ist viel in einer Welt, in der unsere erste Pflicht die Zuversicht zum Leben ist, selbst dann, wenn man keine ermutigende Gewissheit darin entdecken würde, und solange es keine gegenteilige Gewissheit giebt.
Ich weiss, was man gegen die Entwickelungslehre alles einwenden kann. Sie hat zahlreiche Beweise und starke Gründe für sich, aber sie sind nicht notwendig überzeugend. Man darf sich den Wahrheiten seines Zeitalters nie rückhaltlos anvertrauen. In hundert Jahren werden vielleicht viele Kapitel in unseren Büchern, die von ihr durchtränkt sind, deswegen veraltet sein, wie heute die Werke der Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts, die von einer zu vollkommenen Menschheit ausgehen, die es nicht giebt, oder so viele Werke des siebzehnten Jahrhunderts, die befleckt werden durch den Gedanken des kleinlichen und strengen Gottes der von so vielen Lügen und Eitelkeiten entstellten katholischen Tradition.
Trotzdem ist es gut, wenn man die Wahrheit über eine Sache nicht wissen kann, die Hypothese anzunehmen, die sich in dem Augenblick, wo der Zufall uns ins Leben gerufen hat, dem Verstande am unabweislichsten aufdrängt. Man kann wetten, dass sie falsch ist, aber solange man sie für wahr hält, ist sie nützlich, belebt sie die Gemüter und giebt unserer Wissbegier eine neue Richtung. Es mag auf den ersten Blick weiser erscheinen, diese feinsinnigen Hypothesen durch die einfache, tiefere Wahrheit zu ersetzen, dass wir nichts wissen. Aber diese Wahrheit wäre nur dann erspriesslich, wenn es bewiesen wäre, dass wir nie etwas wissen werden. Inzwischen würde sie uns in einer Unbeweglichkeit erhalten, die verderblicher ist, als die thörichtesten Illusionen. Wir sind so geschaffen, dass uns nichts höher und weiter trägt, als die Sprünge unserer Irrtümer. Im Grunde danken wir das Wenige, was wir wissen, den gewagtesten, oft geradezu absurden Hypothesen, die zumeist weit unkluger sind, als die heutige. Sie waren vielleicht sinnlos, aber sie haben die Glut der Erkenntnis in uns geschürt. Mag der, welcher am Herde der Herberge der Menschheit wacht, blind oder im höchsten Alter sein: was thut das dem Wanderer, der friert und sich an seine Seite setzt? Wenn das Feuer unter seiner Obhut nicht erloschen ist, so hat er gethan, was der Beste nicht besser machen könnte. Übertragen wir diese Glut, und zwar nicht wie sie ist, sondern gesteigert; und nichts kann sie so mehren, wie diese Entwickelungshypothese, die uns zwingt, alles, was auf und unter dieser Erde, in den Tiefen des Meeres und an der Veste des Himmels ist, fortan nach strengeren Methoden und mit anhaltenderer Leidenschaft zu befragen. Was giebt es zum Ersatz für sie, und was sollen wir an ihre Stelle setzen, wenn wir sie verwerfen? Etwa das grosse Geständnis der gelehrten Unwissenheit, die sich selbst erkennt, ein Geständnis, das gewöhnlich so thatlos und für die Wissbegier, die dem Menschen nötiger ist, als selbst die Weisheit, so entmutigend ist, oder die Hypothese von dem Beharren der Arten und der göttlichen Schöpfung, die noch unbewiesener ist, als die unsere, und die den lebendigsten Teil des Problems für immer von sich abschiebt, indem sie das Unerklärliche zu befragen vermeidet?
 An diesem Aprilmorgen im Garten, der unter dem frischen Himmelstau zu neuem Leben erwachte, sah ich um die Rosenbeete und die zitternden Primeln in ihrer Einfassung von weissem Täschelkraut, das auch Alysse oder Steinkraut genannt wird, die wilden Bienen schwirren, die Urmütter der unserem Willen und Begehren unterworfenen, und ich gedachte der Lehren meines alten seeländischen Bienenfreundes. Mehr als einmal ist er mit mir durch seine bunten Blumenbeete gegangen, die so gehalten und angelegt waren, wie zu Zeiten des Vater Cats, jenes guten, prosaischen und unversieglichen holländischen Dichters. Sie bildeten Rosetten, Sterne, Guirlanden, Ohrringe und Armleuchter am Fusse einer Weissdornhecke oder eines Obstbaumes, der als Kugel, Pyramide oder Spindel zugeschnitten war, und die Buchsbaumeinfassung lief wie ein wachsamer Schäferhund um alle Ränder, um zu verhüten, dass die Blumen auf den Weg wuchsen. Ich lernte die Namen und Gewohnheiten der einsamen Kunstbienen kennen, die wir nie beachten, da wir sie für gemeine Fliegen, schädliche Wespen oder stumpfsinnige
Käfer halten. Und doch trägt eine jede von ihnen unter ihrem doppelten Flügelpaar, das sie im Insektenlande kennzeichnet, den Lebensplan, die Werkzeuge und den Gedanken zu einem ganz besonderen und oft wunderbaren Schicksal. Da sind zunächst die nächsten Verwandten unserer Hausbiene, die zottigen, untersetzten Hummeln, bisweilen winzig, meist aber riesig und wie die Urmenschen in ein unförmiges Fell gekleidet, um das sich kupferne oder zinnoberrote Spangen schlingen. Sie sind noch halbe Barbaren, vergewaltigen die Kelche, zerreissen sie, wenn sie Widerstand leisten, und dringen unter die atlasschimmernden Schleier der Blumenkronen, wie ein Höhlenbär unter das seiden- und perlenglänzende Zelt einer byzantinischen Prinzessin.
An diesem Aprilmorgen im Garten, der unter dem frischen Himmelstau zu neuem Leben erwachte, sah ich um die Rosenbeete und die zitternden Primeln in ihrer Einfassung von weissem Täschelkraut, das auch Alysse oder Steinkraut genannt wird, die wilden Bienen schwirren, die Urmütter der unserem Willen und Begehren unterworfenen, und ich gedachte der Lehren meines alten seeländischen Bienenfreundes. Mehr als einmal ist er mit mir durch seine bunten Blumenbeete gegangen, die so gehalten und angelegt waren, wie zu Zeiten des Vater Cats, jenes guten, prosaischen und unversieglichen holländischen Dichters. Sie bildeten Rosetten, Sterne, Guirlanden, Ohrringe und Armleuchter am Fusse einer Weissdornhecke oder eines Obstbaumes, der als Kugel, Pyramide oder Spindel zugeschnitten war, und die Buchsbaumeinfassung lief wie ein wachsamer Schäferhund um alle Ränder, um zu verhüten, dass die Blumen auf den Weg wuchsen. Ich lernte die Namen und Gewohnheiten der einsamen Kunstbienen kennen, die wir nie beachten, da wir sie für gemeine Fliegen, schädliche Wespen oder stumpfsinnige
Käfer halten. Und doch trägt eine jede von ihnen unter ihrem doppelten Flügelpaar, das sie im Insektenlande kennzeichnet, den Lebensplan, die Werkzeuge und den Gedanken zu einem ganz besonderen und oft wunderbaren Schicksal. Da sind zunächst die nächsten Verwandten unserer Hausbiene, die zottigen, untersetzten Hummeln, bisweilen winzig, meist aber riesig und wie die Urmenschen in ein unförmiges Fell gekleidet, um das sich kupferne oder zinnoberrote Spangen schlingen. Sie sind noch halbe Barbaren, vergewaltigen die Kelche, zerreissen sie, wenn sie Widerstand leisten, und dringen unter die atlasschimmernden Schleier der Blumenkronen, wie ein Höhlenbär unter das seiden- und perlenglänzende Zelt einer byzantinischen Prinzessin.
Neben ihnen, und grösser als die grösste unter ihnen, steht ein in Finsternis gehülltes Ungetüm, von düsterem Feuer glühend, grün und violett: die Holzbiene (Xylocopa violacea), der Riese in der Bienenwelt. Ihr folgen in der Grösse die ernsten Mörtelbienen (Chalicodoma), die in Schwarz gekleidet sind und sich aus Lehm und Kies Wohnungen erbauen, die hart wie Stein sind. Dann kommen mit einander die Bürsten- oder Hosenbienen (Dasypoda) und die wespenähnlichen Ballenbienen (Halictus), die Erd- oder Sandbienen (Andrena), die oft einem phantastischen Schmarotzer zum Opfer fallen, dem Stylops, der ihr Aussehen vollständig verändert, die zwerghaften, stets schwer mit Pollen beladenen Grabbienen und die vielgestaltigen Osmien (Mauerbienen), die hundert verschiedene Industriezweige haben. Eine von ihnen, die Osmia papaveris, begnügt sich nicht mit dem Brot und Wein, den ihr die Blumen liefern, sie schneidet sich auch grosse Purpurlappen aus den Mohnblumen heraus, um damit den Palast ihrer Töchter fürstlich auszutapezieren. Eine andere Biene, die kleinste von allen, ein Staubkorn, das auf vier elektrisch bewegten Flügeln schwebt, der Blattschneider (Megachile centuncularis), sägt haarscharfe Halbkreise, die man mit der Maschine ausgeschnitten meint, aus den Rosenblättern, faltet sie zusammen und formt daraus jene wundervoll regelmässig zusammengesetzten fingerhutförmigen Zellen, deren jede zur Aufnahme einer Larve dient. Aber ein Buch würde kaum genügen, um die mannigfachen Gewohnheiten und Talente der honigsuchenden Schar aufzuzählen, die sich in jedem Sinne auf begierigen und unbeweglichen Blüten tummelt, wie zwischen gefesselten Brautpaaren, die der Liebesbotschaft harren, welche zerstreute Gäste ihnen bringen.
 Man kennt etwa 4500 wilde Bienenarten. Wir werden sie selbstredend nicht alle durchgehen. Vielleicht wird eines Tages ein gründlicheres Studium in Verbindung mit Beobachtungen und Experimenten, die noch nicht gemacht sind, und die mehr als ein Menschenleben in Anspruch nehmen würden, ein entscheidendes Licht auf die Entwickelungsgeschichte der Bienen werfen. Diese Geschichte ist meines Wissens noch nicht methodisch geschrieben worden. Und doch ist dies zu wünschen, denn es würde damit mehr als ein Problem berührt, das ebenso
gross ist, wie viele Probleme der Weltgeschichte. Was uns betrifft, so wollen wir keine Behauptungen mehr aufstellen, denn wir betreten hier das dunkle Gebiet der Vermutungen, sondern wir wollen uns damit begnügen, einem Zweige der Immen auf seinem Wege zu einem durchgeistigteren Dasein, zu etwas mehr Wohlstand und Sicherheit zu folgen und die springenden Punkte dieses mehrtausendjährigen Aufstieges mit einfachen Strichen anzudeuten. Der Zweig, den wir verfolgen wollen, ist, wie wir schon wissen, der der
Apinen
Man verwechsele nicht Apinen, Apiden und Apiten. Diese drei Ausdrücke werden durcheinander gebraucht, wie sie sich in der Klassifikation von Emile Blanchard vorfinden. Der Stamm der
Apinen umfasst alle Familien der Bienen, die
Apiden bilden die erste Familie derselben und zerfallen ihrerseits in Apiten, Meliponiten und Bombinen (Hummeln). Die
Apiten endlich umfassen die verschiedenen Arten unserer Hausbiene., deren Merkmale so genau bestimmt und deutlich sind, dass ihre Abkunft von einem gemeinsamen Ahnen nicht unwahrscheinlich ist.
Man kennt etwa 4500 wilde Bienenarten. Wir werden sie selbstredend nicht alle durchgehen. Vielleicht wird eines Tages ein gründlicheres Studium in Verbindung mit Beobachtungen und Experimenten, die noch nicht gemacht sind, und die mehr als ein Menschenleben in Anspruch nehmen würden, ein entscheidendes Licht auf die Entwickelungsgeschichte der Bienen werfen. Diese Geschichte ist meines Wissens noch nicht methodisch geschrieben worden. Und doch ist dies zu wünschen, denn es würde damit mehr als ein Problem berührt, das ebenso
gross ist, wie viele Probleme der Weltgeschichte. Was uns betrifft, so wollen wir keine Behauptungen mehr aufstellen, denn wir betreten hier das dunkle Gebiet der Vermutungen, sondern wir wollen uns damit begnügen, einem Zweige der Immen auf seinem Wege zu einem durchgeistigteren Dasein, zu etwas mehr Wohlstand und Sicherheit zu folgen und die springenden Punkte dieses mehrtausendjährigen Aufstieges mit einfachen Strichen anzudeuten. Der Zweig, den wir verfolgen wollen, ist, wie wir schon wissen, der der
Apinen
Man verwechsele nicht Apinen, Apiden und Apiten. Diese drei Ausdrücke werden durcheinander gebraucht, wie sie sich in der Klassifikation von Emile Blanchard vorfinden. Der Stamm der
Apinen umfasst alle Familien der Bienen, die
Apiden bilden die erste Familie derselben und zerfallen ihrerseits in Apiten, Meliponiten und Bombinen (Hummeln). Die
Apiten endlich umfassen die verschiedenen Arten unserer Hausbiene., deren Merkmale so genau bestimmt und deutlich sind, dass ihre Abkunft von einem gemeinsamen Ahnen nicht unwahrscheinlich ist.
Darwins Schüler, insbesondere Hermann Müller, halten eine kleine wilde Biene, die in der ganzen Welt vorkommt, die Prosopis, für den gegenwärtigen Repräsentanten der Urbiene, von der alle uns bekannten Arten abstammen sollen.
Die arme Prosopis steht zu den Hausbienen in etwa dem Verhältnis, wie der Höhlenmensch zum glücklichen Grosstadtbewohner. Vielleicht hat jeder von uns, ohne darauf zu achten, und ohne zu ahnen, dass er hier die ehrwürdige Urmutter vor sich hat, der wir vielleicht die Mehrzahl unserer Blumen und Früchte verdanken – denn man glaubt thatsächlich, dass über hunderttausend Pflanzenarten nicht mehr sein würden, wenn die Bienen sie nicht beflögen und dadurch befruchteten – und wer weiss? vielleicht auch unsere Zivilisation, denn alles greift bei diesen Mysterien in einander über – vielleicht hat jeder von uns sie schon öfter in einem entlegenen Winkel seines Gartens um Gestrüpp herumfliegen sehen. Sie ist hübsch und lebhaft, und die, welche in Frankreich am häufigsten vorkommt, ist elegant mit weiss auf schwarzem Grund gesprenkelt. Aber unter dieser Eleganz verbirgt sich eine unglaubliche Armut. Sie führt ein Hungerleben. Sie ist fast nackt, während ihre Schwestern in warme, prächtige Pelze gekleidet sind. Sie hat keine Schenkelkörbchen zum Einsammeln von Pollen, wie die Apiden, oder an ihrer statt Schienenbürsten, wie die Andrenen, oder Bauchbürsten wie die Bauchsammler. Sie muss den Blumenstaub mit ihren kleinen Krallen hervorscharren und verschlucken, um ihn einzutragen. Sie hat kein anderes Werkzeug, als ihre Zunge, ihren Mund und ihre Füsse, aber die Zunge ist zu kurz, ihre Füsse sind schwächlich und ihre Kauwerkzeuge ohne Kraft. Sie kann weder Wachs erzeugen, noch Löcher in Holz bohren oder in die Erde graben. Sie legt ungeschickte Gänge im weichen Mark der trockenen Brombeeren an, baut ein paar grobe Zellen hinein, versieht sie mit etwas Nahrung für die Brut, die sie nie erblicken wird, und nach Erledigung dieser armseligen Aufgabe, deren Ziel sie nicht kennt, ebensowenig wie wir es kennen, stirbt sie, einsam auf dieser Welt, wie sie gelebt hat, in einem Winkel.
 Wir übergehen viele Zwischenstufen, wo die Zunge allmählich länger wird, um einer immer grösseren Zahl von Blumenkelchen ihren Nektar zu entreissen, wo sich Sammelwerkzeuge für Pollen, Haare und
Franzen, Schenkel-, Fersen- und Bauchbürsten bilden und entwickeln, wo die Füsse und Kinnbacken kräftiger werden, während nützliche Ausscheidungen des Körpers eintreten und über dem Wohnungsbau ein Geist schwebt, der erstaunliche Verbesserungen aller Art zu suchen und zu finden weiss. Dies darzustellen, würde ein Buch für sich beanspruchen. Ich will nur ein Kapitel daraus skizzieren oder noch weniger als ein Kapitel, eine Seite, die uns das Zaudern und Tasten des Lebenswillens in seinem Trachten nach Glück und die langsame Entstehung, das Wachstum und die Selbstgestaltung der sozialen Vernunft zeigt.
Wir übergehen viele Zwischenstufen, wo die Zunge allmählich länger wird, um einer immer grösseren Zahl von Blumenkelchen ihren Nektar zu entreissen, wo sich Sammelwerkzeuge für Pollen, Haare und
Franzen, Schenkel-, Fersen- und Bauchbürsten bilden und entwickeln, wo die Füsse und Kinnbacken kräftiger werden, während nützliche Ausscheidungen des Körpers eintreten und über dem Wohnungsbau ein Geist schwebt, der erstaunliche Verbesserungen aller Art zu suchen und zu finden weiss. Dies darzustellen, würde ein Buch für sich beanspruchen. Ich will nur ein Kapitel daraus skizzieren oder noch weniger als ein Kapitel, eine Seite, die uns das Zaudern und Tasten des Lebenswillens in seinem Trachten nach Glück und die langsame Entstehung, das Wachstum und die Selbstgestaltung der sozialen Vernunft zeigt.
Wir haben gesehen, wie die unglückliche Prosopis in dieser ungeheuren Welt voll schrecklicher Gefahren ihr kleines einsames Leben schweigend erträgt. Eine gewisse Anzahl ihrer Schwestern, die zu Rassen mit besseren Werkzeugen und grösserer Gewandtheit gehören, wie z. B. die reich gekleideten Seidenbienen (Colletes) oder die sonderbaren Blattschneider des Rosenstockes (Megachile centuncularis), leben in derselben tiefen Vereinsamung, und wenn zufällig ein anderes Wesen mit ihnen zusammenwohnt und ihr Obdach teilt, so ist es ein Feind oder gar ein Schmarotzer. Denn die Bienenwelt ist mit weit absonderlicheren Gespenstern bevölkert als die unsere, und manche Art hat einen geheimnisvollen, unthätigen Doppelgänger, der dem von ihm auserkorenen Opfer in allen Stücken gleicht, ausser dass er durch seine unvordenkliche Faulheit alle Arbeitswerkzeuge nacheinander verloren hat und nur noch auf Kosten des emsigen Typus seiner Rasse leben kann. Zum Beispiel die Hummeln, deren Schmarotzer die Psithyrus oder Schmarotzerhummeln sind, die Steliden, die auf Kosten der Anthidien leben. »Man ist«, sagt J. Perez (»Les Abeilles«) sehr richtig, »wegen der häufig vorkommenden Ähnlichkeit der Schmarotzer mit ihren Opfern zu der Annahme gezwungen, dass beide Arten nur zwei Formen desselben Typus bilden und engstens mit einander verwandt sind. Für die der Entwickelungslehre huldigenden Naturforscher ist diese Verwandtschaft nicht nur ideell, sondern real. Die Schmarotzerart ist nach ihnen nur eine Abart der anderen und hat ihre Sammelwerkzeuge durch Anpassung an das Schmarotzerleben verloren.«
Indessen regt sich schon bei den Bienenarten, die man etwas zu kategorisch als »einsame Bienen« bezeichnet, der soziale Instinkt wie eine unter dem Druck der auf allem primitiven Leben lastenden Materie erstickte Flamme. Hier und da, an unvermuteter Stelle, züngelt er in furchtsamer und bisweilen bizarrer Weise, wie um zu zeigen, dass er da ist, allmählich aus dem auf ihm lastenden Holzstoss hervor, der eines Tages seinem Triumphe die Nahrung zuführen wird.
Wenn alles auf Erden Stoff ist, so kann man hier die unstofflichste Bewegung des Stoffes beobachten. Es handelt sich um den Übergang vom egoistischen, unsicheren, unvollkommenen Leben zum brüderlichen, etwas gesicherteren und glücklicheren Dasein. Es handelt sich darum, im Geiste zu vereinigen, was in der Körperwelt getrennt ist, die Selbstverleugnung des Individuums zu Gunsten der Art und die Ersetzung des Sichtbaren durch das Unsichtbare anzubahnen. Ist es da erstaunlich, dass den Bienen das, was wir von unserem privilegierten Platze aus noch nicht erreicht haben, von dem der Instinkt nach allen Seiten ins Bewusstsein ausstrahlt – dass den Bienen das nicht mit einem Schlage gelingt? Es ist wunderbar, fast rührend zu sehen, wie die neue Idee zuerst in der Finsternis tastet, die alles auf Erden Entstehende umhüllt. Sie geht aus der Materie hervor und ist noch ganz Materie. Sie ist nichts als Hunger, Furcht und Kälte, in etwas noch Gestaltloseres umgesetzt. Sie schleicht unsicher um die grossen Gefahren, die langen Nächte, den Einbruch des Winters und einen zweideutigen Schlaf herum, der schon fast Tod ist.
 Die Holzbienen (Xylocopa) sind starke Bienen, die ihr Nest in trockenes Holz graben. Sie leben immer einsam. Trotzdem kommt es gegen Ende des Sommers vor, dass man einige Exemplare einer besonderen Art, der Xylocopa cyanescens, in einem Asphodelenkelche frostig bei einander kauern sieht, um den Winter gemeinsam zu verbringen. Diese zögernde Brüderlichkeit ist eine Ausnahme bei den Holzbienen; aber bei ihren nächsten Verwandten, den Ceratinen, wird sie schon zur unveränderlichen Gewohnheit. Hier kommt die Idee zum Vorschein. Sofort hält sie wieder inne, und bis hierher ist sie bei den Holzbienen über die erste dunkle Linie der Liebe nicht hinausgekommen.
Die Holzbienen (Xylocopa) sind starke Bienen, die ihr Nest in trockenes Holz graben. Sie leben immer einsam. Trotzdem kommt es gegen Ende des Sommers vor, dass man einige Exemplare einer besonderen Art, der Xylocopa cyanescens, in einem Asphodelenkelche frostig bei einander kauern sieht, um den Winter gemeinsam zu verbringen. Diese zögernde Brüderlichkeit ist eine Ausnahme bei den Holzbienen; aber bei ihren nächsten Verwandten, den Ceratinen, wird sie schon zur unveränderlichen Gewohnheit. Hier kommt die Idee zum Vorschein. Sofort hält sie wieder inne, und bis hierher ist sie bei den Holzbienen über die erste dunkle Linie der Liebe nicht hinausgekommen.
Bei anderen Apinen nimmt die sich noch suchende Idee andere Gestalt an. Die Mörtelbienen (Chalicodoma) oder Maurerbienen, die Bürstenbienen (Dasypoda) und Ballenbienen (Halictus) vereinigen sich in zahlreichen Kolonien zum Nesterbau. Aber dies ist ein illusorisches Gemeinwesen von lauter Einsiedlern. Keinerlei Einvernehmen, keine gemeinsame That. Eine jede ist in der Menge tief vereinsamt und baut sich ihre Wohnung für sich selbst, ohne sich um ihre Nachbaren zu kümmern. »Es ist«, sagt J. Perez, »ein einfaches Zusammenkommen von Einzelwesen, die sich durch gleichen Geschmack und gleiche Fähigkeiten am selben Fleck versammeln, wo der Grundsatz ›jeder für sich‹ auf das strengste durchgeführt wird. Es ist ein Schwarm von Arbeitern, der lediglich durch seinen Fleiss und seine Zahl an einen Bienenstock erinnert. Solche Vereinigungen sind also die einfache Folge einer grossen Zahl von Einzelwesen, die auf demselben Fleck wohnen.«
Aber bei den Grabbienen, den Vettern der Dasypoden, dringt plötzlich ein kleiner Lichtstrahl hervor und wirft einen Schein auf die Entstehung eines neuen Gefühls in dem zufälligen Beieinander. Sie vereinigen sich nach Art der vorigen, und jede gräbt ihre eigene unterirdische Höhle für sich, aber der Eingang, das von der Erdoberfläche nach ihren getrennten Behausungen führende Schlupfloch, ist gemeinsam. »So beträgt sich jede«, sagt Perez, »was die Arbeit in den Zellen betrifft, wie wenn sie allein wäre, aber alle benutzen den gemeinsamen Zugang und benutzen so die Arbeit einer einzigen, wodurch sie die Zeit und Mühe sparen, sich jede einen besonderen Gang anzulegen. Es wäre interessant festzustellen, ob diese vorläufige Arbeit selbst nicht gemeinsam ausgeführt wird, und ob sich nicht verschiedene Weibchen abwechselnd darin ablösen.«
Wie dem aber auch sei, die Idee der Brüderlichkeit ist einmal durch die Mauer gedrungen, die zwei Welten schied. Es ist nicht mehr der Winter, der Hunger oder die Todesfurcht, der sie dem Instinkt in entstellter und thörichter Form abzwingt, es ist das thätige Leben, das sie einflüstert. Aber auch diesmal kommt sie nicht weit in dieser Richtung. Trotzdem verzagt sie nicht, sie versucht andere Wege einzuschlagen. So dringt sie bei den Hummeln durch, nimmt in ihrer veränderten Atmosphäre Gestalt an, reift und bewirkt die ersten entscheidenden Wunder.
 Die Hummeln, diese grossen, zottigen, geräuschvollen, furchteinflössenden und doch so friedfertigen Bienen, die wir alle kennen, sind zunächst einsam. Von den ersten Tagen des März an beginnt das fruchtbare, überwinterte Weibchen sein Nest zu bauen, entweder unterirdisch oder in einem Busche, je nach der Art, zu der es gehört. Es ist allein auf der Welt im erwachenden Lenze. Es räumt die gewählte Stelle auf, gräbt ein Loch und tapeziert es aus. Dann legt es ziemlich unförmige Wachszellen an, versieht sie mit Honig und Pollen, legt Eier, bebrütet sie, pflegt und ernährt die auskriechenden Larven und sieht sich alsbald von einer Töchterschar umgeben, die bei allen inneren und äusseren Arbeiten Hand anlegt und zum Teil gleichfalls Eier legt. Der Wohlstand nimmt zu, der Zellenbau wird besser, die Kolonie wächst. Die Gründerin bleibt die Seele und Hauptmutter des Ganzen und steht an der Spitze eines Königreiches, das schon ein Ansatz zu dem unserer Hausbiene ist. Übrigens ein recht grober Ansatz. Der Wohlstand ist beschränkt, die Gesetze sind unklar und werden schlecht befolgt, der Kannibalismus und Kindermord der Urzeit tauchen immer wieder auf, die Architektur ist formlos und weitläufig, aber was beide Stadtbildungen am meisten unterscheidet, ist, dass die eine permanent
und die andere vorübergehend ist. In der That verschwindet die Hummelstadt im Herbst vollständig, ihre drei- bis vierhundert Bewohner sterben, ohne eine Spur ihres Daseins zu hinterlassen, all ihre Arbeit ist umsonst; es überwintert nur ein einziges Weibchen, das im nächsten Frühjahr in derselben Einsamkeit und Armut die fruchtlose Arbeit der Mutter wieder aufnehmen wird. Nichtsdestoweniger ist die Idee sich hier ihrer Kraft bewusst geworden. Wir sehen sie bei den Hummeln diese Grenze nicht überschreiten, aber sogleich wird sie sich, ihrer Gewohnheit getreu, in einer Art von unermüdlicher Seelenwanderung inkarnieren, noch zitternd über ihren letzten Triumph, aber allmächtig und fast vollkommen, und zwar in einer anderen Sippe, der vorletzten der Rasse, der unmittelbaren Vorgängerin unserer Hausbiene, die ihre Krone bildet, nämlich in der Sippe der Meliponiten, die in die tropischen Meliponen und Trigonen zerfällt.
Die Hummeln, diese grossen, zottigen, geräuschvollen, furchteinflössenden und doch so friedfertigen Bienen, die wir alle kennen, sind zunächst einsam. Von den ersten Tagen des März an beginnt das fruchtbare, überwinterte Weibchen sein Nest zu bauen, entweder unterirdisch oder in einem Busche, je nach der Art, zu der es gehört. Es ist allein auf der Welt im erwachenden Lenze. Es räumt die gewählte Stelle auf, gräbt ein Loch und tapeziert es aus. Dann legt es ziemlich unförmige Wachszellen an, versieht sie mit Honig und Pollen, legt Eier, bebrütet sie, pflegt und ernährt die auskriechenden Larven und sieht sich alsbald von einer Töchterschar umgeben, die bei allen inneren und äusseren Arbeiten Hand anlegt und zum Teil gleichfalls Eier legt. Der Wohlstand nimmt zu, der Zellenbau wird besser, die Kolonie wächst. Die Gründerin bleibt die Seele und Hauptmutter des Ganzen und steht an der Spitze eines Königreiches, das schon ein Ansatz zu dem unserer Hausbiene ist. Übrigens ein recht grober Ansatz. Der Wohlstand ist beschränkt, die Gesetze sind unklar und werden schlecht befolgt, der Kannibalismus und Kindermord der Urzeit tauchen immer wieder auf, die Architektur ist formlos und weitläufig, aber was beide Stadtbildungen am meisten unterscheidet, ist, dass die eine permanent
und die andere vorübergehend ist. In der That verschwindet die Hummelstadt im Herbst vollständig, ihre drei- bis vierhundert Bewohner sterben, ohne eine Spur ihres Daseins zu hinterlassen, all ihre Arbeit ist umsonst; es überwintert nur ein einziges Weibchen, das im nächsten Frühjahr in derselben Einsamkeit und Armut die fruchtlose Arbeit der Mutter wieder aufnehmen wird. Nichtsdestoweniger ist die Idee sich hier ihrer Kraft bewusst geworden. Wir sehen sie bei den Hummeln diese Grenze nicht überschreiten, aber sogleich wird sie sich, ihrer Gewohnheit getreu, in einer Art von unermüdlicher Seelenwanderung inkarnieren, noch zitternd über ihren letzten Triumph, aber allmächtig und fast vollkommen, und zwar in einer anderen Sippe, der vorletzten der Rasse, der unmittelbaren Vorgängerin unserer Hausbiene, die ihre Krone bildet, nämlich in der Sippe der Meliponiten, die in die tropischen Meliponen und Trigonen zerfällt.
 Hier ist bereits alles so organisiert, wie in unserem Bienenstocke: eine einzige Mutter
Es steht freilich nicht fest, ob das Prinzip des Königtums oder der Mutterschaft einer Einzigen bei den Meliponiten sehr streng durchgeführt wird. Blanchard glaubt mit Recht, dass wahrscheinlich mehrere Weibchen in einem Stocke leben, da sie sich bei ihrer Stachellosigkeit nicht so leicht töten können, wie die Bienenköniginnen. Aber dies ist bisher nie festgestellt worden, weil die Weibchen und Arbeiterinnen sehr schwer zu unterscheiden sind und die Meliponiten in unseren Himmelsstrichen durchaus nicht gedeihen., unfruchtbare Arbeiterinnen und Drohnen. Einige Einzelheiten sind sogar besser eingerichtet. Die Drohnen sind z. B. nicht vollständig müssig, sie schwitzen Wachs aus. Das Eingangsthor ist sorgfältiger geschlossen, in kalten Nächten durch eine Thür, in warmen durch eine Art von Vorhang, der die Luft durchlässt.
Hier ist bereits alles so organisiert, wie in unserem Bienenstocke: eine einzige Mutter
Es steht freilich nicht fest, ob das Prinzip des Königtums oder der Mutterschaft einer Einzigen bei den Meliponiten sehr streng durchgeführt wird. Blanchard glaubt mit Recht, dass wahrscheinlich mehrere Weibchen in einem Stocke leben, da sie sich bei ihrer Stachellosigkeit nicht so leicht töten können, wie die Bienenköniginnen. Aber dies ist bisher nie festgestellt worden, weil die Weibchen und Arbeiterinnen sehr schwer zu unterscheiden sind und die Meliponiten in unseren Himmelsstrichen durchaus nicht gedeihen., unfruchtbare Arbeiterinnen und Drohnen. Einige Einzelheiten sind sogar besser eingerichtet. Die Drohnen sind z. B. nicht vollständig müssig, sie schwitzen Wachs aus. Das Eingangsthor ist sorgfältiger geschlossen, in kalten Nächten durch eine Thür, in warmen durch eine Art von Vorhang, der die Luft durchlässt.
Aber das Gemeinwesen ist weniger stark, das gemeinsame Leben weniger gesichert, das Gedeihen beschränkter als bei unseren Bienen, und überall, wo man diese einführt, beginnen die Meliponiten vor ihnen zu weichen. Der Gedanke der Brüderlichkeit ist bei ihren beiden Stämmen gleichfalls prächtig entwickelt, nur in einem Punkte ist er bei dem einen nicht über das hinausgekommen, was im engen Familienbau der Hummeln schon erreicht war. Es ist dies die mechanische Organisation der gemeinsamen Arbeit, das genaue Haushalten mit den Kräften, mit einem Worte, die Architektur der Stadt, die hier offenbar noch sehr rückständig ist. Siehe auch die ausführlichere Darstellung auf Seite 112. Hinzugefügt sei noch, dass bei unseren Apiten alle Zellen sowohl zur Aufziehung der Brut wie zur Aufspeicherung der Vorräte geeignet sind, und ebensolange vorhalten, wie die Stadt selbst, während sie bei den Meliponiten nur zu einem bestimmten Zwecke benutzt, und wenn sie den jungen Nymphen zur Wiege gedient haben, nach deren Auskriechen abgetragen werden.
Bei unserer Hausbiene hat dieser Gedanke also seine vollkommenste Form erreicht, und somit wäre das rasch entworfene und unvollständige Bild seines Entwickelungsganges hier beendet. Sind nun aber die einzelnen Stufen dieses Entwickelungsganges bei jeder Art konstant, und besteht die Verbindungslinie zwischen ihnen nur in unserer Vorstellung? Wir wollen auf diesem noch wenig erforschten Gebiete keine voreiligen Schlüsse wagen. Begnügen wir uns zunächst mit vorläufigen Annahmen, und neigen wir, wenn wir wollen, lieber den hoffnungsvollsten zu, denn wenn es unbedingt zu wählen gälte, so zeigt uns hier und dort ein schwacher Schein, dass die am meisten herbeigewünschten die gewissesten sein werden. Überdies müssen wir wieder einmal eingestehen, dass wir garnichts wissen. Wir fangen erst an, die Augen zu öffnen. Tausend Versuche, die gemacht werden könnten, haben noch nicht stattgefunden. Wäre es z. B. nicht möglich, dass die Prosopis, wenn sie in Gefangenschaft gehalten und gezwungen würden, mit ihresgleichen zu hausen, mit der Zeit die Eisenschwelle der vollkommenen Einsamkeit überschreiten und Freude daran finden würden, sich wie die Hosenbienen zu vereinigen und einen Schritt zur Brüderlichkeit zu thun, wie die Grabbienen? Und diese wiederum, würden sie unter abnormen, aufgezwungenen Verhältnissen den gemeinsamen Schlupfgang nicht mit einer gemeinsamen Wohnung vertauschen? Würden die Hummelmütter, wenn sie zusammen überwintert und in Gefangenschaft aufgezogen und gefüttert würden, sich nicht schliesslich zur Arbeitsteilung verstehen? Hat man den Meliponiten je Kunstwaben gegeben? Hat man ihnen künstliche Gefässe gegeben, um ihre sonderbaren »Honigtöpfe« zu ersetzen? Würden sie dieselben annehmen und sich zu Nutze machen, und wie würden sie ihre Gewohnheiten dieser ungewohnten Bauart anpassen? Dergleichen Fragen sind an sehr kleine Wesen gerichtet und schliessen doch die Lösung unserer grössten Geheimnisse ein. Wir können nicht darauf antworten, denn unsere Erfahrung ist von gestern und ehegestern. Von Réaumur an gerechnet, ist es jetzt kaum anderthalb Jahrhunderte her, dass man die Gewohnheiten gewisser wilder Bienen studiert hat. Réaumur kannte nur einen Teil davon, wir haben einige andere beobachtet, aber hunderte, vielleicht tausende, sind bis heute nur von unwissenden oder hastigen Reisenden befragt worden. Die, welche wir seit den schönen Arbeiten des Verfassers der »Mémoires« kennen, haben an ihren Gewohnheiten nichts geändert, und die Hummeln, die sich in den Gärten von Charenton voll Honig sogen und wie ein köstliches Murmeln des Sonnenlichtes goldbestäubt umhersummten, glichen in jedem Punkte denen, die sich im nächsten April einige Schritte weiter in den Wäldern von Vincennes tummeln werden. Aber von Réaumur bis auf unsere Tage ist es nur ein Augenzwinkern der Zeit, das wir beobachten, und mehrere Menschenleben hintereinander bilden nur eine Sekunde in der Geschichte eines Naturgedankens.
 Wenn der Gedanke der Gesellschaftsbildung, dessen schrittweiser Verwirklichung wir in diesem Buche mit den Augen gefolgt sind, seine vollkommenste Gestalt bei unseren Hausbienen erreicht hat, so ist damit nicht gesagt, dass im Bienenstock alles auf der Höhe sei. Ein Meisterstück, die sechseckige Zelle, erreicht freilich die absolute Vollkommenheit in jeder Hinsicht, und alle Genies zusammen könnten nichts mehr daran verbessern. Kein lebendes Wesen, selbst der Mensch nicht, hat in seiner Sphäre das erreicht, was die Biene in der ihren verwirklicht hat, und wenn ein Geist aus einer anderen Welt auf die
Erde herabstiege und die vollkommenste Schöpfung der Logik des Lebens zu sehen begehrte, so müsste man ihm die schlichte Honigwabe zeigen.
Wenn der Gedanke der Gesellschaftsbildung, dessen schrittweiser Verwirklichung wir in diesem Buche mit den Augen gefolgt sind, seine vollkommenste Gestalt bei unseren Hausbienen erreicht hat, so ist damit nicht gesagt, dass im Bienenstock alles auf der Höhe sei. Ein Meisterstück, die sechseckige Zelle, erreicht freilich die absolute Vollkommenheit in jeder Hinsicht, und alle Genies zusammen könnten nichts mehr daran verbessern. Kein lebendes Wesen, selbst der Mensch nicht, hat in seiner Sphäre das erreicht, was die Biene in der ihren verwirklicht hat, und wenn ein Geist aus einer anderen Welt auf die
Erde herabstiege und die vollkommenste Schöpfung der Logik des Lebens zu sehen begehrte, so müsste man ihm die schlichte Honigwabe zeigen.
Aber wie gesagt, es steht nicht alles auf gleicher Höhe. Wir sind schon einigen Fehlern und Irrtümern begegnet, die bisweilen auffällig, bisweilen geheimnisvoll sind, wie der Überfluss an müssigen und verderblichen Drohnen, die jungfräuliche Zeugung, die Gefahren des Hochzeitsausfluges, das Schwarmfieber, der Mangel an Mitleid, die geradezu ungeheuerliche Aufopferung des Individuums zu Gunsten der Art. Dazu käme noch eine seltsame Vorliebe zum Aufspeichern unmässiger Quantitäten von Pollen, die unbenutzt bleiben und daher ranzig und hart werden und die Waben verstopfen, ferner das lange unfruchtbare Interregnum, das vom ersten Schwärmen bis zur Befruchtung der zweiten Königin reicht, u. a. m.
Von diesen Fehlern ist der schwerste und der einzige, der unter unseren Himmelsstrichen fast immer verhängnisvoll wird, das wiederholte Schwärmen. Aber vergessen wir nicht, dass in dieser Hinsicht die natürliche Auslese der Hausbiene seit Jahrtausenden vom Menschen gekreuzt wird. Vom Ägypter der Pharaonenzeit bis zu unserm heutigen Bauern hat der Bienenzüchter den Wünschen und dem Vorteil der Gattung stets zuwider gehandelt. Die Bienenstöcke, die am besten gedeihen, sind die, welche zu Beginn des Sommers einen einzigen Schwarm aussenden. Sie befriedigen damit ihren mütterlichen Instinkt, sichern die Erhaltung des Stammes durch die notwendige Erneuerung der Königin, und ebenso die Zukunft des Schwarmes, der volkreich und früh abgesandt ist und darum Zeit hat, sich eine dauerhafte und mit Vorräten wohl versehene Wohnung anzulegen, ehe der Herbst kommt. Es ist klar, dass wenn die Bienen sich selbst überlassen wären, nur diese Stöcke und ihre Ableger aus den Prüfungen des Winters lebend hervorgegangen wären, während die von anderen Instinkten beseelten Völker ihnen fast regelmässig erliegen würden, und dass sich die Regel des beschränkten Schwärmens bei unsern nördlichen Rassen dadurch fast durchgehends herausgebildet hätte. Aber es sind gerade diese weitblickenden, reichen und wohl akklimatisierten Stöcke, die der Mensch stets vernichtet hat, um sich ihres Schatzes zu bemächtigen. Er liess und lässt auch heute noch in der hergebrachten Praxis nur die Stämme und Kolonien am Leben, die erschöpft sind, die zweiten und dritten (Nach-)Schwärme, die gerade soviel haben, um den Winter zu überdauern, oder denen er einige Honigabfälle giebt, um ihre kläglichen Vorräte zu vervollständigen. Das Resultat davon ist wahrscheinlich eine Schwächung der Rasse und eine erbliche Neigung zum Schwarmfieber, sodass heute fast alle unsere Bienen, insbesondere unsere schwarzen Bienen, zu viel schwärmen. Seit einigen Jahren wird diese gefährliche Angewohnheit durch die neuen Methoden der Mobilzucht bekämpft, und wenn man sieht, mit welcher Schnelligkeit die künstliche Auslese auf die meisten unserer Haustiere, Rinder, Schafe, Hunde, Pferde und Tauben wirkt, – um nicht noch mehr zu nennen, – so darf man der Hoffnung Raum geben, dass wir in kurzem eine Bienenrasse haben werden, die auf das natürliche Schwärmen fast ganz verzichtet und ihre ganze Thätigkeit der Honig- und Pollenernte zuwendet.
 Aber was die anderen Fehler betrifft: würde ein Verstand, dem Zweck und Ziel des Gesellschaftslebens deutlicher wäre, sich nicht davon befreien können? Es wäre viel über diese Fehler zu sagen, die bald aus den unbekannten Tiefen des Bienenstockes hervordringen, bald nichts als eine Folge des Schwärmens und seiner Irrtümer sind, an denen wir mitschuldig sind. Aber nach dem, was man bisher gesehen hat, kann jeder nach seinem Geschmack den Bienen allen Verstand zu- oder absprechen. Ich will sie nicht verteidigen. Mich deucht, sie zeigen unter manchen Verhältnissen ein Einvernehmen, aber wenn sie auch alles, was sie thun, nur blindlings thäten, meine Wissbegier würde darum nicht kleiner werden. Es ist so anziehend zu sehen, wie ein Gehirn
in sich die ausserordentlichen Hilfsquellen entdeckt, um gegen Frost, Hunger, Tod, Zeit, Raum, Einsamkeit und alle Feinde der belebten Materie anzukämpfen, aber wenn es einem Wesen gelingt, sein kleines verwickeltes und tiefes Leben zu erhalten, ohne den Instinkt zu überschreiten, ohne etwas zu thun, was nicht ganz gewöhnlich ist: das dünkt mich erst recht anziehend und ausserordentlich. Das Gewöhnliche und das Wunderbare fliessen in einander über und halten sich die Wage, sobald man sie auf ihren wirklichen
Platz in der Natur stellt. Nicht mehr sie, die Träger angemasster Namen, sondern das Unerklärliche und Unverstandene ist es, was unsere Blicke auf sich lenken, unsere Thätigkeit belohnen und unseren Gedanken, Worten und Gefühlen eine neue, richtigere Form verleihen soll. Es ist Weisheit darin, sich mit nichts weiter zu befassen.
Aber was die anderen Fehler betrifft: würde ein Verstand, dem Zweck und Ziel des Gesellschaftslebens deutlicher wäre, sich nicht davon befreien können? Es wäre viel über diese Fehler zu sagen, die bald aus den unbekannten Tiefen des Bienenstockes hervordringen, bald nichts als eine Folge des Schwärmens und seiner Irrtümer sind, an denen wir mitschuldig sind. Aber nach dem, was man bisher gesehen hat, kann jeder nach seinem Geschmack den Bienen allen Verstand zu- oder absprechen. Ich will sie nicht verteidigen. Mich deucht, sie zeigen unter manchen Verhältnissen ein Einvernehmen, aber wenn sie auch alles, was sie thun, nur blindlings thäten, meine Wissbegier würde darum nicht kleiner werden. Es ist so anziehend zu sehen, wie ein Gehirn
in sich die ausserordentlichen Hilfsquellen entdeckt, um gegen Frost, Hunger, Tod, Zeit, Raum, Einsamkeit und alle Feinde der belebten Materie anzukämpfen, aber wenn es einem Wesen gelingt, sein kleines verwickeltes und tiefes Leben zu erhalten, ohne den Instinkt zu überschreiten, ohne etwas zu thun, was nicht ganz gewöhnlich ist: das dünkt mich erst recht anziehend und ausserordentlich. Das Gewöhnliche und das Wunderbare fliessen in einander über und halten sich die Wage, sobald man sie auf ihren wirklichen
Platz in der Natur stellt. Nicht mehr sie, die Träger angemasster Namen, sondern das Unerklärliche und Unverstandene ist es, was unsere Blicke auf sich lenken, unsere Thätigkeit belohnen und unseren Gedanken, Worten und Gefühlen eine neue, richtigere Form verleihen soll. Es ist Weisheit darin, sich mit nichts weiter zu befassen.
 Wir sind überdies garnicht im stande, die Fehler der Bienen im Namen unseres Verstandes zu richten. Sehen wir nicht, wie lange Verstand und Bewusstsein bei uns inmitten von Fehlern und Irrtümern leben, ohne sie zu bemerken, und länger noch, ohne ihnen abzuhelfen? Wenn es ein Wesen giebt, das durch seine Bestimmung besonders, ja fast organisch, berufen scheint, sich aller Dinge bewusst zu werden, das Gesellschaftsleben nach den Regeln der reinen Vernunft zu gestalten und zu leben, so ist es der Mensch. Und doch: was macht er daraus? Und nun vergleiche man die Fehler des Bienenstaates mit denen unserer menschlichen Gesellschaft. Wenn wir Bienen wären, welche die Menschen beobachteten, so würde unser Erstaunen gross sein, wenn wir z. B. die unlogische und ungerechte Verteilung der Arbeit bei einem Geschlechte beobachteten, das im übrigen mit hervorragendem Verstande ausgerüstet scheint. Wir sehen die Oberfläche der Erde, die einzige Stätte alles gemeinsamen Lebens, von zwei bis drei Zehnteln der Gesamtbevölkerung mühsam und unzureichend bebaut; ein anderes Zehntel zehrt in absolutem Müssiggange den besten Teil
der Produkte jener Arbeit auf, und die sieben übrigen Zehntel sind zu ewigem Halbverhungern verdammt und erschöpfen sich unaufhörlich in seltsamen und unfruchtbaren Anstrengungen, von denen sie doch nie etwas haben werden, und die nur den Zweck zu haben scheinen, das Dasein der Müssiggänger noch komplizierter und unerklärlicher zu machen. Wir würden daraus folgern, dass Vernunft und Moralbegriffe dieser Wesen einer Welt angehören, die von der unseren gänzlich verschieden ist, und dass sie Prinzipien gehorchen, die zu begreifen wir nicht hoffen dürfen. Aber gehen wir unsere Fehler nicht weiter durch, sind sie unserem Geiste doch stets gegenwärtig, wenn ihre Gegenwärtigkeit auch keine grosse Wirkung thut. Höchstens, dass sich von Jahrhundert zu Jahrhundert einer erhebt, einen Augenblick den Schlaf abschüttelt, einen Schrei des Erstaunens thut, den schmerzenden Arm unter seinem Kopfe wegzieht, sich anders hinlegt und wieder einschläft, bis ein neuer Schmerz, wiederum eine Folge der traurigen Erschlaffung der Ruhe, ihn von neuem erweckt.
Wir sind überdies garnicht im stande, die Fehler der Bienen im Namen unseres Verstandes zu richten. Sehen wir nicht, wie lange Verstand und Bewusstsein bei uns inmitten von Fehlern und Irrtümern leben, ohne sie zu bemerken, und länger noch, ohne ihnen abzuhelfen? Wenn es ein Wesen giebt, das durch seine Bestimmung besonders, ja fast organisch, berufen scheint, sich aller Dinge bewusst zu werden, das Gesellschaftsleben nach den Regeln der reinen Vernunft zu gestalten und zu leben, so ist es der Mensch. Und doch: was macht er daraus? Und nun vergleiche man die Fehler des Bienenstaates mit denen unserer menschlichen Gesellschaft. Wenn wir Bienen wären, welche die Menschen beobachteten, so würde unser Erstaunen gross sein, wenn wir z. B. die unlogische und ungerechte Verteilung der Arbeit bei einem Geschlechte beobachteten, das im übrigen mit hervorragendem Verstande ausgerüstet scheint. Wir sehen die Oberfläche der Erde, die einzige Stätte alles gemeinsamen Lebens, von zwei bis drei Zehnteln der Gesamtbevölkerung mühsam und unzureichend bebaut; ein anderes Zehntel zehrt in absolutem Müssiggange den besten Teil
der Produkte jener Arbeit auf, und die sieben übrigen Zehntel sind zu ewigem Halbverhungern verdammt und erschöpfen sich unaufhörlich in seltsamen und unfruchtbaren Anstrengungen, von denen sie doch nie etwas haben werden, und die nur den Zweck zu haben scheinen, das Dasein der Müssiggänger noch komplizierter und unerklärlicher zu machen. Wir würden daraus folgern, dass Vernunft und Moralbegriffe dieser Wesen einer Welt angehören, die von der unseren gänzlich verschieden ist, und dass sie Prinzipien gehorchen, die zu begreifen wir nicht hoffen dürfen. Aber gehen wir unsere Fehler nicht weiter durch, sind sie unserem Geiste doch stets gegenwärtig, wenn ihre Gegenwärtigkeit auch keine grosse Wirkung thut. Höchstens, dass sich von Jahrhundert zu Jahrhundert einer erhebt, einen Augenblick den Schlaf abschüttelt, einen Schrei des Erstaunens thut, den schmerzenden Arm unter seinem Kopfe wegzieht, sich anders hinlegt und wieder einschläft, bis ein neuer Schmerz, wiederum eine Folge der traurigen Erschlaffung der Ruhe, ihn von neuem erweckt.
 Die Entwickelung der Apinen, oder doch wenigstens der Apiten, sei einmal zugegeben, da sie wahrscheinlicher ist als die Starrheit. Welches ist dann aber ihre beständige und allgemeine Richtung? Sie scheint dieselbe Kurve zu beschreiben, wie die unsrige. Sie hat ersichtlich die Tendenz, Kraft zu sparen, die Unsicherheit, das Elend zu mindern, den Wohlstand, die günstigen Verhältnisse und die Autorität der
Art zu mehren. Diesem Ziele opfert sie ohne Zaudern das Individuum, dessen überdies illusorische und unglückliche Unabhängigkeit im Zustande der Einsamkeit durch die Kraft und das Glück der Gesamtheit wieder ausgeglichen wird. Man möchte sagen, die Natur denkt wie Perikles bei Thukydides, dass die Individuen im Schosse einer Stadt, die als Ganzes gedeiht, glücklicher sind, selbst wenn sie darunter zu leiden haben, als wenn das Individuum gedeiht und der Staat zu Grunde geht. Sie begünstigt die arbeitsame Sklaverei in der mächtigen Stadt und überlässt den pflichtenlosen Wanderer den namen- und gestaltlosen Feinden, die in allen Winkeln von Raum und Zeit, in allen Bewegungen des Weltalls lauern. Es ist hier nicht der Ort, diesen Gedanken der Natur zu erörtern, noch sich zu fragen, ob der Mensch gut thue, ihm zu folgen, aber das steht fest, dass überall da, wo die unendliche Materie uns den Ansatz zu einem Gedanken zu zeigen scheint, dieser Ansatz denselben Weg der Entwickelung nimmt, dessen Ziel man nicht kennt. Was uns betrifft, so genügt es uns zu sehen, mit welcher Fürsorge die Natur es sich angelegen sein lässt, in der sich entwickelnden Rasse alles das zu erhalten und festzulegen, was der feindlichen Trägheit der Materie einmal abgerungen ist. Sie bucht jedes erfolgreiche Bemühen und zieht gegen den Rückfall, der nach dem Vorstoss unvermeidlich sein würde, eine Schranke von besonderen, wohlwollenden Gesetzen. Dieser Fortschritt, der sich bei den intelligenteren Arten kaum ableugnen lässt, hat vielleicht keinen anderen Zweck, als den der Bewegung,
und er weiss nicht, wohin er strebt. Auf alle Fälle ist es in einer Welt, in der nichts, ausser einigen Thatsachen dieser Art, auf einen bestimmten Willen schliessen lässt, recht bezeichnend zu sehen, wie sich gewisse Wesen von dem Tage an, wo wir die Augen aufthaten, derart von Stufe zu Stufe ununterbrochen erheben; und wenn die Bienen uns nichts anderes offenbart hätten, als diese geheimnisvolle Spirale zum Lichte in der allmächtigen Nacht, so wäre dies doch genug, und wir hätten die Zeit nicht zu bedauern, die wir dem Studium ihrer kleinen Gebärden und bescheidenen Gewohnheiten gewidmet haben, die unsern grossen Leidenschaften und stolzen Geschicken so fern und doch so nahe stehen.
Die Entwickelung der Apinen, oder doch wenigstens der Apiten, sei einmal zugegeben, da sie wahrscheinlicher ist als die Starrheit. Welches ist dann aber ihre beständige und allgemeine Richtung? Sie scheint dieselbe Kurve zu beschreiben, wie die unsrige. Sie hat ersichtlich die Tendenz, Kraft zu sparen, die Unsicherheit, das Elend zu mindern, den Wohlstand, die günstigen Verhältnisse und die Autorität der
Art zu mehren. Diesem Ziele opfert sie ohne Zaudern das Individuum, dessen überdies illusorische und unglückliche Unabhängigkeit im Zustande der Einsamkeit durch die Kraft und das Glück der Gesamtheit wieder ausgeglichen wird. Man möchte sagen, die Natur denkt wie Perikles bei Thukydides, dass die Individuen im Schosse einer Stadt, die als Ganzes gedeiht, glücklicher sind, selbst wenn sie darunter zu leiden haben, als wenn das Individuum gedeiht und der Staat zu Grunde geht. Sie begünstigt die arbeitsame Sklaverei in der mächtigen Stadt und überlässt den pflichtenlosen Wanderer den namen- und gestaltlosen Feinden, die in allen Winkeln von Raum und Zeit, in allen Bewegungen des Weltalls lauern. Es ist hier nicht der Ort, diesen Gedanken der Natur zu erörtern, noch sich zu fragen, ob der Mensch gut thue, ihm zu folgen, aber das steht fest, dass überall da, wo die unendliche Materie uns den Ansatz zu einem Gedanken zu zeigen scheint, dieser Ansatz denselben Weg der Entwickelung nimmt, dessen Ziel man nicht kennt. Was uns betrifft, so genügt es uns zu sehen, mit welcher Fürsorge die Natur es sich angelegen sein lässt, in der sich entwickelnden Rasse alles das zu erhalten und festzulegen, was der feindlichen Trägheit der Materie einmal abgerungen ist. Sie bucht jedes erfolgreiche Bemühen und zieht gegen den Rückfall, der nach dem Vorstoss unvermeidlich sein würde, eine Schranke von besonderen, wohlwollenden Gesetzen. Dieser Fortschritt, der sich bei den intelligenteren Arten kaum ableugnen lässt, hat vielleicht keinen anderen Zweck, als den der Bewegung,
und er weiss nicht, wohin er strebt. Auf alle Fälle ist es in einer Welt, in der nichts, ausser einigen Thatsachen dieser Art, auf einen bestimmten Willen schliessen lässt, recht bezeichnend zu sehen, wie sich gewisse Wesen von dem Tage an, wo wir die Augen aufthaten, derart von Stufe zu Stufe ununterbrochen erheben; und wenn die Bienen uns nichts anderes offenbart hätten, als diese geheimnisvolle Spirale zum Lichte in der allmächtigen Nacht, so wäre dies doch genug, und wir hätten die Zeit nicht zu bedauern, die wir dem Studium ihrer kleinen Gebärden und bescheidenen Gewohnheiten gewidmet haben, die unsern grossen Leidenschaften und stolzen Geschicken so fern und doch so nahe stehen.
 Vielleicht ist das alles eitel und unsere Spirale zum Licht, wie die der Bienen, ist nur dazu da, um die Finsternis zu belustigen. Vielleicht aber auch giebt ein ungeheurer Zufall, der von aussen kommt, von einer anderen Welt, oder von einer neuen Erscheinung, diesem Streben einen endgültigen Sinn oder den endgültigen Tod. Inzwischen wollen wir unsern Weg weiter gehen, als ob nichts Ungewöhnliches geschehen sollte. Wüssten wir, dass morgen eine Offenbarung – etwa in Form einer Verbindung mit einem älteren und lichtvolleren Planeten – unsere Natur über den Haufen werfen und die Leidenschaften, Gesetze und Grundwahrheiten unseres Wesens aufheben kann, so wäre es das Klügste, unser Heute ganz diesen Leidenschaften, Gesetzen und Wahrheiten zu widmen, sie in unserem
Geiste in Verbindung zu setzen und unserem Schicksal treu zu bleiben, welches darin besteht, die dunklen Gewalten des Lebens in uns und um uns zu unterjochen und um einige Stufen zu erheben. Es ist möglich, dass nach der neuen Offenbarung nichts davon bestehen bleibt, aber gewiss werden
die Seelen, die diesen Beruf, welcher der wahrhaft menschliche Beruf ist, bis zu Ende erfüllt haben, im Vordertreffen stehen, wenn es gilt, diese Offenbarung zu empfangen, und selbst wenn sie von ihr nur das lernten, dass die einzige wahre Pflicht das Gegenteil von Wissbegier und der Verzicht auf das Unerkennbare ist, so werden sie besser als die anderen im stande sein, diesen Mangel an Wissbegier und diese endgültige Entsagung zu begreifen und ihren Vorteil daraus zu ziehen.
Vielleicht ist das alles eitel und unsere Spirale zum Licht, wie die der Bienen, ist nur dazu da, um die Finsternis zu belustigen. Vielleicht aber auch giebt ein ungeheurer Zufall, der von aussen kommt, von einer anderen Welt, oder von einer neuen Erscheinung, diesem Streben einen endgültigen Sinn oder den endgültigen Tod. Inzwischen wollen wir unsern Weg weiter gehen, als ob nichts Ungewöhnliches geschehen sollte. Wüssten wir, dass morgen eine Offenbarung – etwa in Form einer Verbindung mit einem älteren und lichtvolleren Planeten – unsere Natur über den Haufen werfen und die Leidenschaften, Gesetze und Grundwahrheiten unseres Wesens aufheben kann, so wäre es das Klügste, unser Heute ganz diesen Leidenschaften, Gesetzen und Wahrheiten zu widmen, sie in unserem
Geiste in Verbindung zu setzen und unserem Schicksal treu zu bleiben, welches darin besteht, die dunklen Gewalten des Lebens in uns und um uns zu unterjochen und um einige Stufen zu erheben. Es ist möglich, dass nach der neuen Offenbarung nichts davon bestehen bleibt, aber gewiss werden
die Seelen, die diesen Beruf, welcher der wahrhaft menschliche Beruf ist, bis zu Ende erfüllt haben, im Vordertreffen stehen, wenn es gilt, diese Offenbarung zu empfangen, und selbst wenn sie von ihr nur das lernten, dass die einzige wahre Pflicht das Gegenteil von Wissbegier und der Verzicht auf das Unerkennbare ist, so werden sie besser als die anderen im stande sein, diesen Mangel an Wissbegier und diese endgültige Entsagung zu begreifen und ihren Vorteil daraus zu ziehen.
 Darum sollten unsere Phantasien sich auch garnicht in dieser Richtung bewegen. Die Möglichkeit einer allgemeinen Vernichtung sollte unsere Thätigkeit ebensowenig beeinflussen, wie das wunderbare Eingreifen eines Zufalls. Wir sind bisher, trotz der Verheissungen unserer Einbildungskraft, stets auf uns selbst und auf unsere eigenen Hilfsquellen angewiesen geblieben. Alles Nützliche und Dauerhafte, was auf Erden besteht, ist das Werk unseres bescheidenen Strebens. Es steht uns frei, von einem fremden Zufall das Beste oder das Schlimmste zu erwarten, aber nur unter der Bedingung, dass diese Erwartung sich nicht in die Erfüllung unserer menschlichen Aufgabe einmischt. Auch darin geben uns die
Bienen eine Lehre, die wie jede Lehre der Natur vortrefflich ist. Sie haben wirklich solch einen wunderbaren Eingriff erfahren. Sie sind mehr als wir in den Händen eines Willens, der ihre Gattung vernichten oder verändern und ihren Geschicken einen anderen Lauf geben kann. Und doch bleiben sie ihrer ursprünglichen, tiefen Aufgabe unbeirrt treu. Und gerade die unter ihnen, die diese Pflicht am treusten erfüllen, sind auch am besten im stande, aus dem übernatürlichen Eingriff, der heute das Los ihrer Gattung erhebt, ihren Vorteil zu ziehen. Nun aber ist die unfehlbare Pflicht eines Wesens leichter zu entdecken, als man glaubt. Man kann sie jederzeit in den Organen lesen, durch die es sich vor andern auszeichnet und denen alle anderen untergeordnet sind. Und ebenso wie es auf der Zunge, dem Munde und Magen der Bienen geschrieben steht, dass sie Honig hervorbringen müssen, ebenso steht es in unseren Augen, unseren Ohren, unserem Mark und allen Fibern unseres Kopfes, im ganzen Nervensystem unseres Körpers geschrieben, dass wir dazu geschaffen sind, alles Irdische, was wir in uns aufnehmen, in eine besondere Kraft von einer auf diesem Erdball einzigen Art umzusetzen. Kein uns bekanntes Wesen ist so wie wir befähigt, jenes seltsame Fluidum hervorzubringen, das wir Denken, Verstand, Intelligenz, Vernunft, Seele, Geist, Zerebralvermögen, Tugend, Güte, Gerechtigkeit, Wissen nennen, denn es besitzt tausend Namen, obwohl es immer dasselbe ist. Alles in uns ist ihm geopfert worden. Unsere Muskeln, unsere Gesundheit, die Beweglichkeit unserer Gliedmassen,
das Gleichgewicht unserer animalischen Funktionen, die Ruhe unseres Lebens – alle tragen mehr und mehr die Last seines Übergewichtes. Es ist der kostbarste und schwierigste Zustand, zu dem man die Materie erheben kann. Feuer, Licht, Wärme, das Leben selbst, der Instinkt, der feiner ist, als das Leben, und die Mehrzahl der unfasslichen Kräfte, welche die Welt vor unserem Erscheinen krönten, sie sind vor dem neuen Fluidum verblasst. Wir wissen nicht, wohin es uns führen, was es aus uns machen wird, noch wir aus ihm. Von ihm werden wir es zu erfahren haben, sobald es in unumschränkter Machtfülle regiert. Inzwischen wollen wir nur darauf bedacht sein, wie wir ihm alles geben und opfern können, was es verlangt, alles, was seiner vollen Entwickelung frommt. Es ist kein Zweifel, dass hier die erste und grösste unserer augenblicklichen Pflichten liegt. Die anderen werden wir von ihm erfahren, je mehr es wächst. Es wird sie nähren und erweitern, je nachdem es selbst genährt wird, wie das Wasser der Höhen die Bäche der Ebenen speist und erweitert, wenn es seine wunderbare Nahrung von den Gipfeln empfangen hat. Zerbrechen wir uns den Kopf nicht, wer von dieser Kraft, die sich derart auf unsere Kosten anhäuft, einst Nutzen haben wird. Die Bienen wissen auch nicht, ob sie den Honig essen werden, den sie aufspeichern. Und ebenso wissen wir nicht, wem die Geisteskraft, die wir in die Welt einführen, einst frommen wird. Wie sie von Blume zu Blume fliegen, um mehr Honig zu ernten, als sie und ihre Kinder bedürfen, so wollen auch
wir von Realität zu Realität schreiten und alles sammeln, was dieser unbegreiflichen Flamme zur Nahrung dienen kann, damit wir im Gefühl der Erfüllung unserer organischen Pflicht auf alles, was da kommen mag, vorbereitet sind. Nähren wir sie mit unseren Gefühlen und Leidenschaften, mit allem, was man sehen, fühlen, hören, fassen kann, und mit ihrem eigenen Wesen, welches der Gedanke ist, den sie aus allen Entdeckungen, Erfahrungen und Beobachtungen zieht und aus allem einträgt, was sie aufsucht. Dann wird ein Augenblick kommen, wo sich für einen Geist, welcher der wahrhaft menschlichen Pflicht mit bestem Willen gedient hat, alles so natürlich zum Besten wendet, dass selbst die Befürchtung, all sein Streben und Trachten könnte umsonst sein, die Glut seines Forschens noch heller, reiner, selbstloser, unabhängiger und edler entfacht.
Darum sollten unsere Phantasien sich auch garnicht in dieser Richtung bewegen. Die Möglichkeit einer allgemeinen Vernichtung sollte unsere Thätigkeit ebensowenig beeinflussen, wie das wunderbare Eingreifen eines Zufalls. Wir sind bisher, trotz der Verheissungen unserer Einbildungskraft, stets auf uns selbst und auf unsere eigenen Hilfsquellen angewiesen geblieben. Alles Nützliche und Dauerhafte, was auf Erden besteht, ist das Werk unseres bescheidenen Strebens. Es steht uns frei, von einem fremden Zufall das Beste oder das Schlimmste zu erwarten, aber nur unter der Bedingung, dass diese Erwartung sich nicht in die Erfüllung unserer menschlichen Aufgabe einmischt. Auch darin geben uns die
Bienen eine Lehre, die wie jede Lehre der Natur vortrefflich ist. Sie haben wirklich solch einen wunderbaren Eingriff erfahren. Sie sind mehr als wir in den Händen eines Willens, der ihre Gattung vernichten oder verändern und ihren Geschicken einen anderen Lauf geben kann. Und doch bleiben sie ihrer ursprünglichen, tiefen Aufgabe unbeirrt treu. Und gerade die unter ihnen, die diese Pflicht am treusten erfüllen, sind auch am besten im stande, aus dem übernatürlichen Eingriff, der heute das Los ihrer Gattung erhebt, ihren Vorteil zu ziehen. Nun aber ist die unfehlbare Pflicht eines Wesens leichter zu entdecken, als man glaubt. Man kann sie jederzeit in den Organen lesen, durch die es sich vor andern auszeichnet und denen alle anderen untergeordnet sind. Und ebenso wie es auf der Zunge, dem Munde und Magen der Bienen geschrieben steht, dass sie Honig hervorbringen müssen, ebenso steht es in unseren Augen, unseren Ohren, unserem Mark und allen Fibern unseres Kopfes, im ganzen Nervensystem unseres Körpers geschrieben, dass wir dazu geschaffen sind, alles Irdische, was wir in uns aufnehmen, in eine besondere Kraft von einer auf diesem Erdball einzigen Art umzusetzen. Kein uns bekanntes Wesen ist so wie wir befähigt, jenes seltsame Fluidum hervorzubringen, das wir Denken, Verstand, Intelligenz, Vernunft, Seele, Geist, Zerebralvermögen, Tugend, Güte, Gerechtigkeit, Wissen nennen, denn es besitzt tausend Namen, obwohl es immer dasselbe ist. Alles in uns ist ihm geopfert worden. Unsere Muskeln, unsere Gesundheit, die Beweglichkeit unserer Gliedmassen,
das Gleichgewicht unserer animalischen Funktionen, die Ruhe unseres Lebens – alle tragen mehr und mehr die Last seines Übergewichtes. Es ist der kostbarste und schwierigste Zustand, zu dem man die Materie erheben kann. Feuer, Licht, Wärme, das Leben selbst, der Instinkt, der feiner ist, als das Leben, und die Mehrzahl der unfasslichen Kräfte, welche die Welt vor unserem Erscheinen krönten, sie sind vor dem neuen Fluidum verblasst. Wir wissen nicht, wohin es uns führen, was es aus uns machen wird, noch wir aus ihm. Von ihm werden wir es zu erfahren haben, sobald es in unumschränkter Machtfülle regiert. Inzwischen wollen wir nur darauf bedacht sein, wie wir ihm alles geben und opfern können, was es verlangt, alles, was seiner vollen Entwickelung frommt. Es ist kein Zweifel, dass hier die erste und grösste unserer augenblicklichen Pflichten liegt. Die anderen werden wir von ihm erfahren, je mehr es wächst. Es wird sie nähren und erweitern, je nachdem es selbst genährt wird, wie das Wasser der Höhen die Bäche der Ebenen speist und erweitert, wenn es seine wunderbare Nahrung von den Gipfeln empfangen hat. Zerbrechen wir uns den Kopf nicht, wer von dieser Kraft, die sich derart auf unsere Kosten anhäuft, einst Nutzen haben wird. Die Bienen wissen auch nicht, ob sie den Honig essen werden, den sie aufspeichern. Und ebenso wissen wir nicht, wem die Geisteskraft, die wir in die Welt einführen, einst frommen wird. Wie sie von Blume zu Blume fliegen, um mehr Honig zu ernten, als sie und ihre Kinder bedürfen, so wollen auch
wir von Realität zu Realität schreiten und alles sammeln, was dieser unbegreiflichen Flamme zur Nahrung dienen kann, damit wir im Gefühl der Erfüllung unserer organischen Pflicht auf alles, was da kommen mag, vorbereitet sind. Nähren wir sie mit unseren Gefühlen und Leidenschaften, mit allem, was man sehen, fühlen, hören, fassen kann, und mit ihrem eigenen Wesen, welches der Gedanke ist, den sie aus allen Entdeckungen, Erfahrungen und Beobachtungen zieht und aus allem einträgt, was sie aufsucht. Dann wird ein Augenblick kommen, wo sich für einen Geist, welcher der wahrhaft menschlichen Pflicht mit bestem Willen gedient hat, alles so natürlich zum Besten wendet, dass selbst die Befürchtung, all sein Streben und Trachten könnte umsonst sein, die Glut seines Forschens noch heller, reiner, selbstloser, unabhängiger und edler entfacht.
Ende

Anmerkungen als Fußnoten eingearbeitet. joe_ebc, Projekt Gutenberg-DE