
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
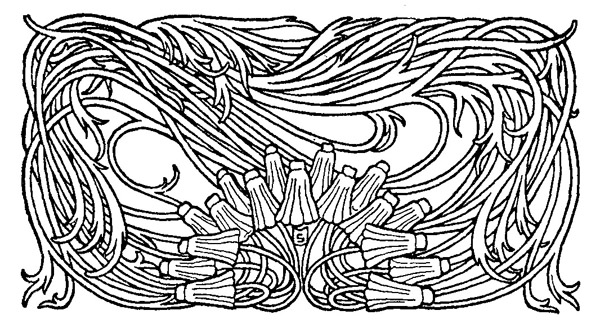
Die Bienen des von uns erwählten Bienenstocks haben also die Starre des Winterschlafes abgeschüttelt. Die Königin beginnt von Anfang Februar an wieder Eier zu legen. Die Arbeitsbienen befliegen die Anemonen, Narzissen, Veilchen, Salweiden und Haselnussträucher. Der Frühling hält seinen Einzug, die Speicher und Keller strotzen wieder von Honig und Blütenstaub, und tausende von Bienen erblicken täglich das Licht der Welt. Die ungeschlachten Drohnen kriechen aus ihren grossen Zellen, laufen auf den Waben herum, und der Bevölkerungszuwachs der Stadt wird bald so gross, dass hunderte von Arbeitsbienen, wenn sie abends vom Felde heimkehren, kein Unterkommen mehr finden und genötigt sind, die Nacht auf der Schwelle zu verbringen, wo viele vor Kälte sterben.
Eine allgemeine Unruhe ergreift das Volk, und die alte Königin gerät in Aufregung. Sie ahnt, dass sich ein neues Schicksal vorbereitet. Sie hat ihre Pflicht als Mutter gewissenhaft gethan, und nun führt ihre Pflichterfüllung zu Verwirrung und Trübsal. Eine unabweisliche Notwendigkeit bedroht ihre Ruhe: bald wird sie die Stadt ihrer Herrschaft verlassen müssen. Und doch ist diese Stadt ihr Werk, ihr eigenstes Ich. Sie ist keine Königin im menschlichen Sinne. Sie giebt keine Befehle; sie ist, wie die letzte ihrer Unterthanen, einer verhüllten Gewalt von überlegener Weisheit unterworfen, die wir einstweilen, bis wir sie zu entschleiern versuchen, den » Geist des Bienenstockes« nennen wollen. Sie ist die alleinige Mutter und das Werkzeug der Liebe. Sie hat die Stadt in Unsicherheit und Armut gegründet. Sie hat sie unaufhörlich mit ihrem eignen Fleisch und Blut bevölkert, und alles, was darinnen lebt, – Arbeitsbienen, Drohnen, Larven, Nymphen und die jungen Prinzessinnen, deren baldiges Ausschlüpfen ihren Aufbruch beschleunigen wird und deren eine ihr vom »Geiste des Bienenstockes« schon zur Nachfolgerin bestimmt ist, – ist aus ihren Weichen hervorgegangen.
 Wo befindet sich dieser »Geist des Bienenstockes« und wo hat er seinen Sitz? Er ist nicht wie der individuelle Instinkt des Vogels, der sein Nest mit Geschicklichkeit baut und andere Himmelsstriche aufzusuchen weiss, wenn der Tag des Wanderns wieder angebrochen ist. Er ist ebensowenig eine mechanische
Gewohnheit der Gattung, die nur vom blinden Lebenswillen beseelt ist und sich an allen Ecken des Zufalls stösst, sobald ein unvorhergesehener Umstand die Abfolge der gewohnten Erscheinungen durchbricht. Im Gegenteil, er folgt Schritt für Schritt den allmächtigen Umständen, wie ein kluger und geschickter Sklave, der auch die gefährlichsten Befehle seines Herrn sich zum Vorteil zu wenden weiss.
Wo befindet sich dieser »Geist des Bienenstockes« und wo hat er seinen Sitz? Er ist nicht wie der individuelle Instinkt des Vogels, der sein Nest mit Geschicklichkeit baut und andere Himmelsstriche aufzusuchen weiss, wenn der Tag des Wanderns wieder angebrochen ist. Er ist ebensowenig eine mechanische
Gewohnheit der Gattung, die nur vom blinden Lebenswillen beseelt ist und sich an allen Ecken des Zufalls stösst, sobald ein unvorhergesehener Umstand die Abfolge der gewohnten Erscheinungen durchbricht. Im Gegenteil, er folgt Schritt für Schritt den allmächtigen Umständen, wie ein kluger und geschickter Sklave, der auch die gefährlichsten Befehle seines Herrn sich zum Vorteil zu wenden weiss.
Er verfügt ohne Rücksicht, aber gewissenhaft, als wäre ihm eine grosse Pflicht auferlegt, über Wohlstand und Glück, Leben und Freiheit dieses geflügelten Völkchens. Er bestimmt Tag für Tag die Zahl der Geburten und zwar genau nach der Blumenzahl, die auf den Fluren blüht. Er sagt der Königin, dass sie verbraucht ist oder dass sie ausschwärmen muss, er zwingt sie, ihren Nebenbuhlerinnen das Leben zu geben, erhebt diese zu Königinnen, schirmt sie vor dem politischen Hass ihrer Mutter und veranlasst oder verhindert, – je nach der Fülle des Blumensegens, dem früheren oder späteren Eintreten des Frühjahrs und den beim Hochzeitsflug zu befürchtenden Gefahren, – dass die erstgeborene unter den jungfräulichen Prinzessinnen ihre jüngeren Schwestern in der Wiege tötet. Oder auch bei vorgerückter Jahreszeit, wenn die Blumenstunden kürzer werden, gebietet er den Arbeitsbienen, die ganze königliche Brut zu vernichten, damit die Ära der Umwälzungen ein Ende hat und die fruchtbringende Arbeit wieder aufgenommen wird. Er ist ein Geist der Vorsicht und Sparsamkeit, aber nicht des Geizes. Er weiss anscheinend um die verhängnisvollen und etwas vernunftwidrigen Naturgesetze der Liebe, und duldet darum in den reichen Sommertagen, in denen die junge Königin ihren Liebhaber suchen geht, das Vorhandensein von drei- oder vierhundert thörichten, ungeschickten, bei aller Geschäftigkeit nur hinderlichen, anspruchvollen, schamlos müssigen, lärmenden, gefrässigen, groben, unsauberen, unersättlichen und ungeschlachten Drohnen. Aber sobald die Königin befruchtet ist, die Blumen ihre Kelche später öffnen und früher schliessen, ordnet er eines Tages gelassen an, dass sie alle miteinander ermordet werden. Er regelt die Arbeit jeder Biene nach ihrem Alter, er bestimmt die einen zur Pflege der Brut, die anderen zur königlichen Leibwache, welche die Königin zu unterhalten hat und sie nie aus den Augen verlieren darf, wieder andere zum Ventilieren: sie lüften mit ihren Flügeln den Stock, führen ihm Wärme oder Kälte zu und beschleunigen die Verdunstung des dem Honig zuviel zugesetzten Wassers; wieder andre verwertet er als Architekten, Maurer und Steinmetzen; sie hängen sich in Ketten auf, um Wachs zu bereiten, und bauen die Waben, während ein anderer Schwärm ausfliegt und einträgt: Nektar, der zu Honig verarbeitet wird, Blütenstaub zum Futterbrei für die Brut, und Stopfwachs (Propolis) zum Verkleben und Befestigen der Bauten. Er weist den Chemikern im Bienenstaate ihre Aufgabe an: den Honig haltbar zu machen, indem sie einen Tropfen Ameisensäure in die gefüllten Zellen thun, den Arbeiterinnen, welche diese Zellen verdeckeln, den Strassenkehrerinnen, die Strassen und Plätze in musterhafter Ordnung halten, den Totengräberinnen, welche die Leichen fortschaffen, und den Amazonen der Schildwache, die Tag und Nacht für Sicherheit des Eingangs sorgen, die Kommenden und Gehenden befragen, sich die jungen Bienen beim ersten Ausfluge merken, die Landstreicher, Bettler und Räuber fortjagen, Eindringlinge austreiben, gefürchtete Feinde in Masse angreifen und nötigenfalls das Flugloch verbarrikadieren.
Endlich bestimmt er die Stunde, wo dem Genius der Art das grosse Jahresopfer gebracht wird, ich meine das Schwärmen, wo das ganze Volk, auf dem Gipfel seiner Macht und seines Gedeihens angelangt, der nächsten Generation plötzlich alles überlässt, seine Schätze und Paläste, seine Wohnungen und die Frucht seiner Arbeit, um fern im Ungewissen und Öden eine neue Heimat zu suchen. Es ist dies ein Akt, der – bewusst oder unbewusst – über die menschliche Moral hinausgeht. Bisweilen zerstört er, immer verarmt er, und sicher zerreisst er das glückgesegnete Volk, damit es einem höheren Gesetze gehorche, als das Gedeihen der Stadt ist. Wo entsteht dieses Gesetz, das, wie wir sogleich sehen werden, nicht so fatalistisch und blind ist, wie man wohl glaubt? In welcher Versammlung, welchem Rat, welcher gemeinsamen Sphäre hat er seinen Sitz, dieser Geist, dem sich alle unterwerfen, und der selbst einer heroischen Pflicht, einer stets auf die Zukunft gerichteten Vernunft gehorcht?
Es ist bei unsren Bienen wie bei der Mehrzahl aller irdischen Dinge: wir beobachten einige ihrer Gewohnheiten, wir sagen, sie thun dies und jenes, sie arbeiten so und so, ihre Königinnen sorgen für Nachkommenschaft, ihre Arbeiterinnen bleiben Jungfrauen, und dann und dann schwärmen sie. Damit glauben wir sie zu kennen und fragen nicht weiter. Wir sehen sie von Blume zu Blume hasten, wir beobachten das bebende Kommen und Gehen im Stock, und dieses Leben scheint uns höchst einfach und beschränkt, wie jedes Leben, das instinktiv nach Selbsterhaltung und Vermehrung trachtet. Aber sobald das Auge tiefer eindringt und sich Rechenschaft ablegen will, erkennt es die erstaunliche Kompliziertheit der einfachsten Erscheinungen, das Wunder des Verstandes und des Willens, der Bestimmungen und Ziele, der Ursachen und Wirkungen, die unbegreifliche Organisation der geringsten Lebensakte.
 In unserem Bienenstock bereitet sich also das grosse Opfer vor, das den anspruchsvollen Volksgöttern gebracht wird. Den Geboten dieses »Geistes« gehorsam, der uns ziemlich unerklärlich erscheint, vorausgesetzt, dass er allen Instinkten und Gefühlen unsrer Art zuwiderläuft, – sind sechzig bis siebzigtausend von den achtzig bis hunderttausend Bienen des Gesamtvolkes im Begriff, die Mutterstadt zur gegebenen Stunde zu verlassen. Es ist kein Augenblick der Angst, in dem sie davonziehen, kein plötzlicher toller Entschluss, das durch Hunger, Krieg oder Seuchen verheerte Heimatland zu fliehen. Ihre Selbstverbannung ist seit lange vorbedacht und die günstigste Stunde wird geduldig abgewartet.
Ist der Stock arm und durch Unglück im Königshause, schlechtes Wetter oder Plünderung geschwächt worden, so wird nicht geschwärmt. Sie verlassen ihre Stadt nur auf dem Gipfel ihres Wohlstands, wenn der mächtige Wachsbau nach harter Frühjahrsarbeit in seinen 120 000 schnurgerade gebauten Zellen prangt und von frischem Honig strotzt, oder von jenem bunten Mehl, das zur Auffütterung der Brut dient und Bienenbrot genannt wird.
In unserem Bienenstock bereitet sich also das grosse Opfer vor, das den anspruchsvollen Volksgöttern gebracht wird. Den Geboten dieses »Geistes« gehorsam, der uns ziemlich unerklärlich erscheint, vorausgesetzt, dass er allen Instinkten und Gefühlen unsrer Art zuwiderläuft, – sind sechzig bis siebzigtausend von den achtzig bis hunderttausend Bienen des Gesamtvolkes im Begriff, die Mutterstadt zur gegebenen Stunde zu verlassen. Es ist kein Augenblick der Angst, in dem sie davonziehen, kein plötzlicher toller Entschluss, das durch Hunger, Krieg oder Seuchen verheerte Heimatland zu fliehen. Ihre Selbstverbannung ist seit lange vorbedacht und die günstigste Stunde wird geduldig abgewartet.
Ist der Stock arm und durch Unglück im Königshause, schlechtes Wetter oder Plünderung geschwächt worden, so wird nicht geschwärmt. Sie verlassen ihre Stadt nur auf dem Gipfel ihres Wohlstands, wenn der mächtige Wachsbau nach harter Frühjahrsarbeit in seinen 120 000 schnurgerade gebauten Zellen prangt und von frischem Honig strotzt, oder von jenem bunten Mehl, das zur Auffütterung der Brut dient und Bienenbrot genannt wird.
Nie sieht der Stock schmucker aus, als am Tage vor der heroischen Entsagung. Es ist für ihn die Stunde ohne Gleichen, die lebensvolle, etwas fieberhafte und doch so heitere Stunde des Überflusses und der Ausgelassenheit. Suchen wir ihn uns vorzustellen, nicht wie ihn die Bienen sehen, denn wir ahnen nicht, welche magische und furchtbare Gestalt die Dinge in den sechs- bis siebentausend Facettenaugen annehmen, die sie an der Seite haben, oder in dem dreifachen Cyclopenauge auf ihrer Stirn, sondern so, wie wir ihn sehen würden, wenn wir ihre Grösse hätten. Oben von der Wölbung, die noch ungeheurer ist, als die des St. Peter in Rom, bis auf den Fussboden herab gehen zahlreiche senkrechte, parallele Riesenmauern, die im Finstern und im Leeren hängen und die man – im Verhältnis gesprochen – wegen ihrer kühnen Bauart, ihrer Genauigkeit und Riesenhaftigkeit mit keinem menschlichen Bauwerk vergleichen kann. Jede dieser Mauern, deren Baustoff noch jungfräulich frisch, silbern, unbefleckt und duftend ist, besteht aus tausenden von Zellen und enthält Vorräte, von denen das ganze Volk wochenlang leben könnte. Hier und dort leuchten rote, gelbe, schwarze und veilchenfarbene Flecken; es ist Pollen, der befruchtende Blumenstaub der gesamten Frühlingsflora, in durchsichtigen Zellen bewahrt, und ringsherum in schweren, üppigen Goldgewinden mit starren, unbeweglichen Falten der Aprilhonig, der reinste und duftreichste, in zwanzigtausend schon verdeckelten Behältern, die nur in den Tagen der höchsten Not erbrochen werden. Weiter unten reift der Maihonig noch in seinen weit geöffneten Behältern, an deren Rand eine wachsame Schar für ununterbrochenen Luftwechsel sorgt. In der Mitte, fernab vom Lichte, dessen Diamantstrahlen durch die einzige Öffnung dringen, schlummert im wärmsten Teile des Bienenstockes die Zukunft oder beginnt zu erwachen. Es ist dies der Bezirk des Brutraums, in dem die Königin und ihre Mägde hausen, etwa zehntausend Zellen, in denen die Eier ruhen, fünfzehn- oder sechzehntausend, die von den Larven bewohnt sind, und vierzigtausend, in denen die wachsbleichen Nymphen von tausenden von Pflegerinnen gewartet werden. (Diese Zahlen entsprechen genau einem stark bevölkerten Stock zur Zeit der Volltracht.) Endlich im Allerheiligsten des Kinderhimmels drei bis zwölf geschlossene, verhältnismässig sehr grosse Weiselzellen, in denen die jungen Prinzessinnen, in eine Art von Leichentuch gehüllt, unbeweglich und bleich ihre Stunde erharren und im Finstern genährt werden.

 Dieser noch gestaltenlosen Jugend räumt also zu einer gegebenen, vom »Geiste des Bienenstocks« genau bestimmten Stunde ein Teil des Volkes das Feld, und auch er ist nach unerschütterlichen, untrüglichen Gesetzen hierzu erlesen. In der schlafenden Stadt zurück bleiben die Drohnen, aus deren Reihen der königliche Buhle hervorgehen wird, die noch ganz jungen Bienen, die die Brut füttern, und einige tausend Arbeitsbienen, die nach wie vor eintragen, den aufgehäuften Schatz beschirmen und die moralischen Traditionen des Bienenstockes aufrecht erhalten. Denn jeder Bienenstock hat seine besondere Moral. Man findet sehr tugendhafte und sehr verdorbene, und der unvorsichtige Imker kann ein Volk verderben, es die Achtung vor fremdem Besitz verlieren lassen, zum Plündern verleiten, ihm Eroberungsgelüste und Neigung zum Müssiggang beibringen, wodurch es zum Schrecken aller schwachen Völker der Umgegend wird. Er braucht die Bienen nur merken zu lassen, dass die Feldarbeit in den Blumen, von denen hunderte beflogen werden müssen, um einen Tropfen Honig zu liefern, weder das einzige, noch das bequemste Mittel zum Reichwerden ist, sondern dass es viel leichter ist, durch List in schlecht bewachte Städte oder durch Gewalt in solche einzudringen, deren Bevölkerung zu schwach ist, um sich zu wehren. Sie verlieren bald den Sinn für die glänzende, aber unbarmherzige Pflicht, die sie zu geflügelten Knechten der Blumen im hochzeitlichen Reigen der Natur
macht, und es ist zuweilen garnicht leicht, ein so zuchtlos gewordenes Volk wieder auf den Weg der Pflicht zu bringen.
Dieser noch gestaltenlosen Jugend räumt also zu einer gegebenen, vom »Geiste des Bienenstocks« genau bestimmten Stunde ein Teil des Volkes das Feld, und auch er ist nach unerschütterlichen, untrüglichen Gesetzen hierzu erlesen. In der schlafenden Stadt zurück bleiben die Drohnen, aus deren Reihen der königliche Buhle hervorgehen wird, die noch ganz jungen Bienen, die die Brut füttern, und einige tausend Arbeitsbienen, die nach wie vor eintragen, den aufgehäuften Schatz beschirmen und die moralischen Traditionen des Bienenstockes aufrecht erhalten. Denn jeder Bienenstock hat seine besondere Moral. Man findet sehr tugendhafte und sehr verdorbene, und der unvorsichtige Imker kann ein Volk verderben, es die Achtung vor fremdem Besitz verlieren lassen, zum Plündern verleiten, ihm Eroberungsgelüste und Neigung zum Müssiggang beibringen, wodurch es zum Schrecken aller schwachen Völker der Umgegend wird. Er braucht die Bienen nur merken zu lassen, dass die Feldarbeit in den Blumen, von denen hunderte beflogen werden müssen, um einen Tropfen Honig zu liefern, weder das einzige, noch das bequemste Mittel zum Reichwerden ist, sondern dass es viel leichter ist, durch List in schlecht bewachte Städte oder durch Gewalt in solche einzudringen, deren Bevölkerung zu schwach ist, um sich zu wehren. Sie verlieren bald den Sinn für die glänzende, aber unbarmherzige Pflicht, die sie zu geflügelten Knechten der Blumen im hochzeitlichen Reigen der Natur
macht, und es ist zuweilen garnicht leicht, ein so zuchtlos gewordenes Volk wieder auf den Weg der Pflicht zu bringen.
 Alles das beweist, dass das Schwärmen nicht von der Königin, sondern vom »Geiste des Bienenstocks« ausgeht. Es ist mit der Königin, wie mit den Führern der Menschen: sie scheinen zu befehlen, und gehorchen doch selbst nur Geboten, die gebieterischer und unerklärlicher sind, als die, welche sie ihren Untergebenen erteilen. Wann dieser »Geist« den Augenblick für gekommen hält, muss er wohl schon bei Morgengrauen, ja vielleicht schon am Tage vorher oder zwei Tage vorher bekannt geben, denn kaum hat die Sonne die ersten Tautropfen aufgetrunken, so nimmt man rings um den Bienenstand eine ungewöhnliche Unruhe wahr, über deren Wesen sich der Bienenwirt selten täuscht. Manchmal soll selbst Uneinigkeit, Zaudern und Zurückweichen eintreten. Es kommt sogar vor, dass sich der goldig schimmernde, durchsichtige Schwarm mehrere Tage hintereinander bildet und ohne ersichtlichen Grund wieder verschwindet. Entsteht in diesem Augenblick am Himmel, den die Bienen sehen, eine Wolke, die wir nicht wahrnehmen, oder ein Heimweh in ihrem Geiste? Wird die Notwendigkeit des Aufbruches in einer geflügelten Ratsversammlung erörtert? Wir wissen davon ebensowenig, wie wir wissen, auf welche Weise der Geist des Bienenstocks seine Entschliessungen bekannt giebt. Wenn es auch feststeht, dass die
Bienen sich Mitteilungen machen, so wissen wir doch keineswegs, ob sie dies nach Art der Menschen thun. Dieses honigduftende Summen, dieses trunkene Schwirren an schönen Sommertagen, welches eine der holdesten Freuden für den Bienenvater ist, dieser Hochgesang der Arbeit, der im Krystall der Luft rings um den Bienenstand bald steigt, bald fällt und gleichsam das fröhliche Flüstern des Blumenflors, das Preislied seines Glückes, der Widerhall seiner süssen Düfte ist, – sie hören ihn vielleicht nicht einmal. Trotzdem besitzen sie eine ganze Skala von Tönen, die wir selbst unterscheiden können und die von tiefer Seligkeit bis zu Drohung, Zorn und Trübsal reicht, sie besitzen ein Lied auf die Königin, ein hohes Lied des Überflusses und Klagelieder, und endlich stossen die jungen Prinzessinnen in den Kämpfen und Blutbädern, die dem Hochzeitsausflug vorausgehen, ein langgezogenes, seltsames Kriegsgeschrei aus. Sind das alles nur Laute von ungefähr, die ihr inneres Schweigen nicht berühren? Um die Geräusche, die wir rings um ihre Wohnungen machen, scheinen sie sich allerdings nicht zu kümmern, aber vielleicht sind sie der Meinung, dass diese Geräusche nicht zu ihrer Welt gehören und für sie keine Bedeutung haben. Wahrscheinlich hören wir unsererseits auch nur einen geringen Teil dessen, was sie sagen, und vielleicht verfügen sie über eine Menge von harmonischen Tönen, die nicht für unsre Organe gemacht sind. Jedenfalls werden wir weiterhin sehen, dass sie sich verständigen können und zwar mit einer oft wunderbaren Geschwindigkeit, z. B. wenn der grosse
Honigdieb, der Totenkopf-Schmetterling, in den Stock dringt und dabei von Zeit zu Zeit eine eigentümliche, unwiderstehliche Beschwörungsformel murmelt. Sofort läuft die Kunde von Mund zu Mund und das ganze Volk von den Wachen am Eingang bis zu den letzten Arbeitsbienen, die auf den fernsten Waben arbeiten, gerät in Schrecken.
Alles das beweist, dass das Schwärmen nicht von der Königin, sondern vom »Geiste des Bienenstocks« ausgeht. Es ist mit der Königin, wie mit den Führern der Menschen: sie scheinen zu befehlen, und gehorchen doch selbst nur Geboten, die gebieterischer und unerklärlicher sind, als die, welche sie ihren Untergebenen erteilen. Wann dieser »Geist« den Augenblick für gekommen hält, muss er wohl schon bei Morgengrauen, ja vielleicht schon am Tage vorher oder zwei Tage vorher bekannt geben, denn kaum hat die Sonne die ersten Tautropfen aufgetrunken, so nimmt man rings um den Bienenstand eine ungewöhnliche Unruhe wahr, über deren Wesen sich der Bienenwirt selten täuscht. Manchmal soll selbst Uneinigkeit, Zaudern und Zurückweichen eintreten. Es kommt sogar vor, dass sich der goldig schimmernde, durchsichtige Schwarm mehrere Tage hintereinander bildet und ohne ersichtlichen Grund wieder verschwindet. Entsteht in diesem Augenblick am Himmel, den die Bienen sehen, eine Wolke, die wir nicht wahrnehmen, oder ein Heimweh in ihrem Geiste? Wird die Notwendigkeit des Aufbruches in einer geflügelten Ratsversammlung erörtert? Wir wissen davon ebensowenig, wie wir wissen, auf welche Weise der Geist des Bienenstocks seine Entschliessungen bekannt giebt. Wenn es auch feststeht, dass die
Bienen sich Mitteilungen machen, so wissen wir doch keineswegs, ob sie dies nach Art der Menschen thun. Dieses honigduftende Summen, dieses trunkene Schwirren an schönen Sommertagen, welches eine der holdesten Freuden für den Bienenvater ist, dieser Hochgesang der Arbeit, der im Krystall der Luft rings um den Bienenstand bald steigt, bald fällt und gleichsam das fröhliche Flüstern des Blumenflors, das Preislied seines Glückes, der Widerhall seiner süssen Düfte ist, – sie hören ihn vielleicht nicht einmal. Trotzdem besitzen sie eine ganze Skala von Tönen, die wir selbst unterscheiden können und die von tiefer Seligkeit bis zu Drohung, Zorn und Trübsal reicht, sie besitzen ein Lied auf die Königin, ein hohes Lied des Überflusses und Klagelieder, und endlich stossen die jungen Prinzessinnen in den Kämpfen und Blutbädern, die dem Hochzeitsausflug vorausgehen, ein langgezogenes, seltsames Kriegsgeschrei aus. Sind das alles nur Laute von ungefähr, die ihr inneres Schweigen nicht berühren? Um die Geräusche, die wir rings um ihre Wohnungen machen, scheinen sie sich allerdings nicht zu kümmern, aber vielleicht sind sie der Meinung, dass diese Geräusche nicht zu ihrer Welt gehören und für sie keine Bedeutung haben. Wahrscheinlich hören wir unsererseits auch nur einen geringen Teil dessen, was sie sagen, und vielleicht verfügen sie über eine Menge von harmonischen Tönen, die nicht für unsre Organe gemacht sind. Jedenfalls werden wir weiterhin sehen, dass sie sich verständigen können und zwar mit einer oft wunderbaren Geschwindigkeit, z. B. wenn der grosse
Honigdieb, der Totenkopf-Schmetterling, in den Stock dringt und dabei von Zeit zu Zeit eine eigentümliche, unwiderstehliche Beschwörungsformel murmelt. Sofort läuft die Kunde von Mund zu Mund und das ganze Volk von den Wachen am Eingang bis zu den letzten Arbeitsbienen, die auf den fernsten Waben arbeiten, gerät in Schrecken.
 Man hat lange gemeint, die klugen Honigwespen, die für gewöhnlich so sparsam, nüchtern und weitblickend sind, gehorchten in dem Augenblick, wo sie die Schätze ihrer Wohnung im Stiche lassen, um sich selbst ins Ungewisse hinauszuwagen, einer Art von Wahnsinn und Verhängnis, einem instinktiven Trieb und Gattungsgesetz oder Naturgebot, kurz, jener dunklen Gewalt, der alle in der Zeitlichkeit lebenden Wesen unterworfen sind. Handelt es sich um die Bienen oder um uns selbst, uns scheint alles, was wir noch nicht verstehen, ein Verhängnis. Aber man hat den Bienen heute drei oder vier ihrer materiellen Geheimnisse abgewonnen, und da hat es sich erwiesen, dass dieser Auszug weder instinktiv, noch vom Schicksal verhängt ist. Es ist keine blinde Auswanderung, sondern ein anscheinend bewusstes Opfer, welches das lebende Geschlecht dem zukünftigen bringt. Der Bienenzüchter braucht nur die jungen, unausgeschlüpften Königinnen in ihren Zellen zu töten und, wenn viele Larven und Nymphen vorhanden sind, gleichzeitig Honig- und Brutraum des Volkes zu erweitern –
und alsbald hört das ganze unfruchtbare Treiben auf, die gewöhnliche Arbeit wird wieder aufgenommen, Honig eingetragen, und die alte Königin, die jetzt unentbehrlich geworden ist und keine Nebenbuhlerinnen zu hoffen oder zu fürchten hat, verzichtet in diesem Jahre auf ein Wiedersehen des Sonnenlichtes. Friedlich nimmt sie ihre Mutterpflicht im Finstern wieder auf und legt methodisch, eine Spirale beschreibend, von Zelle zu Zelle, ohne eine einzige auszulassen, ohne je inne zu halten, jeden Tag zwei- bis dreitausend Eier.
Man hat lange gemeint, die klugen Honigwespen, die für gewöhnlich so sparsam, nüchtern und weitblickend sind, gehorchten in dem Augenblick, wo sie die Schätze ihrer Wohnung im Stiche lassen, um sich selbst ins Ungewisse hinauszuwagen, einer Art von Wahnsinn und Verhängnis, einem instinktiven Trieb und Gattungsgesetz oder Naturgebot, kurz, jener dunklen Gewalt, der alle in der Zeitlichkeit lebenden Wesen unterworfen sind. Handelt es sich um die Bienen oder um uns selbst, uns scheint alles, was wir noch nicht verstehen, ein Verhängnis. Aber man hat den Bienen heute drei oder vier ihrer materiellen Geheimnisse abgewonnen, und da hat es sich erwiesen, dass dieser Auszug weder instinktiv, noch vom Schicksal verhängt ist. Es ist keine blinde Auswanderung, sondern ein anscheinend bewusstes Opfer, welches das lebende Geschlecht dem zukünftigen bringt. Der Bienenzüchter braucht nur die jungen, unausgeschlüpften Königinnen in ihren Zellen zu töten und, wenn viele Larven und Nymphen vorhanden sind, gleichzeitig Honig- und Brutraum des Volkes zu erweitern –
und alsbald hört das ganze unfruchtbare Treiben auf, die gewöhnliche Arbeit wird wieder aufgenommen, Honig eingetragen, und die alte Königin, die jetzt unentbehrlich geworden ist und keine Nebenbuhlerinnen zu hoffen oder zu fürchten hat, verzichtet in diesem Jahre auf ein Wiedersehen des Sonnenlichtes. Friedlich nimmt sie ihre Mutterpflicht im Finstern wieder auf und legt methodisch, eine Spirale beschreibend, von Zelle zu Zelle, ohne eine einzige auszulassen, ohne je inne zu halten, jeden Tag zwei- bis dreitausend Eier.
Was wäre in alledem fatalistisch als die Liebe des Volkes von heute zu dem von morgen? Diese Art von Verhängnis findet sich auch in der menschlichen Gattung, wenn auch nicht mit der gleichen Gewalt und Unbedingtheit, denn sie führt bei uns nie zu so grossen, einmütigen und vollständigen Opfern. Welchem weitblickenden Fatum, das jenes andre ersetzt, mögen wir gehorchen? Niemand weiss es, denn keiner kennt das Wesen, das uns so ansieht, wie wir die Bienen.
 Aber der Mensch soll den Gang der Dinge in dem von uns beobachteten Bienenstocke nicht unterbrechen, und die feuchte Wärme eines langsam dahinfliessenden Sommertages, der seine Strahlen schon unter das Blattwerk sendet, beschleunigt die Stunde des Aufbruchs. Überall in den goldbraunen Gängen, die zwischen den senkrechten Riesenmauern laufen, rüsten die Arbeitsbienen sich zur Reise. Jede versieht
sich mit einem Honigvorrat für fünf bis sechs Tage. Aus diesem Honig bereiten sie, durch einen noch nicht recht aufgeklärten chemischen Prozess, das zur Aufführung von neuen Bauten unmittelbar erforderliche Wachs. Ferner versehen sie sich mit einer gewissen Menge von Propolis, einer harzigen Substanz, die dazu bestimmt ist, die Spalten und Ritzen der neuen Wohnung zu verkitten, alles, was locker ist, zu befestigen, alle Wände zu firnissen und alles Licht abzublenden, denn sie arbeiten nur in einer fast völligen Dunkelheit, in der sie sich mit Hülfe ihrer Facettenaugen oder auch ihrer Fühler zurechttasten, denn diese scheinen in der That der Sitz eines unbekannten Sinnes zu sein, welcher die Finsternis fühlt und misst.
Aber der Mensch soll den Gang der Dinge in dem von uns beobachteten Bienenstocke nicht unterbrechen, und die feuchte Wärme eines langsam dahinfliessenden Sommertages, der seine Strahlen schon unter das Blattwerk sendet, beschleunigt die Stunde des Aufbruchs. Überall in den goldbraunen Gängen, die zwischen den senkrechten Riesenmauern laufen, rüsten die Arbeitsbienen sich zur Reise. Jede versieht
sich mit einem Honigvorrat für fünf bis sechs Tage. Aus diesem Honig bereiten sie, durch einen noch nicht recht aufgeklärten chemischen Prozess, das zur Aufführung von neuen Bauten unmittelbar erforderliche Wachs. Ferner versehen sie sich mit einer gewissen Menge von Propolis, einer harzigen Substanz, die dazu bestimmt ist, die Spalten und Ritzen der neuen Wohnung zu verkitten, alles, was locker ist, zu befestigen, alle Wände zu firnissen und alles Licht abzublenden, denn sie arbeiten nur in einer fast völligen Dunkelheit, in der sie sich mit Hülfe ihrer Facettenaugen oder auch ihrer Fühler zurechttasten, denn diese scheinen in der That der Sitz eines unbekannten Sinnes zu sein, welcher die Finsternis fühlt und misst.
 Sie vermögen also die Ereignisse des gefahrvollsten Tages in ihrem Dasein vorauszusehen. Heute leben sie nur für den grossen Akt und die vielleicht wunderbaren Abenteuer, die er mit sich bringt; heute haben sie keine Zeit, in Gärten und Wiesen hinauszuschwärmen, und morgen oder übermorgen kann es vielleicht regnen und stürmen, ihre kleinen Flügel können erstarren und ihre Blumen sich nicht mehr öffnen. Ohne diese Voraussicht wären sie dem Hungertode preisgegeben. Nichts käme ihnen zu Hülfe, und sie würden niemanden um Hülfe bitten. Von Stock zu Stock kennen sie sich nicht und helfen sich nie. Es kommt sogar vor, dass der Bienenzüchter den Bienenstock, in den er die alte Königin und den sie umgebenden Schwarm eingeschlagen
hat, dicht neben den eben verlassenen Stock stellt. Welches Unglück sie nun auch trifft, man kann sagen, dass sie seinen Frieden, sein emsiges Glück, seine Reichtümer und seine Sicherheit unwiderruflich vergessen haben, und dass sie alle, eine nach der andern bis zur letzten, lieber bei ihrer unglücklichen Königin verhungern, als in ihr Elternhaus zurückzukehren, obschon der Duft seines Überflusses, welches der Duft ihrer verflossenen Arbeit ist, bis in ihre Trübsal herüberdringt.
Sie vermögen also die Ereignisse des gefahrvollsten Tages in ihrem Dasein vorauszusehen. Heute leben sie nur für den grossen Akt und die vielleicht wunderbaren Abenteuer, die er mit sich bringt; heute haben sie keine Zeit, in Gärten und Wiesen hinauszuschwärmen, und morgen oder übermorgen kann es vielleicht regnen und stürmen, ihre kleinen Flügel können erstarren und ihre Blumen sich nicht mehr öffnen. Ohne diese Voraussicht wären sie dem Hungertode preisgegeben. Nichts käme ihnen zu Hülfe, und sie würden niemanden um Hülfe bitten. Von Stock zu Stock kennen sie sich nicht und helfen sich nie. Es kommt sogar vor, dass der Bienenzüchter den Bienenstock, in den er die alte Königin und den sie umgebenden Schwarm eingeschlagen
hat, dicht neben den eben verlassenen Stock stellt. Welches Unglück sie nun auch trifft, man kann sagen, dass sie seinen Frieden, sein emsiges Glück, seine Reichtümer und seine Sicherheit unwiderruflich vergessen haben, und dass sie alle, eine nach der andern bis zur letzten, lieber bei ihrer unglücklichen Königin verhungern, als in ihr Elternhaus zurückzukehren, obschon der Duft seines Überflusses, welches der Duft ihrer verflossenen Arbeit ist, bis in ihre Trübsal herüberdringt.
 Das wird man sagen, würden die Menschen nicht thun; es ist dies kein Beweis dafür, dass hier trotz einer staunenswerten Organisation keine eigentliche Vernunft, kein Bewusstsein vorhanden ist. Was wissen wir davon? Sind wir, ganz abgesehen davon, dass es sehr wohl möglich ist, dass andere Wesen eine andere Vernunft haben als die unsre, eine Vernunft, die sich in ganz anderer Weise äussert, ohne darum minderwertig zu sein, – sind wir, die wir nie aus dem engen Kreise des Menschlichen herauskommen, so gute Richter über geistige Dinge? Wir brauchen nur zwei oder drei Personen hinter einem Fenster sprechen und gestikulieren zu sehen, ohne zu hören, was sie sich sagen, und schon wird es uns sehr schwer, den sie leitenden Gedanken zu erraten. Glaubt man etwa, ein Bewohner des Mars oder der Venus, der von einem Berggipfel herab die kleinen schwarzen Punkte, die wir im Raume sind, durch die Strassen und Plätze hin- und herwimmeln sähe, könnte sich aus dem Anblick unserer Bewegungen,
unserer Gebäude und Kanäle oder Maschinen, eine genaue Vorstellung von unserem Verstande, unserer Moral, unserer Art zu lieben, zu denken und zu hoffen, kurz unsrem inneren und wirklichen Wesen machen? Er würde sich damit begnügen, gewisse erstaunliche Thatsachen festzustellen, ganz wie wir es im Bienenstock thun, und daraus würde er wahrscheinlich ebenso unsichre und irrige Folgerungen ziehen wie wir. Auf alle Fälle dürfte es ihm sehr schwer fallen, in den »kleinen schwarzen Punkten« die grosse moralische Tendenz, das wunderbar einmütige Gefühl zu entdecken, das im Bienenstock zum Ausdruck kommt. »Wohin gehen sie?« würde er sich fragen, wenn er uns Jahre und Jahrhunderte lang beobachtet hätte. »Was thun sie? Welches ist der Mittelpunkt und der Zweck ihres Lebens? Gehorchen sie irgend einem Gotte? Ich sehe nichts, was ihre Schritte lenkt. Heute scheinen sie allerhand Kleinigkeiten aufzuhäufen und aufzubauen, und morgen zerstören und zerstreuen sie sie. Sie kommen und gehen, sie versammeln sich und gehen auseinander, aber man weiss nicht, was sie eigentlich wollen. Sie bieten allerhand unerklärliche Anblicke. So sieht man z. B. etliche, die sich sozusagen nicht rühren. Man erkennt sie an ihren glänzenderen Gewändern. Oft auch sind sie von grösserem Umfange, als die, welche ihnen dienen. Ihre Wohnungen sind zehn oder zwanzig Mal so gross, auch zweckmässiger eingerichtet und reicher als die der andren. Sie halten darin Tag für Tag Mahlzeiten ab, die stundenlang dauern und sich
bisweilen tief in die Nacht erstrecken. Alle, die ihnen näher kommen, scheinen sie ausserordentlich zu ehren; aus den Nachbarhäusern wird ihnen Nahrung zugetragen, und vom Lande her strömen sie in Massen herbei, um ihnen Geschenke zu bringen. Man muss wohl glauben, dass sie unentbehrlich sind und ihrer Gattung wesentliche Dienste leisten, wiewohl unsre Forschungen uns noch keinen Aufschluss darüber gegeben haben, welcher Art diese Dienste sind. Dann wieder sieht man andre in grossen Häusern, die mit kreisenden Rädern angefüllt sind, in düsteren Schlupfwinkeln an den Häfen, oder auf kleinen Erdgevierten, auf denen sie vom Morgen bis zum Abend herumwühlen, in unaufhörlicher, mühevoller Arbeit. Dies alles führt zu der Vermutung, dass ihre Thätigkeit eine Strafe ist. Man lässt sie in engen, schmutzigen und baufälligen Hütten wohnen. Sie sind mit einem farblosen Stoffe bekleidet. Und so gross scheint ihr Eifer bei ihrer schädlichen oder doch zum mindesten unnützen Thätigkeit, dass sie sich kaum zum Schlafen und zum Essen Zeit gönnen. Auf einen der vorhin genannten kommen ihrer Tausend. Es ist zu bewundern, dass sich die Gattung unter Umständen, die ihrer Entwicklung so ungünstig sind, bis auf diesen Tag erhalten hat. Übrigens muss man hinzusetzen, dass sie, wenn man von dem zähen Eifer absieht, mit dem sie ihr mühevolles Tagewerk betreiben, harmlos und willfährig erscheinen und sich in allem jenen andren anbequemen, die augenscheinlich die Hüter und vielleicht die Retter der Gattung sind.«
Das wird man sagen, würden die Menschen nicht thun; es ist dies kein Beweis dafür, dass hier trotz einer staunenswerten Organisation keine eigentliche Vernunft, kein Bewusstsein vorhanden ist. Was wissen wir davon? Sind wir, ganz abgesehen davon, dass es sehr wohl möglich ist, dass andere Wesen eine andere Vernunft haben als die unsre, eine Vernunft, die sich in ganz anderer Weise äussert, ohne darum minderwertig zu sein, – sind wir, die wir nie aus dem engen Kreise des Menschlichen herauskommen, so gute Richter über geistige Dinge? Wir brauchen nur zwei oder drei Personen hinter einem Fenster sprechen und gestikulieren zu sehen, ohne zu hören, was sie sich sagen, und schon wird es uns sehr schwer, den sie leitenden Gedanken zu erraten. Glaubt man etwa, ein Bewohner des Mars oder der Venus, der von einem Berggipfel herab die kleinen schwarzen Punkte, die wir im Raume sind, durch die Strassen und Plätze hin- und herwimmeln sähe, könnte sich aus dem Anblick unserer Bewegungen,
unserer Gebäude und Kanäle oder Maschinen, eine genaue Vorstellung von unserem Verstande, unserer Moral, unserer Art zu lieben, zu denken und zu hoffen, kurz unsrem inneren und wirklichen Wesen machen? Er würde sich damit begnügen, gewisse erstaunliche Thatsachen festzustellen, ganz wie wir es im Bienenstock thun, und daraus würde er wahrscheinlich ebenso unsichre und irrige Folgerungen ziehen wie wir. Auf alle Fälle dürfte es ihm sehr schwer fallen, in den »kleinen schwarzen Punkten« die grosse moralische Tendenz, das wunderbar einmütige Gefühl zu entdecken, das im Bienenstock zum Ausdruck kommt. »Wohin gehen sie?« würde er sich fragen, wenn er uns Jahre und Jahrhunderte lang beobachtet hätte. »Was thun sie? Welches ist der Mittelpunkt und der Zweck ihres Lebens? Gehorchen sie irgend einem Gotte? Ich sehe nichts, was ihre Schritte lenkt. Heute scheinen sie allerhand Kleinigkeiten aufzuhäufen und aufzubauen, und morgen zerstören und zerstreuen sie sie. Sie kommen und gehen, sie versammeln sich und gehen auseinander, aber man weiss nicht, was sie eigentlich wollen. Sie bieten allerhand unerklärliche Anblicke. So sieht man z. B. etliche, die sich sozusagen nicht rühren. Man erkennt sie an ihren glänzenderen Gewändern. Oft auch sind sie von grösserem Umfange, als die, welche ihnen dienen. Ihre Wohnungen sind zehn oder zwanzig Mal so gross, auch zweckmässiger eingerichtet und reicher als die der andren. Sie halten darin Tag für Tag Mahlzeiten ab, die stundenlang dauern und sich
bisweilen tief in die Nacht erstrecken. Alle, die ihnen näher kommen, scheinen sie ausserordentlich zu ehren; aus den Nachbarhäusern wird ihnen Nahrung zugetragen, und vom Lande her strömen sie in Massen herbei, um ihnen Geschenke zu bringen. Man muss wohl glauben, dass sie unentbehrlich sind und ihrer Gattung wesentliche Dienste leisten, wiewohl unsre Forschungen uns noch keinen Aufschluss darüber gegeben haben, welcher Art diese Dienste sind. Dann wieder sieht man andre in grossen Häusern, die mit kreisenden Rädern angefüllt sind, in düsteren Schlupfwinkeln an den Häfen, oder auf kleinen Erdgevierten, auf denen sie vom Morgen bis zum Abend herumwühlen, in unaufhörlicher, mühevoller Arbeit. Dies alles führt zu der Vermutung, dass ihre Thätigkeit eine Strafe ist. Man lässt sie in engen, schmutzigen und baufälligen Hütten wohnen. Sie sind mit einem farblosen Stoffe bekleidet. Und so gross scheint ihr Eifer bei ihrer schädlichen oder doch zum mindesten unnützen Thätigkeit, dass sie sich kaum zum Schlafen und zum Essen Zeit gönnen. Auf einen der vorhin genannten kommen ihrer Tausend. Es ist zu bewundern, dass sich die Gattung unter Umständen, die ihrer Entwicklung so ungünstig sind, bis auf diesen Tag erhalten hat. Übrigens muss man hinzusetzen, dass sie, wenn man von dem zähen Eifer absieht, mit dem sie ihr mühevolles Tagewerk betreiben, harmlos und willfährig erscheinen und sich in allem jenen andren anbequemen, die augenscheinlich die Hüter und vielleicht die Retter der Gattung sind.«
 Ist es nicht sonderbar, dass der Bienenstock, den wir aus der Höhe einer andren Welt nur undeutlich ernennen, uns beim ersten Blick eine tiefe und gewisse Antwort giebt? Ist es nicht wunderbar, dass seine Bauten, seine Sitten und Gesetze, seine soziale und politische Organisation, seine Tugenden und selbst seine Grausamkeiten, uns unmittelbar den Gedanken oder Gott offenbaren, dem die Bienen dienen, der weder der unrechtmässigste, noch der vernunftwidrigste ist, den man sich vorstellen kann, wiewohl vielleicht der einzige, den wir noch nicht ernstlich angebetet haben, nämlich die Zukunft? Wir suchen in unsrer Menschheits-Geschichte bisweilen die moralische Kraft und Grösse eines Volkes zu bewerten, und wir finden keinen andren Masstab, als die Dauerhaftigkeit und Grösse des von ihm verfolgten Ideals und die Selbstverleugnung, mit der es sich ihm hingiebt. – Haben wir oft ein Ideal gefunden, das dem Weltall näher steht, das fester, erhabener, selbstloser und offenkundiger ist und mit einer gänzlicheren und heldenhafteren Selbstverleugnung Hand in Hand geht?
Ist es nicht sonderbar, dass der Bienenstock, den wir aus der Höhe einer andren Welt nur undeutlich ernennen, uns beim ersten Blick eine tiefe und gewisse Antwort giebt? Ist es nicht wunderbar, dass seine Bauten, seine Sitten und Gesetze, seine soziale und politische Organisation, seine Tugenden und selbst seine Grausamkeiten, uns unmittelbar den Gedanken oder Gott offenbaren, dem die Bienen dienen, der weder der unrechtmässigste, noch der vernunftwidrigste ist, den man sich vorstellen kann, wiewohl vielleicht der einzige, den wir noch nicht ernstlich angebetet haben, nämlich die Zukunft? Wir suchen in unsrer Menschheits-Geschichte bisweilen die moralische Kraft und Grösse eines Volkes zu bewerten, und wir finden keinen andren Masstab, als die Dauerhaftigkeit und Grösse des von ihm verfolgten Ideals und die Selbstverleugnung, mit der es sich ihm hingiebt. – Haben wir oft ein Ideal gefunden, das dem Weltall näher steht, das fester, erhabener, selbstloser und offenkundiger ist und mit einer gänzlicheren und heldenhafteren Selbstverleugnung Hand in Hand geht?
 Seltsame kleine Republik, so logisch und so ernst, so zweckvoll und so streng durchgeführt, so sparsam und doch einem so grossen und ungewissen Traume hingegeben! O kleines Volk, so entschlossen und so tief, von Licht und Wärme und allem Reinsten in der Welt genährt, vom Kelch der Blumen, das ist vom sichtbarsten
Lächeln der Materie und ihrem rührendsten Streben nach Glück und Schönheit! Wer wird uns sagen, welche Probleme Ihr gelöst habt und uns zu lösen aufgebt, welche Gewissheiten Ihr erworben habt und uns zu erwerben noch übrig lasset! Und wenn es wahr ist, dass Ihr Probleme gelöst, Gewissheiten erlangt habt, indem Ihr nicht dem Verstände folgtet, sondern einem blinden und dumpfen Drange: welches noch unlösbarere Rätsel zwingt Ihr uns dann noch zu lösen? O kleine Stadt voller Glauben und Hoffen, und voller Mysterien, warum wird Deinen hunderttausend Jungfrauen eine Aufgabe zuteil, die kein menschlicher Sklave je auf sich genommen hat? Schonten sie ihre Kräfte, dachten sie ein wenig mehr an sich selbst, wären sie etwas weniger eifrig bei der Arbeit, sie sähen einen zweiten Lenz und einen neuen Sommer, und doch scheinen sie in dem grossen Augenblick, wo alle Blumen ihnen winken, von einer mörderischen Arbeitslust ergriffen zu werden, und mit geknickten Flügeln, mit eingeschrumpftem, wundenbedecktem Leibe finden sie fast alle in weniger als fünf Wochen den Tod.
Seltsame kleine Republik, so logisch und so ernst, so zweckvoll und so streng durchgeführt, so sparsam und doch einem so grossen und ungewissen Traume hingegeben! O kleines Volk, so entschlossen und so tief, von Licht und Wärme und allem Reinsten in der Welt genährt, vom Kelch der Blumen, das ist vom sichtbarsten
Lächeln der Materie und ihrem rührendsten Streben nach Glück und Schönheit! Wer wird uns sagen, welche Probleme Ihr gelöst habt und uns zu lösen aufgebt, welche Gewissheiten Ihr erworben habt und uns zu erwerben noch übrig lasset! Und wenn es wahr ist, dass Ihr Probleme gelöst, Gewissheiten erlangt habt, indem Ihr nicht dem Verstände folgtet, sondern einem blinden und dumpfen Drange: welches noch unlösbarere Rätsel zwingt Ihr uns dann noch zu lösen? O kleine Stadt voller Glauben und Hoffen, und voller Mysterien, warum wird Deinen hunderttausend Jungfrauen eine Aufgabe zuteil, die kein menschlicher Sklave je auf sich genommen hat? Schonten sie ihre Kräfte, dachten sie ein wenig mehr an sich selbst, wären sie etwas weniger eifrig bei der Arbeit, sie sähen einen zweiten Lenz und einen neuen Sommer, und doch scheinen sie in dem grossen Augenblick, wo alle Blumen ihnen winken, von einer mörderischen Arbeitslust ergriffen zu werden, und mit geknickten Flügeln, mit eingeschrumpftem, wundenbedecktem Leibe finden sie fast alle in weniger als fünf Wochen den Tod.
»Tantus amor florum et generandi gloria mellis«, ruft Vergil aus, der uns im vierten Buche seiner »Georgica«, das den Bienen gewidmet ist, die holden Irrtümer der Alten überliefert hat, welche die Natur mit einem durch die glänzende Vision des Olymps geblendeten Auge betrachteten.

 Warum entsagen Sie dem Schlafe, den Wonnen des Honigs, der Liebe und der göttlichen Musse, die doch ihr geflügelter Bruder, der Schmetterling, kennt? Könnten sie nicht leben wie er? Der Hunger ist es nicht, der sie zur Arbeit treibt. Zwei oder drei Blumen genügen zu ihrer Ernährung, und sie befliegen stündlich zwei- oder dreihundert, um einen Schatz aufzuhäufen, dessen Süsse sie nie kosten werden. Wozu schaffen sie sich soviel Qual und Mühe, und woher kommt eine solche Entschiedenheit? Es muss also das Geschlecht, für das sie sterben, dieses Opfer wohl verdienen, es muss schöner und glücklicher sein und etwas thun, was sie nicht vermochten? Wir erkennen ihr Ziel, es ist klarer, als das unsre, sie wollen in ihren Nachkommen leben, solange die Welt steht: aber welches ist doch der Zweck dieses grossen Ziels und die Aufgabe dieses ewig wiederkehrenden Kreislaufes? – Oder sind wir, die da zweifeln und zaudern, nicht viel eher kindliche Träumer, die unnütze Fragen stellen? Sie könnten von Stufe zu Stufe gestiegen und allmächtig und glückselig geworden sein, sie könnten die letzten Höhen erklommen haben, von denen sich die Naturgesetze beherrschen lassen, sie könnten unsterbliche Göttinnen geworden sein, und wir würden sie immer noch befragen, was sie hofften, wohin sie gingen, wo sie Halt zu machen gedächten und sich am Ziel ihrer Wünsche glaubten. Wir sind so geschaffen, dass uns nichts befriedigt, dass uns nichts seinen eigenen Zweck zu haben und
einfach, ohne Hintergedanken, zu existieren scheint. Haben wir uns bis auf diesen Tag auch nur einen Gott vorstellen können, so dumm oder so vernunftgemäss er auch sein mag, ohne dass wir ihn uns unmittelbar geschäftig und wirkend dachten, ohne dass wir ihn zum Schöpfer einer Menge von Wesen und Dingen machten und tausend Zwecke noch hinter ihm annahmen? Werden wir uns wohl je damit begnügen, einige Stunden lang ruhig eine besondere Form der wirkenden Materie darzustellen, um alsbald ohne Staunen und ohne Bedauern jene andre Form anzunehmen, welches die unbewusste, unbekannte, schlafende, ewige ist?
Warum entsagen Sie dem Schlafe, den Wonnen des Honigs, der Liebe und der göttlichen Musse, die doch ihr geflügelter Bruder, der Schmetterling, kennt? Könnten sie nicht leben wie er? Der Hunger ist es nicht, der sie zur Arbeit treibt. Zwei oder drei Blumen genügen zu ihrer Ernährung, und sie befliegen stündlich zwei- oder dreihundert, um einen Schatz aufzuhäufen, dessen Süsse sie nie kosten werden. Wozu schaffen sie sich soviel Qual und Mühe, und woher kommt eine solche Entschiedenheit? Es muss also das Geschlecht, für das sie sterben, dieses Opfer wohl verdienen, es muss schöner und glücklicher sein und etwas thun, was sie nicht vermochten? Wir erkennen ihr Ziel, es ist klarer, als das unsre, sie wollen in ihren Nachkommen leben, solange die Welt steht: aber welches ist doch der Zweck dieses grossen Ziels und die Aufgabe dieses ewig wiederkehrenden Kreislaufes? – Oder sind wir, die da zweifeln und zaudern, nicht viel eher kindliche Träumer, die unnütze Fragen stellen? Sie könnten von Stufe zu Stufe gestiegen und allmächtig und glückselig geworden sein, sie könnten die letzten Höhen erklommen haben, von denen sich die Naturgesetze beherrschen lassen, sie könnten unsterbliche Göttinnen geworden sein, und wir würden sie immer noch befragen, was sie hofften, wohin sie gingen, wo sie Halt zu machen gedächten und sich am Ziel ihrer Wünsche glaubten. Wir sind so geschaffen, dass uns nichts befriedigt, dass uns nichts seinen eigenen Zweck zu haben und
einfach, ohne Hintergedanken, zu existieren scheint. Haben wir uns bis auf diesen Tag auch nur einen Gott vorstellen können, so dumm oder so vernunftgemäss er auch sein mag, ohne dass wir ihn uns unmittelbar geschäftig und wirkend dachten, ohne dass wir ihn zum Schöpfer einer Menge von Wesen und Dingen machten und tausend Zwecke noch hinter ihm annahmen? Werden wir uns wohl je damit begnügen, einige Stunden lang ruhig eine besondere Form der wirkenden Materie darzustellen, um alsbald ohne Staunen und ohne Bedauern jene andre Form anzunehmen, welches die unbewusste, unbekannte, schlafende, ewige ist?
 Indessen vergessen wir unsren Bienenstock nicht, dessen Schwarm die Geduld verliert, unsern Bienenstock, der schon von schwärzlichen, kribbelnden Fluten brodelt und überschwillt, wie ein klingendes Gefäss in der Sonnenglut. Es ist Mittag, und man möchte sagen, dass die Bäume ringsum in der brütenden Hitze kein Blättchen bewegen, wie man seinen Atem anhält, wenn man vor etwas sehr Holdem, aber sehr Ernstem steht. Die Bienen schenken dem Menschen Honig und duftendes Wachs, aber was vielleicht mehr wert ist, als Honig und Wachs: sie lenken seinen Sinn auf den heiteren Junitag, sie öffnen ihm das Herz für den Zauber der schönen Jahreszeit, und alles, woran sie Anteil haben, verknüpft sich in der Vorstellung mit blauem Himmel, Blumensegen und Sommerlust. Sie sind die eigentliche Seele des Sommers, die Uhr der Stunden des
Überflusses, der schnelle Flügel der aufsteigenden Düfte, der Geist und Sinn des strömenden Lichtes, das Lied der sich dehnenden, ruhenden Luft, und ihr Flug ist das sichtbare Wahrzeichen, die deutliche musikalische Note der tausend kleinen Freuden, die von der Wärme erzeugt sind und im Lichte leben. Sie lehren uns die zarteste Stimme der Natur verstehen, und wer sie einmal kennen und lieben gelernt hat, für den ist ein Sommer ohne Bienensummen so unglücklich und unvollkommen, wie ohne Blumen und ohne Vögel.
Indessen vergessen wir unsren Bienenstock nicht, dessen Schwarm die Geduld verliert, unsern Bienenstock, der schon von schwärzlichen, kribbelnden Fluten brodelt und überschwillt, wie ein klingendes Gefäss in der Sonnenglut. Es ist Mittag, und man möchte sagen, dass die Bäume ringsum in der brütenden Hitze kein Blättchen bewegen, wie man seinen Atem anhält, wenn man vor etwas sehr Holdem, aber sehr Ernstem steht. Die Bienen schenken dem Menschen Honig und duftendes Wachs, aber was vielleicht mehr wert ist, als Honig und Wachs: sie lenken seinen Sinn auf den heiteren Junitag, sie öffnen ihm das Herz für den Zauber der schönen Jahreszeit, und alles, woran sie Anteil haben, verknüpft sich in der Vorstellung mit blauem Himmel, Blumensegen und Sommerlust. Sie sind die eigentliche Seele des Sommers, die Uhr der Stunden des
Überflusses, der schnelle Flügel der aufsteigenden Düfte, der Geist und Sinn des strömenden Lichtes, das Lied der sich dehnenden, ruhenden Luft, und ihr Flug ist das sichtbare Wahrzeichen, die deutliche musikalische Note der tausend kleinen Freuden, die von der Wärme erzeugt sind und im Lichte leben. Sie lehren uns die zarteste Stimme der Natur verstehen, und wer sie einmal kennen und lieben gelernt hat, für den ist ein Sommer ohne Bienensummen so unglücklich und unvollkommen, wie ohne Blumen und ohne Vögel.
 Wer die betäubende und wirre Episode des Schwärmens bei einem starken Bienenvolke zum ersten Male miterlebt, der ist ziemlich ausser Fassung und kommt nur furchtsam näher. Er erkennt die friedlichen und ernsten Bienen der Trachtzeit nicht wieder. Noch vor wenigen Minuten sah er sie aus allen vier Winden herbeifliegen, wie kleine emsige Bürgerfrauen, die sich durch nichts von ihren Haushaltungsgeschäften ablenken lassen. Erschöpft, atemlos, hastig und aufgeregt, aber leise, schlüpften sie fast unbemerkt in das Flugloch und die jungen Wächterinnen am Eingang nickten ihnen im Vorbeikommen mit den Fühlern zu. Kaum wechselten sie die drei oder vier Worte, die wahrscheinlich unerlässlich sind, und übergaben ihre Honigbürde hastig einer der jungen Trägerinnen, die stets im Innenhofe der Werkstätte postiert sind, oder sie gingen selbst hinauf und entleerten die zwei schweren Körbe von Blumenstaub, die an ihren Hinterschenkeln hängen, in den geräumigen
Speichern, die rings um dem Brutraum liegen, um alsbald wieder davonzufliegen, ohne sich darum zu kümmern, was im Laboratorium, im Schlafraume der Nymphen oder im königlichen Palaste vorgeht, ohne sich auch nur eine Sekunde in das geschwätzige Treiben des öffentlichen Platzes vor dem Thore zu mischen, wo in den Stunden grosser Hitze eine Anzahl von Bienen für Luftzufuhr sorgt, indem sie, eine an der andern hängend, hin- und herschaukeln, als ob ein Bart im Winde flattert.
Wer die betäubende und wirre Episode des Schwärmens bei einem starken Bienenvolke zum ersten Male miterlebt, der ist ziemlich ausser Fassung und kommt nur furchtsam näher. Er erkennt die friedlichen und ernsten Bienen der Trachtzeit nicht wieder. Noch vor wenigen Minuten sah er sie aus allen vier Winden herbeifliegen, wie kleine emsige Bürgerfrauen, die sich durch nichts von ihren Haushaltungsgeschäften ablenken lassen. Erschöpft, atemlos, hastig und aufgeregt, aber leise, schlüpften sie fast unbemerkt in das Flugloch und die jungen Wächterinnen am Eingang nickten ihnen im Vorbeikommen mit den Fühlern zu. Kaum wechselten sie die drei oder vier Worte, die wahrscheinlich unerlässlich sind, und übergaben ihre Honigbürde hastig einer der jungen Trägerinnen, die stets im Innenhofe der Werkstätte postiert sind, oder sie gingen selbst hinauf und entleerten die zwei schweren Körbe von Blumenstaub, die an ihren Hinterschenkeln hängen, in den geräumigen
Speichern, die rings um dem Brutraum liegen, um alsbald wieder davonzufliegen, ohne sich darum zu kümmern, was im Laboratorium, im Schlafraume der Nymphen oder im königlichen Palaste vorgeht, ohne sich auch nur eine Sekunde in das geschwätzige Treiben des öffentlichen Platzes vor dem Thore zu mischen, wo in den Stunden grosser Hitze eine Anzahl von Bienen für Luftzufuhr sorgt, indem sie, eine an der andern hängend, hin- und herschaukeln, als ob ein Bart im Winde flattert.
 Heute bietet sich ein ganz anderes Bild dar. Eine Zahl von Arbeitsbienen fliegt allerdings nach wie vor, als wäre nichts geschehen, friedlich aus und ein, reinigt den Stock, klettert zu den Brutzellen hinauf und scheint von der allgemeinen Trunkenheit nicht fortgerissen zu werden. Es sind die, welche die Königin nicht begleiten werden, sondern im alten Heim zurückbleiben, um es zu beschützen, die neun- oder zehntausend Eier, die achtzehntausend Larven, die sechsunddreissigtausend Nymphen und sieben oder acht Prinzessinnen, die allein zurückbleiben, zu pflegen und zu ernähren. Sie werden zu dieser schweren Aufgabe auserkoren, ohne dass man wüsste, wie, noch durch wen und nach welchem Gesetze. Doch sind sie diesem Gesetze fest und unverbrüchlich treu, und wiewohl ich mehrmals das Experiment gemacht habe, eines dieser selbstverleugnenden Aschenbrödel, die man an ihrem ernsten und bedächtigen Wesen leicht aus dem schwärmenden Volke herauserkennt, mit einem Farbstoffe zu bestäuben, so habe
ich doch nur selten eine von ihnen in der trunkenen Menge des Schwarmes wiedergefunden.
Heute bietet sich ein ganz anderes Bild dar. Eine Zahl von Arbeitsbienen fliegt allerdings nach wie vor, als wäre nichts geschehen, friedlich aus und ein, reinigt den Stock, klettert zu den Brutzellen hinauf und scheint von der allgemeinen Trunkenheit nicht fortgerissen zu werden. Es sind die, welche die Königin nicht begleiten werden, sondern im alten Heim zurückbleiben, um es zu beschützen, die neun- oder zehntausend Eier, die achtzehntausend Larven, die sechsunddreissigtausend Nymphen und sieben oder acht Prinzessinnen, die allein zurückbleiben, zu pflegen und zu ernähren. Sie werden zu dieser schweren Aufgabe auserkoren, ohne dass man wüsste, wie, noch durch wen und nach welchem Gesetze. Doch sind sie diesem Gesetze fest und unverbrüchlich treu, und wiewohl ich mehrmals das Experiment gemacht habe, eines dieser selbstverleugnenden Aschenbrödel, die man an ihrem ernsten und bedächtigen Wesen leicht aus dem schwärmenden Volke herauserkennt, mit einem Farbstoffe zu bestäuben, so habe
ich doch nur selten eine von ihnen in der trunkenen Menge des Schwarmes wiedergefunden.
 Und doch scheint der Reiz unwiderstehlich. Es ist der Wonnetaumel des – vielleicht unbewussten – gottverordneten Opfers, das Honigfest, der Sieg der Rasse und der Zukunft, es ist der einzige Tag der Freude, des Vergessens und der Ausgelassenheit, es ist der einzige Sonntag der Bienen. Und anscheinend auch der einzige Tag, wo sie nur für ihren Hunger essen, wo sie die ganze Süsse des von ihnen aufgespeicherten Schatzes empfinden. Sie sind wie freigelassene Gefangene, die sich plötzlich ins Land der Freiheit und des Überflusses versetzt sehen. Sie frohlocken, sie sind nicht mehr Herr ihrer selbst; sie, die nie eine unangebrachte oder unnötige Bewegung machen, sie kommen und gehen, fliegen ein und aus und immer wieder, um ihre Mitschwestern anzufeuern, um nachzusehen, ob die Königin bereit ist, um ihre Ungeduld zu betäuben. Sie fliegen höher, als es sonst der Fall ist, und das Laub der grossen Bäume rings um den Bienenstand bebt von ihrem Schwirren. Sie kennen keine Furcht und Sorge mehr. Sie sind nicht mehr wild, schnüfflerisch, argwöhnisch, reizbar, heftig und unbändig. Der Mensch, der unbekannte Herr, den sie nie anerkennen, und der ihrer nur dadurch Herr wird, dass er sich allen ihren Arbeitsgewohnheiten anpasst, alle ihre Gesetze achtet und Schritt für Schritt der Spur folgt, die ihr stets auf die Zukunft gerichteter Sinn, ihr durch nichts zu trübender, durch nichts
von seinem Ziele abzulenkender Verstand dem Leben aufdrückt, – der Mensch kann ihnen nahen, kann den brausenden, kreisenden Schleier zerreissen, in den sie ihn goldig und sanft einhüllen, er kann sie in die Hand nehmen, sie einzeln abpflücken, wie Weinbeeren von der Traube; sie sind ebenso sanft, ebenso harmlos, wie ein Schwarm Libellen oder Nachtfalter. Sie sind an diesem Tage glücklich, obwohl sie nichts mehr besitzen, sie blicken vertrauensvoll in die Zukunft, und wenn man sie nicht von ihrer Königin trennt, die diese Zukunft in sich trägt, fügen sie sich in Alles und verletzen niemand.
Und doch scheint der Reiz unwiderstehlich. Es ist der Wonnetaumel des – vielleicht unbewussten – gottverordneten Opfers, das Honigfest, der Sieg der Rasse und der Zukunft, es ist der einzige Tag der Freude, des Vergessens und der Ausgelassenheit, es ist der einzige Sonntag der Bienen. Und anscheinend auch der einzige Tag, wo sie nur für ihren Hunger essen, wo sie die ganze Süsse des von ihnen aufgespeicherten Schatzes empfinden. Sie sind wie freigelassene Gefangene, die sich plötzlich ins Land der Freiheit und des Überflusses versetzt sehen. Sie frohlocken, sie sind nicht mehr Herr ihrer selbst; sie, die nie eine unangebrachte oder unnötige Bewegung machen, sie kommen und gehen, fliegen ein und aus und immer wieder, um ihre Mitschwestern anzufeuern, um nachzusehen, ob die Königin bereit ist, um ihre Ungeduld zu betäuben. Sie fliegen höher, als es sonst der Fall ist, und das Laub der grossen Bäume rings um den Bienenstand bebt von ihrem Schwirren. Sie kennen keine Furcht und Sorge mehr. Sie sind nicht mehr wild, schnüfflerisch, argwöhnisch, reizbar, heftig und unbändig. Der Mensch, der unbekannte Herr, den sie nie anerkennen, und der ihrer nur dadurch Herr wird, dass er sich allen ihren Arbeitsgewohnheiten anpasst, alle ihre Gesetze achtet und Schritt für Schritt der Spur folgt, die ihr stets auf die Zukunft gerichteter Sinn, ihr durch nichts zu trübender, durch nichts
von seinem Ziele abzulenkender Verstand dem Leben aufdrückt, – der Mensch kann ihnen nahen, kann den brausenden, kreisenden Schleier zerreissen, in den sie ihn goldig und sanft einhüllen, er kann sie in die Hand nehmen, sie einzeln abpflücken, wie Weinbeeren von der Traube; sie sind ebenso sanft, ebenso harmlos, wie ein Schwarm Libellen oder Nachtfalter. Sie sind an diesem Tage glücklich, obwohl sie nichts mehr besitzen, sie blicken vertrauensvoll in die Zukunft, und wenn man sie nicht von ihrer Königin trennt, die diese Zukunft in sich trägt, fügen sie sich in Alles und verletzen niemand.
 Aber das eigentliche Zeichen ist noch nicht gegeben. Im Bienenstock herrscht eine unbegreifliche Aufregung und eine anscheinend durch nichts zu erklärende Unordnung. Sonst scheinen die Bienen, wenn sie heimgekehrt sind, zu vergessen, dass sie Flügel haben, und jede einzelne sitzt nahezu unbeweglich, wenn auch nicht unthätig, auf den Waben, und zwar an dem Flecke, der ihr durch die Art ihrer Arbeit zugewiesen ist. Jetzt fliegen sie wie unsinnig in dichten Ketten an den Seitenwänden hinauf und hinunter, wie ein bebender Teig, der von einer unsichtbaren Hand geknetet wird. Die Temperatur steigt im Innern jäh, oft so weit, dass der Wachsbau weich wird und sich zerdehnt. Die Königin, welche den Brutraum sonst nie verlässt, läuft aufgeregt und kopflos durch die Oberfläche der brausenden Masse, die sich gleichsam um sich selbst dreht. Geschieht dies zur Beschleunigung oder zur Verzögerung des
Aufbruches? Befiehlt sie oder bittet sie? Verbreitet sie die wunderbare Aufregung oder unterliegt sie ihr? Nach dem, was wir von der Psychologie der Bienen im allgemeinen wissen, scheint es ziemlich erwiesen, dass das Schwärmen allemal gegen den Willen der alten Königin stattfindet. Im Grunde ist die Königin in den Augen der asketischen Arbeitsbienen, welche ihre Töchter sind, das unentbehrliche und geheiligte, aber auch ein wenig geistesschwache und oft kindliche Organ der Liebe. Sie behandeln sie darum auch wie eine Mutter, die unter Vormundschaft steht. Sie besitzen eine grenzenlose Verehrung und heldenmütige Anhänglichkeit gegen sie. Ihr bleibt der reinste, besonders geläuterte und fast restlos verdauliche Honig vorbehalten. Sie hat ein Gefolge von Trabanten oder Liktoren, wie Plinius sagt, eine Leibwache, die Tag und Nacht über sie wacht, ihr die mütterliche Arbeit erleichtert, die Zellen zum Eierlegen bereit macht, sie pflegt, liebkost, ernährt, reinigt, ja, selbst ihre Exkremente auffrisst. Wenn ihr das Geringste zustösst, verbreitet sich die Kunde durch das ganze Volk; alles umdrängt sie und klagt. Wenn man einem Stocke die Königin nimmt und die Bienen auf einen Ersatz nicht hoffen können, sei es, dass sie keine königliche Nachkommenschaft hinterlassen hat, sei es, dass keine Larven von Arbeitsbienen im Alter von weniger als drei Tagen vorhanden sind (denn jede Arbeitsbienenlarve unter drei Tagen kann durch besondere Ernährung in eine Königinnenlarve verwandelt werden; das ist das grosse demokratische Prinzip des Bienenstockes, welches die
Vorrechte der mütterlichen Abkunft kompensiert), – wenn man, sage ich, unter diesen Verhältnissen einem Stocke die Königin nimmt und ihr Fehlen bemerkt wird – es vergehen oft zwei bis drei Stunden, ehe alle Bienen es wissen, so gross ist ihre Stadt, – so ruht alsbald fast jede Arbeit, die Brut wird im Stich gelassen, ein Teil des Volkes irrt im Stock umher und sucht nach seiner Mutter, ein anderer fliegt aus und sucht sie da, die Ketten der Arbeitsbienen, die am Wachsbau beschäftigt waren, zerreissen und lösen sich auf, die Honigsucherinnen befliegen ihre Blumen nicht mehr, die Schildwachen am Eingang verlassen ihren Posten und die fremden Räuber und Honigschmarotzer, die stets auf unverhoffte Beute lauern, kommen und gehen, ohne dass jemand daran denkt, den mühsam erworbenen Schatz zu verteidigen. Allmählich verarmt und verödet der Stock und seine trostlosen Bewohnerinnen sterben bald vor Trübsal und Elend, wiewohl der Sommer ihnen alle seine Blüten öffnet.
Aber das eigentliche Zeichen ist noch nicht gegeben. Im Bienenstock herrscht eine unbegreifliche Aufregung und eine anscheinend durch nichts zu erklärende Unordnung. Sonst scheinen die Bienen, wenn sie heimgekehrt sind, zu vergessen, dass sie Flügel haben, und jede einzelne sitzt nahezu unbeweglich, wenn auch nicht unthätig, auf den Waben, und zwar an dem Flecke, der ihr durch die Art ihrer Arbeit zugewiesen ist. Jetzt fliegen sie wie unsinnig in dichten Ketten an den Seitenwänden hinauf und hinunter, wie ein bebender Teig, der von einer unsichtbaren Hand geknetet wird. Die Temperatur steigt im Innern jäh, oft so weit, dass der Wachsbau weich wird und sich zerdehnt. Die Königin, welche den Brutraum sonst nie verlässt, läuft aufgeregt und kopflos durch die Oberfläche der brausenden Masse, die sich gleichsam um sich selbst dreht. Geschieht dies zur Beschleunigung oder zur Verzögerung des
Aufbruches? Befiehlt sie oder bittet sie? Verbreitet sie die wunderbare Aufregung oder unterliegt sie ihr? Nach dem, was wir von der Psychologie der Bienen im allgemeinen wissen, scheint es ziemlich erwiesen, dass das Schwärmen allemal gegen den Willen der alten Königin stattfindet. Im Grunde ist die Königin in den Augen der asketischen Arbeitsbienen, welche ihre Töchter sind, das unentbehrliche und geheiligte, aber auch ein wenig geistesschwache und oft kindliche Organ der Liebe. Sie behandeln sie darum auch wie eine Mutter, die unter Vormundschaft steht. Sie besitzen eine grenzenlose Verehrung und heldenmütige Anhänglichkeit gegen sie. Ihr bleibt der reinste, besonders geläuterte und fast restlos verdauliche Honig vorbehalten. Sie hat ein Gefolge von Trabanten oder Liktoren, wie Plinius sagt, eine Leibwache, die Tag und Nacht über sie wacht, ihr die mütterliche Arbeit erleichtert, die Zellen zum Eierlegen bereit macht, sie pflegt, liebkost, ernährt, reinigt, ja, selbst ihre Exkremente auffrisst. Wenn ihr das Geringste zustösst, verbreitet sich die Kunde durch das ganze Volk; alles umdrängt sie und klagt. Wenn man einem Stocke die Königin nimmt und die Bienen auf einen Ersatz nicht hoffen können, sei es, dass sie keine königliche Nachkommenschaft hinterlassen hat, sei es, dass keine Larven von Arbeitsbienen im Alter von weniger als drei Tagen vorhanden sind (denn jede Arbeitsbienenlarve unter drei Tagen kann durch besondere Ernährung in eine Königinnenlarve verwandelt werden; das ist das grosse demokratische Prinzip des Bienenstockes, welches die
Vorrechte der mütterlichen Abkunft kompensiert), – wenn man, sage ich, unter diesen Verhältnissen einem Stocke die Königin nimmt und ihr Fehlen bemerkt wird – es vergehen oft zwei bis drei Stunden, ehe alle Bienen es wissen, so gross ist ihre Stadt, – so ruht alsbald fast jede Arbeit, die Brut wird im Stich gelassen, ein Teil des Volkes irrt im Stock umher und sucht nach seiner Mutter, ein anderer fliegt aus und sucht sie da, die Ketten der Arbeitsbienen, die am Wachsbau beschäftigt waren, zerreissen und lösen sich auf, die Honigsucherinnen befliegen ihre Blumen nicht mehr, die Schildwachen am Eingang verlassen ihren Posten und die fremden Räuber und Honigschmarotzer, die stets auf unverhoffte Beute lauern, kommen und gehen, ohne dass jemand daran denkt, den mühsam erworbenen Schatz zu verteidigen. Allmählich verarmt und verödet der Stock und seine trostlosen Bewohnerinnen sterben bald vor Trübsal und Elend, wiewohl der Sommer ihnen alle seine Blüten öffnet.
Giebt man ihnen ihre Königin aber wieder, ehe ihr Verlust ihnen zur vollendeten, unumstösslichen Thatsache geworden ist, ehe die Demoralisation zu sehr um sich gegriffen hat, – denn die Bienen sind wie die Menschen; Unglück und Verzweiflung brechen mit der Zeit ihren Charakter und trüben ihren Verstand, – giebt man ihnen die Königin nach einigen Stunden wieder, so bereiten sie ihr einen ausserordentlich rührenden Empfang. Alle umdrängen sie und rotten sich zusammen, klettern über einander weg und liebkosen sie im Vorbeilaufen mit ihren langen Fühlhörnern, die noch manche unaufgeklärten Organe enthalten, bieten ihr Honig dar und geleiten sie im Gedränge bis zu den königlichen Gemächern. Sofort ist die Ordnung wieder hergestellt und die Arbeit wird wieder aufgenommen, von den innersten Waben des Brutraumes bis zu den abgelegensten Vorbauten, in denen der Überschuss der Ernte gespeichert wird; die Honigsucherinnen fliegen in schwarzen Fäden hinaus und kehren oft schon drei Minuten danach mit Nektar und Blütenstaub beladen heim; die Räuber und Schmarotzer werden vertrieben oder umgebracht, die Gänge gesäubert und der Stock ertönt wieder von dem sanften und eintönigen, eigentümlich freudigen Summen, welches gleichsam das Hohelied auf die Gegenwart der Königin ist.
 Es giebt tausend Beispiele für diese unbedingte Treue und Hingebung der Arbeitsbienen an ihre Königin. Bei fast allen Missgeschicken dieser kleinen Republik, wenn einzelne Tafeln oder der ganze Bau durch menschliche Rohheit oder Unwissenheit zerstört werden, wenn das Volk durch Kälte, Hungersnöte oder Krankheiten dahingerafft wird, bleibt die Königin fast immer wohlbehalten und man findet sie lebend unter den Leichen ihrer treuen Töchter. Denn alle beschützen sie, erleichtern ihr die Flucht und schirmen sie mit ihrem eigenen Leibe, sparen für sie die bekömmlichste Nahrung und die letzten Honigtropfen. Und so lange sie am Leben ist, mag das Missgeschick noch so gross sein, die Verzweiflung bleibt der Stadt der Jungfrauen fern. Man mag ihnen
zwanzigmal hintereinander die Waben zertrümmern, die Brut und die Lebensmittel nehmen, man macht sie doch nicht irre an der Zukunft. Mögen sie gezehntet, halb verhungert sein und kaum noch so viele Überlebende zählen, dass sie ihre Mutter vor den Augen des Feindes verbergen können, sie werden doch die Ordnung im Bau wiederherstellen, werden so schnell wie möglich für Vorräte sorgen und sich nach den neuen Ansprüchen ihrer unglücklichen Lage in die Arbeit teilen. Und sie werden diese Arbeit mit einer Geduld, einem Eifer, einer Umsicht und Beharrlichkeit verrichten, die man in der Natur nicht oft findet, obgleich die Mehrzahl ihrer Bewohner mehr Mut und Zuversicht zu entwickeln pflegt, als der Mensch.
Es giebt tausend Beispiele für diese unbedingte Treue und Hingebung der Arbeitsbienen an ihre Königin. Bei fast allen Missgeschicken dieser kleinen Republik, wenn einzelne Tafeln oder der ganze Bau durch menschliche Rohheit oder Unwissenheit zerstört werden, wenn das Volk durch Kälte, Hungersnöte oder Krankheiten dahingerafft wird, bleibt die Königin fast immer wohlbehalten und man findet sie lebend unter den Leichen ihrer treuen Töchter. Denn alle beschützen sie, erleichtern ihr die Flucht und schirmen sie mit ihrem eigenen Leibe, sparen für sie die bekömmlichste Nahrung und die letzten Honigtropfen. Und so lange sie am Leben ist, mag das Missgeschick noch so gross sein, die Verzweiflung bleibt der Stadt der Jungfrauen fern. Man mag ihnen
zwanzigmal hintereinander die Waben zertrümmern, die Brut und die Lebensmittel nehmen, man macht sie doch nicht irre an der Zukunft. Mögen sie gezehntet, halb verhungert sein und kaum noch so viele Überlebende zählen, dass sie ihre Mutter vor den Augen des Feindes verbergen können, sie werden doch die Ordnung im Bau wiederherstellen, werden so schnell wie möglich für Vorräte sorgen und sich nach den neuen Ansprüchen ihrer unglücklichen Lage in die Arbeit teilen. Und sie werden diese Arbeit mit einer Geduld, einem Eifer, einer Umsicht und Beharrlichkeit verrichten, die man in der Natur nicht oft findet, obgleich die Mehrzahl ihrer Bewohner mehr Mut und Zuversicht zu entwickeln pflegt, als der Mensch.
Um der Verzweiflung vorzubeugen und die Arbeitslust wach zu erhalten, bedarf es nicht einmal des Vorhandenseins einer Königin: genug, wenn diese bei ihrem Scheiden die entfernteste Hoffnung auf Nachkommenschaft zurücklässt. »Wir haben«, sagt der ehrwürdige Langstroth, einer der Väter der modernen Bienenzucht, »ein Volk gesehen, das nicht Bienen genug zählte, um eine Fläche von zehn Quadratzentimetern zu bedecken, und doch suchte es eine Königin zu erziehen. Zwei volle Wochen gab es die Hoffnung nicht auf; endlich, als die Bienen auf die Hälfte reduziert waren, kroch die Königin aus, aber ihre Flügel waren so schwach, dass sie nicht fliegen konnte. Aber trotz ihrer Ohnmacht behandelten ihre Bienen sie nicht weniger ehrerbietig. Eine Woche darauf war nur noch ein Dutzend Bienen übrig und einige Tage später war die Königin verschwunden, einige verzweifelte Überlebende auf den Waben zurücklassend.«
 Noch eine Tatsache, die der Mensch in seiner unerhörten tyrannischen Einmischung an diesen unglücklichen, aber unerschütterlichen Heldinnen erprobt hat, ein Experiment, an dem sich die letzte Geberde der kindlichen Liebe und Selbstverleugnung beobachten lässt. Ich liess mir mehrmals aus Italien geschwängerte Königinnen kommen, wie dies jeder Bienenfreund thut, denn die italienische Rasse ist besser, kräftiger und fruchtbarer, sie ist emsiger und von sanfterer Gemütsart, als die einheimischen. Man verschickt sie in kleinen durchlöcherten Kästen, giebt ihnen etwas Nahrung und einige Arbeitsbienen mit, die nach Möglichkeit aus den höheren Altersstufen gewählt sind. (Das Alter der Bienen erkennt man ziemlich leicht an ihrem glatteren, mageren, fast kahlen Leib und vor allem an ihren abgenutzten und durch die Arbeit beschädigten Flügeln.) Diese Begleiterinnen haben die Aufgabe, sie zu ernähren, zu pflegen und während der Reise zu bewachen. In vielen Fällen kommt eine Reihe davon tot an. In einem Falle waren sogar alle verhungert, aber hier wie dort war die Königin unversehrt und kräftig, und die letzte ihrer Gefährtinnen war wahrscheinlich umgekommen, indem sie ihrer Herrin, der Verkörperung eines kostbareren und herrlicheren Lebens, als das eigene war, den letzten Honigtropfen gegeben hatte, den sie in der Tiefe ihrer Honigblase aufgespart hatte.
Noch eine Tatsache, die der Mensch in seiner unerhörten tyrannischen Einmischung an diesen unglücklichen, aber unerschütterlichen Heldinnen erprobt hat, ein Experiment, an dem sich die letzte Geberde der kindlichen Liebe und Selbstverleugnung beobachten lässt. Ich liess mir mehrmals aus Italien geschwängerte Königinnen kommen, wie dies jeder Bienenfreund thut, denn die italienische Rasse ist besser, kräftiger und fruchtbarer, sie ist emsiger und von sanfterer Gemütsart, als die einheimischen. Man verschickt sie in kleinen durchlöcherten Kästen, giebt ihnen etwas Nahrung und einige Arbeitsbienen mit, die nach Möglichkeit aus den höheren Altersstufen gewählt sind. (Das Alter der Bienen erkennt man ziemlich leicht an ihrem glatteren, mageren, fast kahlen Leib und vor allem an ihren abgenutzten und durch die Arbeit beschädigten Flügeln.) Diese Begleiterinnen haben die Aufgabe, sie zu ernähren, zu pflegen und während der Reise zu bewachen. In vielen Fällen kommt eine Reihe davon tot an. In einem Falle waren sogar alle verhungert, aber hier wie dort war die Königin unversehrt und kräftig, und die letzte ihrer Gefährtinnen war wahrscheinlich umgekommen, indem sie ihrer Herrin, der Verkörperung eines kostbareren und herrlicheren Lebens, als das eigene war, den letzten Honigtropfen gegeben hatte, den sie in der Tiefe ihrer Honigblase aufgespart hatte.
 Die Erkenntnis dieser unverbrüchlichen Hingebung hat dem Menschen den Weg gewiesen, wie er den wunderbaren politischen Sinn der Bienen, ihre Arbeitslust, ihre Beharrlichkeit, Hochherzigkeit und Liebe zur Zukunft, die aus dieser Hingebung hervorgehen oder darin einbegriffen sind, zu seinem Vorteil zu benutzen hat. Durch sie ist es ihm seit einigen Jahren gelungen, die wilden Bienen, ohne dass sie es ahnen, bis zu einem gewissen Grade zu zähmen; denn sie weichen keiner fremden Gewalt und noch in ihrer unbewussten Knechtschaft dienen sie nur ihren eignen Gesetzen. Der Mensch kann glauben, dass er mit der Königin die Seele und das Geschick des Schwarmes in Händen hält. Je nachdem er sie verwendet, je nachdem er sozusagen mit ihr spielt, kann er z. B. das Schwärmen hervorrufen oder verhüten, künstliche Schwärme machen, Schwärme vereinigen oder teilen und die Auswanderung der Völker regeln. Die Königin ist im Grunde eine Art von lebendigem Symbol, das, wie alle Symbole, ein weniger sichtbares und allgemeineres Prinzip vertritt, und der Imker muss sich dessen wohl bewusst werden, wenn er sich nicht mancherlei Misserfolgen aussetzen will. Übrigens täuschen sich die Bienen keineswegs über ihre Königin und verlieren nie aus den Augen, dass hinter ihrer sichtbaren und kurzlebigen Gebieterin eine höhere, beharrende, geistige Macht steht, das ist ihr herrschender Gedanke. Ob dieser Gedanke bewusst oder unbewusst ist, darauf kommt es nur dann an,
wenn wir die Bienen, die ihn haben, oder die Natur, die ihn in sie gelegt hat, insbesondere bewundern wollen. Wo er aber auch seinen Sitz hat, dieser herrschende Gedanke, in den kleinen zarten Bienenleibern oder in dem grossen unerkennbaren Weltkörper, er ist unserer Beachtung wert, und wenn wir uns nebenbei gesagt davor hüteten, unsre Bewunderung gewohnheitsmässig von örtlichen Nebenumständen abhängig zu machen, oder von der Herkunft eines Dinges, so würden wir nicht so oft die Gelegenheit versäumen, unsre Augen voll Bewunderung zu öffnen; denn nichts ist heilsamer, als sie so zu öffnen.
Die Erkenntnis dieser unverbrüchlichen Hingebung hat dem Menschen den Weg gewiesen, wie er den wunderbaren politischen Sinn der Bienen, ihre Arbeitslust, ihre Beharrlichkeit, Hochherzigkeit und Liebe zur Zukunft, die aus dieser Hingebung hervorgehen oder darin einbegriffen sind, zu seinem Vorteil zu benutzen hat. Durch sie ist es ihm seit einigen Jahren gelungen, die wilden Bienen, ohne dass sie es ahnen, bis zu einem gewissen Grade zu zähmen; denn sie weichen keiner fremden Gewalt und noch in ihrer unbewussten Knechtschaft dienen sie nur ihren eignen Gesetzen. Der Mensch kann glauben, dass er mit der Königin die Seele und das Geschick des Schwarmes in Händen hält. Je nachdem er sie verwendet, je nachdem er sozusagen mit ihr spielt, kann er z. B. das Schwärmen hervorrufen oder verhüten, künstliche Schwärme machen, Schwärme vereinigen oder teilen und die Auswanderung der Völker regeln. Die Königin ist im Grunde eine Art von lebendigem Symbol, das, wie alle Symbole, ein weniger sichtbares und allgemeineres Prinzip vertritt, und der Imker muss sich dessen wohl bewusst werden, wenn er sich nicht mancherlei Misserfolgen aussetzen will. Übrigens täuschen sich die Bienen keineswegs über ihre Königin und verlieren nie aus den Augen, dass hinter ihrer sichtbaren und kurzlebigen Gebieterin eine höhere, beharrende, geistige Macht steht, das ist ihr herrschender Gedanke. Ob dieser Gedanke bewusst oder unbewusst ist, darauf kommt es nur dann an,
wenn wir die Bienen, die ihn haben, oder die Natur, die ihn in sie gelegt hat, insbesondere bewundern wollen. Wo er aber auch seinen Sitz hat, dieser herrschende Gedanke, in den kleinen zarten Bienenleibern oder in dem grossen unerkennbaren Weltkörper, er ist unserer Beachtung wert, und wenn wir uns nebenbei gesagt davor hüteten, unsre Bewunderung gewohnheitsmässig von örtlichen Nebenumständen abhängig zu machen, oder von der Herkunft eines Dinges, so würden wir nicht so oft die Gelegenheit versäumen, unsre Augen voll Bewunderung zu öffnen; denn nichts ist heilsamer, als sie so zu öffnen.
 Vielleicht wird man sagen, dass dies sehr gewagte und allzumenschliche Annahmen sind, dass die Bienen wahrscheinlich keinen Gedanken dieser Art haben und dass die Begriffe Zukunft, Liebe zur Rasse und viele andre, die wir ihnen andichten, im Grunde weiter nichts sind, als die Formen, welche der Selbsterhaltungstrieb, die Furcht vor Schmerz und Tod oder der Lustreiz bei ihnen annehmen. Ich gebe zu, dass dies alles nur eine Ausdrucksweise ist und darum messe ich ihm auch keinen allzugrossen Wert bei. Das Einzige, was in diesem Falle – wie in allen andern Fällen – sicher feststeht, ist die Thatsache, dass die Bienen unter den und den Verhältnissen sich gegen ihre Königin so und so benehmen. Der Rest ist ein Mysterium, über das man nur Vermutungen haben kann, die mehr oder weniger annehmbar, mehr oder weniger zutreffend sind. Aber
wenn wir von den Menschen so sprächen, wie es vielleicht klug wäre, von den Bienen zu sprechen, hätten wir dann wohl das Recht, mehr zu sagen? Auch wir gehorchen nur den Notwendigkeiten des Lebens, dem Lustreiz oder der Furcht vor Schmerz und Tod, und was wir unsern Verstand nennen, das hat den gleichen Ursprung und den gleichen Zweck wie das, was wir bei den Tieren Instinkt nennen. Wir vollziehen gewisse Akte, deren Folgen wir zu kennen meinen, wir unterliegen anderen, deren Gründe wir uns besser zu kennen schmeicheln, als sie selbst; aber abgesehen davon, dass diese Annahme durchaus nicht unanfechtbar dasteht, sind solche Akte unerheblich und im Vergleich mit der Unzahl der übrigen selten, und alle, die bestbekannten und die unbekanntesten, die kleinsten und die gewaltigsten, vollziehen sich in einer undurchdringlichen Nacht, in der wir fast ebenso blind sind, wie nach unserer Meinung die Bienen.
Vielleicht wird man sagen, dass dies sehr gewagte und allzumenschliche Annahmen sind, dass die Bienen wahrscheinlich keinen Gedanken dieser Art haben und dass die Begriffe Zukunft, Liebe zur Rasse und viele andre, die wir ihnen andichten, im Grunde weiter nichts sind, als die Formen, welche der Selbsterhaltungstrieb, die Furcht vor Schmerz und Tod oder der Lustreiz bei ihnen annehmen. Ich gebe zu, dass dies alles nur eine Ausdrucksweise ist und darum messe ich ihm auch keinen allzugrossen Wert bei. Das Einzige, was in diesem Falle – wie in allen andern Fällen – sicher feststeht, ist die Thatsache, dass die Bienen unter den und den Verhältnissen sich gegen ihre Königin so und so benehmen. Der Rest ist ein Mysterium, über das man nur Vermutungen haben kann, die mehr oder weniger annehmbar, mehr oder weniger zutreffend sind. Aber
wenn wir von den Menschen so sprächen, wie es vielleicht klug wäre, von den Bienen zu sprechen, hätten wir dann wohl das Recht, mehr zu sagen? Auch wir gehorchen nur den Notwendigkeiten des Lebens, dem Lustreiz oder der Furcht vor Schmerz und Tod, und was wir unsern Verstand nennen, das hat den gleichen Ursprung und den gleichen Zweck wie das, was wir bei den Tieren Instinkt nennen. Wir vollziehen gewisse Akte, deren Folgen wir zu kennen meinen, wir unterliegen anderen, deren Gründe wir uns besser zu kennen schmeicheln, als sie selbst; aber abgesehen davon, dass diese Annahme durchaus nicht unanfechtbar dasteht, sind solche Akte unerheblich und im Vergleich mit der Unzahl der übrigen selten, und alle, die bestbekannten und die unbekanntesten, die kleinsten und die gewaltigsten, vollziehen sich in einer undurchdringlichen Nacht, in der wir fast ebenso blind sind, wie nach unserer Meinung die Bienen.
 »Man muss gestehen«, sagt Buffon, der gegen die Bienen eine höchst spasshafte Abneigung hat, »man muss gestehen, dass diese Tiere einzeln genommen weniger Witz haben als der Hund, der Affe und die meisten anderen Wesen. Man muss gestehen, dass sie weniger gelehrig und anhänglich sind und weniger Gemüt, kurz, weniger menschenähnliche Eigenschaften besitzen, und ferner, dass ihr anscheinender Verstand nur von ihrer vereinigten Masse kommt. Doch setzt diese Vereinigung selbst keinerlei Verstand voraus, denn sie vereinigen sich keineswegs aus moralischen
Absichten, sie finden sich ohne ihre Einwilligung zusammen. Ihr »Staat« ist also nur eine physische Versammlung, von der Natur angeordnet und ohne irgendwelche Bewusstheit und Überlegung entstanden. Die Königin gebiert zehntausend Stück auf einmal und am nämlichen Fleck, also müssen diese zehntausend Stück, auch wenn sie noch tausendmal stumpfsinniger sein mögen, als ich annehme, sich um der blossen Lebenserhaltung willen irgendwie zusammenthun, und da sie alle miteinander mit denselben Kräften ausgerüstet sind, so müssen sie gerade durch den Schaden, den sie sich anfangs etwa thun, bald dahin kommen, sich möglichst wenig zu schaden, d. h. sich zu helfen; sie erwecken infolgedessen den Anschein eines Einvernehmens und eines gemeinsamen Zieles; wer sie beobachtet, wird ihnen also leicht Absichten und den Geist, der ihnen gerade fehlt, unterschieben, er wird bemüht sein, für jede Handlung eine Ursache zu entdecken, jede Bewegung wird bald einen Beweggrund haben, und daraus werden dann Vernunft-Ungeheuer oder Wundertiere ohne Gleichen; denn diese zehntausend Stück, die alle zugleich zur Welt gekommen sind, die zusammen gewohnt haben und fast alle zugleich die Metamorphose durchgemacht haben, können nicht umhin, alle dasselbe zu thun und, wenn sie auch noch so wenig Gemüt haben, die gleichen Gewohnheiten anzunehmen, sich in die Arbeit zu teilen und in dieser Gemeinschaft sich wohl zu fühlen, sich um ihre Wohnung zu kümmern, nach dem Ausfluge wieder zurückzukehren u. s. w. Daher kommt auch die Architektur, die Geometrie, die Ordnung, die
Voraussicht und Heimatsliebe, mit einem Wort: die Republik und das, wie man sieht, auf der Bewunderung des Beobachters beruhende Ganze.«
»Man muss gestehen«, sagt Buffon, der gegen die Bienen eine höchst spasshafte Abneigung hat, »man muss gestehen, dass diese Tiere einzeln genommen weniger Witz haben als der Hund, der Affe und die meisten anderen Wesen. Man muss gestehen, dass sie weniger gelehrig und anhänglich sind und weniger Gemüt, kurz, weniger menschenähnliche Eigenschaften besitzen, und ferner, dass ihr anscheinender Verstand nur von ihrer vereinigten Masse kommt. Doch setzt diese Vereinigung selbst keinerlei Verstand voraus, denn sie vereinigen sich keineswegs aus moralischen
Absichten, sie finden sich ohne ihre Einwilligung zusammen. Ihr »Staat« ist also nur eine physische Versammlung, von der Natur angeordnet und ohne irgendwelche Bewusstheit und Überlegung entstanden. Die Königin gebiert zehntausend Stück auf einmal und am nämlichen Fleck, also müssen diese zehntausend Stück, auch wenn sie noch tausendmal stumpfsinniger sein mögen, als ich annehme, sich um der blossen Lebenserhaltung willen irgendwie zusammenthun, und da sie alle miteinander mit denselben Kräften ausgerüstet sind, so müssen sie gerade durch den Schaden, den sie sich anfangs etwa thun, bald dahin kommen, sich möglichst wenig zu schaden, d. h. sich zu helfen; sie erwecken infolgedessen den Anschein eines Einvernehmens und eines gemeinsamen Zieles; wer sie beobachtet, wird ihnen also leicht Absichten und den Geist, der ihnen gerade fehlt, unterschieben, er wird bemüht sein, für jede Handlung eine Ursache zu entdecken, jede Bewegung wird bald einen Beweggrund haben, und daraus werden dann Vernunft-Ungeheuer oder Wundertiere ohne Gleichen; denn diese zehntausend Stück, die alle zugleich zur Welt gekommen sind, die zusammen gewohnt haben und fast alle zugleich die Metamorphose durchgemacht haben, können nicht umhin, alle dasselbe zu thun und, wenn sie auch noch so wenig Gemüt haben, die gleichen Gewohnheiten anzunehmen, sich in die Arbeit zu teilen und in dieser Gemeinschaft sich wohl zu fühlen, sich um ihre Wohnung zu kümmern, nach dem Ausfluge wieder zurückzukehren u. s. w. Daher kommt auch die Architektur, die Geometrie, die Ordnung, die
Voraussicht und Heimatsliebe, mit einem Wort: die Republik und das, wie man sieht, auf der Bewunderung des Beobachters beruhende Ganze.«
Diese Art, unsere Bienen zu erklären, ist freilich eine ganz andere. Sie kann auf den ersten Blick als natürlicher erscheinen, aber sollte sie nicht gerade, weil sie so einfach klingt, garnichts erklären? Ich übergehe die sachlichen Irrtümer der eben zitierten Worte; aber wenn man sagt, sie passten sich, indem sie sich möglichst wenig schadeten, den Notwendigkeiten des gemeinsamen Lebens an, setzt man dann nicht eine gewisse Intelligenz voraus und zwar eine, die um so beträchtlicher erscheinen muss, je genauer man zusieht, auf welche Weise diese »zehntausend Stück« sich zu schaden vermeiden und sich zu helfen wissen? Ist das nicht ebensogut unsere eigene Geschichte, die der alte ärgerliche Naturforscher da erzählt, und lässt sie sich nicht ganz genau auf alle unsere menschlichen Gesellschaften anwenden? Unsere Weisheit, unsere Tugenden, unsere Politik sind weiter nichts als die Früchte der herben Notwendigkeit, die unsere Einbildungskraft vergoldet hat; sie haben keinen anderen Zweck, als unsere Selbstsucht nutzbar zu machen und die ursprünglich schädliche Thätigkeit der Einzelwesen zum gemeinsamen Heile zu wenden. Und dann, um es noch einmal zu sagen: wenn man den Bienen jeden Gedanken, jedes Gefühl abspricht, das wir ihnen zugelegt haben: was liegt schliesslich an dem Gegenstande unserer Bewunderung? Wenn man es für unvernünftig hält, die Bienen zu bewundern, so können wir ja die Natur bewundern; es wird allemal ein Augenblick kommen, wo man uns unsere Bewunderung nicht mehr rauben kann, und wir werden dann nichts verloren haben, indem wir warteten und zurückwichen.
 Wie dem aber auch sei, und um unsere Annahme nicht fallen zu lassen, denn sie hat wenigstens den Vorzug, gewisse mit der Wirklichkeit in Beziehung stehende Thatsachen auch in unserem Geiste in Beziehung zu setzen, so ist es unstreitig weit mehr das unendliche Fortbestehen ihrer Rasse, was die Bienen in ihrer Königin anbeten, als die Königin selbst. Die Bienen sind keineswegs empfindsam, und wenn eine von ihnen mit so schweren Verletzungen von der Arbeit heimkommt, dass sie für dauernd arbeitsunfähig erachtet werden muss, so wird sie ohne Erbarmen verjagt. Und doch kann man nicht sagen, dass sie jeder persönlichen Anhänglichkeit an ihre Mutter bar sind. Sie erkennen sie unter allen anderen heraus. Selbst wenn sie alt, elend und gelähmt ist, werden die Wachen am Eingang keiner unbekannten Königin Einlass gewähren, so jung, schön und fruchtbar sie auch scheinen mag. Es ist dies freilich einer der Fundamentalgrundsätze ihrer Polizei, und nur in der grossen Trachtzeit wird er zu gunsten einiger fremden Arbeitsbienen aufgegeben, vorausgesetzt, dass diese mit Vorräten wohl beladen sind. – Wird sie schliesslich völlig unfruchtbar, so wird sie ersetzt, indem eine gewisse Zahl von jungen Königinnen erzogen wird. Was aber geschieht mit der alten Herrin? Man weiss es nicht genau, aber es begegnet dem Bienenzüchter bisweilen, dass er
auf den Waben eines Bienenstockes eine prachtvolle Königin in der Blüte ihres Alters findet, und ganz im Grunde in einer dunklen Ecke die alte »Herrin«, wie sie in der Normandie heisst, abgemagert und gelähmt. Wie es scheint, haben sie sie in diesem Falle bis zuletzt gegen den Hass ihrer jugendstarken Rivalin geschützt, die ihren Tod will, denn die Königinnen haben stets einen unbezwinglichen Abscheu vor einander und stürzen auf einander los, sobald zwei unter demselben Dache vereinigt sind. Man ist also zu der Annahme geneigt, dass sie der alten Königin eine Art von friedlichem und bescheidenem Alterssitz in einem entfernten Eckchen des Stockes sichern, wo sie ihre Tage in Frieden beschliessen kann. Es ist dies eines der tausend Wunder dieses Wachskönigreiches, und wir können wieder einmal feststellen, dass die Politik und die Lebensgewohnheiten der Bienen nichts Fatalistisches und Engherziges an sich haben, und dass sie vielen weit verborgeneren Gesetzen gehorchen, als wir zu kennen wähnen.
Wie dem aber auch sei, und um unsere Annahme nicht fallen zu lassen, denn sie hat wenigstens den Vorzug, gewisse mit der Wirklichkeit in Beziehung stehende Thatsachen auch in unserem Geiste in Beziehung zu setzen, so ist es unstreitig weit mehr das unendliche Fortbestehen ihrer Rasse, was die Bienen in ihrer Königin anbeten, als die Königin selbst. Die Bienen sind keineswegs empfindsam, und wenn eine von ihnen mit so schweren Verletzungen von der Arbeit heimkommt, dass sie für dauernd arbeitsunfähig erachtet werden muss, so wird sie ohne Erbarmen verjagt. Und doch kann man nicht sagen, dass sie jeder persönlichen Anhänglichkeit an ihre Mutter bar sind. Sie erkennen sie unter allen anderen heraus. Selbst wenn sie alt, elend und gelähmt ist, werden die Wachen am Eingang keiner unbekannten Königin Einlass gewähren, so jung, schön und fruchtbar sie auch scheinen mag. Es ist dies freilich einer der Fundamentalgrundsätze ihrer Polizei, und nur in der grossen Trachtzeit wird er zu gunsten einiger fremden Arbeitsbienen aufgegeben, vorausgesetzt, dass diese mit Vorräten wohl beladen sind. – Wird sie schliesslich völlig unfruchtbar, so wird sie ersetzt, indem eine gewisse Zahl von jungen Königinnen erzogen wird. Was aber geschieht mit der alten Herrin? Man weiss es nicht genau, aber es begegnet dem Bienenzüchter bisweilen, dass er
auf den Waben eines Bienenstockes eine prachtvolle Königin in der Blüte ihres Alters findet, und ganz im Grunde in einer dunklen Ecke die alte »Herrin«, wie sie in der Normandie heisst, abgemagert und gelähmt. Wie es scheint, haben sie sie in diesem Falle bis zuletzt gegen den Hass ihrer jugendstarken Rivalin geschützt, die ihren Tod will, denn die Königinnen haben stets einen unbezwinglichen Abscheu vor einander und stürzen auf einander los, sobald zwei unter demselben Dache vereinigt sind. Man ist also zu der Annahme geneigt, dass sie der alten Königin eine Art von friedlichem und bescheidenem Alterssitz in einem entfernten Eckchen des Stockes sichern, wo sie ihre Tage in Frieden beschliessen kann. Es ist dies eines der tausend Wunder dieses Wachskönigreiches, und wir können wieder einmal feststellen, dass die Politik und die Lebensgewohnheiten der Bienen nichts Fatalistisches und Engherziges an sich haben, und dass sie vielen weit verborgeneren Gesetzen gehorchen, als wir zu kennen wähnen.
 Aber wir kreuzen alle Augenblicke die Naturgesetze, die den Bienen unerschütterlich erscheinen müssen. Wir versetzen sie alle Tage in die Lage, in der wir uns selbst sehen würden, wenn jemand plötzlich die Gesetze der Schwerkraft, des Lichtes und des Todes aufhöbe.
Aber wir kreuzen alle Augenblicke die Naturgesetze, die den Bienen unerschütterlich erscheinen müssen. Wir versetzen sie alle Tage in die Lage, in der wir uns selbst sehen würden, wenn jemand plötzlich die Gesetze der Schwerkraft, des Lichtes und des Todes aufhöbe.
Was werden sie z. B. thun, wenn man dem Stocke durch List oder Gewalt eine zweite Königin beisetzt? Von Natur ist dieser Fall nie eingetreten, seit Bienen leben, dafür sorgen die Wachen am Eingang. Sie verlieren den Verstand indes nicht, sondern wissen die zwei Grundsätze, die sie wie Göttergebote zu achten scheinen, in einer wunderbaren Weise zu vereinigen. Der eine dieser Grundsätze ist der der ungeteilten Mutterschaft einer Königin, ein unverbrüchlicher Grundsatz, ausser wenn die herrschende Königin unfruchtbar ist (und auch in diesem Falle nur ganz ausnahmsweise). Der zweite ist noch sonderbarer, denn wenn er auch nicht übertreten werden darf, so lässt er sich sozusagen doch beugen. Es ist dies das Prinzip der Unverletzlichkeit jeder königlichen Person. Es wäre den Bienen ein leichtes, die Eingedrungene mit ihren tausend Giftstacheln zu durchbohren, sie würde auf der Stelle tot sein und sie hätten ihren Leichnam nur aus dem Bau zu schaffen. Aber obwohl ihr Stachel stets kampfbereit ist, obwohl sie ihn jeden Augenblick gebrauchen, um innere Zwistigkeiten auszufechten, die Drohnen oder die Schmarotzer des Bienenstockes zu töten, so brauchen sie ihn nie gegen eine Königin, ebenso wie die Königin den ihren nie gegen Menschen, Tiere oder Arbeitsbienen zückt: sie zieht ihre königliche Waffe, die nicht gerade ist, wie bei den Arbeitsbienen, sondern gekrümmt, wie ein Türkensäbel, nur im Kampfe mit ihresgleichen, d. h. gegen eine andere Königin.
Keine Biene wagt also, wie es scheint, einen unmittelbaren, blutigen Königsmord auf sich zu nehmen, und so suchen sie in allen Fällen, wo Ordnung und Gedeihen ihrer Republik den Tod der einen Königin erheischen, diesem Tode den Anschein eines natürlichen zu geben: sie teilen das Verbrechen in tausend Teile, und so wird es anonym.
Sie schliessen dann die Eingedrungene in einen dichten Knäuel ein und bilden eine Art von lebendem Kerker um sie, in dem sie sich nicht rühren kann, bis sie nach vierundzwanzig Stunden verhungert oder erstickt ist. Erscheint inzwischen aber die rechtmässige Königin und wagt den Kampf gegen die Nebenbuhlerin, so öffnen sich alsbald die lebendigen Kerkerwände, die Bienen ziehen sich zurück und schliessen um die beiden Gegnerinnen einen Kreis, ohne sich an dem Kampfe zu beteiligen. Aufmerksam, aber unparteiisch verfolgen sie diesen eigentümlichen Zweikampf, denn nur eine Mutter darf den Stachel gegen eine Mutter erheben, und nur die, welche zwei Millionen Leben in ihren Weichen birgt, scheint das Recht zu haben, mit einem Streiche zwei Millionen zu töten. Wenn aber der Kampf unentschieden bleibt, wenn die zwei gekrümmten Stachel an den schweren Chitinpanzern machtlos abgleiten, so wird die, welche Miene macht zu fliehen, die rechtmässige sowohl wie die fremde, ergriffen und wieder in den lebenden Kerker eingeschlossen, bis sie die Absicht kundgiebt, den Kampf von neuem aufzunehmen. Es muss übrigens noch hinzugefügt werden, dass bei den zahlreichen Versuchen dieser Art die regierende Königin fast immer Siegerin bleibt, sei es, dass sie im Gefühl zu Hause zu sein, mehr Wagemut und Kraft hat, als die andre, sei es, dass die Bienen nur im Augenblick des Kampfes unparteiisch, hingegen in der Art, wie sie die beiden Rivalinnen einschliessen, ziemlich parteiisch sind, denn ihre Mutter scheint unter ihrer Einkerkerung keineswegs zu leiden, aber die Fremde geht fast immer sichtlich gelähmt und zerquetscht daraus hervor.
 Ein einfaches Experiment zeigt besser als alles andere, dass die Bienen ihre Königin wiedererkennen und eine wirkliche Anhänglichkeit an sie haben. Nimmt man einem Bienenstocke die Königin, so sieht man bald alle die Kundgebungen der Unruhe und Trübsal eintreten, die ich in einem früheren Kapitel beschrieben habe. Lässt man nach einigen Stunden dieselbe Königin wieder ein, so kommen alle ihre Töchter ihr huldigend entgegen und bieten ihr Honig dar. Die einen bilden Spalier vor ihr, die andern »präsentieren« in grossen unbeweglichen Halbkreisen um sie herum, d. h. sie senken den Kopf, halten den Hinterleib hoch und schwirren dabei in eigentümlich zitternder Weise mit den Flügeln. Dieses sonderbare Gebaren ist der Ausdruck ihrer Freude über die glückliche Heimkehr und bedeutet in ihrem Hofceremoniell anscheinend feierliche Verehrung oder höchstes Wohlbehagen. Aber man glaube nicht, man könnte sie täuschen und statt der rechtmässigen Königin eine fremde einführen. Wenn diese kaum einige Schritte vorwärts gemacht hat, so laufen die Arbeitsbienen von allen Seiten entrüstet zusammen. Sie wird auf der Stelle umringt, in das furchtbare Getümmel des Schwarms eingekerkert und darin gefangen gehalten, bis sie stirbt,
denn in diesem besonderen Falle kommt es fast nie vor, dass sie lebend entrinnt.
Ein einfaches Experiment zeigt besser als alles andere, dass die Bienen ihre Königin wiedererkennen und eine wirkliche Anhänglichkeit an sie haben. Nimmt man einem Bienenstocke die Königin, so sieht man bald alle die Kundgebungen der Unruhe und Trübsal eintreten, die ich in einem früheren Kapitel beschrieben habe. Lässt man nach einigen Stunden dieselbe Königin wieder ein, so kommen alle ihre Töchter ihr huldigend entgegen und bieten ihr Honig dar. Die einen bilden Spalier vor ihr, die andern »präsentieren« in grossen unbeweglichen Halbkreisen um sie herum, d. h. sie senken den Kopf, halten den Hinterleib hoch und schwirren dabei in eigentümlich zitternder Weise mit den Flügeln. Dieses sonderbare Gebaren ist der Ausdruck ihrer Freude über die glückliche Heimkehr und bedeutet in ihrem Hofceremoniell anscheinend feierliche Verehrung oder höchstes Wohlbehagen. Aber man glaube nicht, man könnte sie täuschen und statt der rechtmässigen Königin eine fremde einführen. Wenn diese kaum einige Schritte vorwärts gemacht hat, so laufen die Arbeitsbienen von allen Seiten entrüstet zusammen. Sie wird auf der Stelle umringt, in das furchtbare Getümmel des Schwarms eingekerkert und darin gefangen gehalten, bis sie stirbt,
denn in diesem besonderen Falle kommt es fast nie vor, dass sie lebend entrinnt.
Es ist darum auch sehr schwierig für den Bienenzüchter, Königinnen zu ersetzen. Es ist eigentümlich zu sehen, zu welchen Kniffen und komplizierten Listen der Mensch greifen muss, um seinen Willen durchzusetzen und diese kleinen klugen, aber stets im besten Glauben lebenden Insekten irrezuführen, die mit rührendem Mute die unverhofftesten Ereignisse annehmen und augenscheinlich nichts anderes in ihnen sehen, als eine neue unvermeidliche Laune der Natur. Auf jeden Fall rechnet der Mensch bei all seiner List und bei der trostlosen Verwirrung, die er mit seinen gewagten Manövern oft anrichtet, allemal auf den wunderbaren praktischen Sinn der Bienen, auf den unerschöpflichen Schatz ihrer Gesetze und merkwürdigen Gewohnheiten, auf ihre Ordnungs- und Friedensliebe, ihren Gemeinsinn, ihre Treue gegen die Zukunft, ihre so geschickte Charakterfestigkeit und ihren so selbstlosen Ernst, vor allem aber auf ihre unermüdliche Pflichterfüllung. Doch die Einzelheiten dieses Verfahrens gehören in das Gebiet der eigentlichen Bienenzucht und würden uns hier zu weit führen. Man setzt eine fremde Königin gewöhnlich in einem kleinen Käfig aus Eisendrähten bei, den man zwischen zwei Waben aufhängt. Die Thüröffnung wird mit Wachs und Honig verschlossen, den die Bienen, wenn ihr Zorn verraucht ist, fortnagen. Die so befreite Gefangene wird von ihnen oft wohlwollend aufgenommen. Mr. S. Simmins, der Leiter der grossen Bienenwirtschaft von Rottingdean, hat kürzlich eine andere Methode gefunden, die ausserordentlich leicht zu befolgen und fast immer erfolgreich ist, weshalb sie auch bei den gewissenhaften Bienenwirten immer mehr Verbreitung findet. Die Schwierigkeit bei der Einführung von Königinnen liegt nämlich in dem Benehmen der Königin selbst. Sie ist aufgeregt, flieht, verbirgt sich, gebärdet sich wie ein Eindringling und erweckt dadurch den Verdacht der Arbeitsbienen, der sich nach näherer Prüfung alsbald bestätigt. Mr. Simmins isoliert darum die beizusetzende Königin vollständig und lässt sie eine halbe Stunde fasten. Dann lüftet er die Innendecke des weisellosen Stockes ein wenig und setzt die fremde Königin auf das oberste Ende einer Wabe. Die vorangegangene Einsamkeit hat sie so unglücklich gemacht, dass sie jetzt froh ist, sich wieder unter Bienen zu sehen, und in ihrem Hunger die ihr dargebotene Nahrung begierig annimmt. Die Arbeitsbienen lassen sich durch ihr sicheres Auftreten täuschen und stellen keine Untersuchung an. Sie bilden sich vielleicht ein, dass ihre alte Herrin wiedergekehrt ist, und nehmen sie mit Freuden auf. Aus diesem Experiment scheint hervorzugehen, dass sie, im Gegensatz zu Huber und allen Beobachtern, ihre Königin nicht wieder zu erkennen vermögen. Wie dem aber auch sei, die beiden Erklärungen sind gleich annehmbar, wenn die Wahrheit vielleicht auch in einer dritten liegen mag, die uns noch nicht bekannt ist, und jedenfalls zeigen sie wieder einmal, wie verwickelt und unklar die Psychologie der Bienen noch ist. Und es lässt sich, wie aus allen Lebensfragen, auch hieraus nur der eine Schluss ziehen, dass wir in Ermangelung eines Besseren die Wissbegier in unserm Busen walten lassen müssen.
 Was aber die persönliche Anhänglichkeit betrifft, mit der ich hier zu Ende kommen möchte, so scheint es gewiss, dass sie vorhanden ist, ebenso gewiss aber, dass sie nicht lange im Gedächtnis bleibt, und wenn man eine Mutter, die mehrere Tage verschwunden war, wieder in ihr Reich einsetzen will, so wird sie
von ihren erbitterten Kindern derart behandelt, dass man sich beeilen muss, sie der tötlichen Einkerkerung zu entziehen, welche das Los der fremden Königinnen ist. Denn sie haben inzwischen Zeit gehabt, ein Dutzend Zellen für Arbeitsbienen in solche für Königinnen umzubauen, und die Zukunft des Volkes steht nicht mehr auf dem Spiele. Ihre Anhänglichkeit nimmt also in dem Masse zu oder ab, inwieweit die Königin diese Zukunft vertritt. So sieht man, wenn eine Königin die gefährliche Zeremonie des Hochzeitsausfluges vollzieht, ihre Unterthanen häufig so besorgt, sie möchte verloren gehen, dass sie sie auf diesem tragischen Liebesfluge, von dem ich späterhin reden werde, begleiten. Das thun sie aber nie, wenn man ihnen ein Stück Zellenbau gegeben hat, der junge Brutzellen enthält, weil sie dann die Aussicht haben, andere Mütter aufzuziehen. Die Anhänglichkeit kann sogar in Wut und Hass umschlagen, wenn ihre Herrin nicht alle ihre Pflichten gegen jene abstrakte Gottheit erfüllt, die man die künftige Gesellschaft nennen könnte und die sie höher zu verehren scheinen, als wir. So hat man die Königin z. B. aus verschiedenen Gründen am Schwärmen gehindert, indem man ein Gitter am Flugloch anbrachte, durch das die dünnen und gelenken Arbeitsbienen ahnungslos hindurchschlüpften, während die arme Sklavin der Liebe mit ihrem beträchtlich schwereren und umfangreicheren Körper nicht hindurchkonnte. Beim ersten Ausflug merkten die Bienen, dass sie ihnen nicht gefolgt war, kehrten in die alte Wohnung zurück und stiessen, drängten und misshandelten die unglückliche Gefangene, die
sie ohne Zweifel der Trägheit anklagten oder für etwas geistesschwach hielten, auf eine sehr unzweideutige Weise. Beim zweiten Ausflug schien ihr böser Wille festzustehen, der Zorn wuchs und die Ausschreitungen wurden ernster. Endlich beim dritten Ausflug waren sie der Meinung, dass sie ihrem Lose und der Zukunft der Rasse für immer untreu geworden war, und verurteilten sie zum Tode in dem königlichen Gefängnis.
Was aber die persönliche Anhänglichkeit betrifft, mit der ich hier zu Ende kommen möchte, so scheint es gewiss, dass sie vorhanden ist, ebenso gewiss aber, dass sie nicht lange im Gedächtnis bleibt, und wenn man eine Mutter, die mehrere Tage verschwunden war, wieder in ihr Reich einsetzen will, so wird sie
von ihren erbitterten Kindern derart behandelt, dass man sich beeilen muss, sie der tötlichen Einkerkerung zu entziehen, welche das Los der fremden Königinnen ist. Denn sie haben inzwischen Zeit gehabt, ein Dutzend Zellen für Arbeitsbienen in solche für Königinnen umzubauen, und die Zukunft des Volkes steht nicht mehr auf dem Spiele. Ihre Anhänglichkeit nimmt also in dem Masse zu oder ab, inwieweit die Königin diese Zukunft vertritt. So sieht man, wenn eine Königin die gefährliche Zeremonie des Hochzeitsausfluges vollzieht, ihre Unterthanen häufig so besorgt, sie möchte verloren gehen, dass sie sie auf diesem tragischen Liebesfluge, von dem ich späterhin reden werde, begleiten. Das thun sie aber nie, wenn man ihnen ein Stück Zellenbau gegeben hat, der junge Brutzellen enthält, weil sie dann die Aussicht haben, andere Mütter aufzuziehen. Die Anhänglichkeit kann sogar in Wut und Hass umschlagen, wenn ihre Herrin nicht alle ihre Pflichten gegen jene abstrakte Gottheit erfüllt, die man die künftige Gesellschaft nennen könnte und die sie höher zu verehren scheinen, als wir. So hat man die Königin z. B. aus verschiedenen Gründen am Schwärmen gehindert, indem man ein Gitter am Flugloch anbrachte, durch das die dünnen und gelenken Arbeitsbienen ahnungslos hindurchschlüpften, während die arme Sklavin der Liebe mit ihrem beträchtlich schwereren und umfangreicheren Körper nicht hindurchkonnte. Beim ersten Ausflug merkten die Bienen, dass sie ihnen nicht gefolgt war, kehrten in die alte Wohnung zurück und stiessen, drängten und misshandelten die unglückliche Gefangene, die
sie ohne Zweifel der Trägheit anklagten oder für etwas geistesschwach hielten, auf eine sehr unzweideutige Weise. Beim zweiten Ausflug schien ihr böser Wille festzustehen, der Zorn wuchs und die Ausschreitungen wurden ernster. Endlich beim dritten Ausflug waren sie der Meinung, dass sie ihrem Lose und der Zukunft der Rasse für immer untreu geworden war, und verurteilten sie zum Tode in dem königlichen Gefängnis.
 Man sieht, dieser Zukunft ist alles mit einer Voraussicht, einer Einstimmigkeit, einer Unbeugsamkeit und Geschicklichkeit im Auslegen und Benutzen der Umstände untergeordnet, dass man vor Bewunderung starr ist, wenn man bedenkt, wie unverhofft und übernatürlich unser Eingreifen den Bienen erscheinen muss. Man wird vielleicht sagen, dass sie sich in diesem Falle das Unvermögen der Königin, ihnen zu folgen, sehr schlecht deuten. Aber würden wir viel hellsichtiger sein, wenn ein anders gearteter Verstand in Verbindung mit einem so riesenhaften Körper, dass seine Bewegungen fast ebenso unfasslich sind, wie die einer Naturerscheinung, sich das Vergnügen machte, uns Fallen gleicher Art zu stellen? Haben wir nicht einige tausend Jahre gebraucht, um eine einigermassen annehmbare Erklärung für den Blitzstrahl zu finden? Jeder Intellekt ist mit Langsamkeit geschlagen, wenn er aus seiner eng begrenzten Wirkungssphäre heraustritt und sich Vorgängen gegenüber sieht, zu denen er nicht den Anstoss gegeben hat. Ausserdem ist nicht gesagt, dass die Bienen,
wenn man das Experiment mit dem Gitter fortsetzen und verallgemeinern würde, nicht schliesslich doch dahinterkämen und einen Ausweg fänden. Sie haben schon manches andre Experiment begriffen und das bestmögliche Teil dabei erwählt, z. B. das Experiment mit den beweglichen Waben oder das mit den Aufsätzen, wo man sie zwingt, ihren überschüssigen Honig in die kleinen amerikanischen Honigkästen zu tragen, oder endlich das ausserordentliche Experiment mit den Kunstwaben, wo die Zellen nur durch einen dünnen Wachsumriss angedeutet sind und die Bienen sofort die Nützlichkeit begreifen und sie sorgfältig ausbauen, ohne Stoff und Arbeitskraft zu verlieren. Finden sie nicht unter allen Verhältnissen, die sich ihnen in Gestalt einer von einem böswilligen und hinterlistigen Gotte gestellten Falle darstellen müssen, stets die beste und einzig menschliche Lösung? Um nur einen ganz naturgemässen, aber abnormen Fall zu erwähnen: wenn eine Schnecke oder eine Maus in den Stock gerät oder darin umkommt – was werden sie wohl thun, um den Kadaver loszuwerden, der alsbald ihre ganze Wohnung verpesten würde? Wenn es ihnen nicht möglich ist, den Eindringling hinauszujagen oder zu zerstückeln, so schliessen sie ihn methodisch in ein hermetisches Grabmal von Wachs und Propolis ein, das unter den gewöhnlichen Bauten der Stadt einen bizarren Eindruck macht. Letztes Jahr fand ich in einem meiner Bienenstöcke ein Konglomerat von drei solchen Grabhügeln, die wie die Zellen des Wachsbaues nur durch eine gemeinsame Mittelwand
getrennt waren, um möglichst viel Wachs zu sparen. Die klugen Totengräberinnen hatten sie über den Leichen dreier Schnecken errichtet, welche ein Kind in ihre Behausung hineingesteckt hatte. Gewöhnlich begnügen sie sich bei Schnecken damit, die Öffnung des Gehäuses mit Wachs zu verkleben. Aber hier, wo die Schale mehr oder weniger zerbrochen oder rissig war, hatten sie es für klüger gehalten, das Ganze zu begraben, und um den Eingang nicht zu verstopfen, hatten sie in dieser den Weg versperrenden Masse eine Anzahl von Gängen angebracht, die genau der Körpergrösse der Drohnen angepasst waren, welche zweimal so gross sind, wie die Bienen. Dies und der folgende Fall erlauben wohl die Annahme, dass sie eines Tages dahinterkommen könnten, warum die Königin ihnen durch das Gitter nicht folgen kann. Sie haben einen ganz ausgeprägten Sinn für Proportionen und den nötigen Spielraum, dessen ein Körper zu seiner Bewegung bedarf. In den Gegenden, wo der Totenkopfschmetterling (Acherontia atropos) häufig ist, errichten sie am Flugloche ihrer Stöcke kleine Wachssäulen, zwischen denen der nächtliche Räuber seinen dicken Leib nicht hindurchzwängen kann.
Man sieht, dieser Zukunft ist alles mit einer Voraussicht, einer Einstimmigkeit, einer Unbeugsamkeit und Geschicklichkeit im Auslegen und Benutzen der Umstände untergeordnet, dass man vor Bewunderung starr ist, wenn man bedenkt, wie unverhofft und übernatürlich unser Eingreifen den Bienen erscheinen muss. Man wird vielleicht sagen, dass sie sich in diesem Falle das Unvermögen der Königin, ihnen zu folgen, sehr schlecht deuten. Aber würden wir viel hellsichtiger sein, wenn ein anders gearteter Verstand in Verbindung mit einem so riesenhaften Körper, dass seine Bewegungen fast ebenso unfasslich sind, wie die einer Naturerscheinung, sich das Vergnügen machte, uns Fallen gleicher Art zu stellen? Haben wir nicht einige tausend Jahre gebraucht, um eine einigermassen annehmbare Erklärung für den Blitzstrahl zu finden? Jeder Intellekt ist mit Langsamkeit geschlagen, wenn er aus seiner eng begrenzten Wirkungssphäre heraustritt und sich Vorgängen gegenüber sieht, zu denen er nicht den Anstoss gegeben hat. Ausserdem ist nicht gesagt, dass die Bienen,
wenn man das Experiment mit dem Gitter fortsetzen und verallgemeinern würde, nicht schliesslich doch dahinterkämen und einen Ausweg fänden. Sie haben schon manches andre Experiment begriffen und das bestmögliche Teil dabei erwählt, z. B. das Experiment mit den beweglichen Waben oder das mit den Aufsätzen, wo man sie zwingt, ihren überschüssigen Honig in die kleinen amerikanischen Honigkästen zu tragen, oder endlich das ausserordentliche Experiment mit den Kunstwaben, wo die Zellen nur durch einen dünnen Wachsumriss angedeutet sind und die Bienen sofort die Nützlichkeit begreifen und sie sorgfältig ausbauen, ohne Stoff und Arbeitskraft zu verlieren. Finden sie nicht unter allen Verhältnissen, die sich ihnen in Gestalt einer von einem böswilligen und hinterlistigen Gotte gestellten Falle darstellen müssen, stets die beste und einzig menschliche Lösung? Um nur einen ganz naturgemässen, aber abnormen Fall zu erwähnen: wenn eine Schnecke oder eine Maus in den Stock gerät oder darin umkommt – was werden sie wohl thun, um den Kadaver loszuwerden, der alsbald ihre ganze Wohnung verpesten würde? Wenn es ihnen nicht möglich ist, den Eindringling hinauszujagen oder zu zerstückeln, so schliessen sie ihn methodisch in ein hermetisches Grabmal von Wachs und Propolis ein, das unter den gewöhnlichen Bauten der Stadt einen bizarren Eindruck macht. Letztes Jahr fand ich in einem meiner Bienenstöcke ein Konglomerat von drei solchen Grabhügeln, die wie die Zellen des Wachsbaues nur durch eine gemeinsame Mittelwand
getrennt waren, um möglichst viel Wachs zu sparen. Die klugen Totengräberinnen hatten sie über den Leichen dreier Schnecken errichtet, welche ein Kind in ihre Behausung hineingesteckt hatte. Gewöhnlich begnügen sie sich bei Schnecken damit, die Öffnung des Gehäuses mit Wachs zu verkleben. Aber hier, wo die Schale mehr oder weniger zerbrochen oder rissig war, hatten sie es für klüger gehalten, das Ganze zu begraben, und um den Eingang nicht zu verstopfen, hatten sie in dieser den Weg versperrenden Masse eine Anzahl von Gängen angebracht, die genau der Körpergrösse der Drohnen angepasst waren, welche zweimal so gross sind, wie die Bienen. Dies und der folgende Fall erlauben wohl die Annahme, dass sie eines Tages dahinterkommen könnten, warum die Königin ihnen durch das Gitter nicht folgen kann. Sie haben einen ganz ausgeprägten Sinn für Proportionen und den nötigen Spielraum, dessen ein Körper zu seiner Bewegung bedarf. In den Gegenden, wo der Totenkopfschmetterling (Acherontia atropos) häufig ist, errichten sie am Flugloche ihrer Stöcke kleine Wachssäulen, zwischen denen der nächtliche Räuber seinen dicken Leib nicht hindurchzwängen kann.
Aber genug davon, ich hätte erst garnicht damit angefangen, wenn es gäl
 te, alle Beispiele zu erschöpfen. Um jedoch die Rolle und Lage der Königin noch einmal zusammenzufassen, so kann man sagen, dass sie das sklavische Herz des Schwarmes ist, während die Arbeitsbienen
den Verstand darstellen. Sie ist die Alleinherrscherin, aber auch die königliche Magd, die gefangene Hüterin und die verantwortliche Vertreterin der Liebe. Ihr Volk dient ihr und verehrt sie, ohne darüber zu vergessen, dass es nicht ihrer Person unterthan ist, sondern der von ihr erfüllten Aufgabe und Bestimmung. Man wird schwerlich ein menschliches Gemeinwesen finden, dessen Plan und Anlage einen so beträchtlichen Teil der Wünsche und Sehnsüchte unseres Planeten erfüllt, eine Gesellschaft, deren Glieder eine grössere und vernünftigere Unabhängigkeit geniessen, und wo andererseits eine unerbittlichere und zweckmässigere Unterordnung herrscht, wo die Opfer härter und unbedingter sind. Man glaube nicht, dass ich diese Opfer ebenso bewunderte, wie ihre Resultate. Es wäre augenscheinlich zu wünschen, dass diese Resultate mit weniger Leid und Selbstaufopferung zu erreichen wären. Stimmt man dem Prinzip aber einmal bei – und vielleicht will die Vernunft unseres Erdballs dieses Prinzip – so ist seine Durchführung jedenfalls bewundernswert. Mag für die Menschen eine andere Wahrheit gelten oder nicht, im Bienenstock wird das Leben jedenfalls nicht als eine Reihe von mehr oder minder angenehmen Stunden angesehen, die man sich nur so weit verbittern und verdüstern darf, als zu seiner Erhaltung unerlässlich ist, sondern als eine grosse gemeinsame Pflicht, die auf eine von Weltbeginn an ewig zurückweichende Zukunft gerichtet ist. Jedes Individuum verzichtet hier auf mehr als auf sein halbes Glück und seine halben Rechte. Die Königin entsagt dem
Tageslicht, den Blumenkelchen und der süssen Freiheit, die Arbeitsbienen entsagen der Liebe, fünf oder sechs Lebensjahren und dem Mutterglück. Die Königin sieht ihr Hirn zu Gunsten der Zeugungsorgane auf ein Nichts zusammenschrumpfen und die Arbeitsbienen sehen diese Organe auf Kosten ihres Intellekts verkümmern. Es wäre unrecht zu behaupten, dass der Wille an diesen Verzichtleistungen keinen Anteil hat. Die Arbeitsbiene ist zwar nicht Herrin ihres eigenen Geschickes, aber sie bestimmt das Schicksal aller Nymphen ihrer Umgebung, die ihre mittelbaren Töchter sind. Wir haben gesehen, dass aus jeder Larve, wenn sie königlich ernährt oder untergebracht wird, eine Königin entstehen kann, und wenn man umgekehrt die Ernährung einer königlichen Larve ändert und ihre Zelle verkleinert, würde eine Arbeitsbiene daraus hervorgehen. Diese geheimnisvollen Wahlen finden jeden Tag in dem goldbraunen Schatten des Bienenstockes statt. Sie geschehen nicht auf gut Glück, sondern eine Klugheit, deren tiefehrlichen Ernst nur der Mensch missbrauchen kann, eine allzeit wachsame Weisheit, die sich von allem Rechenschaft ablegt, was ausserhalb und innerhalb des Stockes vor sich geht, lenkt sie in ihren Entschliessungen. Tritt ein unverhoffter Blumenreichtum ein, wird die Königin alt oder lässt ihre Fruchtbarkeit nach, wird es dem Schwarm infolge starker Vermehrung zu eng in seinen Wänden, so entstehen alsbald Königinnenzellen. Dieselben Zellen können aber wieder abgetragen werden, wenn die Ernte nicht hält, was sie versprach, oder wenn der Bienenstock
grösser geworden ist. Sie werden oft nicht zerstört, so lange die junge Königin ihren Hochzeitsausflug noch nicht – oder noch nicht erfolgreich – ausgeführt hat, aber sofort geschieht dies, sobald sie heimgekehrt ist und das untrügliche Zeichen ihrer Befruchtung wie eine Trophäe hinter sich herschleppt. Wo befindet sich diese Weisheit, die Gegenwart und Zukunft so gewissenhaft abwägt und für die das noch nicht Sichtbare mehr in die Wage fällt, als alles, was man sehen kann? Wo hat sie ihren Sitz, diese unpersönliche Klugheit, die da entsagt und wählt, erhöht und erniedrigt, die so viele Bienen zu Königinnen machen könnte und aus so vielen Müttern ein Volk von Jungfrauen erzieht? Wir sagten weiter oben, dass sie im Geiste des Bienenstockes zu suchen sei, aber wo ist dieser Geist schliesslich zu finden, wenn nicht in der Masse der Arbeitsbienen? Vielleicht war es, um sich zu überzeugen, dass er hier seinen Sitz hat, nicht nötig, die Sitten und Gebräuche dieses republikanischen Königreiches so aufmerksam zu studieren. Es genügte, wie Dujardin, Brandt, Girard, Vogel und andere Entomologen gethan haben, den etwas leeren Hirnschädel der Königin und den prächtigen Drohnenkopf, an dem zwanzigtausend Augen glänzen, neben dem kleinen, undankbaren und kümmerlichen Kopf der jungfräulichen Arbeitsbiene unter das Mikroskop zu legen. Wir würden alsdann gesehen haben, dass sich in diesem kleinen Köpfchen das grösste und vollkommenste Schädelmark des ganzen Gemeinwesens windet, ja, selbst das schönste, komplizierteste und nächst dem des
Menschen auch das vollkommenste in der ganzen Natur, wenngleich es auf einer ganz anderen Stufe steht und ganz anders beschaffen ist.
Das Gehirn der Biene beträgt nach den Berechnungen von Dujardin 1/174 des Gesamtgewichtes ihres Körpers, das der Ameise nur 1/296. Dafür sind die strangförmigen Körper, die sich im gleichen Verhältnis entwickeln, wie der Verstand, bei den Bienen etwas geringer, als bei den Ameisen. Aus diesen Schätzungen scheint – wenn man das Hypothetische derselben und die ganze Dunkelheit des Gegenstandes mit in Betracht zieht – sich zu ergeben, dass Ameise und Biene sich in Bezug auf Intellekt ungefähr gleich stehen müssen. Hier wie überall in der uns bekannten Welt ist da, wo das Gehirn liegt, der Sitz der Autorität, der wirklichen Kraft, der Weisheit und des Sieges. Auch hier findet sich ein fast unsichtbares Atom jener geheimnisvollen Substanz, welche die Materie unterjocht und organisiert und den ungeheuren, trägen Gewalten des Nichts und des Todes ein gesichertes, dauerndes Plätzchen abzuringen weiss.
te, alle Beispiele zu erschöpfen. Um jedoch die Rolle und Lage der Königin noch einmal zusammenzufassen, so kann man sagen, dass sie das sklavische Herz des Schwarmes ist, während die Arbeitsbienen
den Verstand darstellen. Sie ist die Alleinherrscherin, aber auch die königliche Magd, die gefangene Hüterin und die verantwortliche Vertreterin der Liebe. Ihr Volk dient ihr und verehrt sie, ohne darüber zu vergessen, dass es nicht ihrer Person unterthan ist, sondern der von ihr erfüllten Aufgabe und Bestimmung. Man wird schwerlich ein menschliches Gemeinwesen finden, dessen Plan und Anlage einen so beträchtlichen Teil der Wünsche und Sehnsüchte unseres Planeten erfüllt, eine Gesellschaft, deren Glieder eine grössere und vernünftigere Unabhängigkeit geniessen, und wo andererseits eine unerbittlichere und zweckmässigere Unterordnung herrscht, wo die Opfer härter und unbedingter sind. Man glaube nicht, dass ich diese Opfer ebenso bewunderte, wie ihre Resultate. Es wäre augenscheinlich zu wünschen, dass diese Resultate mit weniger Leid und Selbstaufopferung zu erreichen wären. Stimmt man dem Prinzip aber einmal bei – und vielleicht will die Vernunft unseres Erdballs dieses Prinzip – so ist seine Durchführung jedenfalls bewundernswert. Mag für die Menschen eine andere Wahrheit gelten oder nicht, im Bienenstock wird das Leben jedenfalls nicht als eine Reihe von mehr oder minder angenehmen Stunden angesehen, die man sich nur so weit verbittern und verdüstern darf, als zu seiner Erhaltung unerlässlich ist, sondern als eine grosse gemeinsame Pflicht, die auf eine von Weltbeginn an ewig zurückweichende Zukunft gerichtet ist. Jedes Individuum verzichtet hier auf mehr als auf sein halbes Glück und seine halben Rechte. Die Königin entsagt dem
Tageslicht, den Blumenkelchen und der süssen Freiheit, die Arbeitsbienen entsagen der Liebe, fünf oder sechs Lebensjahren und dem Mutterglück. Die Königin sieht ihr Hirn zu Gunsten der Zeugungsorgane auf ein Nichts zusammenschrumpfen und die Arbeitsbienen sehen diese Organe auf Kosten ihres Intellekts verkümmern. Es wäre unrecht zu behaupten, dass der Wille an diesen Verzichtleistungen keinen Anteil hat. Die Arbeitsbiene ist zwar nicht Herrin ihres eigenen Geschickes, aber sie bestimmt das Schicksal aller Nymphen ihrer Umgebung, die ihre mittelbaren Töchter sind. Wir haben gesehen, dass aus jeder Larve, wenn sie königlich ernährt oder untergebracht wird, eine Königin entstehen kann, und wenn man umgekehrt die Ernährung einer königlichen Larve ändert und ihre Zelle verkleinert, würde eine Arbeitsbiene daraus hervorgehen. Diese geheimnisvollen Wahlen finden jeden Tag in dem goldbraunen Schatten des Bienenstockes statt. Sie geschehen nicht auf gut Glück, sondern eine Klugheit, deren tiefehrlichen Ernst nur der Mensch missbrauchen kann, eine allzeit wachsame Weisheit, die sich von allem Rechenschaft ablegt, was ausserhalb und innerhalb des Stockes vor sich geht, lenkt sie in ihren Entschliessungen. Tritt ein unverhoffter Blumenreichtum ein, wird die Königin alt oder lässt ihre Fruchtbarkeit nach, wird es dem Schwarm infolge starker Vermehrung zu eng in seinen Wänden, so entstehen alsbald Königinnenzellen. Dieselben Zellen können aber wieder abgetragen werden, wenn die Ernte nicht hält, was sie versprach, oder wenn der Bienenstock
grösser geworden ist. Sie werden oft nicht zerstört, so lange die junge Königin ihren Hochzeitsausflug noch nicht – oder noch nicht erfolgreich – ausgeführt hat, aber sofort geschieht dies, sobald sie heimgekehrt ist und das untrügliche Zeichen ihrer Befruchtung wie eine Trophäe hinter sich herschleppt. Wo befindet sich diese Weisheit, die Gegenwart und Zukunft so gewissenhaft abwägt und für die das noch nicht Sichtbare mehr in die Wage fällt, als alles, was man sehen kann? Wo hat sie ihren Sitz, diese unpersönliche Klugheit, die da entsagt und wählt, erhöht und erniedrigt, die so viele Bienen zu Königinnen machen könnte und aus so vielen Müttern ein Volk von Jungfrauen erzieht? Wir sagten weiter oben, dass sie im Geiste des Bienenstockes zu suchen sei, aber wo ist dieser Geist schliesslich zu finden, wenn nicht in der Masse der Arbeitsbienen? Vielleicht war es, um sich zu überzeugen, dass er hier seinen Sitz hat, nicht nötig, die Sitten und Gebräuche dieses republikanischen Königreiches so aufmerksam zu studieren. Es genügte, wie Dujardin, Brandt, Girard, Vogel und andere Entomologen gethan haben, den etwas leeren Hirnschädel der Königin und den prächtigen Drohnenkopf, an dem zwanzigtausend Augen glänzen, neben dem kleinen, undankbaren und kümmerlichen Kopf der jungfräulichen Arbeitsbiene unter das Mikroskop zu legen. Wir würden alsdann gesehen haben, dass sich in diesem kleinen Köpfchen das grösste und vollkommenste Schädelmark des ganzen Gemeinwesens windet, ja, selbst das schönste, komplizierteste und nächst dem des
Menschen auch das vollkommenste in der ganzen Natur, wenngleich es auf einer ganz anderen Stufe steht und ganz anders beschaffen ist.
Das Gehirn der Biene beträgt nach den Berechnungen von Dujardin 1/174 des Gesamtgewichtes ihres Körpers, das der Ameise nur 1/296. Dafür sind die strangförmigen Körper, die sich im gleichen Verhältnis entwickeln, wie der Verstand, bei den Bienen etwas geringer, als bei den Ameisen. Aus diesen Schätzungen scheint – wenn man das Hypothetische derselben und die ganze Dunkelheit des Gegenstandes mit in Betracht zieht – sich zu ergeben, dass Ameise und Biene sich in Bezug auf Intellekt ungefähr gleich stehen müssen. Hier wie überall in der uns bekannten Welt ist da, wo das Gehirn liegt, der Sitz der Autorität, der wirklichen Kraft, der Weisheit und des Sieges. Auch hier findet sich ein fast unsichtbares Atom jener geheimnisvollen Substanz, welche die Materie unterjocht und organisiert und den ungeheuren, trägen Gewalten des Nichts und des Todes ein gesichertes, dauerndes Plätzchen abzuringen weiss.
 Doch kehren wir zu unsren schwärmenden Bienen zurück, die nicht auf das Ende dieses Exkurses gewartet haben, um das Zeichen zum Aufbruch zu geben. In dem Augenblick, wo dieses Zeichen gegeben wird, scheinen sich alle Thore der Stadt mit einem Male zu öffnen, wie von einem plötzlichen, irren Stosse, und die schwarze Menge strömt oder vielmehr stürzt heraus, je nach der Anzahl der Öffnungen in einem doppelten, dreifachen oder vierfachen, geraden, straffen, zitternden und ununterbrochenen Strahle, der sich alsbald in der Luft zu einem summenden Netze von hunderttausend wild schwirrenden, durchsichtigen Flügeln zerteilt. Einige Minuten schwebt dieses Netz über dem Bienenstock wie ein durchsichtiges, knisterndes Seidengewebe, das tausend und abertausend elektrisch bewegte Hände unaufhörlich zerreissen und wieder zusammenfügen; es schwankt hin und her, stockt und wallt von neuem zwischen den Blumen der Erde und dem Blau des Himmels
auf und nieder, wie ein Schleier der Freude, den unsichtbare Hände beständig schwenken, zusammenraffen und wieder entfalten, als feierten sie die Ankunft oder das Scheiden eines hohen Gastes. Endlich senkt sich einer der Zipfel, ein andrer hebt sich, die vier sonnenglänzenden Enden des schimmernden Mantels stossen zusammen, und wie ein Zaubertuch im Märchen, das den Horizont durchsegelt, um irgend welche Wünsche zu erfüllen, steigt der Schwarm, bereits wieder geballt, nach dem nächsten Linden-, Birnen- oder Weidenbaum auf, um die heilige Trägerin der Zukunft wieder mit seinen Leibern zu bedecken. Denn die Königin hat sich dort bereits angesetzt, wie ein goldener Nagel, an den sich nun die brausenden Wellen des Schwarmes eine nach der andern anhängen, bis rings herum sich ein flügelglänzender Perlenmantel schlingt.
Doch kehren wir zu unsren schwärmenden Bienen zurück, die nicht auf das Ende dieses Exkurses gewartet haben, um das Zeichen zum Aufbruch zu geben. In dem Augenblick, wo dieses Zeichen gegeben wird, scheinen sich alle Thore der Stadt mit einem Male zu öffnen, wie von einem plötzlichen, irren Stosse, und die schwarze Menge strömt oder vielmehr stürzt heraus, je nach der Anzahl der Öffnungen in einem doppelten, dreifachen oder vierfachen, geraden, straffen, zitternden und ununterbrochenen Strahle, der sich alsbald in der Luft zu einem summenden Netze von hunderttausend wild schwirrenden, durchsichtigen Flügeln zerteilt. Einige Minuten schwebt dieses Netz über dem Bienenstock wie ein durchsichtiges, knisterndes Seidengewebe, das tausend und abertausend elektrisch bewegte Hände unaufhörlich zerreissen und wieder zusammenfügen; es schwankt hin und her, stockt und wallt von neuem zwischen den Blumen der Erde und dem Blau des Himmels
auf und nieder, wie ein Schleier der Freude, den unsichtbare Hände beständig schwenken, zusammenraffen und wieder entfalten, als feierten sie die Ankunft oder das Scheiden eines hohen Gastes. Endlich senkt sich einer der Zipfel, ein andrer hebt sich, die vier sonnenglänzenden Enden des schimmernden Mantels stossen zusammen, und wie ein Zaubertuch im Märchen, das den Horizont durchsegelt, um irgend welche Wünsche zu erfüllen, steigt der Schwarm, bereits wieder geballt, nach dem nächsten Linden-, Birnen- oder Weidenbaum auf, um die heilige Trägerin der Zukunft wieder mit seinen Leibern zu bedecken. Denn die Königin hat sich dort bereits angesetzt, wie ein goldener Nagel, an den sich nun die brausenden Wellen des Schwarmes eine nach der andern anhängen, bis rings herum sich ein flügelglänzender Perlenmantel schlingt.
Dann wird es plötzlich still, und das laute Brausen dieser sonnenverfinsternden Wolke, die aus unendlichem Zorn und unzähligen Drohungen gewebt schien, der betäubende Goldhagel, der unaufhörlich über der ganzen Umgebung schwebte und tönte, verwandelt sich eine Minute darauf zu einer grossen, harmlosen und friedlichen Traube von tausend und abertausend kleinen, lebenden Beeren, die unbeweglich an einem Baumzweige hängt und geduldig auf die Rückkehr der Spürbienen wartet, die eine neue Wohnung auskundschaften.

 Es ist dies das erste Stadium des Schwärmens, der sog. erste oder Hauptschwarm, der allemal die alte Königin bei sich hat. Er legt sich gewöhnlich an einem Baume oder Busche in nächster Nähe des Bienenstocks an, denn die Königin ist mit ihren Eiern beschwert und hat das Licht seit ihrem Hochzeitsausflug oder dem vorjährigen Schwärmen nicht mehr erblickt, deshalb zaudert sie noch, sich dem weiten Luftmeer anzuvertrauen, ja, sie scheint den Gebrauch ihrer Flügel verlernt zu haben.
Es ist dies das erste Stadium des Schwärmens, der sog. erste oder Hauptschwarm, der allemal die alte Königin bei sich hat. Er legt sich gewöhnlich an einem Baume oder Busche in nächster Nähe des Bienenstocks an, denn die Königin ist mit ihren Eiern beschwert und hat das Licht seit ihrem Hochzeitsausflug oder dem vorjährigen Schwärmen nicht mehr erblickt, deshalb zaudert sie noch, sich dem weiten Luftmeer anzuvertrauen, ja, sie scheint den Gebrauch ihrer Flügel verlernt zu haben.
Der Bienenzüchter wartet, bis der Schwarm sich recht zusammengeballt hat. Dann geht er mit einem grossen Strohhut auf dem Kopfe (denn die harmloseste Biene macht unweigerlich Gebrauch von ihrem Stachel, sobald sie sich in die Haare verirrt, wo sie sich jedenfalls in einer Falle wähnt), aber ohne Bienenhaube, sofern er Erfahrung besitzt, und nachdem er die Arme bis an den Ellenbogen in kaltes Wasser getaucht hat, auf den Schwarm zu und schüttelt ihn von dem Aste, an dem er hängt, in einen umgestülpten Bienenkorb. Die Traube fällt schwer hinein wie eine reife Frucht. Oder, wenn der Ast zu stark ist, schöpft er den Klumpen mit einem Löffel auf und schüttet die vollen Löffel wie Getreide, wohin er will. Er braucht die Bienen, die um ihn herumsummen und ihm auf Gesicht und Händen herumkriechen, nicht zu fürchten. Vernimmt er doch ihr trunkenes Lied, den sog. Schwarmgesang, das ihrem zornigen Summen ganz unähnlich ist. Er braucht nicht zu fürchten, dass der Schwarm sich teilt, wütend wird, sich zerstreut oder entschlüpft. Wie ich schon sagte, haben die geheimnisvollen Arbeiterinnen heute ihren Festtag und sind voll unwandelbaren Zutrauens. Sie haben sich von dem unter ihrer Obhut stehenden Schatze losgerissen und kennen ihre Feinde nun nicht mehr. Sie sind harmlos vor Glückseligkeit, und man weiss nicht, warum sie so glücklich sind: erfüllen sie doch nur das Gesetz. Aber alle Wesen kennen diese Stunden blinden Glücks, welche die Natur für solche Augenblicke aufspart, wo sie ihr Ziel erreichen will. Wundern wir uns nicht, dass sie die Betrogenen sind! Auch wir mit unserm vollkommeneren Gehirn, das sie seit vielen Jahrhunderten beobachtet, werden von ihr zum Besten gehalten und wissen noch nicht einmal, ob sie wohlwollend, gleichgültig oder niedrig grausam ist. –
Der Schwarm bleibt da, wohin die Königin gefallen ist, und wenn sie allein in den Bienenkorb gefallen ist, so ziehen alle Bienen, sobald sie dies merken, in langen, schwarzen Fäden nach dem mütterlichen Obdach, die meisten hastig eindringend, andre wieder an der Schwelle des unbekannten Thores stutzend und jenen Reigen feierlicher Freude bildend, mit dem sie glückliche Ereignisse zu begrüssen pflegen. Sie »präsentieren«, wie der Kunstausdruck lautet. Im Nu wird der unerwartete Unterkunftsort angenommen und bis in seine kleinsten Schlupfwinkel untersucht, seine Lage, Form und Farbe vermerkt und in die tausend kleinen, klugen und treuen Gedächtnisse eingegraben. Die Merkzeichen der Umgebung werden sorgsam eingeprägt, die neue Stadt mit ihrem Platze in Geist und Herzen aller Bewohnerinnen gegründet, und bald erschallt in ihren Mauern das Liebeslied der königlichen Gegenwart, während die Arbeit beginnt.
 Wenn der Mensch den Schwarm nicht pflückt, so ist seine Geschichte hier noch nicht zu Ende. Er bleibt an seinem Aste hängen, bis die zur Rekognoszierung und zum Quartiermachen ausgesandten Spürbienen, die sich von Anbeginn des Schwärmens an nach allen Windrichtungen zerstreut haben, um eine neue Wohnung zu suchen, sich wieder eingefunden haben. Eine nach der andern kehrt zurück und berichtet, was sie gefunden hat, denn da wir nicht im stande sind, in das Denken der Bienen einzudringen, so müssen wir uns das Schauspiel, dem wir beiwohnen, wohl auf menschliche Weise erklären. Es ist also wahrscheinlich, dass man ihren Meldungen aufmerksam lauscht. Die eine rühmt gewiss einen hohlen Baumstamm, die andere die Vorteile einer alten Mauerspalte, einer Felsenhöhle oder einer verlassenen Grube. Oft geschieht es, dass der Schwarm zaudert und bis zum nächsten Morgen berät. Endlich wird die Wahl getroffen und die Einstimmigkeit erzielt. In einem bestimmten Augenblick beginnt der Schwarm zu kribbeln, sich zu zerteilen und mit ungestümem, andauernden Fluge, der jetzt kein Hindernis mehr kennt, über Hecken, Getreide- und Leinfelder, Heuschober und Teiche, Flüsse und Ortschaften hinweg, in gerader Linie einem bestimmten und jedesmal sehr entfernten Ziele entgegenzufliegen. Selten
kann der Mensch ihnen auf diesem zweiten Teil ihres Fluges folgen. Sie kehren zur Natur zurück und wir verlieren die Spur ihres Schicksals.
Wenn der Mensch den Schwarm nicht pflückt, so ist seine Geschichte hier noch nicht zu Ende. Er bleibt an seinem Aste hängen, bis die zur Rekognoszierung und zum Quartiermachen ausgesandten Spürbienen, die sich von Anbeginn des Schwärmens an nach allen Windrichtungen zerstreut haben, um eine neue Wohnung zu suchen, sich wieder eingefunden haben. Eine nach der andern kehrt zurück und berichtet, was sie gefunden hat, denn da wir nicht im stande sind, in das Denken der Bienen einzudringen, so müssen wir uns das Schauspiel, dem wir beiwohnen, wohl auf menschliche Weise erklären. Es ist also wahrscheinlich, dass man ihren Meldungen aufmerksam lauscht. Die eine rühmt gewiss einen hohlen Baumstamm, die andere die Vorteile einer alten Mauerspalte, einer Felsenhöhle oder einer verlassenen Grube. Oft geschieht es, dass der Schwarm zaudert und bis zum nächsten Morgen berät. Endlich wird die Wahl getroffen und die Einstimmigkeit erzielt. In einem bestimmten Augenblick beginnt der Schwarm zu kribbeln, sich zu zerteilen und mit ungestümem, andauernden Fluge, der jetzt kein Hindernis mehr kennt, über Hecken, Getreide- und Leinfelder, Heuschober und Teiche, Flüsse und Ortschaften hinweg, in gerader Linie einem bestimmten und jedesmal sehr entfernten Ziele entgegenzufliegen. Selten
kann der Mensch ihnen auf diesem zweiten Teil ihres Fluges folgen. Sie kehren zur Natur zurück und wir verlieren die Spur ihres Schicksals.
