
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Zu Worms – »wie herrlich fällt da der Rhein!« Bilder steigen auf aus dem Nibelungenlied, von dem burgundischen Königshof, von Frau Kriemhild und dem Helden Siegfried, von all dem tragischen Geschehen, das hinüberspielt an die Donau und hier in unserem Vaterland Schicksal wird und Gesang. Nun hält wieder einer aus burgundischem Geblüt – wenn es auch nicht dasselbe Burgund ist – Hof zu Worms, an der Stätte legendärer Erinnerung. Es ist Karl V., der neunzehnjährige Enkel Maximilians, der eben zu Aachen als deutscher König gekrönt worden war.
Er war zu Gent geboren, ein verwaistes Kind, zu frühem Ernst in einer wenig glücklichen Jugend erzogen. Das Gemälde von Tizian in der Wiener Galerie zeigt uns das schmale edle Gesicht mit den großen bannenden Augen, dem etwas vorstehenden, energischen Kinn, dem schlichten rötlich-blonden Haar und Spitzbart; die zarte und dennoch ritterlich gewandte Gestalt des jungen Fürsten; seine Tracht ist niederländisch-spanisch, aber sein Herz ist deutsch.
»Als geborener Deutscher bin ich dieser Nation von meiner Jugend an mit besonderer Liebe zugetan gewesen«, hatte er bei der Krönung in einer Anrede an die Fürsten erklärt. »Viele meiner Vorfahren von deutscher Abkunft haben das Heilige Reich lange Jahre regiert. Nicht um des Eigennutzes willen, sondern um des Reiches selber willen, habe ich nach der Krone getrachtet ...« Er betont, das Reich wieder zu Ehren bringen zu wollen, seinem Eide gemäß die Kirche zu schützen und die Rechte des Volkes, aber er verlangt zu diesem Zweck, daß die kaiserliche Oberhoheit ungeschmälert bleibe. Nicht daß man viele Herren habe, sondern einen, das sei des Heiligen Reiches Herkommen ... Das ist Programm, aus dem sich alles andere ergibt. In der Tat ist an keinen der früheren Kaiser die Pflicht zum Schutz der Kirche so sehr herangetreten, wie an Karl V., dem einzigen der damaligen christlichen Könige, der seinem Eide treu geblieben ist. Selbst Franz I. von Frankreich hat Protestanten und Türken unterstützt. Es ist töricht, zu behaupten, Karl hätte sich im Interesse des Reiches der neuen Lehre anschließen sollen; der Hüter des heiligen Rechts kann und darf keinen Eidbruch begehen. Das Unglück wäre unabsehbar gewesen.
Im Bischofshof zu Worms hatte Karl seinen ersten Reichstag einberufen. In dem ziemlich schmucklosen Saal war der schwarzgoldene Thronbaldachin aufgeschlagen; dem jungen Kaiser zur Rechten saßen die beiden päpstlichen Legaten; im weiten Umkreis die Kurfürsten in scharlachroten Gewändern; dann die Landesfürsten, die Reichsritter und die Vertreter der Reichsstädte. Man sah die historischen Charaktergestalten der Zeit, Joachim von Brandenburg, Friedrich den Weisen von Sachsen, die massige Gestalt Johanns von Sachsen, Philipp von Braunschweig, den Landgrafen Philipp von Hessen und so viele spätere Abtrünnige; dann Herzog Alba; Georg von Frundsberg; den Bankier des Kaisers, Jakob Fugger von Augsburg; Kopf an Kopf, in gespanntester Aufmerksamkeit die Blicke auf den Augustinermönch gerichtet, der blaß und mager, fast furchtsam, und dennoch glühend von Eifer, mitten im Saal stand, vor dem Thron des Kaisers, der ihn mit leicht vorgeneigtem Haupt ruhig und prüfend ansah. Fast enttäuscht von dem ersten Anblick meinte der Kaiser: »Der wird mich nicht zum Ketzer machen!«
Dieser Reichstag, an welchem Karl seinen jüngeren Bruder Ferdinand I. in die Herrschaft der österreichischen Erbländer einsetzte und mit den Verträgen von Worms und Brüssel die Teilung des Erzhauses in eine österreichische und spanische Linie vollzog, wäre wie so viele andere ohne welthistorische Bedeutung vorübergegangen, wenn nicht mit dem Mönch ein tragischer Höhepunkt und ein Ereignis von schicksalsschwersten Folgen eingetreten wäre.
Im Osten rückte Soliman heran, der mächtigste Sultan, der nach Weltherrschaft strebte, nach dem Erbe Karls des Großen, jedoch mit dem Halbmond statt des Kreuzes; im Westen rüstete Franz I. von Frankreich, der gleich Heinrich VIII. von England nach der römisch-deutschen Kaiserkrone gestrebt hatte und vor dem Erben der burgundischen, spanischen und habsburgisch-österreichischen Länder weichen mußte. Zwischen diesen mächtigen Rivalen, die sich miteinander und mit allen Feinden des Kaisers verbinden sollten, stand der junge Fürst, entschlossen, diesen ungeheuren Weltkampf um den Bestand von Kirche und Reich als seine geradezu übermenschliche Lebensaufgabe anzutreten!
Und da erhebt sich vor ihm in dem unscheinbaren Mönch ein dritter Gegner, der das Unheilvollste, wenn auch noch nicht klar Vorausgesehene, herbeiführt: die religiöse Spaltung des Reiches, den Riß in der deutschen Seele, die dauernde Schwächung der Abwehrkraft gegen die Reichsfeinde mit allen weiteren unvermeidlichen Katastrophen.
Das kam erst allmählich, natürlich; aber es gab schon Grund genug, daß es der Kaiser für nötig hielt, den störrischen Mönch zur Verantwortung und zum Widerruf vor den Reichstag zu fordern. Eine Abfallbewegung war im Gange, die man zuerst nur für Reformwillen hielt; sie vollzog sich ganz nach hussitischem Muster mit dem Anschlag der 97 Thesen Luthers – das war dieser Mönch – an der Wittenberger Schloßkirche; mit der Verbrennung der päpstlichen Bannbulle; mit theologischen Streitschriften und Schmähschriften gegen die Kirche, gegen das Dogma, gegen das Meßopfer, gegen die Sakramente, gegen die Autorität des Papstes in Glaubensdingen, gegen den Begriff der Gnade, der natürlichen göttlichen Rechte, gegen die Sündenvergebung, gegen die Werkheiligung, gegen den Ablaßgedanken usw. Die Natur sei unwiderruflich dem Bösen verhaftet; die Rechtfertigung erfolge durch den Glauben allein, es bedürfe dazu weder der guten Werke noch der Vermittlerrolle des Priesters; die Auslegung der Heiligen Schrift sei jedem einzelnen anheimgegeben. Damit war Religion Privatsache geworden. Mit dieser Auflösung verband sich alles, was an politischen und sozialen Ideen in den Köpfen gärte. Der Aufbruch eines dumpfen slawischen Despotismus, der zur Selbstvergottung, zur National- und Staatsvergottung führt, war in der hussitischen Bewegung bereits hundert Jahre früher erfolgt; scheinbar gedämpft, griff der Brand unterirdisch weiter, nordwärts an der tragischen Bruchlinie, ungefähr in der Richtung der Elbe, die den ehemals slawischen Osten von der älteren Kultur des deutschen Westens trennt. An diesen slawischen Urgrund erinnern noch die Ortsnamen wie Möhra, die Heimat der Eltern Luthers, der als Sohn eines Bergmannes zu Eisleben am 10. November 1483 geboren wurde.
Das völlig Neue, Unerhörte, das keine Bewegung vor Luther gewagt hatte, war die Bestreitung der Autorität der Kirche und ihrer Lehre. Als der Kaiser diese Worte hörte, befahl er entsetzt, die Verhandlung abzubrechen. Da soll Luther, wenn auch unverbürgt, die berühmten Worte gerufen haben: »Hie steh ich, ich kann nicht anders! Gott helfe mir! Amen.« Wie bei der Disputation zu Leipzig gegen Dr. Johannes Eck verlangte er, daß man ihn aus der Schrift widerlege, uneingedenk, daß selbst göttliche Vernunft nichts richtet, wenn der gute Wille fehlt. Daß ihm nicht das Schicksal eines Johann Hus widerfuhr, verdankte er der Worttreue des Kaisers, der ihm freies Geleit zugesichert hatte. Im Saal und auf der Straße überwogen die Anhänger des Mönches.
Daß die Kirche in ihrem menschlichen Teil reformbedürftig war, dafür war er selber Beweis. Was immer groß an ihm erscheinen mag, unendlich größer war sein katastrophaler Irrtum, die Religion der subjektiven Willkür anheimzugeben und mit der anderthalbtausendjährigen Tradition der Kirche zu brechen, ja, sie der weltlichen Macht der Fürsten zu unterstellen, mit der Aufforderung an diese, sich der Kirchengüter zu bemächtigen. Der erste, der so tat, war der Hochmeister des Deutschen Ordens auf Marienburg in Preußen, Albrecht von Hohenzollern; andere folgten. Mit der Willkür begann das Chaos. Die Bauernkriege, die unter dem Tiroler Michael Gaißmair auf Österreich übergriffen, waren eine der weiteren Folgen, vor denen schließlich auch dem Reformator graute. Das Reich war entheiligt und mit ihm der Kaiser durch den Abfall von der Kirche, ein Bruch war geschehen, ein Kulturbruch, der mitten durch das Reich ging, durch das Volk, durch die Geschichte. Das war die große Denkwürdigkeit des Reichstages zu Worms 1521.
Die erste Türkenbelagerung 1529, also vor mehr als 400 Jahren, erscheint in der Erinnerung stark verdunkelt durch die zweite von 1683, die durch ihren bedeutenden Personenkreis und durch nähere Erinnerungen in ein starkes Relief gerückt ist. Aber jenes erste Ereignis war nicht minder von entscheidender welthistorischer Bedeutung. Mit dieser ersten Belagerung beginnt das große Heldenzeitalter Österreichs, kaum daß es durch die dauernde Vereinigung mit Ungarn und Böhmen unter Ferdinand I. seine Großstaatlichkeit erlangt hat. Die zweite Belagerung ist nur ein vorläufiger Schlußpunkt dieser österreichischen Heldenzeit, in der es um nichts Geringeres ging, als um die Rettung der Christenheit. Das war die gewaltige Sendung Österreichs damals und auch heute.
Die Lage war verzweifelt, wie sonst vielleicht nie: der Abfall von der Kirche im Norden; die Stimme Luthers: »Lieber türkisch als papistisch!«; die Bauernunruhen in Österreich, die eine Gleichschaltung mit der deutschen Bewegung, mit den Wiedertäufern und ihren kommunistisch-religiösen Zeitideen herbeiführen wollen; die Kämpfe gegen Franz I. von Frankreich, der von der deutschen Kaiserkrone träumt; die Auflehnung der Stände in Wien, die Ferdinand allerdings mit starker Hand bändigt; in Ungarn Johann Zápolya, der Herr von 78 Burgen, als Gegenkönig, der zum zweitenmal die Türken ruft und sich von Sultan Soliman als Vasallenkönig bestätigen läßt.
Soliman, der »Prächtige«, verkörpert den Höhepunkt der türkischen Machtentfaltung, die allerdings nicht aufbaut, sondern nur zerstört und vernichtet. Die klassischen Kulturen von Kleinasien und die blühenden Paradiese von Persien sinken hin unter dem Erobererschritt der Vergewaltiger, die in der mohammedanischen Religion eine Art Protestantismus bilden; lachende, reich bebaute Gefilde verwandeln sich in Wüsteneien. Dieses Schicksal droht Europa; Ungarn hat es seit der unglücklichen Schlacht bei Mohács erfahren müssen; durch mehr als zwei Jahrhunderte blieb es Schlachtfeld.
Soliman, seit der Eroberung von Mekka 1517 höchste geistliche Autorität, glaubte, im Besitz des Kalifats, der wahre Nachfolger der römischen Kaiser zu sein und machte sich mit ungeheuren Streitkräften auf nach Wien, die der gesamten europäischen Macht weit überlegen waren. Es mußte ein wahres Wunder geschehen, um mit den geringen böhmischen und deutschen Söldnerhaufen als Entsatzheer vor Wien standzuhalten. Ehe sie unter dem Pfalzgrafen Philipp vom Rhein, dem Bruder von Ottheinrich, Erbauer des Heidelberger Schlosses, bei Linz gesammelt waren, rückte schon in Gewaltmärschen Soliman gegen Wien heran, dessen schwache Mauern unhaltbar schienen. Er wußte, daß er mit Wien den Schlüssel zur ganzen europäischen Kulturwelt und somit zum christlichen Abendland in Händen hatte.
Der Volksmund sagt: wo der Türke hintritt, wächst kein Gras mehr. Das gilt von den damaligen Zeiten, wo das Wort aufkam: hausen wie der Türk im Feindesland, was dasselbe ausdrückt, nämlich völlige Vernichtung, daß selbst nicht einmal Gras mehr wächst. Was damals drohte, wird erst recht anschaulich, wenn man sich das liebliche Bild vergegenwärtigt, das die damaligen Zeitgenossen von Wien überlieferten, von dem Wien der Dichterkrönungen unter Maximilian und der allegorischen Festspiele und Schuldramen eines Konrad Celtis, eines Chelidonius, dieses dichtenden Schottenabtes, und eines Wolfgang Schmeltzl, dieses biederen Schulmeisters bei den Schotten, der in seinem Lobspruch Wien besingt, die »höchste Hauptbefestigung der Christenheit«. Es war noch dasselbe gotische Wien, das die Herrschaft der Ungarn ertragen hatte, wenn auch seufzend genug, unter König Matthias, der immerhin ein gebildeter Renaissancefürst war. Aber die Türken, nein, da wächst kein Gras mehr!
Ein italienischer Humanist meint, daß ein Gang durch die Stadt, wo so viele Singvögel gehalten werden, dem Spaziergang durch tönende Lustwälder gleiche. Es wird von bemalten Häusern erzählt, die Palästen gleichen, von Höfen mit weiten, gedeckten oder offenen Säulengängen, von Heiligenbildern und Bildhauerwerken, die in der Welt kaum überboten werden, von den schönen Spaziergängen um die Wälle, von den Vorstädten, die an Schönheit und Größe mit der inneren Stadt wetteifern, die selber einer ungeheuren Königsburg gleiche. Vom Prater wird erzählt als von einer Insel mit schönen Gärten voll von Fruchtbäumen, worin die Bürger sich gerne ergehen und die Jugend ihre Mahle und Tanzreigen abhält. Die ganze Umgebung sei ein ungeheurer, herrlicher Garten mit schönen Rebenhügeln, lieblichen Landhäusern, Burgen und Edelsitzen, Dörfern und blühenden Ortschaften. Es ist seitens eines Italieners das größte Lob, wenn er schließlich sagt, hier lieber wohnen zu wollen als in Italien.
Vor diesem Eldorado stand nun der Türke im September 1529 und ließ durch den gefangenen Fähnrich Christof Zedlitz Botschaft an den Verteidiger Wiens richten, daß er die Stadt übergeben solle, und zwar sofort, mit der Drohung, Wien gänzlich zu zerstören, wenn man nicht augenblicklich gehorche. Aber der heldenhafte Verteidiger Wiens dachte nicht daran. Es war der 71jährige Graf Niklas zu Salm, der wiederholt gegen die Ungarn, gegen die Schweizer, gegen die Venezianer, gegen die aufständischen Bauern, gegen Zápolya gekämpft und gesiegt und in der Schlacht bei Pavia 1525 persönlich geholfen hatte, Franz I. von Frankreich gefangenzunehmen. Ein gewaltiger Degen also, der es entschlossen mit dem stärksten Mann der Welt aufnahm, mit Soliman. Die vielbesungenen lieblichen Vorstädte Wiens ließ er niederbrennen, die Kampfunfähigen aus der Stadt bringen, Geschütze auf die Mauern führen, indessen schon die nächtlichen Feuersäulen brennender Dörfer das Nahen des schrecklichen Feindes verkündeten.
Am Morgen des 24. September bot sich den Wienern ein ebenso schöner und bunter, als schreckhafter Anblick dar, der eine starke Probe auf die Beherztheit der kleinen Schar von Verteidigern bedeutete, darunter sich viele Spanier befanden. Unübersehbar die Gezelte der Belagerer im Halbkreis; weithin im Sonnenlicht das schreckliche Gefunkel der goldenen Knäufe des Zeltes des türkischen Großherrn bei Sievering, ungefähr dort, wo später auch der Generalstab Kara Mustaphas lag; die Segel der Proviantflotte belebten den Strom, die leichten Reiterscharen, die Spahis, die weite Ebene.
Die Stärke der Türken lag weniger im Feuergefecht als im Minenkampf, der durch Gegenminen immer wieder vereitelt werden konnte. Am 9. Oktober jedoch flog zwischen Hofburg und Kärntnertor eine Mine auf und riß eine weite Bresche. Mit wildem Geheul liefen die unbesiegbar geltenden Janitscharen, so hieß das Fußvolk, an, aber der krumme Säbel konnte dem Speer und Feuerrohr der todesmutigen Verteidiger nicht standhalten, die mit vielhundertstimmigem Geschrei: »Her!« die Feinde empfingen. Zwei Tage später ging wieder eine Mine in die Luft, dreimal wurde der Sturm abgewiesen. So groß war der Eindruck des ehernen Widerstandes, daß beim Auffliegen einer dritten Mine am 12. Oktober gar kein Sturm mehr versucht wurde. Der mächtige Fürst der Welt mußte sich geschlagen geben. Am 14. Oktober verschwand der böse Spuk vor Wien, Soliman wich nach Ungarn zurück, ehe das spärliche Entsatzheer von Linz heranrückte.
Schier ein Wunder war geschehen; anders ist es nicht erklärlich. Der Himmel hatte trefflich mitgewirkt. Das rauhe Herbstwetter, der Mangel an Proviant, Seuchen im Heer und die abergläubische Verzagtheit der sonst so wilden, verwegenen Türken, wenn sie sich einem unerklärlichen höheren Widerstand gegenüber finden. Soliman hatte Belgrad genommen, in der Schlacht bei Mohacs 1526 Ungarn gebrochen, wiederholt Ofen erstürmt – an Wien war er gescheitert. 1532 versuchte er es nochmals, brach aber schon an der von dem Kroaten Jurischitsch heldenhaft verteidigten Festung Güns zusammen. Sechs Feldzüge unternahm er gegen Ungarn und verschied vor der kleinen Festung Sziget, wo der in Lied und Drama verherrlichte kroatische Held Nikolaus Zriny durch seinen heroischen Opfertod die Lage entschied.

Zrinys Ausfall von Szigeth 1566.
(Gemälde von Peter Krafft. Kunstverlag Wolfrum, Wien.)
Es gibt konstante Größen in der Geschichte, die gleichsam die Achse bilden, um die sich das bunte Weltgeschehen dreht, und die alle sonst zusammenhanglos auseinanderfallenden Vorgänge auf den gleichen Nenner bringen. Es ist der zweite geistige Vorgang, der hinter dem äußeren Geschichtsbild steht und Ereignisse hervorruft, Schicksal schafft und einen letzten großen Sinn enthüllt. Dahinter liegen alle großen Entscheidungen, der Finger Gottes, jene Sinngebung, ohne die alles ins Sinnlose und ins Chaos sinken würde.
Diese konstanten Größen sind Staat und Kirche. Sie sind im Sinne der heiligen Reichskrone Karls des Großen kein Gegensatz, sondern vielmehr eine organische Ergänzung und eine Zweieinheit wie Leib und Seele, Zeitliches und Ewiges, Weltliches und Überweltliches. So erschien der Kaiser in der Kirche als das weltliche Schwert zum Schutze des religiösen Sittengesetzes und einer Weltordnung, die in den göttlichen Geboten verankert ist.
Zum tragischen Verhängnis wird es erst, als diese beiden grundlegenden Mächte, die wir als konstante Größen bezeichnet haben, Staat und Kirche, miteinander in Konflikt geraten. Dieser Kampf erfüllt tosend die Räume der Geschichte. Er ist die Tragödie Deutschlands. Man kann die Geschicke nicht verstehen, wenn man sie nicht von diesem letzten Grund aus begreift. Der Streit zwischen Kaiser und Papst unter den Saliern und Hohenstaufen sucht Europa mit Schrecken und Blutvergießen heim und läßt den Glanz des deutschen Kaisertums untergehen. Eine dauernde Schwächung hat Deutschland davongetragen. Österreich ist verschont geblieben, weil es an dem Zwiespalt nicht teilgenommen hatte und nur später, allerdings wider Willen, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die innere Einheit war gewahrt geblieben; die Babenberger gehorchten dem Wahlspruch: Österreich gehorcht nur Gott und dem Heiligen Vater; ja der letzte, Friedrich der Streitbare, gab sein Land testamentarisch als Lehen Gottes nicht dem staufischen Kaiser, sondern dem Papst in die Hände. Von dem gleichen Grundsatz waren die Habsburger beseelt, die das gesunkene Kaisertum in eine neue Gloriole erhoben.
Der alte geschichtliche Kampf gegen die geistig übergeordnete Hoheit der Kirche und des Papstes entbrannte aufs neue durch das Luthertum, dessen Vorspiel und Schrittmacher der tschechische Hussitismus war. Der unselige Streit entzündete sich an den Ablaßgeldern, von denen der Petersdom in Rom als Glorie der Kirche und höchste Entfaltung der Künste, als ein Werk göttlichen Triumphes, erbaut wurde, während sich Deutschland darum in Schutt und Asche stürzte. Mit nie zuvor erhörter Schroffheit wurde das innere Band und damit die Nation zerrissen. Aus der nie geschlossenen Wunde sind die heillosesten Wirren und Leiden der damaligen und späteren Zeit hervorgegangen bis auf den heutigen Tag. Das Türkenzeitalter war gewiß eine schwere Heimsuchung, aber sie wurde überwunden; die religiöse Spaltung blieb ein dauerndes Übel, das immer neue wechselnde Krankheitserscheinungen hervorrief.
Nicht nur die Befreiung Europas von den Türken, sondern als noch höhere Aufgabe die Wiederherstellung der kirchlichen Einheit hatte sich Karl V. zum Ziel gesetzt. Daraus erwuchs seine Tragödie. Sie hebt, wie wir gesehen haben, mit seinem ersten Reichstag zu Worms an. Der unscheinbare Mönch, der Luther hieß, ließ in jenem Augenblick nicht ermessen, welcher Gigantenkampf daraus entstehen würde. Auf allen Schlachtfeldern Europas kämpften österreichische Heere in der Folgezeit für den Gedanken Gottes. Sogar bis Afrika trug Karl V. den Kampf gegen den dreifachen Feind vor, gegen den Halbmond, dessen Riesenmacht gestärkt wurde durch Franz I. von Frankreich und durch die Protestanten gegen den Kaiser. Der schlägt 1535 ein maurisches Heer und erstürmt Tunis. In den 40 Jahren seiner Regierung hat er 40 große Züge unternommen, darunter zweimal nach Afrika; achtmal hat er das Mittelmeer, dreimal den Ozean durchschifft. Schon die physische Leistung allein reißt zur Bewunderung hin, um so mehr das Heldentum und der weltumfassende Riesengeist, in dem alles vollbracht worden ist.
Man nannte ihn den letzten »mittelalterlichen Kaiser«, weil er die alte Größe und Einheit wiederherzustellen trachtete. Der Vergleich hinkt auf allen Beinen; er ist einseitig und verkleinernd; das Problem ist die Seele Europas und ihre innere Einheit, und das ist nicht nur mittelalterlich, sondern seit der Reformation die moderne Frage. Die Lutheraner verlangen nichts Geringeres als staatliche Herrschaft über die Kirche; der Landesherr wird zugleich Papst, der über Religion und Kirche willkürlich entscheidet und einen Gewissenszwang auf die Untertanen ausübt. Gegen diesen neuerlichen Investiturstreit und gegen die Verweltlichung des Religiösen hat Karl V., seine ganze kaiserliche Macht aufgeboten. Um die Höhe und Heiligkeit der Kirche und somit der Gottesidee vor der Profanierung zu schützen, wenn er auch gelegentlich auf politischem und territorialem Gebiet, also aus anderen Gründen, den Papst gegen sich hatte.
Auf dem Reichstag zu Augsburg hat der Kaiser zwar die Aufhebung der evangelischen Landeskirchen verfügt; er meint, damit die Kluft in der Kirche geschlossen zu haben; aber in dem schmalkaldischen Bund lehnen sich die Fürsten offen gegen Kaiser und Reich auf; es kommt zum Krieg. Als Karl V. abends am 24. April 1547 über das Schlachtfeld von Mühlberg reitet, kann er sagen, daß er nun wirklich unumschränkter Herr über Deutschland ist und daß es das, was man herkömmlicherweise und ganz fälschlich die »Reformation« nennt, nämlich den Abfall von der Kirche, nicht mehr gibt. Der große historische Augenblick war eingetreten: die weltliche und religiöse Souveränität der deutschen Fürsten lag zerbrochen zu des Kaisers Füßen. Der Anbruch der Weltmonarchie war in diesem Augenblick besiegelt. Haus Habsburg herrschte nicht nur über Spanien und Österreich, über Deutschland, Burgund, Niederlande, Mailand und Neapel, sondern auch über Mexiko, Kalifornien, Peru, Chile und La Plata. Es war das Reich, in dem die Sonne nicht unterging.
So hat Makart, der große Historienmaler, den Weltbeherrscher auf seinem Triumphzug nach Antwerpen dargestellt: vier Weltteile: Asien, Afrika, Amerika nebst den Reichen Europas, als der gesamte damals bekannte Erdkreis, huldigen ihm bei diesem Einzug; es will uns scheinen, als ob Kunst und Dichtung in ihren anschaubaren Visionen der geschichtlichen Größe näherkommen als der gewöhnliche Geschichtsschreiber, der zu sehr an bloßen Daten hängt. So hat auch kein Geringerer als Tizian in seinem Gemälde den Kaiser aufgefaßt, der, dem Gralskönig Titurel vergleichbar, durch die Dämmerung von Mühlberg reitet in stahlblau glänzendem Eisenkleid, die Lanze in der Hand, auf schwarzem Roß mit scharlachroter Decke, den wehenden Federbusch am Helm, eine fast gespenstige Vision, die nicht nur das Kriegerische und Beherrschende, sondern auch das Unstete, schattenhaft Flüchtige, magisch Allgegenwärtige der kaiserlichen Erscheinung versinnbildlicht. Mit dem Höhepunkt der kaiserlichen Macht fällt auch die nie mehr erreichte Blütezeit der Künste zusammen; Bramante und Michelangelo, der Schöpfer der Sankt Peterskuppel, sind am Werk; Ariost besingt die Taten Karls des Großen; Torquato Tasso das befreite Jerusalem; Dürer, Leonardo, Tizian vollenden ihre Meisterwerke; neben Nürnberg gewinnt das Fuggersche Augsburg Glanz und Ansehen. Hier bestehen tiefe verborgene Zusammenhänge, die man von der Herrschergestalt nicht ablösen kann.
Von der Höhe erfolgt jäher Sturz. Moritz von Sachsen, im Bunde mit dem Franzosenkönig, führt eine Wendung herbei, so plötzlich, daß der Kaiser vor ihm aus Innsbruck flüchten muß. So labil sind die Gewalten der Erde. In dem Augsburger Religionsfrieden 1555, den Karls Bruder Ferdinand von Österreich schließt, geht alles Errungene verloren. Die Wiederversöhnung der Kirche war mißlungen; es war nicht Schuld des Kaisers, der Übermenschliches wollte. Daß es scheitern mußte, war seine Tragik, noch mehr die des Reichs. Schwermütig zieht er sich in die Klosterstille von Estremadura zurück, sterbend das Wort auf den Lippen: »In Deine Hände befehle ich Deine Kirche!«

Kaiser Karl V.
(Gemälde von Tizian. Mailand)
In dem sogenannten Religionsfrieden von Augsburg, den Ferdinand I. als deutscher König notgedrungen schließen mußte, erblickte Kaiser Karl V. eine Niederlage seiner Politik und zog daraus die Konsequenzen, indem er abdankte. Niemals dachte er daran, das Landeskirchentum und damit die fortdauernde Spaltung in Kirche und Reich anzuerkennen. Sein Urteil war entschieden: »Die Fürsten werden das Kaisertum zerstören, dann wird die Demokratie über sie kommen und sie vernichten.« Dieser prophetische Ausspruch, der sich als allzu wahr erwiesen hat, leuchtet in Grillparzers Drama »Bruderzwist« auf, von dem noch die Rede sein wird.
Ferdinand I., der schon 1532 in Aachen zum deutschen König gekrönt worden war und 1555 seinem Bruder in der Kaiserwürde nachfolgte, war wohl der Meinung, daß der Augsburger Friede eine spätere vollkommene Einigung nicht ausschließe, eine Hoffnung, an der das Haus Habsburg hundert Jahre lang bis Kaiser Leopold I. festhielt, der durch Bischof Spinola den letzten vergeblichen Versuch machte. Tatsache aber war, daß dieser Augsburger Religionsfriede die Quelle dauernden Unfriedens und der schwersten folgenden Kriege wurde. Der Grundsatz: Cujus regio, ejus religio, wurde sanktioniert, Andersgläubige konnten zur Auswanderung gezwungen werden. Doch sollte den protestantischen Ständen in geistlichen Gebieten freie Religionsübung gewahrt bleiben. Das war eine auffällige Begünstigung der protestantischen Herren, wogegen die Katholiken Einspruch erhoben, die den geistlichen Vorbehalt machten, wonach ein katholischer Geistlicher, der evangelisch wurde, dadurch seine Ämter, Einkünfte, Würden verlieren soll. Dieser »geistliche Vorbehalt« wurde auch bald angefochten; in einem wesentlichen Teil drehte sich der Dreißigjährige Krieg darum, ihn zu beseitigen. Es ist nur zu begreiflich, daß der Kaiser mit einem solchen Friedensschluß nicht einverstanden sein konnte, der den heroischen Kampf seines Lebens nicht mit einem Sieg, sondern mit einer Kapitulation krönte.
*
Ergreifend ist der Abschluß dieses tragischen Lebens, das in allen Stücken das Bild eines Gottesstreiters und sittlichen Helden darstellt.
Als der Weltbeherrscher Karl V., in dessen Reich die Sonne nicht unterging, sich infolge des von seinem Bruder Ferdinand I. beschlossenen sogenannten Augsburger Religionsfrieden enttäuscht und schwermütig von der Welt zurückzog, sprach er im Herbst 1555 vor den niederländischen Ständen in Brüssel Abschiedsworte, die eine erschütternde Lebensbeichte bedeuten. Er beteuerte zunächst, daß er die Kaiserkrone nach dem Tode seines Großvaters Maximilian angenommen, um für das Wohl Deutschlands, seines teuren Vaterlandes, und seiner anderen Reiche zu sorgen und der gesamten Christenheit den Frieden, die Eintracht zu erhalten und zu verschaffen, ferner alle Kräfte der Christenheit gegen die Türken zu wenden. Einesteils sei es der Zwiespalt in der Religion, andernteils die Eifersucht und der Neid der Nachbarn gewesen, die ihn an der Ausführung seines Vorsatzes gehindert haben. Dann sprach er von den Mühen, Sorgen und Anstrengungen seines Lebens, von den vierzig großen Zügen und Reisen, die ihn bis Afrika führten und die seine Gesundheit zerrütteten und seine Kraft vor der Zeit aufzehren mußten. Darum sei es längst sein Wunsch gewesen, sich in die Stille und Ruhe zurückzuziehen ...
Nachdem er dargelegt, wie der französische König und einige Deutsche den Frieden gebrochen haben, und wie er den Franzosen gezwungen, ruhmlos heimzukehren, fährt er fort: »Ich habe getan, was durch Gottes Zulassung mir verstattet war. Denn nicht bei uns selbst steht der Ausgang, sondern nur bei Gott. Unser ist es zu tun, was wir vermögen, und Gott zu danken auch im Unglück. Wieviel Dankes aber wir schulden, seht Ihr daraus, daß wir nicht zu klagen haben über eine bemerkenswerte Niederlage, die ein schweres Unglück, daß wir dagegen uns freuen dürfen über eine Kette von Siegen.« Hierauf mahnt er die Anwesenden, untereinander Frieden zu halten: »Bewahret unter Euch die Eintracht der Gemüter und gegenseitiges Wohlwollen, beweiset der Gerechtigkeit und den Gesetzen die schuldige Ehrfurcht und haltet auf ihr Ansehen und ihre Macht. Vor allen Dingen hütet Euch, durch die Sekten der Nachbarländer Euch irreführen zu lassen. Wenn vielleicht einige derselben bei Euch Wurzel geschlagen haben, so tretet ihnen entgegen mit höchstem Fleiße und rottet sie aus, wenn Ihr anders nicht wollt, daß alles in heillose Verwirrung gerate.«
Zum Schluß klagt er sich selbst an, mehr als einmal schwer gefehlt zu haben durch Unkenntnis und menschliche Schwäche und bittet alle um Verzeihung mit den Worten: »Das jedoch wage ich vor Euch auszusprechen: ich habe niemals mit Wissen und Wollen irgendeinem meiner Untertanen Gewalt oder Unrecht getan oder geduldet, daß es geschehe. Wenn dennoch jemand mit Recht in etwas sich beklagen kann, so bezeuge und versichere ich, daß es wider mein Gewissen und wider meinen Willen geschehen sei und rufe darum Euch alle zu Zeugen, daß es mir mißfalle, und bitte die Gegenwärtigen und die Abwesenden, daß sie es mir verzeihen wollen.«
Der Kaiser mußte enden: seine Stimme erlosch, sein Antlitz wurde blaß, die Kräfte schwanden; lautes Schluchzen war im Saal zu vernehmen. Die edlen Worte, die er gesprochen hatte, enthielten Größe; sie warm ein Testament, eine Mahnung für alle Zeiten, beherzigenswert auch in unseren Tagen. So spricht man vor Gott, am jüngsten Tag; es war etwas wie Weltgericht darin.
Die Regierung der spanischen Länder gab Karl an seinen Sohn Philipp; die Kaiserkrone sandte er durch Wilhelm von Oranien an Ferdinand, der sie auf dem Reichstag zu Frankfurt entgegennahm. Dann ging er zu Schiff nach Spanien und beschloß seine Tage als Eremit des heiligen Hieronymus in dem Kloster San Yuste in Estremadura.
*
Gerade in diesen Tagen wird die Aufmerksamkeit auf den fast seit 600 Jahren bestehenden Hieronymiten-Orden gelenkt durch den Umstand, daß der Heilige Vater kürzlich die Aufhebung dieses erlöschenden Ordens beschlossen hat. Er war ursprünglich eine Zusammenfassung der Eremiten-Kongregationen, die der Regel des heiligen Franziskus gehorchten und später die Augustiner-Regel mit Zusätzen aus den Schriften des heiligen Hieronymus annahmen. Auch in Wien gab es ein Frauenkloster dieses Ordens, das in der Zeit Friedrich III. gefallene Mädchen, öffentliche Dirnen zum reuigen, frommen Tugendleben zurückführte, und von dem in den damaligen Schriften gesagt wurde, daß es hoch in Zucht und Ehren stand, und daß keine dieser büßenden Magdalenen rückfällig wurde; ihre Schwestern würden sie in der Donau ertränkt haben.
Der älteste Zweig des beschaulichen Ordens ist der spanische, der von dem Portugiesen Vasco und von dem Spanier Pedro Fernandez Pecha von Guadalajara gegründet wurde. Aber auch seelsorgliche und wissenschaftliche Aufgaben hatte er übernommen und gewann die Führung über das spanische Ordensleben in der Zeit, als Karl V. in San Geronimo de Yuste seinen Lebensabend als Hieronymit verbrachte.
Mit einem kleinen Gefolge war der Kaiser in das Tal des Friedens eingezogen, das sich zwischen Felsen eröffnete und mit seinen rieselnden Quellen und Brunnen, seinen südlichen Gewächsen und Früchten, seinen blauen Fernsichten dem Lande Eden glich, wo über den stillen Garten hinter Klostermauern die Glocken des Friedens und der emportragende, schwebende Gesang der Mönche in ruhigen Wellenkreisen hinhallten. Der Kaiser wurde in einer Sänfte getragen; in dem Fensterausschnitt stützte er das Haupt in die Hand und blickte schwermütig in die liebliche Landschaft hinaus, die einem Gemälde von Meisterhand glich. Die Kutten der Mönche, die schwarze Rüstung spanischer Granden, die ihn auf schwarzen Hengsten begleiteten, gaben dem ganzen das Gepräge eines Trauerzuges, eines Heimganges ins Ewige. Beim Felseingang des Tales wandte der Kaiser noch einmal unwillkürlich den Blick zurück wie zum letzten Abschied von der Welt und von den Stürmen seines tatenreichen, opfervollen Lebens; dann lehnte er sich mit einem Seufzer der Erleichterung zurück – alles lag nun hinter ihm. Die Wohlgerüche der Landschaft, der Duft der Farben belebten und erfrischten ihn; mit Wohlgefallen hing sein Auge an dem gnadenvollen Bild; er mochte fühlen, daß seine innerste Natur zur Beschaulichkeit neigte, für die er bisher so wenig Zeit hatte.
Nun freute es ihn, seine Gärten zu pflegen, Uhren zu machen, und viele Stunden der Andacht und der Lektüre widmen zu können, wobei ihn unter anderem die Schriften des heiligen Bernhard von Clairvaux fesselten. Er konnte Gott nicht genug danken für die Wohltat, daß er ihn »die Nichtigkeit aller irdischen Größe habe einsehen lassen«.
Ein Echo der bösen Welt schlug freilich zuweilen herein: die Schmähschriften, die der Kurfürst von Sachsen durch den Geschichtsschreiber Sleidanus verbreiten ließ. Die ganze spätere Geschichtsschreibung mit ihren Entstellungen und Feindseligkeiten beruht auf diesem Werk. Heute noch sprechen gewisse Historiker geringschätzig von dem »Spanier«, der nicht einmal recht die deutsche Sprache beherrscht haben soll und es versäumt habe, den deutschen Nationalstaat aufzurichten! Als ob die Mentalität des Zweiten oder Dritten Reiches damals denkbar gewesen wäre, wofern der Kaiser überhaupt spießbürgerlich national-liberalen Ideen in seinem welthistorischen Format Raum gegeben hätte. Er begnügte sich über Sleidanus zu sagen: »Der Kerl lügt!« und verbot, diese und auch die Verleumdungen des französischen Königs zu widerlegen. Diese vornehme Haltung wird in der Welt als Fehler empfunden; sicher birgt sie einen Nachteil. So ist es geblieben in Österreich bis auf den heutigen Tag. Der Edle schweigt. Als man Karl V. vorhielt, Julius Cäsar habe die Siege bis zur Vernichtung des Feindes verfolgt, erwiderte er: »Die Alten hatten nur ein Ziel: die Ehre; wir Christen haben zwei: die Ehre und das Gewissen!«
Just in dem Jahre, da Luther in einer Anwandlung von Reue und Schmerz die schrecklichen Folgen seiner Lehre erkannte und das Weltende nahe glaubte, ja herbeisehnte, wurde – 1540 – der neue Orden vom Papst bestätigt, der als die »Armee Jesu« die eigentliche Reformation einleitete, die man fälschlich »Gegenreformation« bezeichnet. Eine geistige Streitmacht trat auf den Plan, die sich selbst »die leichte Kavallerie des Heiligen Vaters« nannte und ihre entscheidenden Schlachten auf österreichischem Boden schlug.
In dem wunderreichen Spanien war es, wo Ignatius Loyola zu Montserrat, wo sich der Sage nach die Gralsburg befand, zu seiner welthistorischen Sendung erweckt wurde. Wieder ereignet sich ein Parzival-Schicksal, die Hinwendung des weltlichen Rittertums zu einem höheren im Dienste des Ewigen, wie es dichterisch die Gralsidee und das Gralsrittertum versinnbildlicht. Auch das Leben des heiligen Franziskus erscheint als ein solches Parzival-Schicksal, und so war es der Fall mit Ignatius von Loyola, der den heiligen Franziskus zum Vorbild nahm. Wie dieser war auch Ignatius ein gewaltiger Kriegsmann, den Freuden der Welt und ihrem lockenden Ruhm hingegeben. Im ritterlichen Minnegeist der damaligen Zeit, den die Dichtung der Troubadours widerspiegelt und der zuletzt in Don Quijote eine heilsame Verspottung findet, träumte auch Ignatius von einer unbekannten schönen Dame, in deren Dienst er seine Heldentage vollbringen wolle.
Er hatte sich dem Soldatenstand gewidmet und lag in der kleinen Grenzfestung zu Pamplona des Königreichs Navarra, die von Franz I. belagert wurde. Schon wollte sich die Besatzung der Übermacht ergeben, um das bloße Leben zu retten, da war es Ignatius, der Offiziere und Mannschaft bestimmte, die Festung bis zum letzten Hauch zu verteidigen. In den darauffolgenden Stürmen zerschmetterte ihm eine Kanonenkugel beide Beine. Auf dem Krankenbett kam ihm an Stelle der beliebten Rittergeschichten eine Heiligengeschichte in die Hände; bei dieser Lektüre begann eine Wandlung seines ruhmsüchtigen Geistes. Kaum geheilt, unternahm er, auf einem Maultier reitend, eine Wallfahrt nach Montserrat. Es war der Weg des irrenden Ritters zum heiligen Gral, der Weg der Sühne, der Demut, der Gnade. In der Kapelle Unserer Lieben Frau wurde ihm klar, daß die unbekannte schöne Dame, die er im dunklen Drang gesucht, und der er seine Dienste weihen wollte, niemand anderer sei, als die Mutter Gottes selbst, vor der er in Waffen Wache hielt als »Soldat Unserer Lieben Frau«.
In Manresa, unweit des Klosters vom heiligen Berge Montserrat, verbrachte er viele Wochen in Einsamkeit und Betrachtung, gleichsam in der Wüste, ehe er sich zu seiner Pilgerfahrt nach Jerusalem anschickte. In diesen Manresa-Tagen entwickelte er an Hand der eigenen tiefsten Seelenerfahrung jene geistlichen Übungen oder Exerzitien, die die Seele tauglich machen als Instrument Gottes zur Verteidigung der heiligsten Güter, so wie etwa die militärischen Übungen den Leib tauglich machen zur Verteidigung des Vaterlandes, des irdischen als Abbild des himmlischen. Zu den drei gewöhnlichen Ordensgelübden: Armut, Keuschheit und Gehorsam, fügte er noch ein viertes hinzu: unbedingte Unterwerfung unter die Befehle des Heiligen Vaters. Zum erstenmal war das Führerprinzip entwickelt, von dem heute so viel die Rede ist, und das willenlose Unterwerfung fordert. Es ist aber nur dann berechtigt und von Segen, wenn der Wille Gottes, das christlich-religiöse Sittengesetz, die Quelle ist; und es wird zum Fluch, wenn die Führergeister nicht aus Gott sind, wie man das heute vielfach sehen muß.
Die Exerzitien waren das große Erziehungsmittel der Völker und Kulturen, das dem furchtbaren Verfall Einhalt tat und eine neue Blütezeit heraufführte, die im Ewigen und Überzeitlichen verankert war wie die Gotik, die neue Kunstepoche des Barock. »Wie ein erfrischender Lenzhauch in eine ausgebrannte Steppe«, sagte der österreichische Barockforscher Albert von Ilg, »brach die Jesuitenkunst in Österreich herein. Mehr als die Dragoner Ferdinands haben die Jünger Jesu die Menge in die berückende, von süßen Musikklängen durchzitierte Pracht der barocken Gotteshäuser getrieben, die als Gesamtkunstwerke alle Künste vereinigten und in den Dienst des Höchsten stellten.« Er meinte Ferdinand II. und erliegt dem landläufigen Irrtum, daß die Menge durch Dragoner in die Kirche getrieben wurde, und daß an irgendwelchen Gewaltsamkeiten die Jesuiten beteiligt gewesen seien. Kein Orden wurde je so gehaßt und gefürchtet wie dieser; das spricht allein schon für seine Erfolge. Bis in unsere Schulbücher hinein wurden Schauermären erzählt über die politischen Machenschaften der Jesuiten, die als Beichtväter der Könige und Königinnen die Schicksale nach ihrem Willen gängelten. Dieses törichte Geschwätz zerfällt in Nichts vor dem Ausspruch des großen Bacon: »Wenn ich sehe, was dieser Orden in der Erziehung leistet, in der Ausbildung sowohl des Charakters wie der Gelehrsamkeit, so möchte ich sagen: da du so bist, wie du bist, so wünschte ich, du wärst der unserige.«
Zu den Großtaten des Ordens gehören die Errichtung des christlichen Idealstaates von Paraguay und die Missionserfolge in Japan und China. Die Kulturmacht des deutschen Südens, insbesondere Österreichs und seiner Weltstellung, ist in grundlegender Weise ein Werk der Jesuiten. Ferdinand I. berief sie nach Wien, wo sie ihre ersten Schulen einrichteten; unter diesen gelehrten Ordensmännern befand sich Peter de Hondt aus Nymwegen, genannt Pater Canisius, der den ersten Katechismus schuf, ein einfaches Religionsbüchlein für das Volk, das eigentlich die tiefste, weltumfassende Philosophie enthält. Es war Ordensbefehl, sich in keine politischen Angelegenheiten einzumischen; die Jesuiten waren dafür auch viel zu klug und konnten sich auf die unzerstörbare Überlegenheit des Geistes über die Dinge dieser Welt verlassen.
Auch auf dem Konzil von Trient standen die Genossen des Ignatius, zu denen Franz Xaver und Lainez gehörten, im Vordergrund. Dieses Konzil war zur Beilegung des Kirchenstreites, die Ferdinand I. vor allem am Herzen lag, einberufen worden und sollte die Fragen entscheiden, die auf dem Augsburger Religionsfrieden einer endgültigen späteren Regelung vorbehalten bleiben sollten. Der Kaiser hoffte noch immer, Papst und Protestantismus zu versöhnen und durch Nachgiebigkeit sein Ziel zu erreichen. Sein »Reformationslibell« verlangte Volkssprache beim Gottesdienst, Kommunion unter beiden Gestalten und Priesterehe. Aber die protestantischen Fürsten beschickten weder das Konzil, noch wollten sie das eingezogene Kirchengut herausgeben, noch auch den Grundsatz von » cujus regio, ejus religio« (wessen Herrschaft, dessen Bekenntnis), der aber nur einseitig zugunsten der Protestanten gelten sollte, preisgeben, denn das war für sie der Gewinn des Augsburger Friedens.
Das Konzil, das 1563 geschlossen wurde, lehnte die Vorschläge des Kaisers ab, es erklärte die Begriffe der katholischen Lehre und festigte das entscheidende Prinzip, wonach das Oberhaupt der Kirche frei sein muß und nicht unter weltlicher Obrigkeit stehen kann. Idee und Geist herrsche über dem Stoff, das Ewige über dem Vergänglichen, und nicht umgekehrt. Durch diese Beschlüsse, die die Grundlage alles dessen sind, was fortan Katholizismus heißt, war die endgültige Trennung vom Protestantismus vollzogen, der seine Kirche zur Dienerin der weltlichen Obrigkeit machte. Verständigung war unmöglich. Es gab nur Kampf oder Belehrung. Lehre und Erziehung war das Amt der Jesuiten. Es war das eigentliche Kampfmittel Ferdinands und seiner Nachfolger. Sein Sohn Maximilian II. suchte noch mehr als der Vater durch Nachgiebigkeit auszugleichen. Er war protestantisch gesinnt und meinte, was an sich gewiß richtig ist, »Religionssachen wollen nicht mit dem Schwerte gerichtet und behandelt sein«.
Als die Jesuiten ihre Erziehungsarbeit und den seelischen Wiederaufbau in Österreich begannen, gab es in allen Teilen des Landes, besonders in der Steiermark, fast keine Katholiken mehr. Während der Protestantismus die deutschen Fürsten in ihrer Macht stärkte, schwächte er umgekehrt in Österreich den Kaiser und mithin das Reich. Aber eine Wende war eingetreten: mit dem Tridentinum und mit der Geistesmacht des neuen Ordens begann die eigentliche Reformation, die man, wie gesagt, fälschlich Gegenreformation nennt.
Um 1600 war Österreich so gut wie »gleichgeschaltet«. Es war lutherisch. Maximilian II., innerlich Protestant, tat nichts dagegen; seine Söhne Kaiser Rudolf II. und Matthias mußte sich in ihrem Bruderzwist auf die protestantischen Stände stützen – es gab fast keine Katholiken mehr in Österreich. Jeder Grundherr fühlte sich als Papst und Landesfürst, bestimmte den Glauben seiner Untertanen, konfiszierte Kirchengüter, besetzte die Pfarren mit Prädikanten, verbündete sich gegen den Landesherrn oft mit dessen Feinden, sogar mit den Türken.
»Gleichschaltung«, die den Schwerpunkt außerhalb sucht, wirkt immer verheerend, auflösend; das fremde Gift kreist immer noch in unseren Adern und wirkt aus in verschiedenen Krisenformen bis auf den heutigen Lag, wenn auch von der gesunden Seelennatur Österreichs immer siegreich überwunden.
Ein bunt bewegtes Bild von der Reformationszeit in Österreich entwirft Franz Grillparzer, dieser österreichische Shakespeare, in seinem aufschlußreichen Staatsdrama »Bruderzwist in Habsburg«, das nicht nur den persönlichen Konflikt zwischen Rudolf und Matthias, sondern den Zwiespalt der Weltanschauung, die Tragödie des Reiches, den Riß der deutschen Seele und die Krise des österreichischen Volkes widerspiegelt.
Der »Bruderzwist« deckt die Ursache des Verfalls auf im Glaubensstreit: »Denn wo der Glaube fehlt, da fehlt die Hoffnung!« Das geschichtliche Drama setzt uns mitten hinein in das Zeitbild: überall klaffen die Widersprüche, politisch, religiös, offen und heimlich; es geht um die Frage, ob der angestammte Fürst herrschen soll oder die aufrührerischen Stände und der Eigennutz der Parteien, die stets an ihren Endsieg glauben – ganz wie heute. Da ist der undurchsichtige politische Drahtzieher Bischof Klesel, heimlich paktierend mit diesen protestantischen Ständen, die, gegen Kaiser und Reich mit den Türken im Bund, Privilegien ertrotzen und über die das bezeichnende Wort fällt: »Und sag ich's nur: die Fähigsten, die Kühnsten – die Ketzer sind's, ich weiß nicht, wie es kommt!«
Da ist ferner Kaiser Rudolf II., zwar nicht innerlich ein halber Protestant wie sein Vater Maximilian II., sondern streng katholisch, doch unglücklicherweise kein Mann der Tat, in Astrologie verstrickt, ein Denker, ein Träumer, ein Hamlet, ein Frommer, ein Weiser, – über ihn fällt das tragisch bedeutsame Wort: »Das ist der Fluch von unserm edlen Haus, – Auf halben Wegen und zu halber Tat – Mit halben Mitteln zauderhaft zu streben. – Ja oder nein, hier ist kein Mittelweg.« Man wird wohl bemerken, daß dieser Spruch nicht nur der Person, sondern ganz allgemein dem österreichischen Wesen gilt und bis auf den heutigen Tag immer wieder zutrifft.
Da ist Matthias, der Bruder, der die Herrschaft erstrebt mit Hilfe der protestantischen Stände; er ist ein Spielball in der Hand Klesels, der von Matthias sagt: »Zum Herrscheramt fehlt ihm die Festigkeit – nicht Kraft, doch das Beharren im Entschluß.«
Doch spüren wir schon jenen kommenden starken Ferdinand II., einstweilen Erzherzog von Steiermark, zu dessen Zeit es fast keine Katholiken mehr in Österreich gab. Mit diesem Ferdinand setzt die Gegenbewegung energisch ein; er macht von dem protestantischen Grundsatz, wonach der Landesfürst über den Glauben seiner Untertanen entscheidet, mit vollem Recht auch für den Katholizismus Gebrauch; jene, die sich nicht fügen, können von dem Recht der Auswanderung Gebrauch machen. Die Stiftung der Grazer Jesuiten-Universität 1585 war der Wiedererneuerung des katholischen Glaubenslebens, die mit Ferdinand II. zuerst von Graz ausging und in irreführender Weise als »Gegenreformation« bezeichnet wurde, gewidmet. Es ist der starke Ferdinand, der kein anderes Trachten kennt: »Als Österreichs Wohl und Jesu Christi Ruhm – Auf daß das Land ein wohlbestellter Garten – Ein Ährenfeld zu Frucht dem höchsten Herrn.«
Wir spüren auch schon Wallenstein und die blutigen Schatten des Dreißigjährigen Krieges, die der Glaubensstreit vorauswirft; wir spüren aber auch die weltgeschichtliche Prophezeiung, deren letzte Erfüllung wir in unserer Gegenwart erlebt haben, und die der Dichter dem Kaiser Rudolf II. in den Mund legt. Aus dem lebensvollen Wien, dem Sitz der Ahnen, hat sich Rudolf in das stillere Prag geflüchtet, das nach Karl IV. durch ihn eine neue zweite Kunstblüte erlebte. Er war am spanischen Hof erzogen und hatte einen ausgeprägten Sinn für die Form und mystische Bedeutung des Herrschertums, ein Freund der Künste und der Wissenschaft, ein Friedensfürst, kein Streiter. Das Geheimnisvolle, Dunkle auch auf diesem Gebiete zog ihn an, Alchimie und Sternenkunde; das mystische Prag, wo Tycho de Brahe lebte, den er ebenso wie Kepler an seinen Hof zog, entsprach seinem mystischen Geist. Weltabgewandt, ja weltscheu, mißtraute er den Menschen, am meisten seinem Bruder Matthias und ward zugleich das Opfer falscher Ratgeber und ungetreuer Helfer. Trotzdem waren seine Erkenntnisse tief und klar, hoheitsvoll und unwiderleglich wie die Sterne am nächtlichen Himmel, in denen er Schicksale prophetisch zu lesen versuchte, über den ewigen Geheimnissen die unmittelbare Wirklichkeit vergessend, die nicht weniger schwere Rätsel zu lösen aufgab.
Aber das Entscheidende hat er erkannt; im Gespräch mit dem edlen Protestanten, dem Herzog von Braunschweig, legt es ihm der Dichter in den Mund, so wie er es gesagt haben könnte, zugleich ein Bild der Zeit von einst und später. Der Herzog meint, es ginge nur um Satzungen des Glaubens; der Kaiser widerlegt: die Macht ist's, was die Ketzer wollen und alles Unerlaubte macht sich frei ... Der Reichsfürst löst sich von dem Reich, der Adel von dem Fürsten; es herrscht der Eigennutz und die Verschwendung, zum Schluß die Not. Die Helden nennt man Toren; man spottet über Weise, die nicht klug für eigenen Säckel; man achtet nur, was Zinsen trägt; nur der gemeine Nutzen gilt. Bis aus den untersten der Tiefen ein Scheusal aufsteigt, nach allem lüstern und durch nichts zu füllen; der Barbar aus eigenem Schoß, der alles Hohe stürzt, die Kunst, den Staat, die Kirche, bis alles gleich, ei ja, weil alles niedrig!
In diesen Gedanken liegt die Tragik der Reichsgeschichte seit 400 Jahren, die Hinwendung zur materialistischen Lebensauffassung, die Entwicklung zum bürgerlichen Liberalismus, zur Nationalvergottung und Bolschewismus: die Tragik von damals und von heute.
Eine österreichische Staatsphilosophie liegt zugleich in dem geschichtlichen Drama und findet Ausdruck in der tiefen Deutung Österreichs mit Worten, die der Dichter Rudolf II. sprechen läßt: »Mein Haus wird bleiben immerdar, ich weiß – Weil es mit eitler Menschenklugheit nicht – Dem Neuen vorgeht oder es hervorruft – Nein, weil es, einig mit dem Geist des Alls – Durch klug und scheinbar unklug, rasch und zögernd – Den Gang nachahmt der ewigen Natur – Und in dem Mittelpunkt der eigenen Schwerkraft – Der Rückkehr harrt der Geister, welche schweifen!«
Dieser Rückkehr harren, ist vielleicht eine der feinsten Lebenslehren, die uns der Dichter und Österreicher zu geben hat. Treffender kann man das ewige Österreich und dessen Verbundenheit mit Gott und Natur nicht charakterisieren. Und wenn auch noch immer das bedeutsame Wort des Dichters gilt: »Das Schwerste dieser Welt ist der Entschluß«, so zeigt doch die Geschichte, daß dieses tiefe, edle, duldende, überwindende Österreich eine heroische Natur ist, ein sittliches Heldentum, das in den schwersten Lagen nicht den Mut verlor und nicht verzweifelte und darum immer wieder gerade in den Augenblicken, wo es der Auflösung nahe schien, wie durch ein Wunder aus seinem Unglück und seinen Niederlagen sich zu neuer Herrlichkeit erhob. Das waren die großen historischen Augenblicke, die beides enthielten: Vernichtung und wunderbare Errettung. Zu diesen Krisenzeiten als Zeiten der Wende gehörte der »Bruderzwist« in der Reformationszeit Österreichs.
Der Abfall von der Kirche war eine jener geistigen Ansteckungen, die über Grenzen und Länder wirken und sich wie eine Seuche verbreiten. Man hat ein Bild von dieser Gefahr, wenn man etwa an den heutigen Bolschewismus denkt, an den marxistischen oder nationalen, die ja beide, ebenso wie die sogenannte »Aufklärung«, späte Sprößlinge jener revolutionären Abfallbewegung sind, und mit ihr in einem ursächlichen und geistigen Zusammenhang stehen. Man wird gut tun, sich jene fernen Dinge in dem lebendigen Erfahrungsbild unserer gegenwärtigen und jüngsten Vorgänge vorzustellen, um das Vergangene zu begreifen, das in diesem Bild naherückt und als verwandte Größe nach einem gewissen Gesetz von der Wiederkehr des Gleichen wie etwas Gleichzeitiges erscheint. Auch die protestantische Bewegung hat in ihren extremen Auswirkungen, wie in den Bauernkriegen und den Perversitäten der Wiedertäufer alle jene kommunistischen Erscheinungen, Entfesselungen der Sinne und Überspitzungen des sozialrevolutionären Nationalismus gezeitigt, die wir aus unserer unmittelbaren Gegenwart kennen. Also alles schon dagewesen, auch die Methoden.
Nur zum geringen Teil mochten religiöse Gewissensfragen die Triebfeder sein. Wie immer hatte das Kulturkämpferische den nie versagenden Anreiz in der Weckung der Begehrlichkeit gefunden: freie Liebe, Beraubung des Privateigentums, vor allem der Kirchenschätze, sozialer Umsturz, der das Unterste nach oben bringt. Zuerst ging die Ausbreitung der neuen Lehre durch Druckschriften vor sich, durch Karikaturen, Propagandazettel, Schmähschriften, Traktate und Erbauungsbücher; namentlich die akademische Jugend und die Intelligenz in den Städten waren für die Gleichschaltung mit dem Reich sehr empfänglich. Nicht weniger waren es die Adeligen und Grundherren, die sogenannten Stände, die in der neuen Bewegung ein Mittel sahen, nicht nur zur materiellen Bereicherung, sondern auch zur Erweiterung ihrer Macht und Unabhängigkeit gegenüber dem Staat oder dem Landesherrn, der im Gegensatz dazu nach zentralistischer Zusammenfassung streben mußte. Die Beamtenorganisation Österreichs, die Maximilian begründete, wurde von Ferdinand I. konsequent ausgebaut; seine straffe Verwaltung gab den Ländern, besonders nach dem Anfall von Böhmen und Ungarn, soweit dieses nicht türkisch oder revolutionär war, den Charakter moderner Staatlichkeit.
Es hat sich immer wieder gezeigt, und zwar zu allen Zeiten bis auf den heutigen Tag, daß eine Bewegung, die von draußen kommt, also kein österreichisches Eigengewächs ist, österreichisches Volkstum zerstört, und nur Entartung an Stelle bewährter Eigenschaften setzt. Was anderswo angemessen erscheinen kann, liegt dem Österreicher darum noch nicht. Es gibt ihm keinen neuen Wert, es nimmt ihm vielmehr seinen eigenen, oder verwandelt ihn in Unwert. Hören wir nur, was die damaligen Zeitgenossen über die Zustände sagen.
So berichtet der lutherische Prädikant Georg Pfitzing 1546 aus Pyrawarth in Niederösterreich: »Der Pastor und sein Weib betrinken sich, raufen und schlagen sich, das Volk geht umher wie das liebe Vieh.«
Auch die Wachau ist protestantisch geworden, aber in Weißenkirchen erheben sich Beschwerden über den Prediger Matthäus Rueff: »Der Vater führe die Töchter zum feilen Wein in die Gesellschaft frecher Gesellen, die Mutter feile ihre Töchter um einen Thaler an, Lästern, teuflischer Aberglaube (Hexenwahn), Verachtung der Predigt, Fressen, Saufen, Ehebruch, Kuppelei nehme überhand ...«
Der Theologe Lukas Backmeister aus Rostock fand bei seiner Kirchenvisitation in Österreich die meisten Prediger vollkommen unwissend, Pfarrhöfe und Schulen verfallen, »es sei vor Gott im Himmel zu erbarmen, daß eine solche babylonische Konfusion eine Religion solle genannt werden«. Und der Prediger David Schweizer klagte: »Rechtschaffene Prediger der neuen Lehre könne man in Österreich nicht bekommen, allein etwa Vollsäufer und Greiner, die gar nichts können, sondern wegen Gottlosigkeit anderswo verjagt sind.«
Aus diesen zeitgenössischen Schilderungen wird ohneweiters klar, daß der Österreicher, sobald er aus seiner himmelgewollten Harmonie gestürzt wird, sofort die Laster seiner Tugenden annimmt; er verwechselt Heim und Heimat mit Wirtshaus und wird ein »Vollsäufer und Greiner«. Die Verwahrlosung der Kirche ist nicht zu leugnen; aber die neue Lehre hat erst das Maß voll gemacht; es war noch keineswegs im Bewußtsein der Zeit, daß es sich bereits um zwei Kirchen handelte; diejenigen, welche zu reformieren glaubten, haben zunächst die ärgsten Verwüstungen angerichtet, die sich zugleich gegen Staat, Gesellschaft und Sittengesetz wendeten.
Eine der schlimmsten Ausgeburten dieser Umwälzung waren der Hexenwahn und die Hexenprozesse. Sie wüteten in den protestantischen Ländern mehr als in den katholischen. Die Wurzel dieser schrecklichen epidemischen Hysterie ist in der neuen Lehre zu finden, die die Natur entheiligt und diese als unentrinnbar der Sünde verfallen erklärt. Satan wird förmlich in die Weltherrschaft eingesetzt. Luther selbst nennt den Menschenwillen »unfrei und ein Pferd, das vom Teufel geritten wird, der überall seine Hand im Spiele hat, zuweilen eine Larve anzieht, als wäre er eine Sau, ein brennender Strohwisch«. Die lutherische Teufelslehre ist die eine Grundlage des Hexenwahns, die Entheiligung der Ehe und die Entfesselung der Sinnlichkeit ist die andere Grundlage. Beide führten zu jener Sexualpathologie, aus der der Hexenglaube hervorging. Eine ungeheure mystische Literatur entstand, die mit Teufelsmessen, mit Incubi und Succubi die Hexenweihe und ihre Fernwirkung begründet und psychische Phänomene behandelt, die wir heute ganz anders ansehen.
Eine geistige Umnachtung hat Platz gegriffen, die es als Vermessenheit erscheinen läßt, von einem »finsteren Mittelalter« zu reden. Die Finsternis begann jetzt erst mit der neuen Zeit, mit dem Bruch der alten religiösen Welt. Zugleich wurden Folter und Scheiterhaufen in Tätigkeit gesetzt. Hunderttausende von Menschen, zumeist alte Weiblein, aber auch sonst Unglückliche und Kranke wurden auf die grausamste Weise hingemartert und verbrannt. Die Geistesverwirrung war so allgemein, daß viele sich selbst bezichteten, vom Teufel besessen und Hexen oder Hexer zu sein. Bloße Angeberei genügte; der Nachbar war vor dem Nachbar nicht sicher, Eltern nicht vor den Kindern; kaum schützte Wissen und Ansehen, wenn nicht Macht dahinterstand. Es ist interessant, daß selbst die Mutter des berühmten Astronomen Kepler, das Kätherle von Leonberg, der Hexerei angeklagt war, die Tortur über sich ergehen lassen und den Feuertod erleiden sollte, vielleicht, weil sie ein spitzes Zünglein hatte. Nur mit Mühe gelang es dem großen Sohn, sie von der peinlichen Befragung zu befreien, vielleicht nicht so sehr Kraft seiner Beweise und Autorität, als kraft dessen, daß er kaiserlicher Beamter war. So entschied der Vogt zu Gueglingen, daß dem Weiblein die Instrumente des Nachrichters, also die Folterwerkzeuge, zwar gezeigt, daß sie aber nicht angegriffen und aufgezogen, noch sonsten gemartert, sondern »von angestellter Klag zu absolvieren und vonstatten gelassen werden soll«.
Die Seuche ließ erst nach, als die Richter selbst von den Angeklagten beschuldigt wurden, ihre Opfer behext zu haben, übrigens waren es die Jesuiten, die zuerst gegen den Hexenwahn auftraten, was deshalb unterstrichen werden muß, weil es eine üble Gepflogenheit geworden ist, die Ursache dieser Greuelerscheinungen der katholischen Kirche zuzuschieben. Diese Geschichtsverdrehung liegt auch dem bekannten »Hexenlied« von Ernst von Wildenbruch zugrunde, das als Dichtung durch diesen tendenziösen Wahrheitsmangel entwertet ist. Die Epidemie war wohl allgemein geworden und hatte religiöse und unreligiöse Gemüter ergriffen; aber ihr Ursprung ist anderswo zu suchen als im katholischen Glauben, der ja das eigentliche Heilmittel solcher seelischen Erkrankungen enthält. Erst mit dem Bruch und mit der Abschaffung der Sakramente, darunter jenes der Buße, ist die Hysterie gestiegen, die keine katholische Erscheinung ist. Immer, wenn sich Gottverbundenheit löst, nimmt Hysterie, Massenpsychose, Spaltung und Bruderkampf überhand, heute wie einst.
Wieder einmal stand Österreich vor der Auflösung; wieder einmal war es durch einen Wundermann errettet und erhoben zu um so größerer Macht in einem jener großen historischen Augenblicke, die die Weltgeschichte auf Jahrhunderte bestimmen. Das war die Sonntagsschlacht am Weißen Berg bei Prag, 8. November 1620, die darüber entschieden hat, ob der Kaiser herrschen wird oder eine feudale Ständerepublik, ob Österreich protestantisch wird oder katholisch bleibt.
Das Reich war in zwei Lager zerrissen: die protestantischen Fürsten schlossen sich zur »Union« zusammen unter Führung Friedrichs von der Pfalz und Christians von Anhalt; dagegen bildeten die katholischen Fürsten die »Liga« unter der Führung Max' von Bayern. Die protestantischen Stände in Österreich hatten in Verbindung mit der Union die Aufteilung Österreichs im Sinne; ganz Europa spitzte und war ebenfalls in zwei Lager geschieden, das eine für Österreich und den Kaiser, das andere gegen ihn, je nachdem sie zum Katholizismus oder zu einer der protestantischen Sekten neigten. Als Dritter freute sich der Türke.
In dieser drangvollen Lage mußte Kaiser Matthias am Ende seiner Tage daran denken, die unter den Erzherzögen aufgeteilten Lande in eine feste Hand zu vereinigen, nämlich in die Ferdinands, der schon in Steiermark Ordnung gemacht hatte. Heroisch ging dieser auf sein Ziel los: »Und wenn's Graz gilt!« Die Gegner wußten, was sie von ihm zu erwarten hatten und machten bei seiner Krönung zum König von Böhmen alle erdenklichen Schwierigkeiten. Er ließ keinen Zweifel und setzte gleich eine Tat, indem er den zweideutigen Bischof Klesl, diesen protestantischen Konvertiten und Meister in der faulen Kunst des Paktierens, kurzerhand durch den Obersten Dampierre und den Hofkammerpräsidenten Breuning verhaften ließ. Das ewige schwächliche Nachgeben unter den Vorgängern Ferdinands hatte ja das Übel so groß werden lassen, daß es schließlich die Existenz des Staates in Frage stellte.

Der Prager Fenstersturz am 2. Mai 1618.
(Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Gemälde von V.v. Brozik.)
Die Hauptverschwörer und »Defensoren« der protestantischen Rechte trieben auf einen offenen Bruch mit Habsburg, in der Absicht, den kalvinistischen Friedrich von der Kurpfalz zum König von Böhmen einzusetzen. Der Anlaß war bald gefunden; sie drangen unter der Führung des Grafen Thurn auf den Hradschin ein und warfen nach einem gereizten Wortwechsel die anwesenden Statthalter Martinitz und Slawata, sowie den Sekretär Fabricius durch ein Fenster in den Schloßgraben. Das war der verhängnisvolle Prager Fenstersturz vom 23. Mai 1618, der Auslösehebel so vieler folgenschwerer Ereignisse. Der Bruch mit dem Herrscherhause war geschehen, das Zeichen zum offenen Aufruhr gegeben. Die Aufständischen sammelten ein Heer unter Graf Thurn, um Wien zu erobern. Ihm schlossen sich Deputationen der protestantischen Stände Ober- und Niederösterreichs an unter Führung des früheren Hofmarschalls Grafen Wilhelm Starhemberg, der, leicht fremden Einflüssen erliegend, seinen Glauben verleugnet hatte, aber später, durch den heiligen Tod des Dominikus erschüttert, seinen Irrtum wieder abschwor.
Die Wahrheit ist schrecklich. Es war soweit, daß die Stände in Oberösterreich Truppen gegen die Türken verweigerten und das Volk gegen die Kaiserlichen bewaffnete, die die Donau herabzogen, um Wien zu befreien. Der oberösterreichische Bauernkrieg wirft bereits seine Schatten voraus. Es wird erzählt, daß Starhemberg und der Freiherr von Thonrädel, der Führer der niederösterreichischen Stände, den Kaiser Ferdinand in der Hofburg bedrängten, daß er seine Truppen entlasse und dieselbe Religionsfreiheit gewähre, wie es der Majestätsbrief Rudolf II. für Böhmen getan. Es ist jene vielfach mit Stift und Pinsel geschilderte Szene, in der Thonrädel den Kaiser ungeziemend beim Knopf anfaßte mit den Worten: »Gib dich, Ferdinandl, unterschreib!«, ein Ausspruch, der keineswegs verbürgt ist. Wie dem auch sei, Ferdinand blieb fest. Er war visionär veranlagt und soll kurz vorher angesichts des Kruzifixes, das heute auf dem Tabernakel der Hofkapelle steht, die Worte vernommen haben: »Ferdinand, ich werde dich nicht verlassen!«
Offenbar war es auf einen Gewaltstreich abgesehen, als unmittelbare Folgerung aus dem Prager Fenstersturz. In diesem höchst kritischen Augenblick schmettern silberhell im Burghof die Trompeten der Dampierreschen Dragoner, die eben unter dem lothringischen Oberst von Saint Hilaire einreiten. Die Kaiserlichen sind da – im Nu sind die Bedränger verschwunden, auch Graf Thurn muß mit seinen Böhmen unverrichteter Sache abziehen. In demselben Zeitpunkt, da Ferdinand II. nach dem Tode Matthias' zum deutschen König und Kaiser am 27. August 1619 gekrönt wird, wählen die aufständischen Böhmen Friedrich von der Pfalz, den sogenannten »Winterkönig«, der nur bis zum nächsten Winter regiert. Nun hat Ferdinand II. als Kaiser das Recht, gegen die Rebellen vorzugehen. Maximilian von Bayern leistet Hilfe durch das Heer der Liga, wofür ihm zur Deckung der Kosten das aufständische Oberösterreich verpfändet wird. Inzwischen haust Friedrich in Prag mit kalvinistischem Bildersturm gegen die heilige Kunst, gegen Bilder und Altäre; mit dem großen Kruzifixus im Dom läßt der Hofprediger Scultetus seine Küche heizen, derselbe, der mit Berufung auf »Prädestination« den ehrgeizigen Friedrich zur Annahme der Königswahl bestimmt hatte. Die protestantischen Fürsten standen unter dem Einfluß ihrer Hofprediger in weitaus größerem Maße als etwa Ferdinand unter dem seines Beichtvaters, des Jesuiten Lämmermann, mit dem sich das Übelwollen gar zu gerne beschäftigt.

Kaiser Ferdinand II. und die aufständischen Protestanten 1619.
(Gemälde von Wurzinger.)
Das ligistische Heer zog unter dem niederländischen Kriegshelden Tilly gegen Prag heran. Er war der Kämpfer des Heiligen Reiches gegen die Rebellen und gegen den türkischen Erbfeind und hatte in zwanzig Schlachten für den Kaiser gesiegt. In dem erstürmten Magdeburg hatte er die Hauptkirchen gerettet, als die Besiegten selbst die Stadt in Brand setzten. Neben ihm glänzt das Heldenbild des Grafen Pappenheim, der, als Protestant geboren, Universitätsbildung genossen und katholisch wurde. Er hat 1626 den Bauernkrieg in Oberösterreich niedergeworfen; die Erstürmung Magdeburgs 1631 ist sein Hauptverdienst. Die Majestät des alten Kaiserreichs wieder herzustellen war ihm heiliger Begriff. »Schrammhans« nannten ihn die Soldaten. Hundert Schrammen zählte man an seinem Körper, als er bei Lützen gleichzeitig mit seinem großen Gegner Gustav Adolf fiel. Sein Prinzip war rasche, endgültige Entscheidung im Gegensatz zu dem Führer der Kaiserlichen, Grafen Bouquoy, aus der hohen spanischen Schule. Noch steht Wallenstein im Hintergrund, aber er ist da, der sie alle in Schatten stellen soll.

Dampierre-Kurassiere in der wiener Hofburg 1619.
(L'Allemand.)
Auch der Himmel hatte einen Helfer gesandt, den unscheinbaren spanischen Karmelitermönch Dominikus a Jesu Maria, der der Schlacht die Wendung zum Siege geben soll. Mit dem Kruzifix in der Hand marschiert er mit den Soldaten. In dem vom Feind verwüsteten Schloß Strakonitz findet er ein kleines geschändetes Bild, die Anbetung der Hirten, darin den dargestellten Personen die Augen ausgestochen sind. Dieses Bild trägt er den Soldaten voran in der Sonntagsschlacht am Weißen Berg zu Prag, wo sich die Feinde gut verschanzt haben, und Tilly mit den Worten des Evangeliums von diesem Tage: »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist!« den Angriff eröffnet. In dem schweren Ringen des Tages schienen die Kaiserlichen zu wanken. Da soll Dominikus auf einem Schimmel, den ihm Maximilian von Bayern überlassen, den Soldaten vorangestürmt sein zum entscheidenden Siege. Die Feinde glaubten in ihm mit abergläubischer Furcht einen römischen Magier zu sehen. Zu Pferd voran mit dem Kruzifix ist er in dem großen Chorgemälde der Kirche Maria della Vittoria zu Rom und in dem Deckengemälde der barocken Kapelle am Weißen Berge abgebildet. Er war und blieb bis zu seinem Tode in der Hofburg der treue Freund und Berater Ferdinand II. Durch ihn ist auch das Wunderbild, Maria mit dem geneigten Haupte, nach Wien gekommen, wo es sich nunmehr in der Karmeliterkirche zu Döbling befindet. Dort ruhen auch die Gebeine des Heiligmäßigen, der vor dreihundert Jahren verstarb.
Die Folgen der Entscheidung waren, abgesehen von dem Blutgericht zu Prag mit 28 Enthauptungen, unabsehbar. Die sogenannten »Freiheiten«, der »Majestätsbrief« Rudolf II. waren verwirkt; Böhmen von da ab habsburgisches Erbland; das Religionsrecht ausschließlich landesfürstliches Recht; wer sich nicht fügte, mußte gehen. Die »vernewerte« Landordnung regelte die staatlichen Verhältnisse. Man sagt, Ferdinand II. hätte den Dreißigjährigen Krieg begonnen mit der Schlacht am Weißen Berg. Das ist Unsinn. Die Ursachen lagen tiefer und ganz wo anders. Beim Glaubensabfall und der entfesselten Selbstsucht. Dagegen konnte jetzt wieder Kultur in Österreich erblühen, katholische Kultur, barocke Kultur, sogenannte »Gegenreformation«.
Szenen aus dem oberösterreichischen Bauernkrieg
Der oberösterreichische Bauernkrieg von 1626 gibt ein anschauliches Bild von dem großen Kulturkampf in Österreich. Die katholischen Truppen des Reichsheeres unter dem Feldobristen Tilly, die geholfen hatten, den Aufstand in Böhmen niederzuwerfen, lagen noch im Land; Oberösterreich, wegen der Kriegskosten an den Kurfürsten Maximilian von Bayern verpfändet, hatte bayrische Besatzung. Die Abfallbewegung ging trotzdem im geheimen fort, geschürt von den Prädikanten, über welche die Landsknechte Tillys das Liedl sangen: »Zum Lärmenblasen, Unglückstiften – Auch Krieg und Unfried anzustiften – Ist niemand tauglicher im Land – Als ein lutherischer Prädikant!«
Sechzehn Bauernrebellen waren auf der Haushamer-Linde gehenkt worden; die Erbitterung war dadurch nur gestiegen; unter dem Vorwand, dem Kaiser zu dienen, wollte man die Fremdherrschaft abschütteln; als eigentliches politisches Ziel stand im Hintergrund die freie Religionsübung, die Errichtung eines Bauernstaates nach dem Muster der freien Schweiz. Die scheußlichen Bilderstürmereien, Beraubungen von Kirchen und Schlössern nahmen ihren Fortgang; doch zum offenen, planvollen Aufstand kam es erst, als in der Person des Hutmachers und Wirtschaftsbesitzers Stefan Fadinger zu Eferding ein Führer erstand, der im Verein mit gleichgesinnten Landadeligen die Kriegstrommel schinnern ließ und die rebellischen Bauern mit ihren Prädikanten unter die Waffen rief. Das Stefan-Fadinger-Lied ging von Mund zu Mund mit dem Spruch: »Weil's gilt die Seel' und auch das Gut – So soll's auch gelten Leib und Blut – O Herr, verleih uns Heldenmut! – Es muß sein!« So stand es auch zu lesen auf den schwarzen Bauernfahnen, in denen ein Totenkopf abgebildet war. Ein regelrechter Krieg begann, der oberösterreichische Bauernkrieg.
*
Eine Abordnung von Bürgern und Bauern ward nach Wien entsandt, um Audienz zu nehmen und den Aufruhr als eine patriotische Tat hinzustellen. Man wolle durch freiwillige Abgaben das bayrische Pfandrecht ablösen und dafür von dem Kaiser Zugeständnisse erbitten, die allerdings auf sektische Freiheiten hinausliefen und mit der Glaubenstrennung zugleich eine Trennung von des Kaisers Hoheitsrechten bedeutet hätten. Alles, was die Unterhändler unterwegs zu Schiff donauabwärts gesehen und gehört hatten, war wenig ermutigend für sie. Mit krampfhafter Entschlossenheit, der dem blinden Fanatismus eigen ist, gingen sie verbissen auf ihr Ziel los. Ihr erster Weg in Wien führte sie in die Hofkanzlei, ihre Papiere abzugeben und um die Audienz nachzusuchen; die hohen, engen Gassen, der höfische Prunk, die Leichtigkeit und Sicherheit der vielen Menschen, all dieses Ungewohnte fiel beklemmend aufs Herz.
Die Abordnung gelangte indessen nicht vor den Kaiser, sondern vor die Reformationskommission, wo ihnen reiner Wein eingeschenkt wurde. Ob die Bürger und Bauern von Oberösterreich nicht den allgemeinen Grundsatz kennen: wem das Land gehört, dem gehört auch die Religion, was überall praktizieret würde in protestantischen Landen und nach diesem Muster folglich auch im katholischen? Mit anderen Worten: des Brot du issest, des Liedlein sollst du singen! Der Kaiser handle treu nach seinem Grundsatze; er hat gelobt, lieber Land und Leute fahren zu lassen und im bloßen Hemd davonzuziehen, als zu Bewilligungen sich zu verstehen, die dem heiligen Glauben zuwider sein könnten. Die Säulen der Welt sollen nicht verrückt werden, soweit das glorreiche Regiment unseres Herrn und Kaisers reicht; sie sollen nicht verrückt werden durch Bauernrebellen und das Geldanbieten der Welser Ratsherren! Drum möge die Abordnung schleunigst heimkehren, und alle fleißig zu Frieden und Ordnung vermahnen. Der Kaiser habe lange gezögert, ehe er Böhmen von den Ketzern reinigen ließ; es läge nun an den Bürgern und Bauern von Oberösterreich, dem Land eine so schwere Sühne zu ersparen ...
*
Im Land hatten die Kriegshandlungen bereits begonnen, Peuerbach wurde gestürmt und die Besatzung hinausgeworfen; blutige Taten geschahen in Gmunden, Enns, Steyr, St. Florian und in Wels, wo das Bauernheer sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Nächtliche Feuersäulen zeigten die Richtung, in der sich der Krieg wälzte, dahin, dorthin. Von Lambach her rückte endlich der Statthalter von Herberstorff mit seiner Heerschar gegen den Bauernhaufen nordwärts gegen Weizenkirchen vor mit tausend Fußknechten, hundert Krobaten, drei Geschützen, ferner mit Henker und Stricken.
Der Wald oben speit plötzlich Feuerblitz, Geschützgekrach, Musketengeknatter, Eisenhagel, zielsicher, todschwanger. Die Bauernrebellen brechen hervor. Blut rinnt aus, tropfendick auf Gras und Straßenstaub; Gestöhn, Geröchel; dann still Mann und Pferd, sie liegen beieinand, Getümmel drüber weg. Jeder Busch hat Beine, Schwert, Spieß; Mann gegen Mann; Schwertblitz; Blutgespritz; Augengefunkel, zornmütig, haßsprühend, todverglast.
Hin und her tobt die Schlacht, kein End abzusehen; keins weiß noch wie sich's wenden will; bald wankt die Bauernflanke zurück, bald die Landsknechte; endloses Juchhugeschrei, am obern Gehölz flattert eine Fahne auf, Stefan Fadinger, der mit Streithaufen aus dem Mühlviertel heranrückt und einen Flankensturm unternimmt. »Hascha, den Grafen nehmt's gefangen, hascha, nit auslassen den Grafen!«
Herberstorff sieht die Schlacht verloren; über 700 Mann sind hingewürgt; unaufhaltsam drängen die Bauernrotten vor; über Sterben, Gestöhn, Verwünschung ein brausend Sieggeschrei und Rufe wie Trompetenstöß: »Den Grafen tun wir nit sehn! Hascha, entlaufen ist er mit seine Edelleut! Bleibt er am Leben, läßt er uns alle hängen! Müssen ihn fassen und fangen, dürfen ihn nit nach Linz gelangen lassen!«
Die Schlacht steht; was nicht entronnen ist, liegt erschlagen oder ist im Fluß ersoffen. Rottweis stürzen alle hin auf Proviantwagen, Weinfässer, spunden auf, halten das Maul drunter; ein Gepuff, Gestoß, Gedräng um den rinnenden Spund; nach getaner Blutarbeit will man sich gütlich tun im Rauben, Plündern, Schlemmen und Weinsaufen. Fadinger hat Mühe, die Horden zusammenzuhalten. Wie ein Feldherr ist er anzuschauen mit roter Schärpe, Säbel, kurzem braunen Wams, Kniehosen, hohen Stiefeln, Sporen dran, weißrote Federn auf seinem Jodelhut, Gewehr in der Hand; nun gibt er Befehl mit scharfer Stimme: sofort aufbrechen, dem Grafen die Flucht abzuschneiden, die Hauptmasse folge auf dem Fuß nach, um Linz einzuschließen; so der Statthalter drin, ist er gefangen wie die Maus in der Falle. Sollen weiters die landesfürstlichen Städte Wels, Enns, Steyr in gleicher Weise zur Übergab gezwungen werden ... Mit Brüllgesang wenden sich die Rotten: Auf nach Linz!
*
Vor Linz wendet sich das Schicksal. Der Sturm mißlingt, der Bauernobrist Fadinger ist todwund geschossen. Das Volk meinte, er hätte einen Wundsegen, daß ihn keine Kugel träfe; Entmutigung und Uneinigkeit der Führer zersetzen die lockeren Haufen. Der Schreck fährt allen in die Glieder, als es heißt: der Pappenhaimber zieht heran mit Heeresmacht! Nur der Mut der Verzweiflung rafft sie zusammen zu einem letzten Treffen.
Eine feurige Schlange zuckt hin über das Emlinger Holz bei Eferding; es wacht der Donner auf und fährt wild herum mit Getös. Fünfzig Lanzen reiten an, stecken und zerbrechen in Bauernleibern. Herberstorff hat das Zeichen zum Angriff gegeben. Das evangelische Bauernheer bricht hervor mit furchtbarem Stoß; drei-, viermal stürmen sie an, den starren Eisenwall der Pikeniere und Hellebardiere zu durchbrechen; umsonst. Das Rottenfeuer lichtet ihre Reihen; Pappenheimer hat das Emlinger Holz umzingelt; kein Entrinnen rundum. Pulver und Blei ist bald verschossen; die Muskete wird zum Prügel und arbeitet neben Sense und Spieß. Der Würgeengel schreitet übers Land.
Eine herrische Stimme gebietet vor Nacht Einhalt. Pappenheimer ist's, er wischt den Säbel an der schwarzen Roßmähne rein: »Hab' in vielen Schlachten gekämpft, aber nie ein hartnäckigeres, grausameres Fechten gesehen. Die Arbeit des Soldaten ist getan. Gegen Rebellen war dies Schwert geführt, die gleichwohl Helden waren; dem heiligen Georg sei es geweiht und in der Pfarrkirche zu Gmunden aufbewahrt!« Im Emlinger Moor ist Stefan Fadingers Leiche verscharrt. Kein Kreuz, kein Erinnerungszeichen bezeichnet die Stelle. Ohne Segen verweht seine Spur. Das Los eines irrenden Helden. Eines Rebellen Gottes.
Die bedeutendste Gestalt des Dreißigjährigen Krieges, der kaiserliche Feldherr Albrecht von Wallenstein, der im Hause des Bürgermeisters von Eger in der Nacht vom 23. Februar 1634 von einigen Offizieren seiner Armee ermordet wurde, ist in der Weltgeschichte das einzige Beispiel eines Mannes, der mit Hilfe des Horoskops Geschichte machen wollte und sich fast willenlos der Lenkung der Gestirne überließ. Er glaubte dem Schicksal in die Karten zu sehen und mit Hilfe der Sterne seinen Lebenslauf nach Maßgabe seines ungeheuren Ehrgeizes vorherbestimmen und korrigieren zu können. Sein abenteuerliches Glücksspiel, sein Aufstieg und Niedergang erklären sich aus dieser verhängnisvollen Neigung, die ihn bis zuletzt mehr als alles andere beherrschte.
Aus Schillers grandiosem Drama ist bekannt, daß er sich eines Hofastrologen namens Seni bediente; doch spielt diese Erscheinung in der klassischen Dichtung nur eine nebensächliche Rolle; der Dichter bedient sich dieser Geheimwissenschaft, die er nicht genau kannte, nur als einer ausschmückenden Zutat. In Wirklichkeit war sie bei Wallenstein beherrschendes Leitmotiv, dem er sich bedenkenlos unterwarf. Kein Geringerer als der berühmte Astronom Kepler hatte ihm sein Horoskop gestellt, das ihm fortan Talisman und himmlischer Kompaß war. Es lag im Zug der damaligen Zeit, daß der Mathematiker nicht nur den Umlauf der Gestirne berechnete, sondern auch ihre Wirkung auf das menschliche Gemüt. Nur noch Kaiser Rudolf II. ist ein ähnlicher Fall, wenngleich nicht so unbedingt und ausschließlich wie Wallenstein. Als dieser zu Gitschin als Sohn eines verarmten tschechischen Landedelmannes aus dem Geschlecht der Ralsko am 14. September 1583 geboren wurde, standen Jupiter und Saturn in Konjunktion.
Die Deutung Keplers lautete nicht günstig. Sie verhieß wohl durch die Stellung Jupiters eine große und siegreiche Zukunft, aber sie deutete auch die dunklen Seiten des Charakters an, die durch die Nähe des Saturn bedingt seien; melancholische, abwegige Gedanken, Mangel an Liebe, Gleichgültigkeit im Religiösen; vorherrschende Neigung zu verborgenen Dingen und zu Grübeleien, zu lichtscheuen und desto übleren Spekulationen; im Zusammenhang damit ein furchtsames Wesen, aber auch ungestümer Jähzorn und Haßgefühl, eine ebenso verschlossene und schweigsame als auch treulose Natur, die unberechenbar sei. Soweit Keplers strenge Charakterologie, die in der Tat die wesentlichen Züge des Mannes herausstellt, die nach und nach in seinen Handlungen sichtbar werden. Andere Stellen des Horoskops deuten auf Habgier und Verschwendung.

Wallensteins Rückzug nach Eger 1634.
(Gemälde von Karl von Pilory. Aufnahme der Photographischen Gesellschaft, Berlin.)
Auf der Universität zu Padua war er mit dieser Geheimwissenschaft bekanntgeworden, die er höher stellte als die Religion. Hervorgegangen war er aus einer hussitischen Sekte; auf dem Jesuitenkolleg zu Olmütz wurde er katholisch; dann besuchte er die protestantische Universität zu Nürnberg, ehe er nach Padua ging. Es bestätigt sich, daß er religiös ziemlich indifferent war und einer Anschauung zuneigte, die das hemmungslose, subjektive Ich vergottete und in den Mittelpunkt des Weltgeschehens stellte. Jedenfalls war er ein Phänomen, wie es auf seine Art Napoleon war, mit dem er in vieler Beziehung vergleichbar ist. Er war alles, nur kein sittlicher Held, der sein Leben für die höchsten Ideen in die Schanze schlägt. Wallenstein dachte nur an sich. Er glaubte die fliehende Glücksgestalt der Gestirne zu seinem Vorteil benützen zu können, »denn stets in Wandlung ist der Himmelsbogen« – und so war auch er »stets in Wandlung«. Ungewöhnlich und erstaunlich sein Aufstieg vom einfachen böhmischen Landjunker zum Herzog von Friedland, von Mecklenburg und Sagan; das Glück war ihm jedenfalls hold. Durch das große Vermögen seiner ersten Gattin war dem Ehrgeizigen die Laufbahn nach Macht und Ehren eröffnet, er konnte auf eigene Kosten ein Regiment ausrüsten, mit dem er dem Kaiser gegen die böhmischen Stände zu Hilfe kam und die Schlacht am Weißen Berge mitmachte. Bald schien kein Glück zu hoch.
Es liegt in seiner Natur, daß ihn alles Erreichte nicht befriedigte, und daß er nach den höchsten Sternen griff. Darum war Pläneschmieden über jede menschliche Berechnung hinaus sein Lebensbedürfnis, ein genialer Zug an sich. In seinen entscheidenden Entschlüssen ließ er sich nur von dem Horoskop beraten, und es gab immer die Antwort, die naturgemäß sein Dämon verlangte. Solange sein Wollen sich mit den heiligen Rechten seines kaiserlichen Herrn deckte, ging er auf sicherem Boden. Die leitende Idee, die nicht unmöglich war, bestand darin, die Fürstenmacht zu brechen und die unbeschränkte Weltmonarchie herzustellen. Wie die Könige von Spanien und Frankreich sollte der Kaiser alleiniger Herr des geeinigten Deutschland sein; nach Wallensteins Ansicht bedurfte es der Fürsten nicht mehr und ebensowenig einer Wahl, »die Nachfolge Ferdinand III. verstehe sich von selbst«. Es schien ein Leichtes, seine Truppen standen von Pommern bis Schwaben; er war der Abgott des Lagers; die kaiserliche Macht stand auf einem Höhepunkt, wie nicht einmal unter Karl V.
Es war auch richtig gedacht, die Türkei zu erobern, Dänemark zum Vasallenstaat zu machen, eine Kriegsflotte zu bauen und unter kaiserlichem Schutz eine Kolonialpolitik zu entfalten, was freilich an der Engherzigkeit der protestantischen Handelsmächte zu Lübeck scheiterte. Auch in dem vergeblichen Sturm auf Stralsund scheint ihn sein Glücksstern im Stich gelassen zu haben. Man rühmt, daß er im Lübecker Frieden Dänemark von Schweden getrennt und so die schutzlosen deutschen Küsten vor dem gemeinsamen Angriff der nordischen Mächte bewahrt habe. Es spielen aber allerhand dunkle Dinge mit, die 1630 zu seinem Sturz führten. Sein maßloser Eigennutz, die ungeheuren Forderungen, die er an den Kaiser stellte, und für die er sich Mecklenburg verpfänden ließ, obzwar er durch die Kontributionen, mit denen er und seine Heerführer sich persönlich bereicherten, weitaus gedeckt war, sein prunkhaftes Auftreten, das die kaiserliche Hofhaltung in Schatten stellte, seine eigentümliche Strategie, die nie zu schnellen Entscheidungen führte, sondern das Reich in Wallensteins Lager verwandelte, dessen unumschränkter Herr er war, nach seinem Grundsatz, »daß der Krieg den Krieg ernähren müsse«, obgleich eine solche Kriegführung am Mark des Volkes zehrte – alles dies und noch viel mehr nährte das Mißtrauen, ob er sein Privatinteresse nicht höher stellte als jenes von Kaiser und Reich.
Er wußte, daß nach bitterer Zurücksetzung seine Zeit wiedergekommen sei, als der Schwede eingriff. Es ist eine der großen Geschichtsirrungen, die seit Schillers Drama Schulbegriff wurde, den sogenannten Dreißigjährigen Krieg als Glaubenskrieg hinzustellen. War doch das katholische Frankreich mit Schweden und den protestantischen Fürsten Deutschlands im geheimen Einverständnis und Kardinal Richelieu Drahtzieher im Kampf um die deutsche Kaiserkrone gegen das Haus Österreich! Ein Raubkrieg war es, wie die anhaltische Kriegskanzlei beweist, die der Feldherr des Winterkönigs, Christian von Anhalt, nach der Schlacht am Weißen Berge zurücklassen mußte, und aus deren Akten die Verbindung mit allen Feinden des Kaisers, mit England, Holland, Bethlen Gabor und den Türken hervorgeht; klar tritt zutage, daß nur der eigene Vorteil die Triebfeder war und nirgends eine höhere Idee, außer bei Kaiser Ferdinand II., als Schirmherrn und Träger des abendländischen sittlich religiösen Gedankens.
Ebenso widersinnig ist es darum, Gustav Adolf als den Retter Deutschlands und als nationalen Helden zu feiern. Die schwedische Geschichte verherrlicht ihn nicht als Erretter, sondern als Eroberer Deutschlands. Er wollte eine Hausmacht in Deutschland begründen, um seine Ansprüche auf Polen zu stützen und die schwedischen Stände im Zaum zu halten. Die Schlacht bei Lützen 1632, in der er seinem Gegenspieler Wallenstein erlag und sein Leben einbüßte, setzte der ergebnislosen Erobererlaufbahn einen Schlußpunkt. Der sinnlose Dreißigjährige Krieg, den man sich nicht als Weltkrieg vorstellen darf, würde in ein unübersichtliches Wirrsal von Teiloperationen, Scharmützeln und Plünderungen hinauslaufen ohne diese beiden gewaltigen Gegner, die nach gleichem Ziel strebten und sich auf dem ungeheuren Kampffeld messen. Durch sie wird das grausame Ungefähr zum geschichtlichen und dramatischen Geschehen.
Grandios über seine Gegner erhebt sich die Gestalt Wallensteins, solange die kaiserliche Idee hinter ihm steht. Ebenso klein wird er als Rebell und Hochverräter, der mit Hilfe der Gegner nach der Krone Böhmens oder gar nach der Krone Deutschlands strebt. Seine Generäle hielten ihn darum reif für den Mordstahl. Als die Verschwörer unter der Führung des irischen Oberst Butler in sein Schlafzimmer stürmten, öffnete er die Arme und empfing lautlos den Todesstoß der Partisane wie einer, der sich müde der Vernichtung entgegensehnt.
Die Geschichte hat keine Erweise für seine Schuld. Wie weit sie bloßes Gedankenspiel, wie weit sie planvolle Absicht war, bleibt auch heute, nach dreihundert Jahren, undurchdringliches Geheimnis. Antwort gibt nur das Horoskop, darauf kein Schuldspruch zu gründen ist. Das Volk behauptete, er sei ein Vasall der Hölle, ein vom Teufel Gezeichneter; er war düster, furchterregend und zugleich furchtbeherrscht: er hinkte etwas, weil er an Podagra litt, und sah sich bei jedem Schritt um. Die Soldaten hielten ihn für kugelfest. Wußte er auch um die gewaltsamen Todesaspekte in seinem Horoskop? Noch immer schwankt sein Charakterbild in der Geschichte, und Schiller »wälzt die größere Hälfte seiner Schuld den unglückseligen Gestirnen zu«.
Seine Schuld war es, daß er dem Dämon vertraute, seinem Aberglauben; er war der Gefangene und Gefolterte seines Horoskops. Daraus erklärt sich das Gewagte, Dunkle, Unberechenbare seiner Entschlüsse, die Widersprüche seines Wesens. Er war kein Held, sondern ein Glücksritter, der sich von dunklen inneren Mächten leiten ließ und schließlich ins Dunkle stürzen mußte. Er hatte die sittlichen Gesetze mißachtet, denen ein wirklicher Held gehorcht, und durch die er siegt, auch wenn er tragisch endet.
In hohen Wogen geht das Schicksal Österreichs im Kampf um die Einheit des Reichs gegen eine Welt von Feinden. Vom Gnadenbild zu Loretto hatte Ferdinand II. die Kraft geholt zur Wiederherstellung der religiösen und politischen Einheit des Reichs. Was er zur Erneuerung der katholischen Kultur so erfolgreich in der Steiermark begonnen, hatte er glücklich in den gesamten österreichischen Landen fortgesetzt. Nun galt es das ganze Deutschland. Das Restitutionsedikt von 1629 bestimmte die Herausgabe der von den Fürsten konfiszierten katholischen Kirchengüter und stellt somit im Prinzip das ursprüngliche Verhältnis wieder her, wonach die Kirche als geistige und sittlich religiöse Macht über der weltlichen Fürstenmacht steht und nicht umgekehrt. Überzeitlich verankert, kann sie nicht der subjektiven Willkür weltlicher Machthaber ausgeliefert sein, weil sonst göttliche und natürliche Rechte, das Seelenheil und die Freiheit in Gott der einzelnen und der Völker in Abhängigkeit solcher Willkür käme und alle höhere Ordnung und Bindung sich auflöste, wie sich ja schon gezeigt hat.
Nun steht die kaiserliche Macht auf der stolzesten Höhe, ihre Flagge weht auf allen Meeren; Deutschland erscheint geeint, eine dominierende Macht der Christenheit, an der der Türke und jeder Feind von außen zerschellen müßte. Wallenstein greift ein und hat nicht Unrecht mit der Ansicht: »Es braucht keine Wahl mehr, die Nachfolge Ferdinand III. versteht sich von selbst« – das Wahlreich erscheint in erbliche Weltmonarchie verwandelt.
Ein Rückschlag erfolgte fast unmittelbar. Die protestantischen Fürsten, durchaus nicht gewillt, den Raub herauszugeben, riefen den Schwedenkönig Gustav Adolf zu Hilfe, der selber auf Raub ausging, auf Gewalt und Eroberung. Die katholischen Fürsten hinwiederum, zur Liga zusammengeschlossen unter der Führung Wittelsbach, das immer eifersüchtig auf Habsburg war, erzwang schon im nächsten Jahr 1630 auf dem Kurfürstentag zu Regensburg den Sturz Wallensteins; damit war die kaiserliche Politik geschlagen und an die Liga gekettet. Man kann sagen, daß der sogenannte Dreißigjährige Krieg als Raubkrieg jetzt erst in sein verhängnisvolles Stadium tritt, seit Schweden und weiterhin Franzosen auf deutschem Boden kämpfen. Wieder greift Wallenstein ein; seine zweifelhafte Haltung führt neuerdings zu seiner Absetzung und schließlich zu seiner Ermordung.

Schlacht bei Nördlingen 1634. Vernichtung des Schwedenheeres unter Ferdinand III.
(Bild von Karl Blaas. Kunstverlag Wolfrum, Wien.)
Inzwischen hat sich der erste Rheinbund deutscher protestantischer Fürsten gebildet, die im Dienste des katholischen Staatsmannes von Frankreich, Kardinal Richelieu, stehen, gegen Kaiser und Reich. Die Feinde rücken schon in Regensburg ein, das der Schlüssel Österreichs ist. Aber in der Schlacht bei Nördlingen vernichtet Ferdinand III. das schwedische Heer; alles Land im Westen ist wieder kaiserlich; das Einheitsreich im katholischen Sinne ist neuerdings hergestellt und im Frieden zu Prag 1635 bestätigt; die Wahl Ferdinand III. zum deutschen Kaiser ergibt sich von selbst, sie erfolgt ein halbes Jahr vor dem Tode Ferdinand II., und zwar 1636; der Kaiser hat wieder alle Macht in Händen und gedenkt am Reichstag zu Regensburg 1640 den Frieden einzuleiten, der aber noch gut sieben Jahre auf sich warten läßt. Die Schweden leben vom Krieg; den Franzosen ist es auch nicht eilig, es geht ja auf Kosten Deutschlands; der Ehrgeiz auf die Reichskrone, die Niederringung Habsburgs ist Ziel ihrer damaligen Politik.
Das Schlachtenglück wechselt; mit Rákóczy im Bunde stehen die Schweden 1645 vor Wien. Eben noch auf der Höhe der Macht scheint auch schon wieder der Zusammenbruch Österreichs nahe und unvermeidlich. In so steilen Kurven geht es auf und ab. Aber Rákóczy kommt nicht mit seinen Ungarn; die Schweden sind zu schwach und müssen wieder abziehen; selbst die gegnerische, kleindeutsche Geschichtsschreibung muß zugeben, daß Österreich in unüberwindlich zäher Widerstandskraft wie durch ein Wunder wieder gerettet war.
Der Dreißigjährige Krieg ging an der allgemeinen Erschöpfung der Parteien und an seiner eigenen Sinnlosigkeit zu Ende. Dem entsprach auch sein Ergebnis im Westfälischen Frieden zu Osnabrück und Münster 1648. Kurz vorher hatten die Schweden noch Prag in aller Eile geplündert. Das Ziel des Kaisers, ein innerlich einiges Reich herzustellen, das im Sinne der abendländischen Idee allen Stürmen der Zeit auch in Hinkunft trotzen kann, war allerdings nicht erreicht. Wohl blieb der Kaiser höchster Herr im Reiche, von dem jedes Recht ausging; das Reichskammergericht in Speyer und der Reichshofrat in Wien waren die beiden Grundpfeiler der Reichsverfassung, die nach dem Dreißigjährigen Krieg bis zur Napoleonzeit bestand. In diesen Reichskörperschaften, sowie auf dem Reichstag, der Regierungsrechte ausübte, waren die Katholiken in der Mehrheit, so daß die Kaiserwürde dem Hause Habsburg gesichert blieb, was ja auch angesichts der ständigen Türkengefahr nicht anders sein konnte. Ansonsten aber war das Reich aufgelöst in einen Bund selbständiger Staaten, die durch den Westfälischen Frieden nicht nur das Recht behaupteten, stehende Heere zu unterhalten, das früher nur dem Kaiser zustand, sondern auch das Recht mit andern Mächten Bündnisse zu schließen, freilich mit der Einschränkung »nur nicht gegen Kaiser und Reich«, die nur zu bald nicht als existent erachtet wurde. Jene Kleinstaaterei war damals entstanden, die bis 1803 dauerte, als sie Napoleon über den Haufen warf. Die spätere napoleonische Herrschaft über Deutschland erklärt sich aus diesen Verhältnissen und besonders aus dem verräterischen Treiben des ersten Rheinbundes im Solde Frankreichs.
Die Reichsidee war ziemlich erloschen; nur die Landeshoheit der Fürsten ging gestärkt aus dem Friedensschluß hervor; jener fürstliche Absolutismus entwickelte sich auf dieser Grundlage, der oft absonderliche Blüten trieb. Dazu gehört es, daß einzelne Landesfürsten ihre Landeskinder als Soldaten an fremde Mächte verkauften und ihre Heere geradezu als Erwerbsmittel benützten. Es wird immer klarer, daß der Kaiser das Reich war, eine Grundtatsache, die man beharrlich übersieht und die schon darin begründet ist, daß er als Schirmvogt der Kirche und somit der Christenheit im Sinne der Heiligen Römischen Reichskrone das Reich verkörpert. Er allein hatte es mit Hilfe seiner Hausmacht und fremden Hilfsvölkern gegen die Türken, gegen Schweden und Franzosen und – gegen die deutschen Fürsten verteidigt, die mit jenen Feinden im Bunde standen.
Ein neuer Gegner war durch die Stärkung des Landesfürstentums im Westfälischen Frieden dem Kaiser erstanden, der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Preußen. Mit ihm beginnt der nun fast dreihundertjährige Rivalitätskampf Preußens gegen Österreich, als ein Kampf der Weltanschauungen, der Kultur und der Vormacht, der, von der Gegenseite mit List und Gewalt geführt, in der Geschichte blutige Spuren und verhängnisvolle Folgen hinterläßt und noch immer nicht ganz überwunden scheint. Der große Kurfürst stellt sich alsbald an Seite Frankreichs, von dem er einen jährlichen Sold von 100.000 Livres empfängt mit der Verpflichtung, Elsaß vom Reiche abzutrennen und unter französische Herrschaft zu bringen. Das lag im Plan Mazarins und Ludwig XIV., der den Plan der Universalmonarchie zu verwirklichen gedachte und auf die Niederringung Habsburgs gründete. Das war auch der Grund, warum Friedrich Wilhelm seine Mitwirkung an der Türkenbefreiung von der Bedingung abhängig machte, daß der Kaiser Elsaß an Frankreich abtrete. Die preußische, kleindeutsche Geschichtsschreibung unterschlägt diesen Sachverhalt, indem sie einseitig feststellt, der Kaiser habe die Hilfe des großen Kurfürsten abgelehnt, ohne hinzuzufügen, warum er sie ablehnt. In Wahrheit hat er nur das verräterische Ansinnen Friedrich Wilhelms abgelehnt, das Reichsland Elsaß preiszugeben; und weil er das nicht tat, versagte der Kurfürst im Bunde mit den Erzfeinden nicht nur für sich selbst die Türkenhilfe, sondern er verhinderte auch andere deutsche Staaten mitzuwirken, wie Braunschweig-Hannover, indem er drohte, in ihr Gebiet einzurücken. Das Reich war ihm einen Pfifferling wert.
Trotz aller dieser Machenschaften und Anschläge, in den schwersten Kampf der von neuem drohenden Türkenmacht verwickelt, vom Westen her durch Frankreich bedroht, von Brandenburg-Preußen und anderen Reichsfürsten im Stich gelassen, hat Österreich unter der nun folgenden Regierung Leopold I. sich nicht nur behauptet, sondern den höchsten Gipfel der Macht und des Ruhmes erstiegen.
Eine gewisse mißgünstige Geschichtsschreibung behauptet immer wieder, Österreich sei nach dem Dreißigjährigen Krieg halb ausgeschlossen von der deutschen Bildung und »auf seine Art zurückgeblieben«. Es habe »durch mehr als anderthalb Jahrhunderte an Dichtung und Wissenschaft nur einen verschwindend geringen Anteil gehabt«.
Dem ist aber keineswegs so. Klagt doch ein deutscher Historiker: »Die deutschen Fürstenhöfe kommen bis zur Mitte des XVIII. Jahrhunderts für die Dichtung, ja für die geistige Bildung überhaupt nicht in Betracht«, wobei er allerdings vergißt hinzuzusetzen: mit rühmlicher Ausnahme des Wiener Hofes. Über den wahren Zustand des deutschen Reiches in und nach dem Dreißigjährigen Krieg gibt Grimmelshausens Zeitroman »Der abenteuerliche Simplizissimus« anschauliche Schilderungen; er wundert sich, daß zum Beispiel in der Schweiz die Ställe voll Vieh stehen und die Bürger friedlich ihrer Arbeit nachgehen, dergleichen habe er in Deutschland nie und nirgends gesehen. Wenn man nur das überlieferte äußere Bild der österreichischen Städte und Landschaften mit ihren sichtbaren Segnungen der Barockkunst und -kultur vergleicht mit der Nüchternheit und Dürftigkeit der Entwicklung im Norden nach dem Dreißigjährigen Krieg, hat man durchaus den Eindruck, daß das Gegenteil wahr ist, und daß es just nicht Österreich ist, das zurückgeblieben sei.
Die Wahrheit ist vielmehr die, daß Österreich unter Leopold I., der ein halbes Jahrhundert herrschte, sich nicht nur staatlich zur ersten Großmacht Europas entwickelte, sondern auch einen Gipfelpunkt des kulturellen Glanzes erreichte, der selbst den Sonnenkönig in mancher Hinsicht beschattete. Und dies trotz der schwersten Kriege. Österreichische Heere kämpften auf Jütland und befreiten Dänemark von den Schweden; sie befreiten Pommern für den großen Kurfürsten, der nur Undank wußte; sie kämpften gegen die Kuruczen, gegen Rákóczy II., gegen die siebenbürgischen Aufrührer, gegen Tököly, der die Türken zu Hilfe rief; sie schlugen ein überlegenes Türkenheer mit einer neuen überraschenden Gefechtsweise bei St. Gotthard in Oststeier; Montecucculi, der kaiserliche Feldherr war Sieger in allen diesen Schlachten. Dann kam die schwarze Pest mit ihrem großen Sterben; dann die Türken vor Wien; dann ging's an die Wiedereroberung Ungarns; dazu die Rivalität Ludwig XIV. von Frankreich, der mit allen Feinden Österreichs im Bunde stand; es folgten die Kämpfe um das spanische Erbe, die Siege Prinz Eugens auf allen Schlachtfeldern Europas – und über alles erstand die Glorie Österreichs als erste Großmacht und Kulturmacht Europas.
Das ist wahrhaftig nicht wenig, wenn man die hohe Blüte anderer Länder mitbedenkt, etwa in den Niederlanden, in Frankreich, in Spanien; es ist das Zeitalter Rembrandts, Franz Hals' und Rubens'; der Denker Descartes und Spinoza; der Dichter Corneille, Racine und Molière am französischen Hof; des großen spanischen Malers Velazquez und des Schöpfers der Sakramentsspiele Calderon, der in einem Drama den »Ruhm Österreichs« singt. Sie gehören mit in die Betrachtung bei der Weltstellung Österreichs, wo sich die Wirkung nach der architektonischen Seite hin und zum Gesamtkunstwerk der mystisch-religiösen Staatsdramatik entfaltet. Hier spürt man Weltkultur. Während protestantische Fürsten mit den Reichsfeinden konspirierten, strebten die schöpferischen Kräfte Deutschlands zum Katholizismus und suchten geistig ihren Zielpunkt in der Casa Austriaca, so die schlesische Dichterschule, Martin Opitz, Hoffmannswaldau, die Säule deutscher Barockdichtung Angelus Silesius, dann auch Grimmelshausen, der Dichter des Simplizissimus und nicht zuletzt der edle Philosoph Leibniz. Ja auch später noch kann man die beiden Dichterfürsten Goethe und Schiller zum österreichischen Kulturkreis rechnen, wenn man berücksichtigt, daß Goethes »Faust« und die Schillerschen Geschichtsdramen in der Katholizität des alten Reiches wurzeln, das vollwertig vom Kaiser und seinen österreichischen Landen verkörpert wird. Ganz bestimmt haben die Romantiker und deutschen Freiheitssänger Anschluß an Österreich gesucht und gefunden. Was man in der Gegenwart etwa verwaschen »gesamtdeutsch« nennt, hat die Monarchia austriaca verkörpert und noch viel mehr.
Während Deutschland infolge der Kirchentrennung in Kleinstaaterei verfiel, ging Österreich aus dem Dreißigjährigen Krieg und aus seinen weiteren Weltkämpfen stärker und einheitlicher als je hervor. Um 1618 schier dem Ende nahe und fast ganz protestantisch geworden, war es durch die Rekatholisierung Ferdinand II. auf die stolzeste Höhe seiner Macht gehoben und mit Deutschland fast zum monarchischen Einheitsstaat verbunden; um 1645 durch die Schweden vor Wien wieder dem Zusammenbruch nahe, war es unter Leopold I. nach den Türkenkriegen als selbständiges Staatswesen die erste Macht Europas geworden. Durch die Reformation war in Deutschland der Reichsgedanke fast gänzlich entschwunden; er war lediglich verkörpert in der Person des Kaisers, der ihn allerdings mit dem Bewußtsein der höchsten Verantwortung trug. Die erneuerte alte Kultureinheit führte Österreich weiter auf dem Wege zum monarchischen Einheitsstaat, den Maximilian I. durch seine Beamtenorganisation vorbildete und Ferdinand II. innerlich verfestigte. Dieses vielfältige österreichische Staatswesen, von der Dynastie zusammengehalten, war ständisch regiert, worunter man allerdings nicht Berufsstände im heutigen Sinne, sondern Herrschaftsstände zu verstehen hat, die Grundherren und Adeligen, den Klerus und die Städte, in Tirol auch bäuerliche Vertreter; sie waren die Träger der Verwaltung; der Staat brauchte nur wenige Behörden. Die Hofkanzlei, die die landesherrlichen Interessen den Ländern gegenüber vertritt, bildete gleichsam das Ministerium des Innern; der Hofkriegsrat war Kriegsministerium, die geheime Konferenz besorgte die auswärtige Politik, und die Hofkammer war mit dem Reichshofrat die gemeinsame Behörde auch für das Reich und für das Reichskammergericht in Speyer, seit 1693 in Wetzlar. In der Beamtenwahl herrschte die größte Weitherzigkeit wie nirgend sonst; es ist eine der schlimmsten Fälschungen der Geschichte, wenn es heißt »Habsburg sei überwiegend undeutsch und noch mehr protestantenfeindlich«. Leopold hat das Gegenteil bewiesen; er machte einen letzten Versuch durch seinen Vertrauensmann, den Dogmatiker Spinola, zur kirchlichen Wiedervereinigung, nachdem der Augsburger Religionsfrieden und der Westfälische Frieden eine solche endgültige Lösung offen ließen. Die protestantischen Fürsten waren gewonnen, sowie auf der anderen Seite die bedeutendsten Ordensgenerale und vor allem der Papst. Gescheitert ist der Plan an der Politik Ludwig XIV., die alles hintertrieb, was Kaiser und Reich stärken konnte.
Leopold I., der als zweiter Sohn Ferdinand III. nach dem Tode seines Vaters 1657 die deutsche Kaiserwürde erlangte, war ursprünglich für den geistlichen Stand bestimmt. Er war eine heiligmäßige Persönlichkeit, ein Mann der Vorsehung wie Ferdinand II.; von ihm wurde gesagt, daß er Wunder aus der Tasche ziehe. Ludwig XIV., sein Gegenpol, hatte erklärt, daß er mehr als die Heere Leopolds seine Wunder fürchte. Beide Monarchen waren verwandt; sie hatten durch ihre Mütter denselben Großvater, Philipp III. von Spanien, durch ihre Gemahlinnen denselben Schwiegervater, Philipp IV.; beide hatten dasselbe Ziel, die Kaiserkrone und das spanische Erbe. Aber soviel Verwandtes, soviel Gegensätzliches: Leopold war der Pol des Rechtes, Ludwig der des Unrechtes; jener der Schützer des Rechtes, dieser der Verächter des Rechtes und Pol der Gewalt und List.
So energisch Ludwig war, so unentschlossen schien Leopold, der dennoch Sieger blieb. Es hieß, es bedürfe eines Berges, um ihn zu einem Entschluß zu bringen, und eines Sandkorns, ihn davon abzubringen. Und dennoch war er felsenfest in der Gefahr, in der Treue zur Kirche, im Glauben an die Sendung des Hauses, in seiner Politik, die in der Expansion nach Osten das gegebene Ziel erkannte. Seine Minister Auersperg und Lobkowitz, die ihn in falscher Richtung mit der Politik Ludwig XIV. verwickelten, entließ er in Ungnade. Er war klein, schwächlich, wortkarg, sittenstreng und liebte zugleich, wie so viele Habsburger, bei persönlichster Einfachheit die höchste öffentliche Prunkentfaltung. Er war nicht nur ein Gelehrter, der die erste naturwissenschaftliche Akademie schuf, sondern auch ein Freund und Förderer der Künste; er dichtete und komponierte selbst. Leibniz nannte ihn »Leopold den Großen«. Jesuitendrama und Barockoper standen im Zenith. Man darf billig staunen, daß er Zeit und Kraft fand trotz immerwährender Kriege, trotz Pest, Türken und Franzosen, eine Kulturblüte zu entfalten, die in der Welt einzig dasteht und im folgenden näher geschildert werden soll.
Barocke Staatsdramatik
Nach den Benediktinern waren die Jesuiten die großen Kulturerzieher Österreichs. Sie haben nicht nur die Wiederkatholisierung Österreichs durchgeführt, sondern auch eine neue Stilepoche, die des Barocks, begründet. Die gesteigertsten Schöpfungen dieser Art nennt man bezeichnenderweise Jesuitenstil. Durch das vielseitige Künstlergenie eines Bernini wird Rom das große barocke Kunstbild, das bis zur Aufhebung des Kirchenstaates 1870 unverändert blieb. Schon an zweiter Stelle ist Wien und Salzburg zu nennen. Die Ankunft der elf Jesuiten in der Kirche Am Hof 1551, das Wirken des Ordenskünstlers P. Andrea del Pozzo und der Carlone bezeichnen die Geburtsstunde des österreichischen Barocks. Architektur, Malerei, Plastik, Musik, Handwerkskunst schließen sich zu einem Gesamtkunstwerk dramatisch zusammen, um der Verherrlichung Gottes auf Erden zu dienen. Eine Kunst, die nicht zu Ende zu schauen ist, wie die Unerschöpflichkeit Gottes. Mit Recht sagte einst der Kunsthistoriker Albert von Ilg: »Da brach in diese ausgeleerte Stätte (nach der Reformation) die Kunst der Jesuiten wie ein Frühlingssturm herein. Übervoll von Gestaltungskraft, von Pracht, vom Zauber der Farbe, des Glanzes und Goldes, mit südlicher Heiterkeit und Grazie, entlud sich dieses Gewölk wie ein Lenzgewitter über die schmachtende Erde, und der kunstbegabte süddeutsche Stamm öffnete den Busen weit dem köstlichen Ozonduft, den dieser warme Regen verbreitete. Die wiedererweckte Herrlichkeit, die potenzierte Majestät des katholischen Gottesdienstes hat mehr Gläubige in die goldstrotzenden, farbengeschmückten, von süßen Musikklängen durchzitterten Tempel getrieben als alle Dragoner Ferdinands ...«
Im Sinne von Calderons »Welttheater« erscheint das Leben ein Spiel, die Welt eine Bühne, die Rolle, die jeder hier zur Schau trägt, als eine Maske, die er erst mit dem Tod angesichts des Ewigen ablegt. Eine neue Dramatik entsteht, ein neues psychologisches Element: die Allegorie. Die Sünde, der Tod, die Eitelkeit, die Tugenden, die schönen Künste treten personifiziert auf als irdische und himmlische Kräfte; abstrakte Vorstellungen werden Fleisch und Blut. So erschütternd ist die Seelenwirkung, daß viele nach der Aufführung des »Cenodoxus, der Doktor von Paris« von dem Ordensdramatiker Bidermann S. J. aus dem Theatersaale ins Kloster eilen. Das Jesuitentheater entsteht, die Barockoper, die Staatsdramatik der »Kaiserspiele«, die große weltgeschichtliche Ideen und staatspolitische Ideale verkörpern. Die ganze reiche und blühende Kunst steht im Dienste der sittlich-religiösen und vaterländischen Erziehung. Die Glanzzeit des Barocktheaters gehört der Epoche Leopold I., Joseph I. und Karl VI. an.
Das Pädagogische der Jesuitenspiele lag in der »Imitatio«, in der Nacheiferung antiker Dramen durch Rezitation und Interpretation. Große heroische Gedanken und vaterländische Gefühle wurden auf diese Weise lebendiger Besitz. Dafür gab es in Wien schon eine ältere Überlieferung in den Festspielen von Celtis unter Maximilian I. und ähnlichen allegorischen Schöpfungen des Schottenabtes Chelidonius, dessen Allegorie »Der Streit der Wollust und der Tugend« als Vorläufer der Jesuitenspiele anzusehen ist, ebenso wie die Schuldramen von Wolfgang Schmeltzl. Eine grandiose Entfaltung nimmt die Sache erst, als in Wien, Am Hof, ein Ordenstheater für Schulaufführungen und ein an die 3000 Personen fassender Festraum für die »Kaiserspiele« entsteht, die dem ganzen Volk künstlerischen Anschauungsunterricht in den höchsten religiösen und staatspolitischen Idealen erteilen und die heilige römische Weltidee Österreichs sinnfällig machen. Eines der beliebtesten Werke dieser Art ist die » Pietas victrix« von Avancinus, das den Sieg Konstantins über den heidnischen Tyrannen Maxentius feiert mit deutlicher Beziehung auf die Türkensiege und auf die christliche Weltsendung des Kaisers. Versetzen wir uns im Geiste in eine solche Festaufführung.

Aus: Pietas victrix.
(Universitätsbibliothek Wien.)
Ein getäfelter Saal, der zwei Stockwerke hoch ist, mit einer langen Fensterreihe auf der einen Seite; vergoldete Rosse, Gemälde und Heiligkeiten auf dem polierten Getäfel; rückwärts auf der Empore sitzen die Musizi. Inzwischen füllen sich die Plätze mit Festgästen in Staatskleidern, gepuderten Perücken; ein Flor von Damen in majestoser Pracht. Plötzlich atemlose Stille in dem lauten Gemurmel; Posaunenklänge: der Hof nimmt unter dem Thronbaldachin auf der Estrade Platz. Alles hat sich ehrerbietig erhoben; dann geht das Geplauder, gedämpfter zwar, wieder fort; man wirft einen Blick auf die Programme, die den Prolog enthalten, deutsch und lateinisch, eine Skizze der Handlung und die Personennamen des Stücks, auch einen Epilog mit Beziehung zur Heiligen Schrift.
Posaunen- und Feldmusik setzt ein und geht in liebliche Sphärenklänge über; holder Gesang ertönt; die Vorderbühne wird zum Feengarten mit Grazien und Nymphen; auf einem geflügelten Pegasus läßt sich Frau Poesia herab und bittet in zierlichen Versen um Audienz oder geneigtes Gehör. Der Vorhang der Hauptbühne mit dem Kaiserporträt Leopold I. fliegt endlich auf; in vielen Verwandlungen, mit mehreren hundert Personen, geht das Spiel ohne Pausen vor sich. Bild auf Bild, Szene auf Szene rollt ab wie in den Fresken der Raffaelschen Stanzen im Vatikan: Rom, dann Konstantins Feldlager, das Gegenlager des Maxentius, komische Zwischenspiele, der Miles gloriosus oder ergötzliche Soldat, der Hanswurst mit burlesker Stegreifdramatik, um die erwünschte Abwechslung zu bringen, das volkstümlich komische Element in der bewährten Verquickung des Erhabenen mit dem niedrig Komischen; die Magierszene fehlt nicht mit dem ganzen Teufelsspuk; Flug- und Wolkenmaschinen treten in Aktion, fliegende Drachen, alle Dämonen der Unterwelt, ein wahrer Höllenbrueghel; der Höllenfürst auf dem Schlangenwagen, gefolgt von einem Schwarm von Teufeln und Ungeheuern; Kometen und Blitzstrahlen durchzucken die Theaternacht; die Musik macht infernalischen Lärm mit Hundegeheul und Eulengekrächze – die Mächte des Himmels kämpfen mit der Unterwelt, sie bestärken den Helden mit allegorischen Sendboten, die zuweilen eine Vermahnung und Verwarnung gegen unliebsame Regierungsakte enthalten.
Dann wieder die Nähe Roms, die Ufer des Tibers, der mit Wassergottheiten einherflutet, Sirenen und Tritonen auf Delphinen und Meermuscheln, zum erlangenden Sieg Glück wünschend. Kriegerische Musik und Himmelschöre im bunten Wechsel; Gesang, Arien, Rezitation, Ballett, lateinische Wechselreden, derbe deutsche Späße, niederländisch-burgundische Fußturniere als österreichische Tradition und zum Schluß die kaiserliche Krönung in einer Apotheose von Licht und Glanz; die Himmel tun sich auf mit seligen Gefilden und der Gemeinschaft der Heiligen wie in den barocken Altarbildern und Deckengemälden; Engelschöre schmettern drein und künden den Sieg des ewig Guten, ewig Schönen, ewig Wahren – das Weihefestspiel, darin dämonische Unterwelt, vergänglicher Weltglanz und ewige Himmelsherrlichkeit im Phantasiebezirk des Theaters sich vereinigt, ist vorüber. Der ganze Olymp war aufgeboten, das Kulttheater der Antike, umgewandelt in den katholischen Geist, in die unermeßliche Phantasiewelt des Barocks.
Die Vermählung Leopold I. mit Margaretha von Spanien wird mit der größten und berühmtesten Barockoper »Der goldene Apfel« ( Il pomo d'oro) von Francesco Sbarra, Musik von P. Cesti, Szenenbilder von Burnacini, gefeiert; ein Jahr lang wird die Oper dreimal wöchentlich bei freiem Eintritt »mit Zulassung aller Leute« wiederholt. Die Chöre erscheinen als Personifikationen des Reiches, der Erbländer sowie Ungarns, Böhmens, Italiens, Sardiniens, Spaniens, Amerikas als Symbol der habsburgischen Weltmacht. Die Kunst, die alle religiösen, sittlichen und vaterländischen Werte umschließt und erhöht, gehört zur Staatsraison.
Die Geburt des männlichen Erben Joseph 1678, ein Jahr vor der großen Pest, wird durch die Prunkoper des Nikolo Minato »Die triumphierende lateinische Monarchie« gefeiert, ein Werk, das womöglich ein noch größeres kosmisches Weltbild entrollt. Keine Gelegenheit ging vorüber, ohne in grandioser Weise künstlerisch und musikalisch gefeiert zu werden.
Der neudeutsche Geschichtsgeist behauptet allerdings: »Der Geist ist durch die Barockzeit gebrochen worden. Die Kultur ist nur soweit wahrhaft gefördert worden, als sie von deutschen Protestanten ausging.« Die Geschichte beweist das Gegenteil. Österreich war die Heimat der Musen allezeit.
Salzburg hat bis Napoleon, 1800, immer seine eigene Geschichte gelebt. Es will scheinen, als ob das stille Erzstift von den Stürmen der Reformationszeit verschont geblieben sei, eine entrückte himmlische Insel, geborgen und wohl behütet zwischen den starken Weltpfeilern: der kaiserlichen Macht zur Rechten, der katholischen Liga zur Linken, und es ist richtig, daß der Dreißigjährige Krieg an dem fürstlichen Hochstift fernab vorüberbrauste, ohne es zu berühren.
Die mächtigste mittelalterliche Erscheinung war Leonhard von Keutschach; sie drückt sich in der Hohenveste aus, die das Stadtbild gewaltig beherrscht. Die zeitliche Ferne gibt ihr einen traumhaft romantischen Schimmer; sie ist dem Alltag entrückt, fast unbegreiflich in dieser Zeit; man möchte an eine Gralsburg denken. Noch mehr festigt sich der Eindruck eines Gralstempels, wenn man die Franziskanerkirche betritt, wo in dem fünfeckigen Säulenchor die Magie des Lichts um die Himmelskönigin flutet, die spätgotische Madonna von Pacher, die bereits ins Barocke hinüberspielt und sich ohne Bruch in den hochbarocken Kapellenkranz einfügt.
Wolf Dietrich hat Salzburg aus dem Mittelalter herausgeführt; der Schöpfer der Residenz, des Schlosses Mirabell, des Doms, hat der Stadt jenen hochkultivierten künstlerischen Charakter einer Fürstenresidenz aufgeprägt, der sie bis heute zu einer der schönsten und dramatischesten Städte machte. Was er begonnen, vollendeten seine Nachfolger, vor allem Markus Sittikus, der mit Schloß und Garten von Hellbrunn ein Stück Italien in unserer rauheren Alpenzone hervorzauberte; ferner Paris Lodron, der Gründer der Salzburger Universität, der als erster den Titel eines souveränen Fürsten führt.
Etwas Bedeutsames war schon 1582 geschehen, wodurch Salzburg, die Stadt des heiligen Rupertus, mit erneuter Bedeutung wieder in die Weltgeschichte eintritt: an Stelle des protestantisch gewordenen Bischofs von Magdeburg übernimmt fortan Salzburg den Vorsitz im deutschen Fürstenrat oder Reichstag; die Salzburger Erzbischöfe tragen die Würde und den Titel eines Primas von Deutschland.
Bedeutsame Zeitereignisse sind es, die die Entwicklung zur hochfürstlichen Repräsentation fördern und schließlich den Beinamen eines deutschen Rom nahelegen. Da ist vor allem das Wiedererstarken des Katholizismus nach dem Konzil von Trient, dieser eigentlichen kirchlichen Reformation, die man sehr uneigentlich als »Gegenreformation« bezeichnet hat. Dann, im Zusammenhang damit, die Erziehungsarbeit der Jünger Jesu, die mit ihren Exerzitien die Seelen neu aufbauen und alle Künste, voran das Theater, mit sinnberauschenden Wirkungen in den heiligen Dienst stellen, so den Aufbruch einer neuen Kunst herbeiführend, an deren Anfang kein Geringerer steht als Michelangelo, der Schöpfer der Peterskuppel in Rom. Es ist die Barockkunst, deren Segnungen bis ins fernste Waldtal zu spüren sind, ein Gegenzug zur verstandesnüchternen, kunstfeindlichen Sektiererei. Schließlich das große Beispiel Kaiser Ferdinand II., der in Wien die Kapuzinergruft stiftet (sein Vorgänger, Kaiser Matthias, hatte in einer nachdenklich ernsten Stunde als erster den Plan gefaßt), den Universitätsbau am alten Universitätsplatz und die prachtvolle Universitätskirche errichten läßt, die später von Andrea del Pozzo, dem großen Jesuitenkünstler, ausgeschmückt wird. Ferdinand II., durchdrungen von der Überzeugung, daß ohne die katholische Kultur die Welt ins Barbarentum zurückfällt, führt sie zum Sieg. Die Musik, die Oper, die großen Festspiele an seinem Hof sind unter ihm und seinen Nachfolgern Staatsangelegenheit.
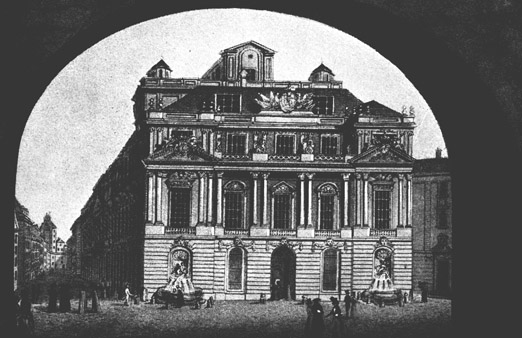
Aus dem barocken Wien: Der alte Universitätsbau.
(Bild von Tranquillo-Mollo. Museum der Stadt Wien.)
Wolf Dietrich, der Enkel des heiligen Karl Borromäus und Zögling des Collegium Germanicum in Rom, dieses Erziehungsinstituts zur Bekehrung der Deutschen, war als kunstliebender Fürst der rechte Mann der Erneuerung, obzwar er von inneren Konflikten nicht frei blieb und tragisch endete. In seine Zeit fällt der große Kulturkampf, der um 1600 und besonders nach dem Sieg am Weißen Berge mit der zwangsläufigen Auswanderung der Protestanten aus den österreichischen Landen und aus Salzburg endet. Denn auch das Erzbistum blieb nicht verschont von dem Fieber, das seit der Kirchenspaltung Deutschland durchschauerte und auf Österreich übergegriffen hatte. Das Revolutionäre einer neuen Lehre, die zugleich im Namen religiöser Grundsätze gewisse Freiheiten verspricht, sinnliche, materielle, auch soziale, und alte, erprobte seelische Bindungen aufhebt, kann immer eines Erfolges bei der leichtgläubigen und urteilslosen Masse sicher sein. Schon das Kämpferische und Negative ist für viele Menschen eine starke Anziehungskraft, wie überhaupt das Neue an sich, dessen Schattenseiten man noch nicht erfahren hat. Diese Tatsache kann man bei allen Bewegungen ähnlicher Art bis auf den heutigen Tag studieren; ihr Ablauf zeigt ein gemeinsames Gesetz. Die Gleichschaltung mit der deutschen Abfallbewegung hatte auch in den Städten und Tälern Salzburgs um sich gegriffen; Propagandazettel, Traktätchen, Schmähschriften, Karikaturen trugen die geistige Ansteckung bis in die entlegensten Hütten; unwillkürlich ist man an naheliegende Vorkommnisse erinnert. Zur Abwehr des fremden Geistes, der im geistlichen Hochstift besonders bedenklich erscheinen mußte, nahm Wolf Dietrich zu dem Jus reformandi seine Zuflucht.
Es war das Recht, das zuerst die protestantischen Fürsten für sich in Anspruch nahmen, und das auf dem Augsburger Religionsfrieden ebenso wie nach dem Dreißigjährigen Krieg im Westfälischen Frieden bestätigt worden ist, und das den Landesherrn zum Herrn der Religion macht: cujus regio, ejus religio; wes Brot du issest, des Liedlein du singest. Der Fürst bestimmte das Glaubensbekenntnis in seinem Lande; wer nicht anders wollte, hatte das Recht auszuwandern. Es war eine harte Maßregel, die da in protestantisch gewordenen Ländern gegen die treugebliebenen Katholiken angewendet wurde; sie ist zugleich aber verhältnismäßig glimpflich, wenn man bedenkt, daß zur selben Zeit im protestantischen England die Katholiken hingerichtet und umgekehrt in Frankreich die Hugenotten oder Protestanten aufs grausamste verfolgt und in der Bartholomäusnacht ermordet wurden.
Ferdinand war der erste, der das Jus reformandi auch zugunsten des Katholizismus anwendete, zunächst in der Steiermark, nach dem Grundsatz: was für den einen recht ist, muß für den andern billig sein. Wolf Dietrich tat das gleiche in Salzburg. 900 Bürger sollen die Auswanderung der Bekehrung vorgezogen haben. Damit war die Bewegung nicht zum Stillstand gekommen, trotz der Missionstätigkeit der Kapuziner, die ziemlich gleichzeitig mit den Jesuiten auftraten und sich der Glaubenserneuerung im niederen Volk widmeten. Unter dem Nachfolger und Vetter Markus Sittikus werden neue Auswandererzüge gemeldet, und später unter Max Gandolph verlassen Leute aus dem Deffereggertal und Dürrnberger Salzarbeiter ihre Heimat. Unter Leopold Firmian erfolgt die letzte Auswanderung, allerdings größten Stils. Unter der Einwirkung auswärtiger Geschehnisse, besonders in Frankreich, ist die Salzburger Bewegung wieder heftig aufgeflammt und schien sich zum Aufruhr oder Umsturz zu entwickeln. Darauf deuten die Versuche, den Reichstag in Regensburg, und insbesondere auch Preußen, das eine solche Gelegenheit immer willkommen hieß, zur Einmischung in innerpolitische Dinge zu bewegen. Es war klar, daß die Bewegung einen außenpolitischen Stützpunkt hatte und für den Bestand des kirchlichen Staates bedrohlich war. Daraus erklären sich zur Genüge die notwendig gewordenen strengen Abwehrmaßnahmen, über die man gerade Salzburg gegenüber nur tendenziöse und gehässige Berichte liest. Mit starker Übertreibung wird von 20.000 Menschen und mehr geredet, die nach Schwaben und Preußen ausgewandert sind.
Es wird immer behauptet, die Blüte Salzburgs hätte einen Knick bekommen. Die reiche künstlerische und kulturelle Entfaltung Salzburgs widerlegt diese Meinung. Das kunstverklärte, herrliche Salzburg als Schöpfung der Gegenreformation würde nicht sein, wenn die Bewegung von Anfang an gesiegt hätte. Man sieht es ja an Deutschland: was dort groß und schön ist, stammt aus der katholischen Zeit. Man kann denken über diese Dinge, wie man will; darüber sind die Gutmeinenden einig: Gott behüte Salzburg vor Bildersturm und Gleichschaltung mit Fremdgeist!
Hier im Gottesstaat Salzburg wurden im Schutz des Friedensregiments, unberührt von den Stürmen des Dreißigjährigen Krieges, wenn auch nicht von den Geisteswirren der Reformation, den Musen Altäre gebaut. Das pittoreske Felsentheater in Hellbrunn, das Markus Sittikus erschuf, um Pastorale und Opern darin aufzuführen, sowie der Schauplatz des Aulatheaters sind heute noch als entseelte Form zu sehen; daneben blühte das Akademietheater in der Residenz und die Bühne im Stift St. Peter, so daß das geistliche Salzburg in jener Glanzepoche zugleich vier Theater zählte.
Unter dem Einfluß der Alma Benedictina entwickelte sich die Blüte des Barocktheaters zu Salzburg, das die Domäne des gelehrten und sprachgewaltigen Dichterkomponisten P. Redtenbacher war, der Verfasser des »Ulixes« und der Schicksalstragödie » Ineluctabilis vis fatorum seu Atisfilius« (1673) und vieler anderer Musikdramen und Singspiele, die, wie der »Atys«, »Demetrius«, »Perseus« und andere ähnliche Stücke, antike Heroen ganz im Calderonschen Sinne mit der Bibel und der Eucharistie verbanden.
Das Aulatheater (1622-1800) genoß zu seiner Zeit geradezu Weltruf, es war Vorbild aller ähnlichen Einrichtungen österreichischer Benediktinerstifte, wie Lambach, Kremsmünster, St. Florian usw., und die überlieferten Dekorationsskizzen, die herrliche Architekturbilder aufweisen, rechtfertigen vollauf das Ansehen dieser Bühne, die durchaus den Vergleich mit den berühmten Jesuitentheatern in Wien, Prag oder Graz aushält. Ein erhaltener Theaterzettel, darauf die Figuren der italienischen Commedia dell'arte ihr Wesen treiben, kündigt eine Pantomime an als Zwischenspiel in einem Trauerspiel »Hermann«, das von der Liebe zum Vaterland handelt, mit deutschen und lateinischen Versen, die das Laster kleiner Städte, nämlich die Klatschsucht, zur Zielscheibe des gesunden Spottes haben.
Eine Salzburger Berglandschaft umrahmt den Text der Ankündigung zu Ehren des Fürsterzbischofs Siegmund Christof von Schrattenbach; der Hahn kräht auf einem Gipfel, über den Textrand beugt sich, den Hut über das Gesicht und die hervorquellenden Allongelocken gedrückt, der Edelmann, neben ihm ein Dämon in Krötengestalt mit Halskrause, seitlich die Spielfiguren des Hanswurst, Harlekin und Pierrot, unterhalb des Textes eine theatralisch bewegte Gestalt, den Kopf im Mantel verhüllt wie zum Angriff oder zur Abwehr, ein Pudel neben ihm; der Teufel, hervorkriechend, von Flammen aus den Felsblöcken angeleuchtet, und ein Magier mit dem Stab auf die Schrift zeigend.
Das Straßenbild zeigt eine Szene im Renaissancestil mit den agierenden Personen, dem wütenden Hausherrn, der Hanswurst und Harlekin aus dem Dienst jagt, indessen der lustige Pierrot als Angeber im Hintergrund lacht und trinkt. Es sind die berühmten Figuren der italienischen Commedia dell'arte; der Hanswurst indessen, der in den Wiener Hanswurstkomödien eine Volksbeliebtheit wurde, ist der echte Salzburger Genius loci.
Neben den lateinischen Komödien, der italienischen Pantomime, taucht das deutsche Schau- und Singspiel auf mit ländlichem, volkstümlichem Einschlag, wie die »Hochzeit auf der Alm« und dergleichen von P. Reichsiegel, die Hanswurstkomödie, wie »Der wachend träumende König Riepel« von Lindemayr. Das Salzburger Musikleben tritt dabei ins hellste Licht; die kirchliche Musik der Psalmen und der Hymnen bildet die Grundlage der geistlichen Musikdramen und der Singspiele, die Oper, als weltliche Schwester des Jesuitenbarocks, wächst immer selbständiger heraus; der italienische Hofpoet Metastasio erscheint unter den Autoren der Salzburger geistlichen Oper, und unter den musikalischen Koryphäen des Salzburger Hofes werden genannt Georg Muffat, der den Händel-Bachschen Stil pflegte (1679); Heinrich Biber (1684); Antonio Caldara (1718); der Opernkomponist Matthias Biechteler (bis 1740); Giov. Adolfo Hasse, Opernkomponist zu Mailand, der den Genius des Knaben Mozart voll erkannte (1763); Johann Ernst Eberlin als Kirchen- und Theaterkomponist (1742-1763), dessen Choral täglich noch heute in Salzburg erklingt; Johann Michael Haydn (der Bruder Joseph Haydns); Anton Caj. Adlgasser, als Schüler Eberlins; Johann Leop. Mozart als Vater Wolfgangs; sie alle sind die Vorläufer des großen Genius Amadeus, der die musikalische Barockkunst zu dem leuchtendsten Gipfelpunkt und zum Abschluss führt.

Der kleine Mozart bei Maria Theresia; neben ihm seine Schwester Nannette.
(Bild von Eugen von Blaas. Kunstverlag Wolfrum, Wien.)
Der verstandesnüchterne Rationalismus eines Gottsched, der die Musen maßregelte, in die Zwangsjacke des steifen französischen Klassizismus steckte, die Aufklärung unter Joseph II., deren Vertreter der letzte regierende Erzbischof Colloredo war, die innere und äußere Säkularisation machten der blühenden Barockkultur, die eine wahre Volkskultur war, ein Ende; den politischen Stürmen der Zeit fiel die Salzburger Benediktineruniversität zum Opfer, und mit der Aufhebung der staatlichen Selbständigkeit Salzburgs durch Napoleon (1800) schloss das Aulatheater seine Pforten; die ruhmvolle Barockkunst und Literatur, Österreichs Heldenlied, sank damit ins Grab des Vergessens und nur ihr Schattenbild ergreift uns in den entgeisterten Architekturen, Gärten und leeren Schauplätzen Salzburgs mit seltsam wehmütigem Reiz. Seit 1816 ist Salzburg bleibend als Kronland, beziehungsweise Bundesland im österreichischen Staatsverband; die Festspiele seit 1921 mit den »Jedermann«-Aufführungen am Domplatz und die schrittweise Erneuerung der alten Salzburger Universität erscheinen als zeitgemäße Kulturbelebung auf dem Boden einer großen Vergangenheit und begründen den neuen Weltruf Salzburgs.
Zwei Ereignisse sind es, die in der glanzvollen Barockentwicklung unter Leopold I. einen tiefen Einschnitt machen, als ob alles wieder zu Ende wäre – jedoch nur um ein neues barockes Wien und ein innerlich erstarktes Österreich desto herrlicher aufblühen zu lassen: die Pestzeit 1679 und vier Jahre später die zweite Belagerung Wiens durch die Türken 1683.
Seit der ersten großen Pestzeit unter Albrecht dem Lahmen 1347 war der schwarze Tod niemals mehr so verheerend aufgetreten als eben in dem denkwürdigen Jahr 1679 in Wien, wo binnen wenigen Monaten nicht weniger als 50.000 Menschen von der Seuche dahingerafft wurden, so dass viele Häuser leerstanden und die Stadt am Schluss verödet schien. Noch im anbrechenden Juli stand die Stadt im höchsten Festesglanz. Die große moskowitische Gesandtschaft hatte einen prächtigen Einzug gehalten, Musik erscholl aus den Palästen und Höfen, ein harmonisches Getös, als hätte der Himmel ein Loch, durch das die Freuden metzenweise in die Wienerstadt gefallen waren. Aber das Glück ist wandelhaft; der »Tod und die Tödtin« hatten ebenfalls ihren Einzug gehalten, in der Leopoldstadt, der ehemaligen Judenstadt, stellten sich die Vorboten ein, und alsbald waren die Häuser und Straßen voll Sterbender und Leichen; die Pest machte keinen Unterschied und verschonte keinen der Stände, weder Geistliche noch Laien, weder Männer noch Frauen, weder arm noch reich. Der Hof hatte sich auf den Kahlenberg zurückgezogen; wer konnte, floh aus der Stadt, hinaus aufs Land, fern von den Menschen; die Pestknechte hatten vollauf zu tun, die Leichen auf die Karren zu laden und die Pestgruben schichtweise mit Leibern anzufüllen, aber sonst auch mitgehen zu lassen, was nicht niet- und nagelfest war. Als helfender, tröstender Engel erwies sich Fürst Ferdinand Schwarzenberg; überall half er, mit eigenen Händen und eigenem Geld, ließ Diebe aufknüpfen, steuerte Mißbräuchen, die mit dem Unglück Hand in Hand gehen. Aus Rache sollen ihn die Pestknechte einmal in eine Pestgrube geworfen haben; aber das Volk wußte seinen »Pestkönig« zu ehren, der am Neuen Markt ein stattliches Palais erbaute, eine architektonische Zierde des alten Wiens bis in unser Jahrhundert herein.
Es ist so recht bezeichnend für das österreichische Gemüt und besonders für die Wiener Art, daß sie auf das schwerste Unglück mit Humor reagiert und mit überlegenem Lächeln einen inneren Ausgleich sucht und findet über der Vergänglichkeit irdischer Herrlichkeit. Keiner hat das so verstanden wie der Augustinermönch Abraham a Santa Clara, der eigentlich Ulrich Megerle hieß und aus dem Badensischen als 18jähriger Novize nach Wien gekommen war. Hier wurde er gleichsam die Stimme des Wiener Genius loci. Seine Predigten, in denen er niemand schonte, am wenigsten die Hofgesellschaft, fanden stürmischen Zulauf. Kaiser Leopold, dem er »eine Weissagung von Glück ohne Tück« machte, ernannte ihn 1677 zu seinem Hofprediger. Seine Predigten und Schriften waren Kunstwerke, funkelnd von Phantasie, Witz und Poesie; sie wetteiferten mit der barocken Architektur und Freskenmalerei, mit der Barockoper und dem prunkvollen Jesuitendrama; sie waren Geist vom selben Geist und noch etwas dazu.
In seinem »Merks Wien« schildert er die Pestzeit in Bildern nach Holbeins Art, ein Totentanz, wie er packender, grausiger und erschütternder niemals geschaut und gesungen ward. Wie eine Trommel tönt sein Lied, die gellend zum Jüngsten Gericht ruft, grandios und volkstümlich zugleich, mit dem Kehrreim: »Denn sterben müssen alle Leut – das ist ein alte Metten!« In seinem Alphabet, das er seinem Werk vorausschickt, sagt er über den Buchstaben W: »Ist endlich der allerschwerste Buchstab! Die kaiserliche Residenzstadt in Österreich, dieses verfestigte Granithaus, die ehrreiche, lehrreich und gewehrreiche Stadt hat von uralten Zeiten her den Namen Wien, dessen erster Buchstab ein W. Nun muß ich es mit nassen Augen anzeigen und nicht mit geringen Herzensseufzern erinnern, daß, wer anjetzo will Wien schreiben, muß es schreiben mit einem großen W, allermaßen ein großes und abergroßes W(eh) und Wehklagen in Wien, an Wien, und um Wien!« Das ist die biegsame, urkräftige, ausdrucksvolle Altwiener Gemütssprache.
Nun hechelt er alle Personen und Stände durch und stellt jedem Kapitel Verse voran als Memento mori, die sprachschöpferisch und als volkstümliche Ausdrucksweise dichterische Kabinettstücke sind. Da ist die Rede »vom dürren Rippenkramer, der Kehraus macht mit Papagei und Lapperei und all der vielen Schwatzerei! Wo der Lakei mit Keierrei muß Posten tragen und mit allen Umständ fragen: ob d'Polsterkatz noch wohlauf sei – da ist's jetzt still, man sieht nicht viel, man find't dafür, früh vor der Tür nur Kranke oder Tote.«
Dann schildert er, wie der Tod vor niemand Halt macht, auch nicht vor der »frommen Klerisei – ihr alle seid vor'm Tod nicht frei, das Reverende Domine mit schönem Titl und Nomine, tut Euch vor'm Tod nicht retten!« Aber auch das »Alabastergesicht der Hofdamen mit Spiegel und mit Kampl überredet ihn nicht, es ist ihm soviel wie der Trampl«. Dasselbe gilt für den Reichen: »Fort, fort, du reicher Batzengesell ...« Oder für die Gelehrten: »Ihr hoch- und wohlgelehrte Köpf, Doctores und Discipel, Ihr seid mir gleich wie andere G'schöpf ...« Dann die Eheleute: »Ihr Ehleut habt doch nimmermehr vorm Tod ein Kräutl g'funden, denn sterben müssen alle Leut, das G'setz läßt sich nicht wenden ...« Auch auf den Soldaten hat der grimmige Tod seinen Pfeil absonderlich gezielt: »Du martialisch Heldenblut, niemand kann dich g'nug preisen, aber trutze nicht, mein Pfeil ist gut, durchdringt ein Kleid von Eisen ...« Zum Schluß wird derjenige entdeckt, der Wien und sonstige Orte der Welt mit der pestilenzischen Seuch angesteckt hat, nämlich der Tod selber: »Wirst sonst keinen andern finden. Singt und sagt nun alle Leut: Gott straft wegen der Sünden.«
Einen Eckstein der Barockliteratur kann man Abraham a Santa Clara nennen, gewiß einen der größten Sittenschilderer aller Zeiten und eine Kulturmacht volkstümlichster Art; sein Hauptwerk »Judas, der Erzschelm« zeigt sein schöpferisches Sprachgenie und seine Gestaltungskraft von der besten Seite; in Österreich ist er heute noch, wie die Barockkunst überhaupt, lebendiges Kulturgut; in der heimatlichen Volkssprache, aus der er schöpfte, und die er bereicherte, lebt er fort.
Eine zweite Verkörperung aus der Pestzeit hat der Genius loci in dem lieben Augustin gefunden, dem Urtypus des Volkssängers und Volksdichters, dessen resigniert übermütiges Liedl: »O du lieber Augustin – alles ist hin« im Volksmund unsterblich ist. Er ist wie der Hanswurst eine Barockgestalt aus dem Volke und zugleich symbolische Figur für die Unüberwindlichkeit des Wienertums, das nicht untergeht und in seiner unverwüstlichen Laune das Heilmittel gegen alle Krankheiten der Zeit gefunden hat. Es ist nicht ohne Bedeutung, das er eine legendenhafte Erscheinung geblieben ist, von der außer seinem lockeren Liedl nichts überliefert ist als die vielsagende Erzählung, daß er voll bezecht von den Totengräbern auf den Pestwagen aufgeladen und in eine Totengrube geworfen wurde. Als er seinen Rausch auf diesem grausigen Lager ausgeschlafen und am Morgen erwachte, griff er zur Sackpfeife, spielte seine närrischen Weisen, auf den Pestleichen hockend, und lockte Leute herbei, daß sie ihm aus der Grube heraushelfen sollten. Ein groteskes Gleichnis, das Todesgrauen und Lustigkeit im schroffsten Gegensatz zusammenfaßt.
Nach dem Erlöschen der Pest brach denn auch die Lebenslust um so stärker wieder hervor. Am Weihnachtstag schritten nicht weniger als 95 Brautpaare in der Stephanskirche zum Altar. Mit monumentaler Größe ragt ein Wahrzeichen der Pestzeit in unsere Gegenwart herein, die Dreifaltigkeitssäule am Graben, die in ihrer bestehenden Form 1693 von Burnacini vollendet wurde. Das repräsentativste barocke Denkmal Wiens, ein steingewordenes Mysterium, darin sich schärfste Realistik, wie die Gestalt des knienden Kaisers, mit kühnster allegorischer Symbolik verbinden. Eine Welt der Phantasie und des Glaubens, die wohl nur wenige ganz zu Ende geschaut und gedacht haben.

Die Türken zum erstenmal vor Wien 1529.
(Museum der Stadt Wien. Bild Hans Lautensack.)
Kreuz oder Halbmond? Der jahrhundertelange, welthistorische Kampf, vom Haus Österreich mit zäher Beharrlichkeit fast allein geführt, kommt nun vor Wien zur endgültigen Entscheidung. Das osmanische Reich von den Karpathen bis Abessinien, vom Atlas bis zum Ararat über drei Erdteile gelagert, ist seit Soliman und seit seiner vergeblichen ersten Belagerung Wiens 1529 im unaufhaltsamen inneren Verfall. Eroberung und Unterwerfung ist der naheliegende Ausweg, hier auch durch den Koran religiös bedingt. Für Österreich schien die Lage verzweifelt. Der ungarische Aufstand unter Tököly, der die Türken zu Hilfe rief, französisches Geld spielte dabei eine große Rolle; die Wegnahme von Straßburg (Elsaß) durch Ludwig XIV. mit Hilfe des Kurfürsten von Brandenburg, der jährlich bereits 400.000 Livres von Frankreich bezog und Braunschweig-Hannover mit dem Einmarsch bedrohte, wenn es dem Kaiser zu Hilfe käme; der drohende Anzug der Türken, denen Tököly und die französischen Ingenieure Ludwigs die Wege nach Wien wiesen – es sah wirklich wieder einmal so aus, als wäre es Matthäi am letzten.

Graf Starhemberg, der Verteidiger Wiens, auf seinem Beobachtungsposten im Stephansturm. Bischof Rollonitz tritt zu ihm ein.
(Bild von A. R. von Perger, Stich von Leop. Beyer.)
Wien verbesserte auf alle Fälle seine Festungswerke, die verglichen mit den Mauern von 1529 modernen Anforderungen entsprachen, mächtige Wälle mit elf Bastionen hinter tiefen Gräben. Rüdiger von Starhemberg hatte die Verteidigung übernommen; die Besatzung zählte im Ganzen 22.000 Mann; auf den Wällen standen 200 Geschütze; gefaßt erwartete Wien den furchtbaren Feind, der mit 230.000 Mann und 300 Geschützen unter der Führung des ehrgeizigen Großwesirs Kara Mustafa heranzog. Der Kaiser war indessen nicht ganz ohne Beistand geblieben. Sein größter Helfer war Papst Innozenz XI., dieser sammelte nicht nur Geld für Lebensmittel und Munition, er ermahnte auch die Fürsten zum Schutz der Christenheit und hielt Ludwig XIV. davon ab, in dieser Lage gegen den Kaiser offen etwas zu unternehmen; vor allem löste er den Polenkönig Johann Sobieski aus dem französischen Bündnis und bestimmte ihn, den Türkensieger, zur Entsendung eines Entsatzheeres.
Wie immer in den großen entscheidenden Augenblicken hatte ein heiligmäßiger Mann Anteil an den Schicksalswendungen Österreichs; wie einst der heilige Capistrano und später Dominikus a Jesu Maria, so war es jetzt der Kapuziner Marco d'Aviano, päpstlicher Legat, Freund und Ratgeber des Kaisers. Erst die neuere Forschung hat festgestellt, wie ungeheuer groß das Verdienst dieses Mannes war, der es verstanden hat, die widerstrebenden und eigensinnigen Führernaturen immer wieder zu einigen und an das hohe und gemeinsame Ziel zu binden, zu trösten, aufzumuntern und anzufeuern, so daß es in Frage steht, ob das schwere Unternehmen ohne eine solche Seelenführung hätte gelingen können.
Militärisch von ausschlaggebender Bedeutung war Karl V. von Lothringen, allerdings ohne Land – Ludwig XIV. hatte es ihm weggenommen, dagegen hatte ihn Leopold als kriegführende Allianzmacht angenommen und damit in seinen Rechten anerkannt – er war Führer des kaiserlichen Heeres und eigentlich die Seele der ganzen Abwehr. Vor den sich heranwälzenden Türkenmassen zog er sich mit seinen 60.000 Kaiserlichen langsam auf Wien zurück und hielt die Stellungen nördlich der Donau, um einerseits in Fühlung mit der Stadt zu bleiben und die Scharen Tökölys abzuwehren, anderseits die Vereinigung mit dem zu erwartenden polnischen Entsatzheer und den Reichstruppen zu einem gemeinsamen Entscheidungsschlag zu ermöglichen.
Am 12. Juli meldete der nächtliche Feuerschein brennender Dörfer die Nähe des Feindes im Osten. Starhemberg ließ die Vorstädte räumen und in Brand stecken, eine harte Notwendigkeit, wenn man bedenkt, wieviel Kultur und Kunstbesitz an Schlössern und herrlichen Kirchen vernichtet werden mußte. Schon am 7. Juli war der Hof nach Linz übersiedelt; eine allgemeine Flucht begann; binnen zwei Tagen sollen 60.000 Menschen die Stadt verlassen haben, zugleich suchten Haufen fliehender Landleute hinter den Wällen Wiens Schutz; meilenweit waren die Straßen mit Wagen, Pferden und obdachsuchenden Menschen bedeckt. Die Panik war ungeheuer. Da ließ Herzog von Lothringen am 8. Juli seine ganze Reiterei, 10.000 Pferde, durch die Stadt ziehen, dadurch wurde der Mut etwas gehoben. Die eiserne Strenge des Kriegsgesetzes herrschte nun über der Stadt und machte kurzen Prozeß mit Überläufern, Aufwieglern, Miesmachern; das hielt die Disziplin aufrecht. Starhemberg war der rechte Mann dazu, streng und leutselig zugleich, unermüdlich in der Pflichterfüllung, obschon mehrfach verwundet und leidend; Tag und Nacht auf der Runde oder oben auf dem Stephansturm, wo er das schauerliche Gemälde beobachten konnte. Ihm zur Seite standen der Wiener-Neustädter Bischof Leopold von Kollonitsch, hingebend in der Pflege der Verwundeten und Kranken und der verwaisten Kinder, ferner der wackere Bürgermeister Liebenberg, der während der Belagerung verstarb.
Im weiten Halbkreis bedeckten die feindlichen Zelte die Ebene von Erdberg bis Döbling; der Großwesir hatte sein prachtvolles Gezelt westlich von der Stadt gegen Penzing aufgeschlagen; nur der Nordosten blieb frei, wo über der Donau das Armeekorps des Herzogs von Lothringen im Marchfeld stand und mit Starhemberg eine gewisse Verbindung unterhielt, vor allem durch den Kundschafter Kolschitzky, einen Serben, und seinen Diener Mihailowitsch, der von seinem dritten Kundschaftergang nicht mehr zurückkehrte. Sein Herr, dem die Kaffeevorräte der Türken zugefallen waren, ist der Begründer des ersten Wiener Kaffeehauses.
Die Türken begannen zugleich mit der Beschießung ihre gewohnte Minierarbeit, diesmal nicht wie bei der ersten Türkenbelagerung zwischen Kärntner- und Stubentor, sondern in der Gegend zwischen Burg und Löwelbastei, wo sie nicht mit Grundwasser zu tun halten. Darin waren sie von genauen Kennern der Befestigungswerke, nämlich von den französischen Ingenieuren, beraten. Wenn eine Mine aufflog, wurde gestürmt; aber jeder Sturm, der sich bald täglich wiederholte, wurde von den tapferen und todesmutigen Wienern zurückgeschlagen. Erst am 4. und 5. September konnte sich der Feind an der Burgbastei und am 6. und 8. an der Löwelbastei festsetzen; er stand mit einem Fuß in der Stadt, wenn auch die Eingänge der nächsten Straßen verbaut und mit Geschütz versehen waren. Die Not war aufs höchste gestiegen. Krankheiten wüteten in der Stadt; Starhemberg war selbst von der Lagerseuche befallen; Munition und Lebensmittel begannen zu fehlen; nur Wein war genug da, denn Wien hatte eine zweite unterirdische Stadt von wohlgefüllten Kellereien, das richtete den sinkenden Mut immer wieder auf. Aber auch im Lager der Janitscharen war es nicht mehr am besten bestellt.
Endlich am 6. September kündeten Raketen über dem Wienerwald die Nähe des Entsatzheeres an; am 9. September zeigten sich starke Abteilungen im Westen; Starhemberg sandte einen Zettel an Herzog von Lothringen: »Keine Zeit mehr verlieren, ja keine Zeit verlieren!« Am 11. September erschien über dem Kahlenberg die rote Fahne mit weißem Kreuz: das Entsatzheer war da. Sobieski hatte 26.000 Polen herangeführt. Johann Georg von Sachsen 11.000 Mann, Max Emanuel von Bayern 11.000 Bayern und 8400 Franken und Schwaben, denen sich Carl von Lothringen mit 27.000 Österreichern anschloß. Am 12. September begann der Gesamtangriff, nachdem die Fürsten in der Kapelle am Leopoldsberg die Messe gehört, wobei der Oberbefehlshaber Sobieski ministrierte. Der Hauptflügel unter Lothringen, die Kaiserlichen und die Sachsen, hielt sich längs der Donau; im Zentrum gingen die Bayern vor, die Franken und Schwaben; die Polen hatten den weitesten Weg als rechter Flügel und kamen erst Nachmittag um 2 Uhr ins Gefecht; dafür fielen ihnen die Schätze des Hauptzeltes in die Hände. Gegen 6 Uhr abends war der Sieg entschieden; das aufgelöste Türkenheer mit den fernsten asiatischen und afrikanischen Völkern war in regelloser Flucht.
Wien sah grauenhaft aus. Die zerschossenen Wälle und Bastionen glichen geborstenen Felsen; die Häuser waren Höhlen, ohne Dach, halb ausgebrannt und teilweise eingestürzt; der Unrat in den Straßen ekelerregend; die Spuren der ausgestandenen Leiden ergreifend; alles eilte in die Stephanskirche, um mit einem Tedeum dem Schöpfer für die Befreiung zu danken, die zugleich den Anbruch einer neuen glücklichen Zeit bedeutete. Aus Schutt und Asche sollte sich Wien neu erheben, schöner als je. Den besten Teil der reichen Beute aber hatte sich Bischof Kollonitsch erwählt: die Scharen der verwaisten Kinder als den größten Schatz, davon Poesie und Malerei die Erinnerung überliefert.

Prinz Eugen von Savoyen.
(B. Vogel nach J. Kupezky. Porträtsammlung der Nationalbibliothek, Wien.)
Ein unscheinbarer, schwächlicher blutjunger Leutnant, häßlich von Angesicht, mit zu kurzer Oberlippe, die die Zähne nicht deckte, und faltigen Zügen, fast greisenhaft, doch edles Feuer in den blitzenden Augen, stürmte er an der Spitze seiner Dragoner in der Entsatzschlacht gegen die Türken vor Wien, am 12. September 1683, vom Leopoldsberg über das Kahlenbergerdörfl gegen das Türkenlager und betrat mit dem Degen in der Faust Wien bei der Burgbastei, ungefähr dort, wo heute sein Denkmal steht; ein armer Prinz aus Savoyen. Er war eben in das kaiserliche Heer eingetreten, nachdem er Frankreich den Rücken gewendet hatte für immer, erbittert über die verächtliche Behandlung, die ihm Ludwig XIV. angedeihen ließ, indem er dem »kleinen Kapuziner« die Führung auch nur einer Kompanie Soldaten verweigerte. Kleine Ursachen, große Wirkungen. Hätte Ludwig die welthistorische Sendung dieses Mannes ahnen können, der ihm als stets siegreicher Gegner nachmals viel Kummer bereitete, die Weltgeschichte hätte vielleicht eine andere Wendung genommen. Noch in späten Tagen äußerte er zu dem besiegten französischen General von Biron: »Es freut einen, manchmal doch in die Lage zu kommen, bezeugte Mißachtung bereuen zu machen.« Rechnet man zu seinem Genie noch die tiefe Frömmigkeit hinzu, dann vervollständigt sich das Bild dieses einzigartigen Mannes, der einer der größten Feldherrn war und mehr als ein Feldherr.

Die Türken vor Wien 1683. Sturm auf die Löwenbastei.
(Leander Ruß.)
Vor Wien waren die Türken zwar geschlagen; zum unheilbar kranken Mann aber, dessen Macht für immer gebrochen war, haben ihn erst nach der Einnahme von Ofen die glänzenden Siege Prinz Eugens gemacht in der gewaltigen Schlacht bei Mohacs 1687, in dem Entscheidungskampf bei Zenta und zwanzig Jahre später in den berühmten Tagen von Peterwardein und Belgrad. Inzwischen hatte auch Brandenburg-Preußen wieder mitgemacht. Hier vor Belgrad, in der gewagtesten Lage des Heeres, ersann der Legende nach ein Wachtmeister das Lied von »Prinz Eugenius, dem edlen Ritter, der dem Kaiser wiederum tat geben Stadt und Festung Belgerad«. Am Wachtfeuer wurde es bald von tausenden rauhen Kehlen gebrüllt und blieb unvergessen als Anfang der österreichischen Kriegs- und Freiheitslieder.
Der Friede von Passarowitz 1718 war wohl einer der glänzendsten für Österreich; die Herrschaft bis zur Donaumündung war nur mehr eine Frage der Zeit und gehörte zu den Plänen Prinz Eugens. Die Kriege im Westen und in Italien verhinderten zunächst die Erfüllung und später war sie durch die unglückliche Hand Joseph II. verscherzt worden. Immerhin aber hat der Sieg bei Zenta, 1697, als der vollkommenste Sieg über die Türken, der die feindliche Armee vernichtet hatte, die Eroberung Ungarns entschieden. Erst die Eroberung Ungarns, das aus einem Wahlreich in ein erbliches Kronreich Habsburgs verwandelt wurde, hat Österreich zur selbständigen europäischen Großmacht erhoben, gänzlich unabhängig vom »Reich«, das nur mehr in der Kaiserwürde eine Schattenexistenz führte. Ohne diese Entwicklung Österreichs, die sich an die Ruhmestaten Prinz Eugens knüpfte, würde Ludwig XIV., wie Leopold von Ranke meint, die römisch-deutsche Kaiserkrone erlangt haben, nach der er strebte. Die französischen Könige fühlten sich nämlich als die eigentlichen direkten Nachkommen Karls des Großen. Doch der Plan Ludwigs ging schon vor den Mauern Wiens 1683 fehl. Dem Sonnenkönig war es unerträglich, daß der Kaiser im Rang über ihm stand – das ist der Grund der vielen Kriege, die Ludwig entfesselte.
Es war nun auch höchste Zeit, der Politik Ludwigs entgegenzutreten, dessen Raubkriege, die sogenannten »Reunionen«, den Westen Deutschlands verwüsteten, die Kaisergräber in Speyer schändeten und das Heidelberger Schloß niederbrannten. Die Abwehrkriege am Rhein und in den Niederlanden, die die deutsche Westgrenze schützten, wenn sie auch das verlorene Straßburg nicht wiederbringen konnten, waren der Auftakt zum Spanischen Erbfolgekrieg, durch den Haus Österreich seine Großmachtstellung behauptete und seinen Anspruch auf den erledigten spanischen Thron gegen Frankreich verteidigte. England und Holland stand an Seite Leopold I.; der Kurfürst von Bayern hielt zu den Franzosen, er gedachte auf Wien zu marschieren, Habsburg zu vernichten und sich die deutsche Kaiserkrone anzueignen. Doch Prinz Eugen, unterstützt von den Engländern unter Marlborough schickt die vereinigten Franzosen und Bayern bei Höchstädt 1704 blutig heim. Die Kämpfe Eugens in Oberitalien bei Carpi, Chiari, Cremona und Luparo, die die Franzosen im Spanischen Erbfolgekrieg zurückdrängten, dann später bei Turin, immer gegen eine gewaltige Übermacht, bedeuteten ebensoviele politische Siege Österreichs. Sie hatten wie die Schlachttage von Oudenarde, Lille und Malplaquet einen bösen Klang für Frankreich. Zwar hatte zuletzt Marlborough unglücklich gekämpft, worüber die Franzosen heute noch spotten: » Marlborough s'en va-t-en guerre«; da war es Prinz Eugen, der in Staub und Rauch der Schlacht flammenden Auges vor seinen Truppen auftauchte und sie zum Siege fortriß. Immer setzte er sein Leben aufs Spiel, fünfmal war er verwundet worden, am schwersten bei Belgrad, niemals aber wurde er besiegt.

Blick auf das barocke Wien vom Belvedere, dem Sommerpalais des Prinzen Eugen.
(Canaletto.)
1705 starb Kaiser Leopold mit den Worten: » Consumatum est.« Obschon friedliebend, hatte er die meisten Kriege zu führen und durch seine Feldherren mehr Siege erfochten als je einer seiner Vorfahren. Er hatte sich um 1700 bestimmen lassen, Friedrich III. von Brandenburg den Königstitel zu verleihen, allerdings nur für Preußen; Prinz Eugen bemerkte, die Räte, die ihn dazu veranlaßten, verdienten gehängt zu werden. Unter Kaiser Joseph I., dem Sohn und Nachfolger Leopolds vollendete Prinz Eugen die Eroberung Italiens gegen die Franzosen; und diente nach dem frühen Tode Josephs auch dessen Bruder und Nachfolger Karl VI. Wenn sich auch die Begründung einer neuen spanischen Linie infolge des frühen Todes Josephs, der an den Blattern gestorben war, nicht ermöglichen ließ, so hatten doch die Friedensverhandlungen zu Rastatt, von Prinz Eugen genial geführt, für Österreich nicht nur den Besitz Belgiens, sondern auch Italiens gesichert. Damit war Österreich die stärkste Großmacht Europas geworden und Wien die kulturelle und politische Hauptstadt Italiens.
Schon damals hatte sich das Wort von der Monarchia Austriaca eingebürgert, österreichische Monarchie, ein Wort, das auch Prinz Eugen gerne gebrauchte. Die Monarchie war recht eigentlich ein Staatenverband, gebunden durch das gemeinsame Herrscherhaus und durch ein Verfassungsgesetz, das Karl VI. gab, die Pragmatische Sanktion. Es war geistige Tradition des Hauses, die überlieferten Rechte der Stände und Länder zu achten und bestehen zu lassen. Dadurch unterscheidet sich Österreich bis auf den heutigen Tag von anderen Staatsauffassungen, wie etwa der preußischen, daß es nicht eine bloße staatliche Zwangsordnung ist, sondern auf einer religiös-sittlichen Ordnung beruht, wie es dem Sinne der heiligen Krone entspricht, auf Recht, nicht auf Gewalt. Was Österreich für den Bestand Europas zu bedeuten hatte, sprach Leibniz aus: »Deutschland würde untergegangen sein, es würde vielleicht gar wie die Ungarn den Barbaren dienen«, schrieb er 1689, »wenn nicht Gott eine neue Macht erweckt hätte in dem Hause Österreich. Österreich erstand als das Bollwerk für Deutschland; Österreich allein hat es vermocht, das wankende Geschick Europas aufrecht zu erhalten. Diesem Haus halte ich für gerecht, es beizumessen, daß Deutschland noch besteht.«
Prinz Eugen war nicht nur einer der genialsten Feldherrn überhaupt, sondern auch ein glänzender Organisator, der für seine Soldaten sorgte, als wären sie seine Kinder. Das erklärt seine ans Wunderbare grenzenden Erfolge, die nicht nur auf seiner neuen Taktik der blitzschnellen Angriffe und des Offensivgeistes beruhen, sondern eben auch darauf, daß er sein Instrument, das Heer, dafür tauglich machte. Als er es übernahm, fand er es in traurigstem Zustand, ohne Stiefel, ohne Geld, fast ohne Mut; er hat es zur stolzen Armee entwickelt, die schier unüberwindlich galt selbst in den gewagtesten und gefährlichsten Schlachten.
Prinz Eugen war aber auch eine kulturelle Persönlichkeit, ein Freund der Künste, der der Stadt Wien, die sich in neuem Glanz erhob, seinen Stempel aufdrückte. Zwei der schönsten Palais Wiens, das Winterpalais in der Himmelpfortgasse, von Fischer von Erlach erbaut, und das Sommerschloß Belvedere, eine Schöpfung Hildebrandts, tragen seinen Namen. Hier spürt man den großen Kunstmäzen. Blickt man im großen Marmorsaal durch die hohen Fenster auf das Gartenbild, wo sich im Hintergrund der Stephansturm und das Kahlengebirge erhebt, dann hat man jenes glanzvolle Wien vor sich, wie es Prinz Eugen gesehen.
Pragmatische Sanktion. – Die Glanzzeit des Barocks
Im Anfang des XVIII. Jahrhunderts war Österreich das größte Reich Europas, wie etwa zur Zeit Karl V. Bereits seit Leopold I. war der Name Österreich für die gesamte Ländermasse üblich und eingebürgert; ein österreichisches Staatsbewußtsein hatte sich nach den Türkenkriegen entwickelt, das durch eine entsprechende Verfassung unterbaut wurde, nämlich durch die Pragmatische Sanktion Karl VI., wonach das Erbrecht auch auf die weiblichen Nachkommen übergehen soll, damit die Ländermasse als Monarchie in einer Hand bleibe. Die Grundlage dieser Verfassung bildet das habsburgische Hausgesetz, ferner die schon unter den Babenbergern gesicherten Rechte, die im friderizianischen Freiheitsbrief bestätigt und im Privilegium majus von Rudolf dem Stifter erweitert wurden.
Die Sorge Karls war tief begründet, nicht nur im dynastischen Interesse, sondern vor allem auch im Interesse der staatlichen und kulturellen Fortdauer. Unausdenkbar, was Österreich gedroht hätte beim Aussterben der Manneslinie. Es wäre zerrissen und aufgeteilt worden, ein Raub fremder Mächte. Wie in Spanien, das für das Haus Habsburg verlorenging, war auch in Österreich kein männlicher Erbe da. Die Söhne Leopold I., Joseph und Karl, waren erst seiner dritten Ehe mit einer deutschen Prinzessin von Pfalz-Neuburg entsprossen; während früher die männlichen Geburten überwogen, schuf die deutsche Verbindung Leopolds auch rein äußerlich einen neuen Typus, wohl mit körperlichen Vorzügen, aber in der Deszendenz des kühleren Blutes mehr Töchter als Söhne. Joseph I. hatte nur Töchter; als er nach kaum sechsjähriger, glänzender Regierungszeit 1711 an Blattern verstarb, mußte sein Bruder Karl, der die spanische Herrschaft angetreten hatte, wo ebenfalls die direkte männliche Nachfolge erloschen war, zurück nach Österreich; trotz des Spanischen Erbfolgekrieges war Spanien gegen den bourbonischen Anspruch nicht zu halten. Dafür war in dem fast vierzehnjährigen Krieg der italienische Besitz Österreichs erkämpft, die deutsche Westgrenze gegen die Machtpolitik Ludwig XIV. gesichert und die Einheit der Monarchie gefestigt.
Auch Karl VI., nunmehr deutscher Kaiser, hatte aus seiner Ehe mit der braunschweigischen Prinzessin Elisabeth Christine nur Töchter, von denen Maria Theresia das nächste Anrecht hatte. Es ist begreiflich, daß Karl VI. zeitlebens um die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion seitens aller Mächte bemüht war und dafür manches Opfer in Kauf nehmen mußte. Es war eben kein willkürlicher Akt, sondern ein Vertrag, der sich nicht auf Gewalt, sondern auf Recht stützte. Das war echt österreichisch. Prinz Eugen meinte zwar, daß 20.000 Mann Soldaten mehr wert seien als alle Zusagen; die spätere Folge schien ihm recht geben zu wollen. Die neue Erbfolgeordnung mußte von den Ständen jedes einzelnen Landes eigens anerkannt werden, was umständlich, aber nicht schwierig war; auch Ungarn hatte sich für die weibliche Nachfolge erklärt. Nicht so einfach war der Handel mit den auswärtigen Mächten, die sich ihre Zusage zum Teil erkaufen ließen. So forderte Frankreich das Herzogtum Lothringen endgültig für sich, wogegen Karl VI. den jungen Herzog Franz Stephan von Lothringen, der in Wien erzogen wurde, später mit Toskana entschädigte. Er war der Enkel des Heerführers im Türkenkrieg, Karl von Lothringen, und zum Gemahl der Maria Theresia bestimmt. Dadurch wurde der Plan einer Vermählung Maria Theresias mit dem spanischen Infanten Don Carlos zunichte, die die habsburgisch-spanische Monarchie Karl V. wiederherstellen hätte sollen. Aber die Liebe hatte ausnahmsweise einmal über die Politik gesiegt und Spanien ging dauernd verloren. Immerhin hatte Franz Stephan den Verlust seines lothringischen Stammlandes nicht nur mit Toskana, sondern mit der Anwartschaft auf die deutsche Kaiserkrone eingetauscht.
*
Die triumphierende österreichische Monarchie hat als Weltidee und staatspolitisches Ideal auch Ausdruck gefunden in der barocken Festoper von Nikolo Minato, die schon bei der Geburt Josephs aufgeführt wurde unter dem Titel: » La monarchia latina trionfante.« Diese Monarchia latina ist das Heilige Römische Reich, das im Sinne der alten Kaiserkrone von der übervölkischen österreichischen Weltmonarchie verkörpert wird. Das römisch-deutsche Reich existierte eigentlich nur mehr dem Namen nach; es war in einen losen Bund auseinanderstrebender Staaten aufgelöst und bildete nur zum Teil, namentlich durch die Kaiserwürde, einen schattenhaften Bestandteil der triumphierenden österreichischen Weltmonarchie. Es war somit seit der Reformation und seit dem Bruch mit der sittlich-religiösen Idee des Reiches ein Umschwung eingetreten, der es gerechtfertigt erscheinen läßt, von einer triumphierenden lateinischen, das heißt österreichischen Monarchie zu reden, womit einfach ausgedrückt war, daß an Stelle des säkularisierten römisch-deutschen Reichsbegriffes die römisch-österreichische Reichsidee getreten ist, was ja auch praktisch durch die Machtstellung der Völkermonarchie in Europa betont war. Es ist nur merkwürdig, daß die bisherige, allerdings einseitig preußisch orientierte Geschichtsauffassung diese bedeutsame und in die Augen springende Tatsache beharrlich übersehen wollte.
Diese Machtstellung kam auch kulturell in dem Kunstbilde Wiens als Weltzentrum und in seiner Ausstrahlungssphäre zum Ausdruck. Wie sich aus den Kreuzzügen das gotische Wien erhob, so jetzt aus den siegreichen Türkenkriegen das barocke Wien, das heute noch dieses entscheidende Gepräge zur Schau trägt. Aus dem Schutt der Vorstädte erhob sich der Glanz barocker Fürstenpaläste mit ihren herrlichen italienischen Gartenkulturen, davon allerdings nur ein verblaßtes Bild geblieben ist. Der Schöpfungen Prinz Eugens ist schon gedacht. Das Belvedere mit dem angrenzenden Schwarzenbergpalais läßt heute noch ahnen, wie es um Wien weithin aussah. Dazu gehört die Karlskirche, die Karl VI. anläßlich der 1713 auftauchenden Pestgefahr erbauen ließ. Die beiden reliefbedeckten Säulen, nach dem Vorbild der Trajanssäule, sind sein Sinnbild, der bis zu den Grenzen der Welt vorgedrungen war, zu den Säulen des Herkules auf Gibraltar, um mit Hilfe der Engländer, die Gibraltar nicht mehr herausgaben, Spanien wieder zu erwerben, dem er dieses Denkmal des Schmerzes gesetzt hatte mit der stolzen Inschrift » Plus ultra!« – Noch weiter! Im Gegensatz zur Zuschrift an den Grenzsäulen der äußersten Grenze Europas: » Non plus ultra!«
Vollkommener ist noch im Stadtinnern das barocke Kunstbild erhalten. Der Leopoldinische Anbau der Hofburg, die Hofbibliothek, die vielen Adelspaläste mit ihren prunkvollen Toren, die saalartigen Plätze, die korridorähnlichen alten Gassen sind auch unser Entzücken. Dazu gehört das Sommerschloß Schönbrunn, dessen Baugeschichte auf Maximilian zurückgeht und das Leopold I. in der Hauptsache von Fischer von Erlach schaffen ließ; vollendet hat es Maria Theresia in dem ihr eigentümlichen Stil des österreichischen Rokoko. Es ist vergleichbar mit Versailles und war Lieblingsaufenthalt der großen Kaiserin, wie auch später Franz Joseph I. Von den Jagdschlössern der Umgebung blieb nur die Favorita von Leopold I., nach den Plänen von Burnacini erbaut; hier starb Karl VI. Maria Theresia bestimmte es für eine Ritterakademie, daher die Bezeichnung Theresianum.
Die Baumeister dieses schönheitstrunkenen Wiens waren die Hofarchitekten Burnacini, der ältere und jüngere Fischer von Erlach, Hildebrandt, dann die Familie Galli-Bibiena, Vater und Söhne, berühmte Theaterdekorateure. Ferner ist Carlone zu nennen, durch den Karl VI. Klosterneuburg als Familienstift des Kaiserhauses ausbauen ließ. Aus dieser Zeit stammen auch die Kaiserzimmer in Göttweig und in Melk, wo der St. Pöltner Meister Prandtauer seinen anmutigen ländlich-barocken Stil entwickelte. Die Repräsentanzräume der großen Stifte Österreichs, die sie für den Kaiserbesuch einrichteten, zeugen für das Prunkbedürfnis Karl VI. Hand in Hand mit der Architektur geht die grandiose Entwicklung der Freskenkunst. Die berühmten Meister sind Paul Troger, Peter und Paul Strudel, Daniel Gran, die beiden Altomonte, der Salzburger Rottmayr. Der Kremser Schmidt entzückt durch seine lieblichen Madonnenbilder. Der Bildhauer der Zeit ist Raphael Donner, dessen michelangelesker Brunnen am Neuen Markt ein Prunkstück Wiens ist.

Kaiser Leopold I.
(Stich von Fr. Bouttats. Porträtsammlung d. Nationalbibliothek, Wien.)
Die Barockoper erfreute sich der besonderen Pflege der drei Kaiser Leopold I., Joseph I. und Karl VI., die sich zugleich musikalisch und dichterisch betätigten. Die höchste Prunkentfaltung aber erfuhren diese Darstellungen als kaiserliche Repräsentation durch Karl VI. Einzelne Aufführungen beliefen sich oft auf 60.000 Gulden; die kaiserliche Kapelle und Kammermusik erforderte jährlich 200.000 Gulden. Der Hofpoet war nach Apostolo Zeno der fruchtbare Metastasio, der indessen schon nach der strengeren Form der griechischen Tragödie hinstrebte als Wegbereiter Glucks. Klassische Barockmusik verkörperte Händel; Johann Joseph Fux als Hofkapellmeister pflegte mit Vorzug auch italienische Musik, aus der das Rokokogenie Mozart hervorging.
Neben der hohen Kunst erfreute sich auch die Hanswurstkomödie großer Beliebtheit nicht nur beim Volk, sondern auch in der Gesellschaft, wie denn überhaupt der Hanswurst bei den ernstesten Haupt- und Staatsaktionen nicht fehlen durfte. Die Freude am Lachen und das erdenfrohe Behagen sind ebenso sehr Ausdruck des Barocks wie der Zug zum Heroenhaften und zur göttlichen Verklärung. Am Hohen Markt hatte der berühmte Hanswurst Stranitzky seine Schaubude aufgeschlagen; er war tiefernster Künstler und zugleich Zahnarzt und lockte durch seine zwerchfellerschütternde Kunst die Vornehmen wie die Niedrigen massenhaft in seine Komödienhütte. Sein Nachfolger Prehauser, den er vorstellte, gewann sich vom ersten Augenblick an die Gunst des Publikums dadurch, daß er das Publikum auf den Knien bat, doch nur zu lachen! In seinen Stegreifkomödien, die der italienischen Commedia dell'Arte entsprachen, wurde Hanswurst, der bisher immer nur Episodenfigur war, die eigentliche Hauptperson und der Held des Stückes, wodurch allerdings die Komödie auf ein sehr tiefes Niveau sank und ihren Witz in unflätigen Zoten und in der Verspottung des idealen Helden suchte. Eine ähnliche Figur schuf Joseph Felix von Kurz in seinem Bernardon; andere berühmte Darsteller brachten weitere Abarten der lustigen Person auf die Bühne, die noch in Raimund und besonders in Nestroy zu spüren sind. Eines aber ist unverkennbar: der Zug zur Entartung. Die Blüte des Barocks neigt bereits zum Verfall.
Der Lebensabend Karl VI. war getrübt durch einen schlecht geführten Türkenkrieg, der im Belgrader Frieden 1737 das am Balkan Errungene wieder preisgeben mußte. Aus Kränkung darüber ist er verhältnismäßig früh gestorben, 1740, zum Entsetzen seiner Völker, die fühlten, daß Schlimmes bevorsteht.
Feinde ringsum, das war die Losung beim Tode Karl VI. Das typische Schicksal Österreichs, der jähe Wechsel von Glück und Unglück, von Machthöhe und drohendem Untergang, von Glanz und plötzlichem Verlöschen, dies freilich nur, um sich ebenso rasch zu neuem Glanz wieder zu erheben. Vorläufig schien freilich wieder einmal alles zu Ende. Die Pragmatische Sanktion ein Fetzen Papier. Eine junge Frau auf dem Thron, inmitten ihrer leichenblassen Minister – hätte sie die Kraft nicht in sich gefunden, diese Männer hätten sie ihr kaum geben können. Sie war der einzige Mann im Staat.
Die Lage war allerdings verzweifelt. Der Staatsschatz zusammengeschmolzen; die Armee zerrüttet nach dem letzten unglücklichen Türkenkrieg; nur mehr etwa drei Generale aus der Schule Prinz Eugens; dazu in Wien das Hinüberschielen nach Bayern, wo Karl Albrecht als Gemahl einer josephinischen Prinzessin Erbansprüche auf Österreich machte und zugleich auf die deutsche Kaiserwürde. In diesem Zustand hatte Maria Theresia den Entscheidungskampf um den Bestand Österreichs zu führen.
Das Schlimmste war, daß sie es mit einem der unritterlichsten und räuberischesten Gegner zu tun hatte, mit Friedrich II. von Preußen, der es Karl VI. zu danken hatte, daß er der Hinrichtung durch den eigenen grausamen Vater entging, und der unter dem Vorwand, Maria Theresia zu schützen, Schlesien raubte, in der ausgesprochenen Absicht, Europa in Brand zu stecken, und seinen Raub dabei zu sichern. Die Sachsen waren in Böhmen eingefallen, wo sie Karl Albrecht von Bayern zum König ausriefen, der dann auch zu Frankfurt 1742 mit der deutschen Kaiserwürde bekleidet wurde. Regimenter der Bayern und der mit ihnen verbündeten Franzosen kamen bis vor Wien.
Da ereignete sich jene historisch denkwürdige Szene, da Maria Theresia mit dem kleinen Joseph am Arm hilfesuchend am Preßburger Landtag vor die ungarischen Magnaten hintrat, die in ritterlicher Begeisterung » vitam et sanguinem«, Leben und Blut zu opfern versprachen. Tatsächlich haben die in Ungarn lebenden Völkerschaften, Magyaren und Kroaten im Verein mit Tirol und den anderen habsburgischen Ländern Österreich gerettet. In dem allgemeinen Aufgebot stellten einzelne Magnaten ganze Husarenregimenter; Franz von der Trenck nahm mit seinen Panduren München am Tage der Kaiserkrönung Albrechts. Bayern wurde österreichische Provinz. Nun treten auch andere Mächte für Österreich ein; England, Hannover, Holland, Hessen, Belgien bilden mit den Österreichern die pragmatische Armee; Frankreich wird am Rhein geschlagen; der Wanderkaiser Karl VII. sitzt hilflos in Frankfurt. Friedrich und die Sachsen wurden aus Böhmen hinausgeworfen. Schließlich bringt der Friede zu Worms 1743 die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion und das Bündnis mit Sachsen.
Damit ist der erste Schlesische Krieg beendet. Trotzdem fällt Friedrich wieder in Böhmen ein, um »Elsaß für Frankreich zu retten«, wird aber von Feldmarschall Traun hinausgedrängt; die Wiedereroberung Schlesiens mißlingt infolge der Siege Friedrichs bei Hohenfriedberg und dann bei Kesselsdorf. Österreich hat aber auch nach diesem zweiten Schlesischen Krieg nicht auf Schlesien verzichtet, immerhin wird die Pragmatische Sanktion nun auch von Friedrich anerkannt und von Bayern, das nach dem Tode Albrechts an seinen Nachfolger Max Joseph zurückgegeben wird; der österreichische Erbfolgekrieg ist damit beendet; der Gemahl Maria Theresias empfängt 1748 die deutsche Kaiserwürde; der Bestand Österreichs ist gerettet.
Aber der Preußenkönig gibt keine Ruhe, er stürzt sich zunächst auf Sachsen. Ungeachtet der Abmahnung des Kaisers: »Abzulassen von friedbrüchiger Vergewaltigung.« Maria Theresia selbst hatte erklärt: »Ich und der König von Preußen sind unvereinbar und keine Rücksicht auf der Welt soll mich bewegen, in eine Vertragsgenossenschaft einzugehen, an der er Teil hat.« Sie hatte den schicksalsbedingten Gegensatz Preußen – Österreich als empfindende Frau wohl am tiefsten gefühlt. Eine europäische Kriegskoalition erhob sich gegen Preußen, der nun auch Frankreich beitrat, ebenso wie Rußland, während England, der Gegner Frankreichs, auf die Seite Preußens tritt. Der Staatskanzler Maria Theresias war der große Kaunitz, der die europäische Politik leitete und das österreichische Bündnis mit Frankreich zustandebrachte. Der Kampf der europäischen Mächte gegen den Preußenkönig wird als der Siebenjährige Krieg bezeichnet. Friedrich steht alsbald wieder in Böhmen, wird aber von Feldmarschall Daun, dem Begründer der Militärakademie in Wiener-Neustadt, bei Kolin 1757 entscheidend geschlagen. Die Stiftung des Maria-Theresien-Ordens als höchste militärische Auszeichnung knüpft sich an diesen Sieg; damit verläßt der Krieg österreichischen Boden. Daun erobert Schlesien, General Hadik nimmt mit einem Handstreich Berlin, das später noch einmal von Laudon und Lacy besetzt wird; bei Hochkirch und Kunersdorf wird Friedrich so entscheidend geschlagen, daß er alles verlorengibt und dem Selbstmord nahe ist; aber bei Torgau ist er wieder Herr der Situation; schließlich endet der Krieg an allgemeiner Erschöpfung 1763 mit dem Frieden zu Hubertusburg nach sieben Verwüstungsjahren, die nichts gebracht haben als allgemeines Elend; Schlesien blieb verloren.

Schlacht bei Rolin 1757, bedeutsam für die Rettung Österreichs und Stiftung des Maria-Theresien-Ordens.
(Bild von Karl Blaas. Kunstverlag Wolfrum, Wien.)
Abgesehen von diesem Verlust war die Zeit der Maria Theresia eine der glücklichsten für Österreich. Die Kaiserin war das Idealbild einer Frau und Landesmutter; sie war vielseitig gebildet, mit natürlichem Verstand begabt, mit Herz und Gefühl, mit lebhaftem, heiterem Temperament, eine große schöne Erscheinung, ausgezeichnet durch Seelengüte, sittliche Kraft und politischen Weitblick. Von ihrem Vater Karl VI. für ihren Beruf auf das sorgfältigste vorbereitet, war sie schon mit 16 Jahren im Staatsrat zugezogen, wo ihre Klugheit nicht selten das Richtige traf. Das Glück ihrer Ehe, der fünf Söhne und elf Töchter entsprossen, war ihr bester Halt in allen Gefahren; als ihr Gemahl 1765 zu Innsbruck einem Herzschlag erlegen war, trug sie fortan Witwentracht, die sie nie mehr ablegte. Sie war nicht nur ein Muster als Herrscherin, sondern auch als Gattin und Mutter, jedenfalls verstand sie es vorzüglich, ihre Staatspflichten mit denen gegenüber ihrer Familie und der Gesellschaft in Einklang zu bringen, so daß keines verkürzt war. Sie liebte einen glänzenden Hof um sich, und nahm mit den ihrigen gern an allen Belustigungen und Festlichkeiten teil, an Schlittenfahrten, Maskenbällen, Opernvorstellungen und Komödien, mit besonderer Vorliebe auch an Volksfesten; im Schönbrunner Schloßtheater wurden eigene Aufführungen unter Mitwirkung der Familie und der Hofgesellschaft veranstaltet. Der Knabe Mozart spielte der Kaiserin im engsten Familienkreis vor; sie hatte den böhmischen und ungarischen Adel an den Hof gezogen; daß sich eine österreichische Staatsgesinnung entwickelte, war das Werk ihres mütterlichen Regimentes. In ihrem Witwentum wurde es einsamer und stiller um sie, besonders nach ihrer Erkrankung an den schwarzen Blattern – als sie vom Krankenlager aufstand, war ihre blühende Schönheit für immer zerstört.

fm. Laudon bei Kunersdorf 1759.
(Sigmund L'Allemand.)
Unwägbar sind ihre Verdienste um die Entwicklung Österreichs; der Segen davon ist heute noch zu spüren. Schon am frühen Morgen las sie den schriftlichen Einlauf; leichte Sachen wurden mit Randbemerkung erledigt, schwierigere der »Konferenz« (Ministerrat) vorbehalten; die letzte Entscheidung traf sie selbst in der Stille. Ihre hohen Ideen waren von dem Gedanken einer göttlichen Vollmacht geleitet; sie sah in den Ministern nur ausführende Diener ihres Willens; doch war sie in ihrer Wahl von untrüglichem Instinkt geführt. Ihr ganzes Streben galt dem Volkswohl. Sie hat die Bauernbefreiung in Angriff genommen; die Rechte der Grundherren eingeschränkt; ein einheitliches Recht geschaffen und damit die Rechtspflege gehoben; eine zeitgemäße Verwaltungsreform durchgeführt, indem sie das landesherrliche Beamtentum verstärkte und durch Schaffung von Kreisämtern die Vorrechte der Stände abbaute. Hand in Hand damit ging die Hebung der Finanzen, so daß trotz der Kriege die Staatseinnahmen stiegen. Das Tabaksmonopol wurde eingeführt, auch das Lotto; Grundsteuern für Adel und Klerus, die bisher davon befreit waren. Die Heeresausbildung war Gegenstand besonderer Obsorge, namentlich unter Lacy; Fürst Liechtenstein hatte Verdienste um die Artillerie. Die Militärgrenze wurde aufgerichtet, der Hafen von Triest ausgebaut; die Wiener Börse gegründet; Straßen und Postverkehr verbessert; Industrie gehoben; Innenkolonisation betrieben, besonders in Ungarn und Siebenbürgen und vor allem die Volksbildung gepflegt. Das erste Volksschulgesetz entstand; die k. k. Studienkommission; die Orientalische Akademie als Diplomatenschule; das Theresianum als Ritterakademie und die Neustädter Militärakademie. Ihr Leibarzt van Swieten, ein Holländer, war ihr Berater in allen Studienangelegenheiten. Selbst der schlimmste Gegner, Friedrich II., mußte bekennen: »Eine von Feind und Freund verehrte Frau!«
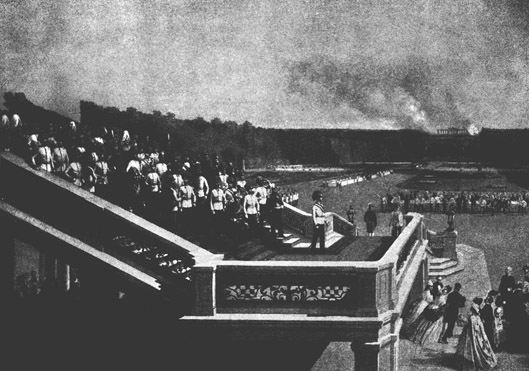
100jähriges Gründungsfest des Maria-Theresien-Ordens in Schönbrunn 1857.
(Fritz L'Allemand.)
Noch war die Türkengefahr in Europa nicht gebrochen, da erhob sich bereits ein neuer Gegenspieler auf der geschichtlichen Bühne, von dem Maria Theresia sagte, daß er gefährlicher sei als die Türken: Friedrich II. von Preußen. Mit ihm beginnt Brandenburg-Preußen in dem Streben zur Macht jene große geschichtliche Rolle zu spielen, die für das »Reich« und namentlich für Österreich oft genug verhängnisvoll wurde. Die preußische Geschichte verherrlicht Friedrich II. als den »Großen«; unter dem Einfluß der preußischen Geschichtsauffassung erscheint auch in unseren Lehrbüchern sein Bild in einer unwahren Verherrlichung, und manche versteigen sich zur Behauptung, es gäbe in unserer ganzen Geschichte kein heroisches Beispiel wie Friedrich II. Sein Bild verdient es jedenfalls, im Lichte der Wahrheit betrachtet zu werden.
Schon unter dem großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. begann jene Machtpolitik gegen Kaiser und Reich, die nach allgemeinem Urteil bestrebt war, recht große deutsche Lande aus dem Körper Deutschlands herauszuschneiden, den großpreußischen Staat zu bilden und sich um das Reich nicht zu kümmern. Das war nur möglich im Bund mit Frankreich. Um geraubte Gebietsteile, wie Jülich, Berg, Rabenstein und ferner Pommern behalten zu können, mußte sich der große Kurfürst verpflichten, die Rückeroberung des Elsaß durch den Kaiser zu verhindern, dem König von Frankreich, Ludwig XIV., die römische Kaiserkrone zu verschaffen, ihm bei der Eroberung der spanischen Niederlande gegen den Kaiser Truppen zu stellen; im Türkenkrieg Norddeutschland zu verhindern, daß es bei der Belagerung Wiens zu Hilfe käme; indirekt die französischen Raubkriege, die Wegnahme von Straßburg zu unterstützen, die sogenannten »Reunionen«, durch die der achte Teil Deutschlands an Frankreich kam; für diesen Reichsverrat empfing der große Kurfürst einen Sold von 100.000 Livres jährlich, der im Türkenkrieg auf 500.000 Livres emporgeschraubt wurde. Die »Kurbrandischen Staatsverträge von 1601 bis 1700« sind eine Beweiskette der »Treulosigkeit und Wortbrüchigkeit«, somit der »absoluten Unverläßlichkeit des politischen Charakters«; selbst Droysen, der preußische Hofhistoriograph, muß zugeben »nur mit Mißachtung und Entrüstung nannte man Brandenburg, das den teuer erkauften (Westfälischen) Frieden gestört hatte ...«. Seit dem Sieg von Fehrbellin entwickelt sich der preußische Militärstaat; der Kurfürst war einer der ersten, der ein stehendes Heer bildete; die Werbungen geschahen gewaltsam, durch Menschenraub, besonders unter Friedrich Wilhelm I. in seiner ungezügelten krankhaften Sucht nach »langen Kerls«; auf der Straße schlug er mit dem Stock drein, ein Mann von rohestem Geschmack; während am Wiener Hofe die Barockoper gepflegt wurde, hielt er »Tabakkollegien«, in denen die Verhöhnung und Mißhandlung des Akademiepräsidenten als Hofnarren beliebte Unterhaltung war, die sich auch auf dessen Begräbnis erstreckte; des Spasses halber ließ ihn der König in einem Faße begraben.
Dieser quälende Tyrann war der Vater Friedrich II., des Begründers der preußischen Großmacht. In keinem Lande war der Absolutismus so entwickelt und infolge davon der Servilismus der Bevölkerung so stark wie in Preußen. Als der englische Gesandte von Preußen nach Polen versetzt wurde, meinte er, er sei »aus Kerkerluft in die Freiheit« gelangt. Lessing nannte es »das sklavischste Land Europas«; der berühmte Kunstforscher Winckelmann bezeichnet es als »vermaledeites Land«, wo der »größte Despotismus« herrsche, es sei »besser, Türke zu sein als Preuße«. Nur mit List und Trug konnte Friedrich II. den Mißhandlungen seines Vaters entgehen, der wieder gegen den Sohn immer den Vorwurf der »Falschheit und Verstellung« erhebt. Der Kronprinz fühlt sich unglücklich bis zum Selbstmord und macht einen Fluchtversuch, angeblich, um die Hand der Erzherzogin Maria Theresia zu erwerben. Eine müßige Kombination, was geworden wäre, wenn der undenkbare Plan Verwirklichung gefunden hätte. Sein Vater läßt ihn als Deserteur vor ein Kriegsgericht stellen und verurteilt ihn selbst zum Tode, indessen wird nur sein Freund und Helfer, Hauptmann Katte, hingerichtet; für den Kronprinzen setzt sich Karl VI. ein; er versorgt ihn auch mit Geld; er ahnt nicht, daß er bei diesem Charakter keinen Dank zu erwarten hat. Auf dem Schlößchen Rheinsberg, das ihm schließlich der Vater als eigene kleine Residenz zuweist, umgibt er sich mit einem Kreis von Philosophen der französischen Aufklärung und des Materialismus, dieser religionsfeindlichen Richtung, die gegen die heuchlerische Frömmigkeit am Hofe Ludwig XIV. entstanden war. Die Freundschaft Friedrichs mit Voltaire ist begründet auf der gemeinsamen Todfeindschaft gegen die Kirche und somit auf dem Atheismus; das bezeichnende Haßwort Voltaires gegen die katholische Kirche lautete: » écrasez l'infame!«
Friedrich bekennt selbst, daß die »Begierde nach Ruhm, das Vergnügen, den Namen in den Zeitungen und in der Geschichte zu lesen«, ihn zu seinen Handlungen verführt habe. Was die Moral dieser Handlungen sei, ergibt sich aus seiner Handlungsweise und seinen Aussprüchen, die sich damit durchaus decken: »Wenn man durch Ehrlichkeit gewinnen kann, dann seien wir ehrlich; muß man betrügen, dann wollen wir Betrüger sein!« Gewalt und Rechtsverachtung sind das Wesen seiner Politik. Schon vor Karl VI. Tod hat er Absichten auf Schlesien, ungeachtet daß alle vermeintlichen Ansprüche aus dem Dreißigjährigen Krieg und Unklarheiten über gewisse schlesische Fürstentümer durch die Verleihung der Königswürde an Preußen 1700 erledigt und als »ab und begraben« erklärt wurden. Im Urteil der Welt steht der Einfall Friedrichs in Schlesien als eine »treulose Wegelagerei« da. Dasselbe gilt von dem zweiten Schlesischen, richtiger gesagt Böhmischen Raubkrieg Friedrichs, der in das entblößte Böhmen einrückt, während die österreichischen Truppen im Westen beschäftigt sind; er erklärt diesen Friedensbruch damit, daß er Elsaß für Frankreich vor der Rückeroberung durch Maria Theresia retten will. Der Einfall in Sachsen, sein dritter Friedensbruch, hat ihn nun freilich in den Siebenjährigen Krieg verwickelt; schließlich muß er um den Frieden bitten, den er in Wien zu diktieren gedachte; er tut es nicht ohne Zynismus: »Ohne Kolin hätte ich Gelegenheit gehabt, meine Aufwartung zu machen ...« Man möchte fast an Haßliebe oder Liebeshaß als geheimste Triebfeder Friedrichs gegen Maria Theresia denken. Die Schlacht bei Kolin war in der Tat die Rettung Österreichs und wurde von Maria Theresia als der »Geburtstag der Monarchie« mit der Stiftung des Maria-Theresien-Ordens gefeiert; von da ab war Friedrich in die Defensive geworfen.

Franz Stephans und Maria Theresias Familienkreis.
(Gemälde von F. v. Fahrenschon.)
Man kann immerhin seine Standhaftigkeit im Unglück bewundern; seine Kriegführung mit dem »Stoß ins Herz«, die er Prinz Eugen abgeguckt hatte; sein Flötenspiel in Sanssouci von Maler Menzel verherrlicht; seine Vergrößerung Preußens von zweieinhalb Millionen auf fünf Millionen Untertanen; man kann gewisse persönliche Züge an ihm sympathisch finden; Größe aber kann man nur einem sittlichen Helden beimessen. Gerade das war er nicht. Seine Grundsätze lassen ihn als das Gegenteil erscheinen. Er war sittenlos und pervers; in der Geschichte wird ihm Lasterhaftigkeit nachgesagt und Kardinal Fleury spricht ihm ein Verdammungsurteil: »Ein schlechter Mensch und Schurke!« Er hat wiederholt ein Bündnis mit dem türkischen Erzfeind angestrebt und hat in Belgien und Ungarn zur Empörung gegen Joseph II. geschürt. Die übliche Fürbitte für Kaiser und Reich beim Gottesdienst hat er ab 1750 verboten. Er schrieb ein schlechtes Französisch und war ein Verächter des Reiches und der deutschen Sprache; dagegen war er bestrebt, eine »preußische Nation« zu schaffen, mit dem Ergebnis, daß der vom Deutschen Orden germanisierte slawische Volksstamm dem unter Preußens Vorherrschaft geratenen Deutschland den Namen gab. Durch Friedrich II. wurde der Begriff des Preußentums, ganz unabhängig von dem an sich tüchtigen und braven Volkstum, zum Inbegriff einer Gewaltpolitik, die die Macht über das Recht setzt, während Österreich zu allen Zeiten den christlichen Grundsatz vertrat, der auch der Reichsidee zugrundeliegt, daß das hohe Recht vor allem die Quelle der Macht sei. Gewalt und Rechtsverachtung bilden den geschichtlichen Antagonismus Preußens gegen Österreich.
Joseph, seit dem Tod seines Vaters Franz Stephan 1765 römischer Kaiser und Mitregent in Österreich, wo er erst mit dem Tode Maria Theresias 1780 zur Alleinherrschaft kommt, war ein stiller Bewunderer des Preußenkönigs Friedrich II., dem er es in mancher Hinsicht gleichzutun versuchte. Zugleich war er ein Anhänger Voltaires und der französischen Aufklärung. Die Kaiserin, um seine Erziehung besorgt, gab ihm nicht weniger als sieben Geschichtslehrer, je einen für jede Großmacht; die Folge war, daß er gerade in der Geschichte sehr schlecht unterrichtet war und die aus den Geschichtsfälschungen entsprungenen Vorurteile des XVIII. Jahrhunderts, besonders den Jesuiten gegenüber, vollkommen teilte. Wegen seiner Abneigung gegen die französische Sprache ließ ihn die Mutter mit Franzosen umgeben, die ihn mit schädlicher Lektüre, vor allem mit den Sensationsschriften Voltaires, versorgten. Dadurch kam er in die Richtung jenes aufgeklärten Despotismus, für den es kein Recht, kein Gesetz, keine Schranke gab und der – Revolution von oben machte. Der Hauptschlag richtete sich gegen den Jesuitenorden, der gewissermaßen das Vorrecht hat, von jeder Revolution als erstes Opfer ausersehen zu werden. Als Papst Klemens XIV. unter dem Druck Frankreichs, Portugals und Spaniens die Aufhebung des Ordens aussprach, war der Damm zerbrochen, der die Kirche vor dem Zugriff schützte.

Comödie-Hütten (Hanswurstspiele) auf der Freyung.
(Museum der Stadt Wien. Bild von Ferd. Probst.)
Joseph II. war wohl eine gläubige Natur; aber er huldigte einer bloßen Vernunftreligion, dem Febronianismus (so genannt nach Febronius, Weihbischof von Trier), der den Staat über die Kirche stellte. Mit dieser Hinneigung zum Staatskirchentum hat Joseph radikal mit der großen barocken Kulturüberlieferung Österreichs gebrochen. Seine Kirchenverstaatlichungsgesetze verbieten den heimischen Bischöfen und den Orden den direkten Verkehr mit Rom. Hand in Hand damit geht die Aufhebung von Klöstern, von frommen Bruderschaften und Prozessionen. Papst Pius VI. kommt eigens nach Wien im Jahre 1782 im feierlichen Aufzug und sucht ihn tränenden Auges umzustimmen, vergebens. Beim Gegenbesuch in Rom droht Joseph sogar mit der Loslösung der österreichischen Kirche. Ein bolschewikischer Bildersturm war mit der Klosteraufhebung über Österreich hereingebrochen. Trödlerbuden wurden aus barocken Kirchen und Äbtebildnissen gebaut; mit kostbaren Manuskript- und Bibliothekschätzen die Löcher der Straßen verstopft, auf denen die Wagen mit dem Klosterraub dahinfuhren; es ist bezeichnend, daß bei der Plünderung die Leiche des Grafen Salm, des ersten Verteidigers Wiens gegen die Türken, aus dem erbrochenen Grabmal verschwunden ist; das sind Streiflichter, die erkennen lassen, wie der Vernichtungsgeist zu Werke ging; es war keine Reform, sondern ein Kulturbruch.
Joseph war ein idealistischer Doktrinär, der mit seinen Toleranzedikten die Welt beglücken wollte und sich dabei rücksichtslos über historische Rechte, über Volksüberlieferung und über die nationalen und landschaftlichen Unterschiede hinwegsetzte. Die Aufhebung der Leibeigenschaft, die Gleichberechtigung der Juden, die Religionsfreiheit der Protestanten (die massenhafte Übertritte bewirkte), griffen der Entwicklung vor und erwiesen sich zunächst als mehr schädlich denn nützlich. Von den 276 Verordnungen im Anfang seiner Alleinregierung waren die meisten überhaupt unausführbar. Er wollte alles zugleich in überstürzter Hast, ohne die organische Entwicklung abzuwarten, weshalb Friedrich II., sein schier unbewußtes Vorbild, über ihn spottete: »Er tut immer den zweiten Schritt, ehe er den ersten getan ...« Entschieden war etwas »Preußisches« an seinem Verfahren, das hierzulande kein Segen ist. Auch darin handelte er gegen das Lebensgesetz Österreichs, daß er einen straff zentralistischen Einheitsstaat bilden wollte, Deutsch als Staatssprache auch in Ungarn statt des Latein einführte und die alte Ständeverfassung umwarf; auch dadurch entfremdete er sich zu seinem Schaden die Ungarn, daß er die Krönung verweigerte und sie in ihren heiligen Rechten verletzte. Auch Belgien ist gegen ihn aufgebracht, aus ähnlichen Gründen. Er möchte Bayern an sich bringen im Austausch gegen Belgien; doch Friedrich II. verhindert es mit dem deutschen Fürstenbund. Dazu kommt zum Schluß die unglückliche Orientpolitik des Kaisers, in die ihn Katharina von Rußland verwickelt. Er muß in den Krieg gegen die Türken; die Schlacht bei Mehadia 1788 ist eine Niederlage, der kranke Kaiser gerät in Lebensgefahr. Stände, Adel und Kirche, tief verletzt, gewähren ihm keine Hilfe. In Belgien bricht der Aufstand aus; 1790 wird von den belgischen Ständen die Republik ausgerufen. Belgien ist verloren, in Ungarn gärt es bedrohlich. Preußen ist mit beiden in Verbindung; auch mit den Türken. Joseph II. bricht todkrank zusammen, er sieht den Zerfall. »Ich habe keine Hoffnung mehr«, schreibt er anfangs 1790 an Kaunitz. Auf dem Totenbett nimmt er seine Verfügungen in Ungarn zurück und stellt den alten Zustand wieder her. Auch mit der Türkei will er um jeden Preis Frieden schließen. Doch schon am 20. Februar 1790 tritt der Tod ein. Der Kaiser ist noch nicht 49 Jahre alt; er war gestorben in der bittersten Enttäuschung, daß so viel Gutgemeintes fehlgegangen war. Sein Bruder Leopold von Toskana, der als Kaiser Leopold II. allerdings nur zwei Jahre regierte (1790-1792), lenkte alles in die Bahnen Maria Theresias zurück, sogar Belgien wurde zurückgewonnen und die Ordnung in Österreich wieder hergestellt, die bis zum Jahre 1848 dauerte.

Am Totenbette Josefs II. 1790.
(Gemälde von Georg Conräder.)
Für den Bestand Österreichs schien der Tod Josephs die Rettung aus der gefährlichsten Lage – dessenungeachtet lebt er als der Volkskaiser in der Überlieferung fort. Man sieht ihn mit der Hand am Pflug als Bauernbefreier. Unerkannt geht er im Volk umher und wirkt Gutes im stillen. Die Volksdramatik verherrlicht ihn als Wohltäter in »Kaiser Joseph und die Schusterstochter«. Es bleibt ihm unvergessen, daß er den Augarten, Laxenburg und den Prater als seine Lieblingsaufenthalte dem Volk zugänglich macht: »Der Menschheit gewidmet von ihrem Schätzer.« Sein Name lebt sprichwörtlich fort in Verbindung mit seinen Wohltätigkeitsgründungen oder Schöpfungen. Zu diesen gehört die Irrenanstalt, im Hinblick auf den einstigen kreisrunden Bau »Kaiser Josephs Gugelhupf« genannt; das Wiener Allgemeine Krankenhaus; das Militär-Arznei-Institut Josephinum; die Taubstummenanstalt; Waisenhäuser; Volksschulen in jeder Pfarre; nicht zuletzt die deutsche Nationalbühne, zu welcher das »Theater nächst der Burg« 1776 erhoben wurde, das Burgtheater. Wie die Religion sollte auch die Kunst, vor allem das Drama, im Dienste des Staates stehen, als besten ersten Diener sich der Kaiser selbst bezeichnet.

Das alte Hofburgtheater in Wien.
(Originalaquarell von Gustav Klimt. Historisches Museum der Stadt Wien.)
Die barocke Staatsdramatik hatte gewiß auch Staatsideale zum Inhalt, aber sie waren geschöpft aus höheren Ordnungen und gaben der Dichtung die Weite ewiger Symbole; wie nüchtern und flügellahm erscheint dagegen der Pegasus im Staatsjoch! Joseph II. liebte auch die Musik, aber in seiner rationalistischen Weise: »Zu viel Noten, zu viel Noten, lieber Mozart!« In Paris siegte der Klassizismus des Österreichers Christoph von Gluck; dort sollte Maria Antoinette als Gemahlin Ludwigs XVI. die Weltinteressen Österreichs pflegen; das war jedenfalls die Meinung der Kaiserin-Mutter Maria Theresia, die nichts so sehr fürchtete als den Preußenkönig; Frankreich war sein Gegengewicht. Von dorther kamen bald Sturmzeichen ...
Joseph meinte wohl, die Revolution, die dort ausbrach, unschädlich zu machen durch die Ideen der Revolution, wie er zugleich auch so preußisch tat wie der Preußenkönig. Das brachte ihn zum österreichischen Wesen in Widerspruch. Sein Ratgeber Sonnenfels, »der Mann ohne Vorurteil«, verjagte den Hanswurst, den Lessing als das »Genie des Wiener Dramas« bezeichnete; Philipp Hafner, der österreichische Molière, führte ihn in der »gereinigten« Komödie wieder ein. Der preußische Einfluß machte sich schon unter Maria Theresia geltend, als sie im Schönbrunner Schloß 1749 den pedantischen »Reiniger« Gottsched empfing; alles wollte »gottschedisch« reden, am Theresianum und am späteren Burgtheater. Ein tiefer Riß trennte die künstlerische Barockzeit von der neuen flachen Aufgeklärtheit; ein innerer Bruch, der durch die Volksseele ging. Es war die Josephinische Krankheit, die zum Liberalismus, zur Selbstentfremdung Österreichs führte. Erst in der Romantik fand es zu sich zurück; ein Heiliger mußte vorangehen: Klemens Maria Hofbauer.