
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
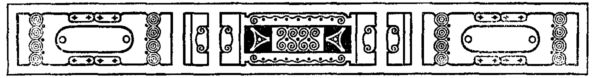
Schillersdorf, den 2. September 1886.
Ich will nur sehen, ob ich einmal diese poetischen Pläne und Schwärmereien lassen und mich ganz auf die Theologie sammeln kann! Wie glücklich sind in sich selbst einige, von keinen tiefen Leidenschaften gequälte Menschen! Aber ich werfe mich bald mit Eifer auf die Poesie und vergesse das ruhige, praktische, nüchterne Leben der Theologie – oder umgekehrt.
Ich muß etwas haben, das mich ganz an das wirkliche, praktische Leben fesselt. Vielleicht der Gedanke an M. [Waldfrau] kann mir hierbei helfen? Da mag nur Papa lange sagen, ich arbeite nicht! Ach nein, nicht Faulheit oder leichtfertige Auffassung ist es, wenn ich nicht immer hinter theologischen Werken sitze, sondern Entfremdung, weil Poesie und Literatur mein ganzes Interesse wieder vorübergehend in Anspruch nehmen.
Wie wohltuend ist der Einfluß, den das liebe Haus im Hochland mit seinen guten alten Bewohnern auf mich ausübt! Und M. darin! Sie kennen an geistigen Interessen fast nur das Religiöse; hierin finden sie Frieden und Ruhe. Hätte ich auch die Einseitigkeit! Hätte ich auch solchen Frieden! Ich will mir alle Mühe antun, mich ganz auf die Theologie zu konzentrieren, immer nur an das praktische Amt zu denken, zu dem ich berufen bin, zu dem mich der Wunsch meiner sterbenden Mutter bestimmt hat, und Gott wird gewiß helfen.
Arbeiten kann ich noch nicht. Meine Gedanken sind immer noch auf den lothringischen Hügeln, immer noch bei M. Von den schönen Tagen und jener ereignisreichen Zeit blieb mir nur wehmütige Erinnerung und leise Sehnsucht, ein leeres, unruhiges, sehnendes Gefühl zurück. Meine Gedanken sind immer bei M ....
3. September.
Heute mittag war ich bei Pfarrer L. Der Mann ist glücklich, lebt nur in seinem Berufe, in seiner bestimmten Gedankenwelt, hat seine Tätigkeit, sein Ziel fest vor Augen.
Ich aber bin so unnüchtern, so schwärmerisch, so unklar, so reiner Gefühlsmensch, Phantast, Poet! Oh, könnte ich so ruhig dahinleben und arbeiten! Freude und Friede und Beruhigung in meiner Berufsarbeit finden!
Diese Leute beurteilen einen so verständnislos. Wie unglücklich mich diese zwei inneren Neigungen machen, ahnt keiner!
Die Tage im Hochland waren so schön, so poesievoll! Aber ich denke nicht gern daran, weil ich mich sonst wieder zu sehr in diese poetischen Träumereien versenke. Selbst M.s Liebe macht mich unglücklich. Hätte ich mein festes Ziel vor Augen, das Pfarramt, würde ich ruhig und sicher auf dieses Ziel lossteuern: ja, dann wäre ich glücklich und wollte M. glücklich machen. Aber so! Herr, hilf! Ich bin in einer so mißmutigen, unruhigen, innerlich unzufriedenen Stimmung, daß ich weder arbeiten noch lesen kann. Nichts freut mich.
Es ist nicht die äußere Beschäftigung mit der Poesie, das Bewundern von Schönheiten des Reimes, der Gedanken oder der Eleganz des Ausdrucks – das ließe sich so nebenbei treiben auch im Pfarramt. Aber die innere, phantastische, poetische, großartige Auffassung der Dinge, wie sie mir in solchen Zeiten eigen ist! Es ist eine bestimmte Beschaffenheit des Gefühls und des Geistes, ein bestimmter Zustand, der ein ruhiges Arbeiten in der Theologie und im nüchternen Amte nicht zuläßt.
Wenn ich an M. denke, so werde ich ruhiger, nüchterner, für feste Arbeit begeisterter: denn dieser Gedanke bindet mich an die Wirklichkeit.
M. hat gleich nach ihrer Ankunft in Frankreich einen Brief an meine Eltern geschrieben. Ich kann mir wohl denken, wie ihr zumute ist. Die zwei Bilder, die sie mitgeschickt, ließen sich sinnig deuten: die »letzte Rose« und »in Liebe ewig dein«. Der Brief hatte weiter keinen Zweck, aber er beweist, wo ihre Gedanken sind.
4. September.
Morgen will ich zum heiligen Abendmahl gehen. Ich werde allmählich wieder ruhiger und lebe mich wieder mehr in die Theologie ein. Ich habe nach all diesen aufregenden Vorgängen und Herzenszuständen ein dringendes Verlangen nach dem heiligen Mahle, ich werde dadurch gewiß mehr Frieden und Ruhe finden. So schön ist das geistliche Amt, so herrlich die Beschäftigung mit geistlichen Dingen! Könnt' ich nur immer dabei bleiben!
Ich hoffe, daß es doch noch gelingt. Wenn ich nun mit meinem Heinrich immer zusammenlebe; wenn ich an den Wunsch meiner sterbenden Mutter denke, an den sehnlichen Wunsch meines Vaters, an meine Verwandten, besonders an eine, und ihre Hoffnungen und Erwartungen von mir, an meine lieben, guten, frommen Großeltern – – und vor allem, wenn ich recht bete: dann hilft der Herr gewiß!
6. September.
Zum Dichter bin ich nicht bestimmt. Je länger je besser seh' ich's ein. Ich habe zwar Gefühl, Phantasie, Verständnis und Sinn für alles Poetische in Natur und im Menschenleben; aber schöpferische Ideen, poetische Gedanken, Beherrschung der poetischen Sprache – nein!
Ich muß suchen, Phantasie und Gefühl zu bändigen, mich nüchtern und verständig zu halten – und vor allem ernst, ruhig und ausdauernd arbeiten zu lernen. Hervorragen werde ich zwar in dieser Hinsicht nicht, aber nötig ist's, wenn ich überhaupt etwas leisten will. So kann ich doch auf theologischem und religiösem und pädagogischem Gebiete vielleicht noch ein Kleines wirken.
Daher fort mit der Poesie! Herr Gott, hilf doch!
Ich habe zwei Predigten von Luther: Beichtrede und Abendmahlspredigt gelesen und werde mir zur Aufgabe machen, wöchentlich eine Predigt von Luther oder Harms zu lesen.
Heute habe ich Galaterbrief [griech. Urtext] angefangen. Wie oft aber schweifen meine Gedanken fort!
Nun sehe ich ein, wie recht meine Lehrer hatten, wenn sie mich warnten, meine Phantasie zu sehr auszubilden. Kann ich doch in der Poesie nichts leisten, und für die Theologie war die meiste Zeit, die ich auf Poesie und Literatur verwandte, ach, und so viele Zeit! verloren.
7. September.
Habe heute den zweiten Vortrag in Luthardts Apologetischen Vorträgen gelesen: die Sünde. Manches ist mir noch unklar und muß noch besser durchdacht werden, z. B. was er wider die philosophische Auffassung sagt, welche die Sünde aus der Endlichkeit (Jacobi) des Menschen herleitet oder aus der notwendigen Gegensätzlichkeit des irdischen Daseins (Hegel). Wir würden die Begriffe Tugend und Güte nicht kennen, wenn wir nicht auch die Sünde hätten. Tugend – Sünde; Freude – Leid; Tag – Nacht; Frost – Hitze; Schlafen – Wachen; Weinen – Lachen; dumm – klug: alles Gegensätze, die sich wechselseitig bedingen. Existiert eins nicht, so kann ich mir auch das andere nicht denken; existieren könnte wohl das eine ohne das andere, aber der Mensch, der sich nur in dem einen befindet und vom andern keine Ahnung hat, fühlt auch nicht seinen eigenen Zustand. Dann hat er auch keinen Namen für diesen einseitigen Zustand, er lebt unbewußt, naiv, dahin.
So allein könnten wir uns eigentlich einen ganz glücklichen Menschen denken – das heißt: wir, die wir auch das Unglück kennen; er selbst aber weiß es nicht, ist sich seines Glückes nicht bewußt. Erst nach dem Sündenfall, wenn der Mensch Sünde, Leid, Ungehorsam und all die Gegensätze zu seinem früheren Zustand erfahren hat, erst da gehen ihm die Augen auf.
Einst im Paradiese war alles wechsellos, ewig gleichmäßig, lauter Einheit in Natur und Menschheit. Folglich hätten aber auch keine Menschen geboren werden können als Gegensatz zum Sterben? Wie konnten die Menschen miteinander verkehren und sich entwickeln, wenn es keine Gegensätze gab? Und was sollte darin das Weib?
Der Mensch ist heute so angelegt, daß er des Wechsels und des Gegensatzes bedarf. Es muß also nach der Vertreibung aus Eden in jeder Beziehung eine Veränderung mit dem Menschen vorgegangen sein – wie ja auch die ihn umgebende Natur anders war. Wo kam nun die heutige Natur mit ihren Gegensätzen auf einmal her? ...
Herr, laß meinen Glauben über diesen Fragen nicht irre werden!
8. September.
Nun kommt der Herbst mit starken Schritten ins Land. Gestern abend war ein Gewitter. Seitdem regnet es, der ganze Himmel ist umzogen, heute morgen wieder Blitz und Donner.
Ich habe gestern nacht während des Gewitters an die schöne und natürliche Christensitte gedacht, daß man bei schwerem Gewitter betet. Es treibt hiezu nicht allein die nahe Gefahr, mit einem Schlage ganz plötzlich vor Gottes Richterstuhl gerufen zu werden, sondern auch die Anschauung, daß Gott selbst im Gewitter gegenwärtig ist (vgl. die Psalmen, Klopstocks Frühlingsode, die griechische Anschauung vom Donnerkeil-werfenden Zeus, die germanische von Donar oder Thor!).
Ein wahrer Christ sollte sich aus einem Gewitter nichts machen: soll er sich etwa fürchten vor einem »zürnenden Gott«? Er kennt keinen zürnenden Richter, sondern durch Christum einen liebenden Vater.
Ferner mußte ich an die Bekehrungen denken, die durch schreckliche Gewitter manchmal bei Menschen vorkommen (vgl. Luthers Gelübde: »Hilf, heilige Anna, ich will ein Mönch werden!«). Ist das dann rechte »Bekehrung«, wenn ich gleichsam, ob auch indirekt, von Gott dazu gezwungen werde, da ich mich doch aus Angst bekehre?
Im Grunde tut's ja jeder aus Angst oder Besorgnis; nicht aus plötzlichem freien Willensentschluß. Das ist der erste Anstoß: Gott sucht den einen durch äußere kräftige Stöße, wie Gewitter, Todesgefahr, Krankheit, den andren durch innerliche Erweckungen aus seinem Sündenschlaf, in dem er von Natur liegt, aufzurütteln und ihm Augen und Ohren für das Ewige zu öffnen.
Was Luthardt über Selbstsucht sagt, ist vielleicht etwas einseitig. Selbst in meinem Verhältnis zu Gott herrscht Selbstliebe vor: ich liebe Gott nicht um Gottes willen, sondern weil ich in dieser Liebe meine Freude, meine Befriedigung finde, weil mich diese Liebe selig macht. Christus sagt ja auch, ich solle meinen Nächsten lieben wie mich selbst: daß ich mich von Natur über alles liebe, weiß er wohl...
Selig sind die Einfältigen! Wieviel Seelenqualen hat der Nicht-Einfältige durchzumachen! »Ach, ich weiß, daß ich aus Werken nicht selig werden kann – –« gut, so mach' dir also keine Vorwürfe, der Glaube an Christum macht dich selig! »Ja, aber glaube ich auch recht oder ist es bloß Mundglauben – –« mach' dir keine Qualen, denn recht glauben wollen ist schon glauben! »Ja, aber will ich denn recht glauben, oder tu' ich nur so, weil ich einsehe, daß ich eigentlich glauben sollte – –« und so fort! Wie glücklich der Einfältige!
9. September.
Gestern war ich in Buchsweiler. Das kleinstädtische, halbgebildete, innerlich unwahre, unfeste, unlautere Benehmen dieser Spießbürger ist mir äußerst zuwider. Da gefallen mir die gediegenen, derben, rohen Bauern besser; nie möchte ich in der Stadt leben, nur auf dem Lande ist mir's wohl. Zwar der Teufel ist überall und macht einem zu schaffen; aber lieber den Teufel aus den Bauern austreiben, als sich mit den Teufeln herumschlagen, die in den Städtern rumoren.
Heute mittag habe ich einen schönen Spaziergang, wie gewöhnlich, nach dem Selberg, in unsre Reben gemacht. Welch herrlicher Ausblick von der Höhe des Weinberges durch die reine, ruhige Spätsommerluft! Es steckt mir noch viel von einem Dichter in den Rippen. In solchen Augenblicken strecke ich begeistert die Arme aus nach dem schönen Land, dem Wasgenwald da drüben, und allerlei Dichterpläne fahren mir durch Herz und Sinn.
Ich arbeite fleißig am Galaterbrief. –
Es ist schon ziemlich spät in der Nacht. Ich habe bei Licht noch bis jetzt am Galaterbrief gearbeitet. Es ist so friedlich, so beruhigend, wenn man in seinen vier Pfählen, hinter seinen Büchern, bei fester Arbeit sitzt, nachdem man draußen ziellos umhergerannt ist. Wahrlich, nur in kleinen Verhältnissen, sagt Jean Paul, gibt es glückliche Leute. Könnt' ich so ruhig bei der Arbeit bleiben!
10. September.
Habe den Galaterbrief heute beendigt und den dritten Vortrag Luthardts (Die Gnade) gelesen.
Manches im Neuen Testament, gerade die Versöhnungslehre, ist mir noch nicht recht klar. Von Luthardt hätte ich auch einiges tiefer behandelt gewünscht.
Einige Fragen, die mir heute gekommen sind, will ich, wenn Zeit und Lust mich lassen, näher durchdenken:
1. Wie verhält sich Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit zu seiner vergebenden Liebe und Gnade? Es widersprechen sich die beiden nicht? Schließen sich nicht aus? –
2. Wer und was ist ein Dichter? Was macht den Wert eines Gedichtes aus?
Zwei Besprechungen in einer Zeitschrift haben mir letztere Fragen nahegelegt. Dies Loben und Herausstreichen bei ganz unbedeutenden Talenten! Diese sonderbaren Ansprüche, die man an Gedichte stellt!
Wenn ich nur auch recht bei der Theologie aushalte!
Herr, hilf mir! Ich fürchte, ich schweife wieder ab. O, Herr Jesu, hilf mir, wenn ich auch die Kraft nicht habe, ganz nur der Theologie und dem Kirchendienst zu leben – – du weißt, Herr, alle Dinge, du weißt auch, daß ich dich lieb habe!
11. September.
Habe heute verschiedenes aus A. Knapps Leben wieder gelesen. Die Art und Weise, wie Knapp und überhaupt die älteren Württemberger unsrem Heiland und Gott gegenüberstehen, ist für uns Elsässer und überhaupt für den wahren lutherischen Christen sentimental und krankhaft. Wir fassen viel nüchterner und natürlicher das Christentum auf; auch wir glauben, lieben, hoffen – – aber dieses überschwengliche Gefühlschristentum! Nun wohl, jeder nach seiner Art. Wir fühlen uns dennoch mit ihnen eins, wenn auch ihr äußeres Gebaren uns krankhaft erscheint.
Wiederholt lesen wir da: »von besonderem Segen war für mich« – oder: »Ich hatte schüchtern gefragt: wo ist denn der liebe Bruder Felician?, da trat er augenblicklich hervor und umfaßte mich mit sprachloser Innigkeit, so daß mir das Herz vor Wonne zitterte« – oder: »Ich ward durchschnitten vom Gefühl meiner Schlechtigkeit und legte mich bitterlich weinend zu Bett« – oder: »ich empfand peinigenden Neid, der mich als einen noch mit Satan zusammenhängenden Menschen darstellte; ich ging dann von ihm weg und warf mich in meiner Kammer vor dem Herrn nieder, dem ich die Greuel meines Herzens darlegte« – und so weiter!
In Hofackers Leben habe ich ganz denselben Ton und Geist gefunden. Wie gesagt, jeder nach seiner Art! ...
Ich habe in einer Zeitschrift verschiedene Besprechungen von Gedichten gelesen und abgeschrieben. Wahrlich, wir leben in einer kleinlichen Zeit! Welche Phrasen und Lobhudeleien von Dichtern, die morgen nicht mehr genannt werden, von Eintagsfliegen! »Bedeutender Dichter«, »große Formvollendung« – von ganz gewöhnlichen Reimereien!
Kleinlichkeit ist das Zeichen unserer Tage. Nicht auf den Geist, nicht auf das Innere, Große, Ideale wird geschaut, sondern auf den Buchstaben, auf Wissens-Anhäufung. Das freifliegende Gemüt, der denkende und hochfliegende Geist wird unter dieser Masse kleinlichen Wissens wie unter Steingeröll verschüttet. –
Die Woche ist zu Ende. Habe den Galaterbrief und den Anfang des Epheserbriefes im Urtext studiert, in Luthardts »Apologetischen Vorträgen«, Band II, drei Vorträge und sonst noch viel durchdacht und innerlich durchlebt.
Ich habe soeben als Abschluß der Wochenlektüre ein Stück aus der Leidensgeschichte gelesen. Es ist doch ein herrliches Amt, von diesem Gekreuzigten zu zeugen!
12. September.
Wir hatten heute morgen im Dorf ein Leichenbegängnis: ein Mann, den der Tod fast mitten aus seinem Tagewerk abgeholt hat. Es ist etwas Ernstes, mich immer tief Ergreifendes, wenn man so am Grabe steht und an seinen eigenen Tod denkt. Ich möchte wohl wissen, was die kritische Theologie einem Sterbenden, den sein Gewissen foltert, als Trost darreichen will? Wie tröstet sie die Hinterbliebenen?
Ein ernster Gang, so hinter dem Sarge! Vielleicht, daß ich einmal eine Skizze darüber ausarbeite.
Soeben lese ich in der Betrachtung auf den 12. September den Spruch: »Rufe mich an in der Not« usw. In der Texterklärung heißt es: »Den Befehl, den unser gnädiger Gott hier gibt« – – Ei, wer sagt dir denn, daß Gott diesen Befehl gegeben? Es steht in einem Psalm, den David gemacht; und der konnte vieles dichten und schwätzen! Die grammatisch-historische Methode legt dar, wann und wo und weshalb er so gesungen und sich mit diesem selbstverfaßten Trost getröstet hat. Nun ja, den Spruch können wir uns auch vorsagen und unser religiöses Gefühl damit stärken – aber – in Wirklichkeit –? – –
Wahrlich, etwas Nebelhaftes, diese kritische Theologie! »Glauben«? Das ist für einen solchen Christen eine Art ideal-religiöses Nebelgefühl. Alles wird in abstrakte Begriffe und Systeme aufgelöst...
13. September.
Sehr warmes, sonniges Herbstwetter! Die Hitze soll von Protuberanzen herrühren, die man an der Sonnenoberfläche beobachtet haben will.
Ich studiere am Epheserbrief. Auch lese ich Luthardts Vorträge weiter und habe heute »Elisabeth« von Marie Nathusius angefangen. Die Beschäftigung mit Literatur und Poesie so streng aufgeben zu wollen, ist eigentlich lächerlich von mir. Wenn es mir nur gelingt, über poetischen Schwärmereien nicht das feste Studium zu vergessen ...
15. September.
Heute waren wir in Dettweiler, den Kaiser und die Manöver zu sehen. Der Kaiser kam zwar nicht, weil er nicht ganz wohlauf war, aber den Kronprinzen, Moltke, herrliche Triumphbogen, großartige Manöver, viele Bekannte, eine Masse Volks haben wir gesehen!
Als wir von dem schön gelegenen Gottesheim herausgingen, trafen wir Pfarrer X. nebst Frau und einer größeren Gesellschaft, darunter Fräulein ... Ich sah hinüber und begegnete ihrem ernsten schönen Blick. Nachher lagerten wir oben an den Reben im Schatten der mächtigen Nutzbäume. Da hatte ich Gelegenheit, sie genauer zu sehen, und auch sie sah mich wiederholt an. Bald aber gingen F. und ich weg, um unsere befreundeten Einjährigen Federlin und Oschmann aufzusuchen, füllten in Geißweiler unsre Wasserflaschen, liefen weit und lange, fanden aber unsre Freunde nicht. Als ich spät und müde nach Gottesheim zurückkam, war nichts mehr von der Gesellschaft zu entdecken.
Denkwürdiger Tag! Dieses Schlachtenspiel im schönen Elsaßland, das der nahe Wasgenwald prachtvoll umkränzte! Fast mehr aber noch haftet mir jene Begegnung im Sinne ... Wurde ihr nicht einmal gesagt vor einiger Zeit, sie müsse einen Pfarrer haben, und ich sei es, der für sie passe? Drum mag sie mich auch heute so aufmerksam betrachtet haben? ... Sie ist schön und ernst, hat fromme, tiefe Augen und so einen leisen Zug von Trauer über dem stillen Gesicht ...
Ach, ich möchte von allem Lieben nichts wissen! Ich bin zu sehr hin und her gerissen! Was soll noch werden?! Einstweilen will ich arbeiten und mich um nichts kümmern.
22. September.
Während dieser Zeit war ich in Kutzenhausen bei Onkel auf Besuch. Von dort aus in den Pfarrhäusern von Sulz unterm Wald und Morsbronn, wo es sehr gemütlich war. Auch in Mattstall, meiner alten Heimat! Aber alles so fremd, so unbekannt! Noch dunkel erinnerte ich mich an das winzige Gärtchen vor unsrer Hintertüre, an die Kirche und sonst noch an dies und das. Aber genau an nichts mehr; alles war mir neu und doch auch wieder alt. Ich wäre schier wehmütig geworden. Aber die prosaische Unterhaltung meines Onkels nebst dem Bürgermeister und Lehrer von Mattstall über Besoldung und dergleichen riß mich in die trockene Wirklichkeit zurück. Der Lehrer versicherte uns übrigens, daß er alljährlich einmal Schiller und Goethe in Auswahl lese: er ist gewiß in dieser Beziehung eine Ausnahme.
Auf dem Liebfrauenberg bei Wörth ist ein Landhaus, in dessen Garten wir eine prächtige Zeder bewunderten. Dort hielten wir uns lange auf. Der Anblick des Schlachtfeldes regte die Phantasie an und weckte bedeutende Gedanken. Abends verirrten wir uns auf diesem Waldberge und kamen spät nach Hause.
Hier lernte ich einen Pariser Elementarlehrer kennen: etwas phlegmatisch, in einem fort erzählend und nicht unüberlegt. Auch bei ihm guckte der heutige Zeitgeist durch: das zweite Wort bei seinen Geschichten ist gewiß »verdienen«. Bald von dem jungen Mann, der sich soundso viel zusammenverdient hat, bald von jener hoffnungsvollen Dame, die eine soundso reiche Partie gemacht! Alles äußerlich geurteilt, nach dem gewöhnlichen Menschenverstand, dem sogenannt »gesunden«! Sein Urteil über einige Dramen Victor Hugos (Lucrezia Borgia, Maria Tudor) war mir sehr interessant. »Es ist schön zu lesen, manchmal ganz schauerlich«, meinte er! »Die Maria Tudor hatte einen Liebsten, der ein schlechter Kerl war usw. Es ist eben auch eine Geschichte wie die von Alexander Dumas«, meinte er! »Die sind manchmal auch so schaurig zu lesen. Ich habe auch die ›drei Mousquetaires‹ gelesen, sie sind aber unmoralisch!« ...
Dem Gefühl nach mag dieses naive »Urteil« schließlich etwas Richtiges enthalten: man hat bei Victor Hugos Dramen tatsächlich mehr den Eindruck, den man von der Lektüre eines spannenden Romans erhält, als den einer tief durchdachten, kunstvoll sich entwickelnden dramatischen Dichtung.
23. September.
Daß man den Unterschied nicht beachtet, der zwischen Marie Eugenie delle Grazies Gedichten und den andren der Lieferung besteht (Leimbach, Deutsche Dichter der Gegenwart)! Wie kleinlich fast die Kritik Leimbachs: »Es lassen sich zwar Spuren von Reminiszenzen nachweisen, aber der Hauptsache nach sind es die frischen Klänge eigener Erfahrung; die Form ist geradezu leicht und vollendet« – – freilich, das ist's ja: die frischen Klänge eigener Erfahrung! Man sieht und hört die Dichterin bei jedem Vers, sie packt und ergreift, sie spricht unmittelbar aus, was in ihrem stürmischen Herzen vorgeht.
Wie glücklich ein Dichter, das aussprechen zu können! Könnt' ich's! Und doch – diese M. E. delle Grazie lebt »ruhe- und friedlos, sehnend und haltlos« dahin! Nein, nicht um alle Schätze könnte und wollte ich den einen Schatz missen, den Heiland in diesem »elenden Dasein«. Und wenn sich eine Welt zwischen dich und mich stellen will, dann, mein Herr und Gott, reiß mich Schwachgläubigen, Sinnbetörlichen mächtig an dich!
24. September.
Wie unreif bin ich noch! Wie wenig ein charakterstarker, wissensreicher, gedankenvoller, glaubensgereifter Mann! Alles so unklar durcheinandergärend! Diese Gymnasialbildung soll der Kuckuck holen, sie verdummt einen nur! Kulturgeschichte, Psychologie, Logik, Geschichte der Philosophie, Kunstgeschichte, Erdkunde – nichts von alledem! Oh, ich muß noch gewaltig lernen!
Schon vor Jahren habe ich nach einem Versmaß, nach einer poetischen Form gesucht, in der man seine Empfindungen ausstürmen kann. Es müßte ein Versmaß sein, das ebenso beweglich und wechselnd und biegsam wäre wie die wogenden, wechselnden Empfindungen einer großartigen, schwungvoll sich ergießenden Phantasie selber. Ließen sich die freien Metren noch ausbilden und kunstvoll behandeln?
Ich arbeite für das Stipendiaten-Examen weiter. Bin am dritten Kapitel der »Richter« (hebräischer Urtext). Habe Galater- und Epheserbrief (griechisch) beendet. Bleibt mir noch Philipperbrief, Kirchengeschichte, Richter und Ruth zu vollenden.
24. September.
Ich arbeite fleißig hebräisch. Die vier ersten Kapitel Richter habe ich gestern gelesen. Heute abend denke ich noch mit Buch Ruth fertig zu werden. Eine liebliche Geschichte, dieses Buch Ruth! Wie naturgetreu, wie seelenwahr, wie anschaulich alles!
Den wirklich großen Dichter macht die Herzenserkenntnis, die tiefen Blicke, die er in Menschen und Welt getan, in das Herz, in die großen Taten Gottes, in das Gewissen. Wenn er die Nacht des Menschenherzens beleuchtet, daß alle blitzartig zurückfahren vor den enthüllten Abgründen, wenn er den ernsten Gott und den liebenden Gott den Spöttern wuchtvoll vorhält – dann ist er groß.
27. September.
War heute im Pfarrhause zu Gumbrechtshofen zu kurzem Besuch. Das Wetter war sehr mild und spätsommerlich. Schön war der Weg durch den Uhrweiler Wald mit seinen vielen Ausblicken auf die in weitem Bogen umkränzenden Berge.
Gestern nacht, vielmehr heute morgen um zwei Uhr ist in unsrer Nähe eine große Scheune niedergebrannt, so daß ich lange aufbleiben und Wasser tragen helfen mußte. Ich kam also heute nicht recht zum Arbeiten. Wie gewaltig dieser Brand mitten in der Nacht! Der ganze weite Umkreis hell von schauerlich roten Flammen! In Obermodern war Meßti; dort gaukelte der junge Eigentümer bezecht herum, während seine Scheune abbrannte! Viele, die, vom Meßti kamen, wo sie gejubelt und gepraßt hatten, standen ernüchtert da und gafften in die lohende Flamme.
Geibels »Judas Ischariot« gelesen, den Leimbach in seinem Buch über Geibel als »eine Lösung eines der schwersten Probleme des Neuen Testaments« preist. Ich finde diesen Judas nicht sehr tief. Doch kann ich kein Urteil abgeben, weil ich mich selbst noch nicht in dieses Seelenproblem vertieft habe. Wie konnte es möglich sein, daß einer der Jünger den Meister verriet? Wie konnte in so heiliger Nähe ein so unheiliger Gedanke entstehen?
Und dann die andre Frage überhaupt: wie konnte in Gottes heiliger Nähe ein unheiliger Engel sündigen und verstoßen werden: Satan?!
28. September.
Der Tod ... Stelle dir vor, wie du auf dem Sterbebette liegst, wie dein keuchender Atem nur noch mit Mühe durchdringt: bald sollst du fort aus allen deinen Gewohnheiten, von allen Bekannten – es läutet in der Kirche – in einigen Minuten wird auch dir die Sterbeglocke läuten – die Eltern und Kinder und Frau oder Mann stehen leise weinend mit bleichen, überwachten Gesichtern am Bett, andre flüstern mit ernsten Gesichtern im Zimmer: »er macht nimmer lang, in ein paar Minuten ist's fertig« ... Du aber sollst fort, heraus aus deinem Leben, der Atem wird dir genommen, die Sinne schwinden, für immer schläfst du ein – und nie wieder wirst du von der Mutter geweckt werden: »Steh auf, 's ist sechs Uhr!«
Für immer fort!
Und wohin?!
Da zittre nur, Spötter! Weißt du, wohin? Wir aber wissen es. Herr Gott, ich bitt' durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut!
Dichter und Priester!
Ein priesterlicher, prophetischer Dichter und ein dichtender Priester und Prophet!
30. September.
Heute hat mir Albert den ersten Band von Byrons Werten gebracht. Ich hatte bisher bloß seinen »Manfred« und einige Gedichte gelesen. Seine Persönlichkeit ist sehr genial und poesievoll, aber mein Ideal selbstverständlich nicht. Dies ruhelos dämonische Umherschweifen – nein, solche Genialität beneide ich nicht ... Genialer Dämon ...
Männlicher Stolz, ja, der jedoch von der christlichen Demut so in Schranken gehalten wird, daß er nicht in Hochmut und Eitelkeit ausschlägt: das ist meine Bestimmung.
Ich fühle mich in meinem eigensten Wesen, wenn ich freudig und frisch, phantasievoll, hoffnungsstark und heiter in die Welt schaue. Nicht grübeln, nicht schwermütig über sich selbst hocken! Ei was, der alte Gott lebt noch! Frischauf!
Ich habe Galater-, Epheser- und Philipper-Brief fertig. Ebenso Buch »Ruth« sowie vier Kapitel der »Richter«. Gegenwärtig arbeite ich Kirchengeschichte.
2. Oktober.
Ich versuche Kirchengeschichte zu studieren, den ganzen langen Tag, komme jedoch über den Versuch nicht hinaus. Ich kann mich kaum ordentlich sammeln. Immer wieder laufen mir die Gedanken von diesen Kirchenvätern fort nach Alt-Ägypten zu den Israeliten, deren Auszug ein vorzügliches Drama liefern müßte: einer bleibt zurück, aus Lust zu hohen Ehren, verleugnet sein Volk und seinen Gott, liebt eine Ägypterin, tötet sich nachher in Verzweiflung ...
Dann fliegen meine Gedanken wieder fort in Wald und Berge dahinten, wo ich gern diese letzten milden Sommerblicke kosten möchte, wenn ich nur Zeit dazu hätte ...
Oder zu Marie Eugenie belle Grazie und ihren Gedichten oder zu Byron oder zur Poesie überhaupt ...
Wieviel, wieviel hab' ich noch zu lernen! Sowohl was meine Kenntnisse als auch meinen Charakter betrifft. Ich muß mich gewöhnen, in meinem ganzen Benehmen immer – nicht nur meistens – mich mutig und fest, ungeniert und frei zu benehmen. Ich will wiederholt hinunter in die Schule gehen, um mich zu gewöhnen, ganz gleichgültig viele Blicke, wenn auch hier nur so viel kleine Augen, auf mich gerichtet zu sehen. Überhaupt keine Einladung abschlagen, um mich zu üben, im Umgang frei und fest und sicher zu werden.
Auch Kulturgeschichte, Kunst- und Musikgeschichte studieren – und wieviel noch! In diesem Winter gedenke ich außer der Theologie noch Mittelhochdeutsche Literatur zu hören, vielleicht Kudrun und ähnliches zu lesen; dann Faust von Goethe, von Marlowe und die anderen Behandlungen der Faustsage; auch Miltons Verlorenes Paradies. In den nächsten Osterferien werde ich dann wohl die Synoptiker (drei ersten Evangelien), die ich diesen Winter bei Holtzmann höre, mit Kommentar und überhaupt die ganze Geschichte Jesu durchstudieren.
Welch schöner, belebter Abend da draußen im Dorf! Wir dürften noch im Juli sein, so sommerlich ist, die Luft. Wie gern möchte ich nun hinausstürmen in den abendlich ruhigen Wald, in die Berge! Dem Abendrot nachsehen und bei spätem Mondschein nach Hause kommen!
Besser aber, wenn ich tüchtig Kirchengeschichte studiere.
2. Oktober.
Ein großer Unterschied zwischen den überrheinischen Deutschen und uns Elsässern! Ein noch größerer zwischen den Nord-Deutschen und uns! Dies Beschränktsein auf unsre »gemütliche Ecke« da im Elsaß – links der trennende Rhein, rechts der scheidende Wasgenwald – hat uns zu recht »gemütlichen« Eckenhockern gemacht. Dazu ist in unsren Adern noch manches altkeltische Blut; auch hat die französische Herrschaft etwas Welsches und Undeutsches in uns hereingetragen. Aber im Grunde unseres Herzens sind wir echt deutsch und gut germanisch.
Ich verspreche mir viel von meinem nächstjährigen Aufenthalt in Norddeutschland: der gefühlvolle Elsässer muß sich am rauhen Norden stählen und härten!
4. Oktober.
Mein Geburtstag heute! Heinrich hat mir ein schönes Bild des Gekreuzigten (Schnorr von Carolsfeld) geschenkt, die beste Gabe, mit der er mich hätte erfreuen können. Möchte es wie mein Zimmer so auch mein Herz zieren!
Du freust dich, Freund Heinrich, daß du im Mai,
Wenn die Welt erwacht, wenn die Lerchen jubeln,
Wenn Frühlingslüfte Sehnsucht wecken –
Du freust dich, daß du im Mai geboren,
Daß ein heitrer Tag dir entgegengelacht?
Ich freilich sah im düstren Oktober diese Erdensonne:
Ein trübroter Ball – durch weite verhüllende Nebel
Schien sie herunter.
Da blühten meine Lieblinge nicht, die vollprangenden Rosen,
Da lachte kein Wasser im Himmelsglanz,
Da sang kein waldfrohes Vöglein mehr,
Kein weißduftiger Schlehbusch umsäumte den Bergwald –
In ernst düstrem Schweigen dehnt sich endlos
Ein graues Nebelmeer,
Und der Wandrer, der trauernd und einsam
Durch den nebeltropfenden Wald schleicht,
Sieht gedankentrüb auf die leis fallenden Blätter,
Auf die schwarzen Krähen, die unheimlich krächzend
Durch die Herbstluft fliegen, hochhin über unser Haus fliegen:
Dunkle Geschicke meinem Leben weissagend.
Dir aber schlug unter Sternenpracht
Die Nachtigall vor dem Fenster im Fliederstrauch,
Leuchtkäfer flogen flimmernd im Garten hin,
Und der Hauch der mildwarmen Frühsommernacht
Umrauschte wie Fittiche schirmender Engel
Euer fröhliches Haus in deiner Geburtsnacht.
Ja, freue dich, glücklicher Freund,
Daß du im wonnigen Mai geboren!
Zwei Gedichte haben an diesem Tage das Licht der Welt erblickt: ich würde sagen, ein gutes Omen und Vorzeichen, wenn die Gedichte nicht gar so schlecht wären, wie überhaupt alle meine Verse. Da ist keins, das mir auch nur im geringsten gefällt, auch nicht eins!
Heute bin ich einundzwanzig Jahre alt! Einundzwanzig Jahre! Und habe noch nichts geleistet!
Laßt mich einmal zurückblicken! In meiner Kindheit war es mir der höchste Genuß, mir vom Vater Geschichten erzählen zu lassen oder selbst den ganzen Tag Geschichten und Märchen zu lesen. Und ging ich einmal fort zu den Spielgenossen, so waren es allerlei Geschichten, die wir spielten, wobei ich immer der Leiter und Anführer sein wollte. Im Äußeren war ich schüchtern, viel über mir sitzend, träumend, lesend. Allmählich, in meinem dreizehnten oder vierzehnten Jahre, kam die Poesie: und mit ihr erwachten in meinem Herzen große Ideale und Träume für die Zukunft. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen war es, etwa in meinem fünfzehnten Jahre, mit meinen Kameraden von mir selbst verfaßte Dramen aufzuführen, allerdings kunstlose Drämchen, Trauerspiele und Lustspiele. »Walladin«, vollständig in Blankvers, doch nur ein Akt; »Der verlorene Sohn«, in Prosa und drei sehr kleinen Aufzügen; »Die Hussiten« oder »Maria von Schaumburg«; »Konradin«, das allererste winzige Trauerspielchen, das ich schrieb; »König Hardung«, schon besser angelegtes Bruchstück; »Die unechten Söhne«, Lustspiel. Erst etwas später, in Obertertia oder Untersekunda, schrieb ich ein regelrechtes Trauerspiel in anständig langen fünf Akten: »Die Lichtenberger«, vielleicht nicht zu schlecht.
Alles aber habe ich in einer überkritischen Stunde verbrannt.
Dann die Geschichten oder Romane, die ich teils Albert, teils und besonders Heinrich auf dem Hin- und Herweg zum und vom Gymnasium erzählte oder selbst schrieb – auch verbrannt glücklicherweise. Und die Gedichte alle! Aber nichts Vollendetes, nichts nur einigermaßen Druckfähiges, Hervorragendes.
Oh, mein innerster, höchster Wunsch war es in jenen schönen Zeiten, in die ich mich heute gern zurückversetze, einst mich ganz der Poesie hingeben zu können, einst in der Poesie Großes zu leisten! Waren es Kinderwünsche? Glühen nicht vielmehr heute noch dieselben Ideale in mir?!
Ein Hauptunterschied besteht zwischen jetzt und damals: ich habe meinen Heiland gefunden. In Unter- und Oberprima lebte ich zwei Jahre lang nur in religiösen Dingen. Durch diese Epoche mußte ich hindurch, so daß ich nun allmählich beides vereinige: christliche Weltanschauung und Poesie. »Wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist!« (Novalis.) Dazu hilf mir, mein Heiland, mein Gott! Diese Bitte tue ich heute zu dir!
Gestern war ein sonniger Tag, heute verhüllt sich alles in dichtem Oktobernebel. Heute in drei Wochen Antritt des Wintersemesters! Was wird es alles bringen? Unglücklich geliebt habe ich lange genug in meiner Jugendzeit, nun aber, da ich nur die Hand auszustrecken brauche, ist mein Herz für diese Liebe erkaltet: – nun soll die Poesie meine Geliebte werden. Du hehres Weib Poesie, laß mich leidenschaftlich und mit edler Begeisterung dich lieben – aber Gott nicht vergessen!
Viel, viel will ich studieren, wenn Gott mir Gnade und Kraft gibt. Auch in französische Sprache will ich mich tüchtig vertiefen, um von dem abstrakten französischen Geist zu lernen: etwa Fénelons »Telemach«, La Bruyère, Bossuet oder Chateaubriand.
Dir, Herr, sei Dank für all das viele Gute, das du mir bisher geschenkt hast, für all deine Lieb' und Gnade! Bleibe du auch ferner bei mir bis an mein Ende!
5. Oktober.
Ich arbeite zwar tagtäglich Kirchengeschichte. Aber wie ich die Frische und Erholung des Studentenlebens in Straßburg, die Geselligkeit, die Kneipe, das – bayerische Bier nötig habe und mich danach sehne! ...
Es ist ärmlich, nur Minnelieder, Natur- und Kneiplieder zu singen. Dies Leben ist so kurz und ernst. Schöne Äuglein und das Veilchen am Bach zu besingen und sich aus solchem lyrischen Gezirpe einen Beruf zu machen – ?! Eine Menschenseele ist mehr wert als aller Tand der Welt.
6. Oktober.
O Poesie, so schön und hehr! Wie oft, wenn ich Kirchengeschichte studierend auf- und abgehe, strecke ich begeistert die Arme aus, vom Ideal, von meinem Liebling, von der Poesie gewaltig gepackt! Wie gerne wollte ich das Drama, das ich im Kopfe trage, »Der Auszug aus Ägypten«, mit Lust und Feuer entwerfen und ausarbeiten! Eine rechte Sturmtragödie: wahr und ernst und groß! Und dann im Roman »Ein Dichter« diesem kleinen Zeitalter das große Ideal eines wahren Dichters hinstellen!
Aber ich bin zu unreif, zu unklar, zu unwissend, zu – unbegabt dazu.
7. Oktober.
Wir waren heute nachmittag in Pfaffenhofen bei Cousine S. Im Pfarrhause habe ich mich ziemlich unterhalten; wir haben die schöne Kirche besehen, haben über Theater, Musik, Konzerte, Goethe und Faust gesprochen.
Wenn ich nur einmal einen träfe, der mir an Wissen und literarischem Blick überlegen wäre! Wie würde ich von dem lernen! Aber Goethe hatte seinen Herder: der dumme Lienhard ist's nicht wert, daß er einen findet.
Ich habe dreierlei Menschen in mir: einen nüchternen, verständigen – den Pfarrer; einen verdrießlichen – den Melancholiker; einen phantasie- und schwungvollen, großartigen, erhabenen – den Dichter. Mit dem letzteren stehe ich auf gutem Fuße; er gefällt mir am besten.
Gestern abend lief ich im Sturmschritt durch den Wald nach dem Selberg, um dann in klarer Vollmondnacht zurückzukehren.
8. Oktober.
O Poesie, du herrliches, stolzes Weib, wie ich dich glühend liebe!
Das Trauerspiel »Der Auszug aus Ägypten« habe ich der Idee nach fertig. Ich hab's Heinrich mitgeteilt; er meint, es würde ein großartiges Werk werden. In diesem Winter will ich die Vorstudien unternehmen: Exodus im hebräischen Text lesen, ägyptische Sitten jener Zeit studieren, Shakespeare – und so weiter!
Habe heute mittag Steinhausens »Irmela« zu Ende gelesen. Am Schluß konnte ich vor Tränen kaum die Worte sehen. Ich habe die Kirchengeschichte für diesen Nachmittag aufgegeben, bin in Wald und Berge gegangen, habe mich auf dem Kuhberg dem Schloß Lichtenberg gegenüber hingesetzt und mich wehmütigen Betrachtungen überlassen. An meine Jugendliebe dachte ich, an die Seligkeit jener ersten Liebe. Und jetzt? Oh, auch ich sehne mich aus dem »Kloster« heraus in die Welt, die mir deshalb so schön erscheint, weil ich von glühender Liebe zu einer minniglichen Jungfrau erfaßt bin, zu dir, meine Irmela, du schöne Poesie!
Aber die Worte, die sich Diether dort zuruft, passen auch auf mich: »Doch wie? Dürft' ich mich überwinden und all dies, was mich abwendig gemacht hatte dem heiligen Stande, ansehen als von dem waltenden Gotte so gefügt? War es nicht vielmehr der Dünkel und Wahn meines unberatenen Herzens, eigenwilliges Entweichen vom Wege, der mir verordnet war? Oh. dann war es ein schuldvoller Ungehorsam!« ... Auch meiner Mutter sehnlichster Wunsch war es, daß ich dem geistlichen Stande all meine Kräfte widmen sollte!
Allmählich aber klärte sich meine Wehmut. Nur der eine Wunsch und Gedanke glänzte noch hervor: möchte ich als großer Dichter Edles und Hohes leisten und das Menschenherz in seinen Tiefen ergreifen!
Auf dem Heimweg im glänzenden Abendschein las ich Klopstocks Oden und sah auf das herrlich im letzten Sonnenschein sich dehnende Land hinaus: auf jene blauduftigen Berge in westlicher Ferne ...
11. Oktober.
Soeben habe ich alle meine früheren Gedichte verbrannt. Sie sind nicht wert, daß ich sie aufbewahre. Entweder gute Gedichte, wie ich sie als Ideal in mir habe, oder gar keine!
Thomasstift, 13. November 86.
Wieder im Straßburger Stadtleben, im Studententreiben! Mitten in all den Arbeiten und Sorgen, die den Vorsitzenden einer Verbindung beschäftigen können! Dahinten, weit dahinten die schönen Sommermonde in Wald und Gebirg und freier Natur!
Das Stipendienexamen ist recht glücklich bestanden. In meine Geschäfte als Präses der Argentina habe ich mich eingelebt. Aber zum Arbeiten lassen mich eben diese Geschäfte kaum kommen.
Die kritische Theologie erbittert mich immer mehr.
Ich hätte noch verschiedene literarhistorische Vorlesungen belegt, aber Professor X., Typus eines deutschen Gelehrten, ist zum Sterben langweilig.
25. November.
Als ich heute nach der Bibliothek ging, um Viktor Hugo, Georges Sand, Grabbe und sonst allerlei Nicht-Theologisches zu holen, begegnete mir Professor Z. (in dessen kirchengeschichtlichem Kolleg ich einmal unter seinen Augen ein Shakespeare-Kolleg ausarbeitete). Es liegt immer etwas Vorwurfsvolles, Ernstes in seinem Blick, wenn er meinen Gruß erwidert. Mit ihm hab' ich's verdorben auf immer!
Und was ist schuld? Dieses leidige Herumträumen in der Literatur! Auch in der Bibliothek, als mich der Beamte fragte, ob wir denn im Thomasstift »solche Sachen« lesen dürften, blieb mir dasselbe Schuldgefühl, ja wurde noch erhöht.
Ach, Gott, ich verträume, versäume meine Zeit! Einem ernsten Studium, einer andauernden Arbeit kann ich mich nicht hingeben, die Theologie vernachlässige ich, und in der Poesie bring' ich auch nichts zustande! Und mein Vater zu Hause arbeitet für mich und denkt täglich an mich und gibt sich reichen Hoffnungen und Erwartungen hin. O ihr Träume! Selbst mein beseligender Kinderglaube ist mir ganz umdüstert und umnebelt worden durch diese unselige kritische Theologie der hiesigen Fakultät und überhaupt durch moderne Geisteswerke. Herr, du hörst, du siehst, was ich hier denke und schreibe! Oh, ich meine es aufrichtig oder möchte es doch aufrichtig meinen – gib, daß ich's von Grund aus aufrichtig meine! Hilf mir doch, lieber, lieber Herr!
O du schöne Kindheit, du süße erste Liebe, du Traum im Elternhause! Zerronnen wie alle Träume. Nichts mehr bleibt mir als die Sehnsucht nach der lichten Himmelsheimat, wo meine Mutter weilt... Mein Gott, verlaß mich nicht!
1. Dezember.
Gestern abend war ich im Theater: Flotows Oper »Martha«. Hat mir zwar gefallen, aber nicht wie der »Trompeter« seinerzeit, der mich mächtig erregte. Die Musik ist viel gleichmäßiger als die Neßlers, die ja stellenweise schrecklich kahle Partien aufweist. Das wehmütig Innige, das manchen Liedern Neßlers anhaftet, fehlt hier. Trotzdem war der Abend genußreich.
Das schöne »letzte Rose«! Erinnerungen an jene Hochlandstage, wo dies unser Lieblingslied war, hat sie nicht geweckt. Überhaupt ist jenes alles für mich vorbei. Ich will und kann und darf nicht daran denken.
Die Kunst allein!
4. Dezember.
Gestern abend in Goethes Faust! Wie herrlich, wie gewaltig, wie ergreifend! Ich war ganz hingerissen. Oh, ich liebe die große, erhabene Kunst mehr als je! Wenn ich dieses gewöhnliche, dumme, bornierte, kleine Stiftlervolk da ansehe, so kocht mein Herz, ich möchte fort, hinauf – –
Es wurde über mein Erwarten gut gespielt. Wie hat mich Gretchens rührend einfache Gestalt ergriffen! Am Anfang diese herrlichen, reinen, kindlichen Liebesgespräche in Frau Marthes Garten – und zuletzt die Kerkerszene, wie ergreifend, wie überwältigend!
Welche Tragik! Wie ernst, erhaben, niedergedrückt von der Wucht der Tragödie, und doch groß gemacht, geht man da hinweg! Da schwindet alles kleinliche Liebeln, alles kleinliche Herumschnüffeln und Herumzanken; unser kritischer Professor N. N. kommt mir in solcher Stimmung ganz erbärmlich vor – und dieses Stift und alles!
Nur die hohe, gewaltige, tiefpackende Kunst bleibt.
Das war kein ergötzlich Phantasiespiel, wie Operette, Posse und derlei – das war eine gewaltige Predigt, gewaltiger, als ein gewöhnlicher Kanzelredner jemals in seiner Art gepredigt hat.
So hat mich noch kein Kunstwerk erhoben, bis ins Innerste gepackt wie dieser »Faust«. Der Faust-Drang ist in uns allen. Behüte uns Gott, daß er uns nicht auf falsche Bahnen, nicht ins Verderben treibt!
Nein, das war kein Theaterspiel mehr, das war Gottesdienst. Ein lebendig vor uns sich abspielendes, ein aufgeführtes Theaterstück ist das einzig Wahre. Ein aufgeführtes Drama ist gewiß das Höchste, was es geben kann! Ich hatte vorher »Faust« gelesen, aber wie wenig ergriff es mich gegenüber der gestrigen Aufführung! Ich las, bewunderte, durchsann es, sah die einzelnen Schönheiten – aber gestern abend: ich sah und hörte mit eigenen Augen und Ohren, ich dachte und fühlte zugleich – und ich ging wortlos nach Hause, ich war überwältigt, tausend Gefühle durchwogten meine Brust. Oh, so herrlich und schön – und so vernichtend und zugleich erhebend ist eine solche Welttragödie!
O Gott, mein Gott, möchten meine glühenden Jugendwünsche sich erfüllen!
10. Dezember.
Ach, ich habe mich in diesen Wochen in inneren Kämpfen und Anfechtungen befunden, daß ich – ehrlich gestanden – an allem, total an allem zweifelte! An Gott, Himmel, Unsterblichkeit – geschweige denn erst an der Gottessohnschaft Christi! Und, Herr Gott, ich bin noch nicht ruhig, noch nicht beruhigt!
Wenn sich nun die Christenheit achtzehnhundert Jahre lang an diesem Glauben getröstet und in diesem Glauben den Märtyrertod erlitten hat – und alles, alles war umsonst, war Dunst, Schein?! Was wir für eine wirkliche, jenseits alles sinnlichen Schauens liegende, unserer Körperwelt entsprechende geistige Welt hielten – ist nichts als schattenhafter Begriff! Dein eigener Geist hat sie erzeugt, dein eigener Geist zerstört sie nun! ...
O du winziges Häuflein Christen, was willst du in dieser allmächtigen Zeitströmung! Du machst dich ja lächerlich mit deinem veralteten einfachen Glauben! »Pah, wir sind Männer geworden, wir brauchen jene Kinderfabeln nicht mehr!« Welch ein Schmerz muß euch durchwühlen, wenn ihr so euren beseligenden Glauben schwinden seht, wenn man euch alles, alles wegbeweist! »Sünde? Subjektiver Begriff! Gibt's nicht!« – »Gott? Phantasieprodukt deines eigenen Geistes!« – »Himmel? Dito! Hölle? Dito!« – Bleibt also nichts als der unendliche Jammer dieses Erdendaseins! Ganz allein stehst du da, deine schönen Gefährten, die holden lieben Engel, der allnahe Gott – alles fortgeflogen als dunstiger »Begriff«!
Höchstens, wenn er sich wieder aufgerafft hat, bleibt dem Geist ein stumpfsinniges Phrasenmachen vom »Ideal«! Was ein Newton, Kopernikus, Dante und Unzählige glaubten – lacht, ihr Leute, sie haben alle geirrt! ...
13. Dezember.
Habe vor einigen Tagen mein Drama »Der Auszug aus Ägypten« (Naphtali) begonnen!
Die Form bereitet mir keine kleinen Schwierigkeiten, wie ich merke. Stünde mein Werk so vor mir auf dem Blatt, wie es mir in Kopf und Herzen lebt!
Diese Grübeleien über Religion und moderne Weltanschauung will ich lassen. Bei meinem einfachen Christentum will ich bleiben. Aber sie sind mir so ins Gefühl übergegangen, diese modernen Schwindeleien, daß ich Mühe habe, diese Stachel des Zweifels herauszureißen, ohne daß eine schmerzende Wunde zurückbleibt.
Herr, wenn du willst, so kannst du mich wohl reinigen und heilen und mir starken, weit-, zweifel- und teufelüberwindenden Glauben geben! Ich habe Augenblicke, Stunden, Tage gehabt, wo ich im eigentlichsten Innern nicht an Gott, an nichts mehr glaubte. Und ich kann nicht behaupten, daß ich von dieser Geistesepidemie wieder genesen bin.
14. Dezember.
Gott, laß mich nicht untergehen! Ich laufe Gefahr, meinen Glauben und alles einzubüßen! Das Weihnachtsfest – wie hab' ich mich sonst so kindlich darauf gefreut! Soll diese lebensvolle Welt des Glaubens fortgeflogen, verdunstet sein wie Kindermärchen, die uns Vater und Mutter erzählten? Dann ist die Welt ein unsäglich trauriges Ding!
Aber es muß, es muß eine belebte Welt da über uns geben! Ich war in diesen Wochen totaler Atheist, mein Gebet war ein Phrasenmachen, mein Wandel Heuchelei. »Gefühl ist alles?« Den Mann muß ich bedauern, der sich an religiösen »Gefühlen« genügen läßt, ohne zu wissen, auf was er sie gründet, ja, ob er überhaupt ein Recht hat, so verblasene, allgemeine, unbegründete »Gefühle« zu hegen! Wir aber kennen Tatsachen.
Wenn die Herzensgeliebte bei dir ist, da fällt dir kein unreiner Gedanke, kein gemeines Tun ein; bei jedem Schritt denkst du an diese dir nahe, auch nur an dich denkende, auf dich blickende Geliebte. So auch ist es, übertragen, wenn Jesus in deiner Nähe weilt. Mit ihm innerlich reden wie mit einem Freunde, durch seine allmächtige Nähe getröstet werden und diese Nähe als etwas Lebendiges unmittelbar spüren: – das heißt glauben.
17. Dezember.
Björnsons »Fröhlichen Burschen« und Bauern-Erzählungen gelesen. Wundervoll! Aber diese naturfrischen, keuschen, derben, unverdorbenen Gestalten lassen ein Gefühl der Wehmut in mir zurück. Wo gibt's noch diese idealen Zustände? Und wenn jene Norweger im Hochland noch so sind – wie lange dauert's, so dringt diese verwüstende, verteufelnde moderne Zivilisation auch dort ein – und überall dann Konvention, Lüge, Unnatur!
Aber wir müssen durch Bildung und Kultur hindurch zur wahren Unschuld und Einfalt. Das sei unser Ziel!
18. Dezember.
Den ganzen Tag fast nur am »Naphtali« gearbeitet. Bis heut abend um acht Uhr kaum aus dem Zimmer gekommen. Nachher im Piton bis zehn Uhr mit den Füchsen exgekneipt. Am Tisch neben uns katholische Studentenverbindung B.; einige von ihnen sind mir vorgekommen (zugetrunken). Es wäre flott, wenn wir eine Exkneipe mit den Leuten einrichten könnten. Aber der Anstoß bei unsren evangelischen Professoren und unsren äußerst lutherischen alten Herren!
Schillersdorf, in der Christnacht.
Die reine Heiterkeit und Freude, die mich sonst in der Weihnachtszeit erfüllte, hat nun teilweise einer ernsten, bittren Stimmung Platz gemacht. Mein Glaube ist in diesem letzten Vierteljahr stark in Gefahr gewesen: ich war nahe daran, ihn zu verlieren. Ach, und das süße Glaubensgefühl, die volle Glaubensgewißheit habe ich noch immer nicht wiedergefunden. Immer, immer noch diesen bittren teuflischen Zweifel in der Brust!
Herr, ich glaube, ich will glauben! Stärke mir –nein: gib, schenke mir den Glauben! Die kalte, leere Phantasiewelt der Dichter und Geistesheroen soll mir den Glauben nicht nehmen. Wie kalt ist's da drin, wo nur öde Trümmer lagern, durch die der Wind seufzt, statt des herrlichen Gottestempels, in welchem ein voller Orgelsang dahinbraust!
5. Januar 1887.
Neujahr vorbei. Nichts Bedeutendes vorgefallen. Silvesterabend mit Albert und Michel bis gegen zwei Uhr gewacht, auf dem Hügel an der steinernen Ruhbank zwischen zwölf und ein Uhr das Glockenläuten der Dörfer gehört.
Kann nichts, bin nichts, komme zu nichts.
Straßburg, 15. Januar.
Den ersten Akt meines Dramas vollendet.
Lese und tue wenig. Die im Lesezimmer der Universität ausliegenden Blätter und Schriften durchfliege ich täglich, mache mir hie und da Auszüge und überzeuge mich von der Jämmerlichkeit der modernen Schriftstellerei.
Ich will niemals mitschwimmen, sondern zeugen von dir, du Gekreuzigter!
24. Januar.
Habe vorgestern die erste lange Szene des zweiten Aktes vollendet. Gestern band mich eine Erkältung ans Zimmer. Da konnte ich gründlich nachdenken, warum mir das Drama in der jetzigen Gestalt mißfällt. Ganzen Plan ändern!
27. Januar.
Gestern ist mir urplötzlich die Idee gekommen: laß die Theologie und wandre zur Philologie hinüber! So überzeugend hat sich mir dieser Gedanke aufgedrängt, daß ich mich wundre, wie alles so rasch gekommen. Denn es war kein Einfall: selten war ich so ernst in meine Studien vertieft wie gegenwärtig.
Früher kam mir zwar dieser Gedanke schon oft; aber ich wies ihn zurück, weil ich meinte, es sei nicht Interesse an der Philologie, das mich hintrieb, sondern bloß – Abneigung gegen das Arbeiten in einem bestimmten Fach. Aber ich bin doch ruhiger geworden; ich sehe, daß ich arbeiten kann. Mein Arbeiten deckt sich aber nicht mit meinen theologischen Aufgaben. Meine Beschäftigung – Drama! – paßt nicht zu meinem Studium und nicht zu meinem späteren Amt.
Gestern von drei bis fünf las Holtzmann; von drei bis vier war ich dort, dann aber ging ich ins Lesezimmer, las und machte fleißig Auszüge. So hab' ich's schon oft getan: die andren sitzen bei den Professoren oder in der freien Zwischenzeit im theologischen Seminar – ich sitze allein im Lesezimmer.
Da drängte sich's mir auf: warum gehst du nicht zur Philologie? – Bin ich morgen oder übermorgen noch dieser Meinung, so schreibe ich nach Hause.
2. Oktober.
Ich habe nach Hause geschrieben, Papa um seinen »väterlichen Rat, Erlaubnis und Gutheißung meines Vorhabens« gebeten. Es hat lange gedauert, bis der Brief fertig war, noch länger, bis er fort kam.
2. Februar.
Bis jetzt noch kein Brief, weder von Papa noch von Bruder Albert. Papa wird jedenfalls alle Hebel in Bewegung setzen, um mich zurückzubringen. Daß Pfarrer L. dabei mitwirken und mitphilosophieren und dogmatisieren wird, ist mir jetzt schon sicher. Auch Mama wird wehe! wehe! rufen.
Ich habe gestern in Biographien von Schiller und Goethe gelesen. Das waren andre Kerle als wir Zwerglein! Damals übersprudelndes Leben – heute alles matt und verschlafen. Zum Henker! Ich würde wild werden, wenn ich nicht selbst solche Schlafmütze wäre! ...
Es sind Kriegsgedanken in der Luft: durch alle Studenten und Spießbürger schwirrt das unheimliche Gerede von einem nahe bevorstehenden Krieg mit Frankreich. Schwüle Stimmung überall!
Welche Wonne, wenn ich im nächsten Semester aus diesem schmutzigen Schlaf- und Futterstall von Stift herauskomme! Den unerträglichen Anblick dieser langweiligen Theologengesichter los werde! Die für nichts Interesse haben als für das Quantum Theologie, das sie zum Examen brauchen, und für ein Glas Bier nebst nächtlichem Lärmen und Brüllen ...
Wahrlich, »selig, wer sich vor der Welt verschließt« – aber »ohne Haß«! Das will ich mir merken. Ich kann oft die Verbitterung, die sich meiner bemächtigt, nicht unterdrücken.
3. Februar.
Gestern kam ein Brief von Bruder Albert über den Aufruhr und den Jammer zu Hause, den mein Brief hervorgerufen. Ich war auf Gegenvorstellung gefaßt; aber auf Tränen, Schmerz, Verzweiflung, als ob ich ein verlorener Sohn wäre, nicht im geringsten.
Mein Drama habe ich verbrannt und dabei geweint wie ein Kind. Blatt für Blatt! Ein trübseliger Aschenhaufen ist alles, was davon übrigblieb.
5. Februar.
Gestern abend traf endlich Papas Brief ein. Er läßt sich auf eigentliche Gegengründe gegen mein Vorhaben, Philologie zu studieren, nur nebenbei zwischen Klammern ein: »Durch Deinen ersten Brief habe ich Dich schon in irgendeinen Dichterklub verstrickt gesehen ohne feste, sichere Lebensstellung (denn Philologe wirst und darfst Du nie werden, der Lebensberuf ist zu trocken, zu aufreibend)« – War Geibel nicht auch Philologe? – Papa rät mir nun, da der Augenblick gekommen, sich energisch für einen bestimmten Beruf zu entscheiden, mich voll und ganz auf die Theologie zu werfen: »Bitte Gott um Kraft und Beistand, Du wirst sicherlich ein guter Pfarrer und wirst Großes leisten.« Als Ideale stellt er mir Huser, Horning, Hermann hin. »Dies ist Dein Lebensberuf, dazu bist Du als Kind von Deinen Eltern bestimmt und dem Herrn geweiht worden, dazu hast Du Deine Gaben erhalten« usw. Wenn ich dennoch weitere Bedenken haben sollte, so solle ich am Samstagabend nach Hause kommen: »wir wollen dann reiflich überlegen und werden gewiß zu einem entscheidenden Entschlusse kommen«.
Gut, gut! Wenn eine bloße Unterredung, ein bloßes Überlegen dazu gehörten, dies oder das zu wählen; aber es handelt sich nicht um zwei Äpfel, von denen ich einen wählen soll, es handelt sich um mein ganzes Wesen, um mein inneres Sein, um meine ganze Gedankenwelt. Die wird durch einen Brief, durch Worte, durch Gegengründe nicht verändert: mach' meine innere Welt anders, dann werde ich von selbst äußerlich auch anders handeln! Literatur, Poesie, mein ganzes geistiges Sein aufgeben? Nie und nimmer! Es wäre geistiger Selbstmord!
Nein, Papa, meine Gedankenwelt ist eine ganz andre als die eure – ich glaube kaum, daß ich Pfarrer werde! Gib du, mein treuer Gott, daß ich immer ein Priester im höheren Sinne des Wortes bleibe!
Heißt denn »Gott dienen«: ein elsässischer Dorfpfarrer werden? Oder überhaupt Geistlicher werden?! »Gott dienen« heißt, an der Hand der göttlichen Gebote mittels des Evangeliums sich selbst erkennen und richtig stellen, richtig im Verhältnis zu Gott, zu den Menschen, zum eigenen Gewissen. Dies muß jeder Mensch tun. Nun aber, nachdem du dich erkannt, suche deine Neigungen in irdischer Beziehung, deine Individualität, zu klären und auszubilden. Dann erfüllt sich das Wort: » ein Geist, aber mancherlei Gaben«.
Ich bin »Gott geweiht worden«, sagt Papa; freilich, aber in obigem Sinne, nicht in dem mittelalterlichen Sinne von »ins Kloster gehen«, oder in dem alttestamentlichen Begriff von »am Tempel dienen«. Der Tempel von heute ist ein geistiger, die Gottgeweihten von heute sind nicht mehr äußerlich »gottgeweiht« als Tempeldiener, Priester, Mönche, sondern sind geistige Priester in unendlich höherem Sinne.
Büst, im Lothringer Hochland. 6. März.
Wieder in den Ferien, wieder im lieben Hochland! Wie rasch die Zeit verfliegt, wie voller geistiger Arbeit, Gedanken, Pläne!
Am letzten Sonntag in Straßburg war ich in Neßlers Oper »Otto der Schütz«. Obwohl mir die Musik stellenweise wenig gefallen, manche lyrische Partien ausgenommen, so begeisterte mich's doch, wie der Komponist wiederholt herausgerufen und mit Lorbeerkränzen und Beifallsrufen überschüttet wurde.
Nun bin ich hier im lieben stillen Büst und ruhe mich geistig und körperlich aus von all diesem wirren Treiben der Stadt. So ein friedlicher Sonntag hier, wo wir alle in der Stube sitzen, draußen im Dorf und hier im Hause Ruhe, und auch in jeder Brust ein himmlischer Friede, jedes über seiner geistlichen Lektüre! Im Ofen summt das kochende Wasser, die Hähne im stillsonnigen Dorf krähen, einzelne Vögel singen dem Frühling entgegen, und alle Herzen sind so feierlich, so sonntäglich gestimmt.
Wie wohl mir diese Ruhe, diese Erholung und Sammlung tut! Mein Herz kann sich wieder auf sich selber besinnen, kann mitten in diesem friedlichen Kreise bei meinen lieben Großeltern sich klären und stärken zu neuer Arbeit.
Ich hatte vor, mein verbranntes Trauerspiel hier wieder anzufangen. Aber alles ist mir hier zu idyllisch, um die Entstehung einer leidenschaftlich glühenden Tragödie zu begünstigen.
7. März.
»Naphtali« angefangen!
Bei Pfarrer Wagner gewesen, im Walde da unten umhergestreift, genieße die frische Hochlandsluft und das süße Nichtstun in vollen Zügen, lebe kolossal äußerlich und natürlich drauflos, esse gut, schlafe gut und freue mich behaglich meines Daseins.
12. März.
Erste Szene des »Naphtali«, bedeutend verändert und hoffentlich verbessert, zu Ende gebracht. Glückauf!
Heute, Montag, den 14. März, Anfang der zweiten Szene. Heute nachmittag wohlbehalten nach Schillersdorf zurückgekehrt.
Schillersdorf, 19. März.
Die Sache ist also entschieden: ich studiere fortan Geschichte und Literatur. Das nächste Semester werde ich nicht, wie ich vorhatte, in Leipzig, sondern noch in Straßburg zubringen. Die Exmatrikulation muß rückgängig gemacht werden. (Im Herbst 1887 ging ich dann auf zwei Semester nach Berlin.) Wollte Gott, daß ich mich nun ganz auf das werfe, was so lange mein Lieblingsstudium war! Daß ich mit einer Wut studiere, denke, sinne, mit einer Energie und Ausdauer, ja fast Einseitigkeit! ...
Überall, wo ich hinkomme – Bischheim, Büst, Schillersdorf – Aufregung wegen meiner Umsattelung. »Fritz wird nicht Pfarrer?!« Ungeheure Neuigkeit für unsre kirchlichen Kreise! Und wahrlich, es ist kein kleiner äußerer Bruch mit meiner Umgebung. Jene Kinderzeit voll leidenschaftlich inniger Liebe – wie war sie selig, so selig! O ihr Erinnerungen, ihr Träume! Das schöne, stille Hochland, diese liebe Ecke, all meine Freunde und Bekannte – alle, alle verlassen, und draußen leben und schaffen! Fürwahr, der an sich unbedeutende, aber von meinen Großeltern abergläubisch gedeutete Zufall, daß dort plötzlich mein Bild von der Wand gefallen, hat eine tiefe Bedeutung. O Jugendliebe! ...
Einstweilen ist die Losung: schaffen, denken, forschen, sinnen, dichten und wieder schaffen! Gelesen habe ich fast nichts, die köstlichen » femmes savantes« ausgenommen. Wenn's geht, so bleibe ich stud. theol. und stud. phil. zu gleicher Zeit.
Wenn ich nur das Praktische nicht aus den Augen verliere und den Examinibus mit Macht zustrebe! Ich huldige allzusehr einseitiger Ideologie, lebe und atme in höheren Regionen, so daß ich manchen Strauß mit meinem das Praktische betonenden Vater auszufechten habe.
Charfreitag 1887.
Der stille Todestag des Herrn! Ich bin zum hl. Abendmahl gegangen, habe die stärkende Himmelsspeise genossen und danke Gott und meinem Versöhner dafür. Laß mich immer dein bleiben, Herr Jesu, und bleibe auch du immer bei mir bis an der Welt Ende!
Heute morgen war der Himmel trüb und bedeckt; heftiger, trockener Sturmwind; am Nachmittag brach die Sonne durch. Und nun liegt da draußen auf Flur und Wald und Dorf der heiterste, friedlichste, windstillste Frühlingsabend!
Das sind die ersten Osterfeiertage, seit langen Jahren, die ich nicht in Büst, sondern zu Hause zubringe. Dieser ruhige Abend, diese stille Abendröte weckt eine tief innere Wehmut in mir. O die alte, schöne Zeit! Jetzt ist Freund Heinrich dort im Hochlandsdorf und steht beim hl. Abendmahl am Altar! Vor einem Jahre sahen meine Großeltern dort mich voll Freude im Pfarr-Rock! Wie ganz anders kommt es nun!
Dieser abendliche Charfreitagsfrieden will mir fast bange machen, wieder in die wilden Strömungen der Zeit hinauszutreten. Möcht' ich immer, immer meinen Glauben behalten! Nun werden wohl meine lieben Großeltern und M. (Waldfrau) und Heinrich miteinander spazierengehen oder sich am Fenster des lieblichen Abends erfreuen – wohlgeborgen, räumlich und geistig, in ihrem Dorf und im Frieden des Christentums, wie auf einem Inselparadies, um das fernher die Brandung, die ruhelose Brandung tost.
Mir aber summt ein Vers von Martin Greif im Kopf:
Sturm, gestillt zu leisem Hauch,
Welch ein Abendfrieden!
Wär' einst meinem Leben auch
Solch ein End' beschieden!
Ende des Tagebuchs.