
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
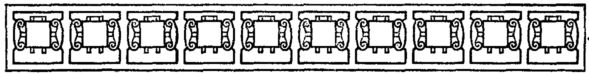
Als ich durch die wechselnden Witterungen des elsässischen Hügellandes ins Gymnasium marschierte, wußte ich noch wenig von den bedeutsamen Beziehungen, die unser ehemaliges Residenzstädtchen mit der Blütezeit der deutschen Dichtung verbanden.
Im Jahre 1884 ward das neue Gymnasialgebäude vollendet: auf den Fundamenten des ehemaligen Schlosses. Ich saß dort noch ein Jahr und erledigte dann die Abgangsprüfung unter dem hochbegabten Direktor Deecke, den des Statthalters Ungnade in unsre Ecke gebannt hatte.
Buchsweiler ist ein reizvoll altertümliches Städtchen an den Ausläufern des Bastberges, ungefähr in der Mitte zwischen Zabern und der alten Barbarossapfalz Hagenau. Zu Häupten der kleinen Stadt erhebt sich, gemächlich ansteigend, der kahle Kegel des genannten Berges, dessen graugelber Kalkstein, an seinen Hängen mit Reben bewachsen, gänzlich von dem roten Sandstein des nahe vorüberlaufenden Wasgaugebirges verschieden ist.
Dieses Landstädtchen war um die Mitte des 18. Jahrhunderts Wohnort der Erbprinzessin Karoline von Hessen-Darmstadt, der späteren »großen Landgräfin«. Sie war eine geborene Prinzessin von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld und seit ihrem zwanzigsten Jahre (1741) vermählt mit dem Darmstädter Erbprinzen, der von seiner Mündigkeit ab regierender »Graf von Hanau« genannt ward. Noch jetzt heißt unsre anmutige Hügelgegend »das Hanauer Land«.
In eben diesem Buchsweiler wohnte also Jahre hindurch jene Fürstin, eine der rühmlichsten Frauengestalten des 18. Jahrhunderts. Der Erbprinz selbst hielt sich, auch später, fast immer in Pirmasens bei seinen Soldaten auf; die gute, kluge, charaktervolle Frau war auf selbständiges Handeln angewiesen. Das Schloß ist heute verschwunden; auf seinen Grundmauern wurde, wie gesagt, unser neues Gymnasium erbaut; rings herum sind in den inzwischen aufgeteilten Gärten noch Spuren von dem ehemaligen im Versailler Stil gehaltenen Schloßpark bemerkbar. Langsam verfließt jetzt das Leben in jenem stillen Städtchen; wir Gymnasiasten hatten kein Bewußtsein von der Tatsache, daß unsre Schulbänke auf der Stelle standen, wo einst – Herzogin Luise von Weimar ihre Kinderjahre verlebt hat!
Denn die Gemahlin Karl Augusts von Sachsen-Weimar-Eisenach war eine Tochter jener Erbprinzessin.
Dadurch aber wiederum zogen sich Fäden von unserem kleinen Buchsweiler nach Sanssouci und Berlin. Denn Luise war in Berlin geboren (20. Januar 1757). Der Darmstädter Erbprinz, eine soldatische Natur, war 1750 nach Prenzlau in der Uckermark übergesiedelt, um unter Friedrich dem Großen ein Regiment zu übernehmen. Seine Gattin war ihm dahin gefolgt. Es entspannen sich freundschaftliche Beziehungen zum preußischen Königshause, besonders zur Prinzessin Amalie, Friedrichs Schwester, mit der die Erbprinzessin auch während des Siebenjährigen Krieges in lebhaft teilnehmendem Briefwechsel blieb. Bei Ausbruch des Krieges war freilich ein Zwiespalt entstanden: der alte Landgraf in Darmstadt war österreichisch gesinnt und verlangte die Heimkehr des Sohnes. Dieser beharrte noch bis Herbst 1757; dann kehrte er in sein Pirmasens zurück und Karoline in ihr Buchsweiler.
Zu Prenzlau und Berlin waren dem erbprinzlichen Paare mehrere Kinder geboren worden, darunter die genannte Prinzessin Luise, deren Paten und Patinnen vom königlichen Hause gestellt wurden. Da waren die regierende Königin nebst Königinwitwe, die Prinzessinnen Heinrich und Ferdinand, Prinzessin Amalie und die Markgräfin von Schwedt (eine andere Schwester des Königs), nebst dem zufällig anwesenden Prinzen von Preußen. Das Herz der künftigen Landgräfin Karoline war begeistert friderizianisch. »Auf ihre kräftige und gesunde, für echte Größe empfängliche Natur übte vor allem die Persönlichkeit Friedrichs II. einen Zauber aus. Sie erkannte in ihm den einzig dastehenden Genius und brachte ihm in diesem Gefühl als ihrem Heros aufrichtige Huldigungen dar. Friedrich bekundete seinerseits durch freundschaftliche Aufmerksamkeiten sein Verständnis für ihre Individualität und bewahrte ihr eine warme Hochachtung, die noch in späteren Jahren durch seine Teilnahme an ihrem und der Ihrigen Schicksal einen tatkräftigen Ausdruck finden sollte. Der Fürstin Herz war und blieb der preußischen Sache gewonnen, ›unsere Sache‹, wie sie in vertraulichen Briefen an Prinzessin Amalie sie bezeichnete.« (E. v. Bojanowski, Luise, Großherzogin von Sachsen.)
Als nun der preußische Thronfolger (Friedrich Wilhelm II.) seine Ehe trennen mußte, erinnerte sich der Einsiedler von Sanssouci der vortrefflichen Mutter vieler Töchter und erbat sich Karolinens zweite Tochter für den preußischen Thron. So wurde die Schwester der Herzogin Luise von Weimar – Friederike – Königin von Preußen. »Ich gestehe Ihnen offen,« schreibt Friedrich II. selber, als er diesen Entschluß für seinen Thronfolger der Landgräfin mitteilte (1769), »der vortrefflichste Eindruck, den mir die Mutter gemacht, hat einzig und allein veranlaßt, daß unsere Wahl auf die Prinzessin, ihre Tochter, gefallen ist.«
Noch nicht genug damit! Die Verknüpfungen werden noch merkwürdiger. Des Erbprinzen jüngerer Bruder Georg, also der Schwager unserer berühmten Karoline, vermählte seine älteste Tochter nach Mecklenburg-Strelitz; aus dieser Ehe entstand gleichfalls eine Luise. Sie wurde später bei den Verwandten in Darmstadt aufgezogen, lernte von da aus in Frankfurt den preußischen Kronprinzen, späteren Friedrich Wilhelm III., kennen und wurde – Königin Luise.
Eine Herzogin von Weimar und eine Königin von Preußen haben also ihre Kinderjahre zu Buchsweiler im Elsaß verlebt.
Sie hatten einen zwanglos vertrauten Umgang mit der Mutter, die ihre Kinder frei und unverzärtelt, fest und fromm erzog. Es war, von der Zeitrichtung abweichend, ein menschlich natürliches Verhältnis. Kleinliche Engherzigkeit lag der Fürstin fern; sie war religiös, aber sie war auch befreundet mit Geistern der Aufklärung, z. B. Baron Grimm, und war durch eine tiefe und gesunde Seele vor der Einseitigkeit jenes Zeitalters bewahrt. Dieser Geist, der poetischen Natursinn und Religiosität in Einklang zu bringen suchte, verbreitete sich später auch in Darmstadt. Dorthin siedelte die Erb- Prinzessin im Jahre 1766 über, nachdem sie acht Jahre (1757–1765) mit ihren Kindern in der Buchsweiler Landstille gewohnt hatte. Von 1768 ab bildete recht eigentlich sie selber – leider nicht viele Jahre – den Mittelpunkt des Darmstädter Hofes. Der alte Landgraf war gestorben; und der nunmehrige Landgraf Ludwig IX. konnte sich auch jetzt von seinem Pirmasens nicht trennen. Es ist inzwischen ein gründliches Buch erschienen, das diese Dinge behandelt: Pirmasens und Buchsweiler, Bilder aus der Hessenzeit der Grafschaft Hanau-Lichtenberg. Von Karl Esselborn (Friedberg 19l7).
Dieser Darmstädter Hof schien nun gleichsam ein erstes Sammelbecken für den neudeutschen Literaturgeist werden zu wollen: ein Vor-Weimar.
Hier schätzte man vor allem Klopstock. Die Landgräfin war die erste, die eine Sammlung und Veröffentlichung seiner Oden veranlaßt hat. Hier schätzte man auch Lavaters Frömmigkeit; versuchsweise wurde hier auch Claudius angesiedelt (1776). Hier weilte der Elsässer Leuchsenring, eine echte Zeiterscheinung, vorweimarisch, noch nicht das Ganze erfassend, Schöngeist in Georg Jacobis weichanmutiger Manier. Hier der derbere Kriegsrat Merck, erst mit Herder, später und enger mit Goethe befreundet, ein ungleicher und nicht glücklicher Charakter, aber energischer Anreger. Und hierher kam 1770, als Reisebegleiter eines Prinzen von Holstein-Eutin, der bereits durch mehrere Schriften bekannte Johann Gottfried Herder.
Und wieder spinnen sich nun Fäden nach dem Elsaß. Denn in Darmstadt wohnte eine junge Elsässerin aus Reichenweier (Oberelsaß): Karoline Flachsland. Mit ihr zog ein Stück Elsaß nach Weimar selbst hinüber: sie wurde Herders Gattin.
In demselben Herbst 1770 ritt im Elsaß ein junger Studiosus manchen Ritt hinaus zu einer anderen Elsässerin: zu Friederike Brion.
Der studentische Freund aber, dem Goethe die Bekanntschaft mit der Sesenheimer Pfarrfamilie verdankte – Weyland –, war aus Buchsweiler. Aus Buchsweiler war auch der Student der Theologie Franz Lerse, dessen Name im »Götz« verewigt worden; er wurde nachher Subdirektor an Pfeffels Militärschule zu Kolmar. Mit Weyland und einem andren Unterelsässer, Engelbach, bereiste Goethe in demselben Sommer 1770 das nördliche Elsaß, übernachtete – von Zabern herkommend – in Buchsweiler und bestieg den Bastberg.
»Dieses Städtchen«, so berichtet er über Buchsweiler in Dichtung und Wahrheit, »war der Hauptplatz der Grafschaft Hanau-Lichtenberg, dem Landgrafen von Darmstadt unter französischer Hoheit gehörig. Eine daselbst angestellte Regierung und Kammer machte den Ort zum bedeutenden Mittelpunkt eines sehr schönen und wünschenswerten fürstlichen Besitzes. Wir vergaßen leicht die ungleichen Straßen, die unregelmäßige Bauart des Ortes, wenn wir hinaustraten, um das alte Schloß und die an einem Hügel vortrefflich angelegten Gärten zu beschauen. Mancherlei Lustwäldchen, eine zahme und wilde Fasanerie und die Reste mancher ähnlichen Anlagen zeigten, wie angenehm diese kleine Residenz ehemals müsse gewesen sein. Doch alle diese Betrachtungen übertraf der Anblick, wenn man von dem nahegelegenen Bastberg die völlig paradiesische Gegend überschaute. Diese Höhe, ganz aus verschiedenen Muscheln angehäuft, machte mich zum ersten Male auf solche Dokumente der Vorwelt aufmerksam; ich hatte sie noch niemals in so großer Masse beisammen gesehen. Doch wendet sich der schaulustige Blick bald ausschließlich in die Gegend. Man steht auf dem letzten Vorgebirge nach dem Lande zu; gegen Norden liegt eine fruchtbare, mit kleinen Wäldchen durchzogene Fläche, von einem ernsten Gebirge begrenzt, das sich gegen Abend nach Zabern hin erstreckt, wo man den bischöflichen Palast und die eine Stunde davon liegende Abtei St. Johann deutlich erkennen mag. Von da verfolgt das Auge die mehr schwindende Bergkette der Vogesen bis nach Süden hin. Wendet man sich gegen Nordost, so sieht man das Schloß Lichtenberg auf einem Felsen, und gegen Südost hat das Auge die unendliche Fläche des Elsasses zu durchforschen, die sich in immer mehr abduftenden Landschaftsgründen dem Gesicht entzieht, bis zuletzt die schwäbischen Gebirge schattenweis in den Horizont verfließen.«
So wurde dieses bescheidene Buchsweiler, worin aber eine Herzogin von Weimar und eine Königin von Preußen ihre Kinderjahre verlebt haben, auch durch Goethes Schilderung geweiht. Fünf Fahre nach des Dichters Aufenthalt hielt Luise in Weimar Einzug (17. Oktober 1775); und einen Monat danach (7. November) Goethe selber.
Vorerst kehrt er auf Umwegen (Lützelstein, Saarbrücken, Niederbronn) nach Straßburg zurück, wo wenige Wochen später (Anfang September 1770) Herder ankommt.
Auch diese Begegnung im Gasthof zum Geist mit all ihren Folgen und Früchten hat uns Goethe ausführlich erzählt. Und so ward die fruchtbringendste Beziehung, die sich für die damalige Literatur überhaupt denken läßt, im Elsaß vollzogen.
Nun geht das oben aufgezeigte Fadenwerk immer noch weiter. Herder wird durch Goethes Vermittlung aus Bückeburg nach Weimar gerufen (1776); er wird in Thüringen samt seiner elsässischen Gattin eine Seelenkraft, besonders im Freundschaftsverhältnis des Herderschen Hauses zur anfangs einsamen, ernsten, innerlichen Herzogin Luise. Auch Schiller, ein Spätling in dieser ganzen Bewegung, streift den Darmstädter Hof. Charlotte von Kalb, seine Freundin, ruft ihn von Mannheim herüber und stellt ihn am Hofe vor (1783), als gerade der Herzog von Weimar anwesend war; im erbprinzlichen Palais liest Schiller etliche Teile seines »Don Carlos« und erhält nach einer folgenden Unterredung mit dem Herzog den »Charakter als Rat«, einen Titel nur, aber einen ersten Gruß aus dem spät und langsam zu erringenden weimarischen Gelände.
Im Jahre l783 schenkt Herzogin Luise von Weimar ihrem ersten Sohne das Leben: Karl Friedrich. Dieser Erbprinz von Weimar wird l804 mit Maria Pawlowna vermählt, wozu bekanntlich Schiller die »Huldigung der Künste« gedichtet hat. Dieses Paares Tochter (1811 geboren), also die Enkelin jener Luise, die ihre Kinderjahre in unserem Buchsweiler verbracht hat, ist Prinzessin Augusta: sie wird die erste deutsche Kaiserin.
Die köstliche Symbolik all dieser Verschwisterungen und Beziehungen kann kaum noch überboten werden. Zumal wenn man im Auge behält, daß auch der erste deutsche Kaiser gleichsam durch Darmstadt hindurchgegangen ist: Wilhelm I. war ja der Sohn der Königin Luise. Und diese war, wie wir sagten, mütterlicherseits eine Enkelin eines jüngeren Darmstädter Prinzen, des Schwagers der großen Karoline.
So haben sich Weimar und Hohenzollern, Elsaß und Thüringen miteinander versponnen. Es ist, als ob dieser Bund zwischen Preußen und dem Süden, beide sich treffend in der thüringischen Mitte, ein Sinnbild wäre für die Einigung deutscher Kultur und Politik überhaupt.
Es sei zum Schluß noch eine reizvolle Tatsache erwähnt, die das Symbolische dieser Beziehungen anschaulich auf einen engen Raum drängt. Im März 1793 hatte sich Kronprinz Friedrich Wilhelm (III.) mit Prinzessin Luise im »Weißen Schwan« zu Frankfurt a. M. verlobt. An derselben Stelle schlossen 78 Jahre später die Vertreter des Sohnes der Königin Luise, Kaiser Wilhelms I., den Frankfurter Frieden ab (10. Mai 1871), der unser Elsaß-Lothringen dem Deutschen Reiche zurückgab.
Wenig von diesen wundersamen Verflechtungen war damals dem Dorfknaben bekannt, der noch in der Hülse des Schülertums steckte. Er seufzte unter dem Drill der Gegenwart, labte sich an Büchern und Träumen, erwarb auch schließlich die Zufriedenheit seiner Lehrer und freute sich auf den Tag, wo all diese kleinstädtische Enge gesprengt wurde.
Welch ein Aufatmen, als die Abgangsprüfung leicht und gut bestanden war!
Auf einem Acker hinter dem Schulhause ward ein Feuer entfacht; Grammatik und andre unbeliebte Schulbücher loderten in Flammen auf; und der angehende Student stieß mit einer Bohnenstange wuchtig und wonnevoll in das Freudenfeuer, damit nur ja alles Vergangene reinab in Asche verwandelt würde.
Das Tor in die Weite war offen.
Heute mag man, zumal in der Stadt, schwerlich nachempfinden können, wie leidenschaftlich dieser Übergang in die Freiheit vom Schulmeistersjungen empfunden wurde. Es flogen damals weder Rad noch Eisenbahn so leicht wie heute vom Land in die Stadt. Taschengeld war spärlich. Bis zum Abiturientenexamen, also fast bis zum zwanzigsten Lebensjahre, hatte ich ein einziges Mal ein Theaterstück gesehen, nämlich im Straßburger Stadttheater Webers »Freischütz«. Allerdings waren wir durch unsre französischen Verwandten bis nach Lunéville und Nancy vorgedrungen; Straßburg im Osten, Zabern nebst Pfalzburg in der Mitte, nach Norden die Waldburgen hinter Niederbronn und Mattstall, nach Süden der weihevolle Odilienberg: das war der Kreis meiner Fahrten. Aber was in der Mitte lag, stellte keine pulsierende Geselligkeit dar; es war vielmehr ein abgenutztes Einerlei in Dorf und Kleinstadt mit dem entsprechend eingeengten Gesichtsfeld.
Der köstliche Besitz der freien Natur, aber auch das Kleinliche dieses Gemeinwesens, beides war nun gründlich eingesogen und verarbeitet. Weiter nun zu neuen Ufern und Aufgaben!
Es gab dort niemanden, wie ich schon mit Bedauern festgestellt habe, der mir über Wesen und Walten eines Schriftstellers und Dichters hätte Auskunft geben können. Mit meinen Lehrern verband mich keine vertrauliche Aussprache. Vom Zeitungswesen machte man sich auf unsren Dörfern eine etwas merkwürdige und ziemlich windige Vorstellung: denn lief nicht ein früherer Schulmeister manchmal als Reporter durch unsre Ecke und notierte fürs Blättel Unglücksfälle und andre dörfliche Weltereignisse? Das war nämlich »d'r Herr Hummel vun Buswiller«. In dieser Richtung ungefähr mußte wohl auch die Schriftstellerei überhaupt zu suchen sein. Und als später die Bauern vernahmen, daß ich »an einer Zeitung angestellt« sei, dachten sie einmütig an den Herrn Hummel von Buchsweiler und schüttelten bedenklich den Kopf.
Mir hatte sich der Begriff Schriftsteller schon in Knabenzeiten äußerst eindrucksvoll und bleibend veranschaulicht. Wenn man im Wald hinter dem Karlssprung-Felsen bei Zabern ins kleine Schlettenbachtal hinuntergeht, so findet man dort eine Villa geheimnisvoll eingenistet. Sie kehrt dem Waldweg die fensterlose Rückseite zu, liegt etwas tiefer und kann eigentlich vom Weg aus mehr geahnt als betrachtet werden. Durch das Holzgatter erspäht man im Garten einen Teich, allerlei wertvolle Nadelbäume, vorn auch einen Springbrunnen und überhaupt einen eigentlich nicht großen, aber zauberhaft stillen Park, den von drei Seiten Laubwald umrahmt. Aus dem Zorntal, doch in gemessener Entfernung, donnert manchmal die Gegenwartssprache der Eisenbahn in dieses Traumland herüber; die Glocken von Zabern, wo einst ein Rohan als Bischof gesessen und einen Cagliostro empfangen hat, hallen herein und verfangen sich im ausgangslosen Tal. Man sieht von unten einen hübschen Ausschnitt aus dem Zaberner Stadtbild. Aber alles ist ruhevoll; kein Weltgeräusch beeinträchtigt dieses entzückende Waldidyll.
Ich meine die Villa About. Dort wohnte im Sommer – so erfuhr der Knabe – der Pariser Schriftsteller Edmond About; er war mit Napoleon III. befreundet und stammte aus Elsaß-Lothringen. Im Jahre 1870 versteckte er unter den Felsen des oberen Parkes, die heute noch rauchgeschwärzt sind, flüchtige Turkos; er selbst eiferte so heftig gegen die deutschen Sieger, daß er verhaftet wurde, eben als er aus dem hinteren Türmchen zu entweichen im Begriff stand. Jenes Türmchen war damals noch durch einen schmalen Steg mit dem Waldweg verbunden; die Tür hatte ein blaues Fensterchen; alles mutete den Knaben unsagbar romantisch an – romantisch und zugleich unnahbar. Es war ein Klang aus der großen, vornehmen Welt der Freiheit und Schönheit, nach der ich armer Bursche die Sehnsucht immerzu wie ein Heimweh im jungen Herzen trug.
Zugleich blieb diese Waldwohnung, die später ein Zaberner Photograph für billiges Geld erstanden hat, wie ein verwunschenes Schloß oder unerlöstes Dornröschen in einem Winkel meiner symbolisch arbeitenden Einbildungskraft. Es war ein Sinnbild der elsässischen Frage; man wußte nicht recht, wie eigentlich diesem Hause, das nicht mehr französisch war, eine Seele zu schaffen sei; es wechselte fortwährend seine Mieter. In eben jenem Zabern brach dann vor einigen Jahren jene gehässige Straßenrevolte durch, ein Sinnbild der elsässischen Krankheit. Die französische Vergangenheit wühlte noch im elsässischen Blute und war bei manchen ein ätzendes Gift geworden; bei einzelnen Reizungen brach sie aus. So verwuchsen im Laufe meines nicht leichten Lebens drei Aufgaben oder Sorgen mit meinem Wesen und gestalteten sich zu dem, was ich als Lebenswerk empfinde: die Arbeit an der eigenen Gesamtbildung und Höhersteigerung, die Einfügung unsres Elsasses in die deutsche Kultur, und der Ausbau unsrer deutschen Reichsseele im Sinn eines künstlerischen und religiösen Idealismus. Es sind drei konzentrische Ringe.
Vorerst winkte der ausziehende Jüngling dem Hügelstädtchen Buchsweiler einen Abschiedsgruß zu.
Ich habe in diesen Blättern die altertümliche Anmut dieser ehemaligen Residenz nicht liebevoll genug behandelt. Aber Goethes Entzücken wird jeder teilen, der einmal in günstiger Jahreszeit und Beleuchtung vom Gipfel des Bastberges aus das Land ins Auge faßt. Ein Braunkohlenbergwerk raucht zwar an jenen Hängen; und der Berg hat überflüssig viel Gestein in den Schollen seiner Rebstücke. Aber die Aussicht in diese behagliche, satte Landschaft, in diesen wirtschaftlich wohlausgenützten Wechsel von Wald, Feld und Wiesen mit den schönen, weißen, pappelumsäumten Straßen aus napoleonischer Zeit – das ist unvergeßlich. Und wieviel freundliche Gärten umrahmen das Städtchen! Auch ist die Umgebung verlockend. In einer Stunde ebenen Weges ist man drüben in Neuweiler, am Fuße des langen Herrensteins, und gleich danach in Dossenheim, durch dessen Tal, die vielgewundene Zinsel entlang, wir so oft ins Hochland emporgewandert sind. Lichtenberg, Bastberg, Hohbarr: dieses Dreieck bezeichnet mein engeres Jugendland. Wobei ich freilich gestehe, daß ich den waldlosen, nur von Nutzbäumen und heißen Reben umstandenen, dem Philistertum allzu nahen Bastberg am wenigsten bestiegen habe. Der Wald war mein Lieblingsgelände von früh an.
Im übrigen hatte Buchsweiler etwas wie ein Residenzgeschmäckle, vornehmer als das benachbarte Ingweiler. Es wohnte da in einzelnen ehrwürdigen, respektvoll von uns Schülern betrachteten Häusern mancher Mann von altem Namen, der zu den Honoratioren zählte, ein Ehrmann, Hartmann oder Kellermann, ein Petri oder Pfersdorff. Ein Gendarmerieoffizier des letzteren Namens, aus Buchsweiler stammend, hatte einst mit seiner Abteilung den unglückseligen Herzog von Enghien auf Napoleons völkerrechtswidrigen Befehl in Baden gefangengenommen. Auch gibt es in den buckligen Gassen malerische Winkel, sei es in der Herrengasse oder auf dem Kornmarkt, sei es unten am Wasser hinter dem Schloßhof oder oben in den Nischen um die Kirche herum. Bis in die siebziger und achtziger Jahre lebten noch allerlei Originale aus älteren Zeiten und gingen verwittert im Städtchen um; die schon erwähnte Marie Hart, eines bekannten Apothekers Tochter, hat solche Gestalten und Stimmungen in ihren reizenden kleinen Bildern voll Gemüt und Humor nachgezeichnet. Auch weiß unser Sammler Stöber von jener Bastberglandschaft viele Sagen zu erzählen. Es ist ein Hexenrevier; und eine lebendige Hexe hat ja einst als Geliebte des Grafen Jakob von Lichtenberg auf dem Schloß gehaust, bis sie im »Buchsweiler Weiberkrieg« vertrieben ward.
Die Schlußfeier und Abiturienten-Entlassung endete mit einem Mißklang. Ich habe an jenem Tage eine nicht eben liebenswürdige Notiz niedergeschrieben, die sich noch unter meinen Papieren findet:
»So liegen diese elf Jahre eines mühseligen, unfreien, langweiligen, erschlaffenden Gymnasiallebens hinter uns! Und dieses Zeugnis, das ich da in der Hand halte, ist also ein Urteil meiner Herren Lehrer über meine Fähigkeiten, meine Leistungen und Kenntnisse? So viel kann ich daraus ersehen: auf kleinliche, äußere Form habe ich weniger geachtet als auf den Inhalt; Grammatik und Mathematik waren mir verhaßt. Heute war Schlußfeier. Meine Kameraden kamen mir mit der Kunde entgegen, einige von ihnen seien Freitag abend nach der öffentlichen Prüfung im Wirtshause ertappt worden, und zwar von Lehrer T. Sie hätten gleich zum Direktor gewollt, aber rennend im Sturmschritt sei ihnen T. zuvorgekommen: ›Herr Direktor, ich muß Sie sogleich sprechen! Wichtige amtliche Angelegenheit!‹ Der Direktor (Deecke) natürlich weiß nicht, was tun. Zürnend erwähnt er es öffentlich in der Abschiedsrede an die Abiturienten, nimmt aber als edler Charakter ebenso freundlich von uns Abschied, als er es ohne das getan hätte. Herr Oberlehrer P., unser Ordinarius, war sehr betrübt: ›Warum haben Sie das mir getan?!‹ Allgemeine Wut gegen T. Stillschweigend geben wir einander die Hand und gehen heim, ohne irgendwie einen Abschiedsschoppen zu trinken oder uns aufzuhalten. – Mein Hauptbestreben in diesen Ferien soll sein: Förderung und Pflege meiner sehr daniederliegenden Gesundheit. Und dann allmähliches Eindringen in das Studium: in die Theologie. So1i Deo Gloria!«
Das Schicksal liebt manchmal Neckereien. So führte es mir einmal später diesen Professor T. in den Weg, mit dem ich übrigens in den oberen Klassen recht gut ausgekommen bin; er war Berliner Israelit, hatte von Rauhbeinen manches auszustehen, war aber ein überaus fleißiger und gewissenhafter Lehrer. Etwa zwanzig Jahre nach dieser unschönen Schlußfeier stand ich mit einem befreundeten Ehepaar in Lugano an einem Schaufenster; schon dunkelte Dämmerung, ein milder Maienabend, und in den Schauläden blitzten die ersten Lichter. Kommt ein unscheinbarer Mann im Lodenhütchen und goldener Brille auf mich zu, grüßt höflich und fragt auf italienisch: » Scusi, signore, dove è l'Albergo Americano?« Ich erkenne ihn auf den ersten Blick und erwidere deutsch: »Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, Herr Professor.« In seiner Zerstreutheit bemerkt er weder mein Deutsch noch meine Anrede, sondern dankt abermals italienisch: » Scusi, signore« und will sich entfernen. Ich muß ausdrücklich seinen Namen nennen: »Sie sind doch Herr Professor T., nicht wahr?« und füge meinen eigenen Namen hinzu. Da blitzt er herum: »I, is nich möglich!«, wird meinen Freunden vorgestellt, und wir verabreden einen Abendtrunk im Hotel Walther. Dort lad' ich die Gesellschaft zu einer Flasche Asti spumante ein und spreche beim ersten Glas ein paar Worte des Dankes an meinen ehemaligen Lehrer: »Ich hab' Ihnen einst viel Mühe gemacht, Herr Professor.« Mein Freund läßt eine zweite kommen und äußert einen schicklichen Trinkspruch; Professor T., der von Pästum und Süditalien schöne Eindrücke mitbrachte, eine dritte. Als er die Gläser gefüllt, räusperte er sich feierlich – ganz mein alter Lehrer, wie er in wichtigen Augenblicken vor der Klasse stand, als er mich in Tertia dumm und faul, in Obersekunda hochbegabt nannte – und sprach das stolze Wort: »Ich sage bloß: er war mein Schüler!«
Im übrigen will ich nicht undankbar an die Tage des Drills zurückdenken. Ich hatte meine leichtsinnigen Epochen; und mein getreuer Nachbar Karl Oschmann »präparierte« meist gewissenhafter als ich und half listig aus, wenn ich »dran kam«. Meine lässige Sicherheit täuschte die Lehrer über den Umfang und die Gründlichkeit meines Wissens, das einerseits viel bedeutender war, als sie wußten, andrerseits in einfachsten Dingen versagte. Im ganzen waren wir frohgemut.
Gern gedenke ich einiger Schulausflüge, wo unsre Lehrer etwas menschlicher und wärmer wurden. Gab es eine wonnigere Labe, als etwa auf den Felsen des Hohbarr zu sitzen, in der Rechten eine »Knackwurst« und in der Linken ein »Soubrot«, vor sich aber eine rosenrote »Framboise«, die köstlichste aller Limonaden?
Einmal hatten wir einen solchen gemeinsamen Ausflug in einem Schulaufsatz zu erzählen; es war in Untersekunda. Ich verdanke hierbei dem betreffenden Lehrer des Deutschen eine bleibende Belehrung. Es war ein immer peinlich sauber gekleideter, etwas umständlicher Junggesell, der seine gemessenen, wunderlichen Redewendungen und Manieren wirksam anbrachte, dabei gerecht und sachlich. Ich glaubte eine vortreffliche Arbeit geschrieben zu haben; aber in aller Kühle tupfte Herr Oberlehrer B. mein Selbstgefühl herunter: »Lienhard, stehen Sie auf! Ich muß Ihnen sagen, Sie haben in Ihrer Arbeit drei schwere Fehler. Erstens sprechen Sie da von einem ›schattigen Wald‹. So? Schattig? Der Ausflug fand im Mai statt, der Wald war noch gar nicht sehr belaubt – also? Zweitens: ›blühender Klostergarten‹. Was soll das? Das Klostergärtchen auf Odilienberg ist nicht blühend, sondern ein bescheidener Nutzgarten mit allerlei Krautköpfen. Wie sagt Uhland? ›Im stillen Klostergarten‹ – still, sehen Sie wohl, das paßt auf ein Klostergärtchen. Aber blühend? Nein, lieber Freund! Das haben Sie gedankenlos hingeschrieben, aber es stimmt nicht.« So kam noch ein dritter Fall, den ich jetzt vergessen habe, und er schloß mit der Mahnung: »Achten Sie künftig in der Wahl der schmückenden Beiworte darauf, daß sie genau Ihrer Beobachtung und dem Gegenstand entsprechen! So. Nun setzen Sie sich!«
Ich setzte mich und schämte mich, denn der Mann hatte recht.
Einen Lebenslauf hatten wir vor dem Examen einzureichen. Hier wurde bereits der Zwiespalt berührt, der bald immer mächtiger und schmerzlicher mein Innerstes ergreifen sollte. »Allmählich« – so schrieb ich dort von meinem Knabenalter – »hatte ich für die Poesie Verständnis bekommen und vertiefte mich mit Begeisterung in die Werke eines Goethe, Lenau, Geibel, später besonders in Herders Volkslieder, in Kleists und Shakespeares Dramen. So oft und so eifrig las ich diese und andre Dichter und Schriftsteller, daß ich z. B. viele Oden Klopstocks und beinahe alle Lieder Goethes auswendig wußte. Wie oft vernachlässigte ich damals meine Schularbeiten aus übertriebener Liebe zu solchen Studien! Wie oft vernachlässigte ich die Pflege meines Körpers, indem ich lange Zeit hindurch den größten Teil der Nacht mit Lesen zubrachte und morgens matt und abgespannt in die Klasse kam! Daß es nicht beim bloßen Lesen blieb, sondern daß schon frühe in mannigfachen Produktionen jene geistigen Eindrücke verarbeitet wurden, ist leicht begreiflich. Je mehr dieses Phantasie- und Traumleben schwand, je mehr der Verstand in den Vordergrund trat, desto größere Freude fand ich an solchen Werken, die das Denken anregen. Anfangs waren es besonders Literaturgeschichten und ästhetische Schriften, die mir zusagten; ich war begierig, die inneren Gesetze und die Geschichte der Werke zu erfahren, die ich gelesen hatte; Vilmars Literaturgeschichte und Lessings Dramaturgie wurden meine Lieblingsbücher. In den oberen Klassen zogen mich Plato und Demosthenes besonders an. Auch mit der französischen Sprache und Literatur suchte ich durch eifrige Lektüre immer tiefer bekannt zu werden. In die Mathematik freilich konnte ich trotz aller Anstrengung nicht eindringen. Um so größere Teilnahme brachte ich dem deutschen Unterricht entgegen; das Anfertigen der deutschen Aufsätze gewährte mir stets besondren Genuß ...«
Daß ich in die feine und reine Kunst der geistschärfenden Mathematik nicht erfolgreicher eingedrungen bin, tut mir heute leid. Ich war darin von Natur nicht unbegabt, wie die Dorfschule und die unteren Klassen bewiesen; aber wir hatten auf den mittleren Stufen wechselnde und nicht gleich gute Lehrer; da entstanden Lücken. Und die Mathematik ist ein empfindliches architektonisches Kunstwerk; werden die Zwischenglieder vernachlässigt, so entsteht weiter oben, in der höheren Arithmetik, ein Wirrwarr.
Aber ich freue mich, daß mir damals schon der glänzende Charakterkopf Demosthenes das Herz höher schlagen ließ; und übrigens ebenso die granitene Prosa des Tacitus. Das Hochgebirge der griechischen Tragik war mir noch nicht zugänglich.
Mein Schriftstück versichert zum Schluß:
»An der Theologie habe ich, durch verschiedene Umstände zu ernsterem Nachdenken gebracht, erst in diesen Jahren Freude und Gefallen gefunden. Die Kirchengeschichte und ähnliche Bücher sind mir ebenso lieb und lieber geworden als früher die Literaturgeschichte. Und so kann ich es wohl aussprechen, daß ich nicht allein durch den Lieblingswunsch meines Vaters oder die letzte Bitte meiner sterbenden Mutter bewogen, sondern auch aus innerem Antriebe und aus Liebe zu religiösen Studien Theologie studieren werde.«
Diese Worte in einer pflichtgemäß zurechtgeschneiderten Eingabe an die Lehrerkonferenz des Gymnasiums sind zwar ehrlich. Aber es fällt dem Beobachter doch wohl auf, daß die Theologie erst in den Schlußsätzen anrückt.
Und so ist in diesem etwas steifleinenen Lebenslauf des unfertigen Gymnasiasten bereits der Kern des Konflikts enthalten, der mir jahrelang schwer zu schaffen gemacht hat. Ich meine den Gegensatz zwischen Theologie und Dichtung. Es ist zugleich der Seelenkampf zwischen strengem Amt und freier Abenteuerlichkeit, zwischen Pflicht und Phantasie – also zwischen zweien der wichtigsten Pole, die sich im Menschen bekämpfen oder ausgleichen.
Das amtliche »Zeugnis der Reife« besagte folgendes:
Er besitzt eingehende Kenntnisse in der deutschen Literatur, doch war er nicht ebenso eifrig bemüht, eine entsprechende Gewandtheit in der Darstellung sich anzueignen. Seine schriftlichen Arbeiten zeigten ernstliches Nachdenken, doch wußte er nicht immer das Richtige zu treffen und erreichte so nicht in allen das Prädikat gut. Die Probearbeit war gut. Gesamtprädikat: genügend.
Er hat sich schriftlich genügende, mündlich fast gut zu nennende Kenntnisse im Französischen angeeignet. Die in den Kreis der Schule fallenden Schriftsteller liest er ohne Schwierigkeit und übersetzt sie mit Verständnis und Geschmack. Die Aszensionsarbeit war indessen mangelhaft. Die mündliche Prüfung fiel gut aus. Gesamtprädikat: gut.
Er besitzt befriedigende Kenntnisse in der Grammatik, Stilistik und Phraseologie und übersetzt nicht zu schwere Stellen der Schulschriftsteller mit gutem Verständnis und Ausdruck. Die schriftliche und mündliche Prüfung fielen genügend aus. Gesamtprädikat: genügend.
Er besitzt die nötigen grammatischen Kenntnisse. Beim Übersetzen zeigte er ziemliche Gewandtheit; da es ihm jedoch mehr um den Inhalt als um die Form zu tun, wandte er nicht immer die nötige Genauigkeit an. Seine Aszensionsarbeit war genügend; ebenso fiel die mündliche Prüfung aus. Gesamtprädikat: genügend.
Bei mäßigen grammatischen Kenntnissen übersetzte er leichtere Stellen ziemlich gewandt; weniger leistete er im Analysieren der Formen. Prädikat: genügend.
Er besitzt sowohl hinlängliche Kenntnisse in den Einzelheiten des historisch-geographischen Unterrichts, als auch genügendes Verständnis für den Zusammenhang der Ereignisse. Die mündliche Prüfung fiel gut aus. Prädikat: genügend.
Er beteiligte sich am mathematischen Unterricht erst in der letzten Zeit mit dem notwendigen Fleiß und Eifer und hat dadurch die vorhandenen Lücken seiner Kenntnisse in genügender Weise ausgefüllt, wie auch seine schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistungen genügten. Prädikat: genügend.
Er zeigte für den Religionsunterricht stets lebhaftes Interesse, und seine Kenntnisse sind zu bezeichnen als gut. – –
Aus dieser gewiß wohlabgewogenen, mäßigen Anerkennung leuchtet klar hervor, daß ich kein besondres Schul-Genie war. Nebenbei aber auch, daß unsre Lehrer mit guten Zensuren überhaupt nicht eben spendefreudig gewesen sind: denn ich galt in den oberen Klassen als einer der Besten und saß Jahre hindurch an der Spitze.
Nun, es war überstanden! Und ich ärgerte mich im stillen nur über eins: über den knurrig-gutmütigen, aber eigensinnigen alten Herrn aus Schwabenland, der sich im Deutschen zu keinem »Gut« aufgeschwungen hatte, obwohl ich darin unbestritten an der Spitze stand. Habeat sibi! Ich nahm das Papier und zog auf die Universität.