
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
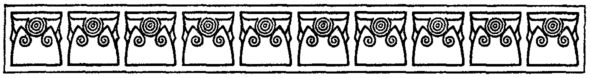
Des Lebens Ursprung ist Liebe. Und so stehe an der Spitze dieser Erinnerungen nicht die Aufzählung von Rasse, Milieu und andern vernünftelnden Erklärungen meiner Herkunft, sondern die Erzählung, wie mein Vater und meine Mutter sich geliebt haben.
Denn die Form und Wesenheit ihrer Liebe hat mich angezogen, als ich mich entschloß, gerade dort auf die Erde zu kommen.
Das Dörfchen Rothbach liegt am Fuße der nördlichen Vogesen, zwischen Zabern und Niederbronn. Dort war ein Bruder meines Vaters als Schmied und Bauer verheiratet, etwa in der Mitte des Dorfes, nahe bei Schule und Pfarrhaus. Bei ihm fand Taufe statt. Es war im Jahre 1860. Mein Vater, ein Bauernsohn aus Menchhofen, damals noch Schüler in der »Ecole normale« zu Straßburg, wo die künftigen Lehrer ausgebildet wurden, nahm als Pate daran teil. Während des Schmauses erkundigte sich der strebsame ältere Lehrer des Dorfes nach neuen Unterrichtsmethoden und erzählte dem Jüngling mit Stolz von seinen Erfolgen im französischen Unterricht. Schließlich lud er ihn ein, sich in der Dorfschule selbst zu überzeugen, wie Schüler und Schülerinnen die Regeln über das Partizip beherrschten und fast fehlerfreie Diktate schrieben.
Wohlan, so wanderten sie denn miteinander in die Schule. Der junge Kandidat stellte selber schwierige Fragen, die vortrefflich beantwortet wurden. »Besonders fiel mir« – so erzählt mein Vater in handschriftlichen Aufzeichnungen – »eine bereits erblühte, schön gewachsene und vornehm gekleidete Schülerin mit roten Pausbäckchen auf. Fehlerfrei schrieb sie die von mir gebildeten Sätze über die Regeln des participes suiviz d'un infinitif auf die Wandtafel. Ich erzählte das meiner Schwägerin und erfuhr von ihr, daß diese tüchtige Schülerin, Elisabeth Gutbub, ihre gegenüber wohnende Nachbarin und die einzige Tochter einer Witwe sei.«
Es vergingen einige Jahre. Elisabeth erwuchs zu einer lieblichen Jungfrau. Sie beschäftigte sich nur wenig mit Ackerbau, um so mehr mit Nähen und dergleichen und besuchte fleißig das nahe Pfarrhaus des bedeutenden Pfarrers Huser, mit dessen Tochter sie befreundet war. Nie nahm das religiös veranlagte Mädchen am Tanz oder »Abendmarkt« teil, dem geselligen Treiben der Sonntagsabende, sondern beschränkte sich auf den Verkehr mit Gleichgesinnten. Sie las gute Bücher, schrieb in ihrer freien Zeit des verehrten Seelsorgers Predigten nieder und lebte zurückgezogen, dabei aber immer so freundlich zu jedermann, daß sie des Dorfes Liebling war.
So fehlte es denn nicht an gewichtigen Freiersleuten. Der Sohn des Bürgermeisters ward von der Mutter auserwählt, ihre einzige Tochter durchs Leben zu führen. Auch dessen Vater war einverstanden, und der Pfarrer begünstigte die Sache.
Nun griff damals eine eigentümliche religiöse Erweckung in das rationalistisch dumpfe evangelische Elsaß ein. Glaubensstarke Kanzelredner, wie Horning in Straßburg, Magnus in Bischheim und Michael Huser in Rothbach, knüpften wieder an die altlutherische Kraft unverwässerten Bibelglaubens an und erzielten überaus belebende Wirkungen durch die einseitige Stoßkraft dieser Orthodoxie des Herzens. Die Missionsfeste am Pfingstmontag zu Rothbach wurden berühmt. Die kleine Kirche war überfüllt bis auf die Straße hinaus. Jedes Haus hatte seine Gäste aus den Nachbardörfern. Es lag ein Geruch von welken Blumen und Festkränzen in der Luft; aus den Nachbarhäusern wurden Stühle und Bänke geholt; die Pfarrer konnten sich kaum durch die Masse der zusammengeströmten Landleute an den Altar hindurchwinden. Und in diese gläubige Menge schollen nun die alten gewaltigen Kirchenlieder; und die Pfarrer predigten kraftvoll und eindringlich in Luthers Art, manchmal in elsässische Mundart übergehend, von Seele zu Seele wirksam das »Eins ist not« verkündend: die Heiligung des Lebens im Sinne der Erlösung durch Jesus.
Ich erinnere mich noch aus meinen Kinderzeiten der mächtigen Stimmung, die dort an Pfingstmontagen im umwaldeten, vom Scheibenberg überschatteten Rothbach lag. Das Dörfchen, unter der Seelsorge des herrlichen, kindlich großen Predigers Huser, war der Mittelpunkt dieser Seelenbewegung, die nichts Pietistisches oder Sentimentales an sich hatte, vielmehr Kräfte des Lebens auf den Plan rief. Erst war es ein Häuflein, verlacht von den satten Bauern der Umgegend, denen der trockene Nationalismus genügte; dann wuchs die Zahl und der Bekennermut, der sich in Kämpfen gegen andere Parteien und unduldsame Pastoren bewähren mußte.
Auch mein Vater wurde von diesem Geist ergriffen. »Der gemütstiefe Pfarrer Huser sprach so ganz anders als unsre gewöhnlichen Prediger«, heißt es in seinen Aufzeichnungen. »Man war in eine andre Welt versetzt, wo Friede herrscht; und doch war man wieder mit dem Alltagsleben ausgesöhnt, weil man Kraft schöpfte, den Kampf aufzunehmen mit den Mächten, die uns das Leben erschweren. Es war Neues und doch Altes. Ich forschte nach in Büchern wie Arndts ›Wahres Christentum‹, Lentz' ›Gebetskämmerlein‹, Harms ›Predigtbuch< usw. und war überrascht, daß diese Gottesmänner vollständig mit der Predigtweise unseres lieben Pfarrers übereinstimmten. Ein Wendepunkt war in meinem Leben eingetreten.«
Als nun mein Vater Hilfslehrer in einem lothringischen Hochlandsdorfe war und Aussicht auf selbständige Stellung hatte, ging sein sehnlicher Wunsch dahin, eine Lebensgefährtin zu finden, die das Feuer seiner religiösen Anschauungen teilte. Und wer wohl wäre dazu berufener gewesen als jene unvergessene Schülerin mit den roten Wangen, den ernsten und zugleich sanften blauen Augen und dem stillen, tiefen Gemüt! Sie war ja von Kind an zu Hause in dieser Geistesluft; sie war die Gespielin der »Mamsell Lydia« vom Pfarrhause; sie war Schülerin und Jüngerin jenes seelenvollen Pfarrers, der für jeden auf der Straße immer irgendein sinniges und belebendes Wort bereit hatte.
Die Schwierigkeiten waren groß. Mein Vater war ein unbegüterter Bauernsohn aus zahlreicher Familie; und ein Schulmeisterlein mit dem damals unglaublich armseligen Gehalt war keine begehrenswerte Partie. Aber mit Unterstützung der Schwägerin gelang es ihm, eine Unterredung mit Elisabeth zu erlangen. Es ergab sich bald ein Briefwechsel zwischen Rothbach und dem lothringischen Dörfchen Altweiler, anfänglich verlegen vom »Lissel von Rothbach«, um so feuriger von meinem Vater geführt, der immer neue Gründe beibrachte, aus seiner Bekannten eine Freundin und noch mehr zu machen. Im Dorfe aber kam es zu einem Gemunkel. Und nach schweren Tagen schickte Elisabeth sämtliche Briefe an den jungen Lehrer zurück mit dem Bemerken, sie wolle aus dem Gerede herauskommen und breche hiermit alle Beziehungen ab.
Das war für den Liebenden ein schwerer Schlag! Es war an einem Mittwochnachmittag, als ihm der Brief in die Schule gereicht wurde. Ratlos und bestürzt lief er hin und her; und das Ende seiner schmerzlichen Erwägungen war, daß er sich sofort nach Schulschluß aufmachte und die ganze Nacht hindurch quer durch die Vogesen marschierte, stracks nach Rothbach, um die Briefe persönlich zurückzubringen.
Nach zehnstündigem Marsch kam er nächtlicherweile vor dem Hause an, das mitten in Rothbach am Kreuzweg liegt. Er klopft am Fensterladen; Mutter und Tochter erscheinen und sind sprachlos. Verhandlungen beginnen; er wird endlich eingelassen, und der nächtliche Kriegszug endet mit der Zurücknahme der Briefe und der Einwilligung der Mutter. Dann pochte er seinen Bruder wach und legte sich nieder, todmüde, doch mit dem behaglichen Gefühl des Siegers.
Am andern Morgen wiederholte der Bräutigam seinen Besuch in aller Form, trank zum erstenmal mit seiner Auserkorenen »den Kaffee«, und nachmittags begleitete ihn Elisabeth durch die staunenden Leute hindurch eine Strecke Wegs über die »Hagholzbuckel« nach Ingweiler zu. Sie versicherte dem Geliebten, daß sie ihm nun, nach dieser Probe von Willenstraft und Liebe, ganz gehöre, und daß niemand sie ihm abwendig machen werde. Durch einen ersten Kuß besiegelten die Glücklichen ihren Seelenbund und trennten sich schweren Herzens.
Die Ferien verbrachte der Bräutigam, der bald darauf als Lehrer nach Mattstall bei Wörth ernannt wurde, fortan in Rothbach. Das Dorf gewöhnte sich rasch und gern an die beiden und grüßte freundlich, wenn das Brautpaar durch die idyllische Landschaft spazierenging nach dem nahen Scheibenfelsen oder dem Hohen Kopf. Man fühlte, sie paßten vortrefflich zusammen, und die ernst-freundliche Liesel oder Lisette würde einmal eine tüchtige Schulfrau werden.
Im Pfarrhause wurde sie für ihren Beruf vorgebildet. Und im August 1864 fand in der Kirche zu Rothbach die Trauung statt.
»Für mich war es ein glücklicher Tag,« schreibt mein Vater, »an der Spitze des Hochzeitszuges den Weg in die nahe Kirche anzutreten. Hinter mir schritt der Brautführer mit der Braut. Wie erstaunt war ich, als ich unterwegs mich umdrehte und von allen Seiten Freundinnen meiner Braut herantreten sah, um ihr – nach damaligem Brauch – bunte Bänder an das Kleid zu heften! So trat sie in die Kirche ein, über und über behangen mit farbigen Bändern, die ihr ein eigentümliches Aussehen gaben. ›Wie Gott mich führt, so will ich gehen‹, sangen die Hochzeitsgäste. Und der treue Seelsorger hielt eine tiefergreifende Predigt. Tags darauf wurde mit den Gästen ein Ausflug nach Schloß Lichtenberg unternommen, und der Wald hallte von den fröhlichen Liedern, die unten in Rothbach in vielen Freundesherzen Widerhall fanden ...«
Dann ging die Fahrt auf hochbepacktem Aussteuerwagen nach Mattstall, in meines Vaters Wirkungskreis ...
Das ist die einfache, gesunde, religiös durchwehte Seelenstimmung, in der ich zur irdischen Geburt bestimmt war.
Als meine Mutter ihrer Niederkunft entgegensah, war es ihr Wunsch, auch dieses ernste Ereignis unter Schirm und Wahrzeichen ihres Pfarrers zu stellen. Zudem überkam sie die Furcht, die schwere Stunde könnte ihre Todesstunde werden; und die kaum zwanzigjährige junge Frau mochte doch lieber in Rothbach als in Mattstall begraben sein. So verbrachte denn mein Vater seine Herbstferien mit der Gattin und deren Mutter in Rothbach.
Nun ergab sich das Seltsame und beinahe Symbolische, daß der erwartete Erstling bereits bei der Geburt kein rechtes Heim vorfand. Denn die Großmutter lebte bei den Kindern in Mattstall und hatte ihr Haus verpachtet, das nun besetzt war. Man mußte also im Nachbarhause, einem einfachen elsässischen Fachwerkbau, ein paar Zimmer mieten. Und dort, in der gemieteten Stube eines fremden Bauernhauses, ist der Verfasser dieser Erinnerungen am 4. Oktober 1866 geboren.
Wenige Tage danach fand in der Kirche von Rothbach durch Pfarrer Huser die Taufe statt.
Dann, als sich meine rüstige Mutter, die ihr Kind selber nährte, rasch erholt hatte, machte der zukünftige Wanderer seine erste Wasgaufahrt: am Mutterherzen, nordwärts, vom Dörfchen Rothbach über Offweiler, Zinsweiler, Reichshofen, Fröschweiler und Langensulzbach ins Dörfchen Mattstall.
Die bäuerliche Familie Lienhard saß schon seit Jahrhunderten in jener Ecke. Bischholz, hart bei Rothbach gelegen, scheint ihr Stammsitz zu sein. Der altdeutsche Name Lienhard oder auch Leonhard (der Löwenstarke) ist im Elsaß und in der Schweiz häufig; ein Heiliger dieses Namens (gest. 659) war aus vornehmem fränkischen Geschlecht und widmete sich der Bekehrung der Franken. Im Unter-Elsaß kommt unsre Familie schon vor dem Dreißigjährigen Kriege, der dort übel hauste, in den Kirchenbüchern von Offweiler vor. Es sind Bauern und Schmiede.
Durch Rothbach rauscht ein rasches helles Gebirgswasser über roten Sand und Kieselstein. Es schlängelt sich als umbuschter Wiesenbach an Bischholz vorüber und mündet schon bei Pfaffenhofen in die Mother, die sich dann in der Sesenheimer Gegend mit der Zorn vereinigt, worauf beide mutig genug sind, sich hinter Drusenheim in den schwer hinströmenden Rhein zu ergießen.
Das Gelände scheint idyllisch und nicht bedeutend. Aber wer einmal im Mai über jene Hügel wandert, der wird überrascht sein von der Triebkraft unsrer fruchtbaren elsässischen Scholle.
Die Leute von Rothbach sind ein besonderer Menschenschlag: leichteren Geblütes als die Bauern schon im nahen Bischholz oder Schillersdorf, ein wenig leichtlebig sogar und wohlgemut, im ganzen nicht begütert. Ihr Weinberg hat einen guten Ruf. In der Mundart weicht ja fast jedes Dorf ein klein wenig von den Nachbardörfern ab, so daß der Einheimische einen »Robächer« leicht vom Nachbarn unterscheiden kann.
Nach Ingweiler zu stand dort einst die Abtei Selberg. Jetzt noch drängt sich in jener Ecke ein ergiebiger Weinbergbrunnen zutage; aber das Kloster nebst zwei nahen Dörfern ist im Dreißigjährigen Kriege von der Erde verschwunden. Nur ein »Dierkirchlein«, in einem stillen Gebirgstal voll Laubwald, gemahnt noch an die Klosterzeit. Ein unterirdischer Gang soll diese Waldruine mit der Abtei verbunden haben. Und etwas weiter das Gebirge hinauf erhebt sich dann plötzlich die steile Felsenfestung Lichtenberg.
Hier sind wir in den Kämpfen der Gegenwart. Im Kriege 1870 wurde dieses Fort von Wörther Rückzugstruppen besetzt und von Württembergern nach kurzer Beschießung zur Übergabe gezwungen. Im eisernen Friedhoftor sieht man heute noch eine Kugelöffnung: ein Schwabe, der dort Deckung gesucht, wurde von einer Chassepotkugel durch das Eisentor hindurch getötet. Als Gegenwirkung war oben an einer Schießscharte noch lange Jahre ein Blutstreifen zu sehen: ein Zuave war dort in den Hals getroffen worden. Und des schwäbischen Oberstleutnants Grabdenkmal überragt auf dem Friedhof die schlichten Gräber. Er war ins Gefecht hinausgeritten und sofort vom Pferd geschossen worden – eine jener vielleicht nicht nötigen Proben ruhigen Mutes, die am Anfang des Krieges so häufig waren. Das Bergschloß wurde von Kanonen in Brand geschossen, die Flammen leuchteten in der Nacht weithin durchs Elsaß.
Lichtenberg hatte im Mittelalter als eine der mächtigsten Burgen unsers burgenreichen Landes einen klangvollen Namen. Ansehnliche Landstrecken um die Residenz Buchsweiler gehörten durch Jahrhunderte den Grafen von Lichtenberg, später Hanau- Lichtenberg. Bücher wie Julius Rathgebers »Grafschaft Hanau-Lichtenberg«, Grubers »Wasgauherbst«, Ebells »Sandstein-Vogesen« und Beckers »Wasgaubilder« erzählen von diesen Sandsteinburgen der Nordvogesen manche ritterliche Fehde und manchen unrühmlichen Handel.
Und da muß ich nun einer sonderbaren Tatsache gedenken, für die mir jede Erklärung fehlt.
Schon in den ersten Kinderjahren, als ich schwerlich jemals eine Burg erblickt hatte, denn das freundliche Waldgelände von Mattstall kennt dergleichen nicht, quälte und ärgerte ich meinen Vater mit der oft wiederholten Frage: »Papa, wo ist denn die Burg, auf der wir einmal gewohnt haben?« – »Eine Burg? Ein Schloß? Aber, dummer Bub, wo sollten wir denn einmal auf einem Schlosse gewohnt haben?« – »Gewiß! Es ging eine weiße, staubige Straße über den Berg, daran war ein Häuschen mit einem Schlagbaum, daneben eine kleine Steintreppe, auf der andern Seite die Burg und gerade darunter das Dorf mit vielen blühenden Obstbäumen. Ich spielte auf dem Felsen, und ihr hattet immer Angst, ich könnte in den Brunnen fallen.«
Mein Vater erinnerte sich noch kurz vor seinem Tode an diese häufige Erkundigung des Kindes nach »unserm Schloß«. Eine Erklärung wußte auch er nicht. Ich sah mich übrigens auch im Traum oft an der Seite eines geliebten, mich beschützenden, gleichsam mütterlichen Wesens auf einer umwaldeten Bergstraße wandern, und in der Ferne war der Turm einer Burg bedeutsam sichtbar; oder ich sah mich in einem eigenartigen Traumdorfe, das Mattstall oder dem späteren Obersulzbach glich und doch anders war. Träume dieser Art mit genau demselben Landschaftsbilde wiederholten sich häufig; ich pflegte mit inniger Sehnsucht, ja mit Tränen daraus zu erwachen und hatte manchmal den Namen »Mama« auf den Lippen.
Später habe ich mir diese Erinnerung, die sich nicht als Erinnerung nachweisen ließ, in meiner Weise umgedeutet. Jenes Traumschloß ward als Schloß des Geistes empfunden, das zu bauen mir aufgetragen war. Einen gewissen herben Stolz meiner gleichwohl liebebedürftigen Natur, der schon früh in Kinderspielen zutage trat, wo ich immer Feldherr oder König sein wollte, habe ich mir gleichfalls umgeschmolzen und verinnerlicht in ein starkes Gefühl für Seelenadel und Größe der Lebensauffassung.
So hat sich der Schulmeistersjunge doch noch sein Schloß erbaut.
Es wird nicht uninteressant sein, auf das Leben und Wirken eines elsässischen Dorfschulmeisters französischer Zeit einen Blick zu werfen.
Mit zwanzig Jahren (1860) hatte mein Vater seine Studien beendet und sah sich als Schulamtskandidat nach einer Stelle um. Die Regierung kümmerte sich wenig um diese Anstellungen; die Hauptlehrer pflegten ihre Gehilfen – Aides genannt – selber zu besorgen. Und so wurde der junge Kandidat beim ehrwürdigen »Papa Hauth« in Altweiler, der nur wenig Französisch konnte, mit Genehmigung der Behörde angestellt.
Dieser alte Lehrer, ein hoher Siebziger, teilte mit seinem Gehilfen sein Jahresgehalt von 600 Franken (480 Mark!), gab ihm Wohnung, Nahrung und Wäsche im Schulhause und besorgte selbst die Gemeindeschreiberei nebst Orgelspiel, Sakristandienst und Läuten. Pensioniert konnte der Greis nicht gut werden: denn er hätte dann das Schulhaus räumen müssen und jährlich nur 80 Franken Pension erhalten! So behielt man denn den treuen Alten im Amte und überließ den Schuldienst einem Anfänger, der das Französische beherrschte.
Bahn oder Postwagen führten damals noch nicht in jene entlegene Ecke. Ein Oheim spannte seine zwei Braunen vor und brachte den neugebackenen Lehrer samt Klavier und Reisekoffer aus dem Elsaß ins Hochland. Am nächsten Tage, einem Sonntag, verkündigte der Herr Pfarrer von der Kanzel, daß am Montag der Unterricht beginnen würde, die Eltern möchten ihre Kinder nur ja recht regelmäßig zur Schule schicken.
»So war ich der Gemeinde vorgestellt«, erzählt mein Vater. »Nachmittags wurden einige Besuche gemacht. Mit ›Er‹ wurde ich angeredet, was mich nicht wenig befremdete; doch die Leutseligkeit der Dorfbewohner mit ihrer schönklingenden Lothringer Mundart und die Freundlichkeit, mit der ich im Schulhause behandelt wurde, trugen viel dazu bei, mich in meinem Hochlandsdorfe bald heimisch zu machen. Schon vor sieben Uhr stand ich am Montag vor der Tür, um meine Kinder zu empfangen und zu ordnen. Von achtzig eingeschriebenen Schülern und Schülerinnen kamen freilich – bloß fünfzehn! Ich war von meinem Patron darauf vorbereitet mit dem Hinweis, daß die Eltern noch zuviel Feldarbeit hätten und ihre Kinder also noch nicht entbehren könnten. So wurde denn der Unterricht mit den fünfzehn Schülern und Schülerinnen begonnen. Mein Wochenbuch war vorbereitet. Drei Klassen wurden eingerichtet, und der Unterricht von sieben bis elf Uhr vormittags folgendermaßen verteilt: Gebet mit Gesang – Religion – französische Sprache – Rechnen – Schreiben. Nachmittagsunterricht wurde erst im November erteilt; es kamen dann noch Geographie, Deutsch und die Kollektivlektion hinzu, in welcher der Lehrer ein religiöses, moralisches oder geschichtliches Thema besprach, um den Kindern in der letzten halben Stunde einen guten Gedanken einzuprägen und mit nach Hause zu geben. Bald hatte ich durch liebevolle Behandlung, gepaart mit gerechter Strenge, meine Kinder gewonnen. Neugierig erkundigten sich die Ferngebliebenen bei ihren Mitschülern über die Person des Lehrers und seine Art des Unterrichtens – und nach und nach füllte sich das geräumige Schulzimmer.«
Wenn man bedenkt, daß der Schulunterricht damals freiwillig war, so wird man begreifen, daß der Lehrer alle möglichen Mittel anwenden mußte, um seine Schule zu füllen. Die Eltern wurden häufig besucht, und nicht nur ihnen, sondern auch den Schülern selbst wurde der Wert und die Würde einer ordentlichen Bildung bei jeder Gelegenheit vor Augen geführt. Und da war es gerade die französische Sprache, die ein wichtiges Anziehungsmittel bildete; denn zum Vorwärtskommen im Leben war es recht vorteilhaft, die Staatssprache zu beherrschen. Die offizielle Schulsprache war Französisch; alle Unterrichtsfächer wurden in dieser Sprache erteilt. Die kleinen Anfänger begannen mit Sprachübungen. Hierbei wurden die besten unter den reiferen Schülern als » moniteurs« verwandt; diese » moniteurs« halfen auch beim ersten Lese- und Schreibunterricht. Auf diese Weise konnte der Lehrer sein Hauptaugenmerk der mittleren und oberen Klasse widmen. Ich entsinne mich noch dieses gleichzeitigen Unterrichts in demselben Schulraum: wie hier ein » moniteur« uns Knirpse abfragte, während Papa mit den Großen beschäftigt war. Das » Monsieur, permettez-moi de sortir!« war das erste Französisch, das wir lernten: wie oft haben wir die Formel angewandt, um draußen ein Weilchen im Hofe umherzuspringen, bis wir wieder in die französischen Stimmen des Schulzimmers untertauchten!
Wandkarten zur Belebung des geographischen Unterrichts gab es in der Altweiler Schule noch nicht. Der junge Lehrer benützte also seine schulfreien Nachmittage, um die Karten von Europa, Frankreich, Elsaß-Lothringen und Palästina mit Farben an die Schulwände zu malen. Er hatte mit seinen Kunstwerken so schönen Erfolg, daß nicht nur die Kinder über diese Zierde der weißen Wände staunten, sondern auch die Vorgesetzten; ja, der Herr Sous-Préfet erteilte dem Maler ein besonderes Lob – aber kein Geld für die Farben. Das hatte mein Vater übrigens auch nicht erwartet. Er machte sich mit seinem guten Bewußtsein und der Freude am schöpferischen Nachahmungsdrang seiner begabteren Schüler bezahlt.
Fast vier Jahre war mein Vater in Altweiler tätig, sehr zur Zufriedenheit des Dorfes und seines Schulinspektors. Selbst in den Zeiten der schwersten Feldarbeit besuchten zwei Drittel der eingeschriebenen Schüler die beliebte Schule. Besonders in der Religionsstunde, bei Behandlung des Kirchenliedes oder des Katechismus – wobei übrigens die deutsche Sprache benutzt wurde –, zeichnete sich der lebhafte und energische junge Lehrer früh schon aus, wie später bei Behandlung deutscher Gedichte und Lesestücke. Da war er mit ganzer warmherziger Persönlichkeit dabei und riß seine Zuhörer mit sich fort.
Zu Mattstall gab es gesteigerte und nicht minder erfolgreiche, sogar durch einen Preis ausgezeichnete Tätigkeit. Von acht bis elf vormittags und von ein bis vier Uhr nachmittags war Schule, von sechs bis neun abends Privatunterricht. Die Besitzer der nahen Glashütte – »Die Glashüttenherren«, wie man sie nannte – ließen ihre Söhne in Französisch, Physik, Geographie und Geschichte unterrichten. Im übrigen widmete sich der junge Ehemann seiner Gattin: es gab neben gern gepflogener guter Lektüre in jenem waldreichen Gelände Gelegenheit genug zu gemeinsamen reizvollen Spaziergängen. Man überblickt von den Höhen aus die eindrucksvolle Landschaft, die bald nachher durch die Schlacht bei Wörth weltberühmt werden sollte.
In dieser Waldecke habe ich die ersten drei bis vier Lebensjahre verbracht. Ich betrachte den Wald als meine Heimat; auch die beiden andern Dörfer, in denen mein Vater nachher wirkte, hatten Wald und Berge in ihrer Nähe. Und zeitlebens ist mir Selbstbesinnung in der ernsten Stille des Waldes Bedürfnis geblieben.
Im übrigen ist von den ersten achtzehn Wochen des Kindes Unrühmliches zu melden. Ich war nach schwerer Geburt scheinbar tot zur Welt gekommen, wurde vom Arzt in einen Kübel voll kalten Wassers gesetzt und tüchtig beklopft, worauf ich durch kräftiges Schreien verkündigte, daß ich meine Erdenpflichten zu übernehmen gesonnen war. Diese Versicherung soll ich dann in den nächsten Wochen, ja Monaten so andauernd und ausgiebig wiederholt haben, daß Eltern und Großmutter geradezu verzweifelten. Endlich griff mein Vater zu einem Gewaltmittel. Er jagte die jammernden Frauen hinaus, schloß hinter ihnen ab, hielt dem hartnäckigen Protestler in der Wiege eine Zornrede und warf schließlich das schreiende Bündel mit solcher Wucht in die Kissen, daß die Wiege zitterte. Vor Verblüffung hörte der Kleine mit Schreien auf, betrachtete seinen Herrn und Vater mit verwunderten Augen und war offenbar nun erst ordentlich zu diesem Planetendasein erwacht, denn er benahm sich fortan manierlich.
Als ich nach Jahrzehnten an einem stillen, leuchtenden Herbstsonntag den kleinen Ort Mattstall wieder besuchte, mutete mich alles ungemein idyllisch, ja niedlich an. Ein gleichmäßig mit Laubwald bedeckter, nicht hoher Berg schaut in den Dorfplatz hinein; auch nach der Glashütte zu überall Wald. Das Schulhaus grenzt mit einem winzigen Vorgärtchen an Kirchhof und Kirche. In jenem Eckchen zwischen Schule und Kirche bin ich auf allen Vieren umhergekrochen und habe mich mit Busch und Baum, Tier und Pflanze früh befreundet. Es begegnete mir an jenem Sonntagnachmittag ein patriarchalischer Greis, der an einem selbstgeschnittenen Stabe, unter den Nußbäumen von Lembach her, ins Dorf schritt. Ich fragte dies und jenes und stellte mich schließlich als Sohn des Lehrers vor, der vor vierzig Jahren hier gewirkt hatte. Da leuchteten des Alten Augen. Er nannte seinen Namen, der mir bekannt im Ohr klang) er hatte den jungen Feuerkopf von Lehrer nicht vergessen. Ich entsann mich, daß ich bei der festlichen Einweihung der Fröschweiler Friedenskirche noch einmal alle diese guten Leute samt meinen Jugendgespielen gesehen hatte. Wir plauderten natürlich in elsässischer Mundart. Aber wie kann man dem Nicht-Elsässer den gemütlichen Tonfall verständlich machen, in dem wir echten alten Elsässer bei solchem Anlaß gemächlich und ohne Innewerden irgendwelches Standesunterschiedes miteinander zu plaudern pflegen! Und was sind dem Fremden Namen wie Trautmann, Krebs, Knobel und dergleichen, die in meiner Kindheit als Namen getreuer Nachbarn oft in unserm Kreise genannt wurden und sich mit dem Gesamtbilde des Dörfchens Mattstall verbanden.
Es will mich bedünken, als wären die Menschen vor 1870 traulicher und gemütvoller gewesen. Unsre unterelsässische Erzählerin Marie Hart aus Buchsweiler hat in ihren Skizzen und Erzählungen jene Zeitstimmung mit warmherzigem Humor allerliebst geschildert.
Der Abschied von Mattstall ist meinem Vater – der im Frühling 1869 in das reiche Obersulzbach bei Ingweiler versetzt wurde – nicht leicht geworden. Viele Eltern kamen ins Schulhaus, um dem beliebten Lehrer zu danken für alles, was er an ihren Kindern getan hatte. And eine Schar seiner Schüler lief dem Wagen, der uns entführte, nach bis in den Wald, wo dann mein Vater abstieg und jedem noch einmal die Hand schüttelte. Sie hatten nicht nur tüchtig miteinander gearbeitet, sie hatten auch auf gemeinsamen Ausflügen, besonders in die benachbarte Pfalz, viel Schönes genossen. Drei seiner begabteren Schüler nahm er übrigens mit in seinen neuen Wirkungskreis, um sie durch Privatunterricht für ihren späteren Lebensberuf vorzubereiten.
Der Krieg unterbrach das Idyll. Wir erlebten dieses mächtige Ereignis ein paar Stunden hinter der französischen Schlachtlinie, im Dorf Obersulzbach.
Als fast fünfjähriger Junge vermochte ich den Vorgängen bereits mit Spannung zu folgen. Ich konnte schon vor dem Schulbesuch lesen und war ein phantasievoller Knabe, der freilich früh seine Eigenarten, Scheuheiten und Träumereien entfaltete. Unklar entsinn' ich mich noch, mit welchen seltsamen Besorgnissen man damals in unsern evangelischen Kreisen dem Kriege mit Preußen und Deutschland entgegensah: es hieß, wir elsässischen Protestanten würden nach Niederwerfung der Deutschen selber von den französischen Katholiken niedergemetzelt werden! Eine neue Bartholomäusnacht also! Im nahen Ingweiler, besagte das unsinnige Gerücht, hätten die Katholiken bereits Waffen in ihren Häusern verborgen. Von den Preußen aber und ihrem fernen Lande hatten wir die abenteuerlichsten Vorstellungen. Diese ärmlichen und rohen Barbaren hausten in einer Sandwüste und lebten von Kartoffeln, Sauerkraut und Pumpernickel. Daß ein solcher Volksstamm über die Grande nation siegen könnte, war ein lächerlicher Gedanke. Wenn man die farbenbunte Armee Mac Mahons durch unsre Dörfer ziehen sah, diese Zuaven mit den Pumphosen und der Zipfelmütze im Genick, diese schwarzen, zähnefletschenden, augenrollenden Turkos, diese gepanzerten Kürassiere und Dragoner mit dem stattlichen Roßschweif am Helm, und gar diese Mitrailleusen – so hatte man den stolzen Eindruck: Unwiderstehlich! Ein Kavallerieregiment, das dort irgendwo vorbeiritt, hatte noch nicht einmal die Säbel geschliffen, denn man würde ja doch nicht zum Einhauen kommen. In der Tat, die Unglücklichen von Morsbronn kamen nicht zum Einhauen. Die Verpflegung der Soldaten war erbärmlich. Die Hungernden durchsuchten unsre Häuser nach Brot und Trank. Pfarrer Klein hat in seiner »Fröschweiler Chronik« diese Zustände mit meisterhafter Anschaulichkeit bis ins kleinste geschildert.
Dann kam der 6. August: die Schlacht von Wörth! Wie oft an jenem Samstag stieg mein Vater mit dem Maire und andern Bürgern auf den Kirchturm, um Ausschau zu halten, während wir andern – Frauen und Kinder – in der Schule saßen und Scharpie zupften! Das Schlachtfeld war reichlich fünf bis sechs Stunden entfernt. Doch der dumpf herrollende Donner der Kanonen und das schwarze Gerücht eines schweren Kampfes drangen rasch in unser entlegenes Bauerndorf. Es stand übel auf den Hügeln von Fröschweiler: ein schweißbedeckter Reiter fragte drüben in Ingweiler, also völlig auf Abwege geraten, nach dem nächsten Wege nach Bitsch! Er sollte de Faillys Hilfskorps aufs Schlachtfeld holen! Und dann kamen die ersten flüchtigen Franzosen das Dorf herab – für uns Kinder ein unheimlicher und unfaßlicher Anblick! Sie drängten sich um den Steintrog des Dorfbrunnens vor Balzers Haus, tranken, wuschen sich, bettelten weiterwandernd um etwas Speise – und hatten auf den Lippen immer das stumpfe, eintönig wiederholte » Tout est perdu!« Alles verloren!
Die Bestürzung in unsrer Ecke war unbeschreiblich. Die Preußen – so lief es von Mund zu Mund – schonen weder Mann noch Weib, besonders nehmen sie die jungen Männer mit! Darum auf in die Berge! Das Beste wurde versteckt oder vergraben, das Nötigste aufgerafft und mitgenommen. Für uns Jungens ein Heidenspaß! Ich erinnere mich, einen Laib Brot unterm Arm geschleppt zu haben, meinen unzertrennlichen Kameraden Louis Ruscher zur Seite, den Sohn der ärmsten Witwe. So stäubte die flüchtende Schar aus dem Oberdorf hinaus nach dem waldigen Hoh-Weinburg, wo wir hinter Buschwerk Quartier bezogen, bang oder gespannt in die sommerliche Ebene hinablauschend. Meine Mutter trug meinen jüngeren Bruder Albert auf dem Arm, einen »Einjährigen«, der demnach ebenso wie ich mit einer Flucht in den Wald die neue deutsch-elsässische Epoche begonnen hat.
Eines Anblicks entsinne ich mich noch, der uns sehr zu Herzen ging. Ein einzelner versprengter Kürassier wanderte unten neben seinem Pferd auf dem Waldsträßchen dahin, den Helm am Arm, niedergeschlagen. Ich weiß nicht, ob unsre ausgestellten Wachen mit ihm gesprochen haben. Jedenfalls: die verstörte Menschenmenge oben am Berge zwischen Betten und Gegenständen aller Art, unten der besiegte, verwundete, traurig und allein nach Frankreich zurückmarschierende Kürassier – es war ein Eindruck, der sich mir unvergeßlich eingeprägt hat.
Hier eine Zwischenbemerkung: es ist in späteren Jahren nicht immer zu entscheiden, ob man solche Dinge unmittelbar selber gesehen oder eindringlich, etwa von einem ausspähenden Bauernburschen, sofort aus dem Erlebnis heraus erzählt bekommen hat. Ich kann es heute nicht mehr reinlich auseinanderhalten, da ja damals tausendfache Eindrücke selbsterlebter oder nur vernommener Dinge durch unsre Herzen und Köpfe gingen. Aber das Bild ist mir geblieben.
Bald schickte mein Vater, der inzwischen zu Hause die Sieger erwartete, einen Boten in den Wald: »Kommt nur wieder heim, die Preußen tun euch nichts!«
Die ersten preußischen Ulanen ritten am Sonntagvormittag mit gespanntem Gewehr in unser Dorf ein. »Keine Franzosen da?« war ihre stehende Frage vor jedem Haustor. In unserm Schulhause lagen noch zwei französische Offiziere in den Betten. Da kam jemand durch die Obstgärten heruntergelaufen: »Herr Schulmeister, die Preußen kommen!« Mein Vater rasch hinüber, rüttelt die beiden heraus, reißt sie durch den Grasgarten auf den Weg nach Weitersweiler – und als einige Augenblicke später die Ulanen in unsern schöngepflasterten Hof trabten, konnte er ruhigen Gewissens antworten: »Nein, keine Franzosen da!«
Nun rollte Tag und Nacht, Nacht und Tag in großartiger Ordnung der endlose Heereszug der deutschen Sieger an uns erstaunten Elsässern vorüber. Himmel, welche unerschöpfliche Nation! Nimmt denn das gar kein Ende?! Immerzu das harte Getöse marschierender Truppen, das Getrappel der Reiterei, das Rollen, Rasseln, Stoßen der Kanonen und Trainwagen. Wir hatten Haus und Scheune gestopft voll Einquartierung. Wie manchem deutschen Offizier hab' ich auf Knien und Schultern gesessen! Einmal stülpte mir einer seinen Helm über, den ich freilich mit den Händchen emporhalten mußte, und schnallte mir seinen Säbel um; so stolperte ich stolz in die Küche zu meiner immerzu kochenden und backenden Mutter, die aus den Aufregungen gar nicht mehr herauskam. Ein andermal versetzte ich die Frauen in Schrecken, indem ich mit einem Arm voll Holz, den ich gerade zu tragen hatte, entsetzt in die Küche stürzte: »Sie schießen!« Es krachte in der Tat im Hofe: die Offiziere hatten sich eine Scheibe angekreidet und übten sich im Pistolenschießen. Dann die unerhörte Neuheit der auf dem Platz vor unserm Hause haltenden, streng bewachten Kanonen und Pulverkarren – für den Dorfknaben unvergeßlich großzügige und fremdartige Eindrücke!
Mein lebhafter und gastfreier Vater verstand sich übrigens mit seinen deutschen Gästen prachtvoll. Als freimütiger und temperamentvoller junger Mann, dem gelegentlicher Jähzorn nicht fremd war, verbiß er sich freilich mit den Offizieren in politische Gespräche. »Diese anscheinende Niederlage von Fröschweiler ist eine Finte Mac Mahons,« setzte er auseinander; »er wird Sie in die Vogesen locken, meine Herren, und kein einziger von Ihnen wird wieder zurückkommen!« Er war damals noch ein rabiater Franzose, mein Papa; allein die deutschen Herren hatten Humor genug, bei unserm vorzüglichen Rothbacher Hauswein auf ein gesundes Wiedersehen mit ihm anzustoßen.
Erst als der Haupttroß längst vorüber war, ereignete sich ein unerquickliches Nachspiel.
Die deutschen Truppen waren im ganzen von musterhafter Zucht. Störungen der Ordnung waren Ausnahmen. Mein Vater war einmal Zeuge, wie eine Nachbarin jammernd in unser Haus gelaufen kam: Soldaten wären über ihren Hühnerstall geraten und wollten die Hühner schlachten; ein Pfiff eines bei uns einquartierten Offiziers genügte, und der Hühnerstall war frei. Aber ein Bayer, der sich von seinem Regiment verlaufen hatte und marodierend von Haus zu Haus strich, machte uns bange Stunden. Das Dorf war nicht mehr von Truppen besetzt; Offiziere konnte man nicht zu Hilfe rufen. Der bayrische Wachtmeister, Feldwebel oder Unteroffizier – irgend so etwas war der Nachzügler – zechte sich durch alle Schnäpse und Weine hindurch und gab sich als Quartiermacher aus. Soviel ich weiß, war er mit einem Revolver bewaffnet und zwang die Bauern, ihm Keller und Küche zu öffnen. Dabei troff der Mensch von unflätigen Schimpfworten; es war eine zornige Aufregung im ganzen Dorfe.
Endlich rief man den jungen Schulmeister: er solle als Respektsperson diesen blau uniformierten Grobian mit dem Raupenhelm zur Rede stellen und nach seinen Papieren fragen. Die Unterredung vollzog sich auf offenem Platz vor dem Hause des Maire, das ich mit seinen großen, grün gestrichenen Hoftoren noch deutlich vor mir sehe. In den Türen und Fenstern drängten sich die Leute; es war ein Augenblick der Spannung. Der kleine, rasche Lehrer trat hinaus und ersuchte den derben Kriegsmann um seinen Ausweis. Kaum hatte er zu sprechen begonnen, so flog auch ihm ein unaussprechliches Schimpfwort an den Kopf. »Was bin ich?!« brauste da mein Vater auf, packte den Bezechten sofort und warf ihn mit Wucht ans Tor. Jetzt bekamen die Bauern Mut. Sie stürzten von allen Seiten über den Gefallenen her; einen Mord zu begehen, wäre keinem dieser ehrenfesten Männer eingefallen, aber sie verprügelten ihn herzhaft. Mein Vater hatte Mühe, ihn aus ihren Händen zu befreien, worauf man ihn am Brunnentrog wusch und auf die »Wacht« brachte: ins Dorfgefängnis.
Bald darauf ritt eine Ulanenpatrouille die Gasse herauf, wahrscheinlich von Buchsweiler herbeigerufen. Mein Vater nebst Maire und Gemeinderat erzählte dem Offizier den Vorfall. Der Sünder wurde vorgeführt: ich sehe den Offizier noch auf seinem Pferd sitzen und den völlig geknickten Übeltäter andonnern. Dann ward er zwischen zwei Pferde genommen, und sie trabten mit ihm davon. Wer weiß, was aus dem Unglücksmenschen geworden sein mag!
Im übrigen brachte der Krieg manchem Fuhrmann Reichtum ins Haus. Die Deutschen bezahlten mit Gutscheinen (»Bons«), die später in gut Geld umgesetzt wurden. So rauschte das große Ereignis wie ein Hagelschlag über uns Elsässer hin, zwar verwüstend, aber auch aufrüttelnd und umgestaltend.
Das reiche Obersulzbach, dessen Schulhaus so ruhevoll abseits zwischen Obstgärten und Wiesen liegt, hat jetzt seine Kirche durch Professor Jordan freundlich ausmalen lassen: in einer blühenden unterelsässischen Lenzlandschaft mit Bauerntypen jener Gegend sitzt predigend der Heiland.
In solcher Stimmung sind mir die Hügel der Heimat gegenwärtig geblieben: Blüten, Glockengeläut, Orgelklang und in Sonntagnächten Volkslieder. Reihenweise zogen die Mädchen am Sonntagabend in ihrer schönen elsässischen Tracht vors Dorf hinaus und sangen zweistimmig ihre oft wehmütig-melodischen Lieder vom Lieben und Scheiden. Oft freilich wurde an solchen warmen Sommerabenden mit der Jugend des Nachbardorfes hitzig gerauft. Und am Meßti gab's blutige Köpfe. Die Alten aber saßen in Hemdärmeln und roten Westen vor ihren Haustüren, rauchten ihre Pfeifchen und politisierten miteinander. Heute ist die hübsche elsässische Tracht leider im Schwinden begriffen. Nur die elsässische Mädchen- und Frauenhaube mit den breiten Bändern hat sich behauptet.
Wir Kinder lebten leidenschaftlich und innig mit der Natur. Soldatenspiel, Umgehungsmärsche, Verstecke, Überfälle, dann Zusehen beim Schweineschlachten in irgendeinem Hause, Obstraub in irgendeinem Garten, Flucht vor dem Bannwart, Fisch- und Krebsfang, Suche nach Nestern von schädlichen Vögeln, wie Elstern oder Neuntöter, die freilich teils verlockend hoch, teils auch in dicksten Dornen hausten – das beschäftigte unsern jugendlichen Drang nach Taten und Abenteuern. Das Dorf war voll von Kindern und Schwalben, die beide in jedes richtige Bauernhaus gehören. Dazwischen Märchenlektüre im einsamsten Haselgebüsch oder unter dem Tafelklavier mit der lang herabhangenden Decke: mein Lieblingsversteck, wenn Fremde ins Haus kamen. Denn ich war etwas fremdenscheu.
Besonders aber das Soldatenspiel »ging« ganz vorzüglich! Ich hatte einen kleinen Ulanenhelm nebst Säbel geschenkt bekommen und war natürlich immer der »General«. Auch erinnere ich mich, das große farbige Bild des Marschalls Mac Mahon, auf einem Pappdeckel aufgezogen, an einer Bohnenstange meiner Kriegsschar vorangetragen zu haben. Außerdem besaß ich eine Trommel, konnte freilich nicht so gut trommeln wie der Nachtwächter, der als öffentlicher Ausrufer seine Wirbel großartig schlug. Ich guckte ihm das ab, wenn er, begleitet von uns Kindern, durchs Dorf marschierte, um durch Trommelwirbel für seine Bekanntmachungen geöffnete Fenster und willige Ohren zu finden. »Es wird bekanntgemacht, daß« usw. – so begann's immer. Diese stehende Formel eignete ich mir dann an und zog nun auf eigne Faust durchs Dorf, trommelnd und ausrufend. Die Bauern lachten nicht wenig über den Ausrufer und die wunderlichen Dinge, die der Knirps nach eignem Ermessen »bekanntmachte«.
Die Dorfschulmeister trieben damals ein wenig Landwirtschaft. Wir hatten Kuh, Ziege und eine Anzahl Kaninchen im Stall; ich hatte außerdem an einem Lamm viel Freude. Von meiner Mutter her besahen wir in Rothbach Weinberge. Und der Organist wird ja noch heute durch Abgabe von Weizen und Korn aus der Gemeinde besoldet.
Mutter und Großmutter besorgten das Haus ohne Dienstboten. Ich kann einen Knabenstreich nicht vergessen, den ich im Verein mit meinem getreuen Louis Ruscher – der jetzt in Neuorleans Brot bäckt – meiner immer tätigen, immer gütigen Großmutter gespielt habe. Sie hatte unter ihrer Nehweiler »Nebelskappe« – einer sonderbaren Kopftracht jener Zeit – ein so mildfreundliches Gesicht, daß sie zu bösen Streichen wahrlich nicht herausforderte. Wöchentlich besorgte sie das mühsame Brotbacken und pflegte sich dabei einen besonderen Kuchen zu bereiten. Den legte sie gewöhnlich auf ihr hohes, mit Gardinen umgebenes Bett und glaubte das kostbare Gebäck vor uns Taugenichtsen gesichert. Aber wir entdeckten das Kleinod. Himmel, was für ein ungewöhnlicher Kuchen! Erst wurde mit vorsichtigem Finger rund um den Rand herumgeprobt, dann die oberste Schicht abgegessen, hierauf zum Zentrum vorgedrungen, endlich nahezu das Ganze vertilgt. Schuldbewußt und gesättigt versteckten wir uns dann unter gewaltigen Reisigbündeln, die im Hofe getürmt lagen. Oh, der Jammer, als sich die müdgearbeitete Greisin an ihrem Lieblingsgebäck laben wollte! Und schon schallte Papas energische Stimme über den Hof. Wie lange die Belagerung unserer Burg gedauert hat und wie die Übergabe erfolgt ist, weiß ich nicht mehr; wohl aber weiß ich, daß mein Vater im handfesten Hosenklopfen Meister war.
In dieser Muskelübung hat mein Vater manchmal zuviel geleistet. Er hatte eine Menge Arbeit zu bewältigen, es gehörte schon Spannkraft dazu, alles gut zu meistern; da schoß das Temperament mitunter über das Ziel. Als Lehrer besaß er den Ehrgeiz des echten Pädagogen, seine Berufsarbeit nicht nur herunterzuhaspeln, sondern eine musterhafte Schule zu haben. Da tanzte noch der Stock auf dem festen Fell der abgehärteten Bauernjungen. Ich erinnere mich, mit welchem respektvollen Grausen ich zusah, wie der unerschrockene kleine Schulherr einmal einen der widerspenstigen »Großen« bändigte: er schleuderte in seinem unwiderstehlichen Zorn den laut heulenden Burschen in der Schulstube herum, daß die Holzstücke flogen, mit denen man damals noch heizte. Im ohrenbetäubenden Heulen waren sie überhaupt talentvoll, die Sprößlinge der Bauern. Der Schulsaal war oft gar unmelodisch belebt. Wie sie mit ihrem Vieh umzugehen pflegen, wie sie am Meßti ins Gebratene einhauen, daß die Kinnladen knacken, wie sie sich selber untereinander in aller Gemütlichkeit zoologische Titel versetzen, vom Stier bis zum Kalb und ähnlichen Gebilden: so mußten sie auch als Schüler unweichlich angepackt werden, wenn es galt, aus diesen gesunden animalischen Gehirnen Geistesfunken herauszuhämmern. Aber es gelang. Die Schule gedieh auch in Obersulzbach. Und mit Lust und Liebe eignete man sich die Grundzüge der deutschen Erziehungslehre an.
Ich war ein gesunder, aber feingebauter und zart organisierter Junge, in dessen braunen Augen viel Gemüt und Phantasie schimmerte. Da konnte es nicht fehlen, daß des leicht staunenden Knaben Treuherzigkeit mißbraucht wurde. Spott und Hohn sind mir neben Lüge und Tücke noch heute gemeinste Eigenschaften; denn Hohn ist die Verzerrung jener liebenswürdigen Begabung, ohne die ja Kunst undenkbar ist: der Schelmerei und Neckerei. Was sich neckt, das liebt sich; aber Hohn ist Quälerei.
Ich erinnere mich, daß ich einmal mit einigen größeren Burschen beim Schäfer stand und neugierig nach dem Inhalt eines Horns forschte, das er an der Seite trug. Das sei ein Horn zum Blasen, meinte der Schäfer. »Versuch's mal!« – Ich setzte an, und eine abscheuliche Flüssigkeit, womit er wohl seine Schafe einrieb, rann mir in den Hals. Ein belangloser Spaß, nicht wahr – aber das Hohngelächter der Burschen! Die Furcht vor dem Ausgelacht- und Verachtetwerden hat mir häufig die Unbefangenheit geraubt. Besonders wenn an meiner Kleidung irgend etwas auffiel oder hätte auffallen können, oder wenn ich ein unförmliches Säckchen oder dergleichen zu tragen hatte, das sich für mich zu tragen nicht schickte – war ich von einer peinlichen Empfindlichkeit. Ich wollte nicht auffallen, nicht ausgelacht werden.
Allmählich wußten die Boshaften unter den Dorfrangen, daß der Schulmeistersjunge von zurückhaltender Gemütsart war, und so suchten sie erst recht Raufereien. Ich saß etwa mit meinem Kameraden Ludwig spielend im Grase des Kirchhofs; es gab dort ausgezeichnete Sauerkirschen. Steine wurden über die Kirchhofsmauer nach uns geworfen. Nachher entwickelte sich unten auf der Straße eine Balgerei, wobei ich im Ringkampf ausrutschte, auf den Hinterkopf fiel und das Hohnlachen der Bande umsonst als Zugabe erhielt. Plötzlich stob alles auseinander: mein Vater blitzte heran, hatte ein eisernes Gardinenstängchen erwischt und prügelte mich braun und blau. Weshalb? Weil ich entgegen seiner Verordnung gerauft hatte!
Es ist mir da manches Unrecht geschehen. Denn meines Vaters Energie, hinter der sich viel schaffensfreudiges Gemüt verbarg, ging oft in Reizbarkeit und üble Laune über, während er manchmal in heiterer Stimmung Unarten ohne Züchtigung durchgehen ließ. Sein damals ausgegebener Befehl: »Ein ordentlicher Junge darf nicht raufen!« beruhte auf einem falschverstandenen Christentum. Diese Anordnung machte mich scheu, ja ängstlich im Zusammenstoß mit andern Jungen oder später mit den Buchsweiler »Wackes«, wie wir die Gassenjungen im Gegensatz zu den » collégiens«, den Gymnasiasten, zu nennen pflegten. Rauferei und Kampfspiel in diesem Alter ist ein Austoben des Blutes und der Muskeln, wie sich der Säugling durch Schreien die Lungen dehnt. Zucht muß sein, aber Furchtsamkeit ist vom Übel. »Wehrt euch eurer Haut! Und wenn einer heimkommt und heult, so kriegt er noch was dazu!« Das habe ich später meinen kleinen Stiefbrüdern eingeprägt. Der Jugend soll man den Mut stählen und für Weinerlichkeit hinter die Ohren hauen.
Ich war als Knabe schüchtern; erst in späteren Zeiten habe ich durch bewußte Selbsterziehung – indem ich mir zum Ziel setzte, ohne Drückebergerei stracks auf die Kanone loszumarschieren – jenen Mangel in sein Gegenteil verwandelt: in ruhigen Mut.
In andrer Beziehung freilich übte mich mein Vater, die Vorspiegelungen meiner lebhaften Phantasie zu bekämpfen. Als Küster hatte er jeden Abend die Kirchuhr aufzuziehen; oft nahm er mich dabei mit hinauf in den Glockenturm. Und sobald ich stark genug war, die schweren Gewichte emporzudrehen – was allerdings erst nachher in Schillersdorf eintrat –, schickte er mich allein hinauf. Da hieß es manchmal bei bereits eingebrochener Nacht: »Jetzt hab' ich die Kirchuhr vergessen! Fritz, en route! Nimm Schlüssel und Laterne – und marsch!« Mit Grausen schlich der Knabe, öfters vom jüngeren Bruder begleitet, durch die leere, hallende Kirche, umtanzt von den gespenstischen Schatten der Laterne, an der Orgel vorüber, empor in den Turm. Später war ich unerschrocken genug, mich im Finstern hinaufzutasten, nur mit einigen Streichhölzern in der Tasche, um vor dem Aufziehen nach dem Zeiger zu sehen.
Ich bin schon als Kind, bei der Eigenart meines Seelenorganismus, der bald zu wild-leidenschaftlichen Spielen, bald zu scheuer Einsamkeit neigte, durch keine leichte Schule gegangen – ich, der ich auf einem Schloß geboren zu sein wähnte! Und gar oft, bis auf die Höhe des Lebens, irrte ich mit meiner Sehnsucht wie ein Fremdling unter den Mitmenschen umher. Da wird man dann begreifen, daß mir die Glocken der Sonntage, die Märchenstimmungen des Waldes, das Lesen und Träumen in stillen Hecken oder die Erwartung vor der Weihnachtszeit ganz besonders wichtige Gegenkräfte geworden sind.
An Sonntagen wurde häufig mit den Eltern durch den Menchhöfer Bann und Ingweiler Wald nach Rothbach gewandert zu den Nachmittags-Gottesdiensten des Pfarrers Huser. Der Knabe ging nicht immer gern mit; er war im Pfarrhause und unter all den Menschen beengt. Aber die Wanderungen sind mir doch von bleibender Bedeutung geworden. Sommerkorn, Lerchengesang, das schwere Glockengeläut von Ingweiler, die hellen Glöckchen von Rothbach, die Choräle – das alles stimmte den Knaben auf jenen Hügeln festlich. Duft und Kraft jener Sonntage habe ich im Herzen behalten. Ja, sie blieben mein heimlich Geleit durch mein ganzes Leben.
Wenn man jene Kirchenlieder nur liest, mögen sie ja wohl trocken und wunderlich klingen. Aber welch eine Farbe, welch ein Schwung, wenn sie gemeinsam mit Freudigkeit gesungen werden! »Nur frisch hinein! Es wird so tief nicht sein!« – »Jerusalem, du hochgebaute Stadt!« – »Dir, dir, Jehova, will ich singen« – wie beflügelt jauchzte das, von kraftvollen Bauernkehlen hinausgeschmettert, durch das Rothbacher Kirchlein!
Im Kaufmann Weyermüller aus Niederbronn besaß die Richtung einen Liederdichter, in Pfarrer Ihme aus dem Bärental einen gründlichen Choralkenner.
Ich hatte frühentwickelten musikalischen Sinn. Oft setzte sich mein Vater ans Klavier: »So, jetzt singen wir ein Lied: Eines wünsch' ich mir vor allem andern« – Mutters Lieblingslied – oder abends oft »Nun ruhen alle Wälder«; und Frau Elisabeth trat hinter ihn, und sie sangen miteinander die alten Gesänge der evangelischen Kirche von Luther und Paul Gerhard bis herab zu neueren Dichtern, wie Knapp, Spitta und dem Elsässer Weyermüller, jenem engen Freunde des Hauses Huser. Oder Großmutter saß mit mir in warmen Mondnächten am Fenster und sang mir in altväterischem Deutsch Volks- und Kinderlieder, wie »Güeter Mond, dü gehscht so stille durch die Abendwolken hin!« Und mein Tag schloß während der Abendglocke mit dem Lied »Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ« und mit dem Nachtgebet: »Müde bin ich, geh' zur Ruh«, das wir oft sangen, statt es nur zu sprechen. Zudem war ja mein Platz in der Kirche immer hart neben der Orgel, die ich früh schon spielen lernte.
So hat sich, gefestigt durch unweichliche Erziehung, in meinem Innersten von Kind an eine ernste und doch melodische Gemütskraft entfaltet.
Damals waren noch viele altdeutsche Volksgebräuche in unserm Elsaß lebendig. Wir hatten sie auf unsern unterelsässischen Dörfern durch die französische Herrschaft hindurchgerettet.
So war die Spinnstube oder »Maistube« (Maidenstube) ein guter alter Brauch. Dieses selber gesponnene und im Hause gewobene Zeug war unzerreißbar, und die fest gearbeiteten und kräftig bemalten Truhen hielten durch Geschlechter. Unsre Frauen und erwachsenen Mädchen trafen sich an Winterabenden beim knisternden Holzfeuer abwechselnd in irgendeiner Bauernstube und saßen nun an ihren Spinnrädern im Kreise um das einfache Öl- oder Talglicht. Auch meine Mutter war eine emsige Spinnerin. Ich durfte sie manchmal begleiten und ihr zwar die Laterne, aber nicht das sorgsam behütete, leicht verhudelte Spinnrad tragen. Dann wurde gebabbelt (geplaudert), gesungen oder vorgelesen; um den Kachelofen herum lungerten Männer und Burschen. Punkt zehn Uhr, wenn die Glocke läutete, wurde Bauernbrot herumgereicht und mit einigen Tropfen Kirsch- oder »Quetschewasser« beträufelt. Dann zerstreuten sich die Laternen wieder nach allen Seiten, und die Holzschuhe verhallten auf den harten Dorfgassen oder knirschten über den Schnee nach Hause.
Zu Pfingsten war es Sitte, daß die Schuljugend mit einem buntbebänderten Pfingstmaien von Haus zu Haus zog und in altmodisch gereimten Versen um Eier, Brot und Speck bat. Ich habe noch den Schlußreim im Ohr: »Eier heraus! Oder wir schicken den Marder ins Hühnerhaus!« Große Körbe wurden am Stecken durch zwei Henkel getragen, um die Vorräte zu bergen; Hausherr und Hausfrau traten vor die Tür, hörten unser Sprüchel an und spendeten ihren Beitrag. Dann ergoß sich der buntfarbige Zug unter den großen Schuppen in Balzers umfangreichem Hof, wo denn nach Herzenslust der gebackene Speck-Eierkuchen gemeinsam vertilgt wurde – eine Art Frühlingsfeier und Jugendfest.
Wenn eine Braut oder eben vermählte Frau auf ihrem hochbepackten Aussteuerwagen an den Ort ihrer Bestimmung fuhr, so mußte sie mit ihrem Spinnrade vorn neben dem Fuhrmann sitzen.
Der Brauch verlangte, daß zumal ärmere Leute, etwa am Eingang oder Ausgang des Dorfes, ein Seil über die Straße spannten und den Wagen zum Stehen brachten. Mit einigen Geldstücken mußte sich die junge Frau loskaufen. Es gab dabei natürlich Auflauf, Lachen und heitere Zurufe genug, wir Kinder fehlten nicht – und kurz: als einmal bei solchem Anlaß Pferde scheu wurden, genügte das der deutschen Behörde, den »Unfug« überhaupt zu verbieten.
So wurden auch die uralten Sonnwendfeuer nebst Scheibenwerfen – wonach der über Rothbach hangende Scheibenfelsen benannt ist – als Unfug vom preußischen Beamtentum untersagt. Aber die zähen Offweiler haben es sich bis heutigestags nicht nehmen lassen, ihre Feuerscheiben vom Berg zu schleudern. Wir Knaben der umliegenden Dörfer standen dann auf Anhöhen und spähten hinüber an die Berge, wo die glühenden Lichter durch die Johannisnacht zu Tal flogen.
Daß den Mädchen von ihren Geliebten Maien vors Haus gesteckt wurden, daß der »Meßti« (Kirmes, Kirchweihtag) ebenso mit besonderen Bräuchen verbunden war wie die Hochzeit und dergleichen bürgerliche Feste, das ist ja heute noch in allen Volksstämmen üblich. Schön und ergreifend war auch die Silvesternacht: denn da läuteten von zwölf bis ein Uhr sämtliche Glocken der vielen Dörfer. Welch eine Musik! Wir pflegten durch den Schnee nach einem Hügel emporzustampfen und dem gewaltigen Zusammenklang der metallenen Stimmen zu lauschen. Wir kannten die Glocken der Nachbarschaft am Geläut; aber fernere Glocken mischten sich drein, und manchmal, wenn etwa der Nordwind am Wasgenwald entlang brauste, war es eine geradezu großartige Verbrüderung in den Lüften.
Auf Erden freilich lieh die Verbrüderung der Herzen zu wünschen übrig. Mein Vater hatte sich mit raschem Entschluß in die deutsche Kultur eingelebt. Aber einige fünfzigtausend Elsässer waren bald nach dem Kriege ausgewandert nach Frankeich; weitere Tausende folgten nach und nach. An ihre Stelle strömten entsprechende Tausende von altdeutschen Beamten und Unterbeamten und füllten die Lücken aus. Viele zurückgebliebene Landeskinder aber gaben die unreife Losung aus: »Protestiert! Dient nicht der deutschen Verwaltung! Wir werden ja doch bald wieder französisch!« So saßen denn diese grollenden Elsässer charaktervoll – hintendran. Und die deutsche Regierung setzte selbstverständlich Eingewanderte an die verlassenen Plätze, weil sie doch nun einmal Leute brauchte. So lebten tätige Eingewanderte und grollende Alt-Elsässer nebeneinander auf derselben Scholle.
Zwischen Unterbeamten und Bevölkerung kamen gelegentlich unliebsame Reibereien vor, deren Ursache zum Teil am undurchgebildeten Menschentum lag, das von der deutschen Regierung verwandt werden mußte. Einige dieser kleinen Herren setzten den Anschnauzeton vom Kasernenhof auch im Verkehr mit den Bürgern fort. Ich entsinne mich eines Rentmeisters aus dem nahen Städtchen, mit dessen Grobheit mein Vater siegreiche Zusammenstöße bestand. Einmal zahlte dieser Steuerbeamte meinem Vater, um ihn zu ärgern, das Vierteljahrsgehalt in lauter abgeschliffenen Kreuzern aus; es war ein schwerer Sack, der nicht über Land zu tragen war. Mein Vater stand am Schalter und beschwerte sich über dies »Lumpedings«, aber er wurde schroff und grob hinausgewiesen. Die Bürger brachten ihre Steuern herbei. Da hatte denn Papa Humor genug, sich mit seiner Kupfermasse draußen aufzustellen und sich dafür Silber und Gold einwechseln zu lassen. Unverzüglich wanderte das Kupfer also wieder an den Schalter zurück, wo der Rentmeister nicht schlecht fluchte. Die Sache kam nebst andern Streitigkeiten sogar vor die Behörde. Lehrer Lienhart wurde angeklagt, er hätte Majestätsbeleidigung verübt; denn er hätte die Kreuzer »Lumpedings« genannt! Aber der Schulmeister von Obersulzbach wehrte sich tapfer seiner Haut, und der unliebenswürdige Rentmeister wurde versetzt.
Das achte Lebensjahr brachte dem Knaben die erste große Erschütterung durch körperlichen Schmerz. In meinem linken Auge trat eine rätselhafte Entzündung so heftig auf, daß ich manchmal vor Qual den Kopf wider die Wand stieß. Großmutter war nicht mehr am Leben; eine alte »Bäsel« aus dem Dorfe (»Base« nannte man einzelstehende ältere Frauen) saß ratlos an meinem Bett. Die Eltern waren bestürzt; der Landarzt verordnete Umschläge und ging wieder seiner Wege. Endlich wurde die Sache meinem Vater unheimlich. Er reiste mit mir nach Straßburg, was damals bei den spärlichen Eisenbahnen ziemlich umständlich war. Der Professor in der Blauwolkengasse besah das Auge. »Wären Sie einen Tag früher gekommen, so hätt' ich's geheilt. Jetzt muß der Junge operiert werden – und er wird leider lebenslang eine Verschleierung auf dem linken Auge behalten.« Mir krampfte sich das Herz zusammen, als Papa abreiste und mich allein ließ. Ich litt unter diesem ersten Alleinsein in fremder Stadt unbeschreiblich. Und dann das schmerzhafte Ausreißen der Augenwimpern, das widerliche Chloroform, das ich vor der Operation einatmen mußte, die fremden Leute, die mit mir im Zimmer hausten: kleinbürgerliche Ober-Elsässer mit ganz anderer Mundart und Lebensform – welch ein Zustand für den scheuen Dorfjungen! Aber auch der Jubel, als mich der oft so strenge und im Grunde so gütig besorgte Vater am schulfreien Donnerstag wieder heimholte!
Die kleine Narbe ist geblieben. Mein linkes Auge hat seine volle Sehkraft nicht wiedererhalten. Dieser Umstand hat mich übrigens zum Militärdienst untauglich gemacht.
Man drückt auf dem Lande seine Liebe zu Kindern oder Eltern selten mit ausgesprochenen Zärtlichkeiten aus. Oft sogar verbirgt sich liebende Sorge unter Schelt- und Mahnworten. Aber man hält doch mit dumpfer Anhänglichkeit fest zusammen. Ich selbst war eine spröde und stolze Natur. Einmal sollte ich meine Mutter wegen irgendeiner Unart um Verzeihung bitten: »Mama, ich will's nicht wiedertun.« Welche Prügel hat es gekostet, bis ich mich zu dieser Demütigung entschloß! Ich »genierte« mich; es vertrotzte, verhärtete sich irgend etwas in mir, das mir den Mund schloß. Ich weiß nicht, ob es überhaupt gelungen ist, die pädagogisch nicht einwandfreien Worte mir abzuringen. Und dabei litt ich selber am allermeisten unter dieser Unbiegsamkeit meines Naturells. Denn mein Herz war voll Bedürfnis nach Liebe.
Kinder dieser Art pflegen keine Musterschüler zu werden. Derselbe spröde Stolz, der mir die Kehle zuschnürte, wo mir Unrecht geschah oder wo der Befehl zu verletzend in mein Nervensystem fuhr, ließ mich stumm auf meinem Platz verharren, wenn ich vom Lehrer in hämischer Weise gefragt wurde. Diese Eigenart hat mir während eines Teils meiner Gymnasialzeit bittere Verkennung eingetragen. In der Dorfschule freilich, bei meinem frisch zugreifenden Vater, kam solche Stauung selten auf. Da saß ich immer obenan.
Doch mit meinem kaum begonnenen neunten Lebensjahre war diese dörfliche Freiherrlichkeit aus. Ich marschierte mit zwei Bauernsöhnen in die Sexta des Gymnasiums zu Buchsweiler. Es war Anfang Oktober; die knappen vier Kilometer auf guter Landstraße waren leicht zu bewältigen.
Mit welchen Segenswünschen wurde der Junge bei diesem ersten Ausmarsch, mit seinem Schulranzen auf dem Rücken, in den Herbstmorgen entlassen! Mutters Ältester, das war ja selbstverständlich, mußte Pfarrer werden wie ihr verehrter Papa Huser, dessen Haare sich inzwischen in Silber verwandelt hatten. Geistlicher Nachwuchs war nötig. Jener geliebte Seelsorger war ein Segen geworden für das Hanauer Ländchen; solcher Segen sollte auch von meiner Mutter Erstling ausströmen. Wie oft sah die Unermüdliche flickend und stopfend über meinen Kleidern und Strümpfen und wog jeden Sou hin und her, ehe sie ihn ausgab! Wie wurde mit Scharfsinn und Enthaltsamkeit für die Kinder gespart, um das teure Studium zu bezahlen und das ferne Ziel zu erreichen – das Ziel meiner frommen Mutter, einst in einer elsässischen Dorfkirche zu den Füßen ihres Sohnes zu sitzen und ihr Leben ausklingen zu lassen, wie es begonnen war: in religiöser Weihe!
Es kam anders.
Mein Vater wurde um die Mitte der siebziger Jahre in die größere Gemeinde Schillersdorf versetzt, was übrigens meinen Marsch ins Gymnasium erschwerte; denn die Entfernung von Buchsweiler betrug sechs Kilometer, die in Wind und Wetter, in Sommerglut und Winterfrost zurückgelegt sein wollten. Wie oft hat da meine Mutter den todmüde heimkehrenden Knaben liebevoll empfangen, umgekleidet, gefüttert! Aber ihre Stunden waren gezählt. Die regsam-freundliche Frau war auf die Mädchen und Frauen des Dorfes von gutem Einfluß; sie versammelte sie manchmal in unserm Hause und sang mit ihnen oder gab ihnen Anweisung im Sticken und dergleichen. Ich sehe sie noch strickend und zugleich lesend am Fenster sitzen, mit ihrer roten, gesunden Gesichtsfarbe und ihren etwas eckigen Zügen. Im Haushalt war sie rasch und rüstig. Ein Dienstmädchen brauchte sie nicht. Das Haus war ohne diese dem Vater ebenbürtige Gefährtin gar nicht vorstellbar.
Und doch! Sie mußte dahin in der Blüte ihrer Kraft. Am 9. März 1877, also in meinem elften Lebensjahre, ist sie einer hitzigen Krankheit erlegen. Ein Mädchen, das sie wenige Wochen zuvor geboren hatte, nachdem bereits in Obersulzbach zwei Brüderchen begraben waren, folgte der Mutter zwei Jahre später.
Das Sterbebett dieser tapferen und frommen Frau war eine Erbauung. Sie stärkte sich und die Umstehenden durch ihre Glaubensworte. Ihrem Gatten vertraute sie kurz vor dem Tode an, daß sie zwar schwere Seelenkämpfe bestanden habe: »Satan wollte mir meine Glaubensgewißheit nehmen, ich hab' ihm aber gesagt: Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn – da ist er gewichen, und nun bin ich ganz heiter und glücklich.« Jemand von den Anwesenden holte, als es zum Sterben ging, den Geistlichen des Ortes, einen harmlosen alten Mann, dessen verwaschener Rationalismus gar sehr abwich von der puritanischen Glaubensglut der Schülerin eines Pfarrer Huser. Aber als der Biedere an ihrem Bette stand und von ihren Tugenden zu sprechen anhub, winkte sie ab. »Wir sind alle Sünder«, stieß sie hervor, »und werden durch Jesum allein selig!« Und sie schickte ihn hinaus und vertraute sich ihrem Gott und Heiland ohne Vermittler an.
Dann kam die furchtbare Nachtstunde, wo wir zwei Knaben aus dem Schlaf geweckt, angekleidet und an ihr Bett hinübergeholt wurden. »Eure Mutter will euch noch einmal sehen, eure Mutter stirbt!« Sterben?! Der Tod! Was ist denn das?! Ich hatte die beiden Brüderchen und Großmutter im Sarg gesehen; jene waren sehr jung, diese sehr alt. Aber nun unsre lebensvolle Mutter?! Und da standen nun die Frauen weinend um ihr Bett herum, und Papa hob uns zu der Sterbenden empor in die Kissen. Mit fliegendem Atem nahm sie unsre Händchen, und wir mußten ihr das lang in mir nachwirkende Versprechen geben, Pfarrer zu werden und Gottes Wort zu verkündigen. »Der Herr beschütze euch, folgt eurem Papa!« So küßte und entließ uns unsre liebe Mutter. Ihre letzten Worte waren unter freundlichem Lächeln geflüstert: »O wie schön, wie schön!«
Halb betäubt legten sich die zwei Knaben im Wohnzimmer nebenan auf das Sofa – und ich hielt Augen und Ohren zu, um nichts mehr von dem unfaßlichen Schauspiel wahrzunehmen. Mein achtjähriger Bruder schlief noch rascher ein als ich. Es war schon nüchternes Tageslicht, als uns der Vater unter Tränen weckte: »Kinder, jetzt habt ihr keine Mutter mehr!«
Ich habe das Versprechen, das ich meiner Mutter auf dem Todesbett gegeben habe, nicht gebrochen. Mein Bruder hat es wörtlich ausgeführt; er ist Pfarrer im Elsaß. Ich meinerseits habe mit Zähigkeit die Göttlichkeit meines Sängerberufs festgehalten und durchgeführt, wenn auch nicht auf der bretternen Kanzel einer elsässischen Dorfkirche.
Und so möge jenes einfache Gedicht hier stehen, das ich einmal in späteren Jahren der Abgeschiedenen gewidmet habe:
Hab' ich den Wunsch in deiner letzten Nacht,
Als sie den Knaben an dein Bett gebracht,
Den Wunsch, ein Prediger des Herrn zu sein –
Hab' ich ihn treu erfüllt, lieb Mütterlein?
Wohl schweif' ich amtlos durch die offne Welt,
Der Stift mein Werkzeug und der Wald mein Zelt!
O Mutter, dennoch sollst du fröhlich sein:
Auf Berge baut' ich meine Kanzel ein!
All was da unten lebt – es lebt mir nicht,
Schau' ich es nicht in Gottes großem Licht.
Und was ich schaute, bring' ich fest und klar
Als Sänger meinem ganzen Volke dar.
Ihr Sterbliches ruht auf dem Gottesacker zu Schillersdorf, eine kleine Wegstunde von ihrem Geburtsort Rothbach entfernt. »Was ich jetzt tue, das weißt du nicht; du wirst es aber hernach erfahren« – so lautete der Leichentext.
Mit zwanzig Jahren zog sie in die Welt und gab ihrem Erstling das Leben; mit wenig über dreißig Jahren war die Ausfahrt vollendet.
Sie trug den Namen der Landgräfin und Heiligen von Thüringen, die ich später liebgewonnen habe. Es hätte schwere Kämpfe gekostet, wenn sie sich aus der frommen und tapferen Beschränktheit ihres wunderschönen Waldwinkels hätte umstellen müssen auf ihres ältesten Sohnes weitgespannten Lebens- und Bildungskreis. Davor ist die Gute bewahrt geblieben.
Mit meiner Mutter Tod war meine Kindheit zu Ende. Es begannen herbe Jahre. Aber es fehlte auch nicht an sonnigen Gegenkräften.
Ich gehöre nicht zu den weichlich zurückträumenden Naturen, die der Kindheit nachtrauern oder den entschwundenen Frühling beklagen. Der Herbst ist nicht des Frühlings Tod, sondern des Frühlings Erfüllung; denn die Blüte hat sich umgewandelt in Frucht. Und so schau' ich in die Kindheit zurück mit einem Gefühl des Dankes: ich habe sie nicht verloren, ich habe ihre geistigen Kräfte in mir. Die nämliche Sonne, die des Morgens in buntem Farbenspiel emporsteigt, verbreitet auch das klare Tageslicht und geht in neuer Farbenschönheit abends wieder hinab – in das geheimnisvolle Weltall, aus dem sie aufgetaucht ist.