
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
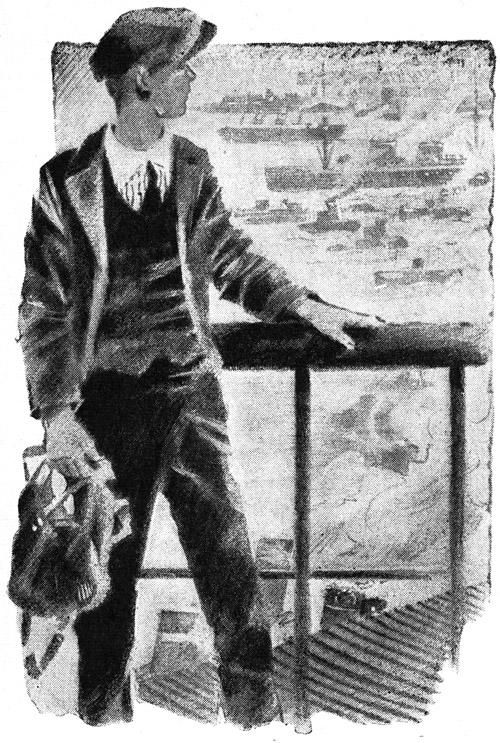
Die Dämmerung eines Spätaugusttages fällt auf den Alten Steinweg in Hamburg. Sie hüllt verschämt die heuchlerisch prunkenden Stuckfassaden der Gründerzeit ein, die aus dieser Straße gen Himmel ragen, die von der niedrigen Innenstadt mit ihren Fleten hinaufführt nach St. Pauli, dem Mittelpunkt des Vergnügungslebens. Diese beiden Pole geben der Straße auch ihr Gesicht. Die Kontore und Läden tauchen ins Dunkel, und die Lichtbündel der Kinos und die lockenden bunten Lampen der ärmlichen Cafés und Eisdielen beherrschen das Bild. Der Strom der von ihrer Tagesarbeit aus der Stadt Heimkehrenden verebbt, und bald wird sich die Straße mit Menschen füllen, die den lichtdurchfluteten Vergnügungsstätten unter dem geröteten Himmel entgegeneilen.
Im Wechsel zwischen Tag und Nacht hält die Straße für eine kurze Stunde den Atem an. Sie ist fast menschenleer. Aus einer der engen Gassen, die wie unergründliche Höhlen in die Nacht übergehen, tritt ein Polizeibeamter, der langsam sein Revier abschreitet. Es wird schon kühl, denkt er fröstelnd, die Zeit kommt, wo der Abenddienst hier wieder zu zweit versehen werden muß. Er wünscht, seine Dienststunden wären zu Ende. In seiner verharschten Wunde am Ellbogen, die er sich in einer Schlägerei in den Höfen des Gängegewirrs geholt hat, reißt und zieht es; das Wetter wird vielleicht umschlagen.
Durch johlendes Geschrei wird der Beamte veranlaßt, sich umzuwenden und die Straße hinaufzuschauen. Drei Betrunkene, anscheinend Seeleute, taumeln Arm in Arm mitten auf der Straße. Das ist stark. Man läßt hier schon allerlei durchgehen. Na, jetzt treten sie wenigstens auf den Bürgersteig. Er will sie nicht ansprechen, wenn's nicht durchaus nötig ist. Nun kommen sie näher und wollen an ihm vorüber. Er tritt ins Dunkel eines Hofeingangs. Da sieht er, wie einer die andern ganz nach links hinüberzieht. Holla, denkt er kühl, nun purzeln sie doch noch hin, oder sie fallen in die Scheiben des Cafés. Sie stürzen mit der Wucht ihrer drei Körper gegen einen jungen Mann, der ihnen den Rücken zukehrt und die hohen Tortenstücke in der Fensterauslage betrachtet. Der Junge ist auf nichts gefaßt und bricht in die Knie. Mit dem Kopf schlägt er gegen die Scheibe. Dann rappelt er sich auf und greift nach dem Brotbeutel, der ihm entfallen ist. Er begreift gar nicht, was da vorfiel. Sein erstes Gefühl ist ein rasender Schmerz im Kopf, als wäre etwas Schweres von oben auf ihn gefallen. Dann dreht er sich, um einen Halt zu gewinnen. Die ganze Straße mit ihren bunten Lichtern kreist um ihn.
»Mann, so schlimm war das doch nicht. Was haben Sie, sind Sie krank?«
Jetzt sieht er den Polizeibeamten, der vor ihm steht. »Mir war nicht wohl, es geht schon vorüber.«
Der Beamte ist Menschenkenner genug, um zu sehen, wen er vor sich hat: Einen jener jungen heimatlosen Wanderer, die, von der Großstadt angezogen, nach Hamburg kommen, aus romantischen Gefühlen, um Arbeit zu finden, oder nach Übersee zu fahren, die aber oft, wenn Enttäuschung und Verzweiflung sie packt, in den finstern Gängen dieses Stadtviertels untertauchen, wo das Laster wohnt.
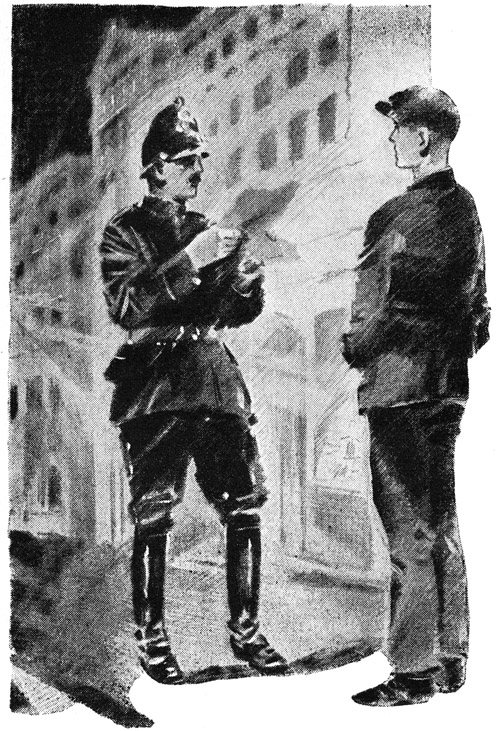
Heimatlos in der Großstadt
Er stellt Fragen. Nein, Wanderpapiere hat der junge Mensch nicht, in ein Wanderheim kann er den Obdachlosen nicht schicken. Irgendwelche Verwandte oder Bekannte? Auch nicht. Geld? Keins. Schon zwei Tage gehungert, die letzte Nacht im Park auf einer Bank geschlafen. Wohin mit ihm? Da bleibt nur das Polizeiasyl in der Neustädter Straße. Er habe die Pflicht, ihn dahin zu weisen. Ja natürlich, wenn's nur ein Dach über dem Kopf ist.
Ein Stück Wegs schreitet der Polizist neben dem Heimatlosen her. Kein übler Kerl, denkt er, gut gewachsen, das gäbe einen Sportler oder einen Soldaten. Ich glaube auch nicht, daß der untergeht. Jemand müßte ihn mal so richtig herausfuttern. »Hier ist meine Reviergrenze. Gehen Sie die Straße hinauf und halten Sie sich rechts.«
Der lang aufgeschossene Junge mit dem schlenkernden Schritt braucht keinen Führer mehr zur Herberge; dunkle Gestalten, obdach- und heimatlos wie er, tauchen vor ihm aus den Gängen und Torwegen auf. Sie streben alle dem gleichen Ziele zu, der letzten Zuflucht der Untergehenden: dem Polizeiasyl. Das hohe Polizeihaus mit den vergitterten Fenstern liegt in der Neustädter Straße versteckt nach hinten hinaus. Im Zuge der neuen Stadtplanung sind die Höfe des Gängeviertels bis auf geringe Reste abgerissen worden; heute sieht man von den Fenstern des Polizeihauses auf moderne, formschöne Wohnblocks.
Ein Vorsaal nimmt die müden Pilger auf. Die Augen des Neulings müssen sich erst an den Anblick gewöhnen, der sich ihm bietet; undurchdringlich scheint der Dunst. Doch dann erkennt er: Da stehen, sitzen oder liegen hundert Gestalten, die fast alle gleich aussehen, Bettler, Säufer, Heruntergekommene. Die Straße hat sie gleich gemacht. Wanderleben und Alkohol hat die älteren unter ihnen zerschlissen und ausgebrannt. Ihre Kleidung ist zerrissen, sie schleppen sich nur noch so hin. Die jüngeren Männer, die in der Mehrzahl sind – sie sehen noch besser aus, wie der Neuling feststellt. Er kennt das, sie halten immerhin auf sich. »Kein Mädchen guckt mich mehr an«, wäre der schwerste Makel, der auf sie fallen kann.
Ohne Scham wird da der Inhalt der Säcke ausgebreitet. Sie flicken ihre Lumpen oder rücken die Fußlappen zurecht. Aber keiner sieht den andern an oder bekümmert sich im geringsten um ihn. Das Gefühl für Gemeinschaft scheint gänzlich in ihnen ausgelöscht. Das einzige Gemeinsame ist die Not, und hier schließlich das Dach über dem Kopf. Das bindet nicht. Kein Wort wird gesprochen, eher noch auf der Straße als hier. Viele haben den ganzen Tag gehungert, Gier und Müdigkeit beherrscht sie.
Der Neuling fühlt, daß er sich nicht unter diese Menschen mischen kann. So weit herunter kann er noch nicht sein! Er geht mitten durch die Menge. Da erscheint in einer erhöhten Durchgangstür ein Wärter. Bewegung gerät unter die Masse; denn jetzt werden wieder vierzig Mann vorgelassen. Der Neuling treibt in dem Strome fort und wird nach oben gerissen. Säcke mit harten Gegenständen stoßen ihm gegen die Knie. Man drängt die Stufen hinauf in den zweiten Saal. Hastig nehmen die vierzig auf Bänken Platz. Halt, es sind genug.
»Stiefel ausziehen!«
Die meisten sind Stammgäste und wissen schon Bescheid.
»Bankweise vortreten und die Papiere abgeben.«
Für die speckigen Personalpapiere händigt man ihnen ein Badetuch aus. Sie werfen sich Stiefel und Gepäck über die Schulter und begeben sich im Gänsemarsch in den Badesaal.
In der Mitte des gekachelten Raumes hängt von der Decke ein riesiges reckartiges Eisengestell herab, aus dem ein warmer Rieselregen auf die vierzig bärtigen Männer strömt, die sich mit einer staunenswerten Schnelligkeit entkleidet haben. Auch dem Jungen tut das warme Wasser nach den Strapazen der letzten Tage unendlich wohl. Zugleich bringt es den Hunger stärker zum Bewußtsein und eine bleierne Müdigkeit! Schlafen, nur schlafen!
Eine Seitentür führt zum Aufnahmeraum. Die Männer drängen sich um die Barriere, wo ihre Namen aufgerufen werden und sie ihre Papiere nebst einer Blechmarke zurückerhalten. Der Raum leert sich rasch. Nur einer bleibt zurück.
»Holtz? – Wie ist Ihr Vorname?«
»Hans.«
»Haben Sie nicht mehr Papiere? Dieser alte Abmeldeschein aus Düsseldorf genügt nicht. Wir brauchen mindestens zwei Papiere.«
»Ich habe nichts.«
»Woher kommen Sie? Wo haben Sie die letzte Nacht geschlafen?«
Hans Holtz gibt Auskunft. Die Beamten treten hinter die Karteikästen. Da fällt ihm ein: Einen Brief von der Mutter muß er bei sich haben. Sie schrieb ihm, als er im Rheinland war. Zwei Jahre ist das schon her. Hier ist er ja.
»Holtz, wie wollen Sie beweisen, daß Sie das Papier nicht gestohlen oder gefälscht haben?«
Da reicht er den Brief seiner Mutter hin. Man vergleicht die Anschrift. Der Vorsteher liest ihn halblaut vor:
»... mein Junge, das darfst Du Deiner Mutter nicht antun. Dein Vater ist tot. Dein Bruder blieb im Krieg, ich hab niemanden mehr als Dich. Du willst in die Welt, aber denk auch mal an Deine Mutter ...«
Solche Worte mögen selten zwischen diesen Wänden erklungen sein. Hans Holtz hat den Brief seiner Mutter lange nicht gelesen, und aus fremdem Munde wirkt das gesprochene Wort wie ein gewaltiger Appell. Das war seine Mutter, die da sprach! Er wischt sich mit dem Rockärmel über die Nase, und während die Beamten überlegen, ob sie Holtz der Kriminalpolizei übergeben sollen, geht die Tür auf, und der nächste Schub von vierzig Mann drängt sich heran. Holtz hat, ehe er sich's versieht, seine Papiere und die Blechmarke in Händen.
Man schiebt ihn zur Essenausgabe und zum Speisesaal, doch er tut alles mit halbem Bewußtsein. Er kommt erst wieder zu sich, als er in einem der großen Schlafsäle auf dem eisernen Netz liegt. Die Bohnensuppe liegt ihm schwer im Magen, er kann nicht einschlafen. Er hat nur ein Untergestell erwischt, die Oberpritschen sind bereits alle besetzt gewesen. Es ist ihm allerdings nicht ungewohnt, seine Kleidung anzubehalten; denn ein Unterbett oder Decken gibt es nicht. Die bloßen Füße frieren, trotz der feuchten Wärme, die im Raume herrscht.
Gegenüber sieht er auf eine lange Reihe bloßer Füße. Stöhnen, Schnarchen, untermischt mit dem dengelnden Klang der Drahtnetze, wenn sich jemand umdreht, erfüllt den Raum. Schlafen, nur schlafen! Der junge Kerl über ihm scheint schwer zu träumen, er wälzt sich und spricht im Schlaf. Erinnerungen wachen auf. Er möchte auch schlafen und von seiner Mutter träumen. Die übelriechende, heiße Luft betäubt ihn. Und während er auf die verschwitzten Fenster schaut, durch die ein schwacher Mondschein dringt, weilt er in Gedanken bei seiner Mutter und schläft dabei ein.
Am andern Morgen im Speisesaal ist's, während Hans Holtz vor seinem Blechbecher sitzt und das trockne Kommißbrot verzehrt. Da vernimmt er vom nebelverdunkelten Fenster her ein Stimmengetön wie fernes Orgelbrausen, das Rufen der Schiffe im Hafen.
Er steht früher vom Mahl auf als die Brüder von der Landstraße, die ja nichts zu versäumen haben. Der Beamte im weißen Kittel am Saaldurchgang mustert ihn. »Willst zwei Stunden arbeiten?« Und als Holtz nicht zusagt: »Für einen Gutschein in der Kaffeehalle?«
Doch Holtz schüttelt den Kopf und geht durch den leeren Eingangsraum, auf dem noch die Stimmung der Trostlosigkeit liegt, auf die Straße.
Nebel umfängt ihn. Er tastet sich den fernen Rufen nach, als gälten sie ihm.