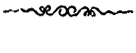|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es gibt in der Welt nichts Schrecklicheres, nichts Grausameres als Selbstquälerei; nichts wird schonungsloser betrieben, als in vielen Fällen das Wüthen auf diese Art gegen seine eigene Person. Und dabei wird es uns so leicht, die schwächsten Seiten unseres Opfers aufzufinden, da wir eben dieses Opfer selbst sind und deßhalb auch unsere schwächsten Seiten, unsere verwundbarsten Stellen am besten kennen; und der Selbstquäler treibt dieses Geschäft meist ohne Ruhe und Rast, ohne Aufhören.
Ein anderer Peiniger hat doch Augenblicke, wo er von seinem Schlachtopfer ablassen muß; er kann sich nicht immer bei seinen Quälereien aufhalten, er muß doch sich und dem unglücklichen Geschöpfe, das er quält, zuweilen einige Ruhe gönnen, wäre es auch nur zur Zeit des Schlafes. Nicht so der Selbstquäler. Läßt dieser sich doch während des langen Tages und während eines großen Theiles der Nacht, wenn er sich ruhelos aus seinem Lager hin und her wirft, nicht eine Sekunde lang aus seinen herz- und gemüth-zerfleischenden Krallen; ist doch sein Ohr auch zugleich das des Unglücklichen; ja, noch mehr, sind doch seine Gedanken auch die des Anderen, und jeder, den er im Kopfe sich selbst zur Qual gebiert, macht den Kreislauf durch sein aufgeregtes Gehirn, durch sein erhitztes Blut, um wie ein immer neuer Keulenschlag auf den armen Kopf zurück zu fallen. Und er kennt dabei keine Schonung; für alles, was andere Menschen ihm gethan oder zu ihm gesagt, hat er die giftigsten Auslegungen; er bemerkt sogleich die Schlange, die hinter jedem harmlosen Worte lauert; er fühlt, daß das Lächeln seines Nebenmenschen nur Maske ist, und sieht als Fortsetzung eines freundlichen Grußes, eines lieblichen Lächelns von schönem Munde hämisches Naserümpfen, verächtliches Achselzucken. Und wie sieht und hört der Selbstquäler! Sein Ohr reicht meilenweit, und es ist für ihn eine Kleinigkeit, um die Ecke zu schauen.
Nach dieser unserer Schilderung, die gewiß nicht übertrieben ist, sollte man glauben oder wenigstens hoffen, die Gattung der Selbstquäler sei wenig zahlreich. Aber dem ist leider nicht so; die Selbstquäler sind ein zahlloses, weitverzweigtes Geschlecht, zu ihnen gehört mancher, der es sich nicht einmal bewußt ist, sie finden sich in jedem Alter, von jenen kleinen Geschöpfen an, welche mit Stolz die ersten Höschen tragen, bis zu jenen verlebten Gestalten, die ohne Stolz die letzten anziehen; dazu in jedem Stande, bei Arm und Reich, bei Vornehm und Gering. Glaube nicht, geliebter Leser, daß du eine Ausnahme machest; auch du bist Selbstquäler, wissentlich oder unbewußt, vielleicht in diesem Augenblicke, wenn du anfängst, dieses Kapitel zu lesen, und dabei den Gedanken hegst, es nehme dir einen Theil deiner kostbaren Zeit und gehöre doch eigentlich nicht zu der Geschichte, die wir dir erzählen wollten. Auch wir sind Selbstquäler, sehr Selbstquäler; doch gehört das nicht hieher; wir wollen vielleicht ein ander Mal darüber sprechen.
Ja, Tausende und aber Tausende von uns haben sich selbst gequält von jener glückseligen Zeit an, wo sie noch in die Schule gingen, bis heute, wo, Gott mag es wissen, welcher Grund sie zu ihren Selbstquälereien veranlaßt. Damals betrachteten wir das Röckchen unseres Nachbars oder dessen Tafel, sein Federmesser, oder was es sonst war, fanden das alles viel schöner und fragten uns, ohne ihn gerade zu beneiden: Warum sind meine Sachen nicht so neu oder reich? Daran schloß sich eine ganze Kette von Selbstquälereien, und steigerten sich diese bis zum Unerträglichen, wenn wir, auf morgen ein strenges Strafgericht vorhersehend, während des Abends und vor dem Einschlafen Zahl und Geschmack der Prügel mit einer sehr lebhaften Knaben-Phantasie uns aufs furchtbarste vergegenwärtigten – Prügel, die vielleicht am anderen Tage gar nicht erschienen. Oder wenn sie, für die wir schon damals schwärmten, an uns vorüber ging, ohne uns eines Grußes zu würdigen, unsere Veilchen verschmähte und dafür die Vergißmeinnicht jenes langen tölpelhaften Schlingels nahm, der mit uns in der gleichen Bank saß und beständig ein impertinentes Lächeln bereit hatte, wenn wir eine Frage nicht beantworten konnten, die ihm eine leichte war. O schreckliche Stunden, die darauf folgten, wo wir uns die Werthlosigkeit der eigenen Person mit so schrecklichen Farben auf feuchten Kissen vormalten, wo wir es uns erklären konnten, nachdem wir einen schüchternen Blick in den Spiegel geworfen, daß sie die Vergißmeinnicht dem Veilchen vorzog, wo wir überzeugt waren, es nie zu begreifen, warum das verfluchte Quadrat der Hypothenuse gleich sei mit jenem dummen Quadrat der beiden Katheten, wo wir selbst einsahen, daß wir nie etwas Rechtes lernen würden und uns also wirklich nur die Wahl blieb zwischen Tambour und Schneiderlehrling, wie uns unser Vater prophezeite!
Vorbei! – Die Tage folgen einander, aber gleichen sich nur in den Selbstquälereien, die wir nicht lassen können und welche mit jedem Tage stärker werden. Dabei ist es eigenthümlich, wie sehr sie sich bei manchen Unglücklichen steigern, wenn jene Zeit herannaht, wo man in der That verliebt ist. Da entwickelt sich aus der gewöhnlichen Selbstquälerei eine ebenso furchtbare Schwester, die Eifersucht, und was die eine erfährt, oder auch nur erdenkt, das flüstert die andere hohnlachend in unser Ohr. Die Beiden zusammen aber verwandeln uns vollkommen, und sind wir schon vorher aufgeregter Natur gewesen, so werden wir jetzt förmliche Narren; haben wir uns aber bis dahin ein ruhiges Temperament bewahrt, so ist alsdann die Zeit gekommen, wo wir uns ruhelos umhertreiben, wie das personificirte schlechte Gewissen, wo sich unser heiterer Blick trübt und wir selbst am hellen Mittage Schatten und Gespenster zu sehen glauben.
George von Breda war einer von den Glücklichen, die früher wenig oder gar nicht unter Selbstquälereien gelitten; er war eine ruhige harmonische Natur, mit Philosophie genug, um das Leben gerade so zu nehmen, wie es sich ihm darbot, und mit der Kraft eines vollkommen gesunden Gemüthes, welches sich allen Einflüsterungen heiter entgegenwarf und nicht an Schlangen dachte, wenn es Rosen vor sich sah. Auch er hatte sich in letzter Zeit geändert, auch ihn hatte der Dämon der Selbstquälerei heimgesucht. Wie hatte er bis hieher so ruhig, so vollkommen glücklich das liebliche Mädchen betrachtet, das um ihn spielte wie ein heiterer Sonnenstrahl, das sein Herz, seinen Geist erfreute wie ein. frischer Frühlingstag, an dem ja auch er seinen Antheil hatte, und den für sich allein besitzen zu wollen, ja wohl keinem Sterblichen einfallen wird! Wie war ihm alles so wunderbar erschienen, was ihr Blick getroffen, was ihre Hand berührt, eigenthümlich verschönert, fast wie geweiht! Die Rose, deren Duft das junge Mädchen genossen, erschien ihm von einer eigenen, besonders schönen Art; das Wasser, welches von dem Springbrunnen auf ihre weiße Hand fiel, wenn sie dieselbe neckisch darunter hielt, war für ihn klarer und reiner als alles, was er bis jetzt gesehen; Regentropfen, die sich in ihrem dunklen Haare festhängten, erschienen ihm wie Perlen und Brillanten, und wenn er mit den Fingern leicht darüber fuhr, so konnte er sich ordentlich kindisch wundern, daß sie vergingen und nichts davon zurückblieb.
O, er war sehr glücklich gewesen, so glücklich, daß er keine Grenzen seines Glücks ahnte. Und als diese sich ihm endlich zeigten, waren sie so schroffer und drohender Art, daß er förmlich davor zurückschauderte und nur noch die schwarzen Schatten sah, welche sie auf das bisher unabsehbare Gefilde seiner Glückseligkeit warfen – finstere, unheimliche Schatten, die sich um sein schönes, großes Herz legten, es zusammendrückend, die sein sonst so klares Auge mit trüben, garstigen Schleiern bedeckten. Und durch diese Schleier erschienen ihm begreiflicher Weise alle Gegenstände entstellt und in unnatürlicher Färbung.
Als die Baronin ihm zum ersten Male von einer Verheirathung Eugeniens sprach, bebte er zusammen, weil er einen Verlust vor sich sah, den er bis dahin nicht für möglich gehalten, und weil er durch das entsetzliche Gefühl, welches ihm dieser drohende Verlust verursachte, erst recht und mit Schrecken einsah, wie er sein Herz an jenes Mädchen gekettet, wie er es liebte, grenzenlos, unaussprechlich. Schmerzlich hatte er nach diesem Geständnisse mit sich selbst gerungen, hatte es versucht, seine Vernunft walten zu lassen – vergeblich! Es gelang keinem Grunde mehr, in sein Herz zu dringen, das ganz von ihrem Bilde angefüllt war.
Die bis jetzt so ruhige, eiserne Natur George's hatte gewaltig gekämpft; der heitere Tag seines Lebens hatte sich mit schwarzen, drohenden Wolken bezogen, böse Wetter stiegen vor seiner Seele auf, deren dumpfen, rollenden Donner er zu hören vermeinte und deren endlicher Ausbruch alles das zu zerstören drohte, was ihm bisher lieb und theuer gewesen. Zuweilen leuchtete auch ein Blitz durch die Nacht seiner Seele, ein Blitz, der in Flammenschrift die Worte schrieb, welche die Mutter des jungen Mädchens zu ihm gesprochen: – Auch Eugenie! Ach, und wenn diese auflodernde Flamme ihn auch auf Sekunden klar sehen ließ, ihn vielleicht erfreute, so erschien ihm doch gleich darauf wieder die Finsterniß, welche ihn umgab, um so drückender, um so trostloser. – Auch Eugenie!
Doch hielt auch dieses tiefe Leiden nicht an; Stunden und Tage milderten es, und als er sah, wie sich Eugenie so gleich blieb, wie sie nach wie vor unbefangen und heiter in dem Hause schaltete, so kehrte – nicht der süße Friede, der ihn bis jetzt so glücklich gemacht, in sein Herz zurück, wohl aber eine Ruhe, wenn auch keine erquickende Ruhe; es war jene nicht mehr, die ihn stundenlang heiter und zufrieden an Eugenie denken ließ, wenn sie abwesend war, oder die ihm beim Anblicke des lieblichen Mädchens ein inneres reines Vergnügen gewährte; – es war vielmehr die Ruhe, die wir uns gewaltsam aneignen, um Körper und Seele zu stärken für unabweisbare Kämpfe, jene Ruhe, die eigentlich keine Ruhe ist, sondern nur ein fieberhaftes Hinträumen, in welchem wir angstvoll jede äußere Erscheinung betrachten, jede Wolke am klaren Himmel argwöhnisch beobachten, ob sie nicht auf uns einen zerschmetternden Blitzstrahl herabsenden werde. – Auch Eugenie! O, dieses schreckliche Wort konnte sein Herz jetzt freudig erbeben machen, um ihm gleich darauf das tiefste Weh zu bereiten.
So ging es George von Breda, wenn er sich bei Eugenien im Zimmer befand und mit düsterem Blicke ihre wunderbare Gestalt betrachtete, doch dabei nur mit halbem Ohr ihren Worten lauschend. Der Galoppschlag eines Pferdes, das Rasseln eines Wagens schreckte ihn empor; es konnte ja Fremont sein oder die Mutter Eugeniens, oder sonst ein Feind, der kam, um ihm sein Glück zu entreißen. Wie hatte es ihn sonst so erfreut, dem jungen Mädchen zuzuschauen, wenn sie im Wintergarten saß, den Kopf in die Hand gestützt, und nachsinnend dem aufsteigenden Wasserstrahle zuschaute. – Jetzt beunruhigte ihn ein solches Nachsinnen. – Was ging durch ihre Seele? Hatte sie ihre Mutter gesprochen, hatte sie Briefe von dieser erhalten, hatte vielleicht Fremont Mittel gefunden, sich auf irgend eine Art dem Mädchen zu nähern? Dachte sie vielleicht selbst an eine veränderte Stellung im Leben? – Entsetzlich! Machte sie vielleicht Vergleiche zwischen seinem Hause und einem eigenen?
In solchen Momenten konnte er sie fast zitternd fragen: »Woran dachtest du, Eugenie?« Und wenn sie zur Antwort gab: »Ich dachte an das kommende Frühjahr, an unser kleines Landhaus, an den herrlichen grünen Wald, an all die tausend Blumen, und an die schönen Tage, wo wir dort Besuch machen werden,« – dann durchschauerte es ihn einen Augenblick freudig, im anderen aber biß er die Zähne zusammen, ballte krampfhaft die Hand und murmelte vor sich hin: »Ah! wohl mag sie daran denken, aber dabei gewiß auch an einen anderen Begleiter, der ihr zur Seite reitet!«
Ein Wort, eine Anspielung, der Eintritt des Kammerdieners, um einen Besuch anzumelden, konnten den Baron unruhig machen; er haßte die ganze Welt, denn Alles schien sich zu bestreben, Eugeniens Aufmerksamkeit zu erregen. Früher im unbestrittenen, wenngleich vollkommen harmlosen Besitze des jungen Mädchens, war er glücklich darüber, wenn alle Menschen sie bewunderten; jetzt, wo damit ein Verlust für ihn in Gefahr stand, fürchtete er ein bezeichnendes Wort, einen freudig erstaunten Blick. – O, er war sehr, sehr unglücklich! Wenn in solchen Augenblicken die Vernunft wieder in ihre Rechte trat, so konnte er mit einem tiefen Seufzer den Wunsch hegen, sie, die jetzt sein ganzes Herz erfüllte, nie gesehen zu haben.
Wer sucht, der findet, und wer mit Eifer sucht, um so gewisser. Je ängstlicher sich der Baron vielleicht bedeutungslose Worte und Blicke Eugeniens aus ihrem Zusammenhange riß und willkürlich an einander kettete, um so eher glaubte er zu der Gewißheit zu gelangen, sie habe irgendwoher von der Werbung des Baron Fremont Kunde erhalten, und ihr Wesen sei seither verändert. Daß er selbst anders geworden war und manchmal schroff gegen sie sein konnte, einen ihrer aufrichtigsten Blicke finster erwiderte, ein Wort, das ihm außergewöhnlich erschien, barsch beantwortete, fiel ihm nicht ein; er dachte nicht an die Ursache – sondern nur an die Wirkung, und er hatte nicht Unrecht, als er endlich mit Schrecken zu bemerken glaubte, daß das junge Mädchen in seiner Gegenwart befangen wurde, daß sie ihre Augen nicht mehr so offen und frei gegen ihn aufschlug, wie früher, daß sie sich mit ihrem zartfühlenden Herzen scheu in sich zusammenzog, wie gewisse Pflanzen und Blüthen bei rauher Berührung.
Wenig verminderte es seinen erwachten Argwohn, daß weder die Baronin, noch seine Schwägerin, noch sonst Jemand seit jenem ersten Male über die Verbindung Eugeniens mit dem Baron Fremont weiter mit ihm sprach. Man intriguirt im Geheimen gegen mich, dachte er; man wird nächstens mit der fertigen Sache vor mich hintreten; ich habe alsdann nur noch Ja zu sagen.
Es war dem Baron früher nie eingefallen, sich darnach zu erkundigen, wohin seine Frau und Eugenie ihre Spazierfahrten richteten, welche Besuche sie machten, was sie überhaupt in dieser Richtung in seiner Abwesenheit thaten. Wie oft war Eugenie in dem kleinen Phaeton allein ausgefahren, hatte eine Bekannte aufgesucht, oder war in den Umgebungen der Stadt gewesen! Damals hatte es ihn nur gefreut, wenn sie überhaupt seinen kleinen Phaeton benutzte, er war ihm dadurch nur um so lieber geworden. Jetzt fand er es nicht mehr so recht passend, daß ein junges Mädchen allein ausfahre, und er hatte schon mit der Baronin darüber gesprochen, sowie über vereinzelte Fälle, wo Eugenie ohne Begleitung ausgegangen.
Freilich waren es nur Augenblicke, in welchen er so dachte, und ein beruhigendes Wort seiner Frau, das stille, gemessene Wesen Eugeniens ließen ihn seinen Argwohn gleich darauf wieder belächeln. Aber die Gefühle, welche ihn beherrschten, wechselten oftmals schneller, als der Pulsschlag seines erregten Blutes; – er sah am Fenster stehend Eugenie aus dem Hause verschwinden, um einen kleinen Spaziergang zu machen; er erwiderte heiter ihren freundlichen Gruß, um gleich darauf, ein furchtbarer Selbstquäler, den finstersten Gedanken Raum zu geben, um vielleicht in der nächsten Minute sein Pferd zu besteigen und ruhelos Straßen und Wege zu durchstreifen. – Gewiß, er war sehr, sehr unglücklich.
So geschah es auch eines Vormittags, daß Eugenie bei klarem, angenehmem Wetter einige Einkäufe besorgen wollte und allein das Haus zu Fuße verließ. Onkel George befand sich gerade im Wintergarten und gab für ein neues Arrangement dem Gärtner seine Befehle, als das junge Mädchen leicht zu ihm hinschritt und, von ihm Abschied nehmend, ihm freundlich die Hand reichte.
»Du gehst in die Stadt?« fragte der Baron.
»Ja, Onkel George, ich will einige Einkäufe machen.«
Gewöhnlich pflegte Eugenie alsdann hinzuzusetzen: »Willst du mich nicht begleiten, Onkel George?« oder: »Kannst du mich irgendwo treffen? ich werde um die und die Stunde da oder dort sein.« – Heute sagte sie nichts davon.
»Hat sie es vergessen?« fragte sich der Baron, dem das nicht entging, »oder wollte sie es absichtlich nicht sagen, wohin ihr Weg sie führe?« Ihm schwebte es auf der Zunge, ihr seine Begleitung anzutragen. Früher hätte er es in unbefangener Weise gewiß gethan, heute aber dachte er unmuthig: Warum das? – warum mich hier aufdrängen? mir eine abschlägige Antwort geben lassen? Sie wird um einen Grund, meine Begleitung abzulehnen, nicht verlegen sein. – Und doch! – nein, nein! – Er hielt ihre Hand ein paar Sekunden lang in der seinigen, und es war ihm, als könne er sich nicht entschließen, diese Hand fahren zu lassen.
Auch Eugenie schien durchaus keine Eile zu haben, ja, es war, als suche sie einen Vorwand, bei dem Baron stehen zu bleiben, denn sie fragte Dies und Das, lauter gleichgültige Dinge, und dabei schien es ihm, als habe ihre Stimme nicht den gewöhnlichen frischen Klang, als bebten ihre Finger leicht in den seinigen. Er sagte: »Du solltest vielleicht Friedrich mitnehmen, er könnte dir deine Einkäufe tragen,« und er setzte lächelnd hinzu: »Ihr Damen könnt ja doch nie erwarten, bis man euch eure Herrlichkeiten nach Hause bringt.«
»Nein, nein, Onkel George,«: gab Eugenie hastig zur Antwort, »ich danke. Es ist nicht viel, was ich einzukaufen beabsichtige, und dann weißt du wohl, ich habe nicht gern einen Diener hinter mir drein gehen.«
Und auch darauf sagte sie nicht: »Vielleicht könntest du mich begleiten, Onkel George;« sie zog sanft ihre Hand aus der seinigen, und als sie nun ihren leichten Mantel fester um sich nahm und sich zum Weggehen wandte, schien sie seine Blicke zu vermeiden, sie bog ihr Gesicht zu einer Rosenknospe hinab, die eben daran war, sich zu öffnen, und streifte mit ihren Fingern leicht über die feinen, rothen, duftigen Blättchen.
Andreas, der Gärtner, der in der Nähe stand, öffnete ehrerbietig die Thür des Glashauses, und dahin schritt das schöne Mädchen mit dem raschen elastischen Gange. Gewöhnlich schaute sie sich um, ehe sie das Thor erreichte, um noch einmal freundlich zurück zu grüßen. – George von Breda wartete mit Spannung darauf. Heute that sie es nicht; dagegen schritt sie zögernder, als sie dem Ausgange nahe war, und ein paar Mal schien es, als wolle sie stehen bleiben, umkehren, wie wenn sie sich auf etwas besänne, das sie noch im Hause sagen müsse, oder als wolle sie eine vergessene Sache holen. Dann aber erhob sie plötzlich den Kopf, den sie etwas gesenkt hatte, nahm ihren raschen Schritt wieder auf und war gleich darauf in der Biegung des Weges vor dem Thore verschwunden.
Der Baron wußte nicht, warum sich sein Herz auf einmal schmerzlich zusammenzog, warum er nur mühsam athmen konnte. War es ihm doch gerade, als verlasse Eugenie in dieser Stunde sein Haus für immer; ja, wenn er auch über diesen Gedanken lächeln mußte, so konnte er ihn doch nicht ganz verbannen. Voll dieser sonderbaren Phantasie, blickte er im Wintergarten umher, und obgleich hier hunderte von Blumen und Blüthen ihre bunten Farben zeigten, schien ihm Alles öde, leer, erstorben. Das war kein frisches Grün mehr, was ihn von allen Seiten umgab; es schien kein Frühling werden zu wollen, es kam ihm vor wie ein später Herbsttag, wie beginnender Winter, ja, es fröstelte ihn, wie es wohl zu geschehen pflegt, wenn wir draußen die ersten Schneeflocken herabwirbeln sehen.
Das ist ein eigenes Gefühl, sprach er zu sich selber und versuchte zu lächeln. Ah, dumme Träumereien! Eugenie wird nach einer Stunde, oder noch früher, dort gerade so wieder in den Hof treten, wie sie ihn verlassen hat. – Und doch, sollten meine finsteren Gedanken von so eben eine Bedeutung haben? Obgleich ich diesen Augenblick gewiß nicht vergessen werde, will ich mir doch ein Zeichen machen, das ihn mir noch lebhafter zurückrufen soll.
Bei diesen Worten brach der Baron die Rosenknospe ab, über welche Eugenie vorher mit der Hand gestreift, und legte sie in sein Taschentuch. – »Kleine Blumenleiche,« murmelte er, »solltest du mir doch etwas Fürchterliches erzählen, wenn ich dich wiedersehe? – – Hinaus, hinaus! ich muß ins Freie!«
Damit schritt er eilig durch den Wintergarten in das Haus zurück, wogegen Andreas, sobald ihm der Herr aus dem Gesichtskreis entschwunden war, dessen Stelle an der Thür des Wintergartens einnahm. Er verhalf sich mit großer Umständlichkeit zu einer Prise, rieb darauf die Achsel an der eisernen Einfassung der Thür und lächelte vergnügt in sich hinein.
Das macht sich, sprach er alsdann zu sich selber; das macht sich; ich sehe es deutlich, obgleich ich nur meine Kübel begieße und die Blumen aufbinde. Den Teufel auch! solche Geschichten führen nie zu einem guten Ende; ich hätte es der gnädigen Frau damals schon prophezeien können, ehe sie noch gnädige Frau war, und wo ich mit der einzigen Beschäftigung, ihre zwölf Blumenscherben in Ordnung zu halten, ein Leben hatte wie Gott in Frankreich, wenn mich nicht der Respekt daran gehindert hätte. Der verdammte Respekt! Na, wenn die Sachen einmal zum Klappen kommen, da werden ihr wohl die Augen aufgehen. Der Gestrenge wird etwas klein beigeben, und dann kann es sich auch noch machen. –
Er rieb behaglich seine Hände. – Auf alle Fälle aber, fuhr er nach einer Pause fort, werden wir die Prinzessin los, und das ist mir vorderhand die Hauptsache. – Hochmuth und Armseligkeit! – Als wenn es nothwendig wäre, daß ich mich deßhalb vor aller Welt müßte schuhriegeln lassen, weil ich in der Wohnstube geboren bin und kein so glattes Gesicht besitze oder eine gedrechselte Figur. Wie ich aber immer sagte: Ausdauer. – Er vollendete den Satz nicht, sondern prallte von der Glasthür zurück hinter einen der Orangenkübel, weil er den Baron von Breda so eben aus dem Hause kommen sah.
Dieser richtete seine Schritte nach dem Ausgange des Hofes und verschwand nach eben der Seite, wohin auch Eugenie gegangen war.
Andreas hatte dies durch die Zweige des Orangenbaumes bemerkt; er lächelte abermals vergnügt in sich hinein und war im Begriff, sein Selbstgespräch wieder aufzunehmen, als er fühlte, daß ihm Jemand leise auf die Schulter tippte. Rasch wandte er sich um und machte ein sehr gleichgültiges Gesicht, als er den kleinen Reitknecht bemerkte, der hinter ihn geschlichen war und ihn auf die eben beschriebene Art in seinen Betrachtungen störte.
»Ich dachte, es sei was Rechtes,« sprach der Gärtner achselzuckend, »das mich da in meiner Arbeit unterbricht. So du bist es? Ich meine, du hättest doch genug in deinem Stall zu thun, um den Mist auszukehren; zu sonst etwas bist du doch nicht zu gebrauchen. – Was willst du eigentlich?«
»Bst!« Machte der Groom und legte mit einem ungemein wichtigen Gesicht den Finger an den Mund, wobei er sich etwas affektirt nach allen Seiten umschaute.
»Was hast du denn da zu gaffen? Das möchte ich wissen,« fuhr Andreas fort, der sich nun aufrichtete und, ohne den Anderen weiter anzuschauen, einen kleinen dürren Zweig des Orangenbaumes behutsam wegschnitt. »Fürchtest du dich, überrascht zu werden, armer Kerl? Ja, deine Thaten sind freilich so ungeheurer Art, daß du dich in Acht nehmen mußt, um nicht entdeckt zu werden. Laß mich zufrieden und geh in deinen Stall.«
Ohne sich durch diese unfreundlichen Reden verscheuchen zu lassen, flüsterte der Reitknecht: »Ist Niemand mehr in der Nähe?«
»Das weißt du so gut wie ich,« entgegnete der Andere barsch; »denn wenn Jemand in der Nähe wäre, würdest du es ja gar nicht gewagt haben, hieher zu kommen. Thut dieser Kerl doch, als wisse er nicht, daß das gnädige Fräulein und der Herr ausgegangen sind.«
»Aber Beide allein,« sagte Friedrich mit Beziehung.
»Allerdings Beide allein. Das geschieht so oft, wie sie auch mit einander ausgehen.«
»Heute aber wären sie nicht mit einander ausgegangen,« sprach der kleine Groom mit einem pfiffigen Lächeln. »Darauf könnt Ihr Euch verlassen, Andreas. Das gnädige Fräulein hat allein ausgehen wollen; ich weiß das ganz genau. – Ja, leider weiß ich es,« setzte er hinzu, indem er affektirt seufzte. »O du lieber Himmel! ich bin wirklich sehr dumm gewesen.«
»Nun, das unterschreib' ich dir vor Zeugen,« gab der Gärtner, der anfing, auf die Worte des Reitknechts aufmerksam zu werden, kopfnickend zur Antwort. »Dumm warst du von jeher, dumm wie – wie – ich weiß wahrhaftig nichts so Dummes.« Dabei setzte er sich auf den Kübel des Orangenbaumes, nahm seinen einen Fuß auf das Knie und scharrte mit seinem Gartenmesser die Erde vom Stiefel.
»Ich darf mich nicht beklagen,« sprach nun wirklich seufzend der Groom, »habt Ihr mir doch oft gerathen, und, wie ich wohl sagen darf, gut gerathen. Aber jetzt wird wohl Alles aus sein.«
»Du sprichst ja wie ein Todtenkopf,« erwiderte der Gärtner. »Wer lebt, hat noch nicht verloren. Entweder hast du heute Morgen einen starken Schnaps getrunken, Bürschlein, oder dir ist etwas Absonderliches begegnet, he!«
»Mir ist freilich etwas Absonderliches begegnet,« versetzte der Andere, wobei er melancholisch den Kopf hängen ließ. »Ach! das hätte ich nimmer gedacht. Nein, nein, das hätte ich nimmer gedacht!«
»Was du denkst, ist mir sehr gleichgültig,« sagte barsch der Gärtner, »denn das ist nie etwas Gescheidtes. Wenn ich aber erfahren soll, was dir Absonderliches begegnet ist, so thu gefälligst dein Maul auf und sprich. Aus dem Gefasel könnte sogar ein Gescheidter nicht klug werden.«
Friedrich schluckte ein paar Mal heftig, blickte wiederholt scheu um sich und setzte sich alsdann neben Andreas auf den Rand des Kübels.
»Ihr habt mir anempfohlen,« flüsterte er, »genau aufzupassen, wenn der Jäger Klaus wieder komme, um, wenn es möglich sei, zu erfahren, was er mit dem gnädigen Fräulein verhandle. – Heute früh ist er da gewesen.«
»So?«
»Ja ich war glücklicher Weise auf dem Heuboden und konnte ihn also sehen, wie er um die Hofmauer herum schlich. Er ging zu der kleinen Thür herein, die nach den Stallungen führt und die nur angelehnt war, dann verlor er sich in die Ecke des Gartens hinter dem Gebüsch von immergrünen Bäumen.
»Oho!« machte Andreas, »das ist der einzige Platz, um Jemandem insgeheim zu sprechen. Und du?«
»Ich that, wie Ihr mich geheißen, ging längs der Mauer auf dem weichen Sandwege; Ihr hättet mich sehen sollen, wie ich das geschickt machte.«
»Ja, schleichen kannst du; aber sprich weiter.«
»Und kroch dann hinter die Strohdecken, die Ihr dort aufgestellt.«
»Siehst du nun, daß ich immer Recht habe,« unterbrach der Gärtner den Groom mit einem finsteren Stirnrunzeln. »Dahin mußte der kommen. O, wenn du Kerl nur meinem Rath folgen wolltest! – Nun?«
»Ich brauchte nicht lange zu warten,« fuhr Friedrich fort, »da hörte ich leise Tritte und sah das gnädige Fräulein daher kommen. Sie reichte dem Klaus so freundlich ihre beiden Hände, daß es mir einen Stich ins Herz gab.«
»Ja, der Klaus ist auch ein tüchtiger Kerl, der hat Courage; der fürchtet sich nicht. Aber erzähle weiter, wer weiß, ob nicht bald Jemand kommt und uns stört.«
»Zuerst sprachen sie Dies und Das, was mich nicht besonders interessirte.«
»Da ist Alles interessant.«
»Von einer armen Familie, der es nun wieder etwas besser geht, von dem kleinen Kinde des Tagelöhners, das nicht mehr krank sei, und dergleichen.«.
Andreas zuckte verächtlich mit den Achseln.
»Dann aber ging's los,« sagte triumphirend der kleine Reitknecht. »Klaus sprach von Jemand, der, wie das gnädige Fräulein wohl wisse, sich so sehr darauf freue, sie wieder zu sehen; er sagte auch bittend, sie habe schon so oft versprochen, der alten Frau einen Besuch zu machen.«
»Der alten Frau?« fragte der Gärtner.
»Nun, eine alte Frau kann auch da sein. Das versteht sich am Ende von selbst. Aber auch von ihm war die Rede.«
»Von wem?«
»Von Jemand, der das gnädige Fräulein früher gesehen, der sehr leidend gewesen, dem es jetzt aber etwas besser gehe und der seine einzige Hoffnung darauf gesetzt habe, das freundliche Gesicht des gnädigen Fräuleins wieder einmal zu sehen. – Es ist ja bei der alten Frau, sagte Klaus, nachdem er eindringlich gebeten.«
»Das ist allerdings nicht unwichtig,« sprach Andreas, nachdem er eine kurze Weile nachgedacht. »Und die Gnädige?«
»O mein lieber Himmel!« antwortete Friedrich wehmüthig, »sie sagte endlich Ja, sie werde kommen.«
»Und wann?« forschte eifrig der Gärtner.
»Heute noch, um elf Uhr.«
»Das geschieht dir schon rechts Schafskopf,« sagte scheinbar ärgerlich der Gärtner.
»Was geschieht denn mir wieder einmal recht?« fragte verwundert der Andere.
»Nun, wenn du das nicht begreifst – daß dir da Jemand zuvorgekommen ist! Wie oft habe ich dir gesagt und bewiesen, daß sie nach dir hinsieht! Wie oft habe ich dich ermahnt, dein Glück zu versuchen! Ja, dazu gehört Courage, und was das ist, weißt du gar nicht. – Siehst du nun ein, wie Recht ich gehabt?«
»Ja, ich glaube, daß ich es einsehe,« erwiderte traurig der kleine Reitknecht und kratzte sich am Kopfe.
»Da hilft kein Kopfkratzen mehr, und wenn ich die Sache bei Licht betrachte, so könntest du immer noch was unternehmen, wenn du ein rechter Kerl wärest. Wer weiß, was es mit Klaus für eine Geschichte ist! Du bist ein junger Mensch, Friedrich, der sich schon kann sehen lassen; ich kann dir versichern, wenn mir das Glück so lächelte wie dir, ich würde mich keinen Augenblick besinnen, es zu ergreifen. Wenn sie auch irgend wohin gegarten ist, wo es Niemand wissen soll, was schadet's dir? Bist du durch deine Hartherzigkeit nicht im Grunde selbst schuld daran? – Ja, du bist es,« fuhr er fort, indem er sich gegen den Groom umwandte und ihn durch einen Blick bannte, wie die listige Schlange den armen Vogel. »Dich kann sie bei alle dem doch nicht vergessen. Was war doch vorhin wieder, ehe sie wegging?« – Er that, als wenn er sich besänne. – »Ja, richtig! der Herr Baron sagte zu ihr: Laß doch den Friedrich mit dir gehen, er kann dir deine Sachen tragen, worauf sie antwortete, und mit einem leichten Seufzer, antwortete: Ach nein, ich mag den Friedrich nicht so als Diener hinter mir drein gehen lassen. – Aha! dachte ich, nicht so als Diener! Verstehst du das, Bursche?«
»Ich glaube, daß ich es verstehe,« antwortete der Groom mit einem ziemlich dummen Lächeln.
»Nun, Gott sei Dank, wenn du es verstehst. Ich habe es verstanden. Nicht als Diener – ja, gehorsamer Diener! Nun,« unterbrach er sich, indem er seine Schnupftabaksdose hervorzog, »was soll ich da Wetter an dich hin reden? mir kann es egal sein.«
»Aber mir ist es nicht egal, Andreas,« sagte energisch der Reitknecht und fuhr sich mit der Hand über sein struppiges Haar. »Ich versichere Euch, ich habe an allen Gliedern gebebt, als ich das hörte und dabei das gnädige Fräulein ansah, wie sie so außergewöhnlich schön ist. – Ach! ich hätte jetzt auch vielleicht so weit sein können, wie der Jemand, der gewiß nicht besser ist als ich. Wozu sonst diese Heimlichkeiten?«
»Das sind die ersten vernünftigen Worte, die ich von dir höre.«
»Wer was denkt Ihr denn von der Geschichte selbst?« forschte eifrig der Groom. »Sollte denn wirklich etwas daran sein?«
»Wenn du recht gehört hast,« erwiderte der Gärtner mit ernster Miene, wobei er seine Achseln ungewöhnlich hoch erhob, »so will ich für nichts einstehen. Aber wenn du ein ordentlicher Kerl bist, so ist jetzt für dich die Zeit da, um zu handeln. – Wohin sie auch gegangen sein mag, – das kannst du mir glauben, ehe sie wegging, dachte sie an dich und sprach von dir. – Das wäre mir genug.«
»Mir ist es auch genug,« gab Friedrich entschlossen zur Antwort, wobei er sein Röckchen fest in die Taille zog und dann seine Haare, mit beiden Händen pätschelte. »Ihr habt Recht, Andreas; ich bin wahrhaftig so gut wie der Jemand des Jägers Klaus, und nach den vielen Beweisen von – Wohlwollen, die sie mir gegeben, kann ich mir schon etwas erlauben. – Andreas, Ihr sollt von mir hören.«
Der Blick, womit nach diesen Worten der Gärtner seinen kleinen Nachbar von der Seite betrachtete, den dieser aber nicht sah, da er, in tiefe Gedanken versunken, den Kopf in seiner Hand ruhen ließ, war ein Gemisch vorn Bosheit und Schadenfreude. Nach einigen Sekunden sprach er, indem er dem Groom leicht auf die Schulter tippte:
»Das hast du freilich schon oft gesagt, mein guter Freund, aber wir wollen sehen, ob man allen Glauben au dich verlieren muß, oder ob du wirklich noch zu etwas Besserem auf der Welt bist, als Pferde zu putzen und den Stall auszumisten.«
»Laßt diese Reden jetzt sein,« entgegnete Friedrich gekränkt; »man muß Einem die süßen Gedanken, die man hat, nicht mit so prosaischen Aeußerungen verderben. – Ausmisten!« fügte er verächtlich bei, »das ist überhaupt nicht meine Beschäftigung; ich bin Reitknecht, Jockey; mein Bruder, der Kellner, würde sagen, er sei Leibpage, wenn er in meinen Stiefeln stäke.«
»Ja, dein Bruder, der Kellner, ist ein anderer Kerl,« gab Andreas kopfnickend zur Antwort; »der hat Poesie im Leibe, das will ich meinen. Der hätte nicht so lange gefackelt. Nun, ein gut Ding, das sich bessert,« fügte er bei, während er sich erhob und alsdann dem Anderen auf die Achseln klopfte. »Laß mich was von dir hören, Bürschlein, und meine volle Achtung soll dir nicht fehlen.«
Der kleine Groom machte eine Bewegung mit dem Kopfe und erhob die rechte Hand, wodurch er ausdrücken zu wollen schien: Wir wollen nicht weiter darüber reden, Ihr werdet schon sehen. Dann stand er auf, klopfte sorgfältig die Erde von seinen Reithosen ab und begab sich in den Stall.
Als der Gärtner allein war, stützte er den Arm auf einen Stamm des Orangenbaumes, legte den Kopf darauf und sagte: »Ei, ei, so weit wären wir also! Nun, wenn ich jetzt nicht gewonnenes Spiel habe und nicht Eins ums Andere in die Luft springt, da will ich doch Scheerenschleifer werden. Das geht über alle meine Erwartungen. O, wenn der Gestrenge, der dort eben hinter der Gnädigen drein schoß, sie erreichte oder sie irgend wohin gehen sähe, wo sie nicht hin gehört – das wäre nicht mit Geld zu bezahlen. Auf jeden Fall muß es Mittel und Wege geben, es ihm beizubringen. Dazu ist François auf der Welt. Wenn der es weiß, so weiß es auch die gnädige Frau Mutter, und dann wird es auch uns hier im Hause nicht lange mehr verschwiegen bleiben. – Was aber jene dumme Bestie anbelangt« – damit wandte er die Augen nach der Richtung, in welcher der kleine Reitknecht verschwunden war – »so glaube ich, ist ihm genug eingeheizt und der Kerl wirklich im Stande, den heillosesten Streich zu machen, den sich je ein Reitknecht zu Schulden kommen ließ. Na, viel Glück! Es ist mir gerade,« setzte er händereibend und mit dem uns bekannten freundlichen Lächeln hinzu, »als wenn die Luft doch noch einmal hier rein werden könnte. – Frisch ausgespielt, Herzen ist Trumpf!«