
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
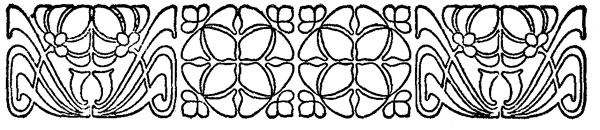
Ganz ähnlich wie der eben geschilderte Tag, sowohl was die ungünstige Witterung wie die Nichterfüllung seiner lebhaftesten Wünsche betraf, verliefen Franz Marssen auch die beiden nächsten Tage. Morgens hing die Luft voller Nebel, vom Mittag an bis zum Abend regnete es unaufhörlich, und seine Arbeiten schritten dabei rasch vor, während die Erwartung seines Herzens auf das Höchste stieg, denn im Nachbargarten war in diesen ersten drei Tagen nach seiner Rückkehr kein Mensch erschienen, der ihm irgend eine Kunde von den Bewohnern jener stillen Pension gebracht hätte, die ihm jetzt von allen, welche Interlaken füllten, die bei weitem wichtigsten geworden waren: und je länger er von Miß Edda getrennt blieb, um so höher schwollen die Wogen seiner Sehnsucht nach ihr auf, bis sie zuletzt in eine fieberhafte Unruhe überging, deren Symptome er nur mit Mühe dem mit anderen Dingen beschäftigten Vater, viel weniger aber der aufmerksamen Schwester desselben zu verbergen imstande war.
Endlich, nachdem schon drei lange Tage immer wieder erneuter Hoffnung und ewig vergeblichen Harrens vergangen waren, brach der vierte Morgen an, und abermals war es ein trüber und regnerischer, die Berge waren mit trauernden Nebelschleiern verhangen, und das schöne Tal, welches die Aare durchströmt, bot ein Bild der Melancholie dar, wie man es nur selten in den besten Monaten des Jahres auf längere Zeit zu sehen bekommt.
Franz hatte an diesem Morgen keine Ruhe mehr im Bette. Schon um vier Uhr hatte er es verlassen und sich eine Stunde, rastlos hierhin und dorthin schweifend, in den nahe gelegenen Umgebungen seines Hauses umhergetrieben. Nach fünf Uhr betrat er sein Atelier, und nachdem er mit einem Seufzer den stillen öden Obstgarten begrüßt, der auch mit Trauernebeln erfüllt war, begann er seine Arbeit, indem er diesmal die Hochlandschaft vornahm, deren Hauptfigur er an diesem Tage zu vollenden hoffte.
Während des Malens aber beschäftigte er sich unausgesetzt mit Grübeleien über sein seltsames Mißgeschick, und endlich sagte er sich: »Wenn sie auch heute nicht in den Garten kommt, so werde ich mich entschließen müssen, ihr auf irgend einem anderen Wege zu begegnen. Ich sehe auch gar nicht ein, warum ich ihr Haus nicht besuchen sollte, in welches ich freilich nicht eingeladen bin, dessen Schwelle zu betreten, mir aber gewiß niemand verwehren wird, da Miß Edda selbst – ich irre gewiß nicht darin – mich nur willkommen heißen würde.«
Diesen Gedanken verfolgte er im Laufe des Vormittags immer wieder von neuem, so oft er aber mit wachsendem Verlangen, ihn zur Tat werden zu lassen, zu ihm zurückkehrte, so fand sich auch ein Hindernis vor, und zuletzt war es sogar eine innere Stimme, deren Rat er nie zu überhören pflegte, die ihn von dem so lange überlegten kühnen Entschluß zurückhielt. Was diese Stimme ihm zuflüsterte, und warum er ihr gehorchte, das wußte er freilich nicht und danach forschte er nicht: es war eben ein dunkles hemmendes Gefühl, welches ihn von dem Besuche des Nachbarhauses abschreckte, so daß schließlich der ganze schöne, schon halb und halb gefaßte Entschluß in sich selbst zerrann und nichts als eine gesteigerte Sehnsucht in dem Herzen des jungen Mannes zurückblieb, das immer lebhafter klopfte und von einer namenlosen inneren Angst mehr denn jemals in seinem Leben gepeinigt ward.
Endlich wurde dies ängstliche beklemmende Gefühl so arg in seiner Brust, daß er mitten in der Arbeit innehalten und sich ein wenig ruhen mußte. Wie er nun so still und nachdenklich, den Kopf in die Hand gestützt, auf seinem kleinen Sofa saß, fiel ihm ein anderer Gedanke ein, und diesen ergriff er zuerst mit leidenschaftlicher Heftigkeit, als den einzigen Weg, der ihn zum Ziele führen konnte. Er betraf die Absicht, der holländischen Familie den versprochenen Besuch abzustatten und sich bei dieser Gelegenheit auf geschickte Weise nach Miß Edda zu erkundigen. Allein als er sich diesen neuen Entschluß nach allen Seiten überlegte, stand er auch davon wieder ab. Er hatte durchaus keine Neigung dazu und war auch viel zu befangen und unruhig, um unter fremde oder ihm wenigstens noch ziemlich fern stehende Menschen zu gehen, die unmöglich ein so lebhaftes Interesse an Personen nahmen, wie er es dafür empfand. Und selbst wenn sie freiwillig, oder durch seine Anregung dazu gebracht, über Miß Edda zu sprechen begannen, wie sollte er sich ihren beobachtenden Mienen gegenüber verhalten, er, dem schon der bloße Gedanke an sie oder die Nennung ihres Namens alles Blut aus dem Herzen ins Gesicht jagte? Nein, mit ihm noch so fern stehenden Menschen über Miß Edda wie über eine fremde, gleichgültige Person zu reden, das war ihm unmöglich, davor empfand er eine Art bangen Grauens, denn nur in ihm allein lebte und webte sie so, wie sie war, in ihrem eigentümlichen Reiz, in ihrer geheimnisvollen und um so verführerischen Erscheinung, und für dieses sein inneres Leben und Weben konnten andere ja kein Verständnis haben, er würde sich also ihnen gegenüber verraten und vielleicht gar Miß Edda selbst dadurch Verlegenheit bereiten.
Nein, nein, auch das war kein maßgebender Gedanke, kein richtiger, durchzuführender Plan, es blieb ihm also weiter nichts übrig, als geduldig – o Geduld bei solch' leidenschaftlichem Gefühl! – auszuharren, das Wiederauftreten ihrer Person abzuwarten und bis dahin von dem bisher erlebten Glück zu zehren, ohne sich in eine neue Hoffnung einzuwiegen, denn Franz Marssen war kein Mensch, der sich phantastische Luftschlösser baute und schon die Zukunft seines Lebens mit strahlendem Glanz verbrämt sah, so lange seine Gegenwart noch trübe und finster war. Von seinem Vater hatte er so viel praktischen Sinn geerbt, daß er sich in seiner augenblicklichen Lage zurechtzufinden wußte, er beurteilte sie weder günstig noch ungünstig, er nahm sie nur auf, wie sie war, und höchstens erfüllte ihn ein schmerzliches Bedauern, daß das schöne zutrauliche Verhältnis, welches früher zwischen der schönen Dame und ihm gewaltet, nun mit einem Male wie durch die Schere einer mißgünstigen Parze abgeschnitten schien, daß der grüne Rasenfleck und der Tisch unter dem Apfelbaum, der noch immer dastand, jetzt so öde und leer blieb, und daß irgend eine unergründliche Ursache vorhanden sein mußte, die sie abhielt, jenes ihn so beglückende Verhältnis weiter fortzusetzen.
Von diesem Bedauern ganz und gar erfüllt und sich nun ohne weiteren Widerstand in sein Schicksal ergebend, verließ Franz sein Atelier, um sich zu einem Ausgange anzukleiden, da er in einer Drogenhandlung in Interlaken, die zugleich eine Apotheke war, einige Materialien für seine Malerei kaufen mußte. Als er in das Vorderhaus trat, stand der Rappe seines Vaters gesattelt vor der Tür, und dieser kam eben heraus und stieg auf, um, wie es schien, einen weiteren Ritt anzutreten.
»Willst du bei dem schlechten Wetter spazieren reiten?« fragte ihn Franz, indem er an seine Seite trat.
Der Doktor hob seinen Kopf nach dem Himmel empor und entgegnete: »Es regnet ja jetzt nicht mehr, Franz. Überdies muß ich einen Kranken besuchen, und da darf mich das Wetter nicht abhalten. Adieu, mein Junge, wir werden uns erst am späten Abend wiedersehen.«
Langsam ritt Doktor Marssen ab und wählte ganz gegen seine frühere Gewohnheit die enge Gasse, in welcher die benachbarte Pension lag, in deren Fenster hineinzuspähen er nun einmal Verlangen trug, denn so wenig er darüber sprach: jenes herrliche Antlitz, welches er auf der Leinwand bei seinem Sohn gesehen, zog ihn noch immer auf eine unerklärliche Weise an, und gar zu gern hätte er es selbst in seiner natürlichen Schönheit bewundert – ein Wunsch, der ihm leider aber auch an diesem Tage noch nicht erfüllt werden sollte. –
Franz kleidete sich an, nahm einen Regenschirm und ging bei wieder leise sprühendem Regen langsam nach der Apotheke, ohne jedoch die Dreistigkeit zu haben, denselben Weg dahin zu wählen, den sein Vater genommen, obgleich er der kürzeste von allen übrigen war. Wenig auf die Menschen achtend, die ihm begegneten, ganz seinem stillen Grübeln hingegeben, schritt er über den Höheweg dahin und trat endlich am oberen Ende der Straße in die Apotheke ein, wo man das von ihm Begehrte vorrätig hielt. Schon hatte er dasselbe in der Tasche und wollte eben wieder der Tür zuschreiten, als er auf das freudigste überrascht ward und doch erschrak, denn durch diese Tür trat in demselben Augenblick Miß Rosy, um eine Arznei zu holen, die schon angefertigt in einer Schachtel auf dem Tisch der Apotheke stand.
Auch Miß Rosy schien erfreut, den Maler so unverhofft wiederzusehen, wenigstens nahmen ihre Augen sogleich den freundlichen Ausdruck jener demütigen Milde an, die ihr eigen war, und welche Franz Marssen schon früher veranlaßt hatte, ihr seine Aufmerksamkeit zu schenken. Heute aber lag außer dieser milden Freundlichkeit noch eine gewisse ängstliche Scheu in ihrem Auge, als sie so unvorbereitet auf den Maler traf, und mit einiger Verlegenheit reichte sie ihm die Hand, da er ihr die seinige sogleich entgegenstreckte und sie mit einigen herzlichen Worten begrüßt hatte.
Miß Rosy jedoch sprach im Laden nur wenig, und erst nachdem sie ihre in Papier gewickelte Schachtel empfangen hatte und mit Franz auf die Straße hinausgetreten war, äußerte sie sich etwas freier. Als er sie nun fragte, ob sie nach Hause gehe, bot er ihr nach Bejahung dieser Frage höflich Arm und Schirm dar. Sie nahm beides dankbar an, und so schritten die sich so zufällig Begegnenden langsam die Straße wieder hinab, ohne gegenseitig von sich zu wissen, daß des einen Herz ebenso heftig vor brennender Neugier schlug, wie das andere von einer zaghaften Zurückhaltung bedrückt war, welche letztere erst allmählich wich, nachdem Franz in seinem früheren herzlichen Ton mehrere Fragen an das gute Mädchen gerichtet hatte.
»Ich freue mich sehr,« begann Franz das Gespräch, während er absichtlich seine Schritte immer langsamer werden ließ, »Sie einmal wiederzusehen, Miß Rosy. Aber Sie haben, wie es scheint, Arznei aus der Apotheke geholt, und das bekümmert mich einigermaßen, zumal Sie selbst dieses Geschäft besorgen und demselben dadurch eine größere Wichtigkeit beilegen.«
»Ach, Sir,« entgegnete die Engländerin, die sich dicht an die Seite des Malers drängte, als wolle sie von dem über ihren Kopf gehaltenen Schirm möglichst Nutzen ziehen, »in unserm Hause geht es nicht sonderlich gut her. Unser Diener ist seit zwei Tagen bettlägerig krank, und so muß ich schon selbst kleine Geschäftsgänge übernehmen, da wir nicht zu jeder Zeit einen anderen Bedienten haben.«
»So haben Sie jene Arznei für diesen Diener geholt?«
»Ach nein, Sir,« versetzte Miß Rosy mit sichtlichem Rückhalt, »diese Arznei ist nicht für den Diener; der hat die seinige schon gestern erhalten.«
»So ist die Frau Baronin wohl kränker geworden?«
»Auch das nicht, Sir. Mit meiner Lady geht es immer in der alten Weise fort, und sie nimmt schon lange keine Arznei mehr, da sie einen unbesieglichen Widerwillen dagegen hat. Nein, diese Schachtel ist für den Herrn Baron.«
»Wie,« rief Franz verwundert, »ist denn auch er krank?«
Die Engländerin schwieg nachdenklich, dann erhob sie langsam ihr blaues Auge und sah den jungen Mann mit einer fast kindlichen Vertraulichkeit an. »Darf ich Ihnen noch immer vertrauen?« fragte sie mit leiser und beinahe bittender Stimme.
»Miß Rosy,« erwiderte Franz mit seiner warmen natürlichen Innigkeit, »vertrauen Sie mir ganz und gar. Sie können mir glauben, daß ich großen Anteil an der Familie nehme, in der Sie selbst heimisch sind.«
»Ich weiß es, Sir, und deshalb rede ich so gern mit Ihnen, da ich ja keinen Menschen sonst hier habe, vor dem ich mein Herz ausschütten kann. Was ich Ihnen aber auch sage, sei es nun jetzt oder ein andermal, Sie dürfen nie darüber reden, und am wenigsten mit – mit Miß Edda.«
»Ich will es nicht, ich verspreche es Ihnen; doch nun öffnen Sie mir Ihr Herz.«
»Soweit ich kann, ja, Sir. Nun denn, in unserm Hause, dessen Verhältnisse Ihnen ja einigermaßen bekannt sind, ist nicht alles so, wie es sein sollte. Und jetzt noch viel weniger als früher. Der Herr Baron hat ein schweres Amt auf sich und wird, da er es nicht nach Wunsch bewältigen kann, nicht selten in Verlegenheit gesetzt. So scheint es mir wenigstens. Er muß beständig zwischen hier und Bern hin und her reisen, und heute mittag um drei Uhr geht er wieder auf einige Tage dahin ab. Das macht ihn verdrießlich und ungenießbar, und wir alle haben mehr oder weniger darunter zu leiden. Vor der kranken Lady, die er sehr liebt, legt er sich noch den meisten Zwang auf, Miß Edda aber hat alle seine Launen zu ertragen. Sie allein weiß auch mit ihm zu verkehren, ihm mit gutem Rat an die Hand zu gehen, und so ist ihre Zeit, so lange der Vater da ist und seine Verhältnisse so übel stehen, mehr denn je von ihm in Anspruch genommen.«
Hier atmete Franz so laut und erleichtert auf, daß ihn Miß Rosy fragend von der Seite ansah, aber da er ermunternd lächelte, sogleich zu sprechen fortfuhr. »Ja, Sir,« sagte sie, »Miß Edda ist ihrem geplagten Vater ein großer Trost, und da sie einen starken Geist, einen festen Willen und eine große natürliche Kraft in allen ihren Entschlüssen besitzt, so tut der Vater fast keinen Schritt, den er nicht mit ihr vorher genau überlegt hätte. Da haben Sie alles, was ich Ihnen sagen darf, und ich bin gewiß, nicht mehr verraten zu haben, als ich füglich auf mein Gewissen nehmen kann.«
»Ja, das können Sie dreist, Miß Rosy,« erwiderte Franz lächelnd, »denn eigentlich haben Sie mir nichts gesagt, was ich nicht schon längst gewußt oder wenigstens vermutet hätte. – Aber Miß Edda ist doch ganz wohl?« setzte er, um endlich zum Ziele zu kommen, mit leise bebender Stimme hinzu.
Miß Rosy wollte wieder nicht recht mit der Sprache heraus und sah ihren Führer noch einmal bedenklich von der Seite an. »O ja,« sagte sie endlich, »körperlich ist sie gewiß wohl, denn sie strotzt von Gesundheit und Frische, aber ihr Gemüt scheint mir etwas bedrückt zu sein.«
»Ihr Gemüt? Bedrückt? O, das wird die Folge der Verwicklungen ihres Vaters sein, die sie so genau kennt –«
Miß Rosy schüttelte den Kopf. »Ach nein, Sir, das glaube ich nicht. Ich habe es erst bemerkt, seitdem sie von der Reise nach dem schönen Gletscher zurückgekehrt ist, die ihr nicht ganz wohlgetan zu haben scheint.«
»Nicht wohlgetan? O, sie wird noch ein wenig angestrengt und davon ermüdet sein?«
»Ermüdet? Das ist auch nicht der Fall. Nein, Sir, es muß etwas anderes sein, und ergründen kann ich es nicht, denn Miß Edda ist gegen ihre Eltern und mich nie so schweigsam gewesen, wie eben jetzt, und nur mit Mühe haben wir ihr einige Mitteilungen über diese Reise selbst abpressen können.«
Die beiden unter dem Schirm Gehenden hatten jetzt die belebteste Stelle des Höheweges erreicht, und viele Menschen gingen dicht an ihnen vorüber. Miß Rosy drängte sich unwillkürlich immer näher an den jungen Mann und warf zuweilen scheue Blicke um sich her, als besorge sie, von irgend jemanden bemerkt oder beobachtet zu werden. Franz hätte für sein Leben gern noch viel mehr mit ihr über Miß Edda gesprochen, aber die Engländerin beeilte ihre Schritte, und er merkte ihr an, daß sie den Abbruch der Unterhaltung wünsche. Endlich hatten sie die kleine Nebenstraße erreicht, welche zunächst nach der stillen Pension führte, wo Baron Bolton wohnte, und hier blieb Miß Rosy stehen, reichte Franz mit herzlichem Wohlwollen die Hand und, indem sie ihren eigenen Schirm aufspannte, sagte sie lächelnd:
»Sir, ich ginge gern noch weiter mit Ihnen, aber es geht nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil ich nicht darf.«
»Sie dürfen nicht?«
»Nein, aber fragen Sie mich nicht, ich bin wirklich zu plauderhaft, wie Miß Edda sagt, und Sie sehen mich mit so bittenden Augen an, daß ich Ihnen kaum widerstehen kann.«
Franz drückte ihr noch einmal die Hand und sagte dann: »So will ich Sie weder mit Worten noch Blicken weiter bedrängen. Gehen Sie und empfehlen Sie mich Miß Edda, wenn ich darum bitten darf.«
Miß Rosy schüttelte bedenklich den Kopf. »Nein, Sir,« sagte sie fest, »das tue ich auch nicht. Bestellen Sie keinen Gruß an Miß Edda, denn ich überbringe ihn nicht.«
Franz blickte höchst überrascht auf. »Warum denn nicht?« brachte er mit zitternden Lippen hervor.
Miß Rosy besann sich eine Weile, ehe sie antwortete. Endlich sagte sie dreist, indem sie noch einmal dicht an den Maler herantrat: »Ich will es Ihnen sagen, Sie verstehen zu schweigen, ich weiß es. Miß Edda sieht es nicht gern, daß ich mit Ihnen mehr spreche, als nötig ist, und wenn ich in Ihrer Nähe bin, beobachtet sie mich mit Augen, wie nur sie welche im Kopfe hat. Man könnte sie darin die Tochter des Argus nennen.«
»Aber warum sieht sie das nicht gern, und warum beobachtet sie Sie so genau?« fragte Franz mit steigender Verwunderung.
Miß Rosy zuckte die Achseln und sah absichtlich von des Malers Gesicht fort und zur Seite hin. »Sie hält mich eben für plauderhaft,« entgegnete sie leise, »und alles in allem genommen, bin ich es gewiß nicht, wenn ich auch gern meinem Herzen bisweilen eine Erleichterung verschaffen möchte. Denn schon viele Jahre lang lebe ich in einer Stellung, die nicht viel Beneidenswertes hat. Nun aber ist es genug, und ich muß Sie verlassen. Geben Sie mir nicht nach, ich bitte Sie, sondern wählen Sie einen anderen Weg.«
»Ich werde es tun und verspreche Ihnen noch einmal feierlich, daß ich kein Wort unseres Gesprächs jemals über die Lippen bringen will.«
Miß Rosy lächelte dankbar, und einen Augenblick darauf war sie von seiner Seite weggeschlüpft und schritt eilig die kleine Straße hinab.
Franz Marssen aber verfolgte den Höheweg weiter und ging ihn ganz zu Ende, ohne eigentlich zu wissen, wohin er ging, denn alles, was er soeben vernommen, hatte ihn in neue Aufregung und Gärung versetzt, wenn seine Brust auch von mancher Sorge, die vorher darauf gelastet, befreit war. Endlich aber glaubte er sich beruhigt, und über das Gehörte hinlänglich nachgedacht zu haben, und so kehrte er langsamer, als er fortgegangen, nach Hause zurück. Die Veranda fand er an diesem feuchten Tage leer, und der Mittagstisch war heute im Innern des Hauses gedeckt. Franz trat still und nachdenklich ein, und zwei Minuten später sah er sich Tante Karoline gegenüber, die ihn mit einem seltsamen Lächeln empfing und auf deren ungewöhnlich geröteten Wangen sich die Spuren einer kaum vorübergegangenen Erregung wahrnehmen ließen.
»Nun,« redete Franz sie an, indem er seinen Hut beiseite stellte, »was gibt es denn Neues? Du siehst ja außerordentlich echauffiert aus?«
»Echauffiert? O, doch wohl nicht,« erwiderte die Tante mit einem Blick in den Spiegel, und dabei lächelte sie noch seltsamer als vorher, wie es wenigstens ihrem Neffen bedünken wollte. »Aber ich habe eine kurze Freude gehabt,« fuhr sie fort, indem sie sich dicht vor Franz hinstellte, »und ich wundere mich, daß der liebliche Duft, der hier im Zimmer schwebt, und den du doch schon länger als ich kennen mußt, dir nicht sagt, welchen Besuch ich wieder gehabt.«
»Du hast einen Besuch gehabt?« fragte Franz mit weit aufgerissenen Augen und sog den in der Tat im Zimmer wahrnehmbaren Duft mit vollen Zügen ein. »O – sollte es möglich sein? Ja, ich kenne diesen Duft!«
»Nun, siehst du, mein Junge, und warum sollte es denn nicht möglich sein? Miß Edda ist wirklich, trotz ihrer vielen Geschäfte, die sie mir vorgeklagt hat, ohne ein einziges zu nennen, eine gute halbe Stunde bei mir gewesen, hat sich für den geliehenen Fuchs bedankt und dann viel über Eure Reise gesprochen. Nun – warum lachst du denn so absonderlich?«
Franz, bei dieser Nachricht von unsäglich freudigen Gefühlen bewegt, lächelte in der Tat fast schelmisch. »Hat dir denn das gefährliche Raubtier, was nach deiner Meinung in ihren Augen lauert, nichts Böses getan?« fragte er, der guten Tante die runde Wange streichelnd.
»Mir nicht, Franz; für mich ist dies Raubtier nicht da – aber in Wahrheit, mein Junge, das Mädchen erschien mir seit ihrem neulichen Besuch ganz umgewandelt. Sie war mir gar keine Fremde mehr, und ich ihr auch nicht. Wie eine alte Freundin kam sie herein, umhalste und küßte mich und fragte nach tausend Kleinigkeiten, die sie Gott weiß wo aus den Wolken gesogen hat. Und dabei legte sie ein so herzliches, teilnehmendes Wesen an den Tag, daß sie mich ganz warm gemacht hat, und ich muß sagen, ich habe sie so recht von Herzen liebgewonnen.«
Franz Marssens Seele jauchzte im stillen. Er wollte etwas sagen, aber er vermochte es nicht, so kurz war ihm der Atem geworden, und so fest hingen, nicht seine Augen allein, sondern auch seine ganze Seele an den Lippen der Tante, die ohne Zweifel noch viel mehr von ihrem Besuch zu reden hatte.
»Also von der Reise hat sie gesprochen?« brachte er endlich mit Mühe hervor.
»Ja, und es war eigentlich närrisch, wie sie mich mehr darüber sprechen ließ, als sie selbst sprach, denn sie fragte mich, ob du mir auch alles recht genau erzählt hättest, und als ich ›Ja‹ sagte, mußte ich ihr berichten, was du erzählt hast.«
»War sie denn damit zufrieden, was ich dir erzählt?« fragte Franz mit wieder stockendem Atem, da er die Ursache dieser schlauen Handlungsweise Miß Eddas zu erkennen glaubte.
»Ja,« sagte Karoline, indem sie freundlich nickte. »Das liebe Kind war zufrieden, so schien es mir wenigstens, und da erzählte sie mir aus freien Stücken, daß du dich sehr aufmerksam gegen sie erwiesen habest, daß sie dir zu vielfachem Danke verpflichtet und daß sie zufrieden sei, einen solchen Gefährten auf ihrer Schweizerreise gefunden zu haben.«
Des jungen Mannes Wangen glühten, noch mehr als Tante Karolinens, und dabei flammte sein schönes blaues Auge so hell auf, daß jene, ohne eine große Menschenkennerin zu sein, wahrnehmen konnte, daß Freude in seinem Herzen, oder vielleicht gar – ach! und hier suchte sie wieder ihre frühere Sorge heim – noch etwas mehr darin sei.
In diesem Augenblick rückte Karoline ganz nahe an ihren Liebling heran, der schon lange neben ihr auf dem Sofa saß, legte ihren rechten Arm um seine Schulter und drückte ihn liebevoll an sich. »Franz!« rief sie, beinahe in Tränen ausbrechend, »sprich die Wahrheit, mein Junge: dies Mädchen ist dir nicht gleichgültig mehr, wie?«
Er raffte alle seine Kraft zusammen, um diesem mütterlichen Andringen zu widerstehen, und so schwer es ihm auch ward, so sagte er mit erzwungen ruhiger Miene: »Gleichgültig! Wie du das sagst, und wie du es nur denken kannst, Tante! Nein, gleichgültig ist sie mir gewiß nicht, dazu finde ich sie zu schön, zu interessant, zu originell – alles in allem – aber –«
»Aber mein Gott, Franz,« unterbrach ihn die Tante mit steigender Lebhaftigkeit, »habe doch nur Vertrauen zu mir – warum atmest du denn so schwer?«
»Ich atme schwer?« fragte Franz mit fast verzweifelter Anstrengung, seine wogende Brust zur Ruhe zu bringen – »wie seltsam du sprichst, Tante!«
Das gute Wesen ließ von ihm ab, legte ihre Hände gefaltet in den Schoß und sah träumerisch und bange vor sich nieder. »Gut,« sagte sie mit anscheinend ruhigerem Wesen, »du willst mir nichts sagen, du bist ein trotziger, eigensinniger Mann, und doch lehrt mich mein Gefühl – ja, mag es der weibliche Instinkt sein – daß hier, unter dieser Weste, dein Herz jetzt in heftigen Pulsen schlägt – und wenn ich mir denke, daß vielleicht meine Warnungen zu spät kommen, daß dein Auge in diesem himmlisch verräterischen Auge keinen Grund mehr gefunden hat, sondern bis in ihre Seele gedrungen ist, daß du, Franz, der einzige Sohn meines Bruders, also auch mein einziger Sohn, ein ähnliches Schicksal haben könntest, wie – ich – ich es leider gehabt – o dann könnte mir mein eigenes Herz brechen, und das wäre der letzte Schlag für mich auf alle früheren Schläge, und ich wäre dann ganz – unglücklich!«
Sie fiel ihrem Neffen noch einmal um den Hals und weinte bitterlich.
Franz liebkoste sie und suchte sie zu beruhigen und da er so sanft und zärtlich zu ihr sprach, gelang es ihm auch wunderbar schnell. So sammelte sie sich denn und sagte »Nun denn ja, fürchten wir das Schlimmste noch nicht, es macht sich vielleicht alles besser, als man denkt. Wenn mir dieses Mädchen auch ein schwer lösbares Rätsel ist, wenn ich auch nicht alles an ihr begreife, es ist darum doch nicht notwendig, daß die Lösung dieses Rätsels ein Unglück zutage bringen muß«
Bei diesen Worten lächelte Franz fast schmerzlich, aber er nickte der Tante mit innerem Einverständnis zu. »Nein,« sagte er weich, »ein Unglück braucht es nicht zu geben, das fürchte ich auch nicht. Doch nun laß uns vernünftig und ohne Nebensprünge weiter miteinander reden. Das war also alles, was du mit der jungen Dame verhandelt hast?«
»Nein, Franz, das war nicht alles,« fuhr die Tante nach einigem Besinnen merklich beruhigter fort. »Als ich ihr zufällig sagte, daß dein Vater über Land geritten sei und erst am späten Abend wiederkomme, rief sie frohlockend: O, das trifft sich ja herrlich! Mein Vater verreist heute nachmittag auch, und da sind wir Frauen allein. Besuchen Sie mich also um vier Uhr, und trinken Sie Ihren Kaffee bei mir; meine Mutter wünscht schon lange, Ihnen für Ihre Freundlichkeit persönlich zu danken, und dann, wenn meine Mutter schläft – sie schläft den halben Tag – wollen wir uns in mein Zimmer setzen und recht gemütlich von Gott weiß welchen Dingen plaudern.«
Des Malers Gesicht nahm wieder einen freudigeren Ausdruck an, und doch überraschte ihn diese Einladung sehr, obgleich er nicht wußte, warum. »Du wirst also zu ihr gehen?« fragte er.
»Warum denn nicht, Franz? Ich komme ja so wenig unter Menschen – diese Edda wenigstens gefällt mir, wie sie – o du hast es mir ja selbst gesagt – auch dir schon lange gefallen hat.«
Franz schwieg und spielte anscheinend gedankenlos mit seiner Uhrkette. Da trat die Magd herein und fragte mit verwundertem Gesicht:
»Soll ich denn noch nicht anrichten, Fräulein?«
Karoline fuhr wie aus dem Traum in die Höhe. »Ach mein Gott,« rief sie, es ist ja gleich zwei Uhr, und wir haben unser Mittagbrot ganz vergessen. Geschwind, Resi, trage auf, es ist die höchste Zeit dazu.«
*
Nachdem Tante und Neffe ihr Mahl in aller Stille eingenommen und dabei nur noch einige Worte über den vorliegenden Gegenstand gewechselt hatten, dachte weder Karoline an ihre Mittagsruhe, noch Franz an sein Atelier. Beide blieben am abgeräumten Tische sitzen, und Franz trank, ohne es zu wissen, ein Glas Wein nach dem andern, der heute gar keine Wirkung auf ihn zu üben schien. Endlich aber, als es drei Uhr war, stand die Tante zuerst auf und sagte:
»Ich muß mich zu meinem Besuche ankleiden, Franz, denn ich kann doch nicht in meinem Hauskleide hinübergehen und, wenn es so vornehme Leute sind, wie du sagst – ein Baron ist ihr Vater gewiß, wie Leo ausgeforscht hat – so geben sie ohne Zweifel auch auf das Äußere viel. Willst du denn aber heute nicht in dein Atelier gehen?«
»Ja,« tönte es langsam von seinen Lippen, und aus dem Tone, womit er es sprach, klang nicht eben die alte Lust zum Malen hervor. »Doch später erst,« fuhr er fort, »erst muß ich dich in deiner Glanztoilette sehen – dies Vergnügen ist mir lange nicht zu Teil geworden.«
»Wenn dir das ein Vergnügen ist, so sollst du es bald genießen!« erwiderte Karoline mit ihrem alten herzlichen Lächeln, und rasch entfernte sie sich, um ihr gewöhnliches Hauskleid mit einem besseren zu vertauschen.
Als sie nach einer halben Stunde wieder in das Zimmer trat, fand sie ihren Liebling am Fenster stehend und eine Zigarre rauchend, was er nur selten tat. Er schaute nach den Bergen hinauf, die noch immer in Nebel gehüllt waren, und hörte kaum den leisen Tritt der Tante, als sie hinter ihm ins Zimmer rauschte. Da legte sie sanft ihre Hand auf seine Schulter, und augenblicklich, als er sich nach ihr umdrehte und sie in ihrem eben angelegten Putz sah, war er von seinem halb trüben, halb freudigen Sinnen befreit. Sie trug ein schweres schwarzseidenes Kleid, welches den noch immer schönen Formen ihres Körpers gut angepaßt war. Um die Schultern hatte sie eine schwarze Spitzenmantille geworfen, und ihre reichen blonden Haare fielen in glatten Scheiteln über ihr blasses, edles und in der Regel so wehmütig lächelndes Gesicht.
»Nun,« sagte sie scherzend, da er noch immer schweigend auf sie hinstarrte, als ob er eine ganz fremde Person vor sich habe, »gefalle ich dir, mein Lieber, und kann ich mich so vor der Lady-Mutter deiner – deiner schottischen Reisegefährtin sehen lassen?«
»Ja,« erwiderte Franz ruhig, »du siehst gut aus, und ich wüßte nicht, worin in Eurer Erscheinung ein Unterschied liegen sollte. Du bist eine stattliche Dame, Tante – bitte, ich schmeichle dir nicht – und siehst ebenso vornehm wie jede andere vornehme Dame aus. Doch darum handelt es sich ja hier nicht, du machst einen nachbarlichen Besuch und weiter nichts. Grüße die schöne junge Dame von mir und vergnüge dich – ich aber werde zu derselben Dame geben, zu der du gehst, nur daß zwischen beiden ein kleiner Unterschied ist, dessen Vorteil ganz auf deiner Seite liegt. Nun, ich gönne ihn dir, und jetzt lebe wohl.«
*
Obgleich Franz sich in ziemlich ruhiger Stimmung befand, als er diesen Nachmittag so spät sein Atelier betrat, so nahm diese Ruhe doch allmählich wieder ab, je mehr die Zeit verstrich und der Abend heranrückte, der bei dem trüben Himmel schneller als sonst näher kam. Endlich glaubte er, daß ihm das Licht zum Malen ausgehe, und so kehrte er nach dem Vorderhause zurück, wo er, nach seiner Meinung, jeden Augenblick das Eintreffen der Tante erwarten konnte. Allein sie kam noch lange nicht, und Franz hatte Zeit genug, alle vorhandenen Zeitungen, so aufmerksam er es vermochte, zu lesen, bis der Kaffeebesuch sein Ende erreicht. Endlich aber sollte auch dieser Zeitpunkt herannahen, und gegen acht Uhr sah er Tante Karoline langsam und feierlich die kleine Straße heraufkommen, die nach dem Nachbarhause führte.
Er lief ihr mit großer Spannung bis zur Veranda entgegen, aber ihr Gesicht erschien ihm, als er es bei der abendlichen Beleuchtung in der Nähe betrachtete, mehr ernst und nachdenklich als heiter gestimmt zu sein. Auch rief sie ihm nicht wie sonst einen lauten Gruß zu, sondern sie trat still und sinnend an ihn heran, bis er sie endlich mit gepreßter Stimme sagen hörte: »Guten Abend, Franz, du hast mich wohl schon lange erwartet?«
»Ja,« erwiderte er gedehnt, »du hast dich etwas lange aufgehalten. War der Kaffee denn so überaus interessant?«
»Wie man es nehmen will,« erwiderte sie kalt, indem sie in ihre Stube trat, »doch ich bin ja schon lange mit allem zufrieden.«
Bei diesen Worten legte sie ihre Mantille und Handschuhe ab und setzte sich dann neben Franz auf das Sofa, auf dem dieser in einer seltsamen Stimmung bereits Platz genommen hatte, denn das Gesicht und Wesen der Tante schien ihm keine behaglichen Neuigkeiten zu verkünden.
Da fing Karoline von selbst zu sprechen an, nachdem sie vergebens eine Frage von ihrem merkwürdig schweigsamen Neffen erwartet hatte. »Es sind seltsame Leute, bei denen ich gewesen bin,« sagte sie, »und ich werde jetzt noch weniger aus ihnen klug als früher.«
»Haben sie dich nicht wohl aufgenommen?« fragte Franz mit wieder kürzer werdendem Atem.
»O, wie kannst du das erwarten? Nein, mein Sohn, es liegt in etwas ganz anderem. Sieh, in dem Verhältnis dieser unzweifelhaft vornehmen und gut erzogenen Leute ist – du magst es mir glauben – bei weitem nicht alles in der gehörigen Ordnung. Doch nun höre, was ich dir sagen kann. Miß Edda empfing mich mit großer Herzlichkeit und in einer Art und Weise, daß ich vielleicht von dem Folgenden zu Großes erwartete. Doch in dieser Erwartung täuschte ich mich. Sie führte mich zuerst in ein von dunklen Vorhängen beschattetes Gemach, und ich sah da eine bleiche kränkliche Dame auf einem Ruhebett liegen, die mir mehr dem Tode als dem Leben anzugehören schien. Ihre Augen waren hohl, ihre Stimme klang hohl und – nimm es mir nicht übel – auch ihr Herz schien hohl zu sein, wenn mich zu diesem Glauben nicht der Umstand veranlaßte, daß sie ebensowenig Deutsch wie ich Englisch sprechen konnte, weshalb uns Edda als Dolmetscher diente. Als diese mich vorstellte, reichte mir die Mutter ihre brennend heiße abgemagerte Hand, und eine blonde Dame mit Hängelocken, wahrscheinlich die Gesellschafterin, entfernte sich sogleich von dem Bett, an dem sie Wache gehalten zu haben schien. Die Dame dankte mir nun für alle Gefälligkeiten, die ich ihr und ihrer Tochter durch dich erwiesen hätte, aber ihre Worte waren kalt wie der Blick, den sie dabei auf mich richtete und der mir fast das Blut im Herzen erstarren machte. Das ist beinahe alles, Franz, was ich dir von der Mutter sagen kann, die im ganzen einen schrecklich wehmütigen Eindruck auf mich hervorbrachte. Fast auf der Stelle befiel mich das Gefühl, daß die vor mir liegende Frau grenzenlos unglücklich sei, und dies drückte mich dergestalt nieder, daß ich auch nachher in Miß Eddas Gesellschaft nicht so bald wieder warm und froh werden konnte, obwohl sie es an liebervoller Zärtlichkeit gegen mich nicht fehlen ließ. Im ganzen war mir zu Mute, als ob ich an der Schwelle eines großen Unglücks stände und als ob ein Geheimnis über dieser Familie schwebte, das mir bis ins Herz hinein erkältend und befremdend wirkte. Miß Edda merkte das auch sehr bald, denn sie ist klug und hat ihre Augen und Ohren überall. Auch bot sie alles mögliche auf, uni mich zu unterhalten, mich wärmer zu stimmen, und zuletzt gelang es ihr auch so ziemlich und ich erwiderte ihre Zärtlichkeiten, wie es die schöne Person einem so leicht macht. So verging mir die Zeit wunderbar schnell und zwischen unsern Gesprächen hindurch überfluteten mich seltsame Gedanken, die mich erst wieder verließen, als ich an die frische Luft kam, und jetzt – jetzt, mein Junge, danke ich Gott, daß ich wieder in einer anderen Atmosphäre bin, denn die Luft in jenem Hause ist eine böse Krankenluft, die ansteckend wirkt, und ich begreife es sehr wohl, daß diese Edda sich in der Bergluft so glücklich fühlt, wie sie mir wohl hundertmal versichert hat. Übrigens läßt Sie dich grüßen und hofft dich bald wieder zu sehen, wo, hat sie mir freilich nicht gesagt; wenn du aber meinem Rate folgen willst, so gehe nicht in dies Haus – ein Schauer überrieselt mich noch jetzt, wenn ich an das elende, abgelebte Gesicht dieser einstmals gewiß sehr schönen Dame zurückdenke, und ich will froh sein, wenn Leo, dein Vater, wieder hier ist und ich sein fröhliches Gesicht sehe und seine frische Stimme höre – denn in dir – das merke ich schon – werde ich keinen besonderen Tröster gefunden haben.«
In letzterem mochte sie recht haben, denn ihre Schilderung der Familie Miß Eddas hatte wie eine erstickende Luft auf Franz gewirkt; er war still, gedankenvoll und trübe geworden, wie er es am Morgen dieses Tages gewesen war, und selbst als der Vater um neun Uhr müde und hungrig nach Hause kam und in seiner heiteren Weise sogleich von alltäglichen Dingen zu sprechen begann, ohne die sonderbaren Gesichter der Seinigen zu studieren, fühlte er sich noch immer bedrückt und war froh, als er sich um zehn Uhr in sein Zimmer zurückziehen und diesen Tag in ungestörter Einsamkeit überdenken konnte, der ihm allerdings viel Neues, aber wenig Angenehmes gebracht hatte.
*
Als Franz seinen Vater und dessen Schwester um zehn Uhr verlassen hatte, blieben diese still nebeneinander auf dem Sofa sitzen. Doktor Marssen rauchte noch seine Zigarre, wie er es jeden Abend vorm Schlafengehen zu tun liebte, Karoline dagegen, die sonst zu stricken oder zu lesen pflegte, saß heute unbeweglich neben ihm, hielt die Arme vor der Brust übereinander geschlagen und schaute mit fast starrem Auge vor sich ins Leere, wobei ihr Herz aber nicht ganz ruhig zu schlagen schien.
Doktor Marssen, der seinen eigenen Gedanken folgte und erst gar nicht auf das ungewöhnliche Wesen seiner Schwester achtete, bemerkte indessen doch nach einiger Zeit, daß diese in einer ganz eigenen Stimmung sich befand, und augenblicklich sich voller Teilnahme zu ihr wendend, sagte er:
»Karoline, ist dir heute etwas besonderes begegnet? Du bist so wortkarg und träumerisch, und deine sonst so fleißigen Hände ruhen, als ob dein Kopf übermäßig beschäftigt wäre.«
»Du hast dich nicht getäuscht – ich habe zu denken, Leo,« erwiderte sie ausweichend.
»Das scheint mir auch so, meine Liebe. Aber ich möchte dir denken helfen, wenn du meine Hilfe annehmen willst.«
Karoline wandte sich lebhaft zu ihm hin und blickte ihm in die festen redlichen Augen, die liebevoll, fragend und doch mit männlicher Zuversicht auf ihrem trübseligen Gesicht ruhten. »Leo,«« sprach sie mit leiserer und tiefbewegter Stimme, »bist du in der Stimmung, etwas recht Ernsthaftes aus meinem Munde zu vernehmen?«
Doktor Marssens Aufmerksamkeit wuchs von Sekunde zu Sekunde und jetzt las er in dem Auge der Schwester eine wirkliche Besorgnis. »Sprich,« sagte er mit seiner gewöhnlichen Ruhe, die seinem Zuhörer stets Mut und Vertrauen einflößte, während der tiefe metallene Klang seiner Stimme den wahren Tröster in ihm erkennen ließ, »sprich, was hast du? Dir scheint wirklich etwas Ernsthaftes während meiner Abwesenheit in den Weg getreten zu sein.«
»Ja, du hast es erraten, mein Freund,« erwiderte die Schwester und ergriff die derbe kräftige Hand des Bruders, die sie zwischen ihre beiden nahm. »Ich habe heute kurz vor Tisch Besuch gehabt und Nachmittag einen Besuch gemacht, die mir beide zu denken geben, und das beschäftigt mich jetzt.«
»Du hast einen Besuch gemacht?« rief der Doktor überrascht, denn daß Karoline eines Besuches wegen das Haus verließ, war eine Seltenheit und hatte stets etwas Ungewöhnliches zu bedeuten.
Karoline nickte und nun erzählte sie ihm, was vorgefallen war und wie der Besuch im Nachbarhause so seltsam auf sie gewirkt hatte.
Als Doktor Marssen ihre umständliche Erzählung vernommen, schwieg er längere Zeit, legte die Zigarre weg und entzog Karolinen seine Hand, die er nun auf seine Stirn drückte und dabei still in sich hineinlächelte, als wollte er der Schwester so viel wie möglich seine Gedanken und den Ausdruck seines Gesichts verbergen.
»Scheint dir das nicht bedenklich?« fragte da Karoline mit lebhafterer Wärme.
»Was soll mir denn bedenklich scheinen, Schwester, wenn ich denn doch einmal mit dir über deine beängstigenden Visionen sprechen soll?«
»Oho! Es sind keine Visionen. Leo, die ich vor mir habe, sondern handgreifliche Entdeckungen. Denn sieh, lieber Leo, diese fremde junge Dame, die erst einen besorglichen, dann einen so freundlichen, immer aber einen höchst bedeutsamen Eindruck auf mich gemacht hat, ist ein ungewöhnlich schönes, geistreiches und kluges Weib, die einem jungen Mann auf allerlei Weise gefährlich werden kann.«
Doktor Marssen lächelte wieder. »Ja, das habe ich neulich auch schon gedacht und gesagt,« erwiderte er, »als ich ihr Porträt bei Franz im Atelier sah, und er hat wirklich ein Meisterstück damit geliefert.«
»So, also dir ist sie auch aufgefallen?«
»Gewiß, Karoline, solch ein Gesicht muß einem jeden auffallen, ohne daß es jedoch in jedem eine so ängstliche Sorge hervorruft, wie es bei dir getan zu haben scheint. Worin besteht denn nun deine Hauptsorge? Sprich dich klar und deutlich aus, auf dass wir damit zu Ende kommen.«
»Ei mein Gott, Leo, liegt denn das nicht ganz nahe? Wenn der Franz, unser Liebling, nun über die geheimnisvolle Gestaltung ihrer Verhältnisse, über ihre, die seinige bei weitem überragende Stellung, wie es scheint, wegsähe, denn ihr Vater ist ja eine Exzellenz, hat er mir neulich gesagt, und – diesem Mädchen seine Neigung schenkte, ja, eine leidenschaftliche Liebe zu ihr faßte – was würdest du dazu sagen?«
Doktor Marssen schwieg, sann eine Weile nach und dann sagte er ohne allen Anflug einer inneren Besorgnis: »Was ich dazu sagen würde? O, was Ihr Frauen Euch immer mit möglichen, nie aber mit wirklichen Dingen quält – ich würde ganz einfach sagen: das ist eine schon sehr häufig vorgekommene Künstlerliebe. Während er malte und in sein Bild hineindichtete, hat dies Bild sich in ihn hineingemalt und gedichtet, und da mag es denn als reizende Poesie haften, sein Ideal bleiben und als solches wirken, das kann höchstens nur ein Vorteil für seine künftige künstlerische Ausbildung sein.«
»Aber, bester Leo, vergiß doch einmal den Künstler in ihm und sieh dir den Menschen an. Er liebt nicht sein Bild, er liebt das Weib in seinem Bilde, und wenn in eines Menschen Brust, wie Franz einer ist, einmal eine Leidenschaft erwacht, dann ist sie keine gewöhnliche, jugendliche, vorübergehende Leidenschaft mehr, dann wird sie ein unausrottbares Gefühl, und wenn dies Gefühl nun in ihm die Oberhand gewinnt, ihn zu Hoffnungen hinreißt, die nie verwirklicht, zu Handlungen, die nie zurückgetan werden können – siehst du denn darin ein Glück für deinen Sohn?«
»Wie du die Sache auffassest, freilich nicht, Karoline, aber ich fasse sie eben nicht so auf wie du – das ist der Unterschied zwischen uns und unsern Ansichten. Laß doch die Brust dieses Menschen sich auch einmal erwärmen und einen Strahl des schönsten Erdenlichtes hineinfallen – ist denn das etwas so Schreckliches und Gefährliches? Ich finde das gar nicht, nein, ganz und gar nicht, Liebe. Einmal wird er doch aus unsern Herzen schlüpfen, wie er schon früher aus unsern Armen geschlüpft ist, er wird sich in einem andern Herzen einnisten, und wohl ihm, wenn er ein süßes, warmes Nest findet, in dem er sich glücklich und behaglich gebettet findet.«
»Das bestreite oder bezweifle ich eben, lieber Leo, er wird sich in diesem Neste nicht glücklich und behaglich gebettet finden.«
»Warum nicht? Weißt du das so genau? Ist dieses, uns freilich noch unbekannte Mädchen – mag sie eine sogenannte vornehme Person sein oder nicht, mir ist das sehr gleichgültig, wie du weißt – ist es seiner wert? Das ist die Hauptsache, meine Liebe, und darauf gib mir zuerst eine vernünftige Antwort.«
Jetzt schwieg Karoline. Von diesem Gesichtspunkte aus hatte sie freilich das ganze Verhältnis noch nicht betrachtet. »Ob sie seiner wert ist?« murmelte sie mehr vor sich hin, als sie sprach – »Sie an sich selbst – o ganz gewiß, Leo, denn sie ist eine edle Persönlichkeit, sie hat eine vortreffliche Bildung genossen, sie ist schön wie Morgensonnenglanz, ja, sie ist noch mehr, sie ist eine Person, vollkommen geeignet, einen Mann, und noch dazu einen Künstler, glücklich zu machen, ja, das ist sie, wenn ich mir alles in allem überlege.«
»Nun also – was willst du denn mehr?«
»Aber mein Gott, Leo, du übersiehst ja ganz die eigentümlichen Verhältnisse –«
»Was denn für Verhältnisse? Kennst du sie so genau, daß du dich vor ihnen fürchtest?«
»Nein, nein, Leo, aber du nimmst die Sache bei alledem sehr leicht, wie mir scheint.«
»Bis jetzt, ja – mich belastet sie noch nicht wie dich, und was hilfe es mir auch, wenn ich sie schwer, recht schwer nähme, wie? Hältst du mich etwa für einen Vater, der einem jungen Manne, wie Franz ist, eine Liebe, wenn sie wirklich in ihm vorhanden, mit der Wurzel aus der Brust reißen wollte? Und wiederum, hältst du Franz für einen Mann, der sich diese Liebe, wenn sie fest in ihm Wurzel geschlagen, so leicht aus der Brust reißen ließe? O, sei doch nicht so altjüngferlich überempfindlich, überklug, überweise, Karoline, und laß einem jeden sein angeborenes, angestammtes Recht widerfahren. Franz ist mündig, wie du weißt, und er hat bis jetzt noch keinen Schritt im Leben getan, den er zu bereuen, und den wir zu beklagen hätten. Begeht er jetzt einen Schritt, der ihn in eine Klemme führt, nun, dann begeht er ihn selbständig, dann mag er die Verantwortung übernehmen. Er ist es, der sich seine Zukunft, sein Glück allein auferbauen muß, und wir werden ihm doch nicht dazu die Steine versagen, die er gebraucht? Nein, gute Karoline, das wollen, das dürfen wir nicht. Am klügsten ist es für die hierbei zunächst Beteiligten, die wir allerdings sind, sich ruhig und abwartend zu verhalten. Wir wollen seine erst im Entstehen begriffene Leidenschaft nicht fördern, den bindenden Mörtel nicht zu freigebig herbeitragen, aber wir wollen auch nicht voreilig und schadenfroh die Stützen seines Gerüstes niederreißen. Mag er bauen und seinen Bau bis in die Wolken gipfeln, meinetwegen, er, nicht wir sollen darin wohnen, und so mag er sich, wenn er will, eine neue und schönere Heimat gründen, als wir sie ihm mit aller unserer Liebe geben können, das ist mein lebhaftester Wunsch, Karoline. Wie er mit ihrem Vater fertig wird, ob er den zu gewinnen imstande ist – nun, das ist seine Sache – doch so weit sind wir ja noch lange nicht. Warten wir also ab, was kommt, und überstürzen wir uns nicht. Hier hast du meine Meinung und ich hoffe, sie wird dir nicht schlechter und grundloser erscheinen, als die deine ist, wenn du sie mit Ruhe erwägst und überlegst.«
»Mit Ruhe!« seufzte Tante Karoline. »O, mit Ruhe! Ja, ja, ich sehe es wieder, mit Euch Männern läßt sich über so wichtige Lebensverhältnisse nicht füglich reden. Ihr seid immer die Sieger und wir die Besiegen. Und als Besiegte füge ich mich dir – ja, ja, ja, in Gottes Namen – ob du mich aber überzeugt hast, das ist eine andere Frage.«
»Die ich heute nicht beantworten will und kann,« schloß Doktor Marssen seine Rede. »Den Frauen eine Überzeugung beizubringen von dem, wovon sie sich nicht überzeugen können oder wollen, ist eine Arbeit des Sisyphus, und darauf verzichte ich. Und nun laß uns dies Gespräch abbrechen, ich bin müde, ich will schlafen gehen.«
»Gehe schlafen und lege dich mit Ruhe nieder, wenn du kannst.«
»Das kann ich, Gott sei Dank, ja, und ich werde es.«
»Tue es, ich aber werde zu Gott beten, daß er diesen neuen Kelch an uns vorübergehen lasse – mir schmeckt er bitter genug, mein Freund.«
»Füge etwas Zucker von deiner mütterlichen Liebe hinzu, dann wird er süßer,« scherzte Doktor Marssen, indem er sich von seinem Sitze erhob.
»Ach, Leo, mein guter Bruder,« seufzte Karoline und wischte sich eine Träne aus dem Auge, »meine ganze mütterliebe Liebe habe ich schon hinzugefügt und mit dem Tranke dieses Kelches gemischt, und doch ist er nicht süß davon geworden, ja, gerade sie hat ihn mir am bittersten gemacht, denn ich bin – ich bin um meinen guten Franz besorgt.«
»Ich noch keinen Augenblick. Um dich aber doch etwas zu beruhigen, denn du bist in Wahrheit aufgeregt, Liebe, verspreche ich dir, daß ich bei Gelegenheit mit ihm ein ernstes Wort reden will. Mehr kann und will ich nicht tun – bist du damit zufrieden?«
Karoline schaute fest in ihres Bruders reines, offenes Auge, und dieses Auge strahlte von einer so männlichen, siegesgewissen Zuversicht, daß ein kleiner Strahl davon auch in ihr Herz überging und sie, als sie ihm die Hand reichte und eine gute Nacht wünschte, sagen konnte: »Ja, ich bin damit zufrieden – für heute, ja; und für morgen, übermorgen und künftige Tage mag der liebe Gott sorgen. Amen!« –