
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Aus: »Auf dem Wege nach Atlantis; Bericht über den Verlauf der zweiten Reiseperiode der D. I. A. F. E. in den Jahren 1907 bis 1910«. Charlottenburg; Vita, Deutsches Verlagshaus. 1911. S. 50-58; 219-223. Das erste Stück behandelt das Leben in Sans-Souci, meiner Forschungsstation in Bamako, der Metropole des westlichen französischen Sudan, u. zw. am Niger, das zweite eine Seite unserer Tätigkeit in Mopti, einer alten Eingeborenenstadt am Rande des Kulturbeckens Faraka. Die Assistenten der Expedition waren Dr. ing. Hugershoff und der Kunstmaler und Zeichner Fritz Nansen.
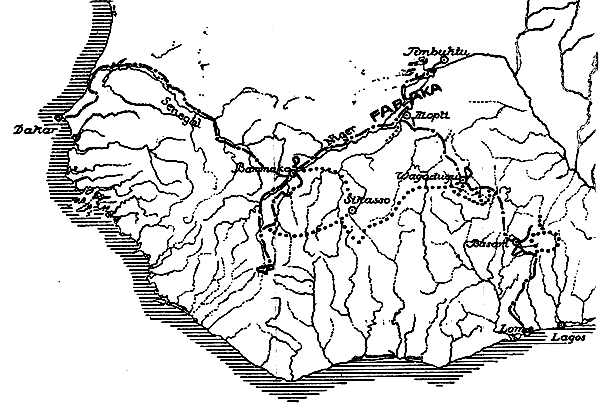
Abb. 2. Kartenskizze zur zweiten Reise
(Zweite Reise.)
Die zweite Reise (1907-1909) führte zunächst vom Senegalgebiet zum oberen Niger und nach Liberia, dann hinauf nach Timbuktu und in südlicher Richtung Togo von Norden nach Süden kreuzend wieder zur Küste. Hauptförderer dieser Expedition waren die Direktoren der Museen für Völkerkunde in Hamburg und Leipzig; auch die wissenschaftlichen Stiftungen beteiligten sich hier wiederum. Bei dieser Expedition wurde zum ersten Male die steinzeitliche Periode des westlichen Afrika eingehend durchforscht. Anmerkung des Institutes.
(1908.)
1. Auf der Ausgangsstation am Niger; Arbeit und Arbeitsstudium; Arbeit der Sudaner. – 2. Epenforschung in Mopti am Rande Farakas.
Die erste Reise im Sinne der Forschungsexpedition war abgeschlossen. In erfreulicher Weise waren Notizbücher und Skizzenhefte gefüllt; manches war noch im Unreinen, vieles schon ausgeführt, das Ganze machte aber jenen Eindruck der Verworrenheit, den auf der Route eingeheimstes Material immer hervorruft. Gar mancher Reisende ist mit derartigen zusammengerafften Aufzeichnungen heimgekehrt, hat daheim die Arbeit des Ordnens vorgenommen und dann mit Schrecken gesehen, wie »fast zufällig aufgerafft« solche Ergebnisse ausschauen. Daher hört man so oft den Ausruf: »Wenn man nach Europa heimgekehrt ist, muß man ordnen und dann noch einmal in das gleiche Gebiet zurückkehren, um das Fehlende zu ergänzen.« Mehr oder weniger wird es jedem so ergehen, und je sorgfältiger später durchgearbeitet wird, desto mehr Lücken werden gefunden werden. Immerhin sollte ein Zurückkehren zum notwendigen Ergänzen nicht in Frage kommen. Es muß ein geschlossenes Werk sein, das heimkommt, – schon wenn es heimkommt, und ein »Zusammenstoppeln«, wie es leider allzu häufig stattfindet, sollte nicht in Betracht gezogen werden. Das kann aber der, der so dicke und wohlausgefüllte Aufgabenbücher mit hinausnimmt wie wir, nur dann erreichen, wenn er von Zeit zu Zeit sichtet und in Ordnung bringt. Bitte, langweilen Sie sich nicht, verehrter Leser oder Kollege, wenn Sie einen Hinweis auf diese Tätigkeit in meinen Reisewerken öfter finden.
Also Ordnen und Sichten der Aufzeichnungen und Skizzen. Danach begann das Ergänzen. Mehrmals am Tage wurden Bammana unter meinem Dache versammelt und ausgefragt. So manche Ergänzung zu meinen Erfahrungen über die Tänze der Bewohner Beledugus wurde mir da zuteil, und somit war ich nach dieser Richtung für das entsprechende Weiterstudium im östlichen Bammanagebiet sehr gut vorbereitet. Größere Schwierigkeiten aber bereitete mir die Verfolgung der historischen Erinnerungen der Völker. Vereinzelte Angaben hatten ja schon die älteren französischen Reisenden beigebracht. Der Charakter ihrer Nachrichten ließ mich aber vermuten, daß darin nur Stückwerk und nicht die Berichte selbst wiedergegeben seien. Es drängte mich, einige Originalberichte zu erlangen. Fraglich war es mir natürlich, ob es gelingen werde, Wesentliches aufzufinden; denn ich mußte mir immerhin sagen, daß ich nur kurze Zeit unter diesen »legendarisch«, wenn nicht historisch denkenden Völkern weile und so an irgendeine Vollkommenheit in diesem Studium nicht denken dürfe. Aber eine Probe wollte ich hören. Also nur eine Probe!
Zunächst sandte ich Karimacha auf die Suche. Wurde nichts. Ich sandte Mballa, Nama, ja Nege. Keiner fand etwas. Man brachte mir Leute, die niedliche kleine Legenden erzählten, aber die Region der historischen Ueberlieferungen blieb mir ein gänzlich verschlossenes Gebiet. Ich hatte den Anfang mit der Suche schon in Kayes gemacht. Vor dem Aufbruch nach Kumi wurde es nichts. Auf der Kumireise selbst ward es auch nichts. Jetzt, während meines zweiten Aufenthaltes in Bamako, mußte es gelingen. Aber wie das anfangen? – Nun, es gelang auf eine sehr originelle Weise. Ich wußte, daß unsere sämtlichen Boys, Kapitas (Kolonnenführer), Interpreten, also der ganze Stab und die ganze Arbeiterschaft aus Horro und Numu, aus Vornehmen und Industriellen bestand. Eines Tages engagierte ich den Boy Kalfa, der angab, ein Kuloballi zu sein. Einige Stunden nachher kam aber Karimacha verächtlich lachend zu mir und erklärte, dieser Knabe tauge nicht viel für uns; denn er habe eine Mutter, die eine Dialli (also aus der Bardenkaste) sei. Wenig später erschien Nege und sagte mit etwas verlegener Miene, ich solle nur Kalfa entlassen, denn es werde Streitigkeiten in der Kolonne geben, da dieser Bursche »nur« ein Dialli sei und die andern Mitglieder des Stabes nicht gerne mit ihm aus einer Schüssel würden essen wollen.
Sobald ich das hörte, entstand in meiner schwarzen Ethnologenseele ein recht schöner Plan. Ich erklärte, daß ich mir die Sache überlegen wolle, und ließ sie damit auf sich beruhen. Nun war unter meinen jugendlichen, allabendlich erscheinenden Geschichtenerzählern ein junger Mann, der ein echter, reiner Dialli war. An diesem Abend, als alle zum Geschichtenerzählen bei mir versammelt waren, fragte ich diesen Knaben in Gegenwart des rund herum hockenden Stabes, ob er in meinen Dienst treten wolle, um Geschichten zu sammeln und vorzutragen. Der Junge sagte: »ja!« Ich setzte hinzu, er solle heute nach Hause gehen und mit seiner Mutter darüber sprechen. Am andern Tage solle er um zehn Uhr wiederkommen und man könne dann weiter darüber verhandeln. Der Knabe ging. Meine Leute sahen mich mit Erstaunen und Verwunderung, ja mit Entsetzen an. Sie mußten sich ganz folgerichtig sagen, daß dieser Schritt, den ich vorhatte, irgendeine ganz besondere Veranlassung haben müsse, da sie mich doch gerade an diesem Tage darüber unterrichtet hatten, daß sie nicht einmal einen Diallimischling unter sich sehen wollten. Es mochte wohl auch eine gewisse Ahnung in ihnen dämmern. Natürlich kümmerte ich mich nicht um ihre Mienen, sondern ging zu Bett. Wohl aber hörte ich noch lange bis in die Nacht hinein aus Neges Haus ein Rechten und Sprechen und heftiges Parlamentieren, wobei der Name »Dialli« oft genannt wurde. Am andern Morgen erschien der junge Dialli pünktlich, ebenso pünktlich trat aber auch Nege an und fragte, weshalb ich diesen jungen Mann engagieren wolle. Sehr ernst erwiderte ich dem Guten, ich hätte, seit ich angekommen und seitdem er mir selber gesagt habe, daß es früher ganz anders hier gewesen und dies Alte im Gedächtnis der Dialli aufgespeichert sei, oft nach einem Dialli gefragt, der die alte Geschichte kenne. Ich hätte aber keine Auskunft erhalten. Nun wolle ich diesen Jüngling anwerben, um Beziehung zu dieser Kaste zu erhalten. Prompt erfolgte die zweite Frage: »Willst du auf den Jungen verzichten, wenn ich dir einen alten Dialli bringe, der alles weiß und dir erzählen wird?« Antwort: »Ja!« – Punkt ¾11 Uhr hielt der alte Barde Korongo aus Segu bei mir Einzug. Rechts und links von ihm nahmen Karimacha und Nege Platz, und dann begann Korongo zu erzählen: »Von Uranfang an« – erzählte er, erzählte, erzählte! Mittendurch nahm ich in einer Pause ein schnelles Gabelfrühstück und Kaffee ein und ließ dem edlen Sänger auf seinen Wunsch Schnaps vorsetzen. Dann ging es weiter bis zum Abend. Da konnten wir alle nicht mehr, und Korongo war infolge häufiger Auffüllung von Absinth vollkommen betrunken. Leider hatte er noch Geistesgegenwart genug, ein Honorar von vierzehn Franken zu fordern. Das ging nun so Tag für Tag.
Erst war ich mir nicht recht klar, was das bedeuten solle, was da der edle Sänger mir verriet. Ja, ich mißtraute anfangs sogar seinen Versicherungen und Berichten. Denn er hub nicht nur mit einer »Ode auf den Schnaps« an, sondern bekräftigte die Behauptung, daß er »das alles« wissen müsse, damit, daß er auf seine, allerdings recht alte Gitarre hinwies. Diese Gitarre, betonte er immer wieder, habe er dem größten Dialli, der je gelebt habe, nämlich dem Führer der Dialli in Segu, schon vor zwanzig Jahren gestohlen. Deswegen habe er aus Segu fliehen müssen, und deswegen könne er dahin nie wieder zurückkehren. Deswegen wisse er aber auch »alles« sehr gut, denn sein Meister habe alles gewußt, und diese Gitarre stamme von seinem Lehrer in Segu. – Diese in schöner Negerlogik vorgetragene Nachricht befestigte nicht das geringe Zutrauen, das ich Korongo anfangs entgegenbrachte. Aber ich ward in angenehmster Weise enttäuscht.
Was Korongo mir von den Stammherren der Malinke vortrug, das war wahrhaft prächtige, echte, alt-mythische Historie, die teilweise an polynesische Traditionen, teilweise an biblische Geschichte erinnerte. Es war wundervolle Wandersage, in der mythologische Vorstellungen sichtlich mit historischen Erinnerungen verknüpft waren, ein Produkt, das wir Ethnologen als Goldkörner der Wissenschaft nicht hoch genug schätzen können. Und wie wuchs dann mein Erstaunen, als am fünften Tage der Bericht über die Sage der Soninke begann. Darin war manche Tiefe und Größe der Auffassung, manche Klarstellung der Vergangenheit, Volksauffassung und Volkssitte enthalten, die Licht nach allen Seiten verbreitete. So merkte ich denn, daß die französischen Reisenden nur das Datenmäßige der Wiedergabe für wichtig erachtet hatten, oder aber, daß ihnen nie der ganze Bestand vorgeführt worden sei. Das, was ich da aufzeichnen konnte, war wunderbare Weisheit, und ich beschloß, dieser Sache noch mehr Zeit zu opfern, als ich vorher gewollt hatte. Ich werde nachher zu berichten haben, wie dieser Fund meine ferneren Reiseabsichten beeinflußte.
Zunächst war allerdings nicht an ein so schnelles Abreisen behufs Weiterführung der Kolonne, wie anfangs beabsichtigt, zu denken. Als ich von Kumi nach Sans-Souci zurückkam, fand ich meine kleine Station in einem nicht sonderlich guten Zustande vor. Die Ecken und Winkel waren verschmutzt, die Wände der verschiedenen Häuser mit Termitengängen bedeckt. Auch in Kisten und an Kofferwänden hatten sie sich angesiedelt, und außerdem fehlte, nach dem muffigen Geruch zu schließen, ein kräftiger Verkehr mit Wasser und Besen. Die ganze Station machte etwa den Eindruck eines Dornröschenschlosses, in dem während langer Zeit kein wirkliches Leben mehr pulsiert hatte. Und dieser Eindruck ward verstärkt, als ich, über den toten Hof reitend, vor dem Hause des Doktors anhielt und abstieg. Der da herauskam, der – fast hätte ich gesagt: alte – Mann mit den eingefallenen Wangen, mit den matten Augen, aus denen nur flaue Blicke herausflatterten, der Mann mit der gebückten Gestalt und dem schleifenden Gange, der kam mir vor wie einer, der lange Zeit in einem Zauberschlosse vertrauert hatte, ein Mann, der ausgegraben wurde, aber nicht wie der frische, tatenlustige kleine Hugershoff, an dessen frischer Hoffnungsfreudigkeit sich in Berlin alle Welt ergötzt hatte. Das halbeingesunkene Zelt, der scheinbar alternde, blasse Doktor, der träumerische Schmutz, – das paßte vorzüglich zueinander, und ich mußte gleich einmal aufseufzen. Da galt es ja schleunigst zu reparieren und aufzuräumen, in diesem Mann und in dieser Station, und das nahm meine Zeit gehörig in Anspruch. Mein kleiner Doktor war im wissenschaftlichen Uebereifer – das war mir nach fünf Minuten Unterhaltung klar – verbüffelt.
Na, da wurde denn natürlich die kleine Welt, die uns umgab, etwas umgekehrt, so daß das Unterste zu oberst, das Oberste zu unterst kam. Bei dem einfachen Ordnungschaffen ließ ich es nicht bewenden. Alles, was in den Häusern lag und stand, kam ins Freie; die Mauern wurden abgekratzt und innen mit einem Putz, aus Lehm, Asche und Petroleum gemischt, überzogen. Mußte ich doch daran denken, daß ich in einigen Wochen für etwa ein halbes Jahr nach dem Innern abreisen wollte, daß die Station dann als Magazin, und als solches vielleicht auch in der Regenzeit, aushalten sollte. Da mußte gründlich vorgesorgt und von oben bis unten alles aufgefrischt, gegen Termiten und Nässe geschützt werden. Einige Häuser sollten außerdem mit Tür- und Fensterverschluß versehen und einige provisorische Bauten für Nansen und mich überhaupt neu errichtet werden. Arbeit genug für einen halben Monat, in dessen Verlauf außerdem noch umfangreiche ethnologische Arbeit zu erledigen war.
Mir ward die Leitung der Arbeit zunächst durch meine Unkenntnis der Arbeitsweise der Sudanneger erschwert. Daß die Leute ganz anders funktionierten als die West- und Zentralafrikaner, war mir schon während der Reise nach Kumi klar geworden. In welcher Weise aber die Unterschiede ausgenützt, die Einwirkungsform auf die Menschen umgeändert und Ansprüche herauf- oder herabgesetzt werden müßten, das konnte ich bei dem Umbau der Station Sans-Souci, im Dezember 1907, kennen lernen. Ich habe in dem Werke über die erste Reise der D. I. A. F. E. geschildert, wie ich die Arbeitsweise der Kulineger untersuchte. Es konnte der große Unterschied zwischen freiwilliger und dienstlicher Arbeit genau charakterisiert werden. In Sans-Souci beobachtete ich die Arbeiter des Hausbaues in Dienstbarkeit, und in Kumi, später nach Kankan zu und andernorts die freien Arbeiter im Hausbau. Zunächst sei betont, daß ich die spielerische Form der Arbeit auch beim freiwilligen Hausbau hier nicht wahrnahm, ich habe sie auch bei anderen Tätigkeiten nicht gesehen. Wenn aber der Mussonge, der Muluba, Mujansi webt, dann tut er das eine Zeitlang, nicht allzu lange. Sobald irgendwo etwas im »Dörfli« passiert, wenn zwei sich streiten, wenn irgendwo einer mit Jagdbeute auftaucht, wenn an der Ecke des Dorfes die Hunde sich eine kleine Bataille liefern, also bei jeder Kleinigkeit erhebt sich der »emsige Weber«, geht zu dem Spektakulum und ist innerlich so froh über die schöne und nichtige Unterbrechung des Alltagslebens und – der Arbeit, daß er an dem Tage sicher nicht mehr zu der Weberei zurückkehrt, da für die Weiterführung des Stückes ja unendlich viel Zeit übrig ist. Wie anders die Frau dieses Kassaimannes, die vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hinein beim Ackerbau, beim Kornstampfen, Kochen, d. h. bei zum Teil wirklich sehr anstrengender Tätigkeit beschäftigt ist und dabei noch die Kinder wartet oder ein keimendes Wesen in sich herumschleppt. Diese Frau arbeitet, – sie kann arbeiten. Ich habe die Westafrikanerin als Arbeiterin hochschätzen und achten gelernt, während ich ihrem Manne, dem Westafrikaner, die »Kenntnis der Arbeit«, das »Arbeitenkönnen« abstreite. Genau das Gleiche war es seinerzeit im Grunde genommen beim Arbeiten an meinen Stationshäusern, und nur da, wo der Arbeitszwang durch Dienstverpflichtung eintrat, war die Leistung eine bessere. Der Schluß, der hieraus zu ziehen ist, zielt nicht dahin, daß die Frau von Natur besser arbeiten kann, sondern hat dahin zu erfolgen, daß die Frau zur Arbeit erzogen worden ist, und zwar durch eben diesen Mann erzogen, der als Stärkerer durch das schwache Geschlecht die gleichlaufende, wenn auch körperlich anstrengendere Arbeit des Gartenbaues ausführen läßt.
Mit diesem Beobachtungsergebnis verglich ich nun die Tätigkeit des Sudannegers, wie ich sie in den Mandingoländern kennen lernte, und ich fand einen sehr, sehr großen Unterschied. Ich sah hier Weber in den Dörfern bei der Arbeit, die fast ohne Unterbrechung, ohne aufzustehen, ihrem klappernden Handwerke vom Morgen bis zum Mittag, vom Nachmittag bis zum Abend oblagen. Mochte irgendwo ein Krawall entstehen, eine große Karawane durchkommen, eintreffen oder abmarschieren, was alles den Westafrikanern willkommene Abhaltung von der »Arbeit« für mindestens ein bis zwei Tage geboten hätte, so störte das den Weber oder den Lederarbeiter oder den Schmied hier nicht im geringsten. Er sah nicht einmal auf und unterbrach nicht einmal seine Tätigkeit. In gleicher Emsigkeit arbeiten die Bauern auf dem Felde, arbeitet alles, was jung und kräftig ist, und nur das Alter hockt stumpfsinnig oder kannegießernd auf den Dorfplätzen, der Galla oder vor den Häusern. Das war für mich als Bauherrn ein ganz anderes Arbeitermaterial. Der Baustoff für ein neues Spitzdach (Stroh, Bambus, Rindenstreifen als Verbandmittel) wurde von 14 Mann in zwei Tagen beschafft und dann an einem Tage verarbeitet. Sie banden das Stroh am Vormittag, bauten das Gerüst binnen drei Stunden am Nachmittag, deckten es in weiteren zwei Stunden und hoben es am gleichen Abend noch auf das Wandwerk. Achtzehn 2,50 m lange, 25 cm starke Gabelhölzer schlugen 14 Mann in zwei Tagen und lieferten sie am zweiten Tage abends in der Station ab. Man vergleiche damit das Arbeitsergebnis gleicher Art am Kuilu. (»Im Schatten des Kongostaates« Kap. 6.) Gewiß waren hier die Instrumente besser, und ein wenig muß auf diese Tatsache Rücksicht genommen werden. Aber damit läßt sich der bedeutende Unterschied in der Leistung nicht erklären. Es kommt noch eine ganze Reihe von Gründen des Unterschiedes dazu. Zunächst ist der Sudanneger kräftiger oder geübter als der Westafrikaner. Das kann man beim Tragen, bei der Handhabung schwerer Werkzeuge und anderem mehr sehen. Es ist das nicht erstaunlich; denn die Arbeit des Ackerbaus hat die Glieder des Volkes gekräftigt, und die Nahrung des Sudan, vorzügliche Hirse, ist nach meiner Ansicht viel vorteilhafter als der bevorzugte wabblige, wässrige Maniokbrei Westafrikas.
Vor allen Dingen aber ist die Arbeitsform der Sudaner eine organisierte, und zwar eine sehr gut organisierte. Der einzelne Mann ist arbeitsfreudiger, emsiger und williger. Die Arbeit ist etwas Selbstverständliches, nichts Ungewöhnliches. Jeder findet es ganz natürlich, daß alle jungen Männer kräftig tätig sind. Und hierfür habe ich eine Erklärung gesucht und glaube ich eine gute Begründung bieten zu können. Anfangs meinte ich sie in dem Berufe der Hackbauern finden zu können; denn vielleicht war mit dem Hirsebau eine Arbeitserziehung geboten. Aber das ist nicht richtig; denn der Hirsebau, den im Sudan zumeist die Männer betreiben, erfordert weniger Anspannung der Kräfte als der Urwaldgartenbau, der in den Händen der Westafrikanerinnen liegt. Nein, das ist es nicht! Vielmehr glaube ich, daß es der Männerarbeit im Sudan ebenso gegangen ist wie der Frauenarbeit in Westafrika. Dort wurden die Frauen von den Männern erzogen, hier die Männer von fremden Unterdrückern.
Der westliche Sudan ist, soweit es sich um die Mandingoländer handelt, durchweg versklavt. Diese Ansicht, daß der Drill der Sklaverei zur höheren Arbeitsform des Negers im Sudan geführt habe, bedarf zweier Ergänzungen. Zum ersten hat innerafrikanische Sklaverei mit unserer Vorstellung von Sklaverei nichts zu tun. Sie führt zur Pflichtarbeit und nicht zur Zwangsarbeit, ist viel mehr Hörigenschaft, geboten gegen Schutzpflicht, als Fron gleich Ausnutzung der Schwachen. – Des ferneren muß ich meine Ansicht von 1907 noch dahingehend gründlich verbessern, als mir auf den späteren Wanderungen unter den sudanischen Splittervölkern mehr und mehr klar wurde, daß das strenge religiöse Patriarchat als Grundlage der höheren Arbeitsfähigkeit anzusehen ist. Diese prachtvoll erzogenen Sippenvölker wurden erst nach dieser Ausbildung Hörige der Herrenvölker. Mit Erstaunen ersieht man aus den alten, halb heiligen Sagen, daß die edlen Geschlechter der heute teilweise noch im Sudan regierenden Horro (Edlen, Adligen) von Sklaven der alten Könige abstammen. Diese alten Könige repräsentieren aber ein Unterdrückervolk, das heute selbst in den Reihen der Vornehmen aufgegangen ist. Welle auf Welle brach aus der Wüste, ein Herrenvolk nach dem andern über diese Länder herein. Die Gesänge erzählen vom ersten Auftauchen und von gewaltigen Siegen des ersten Reitervolkes. Wir kennen einen Teil der historischen Vorgänge, aber nur einen Teil. Aber dieses uns Bekannte läßt genug von Unbekanntem ahnen. Man denke an den Tyrannen Samory, der Tausende und Hunderttausende in die Sklaverei führte, – man denke an die Stadt Uassulu, die gar volkreich war und mit einen Schlage leer und vereinsamt wurde, als diesen Sklaven die Freiheit geschenkt wurde. Es war, als sei ein gewaltiger Windhauch über das Land hingefahren und als seien diese Menschen Spreu gewesen, die nun weggefegt ward, – so wirkte die Freiheitsbotschaft.
Die Sklaverei des westlichen Sudan war eine schwere, schwere Geißel. Diese Sklavenkriege haben unendlich mehr Unheil über diesen Teil Afrikas gebracht, als Europa je – soweit wir historisch denken können – erlebt hat, aber immerhin, es war nicht ein Sklavenhandel wie der der Portugiesen in Westafrika, die das Menschenmaterial ausführten und so die Kraft dem Erdteil entzogen, – es war nicht die Sklaverei der Araber Ostafrikas, die ihre Leute nur zu Raubkriegen und Elfenbeinschlepperei, sehr selten aber zum Anbau verwandten. (Wer weiß allerdings, ob sich hier nicht auch im Laufe der Zeit eine günstigere und wertvollere Schulungssklaverei eingestellt hätte, wenn Europa nicht eingegriffen hätte?!) Nein, im westlichen Sudan ist die Sklaverei zur Völkerschule geworden. Hier hat sie zu einer Form der Organisation geführt, die zuletzt dem Volke von Segen war. Die Schulstunde wurde mit Blut und Schändung bezahlt. Das ist wahr und traurig. Ja, es ist möglich, daß mancher der erbärmlichen und schwächlichen Charakterzüge der Negerrasse auf das Konto dieser Erziehung zu bringen ist. Ich glaube es. Denn die Negernatur ist im großen und ganzen heute eine Sklavennatur. Aber trotz und wieder trotz alledem kam der Segen der Arbeitserziehung über das Volk und in das Land. Die Arbeit ist also heute als eine in diesen Ländern durchaus einheimische und zugehörige Pflanze zu bezeichnen. Diese Völker brauchen den schweren Arbeitszwang nicht mehr, der den Westafrikanern dringend nottut, wenn man sie den europäischen Völkern erhalten will. Denn entweder lernt ein Volk arbeiten oder es geht unter der Kulturwelle Europas zugrunde.
Deshalb sind die Aufgaben der kolonisierenden Völker Europas in diesen Ländern andere als in den Gebieten Westafrikas, denen die Verschreibung des Arbeitszwanges noch zuteil werden muß. Der Sudanneger des oberen Niger hat in der Sklaverei arbeiten gelernt, aber er hat ein gut Teil der Menschenwürde verloren. Das ist es, was ihm wiedergegeben werden muß, und es soll mir eine wertvolle und ernste Aufgabe sein, zu der Lösung dieses Problems einen Beitrag zu liefern. Indem ich diesen Betrachtungen und Gedanken während der Beobachtung meiner Bauarbeiter nachhing, erschlossen sich mir Ausblicke auf ernste Probleme.
*
Denen, die mit Verwunderung fragen, was mich dazu trieb, hier (in Mopti) so lange in so unbehaglichem Logis zu verweilen, eine Aufzählung der Gründe: Mit Mopti verließ ich das alte Kulturbecken Faraka, das Ueberschwemmungsgebiet des Niger, und kam in die Gebirge. Also war hier voraussichtlich die letzte Möglichkeit, mich mit den alten Kulturen des Westens noch einmal gründlich zu beschäftigen. Vor allem konnte ich hier hoffen, einen tieferen Einblick in das Leben und Treiben der Fulbe Massinas, in ihre alten Wanderungen und vorislamitische Gesittung zu gewinnen. – Zum zweiten galt es, die Expedition, den Zug auf der Sehne des Nigerbogens vorzubereiten und von vornherein gleich möglichst vollständige Erkundungen über Völker und Wege, Städte und Vergangenheit einzuziehen. – Endlich mußte notgedrungen, um das Gesamte zu vervollständigen, eine Aufnahme der Architektur Djennes vorgenommen werden. Diese letzte Aufnahme vertraute ich Nansen an, der sich in einem großen, gut equipierten, aber wenig gegen die Unbilden der Witterung schützenden Boote auf den Weg machte.
Ich selbst aber vertiefte mich noch einmal in das Studium jener Akten, die in den Köpfen aller Barden leben. Hier in Mopti lernte ich den alten Allei Sangu, einen hinkenden, trunksüchtigen, geldgierigen und über alle Maßen häßlichen Mabo-Barden kennen, einen jener Leute, deren Gedächtniskraft und Wissensreichtum uns schreibkundige Europäer immer wieder verblüfft. Der häßliche Allei diktierte, betrank sich und bestahl mich nach Noten. Es war nicht gerade angenehm, mit diesem Menschen arbeiten zu müssen, aber er zauberte mir ein Gemälde aus dem Boden, wie ich es ohne ihn wohl nie hätte gewinnen können: Massinas Vergangenheit. Er war ein häßlicher, abstoßender Mensch; aber wenn er sang, dann verlor sich dieser Eindruck, und eine gesunde Phantasie konnte ihn leicht als Knappen eines der gewaltigsten Helden des goldenen Ritteralters deuten.
Mopti! Ritterleben! Königspracht!
Die Leser dieses Buches wollen sicher nicht mit leidigen Stichworten abgespeist werden. Sie haben ein Recht darauf, etwas von dem zu hören, was mich hier gewaltig erregte und mich geduldig und freudig in diesem Wanzen- und Flohnest ausharren ließ. Und wie kann jemand, der nur den landläufigen Typus des heutigen Negers kennt, es ohne weiteres verstehen, daß in meinen Akten ebensoviel von Mannheit, Turnierkunst, Waffenklirren, Knappentreue und Frauenschönheit verzeichnet ist wie in jedem Werke über Rittersagen unseres eigenen Altertums!
Die nördlichsten Teile des Sudan, jene Länder, die am Südrande der Sahara liegen und vom Senegal und Niger durchzogen werden, waren nicht immer von Negern bewohnt und waren ebensowenig wie unser Norden stets dem wirtschaftlichen Drange der Gegenwart unterworfen. Gelbe und rote Leute wohnten hier, und ihre Art hatte nichts Negerhaftes am Körper und im Wesen. Aber nach Süden hin wohnten die Neger in Ländern, die reich waren an Korn und Gold. Und diese Nachbarschaft war das Unglück der Gelben und Roten. Sie zogen hinab und eroberten Schätze und Sklaven, männliche und weibliche. Die männlichen mußten die Felder bestellen, die weiblichen teilten allzuhäufig das Lager der Edlen. Mischvolk entstand. Immer mehr schlug das Negerblut durch. Der Sudan vernigerte, immer schwärzer ward das Volk. Nur wenige »reinere« Familien hoben sich allerorts vom vorherrschenden Gesamttypus ab, und die waren dann nicht nur dem Namen nach, sondern auch in der Tat die Vornehmen, die Adligen.
Mehrmals ist gelbes oder rotes, dann auch weißes Maurenvolk darüber hingerollt.
Das heutige Sudanvolk ist das Produkt dieses Werdeganges. Es ist ein buntes Durcheinander von Farben und Typen. Das aber, was die Sänger in ihrem Rhythmus festgestellt haben, das ist das in vielen Varianten und Gleichnissen, Erzählungen und Dichtungen gewahrte Lied vom Dasein, vom Kampf und Untergang jener edleren Völker, die hier im nördlichen Sudan einst lebten und webten. Manches alte Volk muß hier seinem Aeußeren nach viel Aehnlichkeit mit jenen Aethiopen gehabt haben, von deren heiliger Herrlichkeit uns der alte Diodor so mancherlei Wunderbares erzählt hat. Ihrem Wesen nach stimmten sie aber ganz und gar nicht mit jenen überein, – gar nicht, wenigstens wenn die Schilderungen der alten Herren des klassischen Altertums richtig sind.
Desto verblüffender ist die Aehnlichkeit mit dem Menschentypus der nordischen, der deutschen und der französischen Heldensagen. – Die alte Zeit muß sowohl königliche Helden im Besitz selbsterworbener, großartiger Schätze als arme, hochgeehrte Ritter gesehen haben. Es gab größere Städte und mächtige Reiche. Aber der Schwerpunkt lag bald hier, bald dort. Diese Verschiebungen waren die Ergebnisse der ritterlichen Tüchtigkeit einzelner. Die Mehrzahl der Recken rekrutierte sich aus der Reihe jener Königs- und Fürstensöhne, die nicht das Erbrecht hatten, weil nach dem Tode ihres königlichen Vaters und Herrn dessen Bruder oder ältester Schwestersohn die Thronfolge übernahm.
Die nicht zur Erbschaft berechtigten Söhne zogen aus. Der Vater gab ihnen Pferde und Waffen, dazu einen alten Hörigen, der in der Sitte wohlerfahren und im Leierspiel bewandert war. So ausgerüstet zog mancher junge Degen aus, bereit, die Wunder der Welt, die noch durchaus eroberbar waren, kennen zu lernen und in edlem Kampfe Belege guter Erziehung, edler Abstammung und persönlicher Kraft zu erbringen. Die Sage weiß zu erzählen von Kämpfen mit wilden Jägervölkern, von der Befreiung einer minnigen Maid, die an den grimmigen Drachen ausgeliefert werden soll, vom Kampfe gegen ganze Reiterscharen. Am liebsten aber weilt sie bei dem klirrenden Zweikampf, und meist schließt die Handlung mit der Eroberung eines Herrschersitzes.
Dieses Volk hatte Charaktereigenschaften, die mit denen eines Negervolkes nichts zu tun haben. Den Ritter ziert vor allem edle Rasse und persönlicher Mut, der ihn auszeichnet vor den nur in der Masse kriegstüchtigen Kasten. Er soll offen, treu und freigeistig sein. Das Gleiche, dazu edle Sangeskunst und Opfermut bis zum Tode verlangte man von den Knappen. Die Fräulein waren minnig schön. Die Ritter brachen ihrer Geliebten wegen Stadtmauern und Königsrechte. Ueberall herrscht in den Liedern der Preis der persönlichen Liebe. Bekannt war jener Periode das lustige Gelage, und auch das Spielbrett fehlte nicht.
Das Auffallendste bei allen wunderbaren Eigenarten dieser Dichtungen ist für mich die Tatsache, daß die persönlichen Eigenschaften der Helden und Frauen außerordentlich fein beobachtet und beschrieben werden. Dieser Zug fehlt den weitaus meisten Volksdichtungen der älteren Menschheit, und auch der dunkle Mann kennt nur »gut« und »böse«, »listig« und »tölpelhaft«. Aber hier im Bardengesang des Sudan werden klare Charaktere dargestellt, ehrgeizige, plumpe, feinfühlige, besonnene, feige. Ja, sogar das Erwachen der Männlichkeit, wie in dem Parsivalgesang, finden wir wunderbar geschildert und umschrieben. Ganz besonders schön sind die Ausarbeitungen der Frauencharaktere, auch die Umbildung bestimmter Charaktereigenschaften bei ihnen.
Alles in allem würde niemand etwas Merkwürdiges dabei finden können, wenn ich eine Reihe dieser alten Kunstwerke unter dem Titel: »Neuentdecktes Heldenbuch der Franken« oder ähnlich herausgeben würde. Wir fragen gespannt nach dem Urhebervolke. Wer schuf das? Allzu schnell wird heute bei allen höheren Kulturgütern Afrikas auf Asien als Heimatland und auf die Araber als Kulturträger hingewiesen. Im vorliegenden Falle können wir das prompt zurückweisen. Denn Lied und Sang der arabischen Wanderperiode kennen wir. Es mag eher darauf hingewiesen werden, daß am Nord- und Südrande des westlichen Mittelmeeres »vordem« Völker saßen, deren nördliche Zweige wohl allen Zuschuß zum Kulturgute unseres Mittelalters geliefert haben, während die südlichen Verwandten durch phönizische und arabische Einflüsse wohl ziemlich sicher in die Atlastäler und in den Sudan gedrängt worden sein dürften.
Die Gesänge sind erhalten. Ob auch Nachkommen der alten Barden?
Wenn der Trunkenbold Allei seinen Platz eingenommen und, was oft mühsam genug war, den Weg in sein Lied hineingefunden hatte, dann ward er meist so fortgerissen, daß er singend und spielend seine Umgebung und sich vergaß und, ohne mir die Möglichkeit einer Hemmung zu lassen, den Faden abrollte, bis der Held gefallen oder das Glück von ihm erobert war. Dann funkelten seine Augen. Er stampfte zum Kampfspiel mit den Füßen. Er schluchzte mit dem Sterbenden und strahlte im Siege. Wenn ich solche Sangesentwicklung sah, legte ich Stift und Blatt beiseite, lehnte mich zurück und freute mich, dies Bild genießen zu können. Hatte er geendet, so griff ich wieder nach meinem Gerät und sagte:
»So Allei, – nun wiederhole es mir noch einmal, – langsam, damit Nege den Text übersetzen und diktieren kann!«