
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Vor mehr als einem Menschenalter schickte ich diesem Abschnitt folgende Bemerkung voraus: »Ich habe versucht, allgemein verbreitete Ansichten vom römischen Luxus als unhaltbar zu erweisen. Als ich meine Untersuchungen über diesen Gegenstand begann, teilte ich diese Ansichten durchaus; je weiter ich aber darin fortschritt, desto unmöglicher schien es mir, sie festzuhalten. Ihre Unhaltbarkeit glaubte ich namentlich auch durch Vergleichungen mit dem Luxus anderer Zeiten dartun zu müssen. Ohne Zweifel würde mich eine bessere Kenntnis der mittelalterlichen und neueren Kulturgeschichte in den Stand gesetzt haben, bessere Parallelen zu wählen und Irrtümer zu vermeiden, die bei der Benutzung eines nur durch den Zufall gebotenen und großenteils aus abgeleiteten Quellen geschöpften Materials fast unausbleiblich sind. Da ich überdies hier auch dadurch der Gefahr zu irren ausgesetzt gewesen bin, daß ich nicht umhin konnte, das mir fremde Gebiet der Nationalökonomie zu streifen, habe ich um so mehr Grund, diesen Abschnitt, als einen ersten Versuch der Vergleichung des römischen Luxus mit dem Luxus anderer Zeiten, der Nachsicht sachkundiger Leser zu empfehlen.«
Ich bin seitdem fortwährend bemüht gewesen, zur Beurteilung des römischen Luxus aus dem Luxus anderer Zeiten zahlreichere und sicherere Anhaltspunkte zu gewinnen, namentlich mit Hilfe neu erschienener Arbeiten. Freilich habe ich dabei je länger je mehr die Mißlichkeit aller solcher Vergleichungen eingesehen, da man selten oder nie die wirkenden Kräfte und Einflüsse, durch welche die zu vergleichenden Erscheinungen bedingt waren, auch nur in einiger Vollständigkeit übersieht und daher gewiß nur zu oft genötigt ist, Tatsachen zu verwerten, die, aus ihrem natürlichen Zusammenhange gerissen, einen täuschenden Eindruck zu machen und das Urteil irrezuleiten als zu berichtigen geeignet sind.
Trotzdem halte ich diese Vergleichungen nicht nur nicht für wertlos, sondern auch für unentbehrlich. Auch die Beurteilung des römischen Luxus beruht vorzugsweise auf solchen aus dem Zusammenhang gerissenen, zum Teil überdies von den alten Schriftstellern tendenziös ausgewählten Tatsachen. Wenn ich zur Verbreitung der Überzeugung beigetragen haben sollte, daß es einer größeren Vorsicht als der bisher angewandten zur Beantwortung der hier aufzuwerfenden schwierigen Fragen bedarf, und wenn es mir außerdem gelungen sein sollte, den römischen Luxus von dem Nimbus des Fabelhaften und Unerhörten zu befreien, so würde meine Arbeit nicht fruchtlos gewesen sein.
Wer eine seit Jahrhunderten herrschende Ansicht zu bekämpfen unternimmt, muß auf vielfachen und entschiedenen Widerspruch gefaßt sein. Ich erkenne aber auch bereitwillig an, daß er sehr der Gefahr ausgesetzt ist, eine Vorliebe für die neue gewonnene Ansicht zu fassen und denjenigen Momenten, die zu ihren Gunsten zu sprechen scheinen, einen zu großen Wert beizulegen. Wie weit es immer gelungen ist, mich von einer solchen Befangenheit freizuhalten, muß ich dem Urteil meiner Leser überlassen.
Der Vorwurf, daß ich den römischen Luxus zu günstig aufgefaßt habe, ist mir wiederholt gemacht, aber bisher nicht hinlänglich begründet worden, um mich zu einer Änderung meiner Ansicht zu veranlassen. Die sehr allgemein gehaltenen Einwendungen von Baudrillart in seiner (sonst überaus wohlwollenden) Anzeige der französischen Bearbeitung dieses Buchs und in seiner Histoire du luxe, II, 393 ff., haben meine Überzeugung ebensowenig erschüttert wie folgende Bemerkung von Nissen in den Pompejanischen Studien, S. 667: »Man kann den römischen Luxus erklären, vielleicht entschuldigen, aber mit keinen Künsten der Interpretation hinwegdeuten. Die Klagen patriotischer Schriftsteller sind doch ganz anders begründet, als uns z. B. Friedländer glauben machen will. Der Luxus hat die Freiheit der Römer vernichtet. Und wer das Verschwinden der Atrien Pompejis in den Gärten der Sullaner verfolgt, dem mag wohl das trübe Wort des Plinius in den Sinn kommen: latifundia perdidere Italiam.«
Daß ich »Künste der Interpretation« wenigstens nicht wissentlich angewandt habe, brauche ich hoffentlich nicht erst zu versichern. Ich wiederhole, daß meine Resultate sich mir nicht bloß als ungesuchte ergeben haben, sondern auch als unerwartete. Welche der von mir für unbegründet erklärten Klagen römischer Schriftsteller Nissen für begründet hält, geht aus seinen Worten nicht hervor. Die Klage des Plinius über die Latifundien aber kann unmöglich dazu gehören, da ich bei den meiner Arbeit gesteckten Grenzen ihre Berechtigung ebensowenig zu prüfen als die Frage zu beantworten hatte, und in inwiefern der Luxus die Freiheit der Römer vernichtet habe. Ich würde sie allerdings anders beantworten als Nissen. Ohne zu leugnen, daß auch der Luxus zum Untergange der Republik mitgewirkt habe, halte ich ihn doch weit mehr für ein Symptom als für eine Ursache, für eine der notwendigen Folgen der großen volkswirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen, die seit den punischen Kriegen die Fundamente der Republik untergraben haben: der Anhäufung großer Kapitalien neben der Abnahme des Mittelstands und der Zunahme des Proletariats einerseits, und der Zerstörung der alten Einfachheit und Sittenstrenge durch die Steigerung der Bedürfnisse, die Vermehrung der Genußmittel und das Überhandnehmen der Genußsucht anderseits. (Geschrieben 1909.)
Die sehr verbreitete Ansicht, das der Luxus des späteren römischen Altertums ein ebenso beispielloser und fabelhafter wie unsittlicher und törichter gewesen sei, ist noch heute nicht wesentlich anders begründet, als es von Meursius in seiner 1605 erschienenen kleinen Schrift: »Roma luxurians sive de luxu Romanorum« geschehen ist; denn sie beruht auf dem Gesamteindruck einer Anzahl bunt zusammengewürfelter, durchaus heterogener Tatsachen, von denen die erstaunlichsten und ungeheuerlichsten auch die bekanntesten sind. Bei dem Gedanken an das kaiserliche Rom drängen sich der Erinnerung jene so oft wiederholten Erzählungen auf von den Bauten im Meer, den Gärten auf hohen Dächern, der Verwendung von Gold und Silber zu den Hufbeschlägen der Maultiere sowie zu den Behältern für Kot, von den Bädern in Eselsmilch und wohlriechenden Essenzen, den Getränken, in denen kostbare Perlen aufgelöst waren, den aus Pfauengehirnen und Flamingozungen bereiteten Gerichten, und was dergleichen mehr ist.
Zur Festhaltung übertriebener Vorstellungen hat übrigens auch hier wie anderwärts die Neigung beigetragen, die Erscheinungen des römischen Lebens im Guten wie im Bösen von vornherein im Verhältnis zu den entsprechenden der modernen Welt als riesenhaft anzusehen: eine Neigung, von der selbst die besten Altertumskenner keineswegs immer frei gewesen sind, wie C. G. Zumpt, welcher meinte, daß wir in der Kunst des Genießens gegen die Alten Kinder sind, und W. A. Becker, demgegenüber der verschwenderischen Pracht Roms der ausschweifendste Luxus aller Zeiten als ärmliches Unvermögen erschien. Bei näherer Betrachtung ergibt sich jedoch, daß die Tatsachen, auf die man sich zu berufen pflegt, wenigstens zum Teil falsch aufgefaßt oder falsch gruppiert sind, und daß die herrschende Ansicht wesentlicher Einschränkungen bedarf. Dies würde selbst dann der Fall sein, wenn die betreffenden Angaben überall den vollen Glauben verdienten, der ihnen zum Teil ihrer Natur nach von vornherein versagt werden muß.
Übrigens würden auch diejenigen, die vor ein paar Menschenaltern den römischen Luxus als einen beispiellosen und ungeheuerlichen ansahen, heute wahrscheinlich anders urteilen. Gerade seit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, noch mehr seit dessen Mitte, ist in der ganzen zivilisierten Welt eine außerordentlich große Zunahme des Luxus eingetreten und unser Maßstab dadurch ein völlig anderer geworden. Der Luxus des ersten französischen Kaiserreichs, der damals die Welt in Erstaunen setzte, erscheint mit dem des zweiten verglichen, sehr bescheiden. Ein englischer Autor, Alfred Austin, sagte im Jahre 1883, daß im letzten Menschenalter in England das Wachstum des Luxus mit dem des Reichtums gleichen Schritt gehalten habe, und (nach Gladstone) die Vermehrung des letzteren in den letzten fünfzig Jahren größer gewesen sei als in allen früheren Jahrhunderten seit der normannischen Eroberung. Die ganze Lebensführung der Reichen biete ein Schauspiel, wie es die Welt nicht gesehen habe, seit Rom sich seinem Falle zuneigte.
Sodann ist die durch die Natur der Überlieferung auf dem ganzen Gebiete der Altertumswissenschaft bedingte Gefahr, aus einzelnen zufällig berichteten Fällen falsche Schlüsse zu ziehen und Ausnahmen für die Regel anzusehen, auch von den Beurteilern des römischen Luxus keineswegs immer vermieden worden. Aber man hat überdies auch, wie gesagt, seit dem Vorgange von Meursius Berichte aus den verschiedensten Zeiten und von der verschiedensten Art durcheinandergeworfen: Berichte von den Extravaganzen berüchtigter Verschwender, der fürstlichen Lebensweise prachtliebender Großen, den raffinierten Schwelgereien der Virtuosen des Genusses – und zwar gewöhnlich ohne Rücksicht auf den Standpunkt der Berichterstatter und auf den Zusammenhang, in dem die Tatsachen mitgeteilt werden.
Vor allem hätte immer ganz von der Betrachtung ausgeschlossen bleiben sollen, was von dem Luxus einzelner Kaiser berichtet wird. Der Luxus eines Caligula und Nero erhielt seinen Ausnahmecharakter dadurch, daß er eine Dokumentation ihres Allmachtschwindels war. Sie wollten auch hierin die übermenschliche Macht und Größe des Cäsarentums, den unermeßlichen Abstand des Weltherrschers von seinen Untertanen zur Anschauung bringen, für sie sollte es keine Unmöglichkeit, für ihren Willen keine Schranke geben. In diesem Sinne ließ Caligula – dessen Cäsarenwahnsinn übrigens vielleicht nicht ohne eine Beimischung wirklicher Verrücktheit war – an tiefen und gefährlichen Stellen des Meeres Bauten aufführen und verpraßte den Tribut dreier Provinzen (10 Millionen Sesterzen, d. h. über 2 Millionen Mark) an einem Tage; in diesem Sinne unternahmen er und Nero, bei ihren Festen, in ihren Prachtschiffen und Palästen die Träume einer ausschweifenden Phantasie zu verwirklichen.
Doch Caligula und Nero sind auch in dieser Beziehung unter den Kaisern der beiden ersten Jahrhunderte fast alleinstehende Ausnahmen, da man ihnen nicht einmal Lucius Verus an die Seite stellen kann, und der Luxus des Vitellius sich auf die Befriedigung einer monströsen Gefräßigkeit beschränkte. Dagegen sind Tiberius, Galba, Vespasian, Pertinax bis zur Kargheit sparsam, und unter den übrigen keiner ein eigentlicher Verschwender gewesen. Und es fragt sich wohl noch, ob selbst der Luxus Caligulas und Neros widersinniger und verderblicher war als der mancher kleinen deutschen Despoten des 17. und 18. Jahrhunderts. Denn wenn August der Starke allein für eine einzige Oper 80.000 Taler, für das Lustlager von Mühlberg 5 Millionen verausgabte; wenn Karl Eugen von Württemberg (der Stifter der Karlsschule) seinen Hof zum glänzendsten in ganz Europa machte, die ersten Künstler in seinen Schauspielen auftreten, unter seinen Gästen die kostbarsten Geschenke verlosen, für die Menge Weinfontänen springen ließ, Feuerwerke gab, die eine halbe Tonne Golds kosteten, Seen auf Bergen graben ließ und Schlittenfahrten veranstaltete, zu denen der Schnee meilenweit herbeigeschafft werden mußte: so wurden die Mittel zu dieser rasenden Verschwendung doch in Ländern erpreßt, deren Steuerkraft schwerlich die einer einzigen größeren römischen Provinz erreichte. Unter August dem Starken beliefen sich die Einkünfte Sachsens auf 6 Millionen Taler. In Württemberg (einem Lande mit 152 Quadratmeilen und etwa 650.000 Einwohnern) deckten unter Herzog Karl Eugen (1737-1793) die ordentlichen Einnahmen aus dem Kammergut und den Steuern die Ausgaben nicht. Jedenfalls aber würde ein Schluß von dem Luxus Caligulas und Neros auf den des damaligen Rom ebenso unzulässig sein, wie ein Schluß von den Ausschweifungen der absolutistischen Höfe auf die Sitten des damaligen Deutschland.
Ebensowenig wie auf die Beispiele der römischen Kaiser kann man sich bei der Beurteilung des römischen Luxus ohne weiteres auf die jener Großen in der letzten Zeit der Republik berufen, die in siegreichen Feldzügen reiche, zum Teil noch unerschöpfte Länder plünderten und von dort ungeheure Schätze heimbrachten. Die kolossale Verschwendung eines Lucullus, Scaurus, Pompejus, Cäsar war durch Umstände und Veranlassungen bedingt, die später im Altertum nicht wieder eingetreten sind; sie ist selbst von den Kaisern kaum jemals überboten worden. Plutarch sagt, daß die Gärten des Lucullus trotz der großen, seitdem erfolgten Zunahme des Luxus zu den prachtvollsten unter den kaiserlichen gezählt wurden; Plinius, daß ein Privatmann wie Scaurus durch sein Theater die Bauten des Caligula und Nero an unsinniger Verschwendung übertroffen habe. Es mag dahingestellt bleiben, ob die seit Jahrhunderten von orientalischen Despoten aufgehäuften Gold- und Juwelenschätze, die den römischen Besiegern Asiens zufielen, der Beute der spanischen Konquistadoren, der englischen Eroberer Ostindiens nachstanden. Das Lösegeld für den Inka Atahualpa von Peru wird auf 23,300.998 Frcs. angegeben (eine Summe, deren damaliger relativer Wert das Vierfache des heutigen betragen soll); auf Pizarros Anteil kam ein Wert von 1,402.748 Frcs. Für Clive wäre es in Bengalen während seiner zweiten Verwaltung, wie Macaulay sagt, leicht gewesen, Reichtümer aufzuhäufen, wie sie kein Untertan in Europa besaß. Ohne die reichen Bewohner der Provinz einem stärkeren Drucke zu unterwerfen, als an den sie ihre mildesten Beherrscher gewöhnt hatten, hätte er Geschenke im Belauf von 300.000 Lstr. jährlich empfangen können; die benachbarten Fürsten würden gern jeden Preis für seine Gunst gezahlt haben. Den römischen Feldherren und Beamten im Orient boten sich dieselben Gelegenheiten wie Clive und Warren Hastings; von der Mäßigung und verhältnismäßigen Uneigennützigkeit des ersteren aber waren sie ebenso weit entfernt wie der letztere. Wie ungeheure Summen ihnen zuströmten, mögen einige Angaben zeigen. Der Judenfürst Aristobulus bestach bei seinem Streite mit seinem Bruder, dem Hohenpriester Hyrcanus, den Legaten A. Gabinius mit 300, den Quästor M. Aemilius Scaurus mit 400 Talenten, und versuchte dasselbe auch bei Pompejus mit einem goldenen Weinstock im Wert von 500 Talenten (nahezu 2½ Millionen Mark). Ptolemäus Mennäi, Fürst eines Raubstaats am Libanon, kaufte von Pompejus Freiheit und Fortbestand seiner Herrschaft für 1000 Talente (4,7 Millionen Mark), die Pompejus zur Besoldung seiner Truppen verwandte. Ariobarzanes von Cappadocien zahlte an ihn monatlich 33 Talente (155.600 Mark), die noch nicht zur Abtragung der Zinsen seiner Schulden hinreichten. Gabinius hatte als Prokonsul in Syrien 100 Millionen Denare (70 Millionen Mark) erpreßt. Dem Könige von Ägypten Ptolemäus Auletes hatte er angeblich seine Unterstützung für 10.000 Talente (47 Millionen Mark) zugesagt, nachdem Cäsar in seinem eigenen und Pompejus' Namen demselben bereits gegen 600 Talente (über 28 Millionen Mark) abgenommen hatte. Crassus raubte aus dem Tempel zu Jerusalem an Geld und Geldeswert 10.000 Talente. Auch Gallien, dessen Reichtum bei den Römern sprichwörtlich blieb, war in Cäsars Zeit ein goldreiches Land. Der von Q. Servilius Cäpio (etwa 106) aus der Tektosagenstadt Tolosa geraubte Tempelschatz hatte nach Posidonius 15.000 Talente (über 70 Millionen Mark) betragen. Im ganzen Gebiete des Rheins und in dem der Loire und Seine ist bis auf Cäsar in großer Menge, ja vielleicht an vielen Orten allein Gold geschlagen worden, und Cäsar brachte von der gallischen Beute dessen so viel auf den Markt, daß das Pfund zu 3000 (statt 4000) Sesterzen in Italien und den Provinzen verkauft wurde, also um 25 Prozent gegen Silber fiel.
Ebenso groß wie die Beute jener Römer in der letzten Zeit der Republik waren aber auch die Ausgaben, zu denen ihre Stellung und die Ruchbarkeit ihrer Verbrechen sie nötigte. Oft mußten sie, wie Warren Hastings, die geraubten Schätze ganz oder teilweise opfern, um eine Freisprechung von den gegen sie erhobenen Anklagen zu erwirken. Immer aber verschlang der zu den großen politischen Unternehmungen erforderliche Aufwand die kolossalen Bestechungen, die Unterhaltung eines ungeheuren Trosses von Anhängern und die Schauspiele, deren Pracht ans Fabelhafte grenzte, enorme Summen. Die Ädilität des Scaurus erschöpfte sein Vermögen und stürzte ihn in Schulden. So zerrannen jene Schätze zum großen Teil so, wie sie gewonnen waren, und der wirkliche Besitz der damaligen Nabobs stand weder zu ihren Erwerbungen noch zu ihrer Verschwendung im Verhältnis. Selbst Crassus, dessen Reichtum in seiner Zeit als beispiellos gegolten zu haben scheint, war nicht so reich wie mehrere Freigelassene der ersten Kaiserzeit, wie Pallas, Callistus und Narcissus. Er besaß vor dem parthischen Kriege etwa 7100 Talente (33½ Millionen Mark). Dem älteren Plinius erschien die letzte Zeit der Republik, mit der Gegenwart verglichen, als eine Zeit der Armut. Wahrscheinlich erreichten in der Tat die großen Kapitalansammlungen in der Kaiserzeit nicht nur eine größere Höhe, sondern waren auch häufiger als in der Republik. Die Ursachen, die eine Hebung des Wohlstands überhaupt bewirkten, trugen auch zur Bildung kolossaler Einzelvermögen bei: namentlich die Ausbeutung zahlreicher neuer, noch unerschöpfter Provinzen, der Aufschwung des Handels, besonders mit Völkern, die in der Kultur tiefer standen, die Sicherung und die vielfachen Erleichterungen des Verkehrs, wohl auch die Beschleunigung des Geldumlaufs.
Aber auch die Summen der größten Reichtümer in der Kaiserzeit stehen (obwohl sie ein dem modernen Reichtum in der Regel fehlendes, sehr bedeutendes Wertobjekt, die Sklaven, in sich schlossen) hinter den Summen, zu welchen die höchsten Vermögen und Einkünfte in neueren und neuesten Zeiten geschätzt worden sind, zurück. Wenn ein Freigelassener Neros einen Besitzer von 1,3 Millionen Mark für einen seiner Armut wegen beklagenswerten Mann erklärte, so beweist dies (die Wahrheit der Erzählung vorausgesetzt) nicht, daß ein solches Vermögen als Armut galt, sondern daß der Übermut der damaligen Millionäre ebenso groß war wie der der heutigen: nur daß diesen ganz andere Reichtümer, mit ihrem so viel größeren Maßstabe gemessen, ärmlich erscheinen. Von einem Kapitalisten, dessen Vermögen bei seinem Tode 2 Millionen Lstr. betrug, soll »der größte Bankier Europas« gesagt haben: Ich glaubte nicht, daß er so arm war.« Die größten bekannten Vermögen des römischen Altertums betragen 300 und 400 Millionen Sesterzen (65¼ und 87 Millionen Mark); nur zwei Personen werden genannt, welche die letztere Summe besessen haben sollen, der Augur Cn. Lentulus und der Freigelassene Neros Narcissus. Als Zinsen für sichere Anlagen finden wir (mit Ausnahme von Griechenland und Kleinasien, wo sie 8 bis 9 Prozent betrugen) im ganzen römischen Reiche 3 bis 15, doch das typische Niveau lag überall und zu allen Zeiten zwischen 4 und 6, mit einer schwachen Senkung gegen 4 unter Caracalla bis Alexander Severus, die aber wieder dem früheren Stande wich, endlich unter Justinian vielleicht mit einem schwachen Steigen (gegen 6 und 7). Das höchste aus dem Altertum bekannte Jahreseinkommen ist dasjenige, welches die reichsten römischen Familien am Anfang des 5. Jahrhunderts bezogen haben sollen: etwa 4000 Pfund Gold bar, und Naturalien im Werte des dritten Teils dieser Summe; im ganzen nach heutigem Gelde 4,872.480 Mark.
Zur richtigen Schätzung dieser Summen können einige Angaben der größten Vermögen und Einkünfte in verschiedenen Zeiten und Ländern als ein zwar sehr unvollkommenes, aber doch nicht ganz wertloses Hilfsmittel dienen; mehrere derselben sind, wie gesagt, höher als die Angaben aus der römischen Kaiserzeit, und zwar beträchtlich. Ungeheure Reichtümer, die ebenso schnell zerrannen, wurden von einzelnen im Reiche der Kalifen gewonnen. Unter Kalif Mahdy hatte ein reicher Hâshimide in Bassora ein tägliches Einkommen von 100.000 Dirhem (soviel wie Francs); er soll 50.000 Klienten gehabt haben. Ein Lorenzo de' Medici hinterließ bei seinem Tode (1440) 235.137 Goldgulden (etwa 2⅓ Millionen Mark). Jacques Cœur (etwa 1400-1456), der reichste Mann Frankreichs im Mittelalter, der das ganze Bankgeschäft sowie fast den ganzen Ein- und Ausfuhrhandel des Landes in seiner Hand vereinigte, in zahlreichen Häfen der Levante Kontore, in der Mehrzahl der französischen Städte Niederlassungen hatte, Kupfer-, Blei- und Silbergruben besaß, war imstande, Karl VII. zur Vertreibung der Engländer aus der Normandie 200.000 écus (entsprechend 13-16 Millionen Mark in heutigem Gelde) zu leihen. Er erwarb mehr als 20 Herrschaften und Kastellaneien, hatte Häuser und Schlösser in den größeren Städten Frankreichs und stattete mehrere der letzteren mit Bauten aus. Die ihm durch eine ungerechte Verurteilung auferlegte Buße betrug 400.000 écus. Der Bankier von Julius II., Agostino Chigi, der mehr als 100 Schiffe auf den Meeren und Handelshäuser in Lyon, Constantinopel, Amsterdam, selbst in Babylon besaß und mehr als 20.000 Menschen unterhielt, soll ein Einkommen von 70.000 Dukaten gehabt haben. Das Vermögen der Fugger, das 1511 rund 250.000 Gulden betrug und bis Ende 1527 auf 2 Millionen gestiegen war, erreichte 1546 mit 4¾ Millionen Gulden seinen höchsten Stand; in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erfolgte nach einem Verlust von 8 Millionen der Bankrott des Hauses. Mazarins Vermögen schätzt Voltaire auf etwa 200 Millionen Frcs. nach damaliger Währung. Unter Ludwig XIV. besaß der Bankier Samuel Bernard 33 Millionen Livres, der ehemalige Steuereinnehmer Bretonvilliers ein Jahreseinkommen von über 3 Mill. Frcs. in heutigem Gelde. Das Barvermögen des Fürsten Alexei Danilowitsch Menschikow († 1729) soll bei seiner Verbannung 5, nach andern 10 Millionen Rubel betragen. Er hatte allein in Kleinrußland 4 Städte, 88 Kirchdörfer, 99 Dörfer, 15 kleine Flecken und 87 Fischereien besessen, in Ingermanland 16 Güter, 98 Dörfer, Diamanten und Wertsachen für eine Million Rubel, 72 Dutzend silberne Teller, 150 Pud (= 1720 Kilogramm) Tischservice in Gold. Potemkin brachte, unter kolossalen Verschwendungen bei einem Prasserleben, dessen Muster in den Märchen von 1001 Nacht zu suchen ist, in 16 Jahren ein Vermögen von 90 Mill. Rubel zusammen, während damals die ganze Jahreseinnahme des Reichs etwa 50 Millionen betrug. Der jährliche Verbrauch des Grafen Brühl wurde auf 6 Millionen Mark geschätzt. Die Einkünfte des Kardinals Ludwig Rohan werden auf ungefähr 5 Millionen Mark angegeben. Das Privatvermögen Talleyrands schätzte man auf 18 Millionen Frcs. Von den spanischen Granden hatte im 18. Jahrhundert der Herzog von Alba eine Revenue von 8 Millionen Realen (über 1,600.000 Mark), der Herzog von Berwick nahe an 2 Millionen, aber diese Einkünfte wurden größtenteils durch ungeheure Dienerschaften aufgezehrt. Der Herzog von Ossuna hatte (nach Bismarck 1859) ein Einkommen von Millionen; er besaß prächtige Gärten und Schlösser in Spanien, Italien, Belgien und Sardinien, die er selbst nur im Bilde kannte. Unter den polnischen Magnaten in der Zeit Stanislaw Augusts konnte Felix Potocki 30 Meilen ohne Unterbrechung auf eigenem Grunde reiten, sein Besitz brachte ihm trotz der großen vom Vater her darauf lastenden Schulden anfangs jährlich 700.000 Mark, machte ihn aber bald zum reichsten Mann Kronpolens. Die Czartoryski hatten 15 Städte, 11 schloßähnliche Landsitze, 2 Paläste in Warschau, die Hinterlassenschaft August Czartoryskis brachte etwa 1,800.000 Mark Einkünfte. Karl Radziwill hinterließ trotz einer echt polnischen Mißwirtschaft einen Besitz von gegen 3 Millionen Mark jährlicher Einkünfte.
In Rußland bildeten bekanntlich bis 1863 die Leibeigenen (nahezu ein Drittel der Gesamtbevölkerung) einen sehr bedeutenden Teil der großen Vermögen. Fürst Nicolai Borissowitsch Jussupow gab bei dem Besuche Friedrich Wilhelms II. in Moskau nach der Geburt Alexanders II. (1818) auf seinem dortigen Gute in Archangelsk ein Fest, bei dem er unter anderm seine Gäste durch 40.000 Leibeigene in festlichen Gewändern mit Salz und Brot, den russischen Symbolen der Gastfreiheit, empfangen ließ. Das Vermögen der Jussupows, obwohl mehrmals zur Strafe für Verschwörungen halb konfisziert, war im Jahre 1870 immer noch größer als das der meisten deutschen Fürsten und hatte dadurch, daß zwei Leibeigene, Vater und Sohn, die nacheinander als Verwalter fungierten, während ihrer Dienstzeit 3 Millionen an sich gebracht hatten, keine sehr merkliche Verminderung erlitten. Die Demidows sollen unter anderm einen ungeheuren Felsen von Malachit besessen haben, von dem jedes Pud 800 Rubel kostete; der enorm reiche Astaschew hatte allein im Jahre 1843 in Sibirien 111 Pud Gold brutto, d. h. einen Wert von 5,104.890 Mark gewonnen; das Vermögen des Fähnrichs Jakubow, »1847 vielleicht das kolossalste auf dem Kontinent«, schätzte man auf mehr als 300 Millionen Mark.
Im übrigen Europa (besonders in England) sowie in Amerika hat sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Anhäufung ungeheurer Kapitalien in den Händen einzelner in einem Umfang bis zu einer Höhe vollzogen wie vielleicht nie zuvor. Wohl niemand in Frankreich würde heute, wie Frau von Rémusat 1818, ein Einkommen von (höchstens) einer Million Frcs. »ein unermeßliches« nennen. In England, wo in Johnsons Zeit der Gesamtverbrauch eines Mannes von hohem Range mit 5000 Lstr. vollständig bestritten werden konnte, und wo nach Macaulay um 1760 ein Einkommen von 40.000 Lstr. mindestens ebenso selten war wie 1840 eines von 100.000, gab es noch 1854 kaum 20 Mitglieder des Hauses der Gemeinen, die ein Einkommen von 10.000 Lstr. hatten; im Jahre 1888 konnte man deren unschwer fünfmal soviel zählen, die ein drei- und vierfaches Einkommen besaßen, und »Zehntausend jährlich« galten nicht mehr wie damals als großer Reichtum. In der Stadt New York zählte man 1847 nicht mehr als 25 Personen, die ein Vermögen von einer Million Dollar hatten; unter diesen »bescheidenen Millionären« ragte Johann Jakob Aster hervor, der bei seinem Tode (1848) auf 20 Millionen Dollar geschätzt wurde. Die Bildung kolossaler Einzelvermögen begann mit dem gewaltigen Aufschwung Amerikas nach dem Sezessionskriege. Alexander F. Stewart gab 1865 sein Jahreseinkommen auf 4,071.256 Dollar an und zahlte an Einkommensteuer 407.000. Cornelius Vanderbild, der 1846 nur 750.000 Dollar besaß, soll, als er 1877 im Alter von 81 Jahren starb, gesagt haben, daß er seit seiner Geburt im Durchschnitt jährlich 1 Million erworben habe; er hinterließ seinem Haupterben 90 Millionen, außerdem Legate im Betrage von 15 Millionen. Jay Gould, der 1884 für den reichsten Mann der ganzen Welt galt, besaß angeblich 275 Millionen, J.W. Mackay, der in der Liste der größten Millionäre die zweite Stelle einnahm, 250 Millionen Dollar; bei J. Pierpont Morgan wurde allein der Gewinn, den er bis 1909 durch den Zuckertrust gemacht hatte, auf 660 Millionen Dollar geschätzt; auf das Vermögen Andrew Carnegies läßt die Tatsache einen Schluß zu, daß sich die von ihm gemachten Stiftungen gegenwärtig auf ungefähr 157 Millionen Dollar belaufen.
Wenn aber Amerika die höchste Ziffer der Einzelvermögen aufweist, so ist England nichtsdestoweniger das reichste Land, auf welches man gegen Ende des 19. Jahrhunderts von den 700 Besitzern von einer Million Lstr., die damals auf der ganzen Erde leben sollten, nicht weniger als 200 rechnete. Ein Einkommen von mehr als 10.000 Lstr. oder 200.000 Mark jährlich hatten dort 2418 Personen, in Frankreich 700-800, in Deutschland nur 144. Nach jener 1884 aufgestellten Liste der 12 größten Millionäre, die 7 Amerikaner und 5 Engländer enthält, besaß der reichste Mann in England, Rothschild, ein Vermögen von 800, der Herzog von Westminster 320 Millionen Mark; die drei übrigen waren die Herzöge von Sutherland und Northumberland und der Marquis von Bute, der mit einem Vermögen von 80 Millionen Mark die letzte Stelle in der Liste einnahm.
Alle solche Angaben genügen nun freilich nicht zur Beantwortung der Frage, ob die reichsten Leute des Altertums reicher waren als die reichsten der neueren Zeiten. Diese Frage wäre selbst dann nicht leicht zu beantworten, wenn es gelänge, den Sachwert festzustellen, den das Geld in den beiden verglichenen Perioden hatte. Daß nun der Sachwert des Gelds im Altertum weit höher gestanden habe als heute, ist eine Ansicht, zu der auch die Untersuchung von Rodbertus über diesen Gegenstand gelangt. Zwar wird dort zugestanden, daß er die letzten Jahrhunderte der Republik hindurch bis jedenfalls zu Nero etwas sank, doch nur für Rom und Italien; von da ab sei er aber wieder im ganzen römischen Reiche gestiegen. Doch abgesehen von manchen andern sich hier aufdrängenden Bedenken, erscheinen die zugrunde gelegten Angaben aus dem Altertum zur Aufstellung so weitgehender Folgerungen keineswegs ausreichend. Immer ist nicht zu vergessen, daß im Altertum die Genußmittel wie die Fabrikate überhaupt einerseits (wenigstens großenteils) durch die verhältnismäßige Unvollkommenheit der Fabrikation und des Transports verteuert wurden, anderseits durch ihre verhältnismäßige Seltenheit, da der sehr viel geringeren Masse von Edelmetall, die im römischen Reiche zirkulierte, auch eine sehr viel geringere Masse von Genußmitteln wie von Wertobjekten überhaupt gegenüberstand. Freilich war die Entwicklung der Geldsurrogate eine verhältnismäßig sehr geringe, und die Schnelligkeit des Geldumlaufs, die in so vieler Hinsicht ähnlich wirkt wie die Geldmenge, bleibt völlig unmeßbar. Ob aber die Masse der durch Fabrikation erzeugten oder durch Handel eingeführten Genußmittel seit dem Untergang des Altertums nicht in demselben Maße gewachsen ist wie die Masse des Edelmetalls, wird zwar wohl nie zu ermitteln sein, doch für unmöglich kann es gewiß nicht erklärt werden. Ebensowenig wird sich wahrscheinlich jemals feststellen lassen, worauf es bei dem Vergleich der heutigen Reichtümer mit den damaligen hauptsächlich ankommt: ob die größten Einkommen in der Kaiserzeit eine mittlere Jahresrente höher überragten als in der Gegenwart. Jedenfalls sind gegenwärtig alle Angaben über den relativen Wert derselben Geldsummen im Altertum und in irgendeiner Periode der neueren Zeit ganz willkürlich.
Doch nicht bloß der Luxus der Kaiser und der Großen in der letzten Zeit der Republik ist ein exzeptioneller; auch von den übrigen Beispielen des Luxus, auf die man sich zu berufen pflegt, werden manche ganz offenbar als einzeln stehende Ausnahmen berichtet. Jener M. Gavius Apicius, der unter Augustus und Tiberius ungeheure Reichtümer (60 oder 100 Millionen Sesterzen) in raffinierter Schwelgerei verpraßte, und als er sein Vermögen bei einer Überrechnung auf 10 Millionen Sesterzen (über 2 Millionen Mark) herabgeschwunden fand, sich nach glaubwürdiger Mitteilung den Tod gab, weil er angeblich mit einer so geringen Summe zu leben nicht für möglich hielt, und vielleicht noch mehr, weil er alle Genüsse bis zum Ekel ausgekostet hatte, galt auch seinerzeit als ein Wunder von Üppigkeit. Ein gelehrter Vielschreiber (Apio) gab ein Buch über seinen Luxus heraus, sein Name ward sprichwörtlich, er selbst zum Mythus, und durch diesen zu einer Art von Typus der vollendetsten Schwelgerei; noch zweihundert Jahre später wählte ein Elagabal ihn zum Vorbilde. Von den Anekdoten, deren Gegenstand er war, genügt als Probe die folgende (vielleicht aus Apios Buch entlehnte): er habe eigens eine beschwerliche Seereise von Minturnä nach Afrika unternommen, weil er gehört hatte, daß dort die Krebse sehr groß seien, und als er sich vom Gegenteil überzeugt, sei er sofort wieder umgekehrt. Wenn es aber überall unzulässig ist, aus Anomalien und Ausnahmen auf allgemeine Zustände zu schließen, so gilt dies ganz besonders für das kaiserliche Rom, auf dessen Boden, unter Einflüssen und Bedingungen, wie sie so nie wiedergekehrt sind, Laster und Ausschweifungen die Tendenz hatten, ins Kolossale und Monströse auszuarten: und so mögen freilich Apicius und seinesgleichen die berüchtigtsten Verschwender neuerer Zeiten hinter sich zurücklassen, wie den Grafen Brühl und den durch den Halsbandprozeß bekannten Kardinal Rohan, von dem die Äußerung berichtet wird: er begreife nicht, wie man mit weniger als anderthalb Millionen Livres als Einkommen leben könne.
Vollends jener widersinnige Luxus, der nicht im Genuß, sondern in der Herabwürdigung und Zerstörung des Kostbaren und Wertvollen seine Befriedigung findet, kann der Natur der Sache nach nie anders als vereinzelt vorgekommen sein, und nichts spricht dafür, daß er in Rom verhältnismäßig häufiger war als in modernen Weltstädten, wo zu allen Zeiten großer Reichtum und Übermaß des Genusses Übersättigung und einen mit dem Frevel prahlenden Übermut erzeugt hat. Übrigens fehlt es auch an sonstigen Beispielen dafür nicht. Auch die Großen des Mittelalters suchten ihren Ruhm in völliger Nichtachtung des Besitzes und betätigten diese nicht bloß durch rücksichtslose Verschwendung, sondern auch durch Zerstörung. Bei einer 1174 von Heinrich II. von England nach Beaucaire berufenen Versammlung, wo eine außerordentliche Menge von Freiherren und Rittern zusammenkamen, ließ Bertram Rambaut ein Stück Land pflügen und 30.000 Sols in Pfennigen aussäen, Wilhelm von Martell, der 300 Ritter im Gefolge hatte, alle Speisen in seiner Küche an Wachsfackeln bereiten, Raimund von Venous 30 Pferde herbeiführen und lebendig verbrennen. Als Joachim I. von Brandenburg 1500 nach Frankfurt kam, um die Huldigung der Stadt zu empfangen, schritt ein Herr von Belkow in Samtstiefeln, die mit Perlen geschmückt waren, zur Seite seines Pferdes mitten durch den Kot. Derselbe pflegte mit seinen Brüdern auf den Töpfermarkt zu reiten, sie ließen das sämtliche Geschirr von ihren Pferden zertrümmern und zahlten den doppelten Preis dafür, dann führten sie die Pferde in den Ratskeller und wuschen sie mit Malvasier. Erwägt man, daß in Rußland gewisse Festlichkeiten, wo es hoch hergeht, ohne das Zertrümmern des Geschirrs nicht für vollständig gelten; daß Tanzen auf Porzellan auch zu den Extravaganzen unserer Seeleute gehört, wenn sie sich am Land befinden; daß Kreolinnen in Habana »ihre neuen, soeben aus Paris bezogenen Kleider im Werte von vielen hundert Talern über die Räder ihrer Wagen breiten, um sie in wenigen Minuten total zu verderben und dadurch mit ihrem Reichtum zu prunken«: so muß man glauben, daß der Hang zu dieser Art der Perversität nicht ein gewissen Kulturperioden eigentümlicher und für sie bezeichnender, sondern ein der menschlichen Seele tief eingepflanzter ist.
Fast die einzigen auffallenden Beispiele dieser Form des Luxus, die aus dem alten Rom berichtet werden, sind (wenn man von den Kaisern absieht) das des Verspeisens von Singvögeln, abgerichteten und sprechenden Vögeln, und des Schlürfens aufgelöster Perlen. Nach Valerius Maximus soll der Sohn des großen, durch seine Kunst sehr reich gewordenen tragischen Schauspielers Äsop das letztere zu tun gepflegt, nach Plinius soll er jedem von seinen Gästen eine aufgelöste Perle vorgesetzt haben. Nach Horaz schlürfte er selbst eine solche, die Metella im Ohr getragen, um auf einmal eine Million hinabzuschlucken. Auch das Braten von Singvögeln und sprechenden Vögeln schreibt Valerius Maximus dem Sohn, Plinius dagegen dem Vater Äsopus zu; der letztere gibt sogar den Preis der einzelnen auf 6000, den Preis der ganzen berühmten Schüssel auf 100.000 Sesterzen an; bei Horaz endlich sind es die beiden Söhne des Q. Arrius, die teuer gekaufte Nachtigallen zu speisen pflegten. Die Abweichungen der Berichterstatter zeigen, wie diese und ähnliche Anekdoten sich im Munde jedes Erzählers anders gestalteten, daß daher ihre Zuverlässigkeit in Einzelheiten äußerst gering ist, und ihr Wert nur darin besteht, daß sie allgemein geglaubt wurden. Weil sie nun unendlich oft wiederholt worden sind (wobei zuweilen auch die Perle der Cleopatra auf die Rechnung des römischen Luxus gesetzt wurde), bildete man sich nicht selten unwillkürlich ein, sie müßten auch oft vorgekommen sein. In der Tat aber haben diese und andre »Solözismen der Wollust« eben auch damals für Anomalien gegolten. Augustus, erzählte man, habe Eros, seinen Prokurator in Ägypten, weil er eine in allen Kämpfen siegreich gebliebene Wachtel kaufte und braten ließ, an einen Schiffsmast nageln lassen. Solche und ähnliche Extravaganzen (wie das Zerbrechen eines Silbergefäßes von Mentor, einem antiken Cellini, um dessen Reliefs an dem Nachtgeschirr einer Maitresse anbringen oder gar es daraus anfertigen zu lassen) kennzeichneten außer dem unsinnigen Verschwender höchstens noch den ungebildeten Emporkömmling: bei Trimalchio sind die Kissen mit Purpurwolle gestopft, und ein Sklave, der dessen verletzten Arm mit weißer statt mit Purpurwolle verbindet, wird gepeitscht. Zur Charakteristik des damaligen Luxus im allgemeinen kann dergleichen ebensowenig benutzt werden, wie man auf den Luxus des 18. Jahrhunderts etwa daraus schließen darf, daß der Prinz von Conti die Tinte eines Billetts mit Diamantenstaub bestreute, und die Töchter des Bankiers Tepper in Warschau (um 1790) ihren Kaffee auf einem Feuer von Sandelholz bereiten ließen.
Zu Irrtümern hat es ferner geführt, daß man öfters ohne Prüfung in die verdammenden Urteile römischer Schriftsteller über manchen Luxus eingestimmt hat, der einer unbefangenen Betrachtung tadelfrei und vernünftig, ja selbst als erfreuliches Symptom fortgeschrittener Kultur und vermehrten Wohlstands erscheint. Bekanntlich ist der Begriff des Luxus ein durchaus relativer. »Jeder einzelne und jeder Stand, jedes Volk und jedes Zeitalter erklärt alle diejenigen Konsumtionen für Luxus, welche ihm selbst entbehrlich scheinen.« Im ganzen war nun aber die Ansicht des Altertums in dieser Beziehung eine strengere als die neuerer Zeiten. Das Leben der Alten war (und das der Südländer ist, wenn auch in geringerem Grade, noch heute) weit mehr an die Natur gebunden und darum naturgemäßer als das der Modernen. Jede durch die steigende Kultur herbeigeführte künstliche Befriedigung der Bedürfnisse erschien jenen darum viel eher nicht bloß als überflüssig, sondern selbst als widernatürlich, während bei den hochkultivierten Nationen der nördlichen Zonen, die von vornherein auf einen künstlichen Ersatz der ihnen zu ihrem Wohlbefinden von der Natur versagten Bedingungen gewiesen sind, eine Erhöhung dieser Künstlichkeit nicht nur als unschuldig, sondern sogar oft mit Recht als ein Fortschritt erscheinen muß. Dazu kommt, daß zufälligerweise gerade die drei Schriftsteller, denen wir hauptsächlich die Nachrichten über den römischen Luxus verdanken, Varro, Seneca und der ältere Plinius, Männer von besonders einfachen und strengen Gewohnheiten, ja von einer grundsätzlichen Enthaltsamkeit waren, deren Ansichten die durchschnittlichen ihrer Zeitgenossen gewiß an Strenge übertrafen. Namentlich gilt dies von Seneca, der sich in seiner Jugend sogar ein Jahr lang der animalischen Nahrung enthielt, sich auf den Rat des Attalus nicht bloß unerlaubte, sondern auch überflüssige Genüsse versagte und, wenn er gleich allmählich in der Strenge seiner Lebensweise nachließ, sich doch selbst im höheren Alter der Austern und Pilze, der Wohlgerüche, des Weins, der warmen Bäder enthielt und auch in den Genüssen, die er sich gestattete, eine an Enthaltsamkeit grenzende Mäßigkeit beobachtete. Sein Körper war, wie sich bei seinem Tode zeigte, durch die dürftige Ernährung abgemagert. Er, Plinius und Varro verdammen mehr oder minder unbedingt jede Bequemlichkeit, jede Verfeinerung des Genusses, ja sogar jeden entbehrlichen Genuß, und sind selbst von Anwandlungen einer Sehnsucht nach dem ursprünglichen Naturzustande nicht frei. Plinius, bei dem die Betrachtung des unergründlichen Reichtums der sich selbst überlassenen Schöpfung diesen Hang nährte und steigerte, geht unter anderm so weit, die Erfindung des Segelschiffs als einen frevelhaften Eingriff in die Ordnung der Natur zu verwünschen. Varro mißbilligt das Herbeischaffen von Nahrungsmitteln aus fremden Ländern. Plinius findet in der künstlichen Spargelzucht den Beweis einer monströsen Schlemmerei; er und Seneca deklamieren, der letztere wiederholt, gegen das Kühlen von Getränken mit Schnee als einen naturwidrigen Luxus, während dies heutzutage im Süden auch dem Ärmsten als unentbehrlicher Genuß gilt und schon seit Jahrhunderten gegolten hat; Addison, der Neapel in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts besuchte, meinte, ein Mangel an Schnee würde dort ebensogut wie anderswo ein Mangel an Korn einen Aufstand erregen. Gewiß ist es aber auch ein sehr naturgemäßer Genuß; auch rühmt der Arzt Galenus die Leichtigkeit der Beschaffung von Schnee als einen Vorzug von Rom. In Sicilien soll mit dem zunehmenden Gebrauch des Schnees sich auch der Gesundheitszustand gehoben haben. Die Bereitung des Gefrorenen von Fruchtsäften und andern wohlschmeckenden Substanzen ist übrigens eine (französische) Erfindung aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Auch der kolossale Aufschwung, den Eishandel und Eisfabrikation in der neuesten Zeit genommen haben, ist wohl geeignet, an den Abstand des heutigen Luxus von dem antiken und die engen Schranken, in die der letztere gebannt war, zu erinnern. Der amerikanische Eishandel, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Höhepunkt erreichte, indem er jährlich für mehr als 1 Million Mark Natureis von den nördlichen Seen bis in die Äquatorialgegenden regelmäßig lieferte, hat auf den meisten Märkten der Konkurrenz des künstlichen Eises weichen müssen; und man erwartet, daß die Eismaschinen, die bereits die mannigfachste Verwendung finden, bald zu den Utensilien jedes wohleingerichteten Haushalts gehören werden.
Begründeter als gegen den Luxus der Kühlung durch Schnee ist das Bedenken des Plinius gegen die Verweichlichung durch den Gebrauch von Federkissen: doch schwerlich kann diese nordische, dem wärmeren Klima durchaus nicht zusagende Sitte, die bereits Varro und Cicero erwähnen, im Altertum jemals große Verbreitung gefunden haben. Ein Übermaß des Luxus aber vermögen wir auch hierin keineswegs zu erkennen. Ein Volkswirtschaftslehrer des 18. Jahrhunderts sieht sogar darin einen Beweis für die Armseligkeit des römischen Handels, daß die Römer sich zur Füllung ihrer Kissen und Pfühle nur der Federn deutscher Gänse und der Schwäne bedienten, während die Daunen der Eidergänse aus den Polarländern ihnen unzugänglich blieben. Den Preis der Gänsefedern gibt Plinius auf 5 Denare (zirka 4⅓ Mark) für das römische Pfund (327 gr.) an. Ein Pfund der feinsten Eiderdaunen kostete in Frankfurt a. M. im Jahre 1786 sechs Taler.
Außerdem darf man nicht vergessen, daß die meisten römischen Schriftsteller dieser Zeit die Tendenz haben, die Vergangenheit zu preisen und zu rühmen, die Gegenwart auf deren Kosten herabzusetzen. Durch die ganze spätere römische Literatur zieht sich wie ein roter Faden die Klage über Verschlimmerung der Zeiten, wobei die Klage über das Überhandnehmen der Üppigkeit und Schwelgerei, wie berechtigt auch in vieler Hinsicht, doch viel zu sehr verallgemeinert und übertrieben wird. Man glaubt in diesen »Kapuzinerpredigten«, wie sie Goethe genannt hat, eine der von der Rhetorenschule anhaftenden Gewohnheiten zu erkennen, wo derartige Vergleichungen zu den Gemeinplätzen gehört haben mögen: eine Gewohnheit, der sich selbst die nicht immer entziehen können, die wie Seneca überzeugt waren, daß der Zustand der menschlichen Dinge im wesentlichen zu allen Zeiten derselbe gewesen sei und bleiben werde. Namentlich Plinius entlehnt den Maßstab zur Beurteilung des Luxus im kaiserlichen Rom den Zuständen der Zeit, in der Mehlbrei, aus irdenen Töpfen gegessen, die Hauptnahrung der Römer war, die Wände der Wohnungen noch keinen Bewurf hatten und ein einziger Sklave den Dienst eines großen Hauswesens besorgte. Er und andere reden so, als wenn es auch nur denkbar wäre, daß diese Einfachheit hätte dauern können, nachdem Rom eine Weltstadt geworden war, in der die Genußmittel aller Zonen zusammenströmten, nachdem eine hochentwickelte Kultur Bedürfnisse und Genüsse unendlich vervielfacht, verfeinert und verallgemeinert hatte. Ihnen erscheint der Glanz und die Pracht, die Anmut und das Behagen, mit denen diese Kultur das Leben geschmückt hatte, kaum minder bedauernswert als ihre schlimmsten Schattenseiten. Ihre Klagen haben deshalb oft keine größere Berechtigung, als wenn jemand heutzutage die Zustände der Jahrhunderte zurückwünschen wollte, wo die Straßen der Stadt weder Pflaster noch Beleuchtung, die Fenster der Wohnhäuser keine Glasscheiben hatten und der Gebrauch der Gabel beim Essen unerhört war. Auch dieser Gebrauch, der in Frankreich im 14., in Italien zu Anfang des 15. Jahrhunderts aufkam, hat seinerzeit Anstoß gegeben; ein alter Chronist Dandolo erzählt, daß die Gemahlin eines Dogen, die sich einer goldenen Gabel bediente, zur Strafe für diese Üppigkeit lange vor ihrem Tode einen Leichengeruch aushauchte. Ebenso wird über jede Neuerung, die eine Erhöhung der Bequemlichkeit oder Annehmlichkeit bezweckte, in den Chroniken des 14. und 15. Jahrhunderts als über ein Symptom des Sittenverfalls geklagt; so über die Einführung der Matratzen statt der Strohsäcke, der Betthimmel und -vorhänge, der Beleuchtung durch Talg- und Wachskerzen statt durch Fackeln; desgleichen in der Einleitung von Holinsheds Chronik 1577 über die Errichtung von Kaminen in England und die Einführung zinnerner Schüsseln statt irdener und hölzerner.
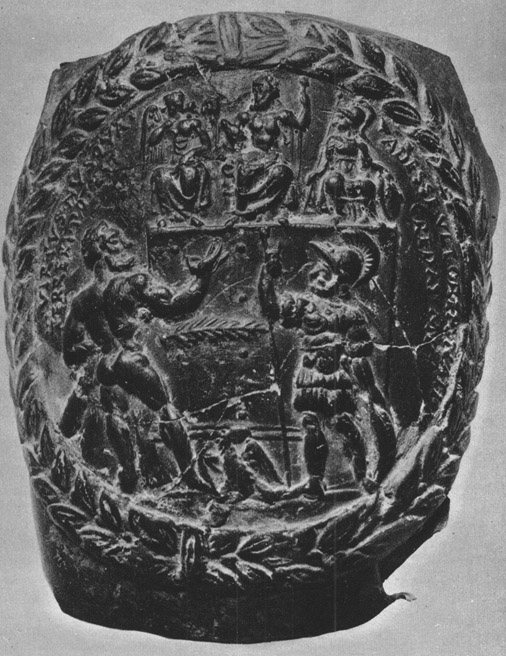
87. SZENE AUS EINER RÖMISCHEN TRAGÖDIE.
Medaillon von einer römischen Vase, im British Museum zu London. (Auf erhöhter Bühne Jupiter, Victoria zu seiner Rechten, Minerva zur Linken. Davor Hercules und Mars. Hercules hat Cycnus, den Sohn des Mars, erschlagen. Mars: »Adesse ultorem nati me credas mei.« Hercules: »Invicta virtus nusquam terreri potest.«
Endlich ist die Beurteilung des Luxus dadurch erschwert worden, daß man seine verschiedenen Gattungen nicht auseinandergehalten und aus der Größe gewisser Arten der Verschwendung auf die Größe des Luxus überhaupt geschlossen hat. Aber bei demselben Volke und in derselben Zeit kann sehr wohl neben großem Luxus auf einem Gebiete Sparsamkeit und Dürftigkeit auf einem andern bestehen. So waren nach Wilhelm von Malmesbury die Bankette der Angelsachsen sehr verschwenderisch, aber ihre Wohnungen armselig; dagegen waren die Normannen im Essen sehr mäßig, aber bauten sich prachtvolle Schlösser. In Deutschland hatte man in den früheren Jahrhunderten (mindestens seit dem sechzehnten) in den dürftig ausgestatteten Häusern wenig Komfort; der Hauptluxus bestand in der Kleiderpracht, welche so zahlreiche Kleiderordnungen veranlaßte. Auch in Rußland zeigte sich im 17. Jahrhundert der Luxus, außer in verschwenderischem Gebrauch der Edelmetalle, fast ausschließlich in der Kostbarkeit der (meist orientalischen) Kleiderstoffe, besonders Seidenzeuge. Der Patriarch Nikon gab 1652 in 7 Monaten 700 Rubel (= 150.000 Pfund Roggen) für seine Kleidung aus, während er sich mit einer bäurischen Kost begnügte und auch seine sonstigen Ausgaben für Hausgerät u. dgl. überaus gering waren. Selbst am Hofe hatte man zwar goldene Schüsseln, aber ebensowenig Teller wie Servietten. In der Existenz der spanischen Großen des 17. Jahrhunderts war Prunk und Knauserei überall verbunden. Ihr Luxus bestand in einer kolossalen Verschwendung des aus den Gruben von Mexiko und Peru massenhaft einströmenden Edelmetalls, namentlich zu Tafelgeschirren; in einer Anhäufung kostbarer Möbel und Zimmerdekorationen; in ungeheuren, aber schlecht bezahlten (daher ärmlich lebenden, selbst hungernden) Dienerschaften; in entsprechend großartigen Wohnräumen; in prachtvollen Sänften und reich behangenen Maultieren mit silberbeschlagenen Hufen, Karossen und Pferden zu enormen Preisen (erstere z. B. zu 12.000, letztere zu 25.000 écus); in einer unglaublichen Überladung der Frauentrachten mit Edelsteinen, Perlen usw. Dagegen die sehr hochgeschätzte feine Wäsche war so selten, daß mancher nur ein einziges Hemd besaß und, während dies gewaschen wurde, im Bett bleiben oder ohne Hemd gehen mußte. Überhaupt verbarg sich hinter all jener Pracht vielfach die größte Armseligkeit; denn bares Geld fehlte überall, und man bewahrte es hinter Schloß und Riegel, statt es zinsbar anzulegen. Der Präsident de Brosses bemerkt (1739/40), daß die Begriffe von Glanz und Pracht bei Italienern und Franzosen sehr verschieden waren. »Bei uns in Frankreich besteht, was wir ein großes Haus, eine große Figur nennen, gewöhnlich in einer wohl besetzten Tafel.« Reiche Leute hielten ein zahlreiches Küchenpersonal, große Livréen, ließen dreimal mehr Gerichte als nötig, den Nachtisch sehr zierlich geordnet auftragen; die Italiener verwandten ihr Vermögen auf die Ausschmückung ihrer Vaterstadt mit einem Monument oder schönen Gebäude, das ihren Namen und Kunstsinn auf die Nachwelt brachte. Derselbe sagt, daß die venezianischen Patrizierinnen, die bei Festlichkeiten im Glanze der kostbarsten Geschmeide strahlten, sich mit einer sehr geringen Kost begnügten und die einfachsten Zimmer jener stolzen Paläste bewohnten, von denen ein einziger in weniger als sieben Stunden das glänzende und imposante Schauspiel von 40 prachtvoll möblierten Gemächern bieten konnte.

88. THEATER-SZENENWAND.
Fresko aus Boscoreale. Neapel, Nationalmuseum
Die verschiedenen Gattungen des Luxus hängen also keineswegs notwendig miteinander zusammen. Der Luxus der Tafel, der Kleidung und des Schmucks, der Wohnungen und der häuslichen Einrichtung, der Bestattungsluxus, der Sklavenluxus, der Kunstluxus im römischen Altertum beruhten zum Teil auf sehr verschiedenen Bedingungen und fordern eine gesonderte Betrachtung. Ebenso ist der öffentliche und der Privatluxus jener Zeit zu trennen. Hier soll nur der letztere der Gegenstand einer eingehenden Behandlung sein.

89. TRAUUNGSSZENE AUS EINER RÖMISCHEN KOMÖDIE.
(Wahrscheinlich 4. Akt der »Casina« von Plautus.) Tonlampe. London, British Museum
Die erste Periode eines enormen Luxus in Rom war jene Zeit der Nabobs, und Lucull, den die Beute zweier orientalischen Königreiche in den Stand setzte, als »Xerxes in der Toga« zu leben, galt damals wie später als ihr Hauptrepräsentant, der die ungeheure Verschwendung besonders in Bauten und Gastmählern in Rom eingeführt habe. Doch blieb diese während der Republik natürlich vereinzelt oder auf kleine Kreise beschränkt und verbreitete sich erst nach Begründung der Monarchie, in der auch, wie oben bemerkt, der Reichtum größer war. Darum sagt Tacitus ohne Zweifel mit Recht, die Periode des größten Luxus in Rom sei das Jahrhundert von der Schlacht bei Actium bis zum Regierungsantritt Vespasians gewesen, der, selbst ein Mann von altertümlicher Lebensweise, durch sein Beispiel mehr zur Einschränkung der Üppigkeit beitrug, als Verordnungen und Gesetze vermocht hätten. Dazu kam, daß vielen großen Familien gerade die Sucht, sich durch Glanz und Pracht hervorzutun, unter den Julischen Kaisern den Untergang gebracht hatte, wodurch die übrigen weiser und vorsichtiger geworden waren. Endlich waren aus den Städten Italiens und der Provinzen viele »neue Männer« in die römische Aristokratie eingetreten, welche die heimische Sparsamkeit mitbrachten und, auch wenn sie reich wurden, den früheren Sinn bewahrten. Alle diese Bedingungen zur Einschränkung des Luxus haben durch das ganze 2. Jahrhundert fortbestanden: das Beispiel der Kaiser (mit Ausnahme des L. Verus), eine stete Abnahme des alten, eine stete Zunahme des neuen Adels. Es ist daher nicht anzunehmen, daß nach Trajan, in dessen letzter Zeit Tacitus jene Äußerung tat, in dieser Beziehung eine wesentliche Änderung eingetreten wäre.
Nur mit großer Vorsicht darf man die Klagen der Alten über den Luxus der Tafel aufnehmen. Das Nahrungsbedürfnis der Südländer ist so gering, ihre Mäßigkeit im Genuß von Speise und Trank so groß, daß ihnen sehr leicht als Völlerei erscheint, was uns als erlaubter Genuß gilt, um hier nur an das Trinken des ungemischten Weins zu erinnern. Selbst die Philosophie Epikurs machte ja ihren Schülern die größte Einfachheit der Genüsse, die größte Genügsamkeit zur obersten Regel. Der »Lehrer der Wollust« pries den dem Zeus gleich, der sich an Wasser und Brot genügen lasse, und befolgte diesen Grundsatz so streng, daß er nur, wenn er schlemmen wollte, sich ein Töpfchen Käse gestattete; ja er versuchte (wie Pascal in Port Royal) das geringste Maß der zur Fristung des Lebens erforderlichen Nahrung zu ermitteln, um sich darauf zu beschränken. Er rühmte sich, daß seine Beköstigung noch nicht einen ganzen As (5½ Pfg.) koste, während Metrodor, der es nicht so weit gebracht hatte, für die seinige einen ganzen brauchte.
In Rom erhielt sich die größte Einfachheit des Tisches sehr lange. Auch nachdem das aus Kleinasien zurückkehrende Heer (im Jahre 188) Rom zuerst mit orientalischer Üppigkeit und Schwelgerei bekannt gemacht, nachdem man erfahren hatte, daß es eine Kochkunst gebe, und nun anfing, für Köche, sonst die verachtetsten Sklaven, gute Preise zu zahlen, auch da kann der Luxus der Tafel (mindestens während der nächsten hundert Jahre) noch nicht groß gewesen sein. Denn bis zum Jahre 174 bereiteten die Hausfrauen das Brot selbst, und es gab keine Bäcker in der Stadt, und noch im Jahre 161 erregte das Mästen von Hühnern so viel Anstoß, daß es durch eine eigene zensorische Verordnung verboten und dies Verbot seitdem in allen folgenden Luxusgesetzen wiederholt wurde: man umging es dadurch, daß man Hähne mästete. Noch viel später wurden ausländische Vögel und Muscheln in Rom eingeführt: eine Verordnung, die beides (und außerdem Haselmäuse) verbietet, ist im Jahre 115 erlassen worden. Noch um das Jahre 100 wurde auch bei prächtigen Mahlzeiten griechischer Wein nie mehr als einmal herumgegeben: was bei der Leichtigkeit des Verkehrs zwischen Italien und Griechenland am besten für die große Bescheidenheit der damaligen Tafelgenüsse zeugt. Der Stoiker Posidonius berichtet nach seinen zu Anfang des letzten Jahrhunderts v. Chr. gemachten Beobachtungen, daß die Wohlhabenden in Italien ihre Kinder an eine überaus einfache Kost gewöhnten, so daß sie aßen, was es gerade gab, und meist Wasser tranken; »und oft fragte der Vater oder die Mutter den Sohn, ob er Obst zur Mahlzeit haben wolle, und wenn er davon etwas gegessen hatte, war er zufrieden und legte sich schlafen«.
Doch der aufblühende Handel erhob mit den übrigen Waren auch die Nahrungsmittel der Fremde zum Bedürfnis. Infolge der immer ausgedehnteren Beziehungen Roms zu den überseeischen Ländern, des immer lebhafteren Verkehrs, in welchem die Küsten des Mittelmeers ihre Produkte austauschten, wußte man in Rom bald sehr gut, daß die Böckchen in Ambracia, die Eselfische in Pessinus, die Austern in Tarent, die Datteln in Ägypten usw. in größter Vollkommenheit zu finden seien. Strengere Zeitgenossen, wie Varro, bemerkten dies mit der größten Mißbilligung, weil sie offenbar – ganz wie in Deutschland im 16. Jahrhundert Luther und Hutten – schon darin eine tadelnswerte Üppigkeit fanden, daß man sich nicht an den doch so vortrefflichen einheimischen Nahrungsmitteln genügen ließ. Schwerlich ist aber eine so strenge Auffassung selbst im Altertum zu irgendeiner Zeit allgemein gewesen. Thucydides hebt es als Vorzug Athens hervor, daß dort die Erzeugnisse aller Länder eingeführt würden und seinen Bewohnern der Genuß fremder Güter nicht minder eigentümlich sei als einheimischer; und Dichter der späteren attischen Komödie, wie Antiphanes, und der von Ennius bearbeitete Archestratus von Gela (in einer gastronomischen Reise um die Welt) haben Verzeichnisse von Leckerbissen verschiedener Länder mit einem ähnlichen Behagen zusammengestellt wie Brillat-Savarin, der die Mahlzeiten von Paris als kosmopolitische rühmt, weil jeder Weltteil dazu seine Erzeugnisse beigesteuert habe.
Am wenigsten dürfte Varros Ansicht heutzutage auf Zustimmung zu rechnen haben, wo »bei einem Frühstück des deutschen Mittelstands ostindischer Kaffee, chinesischer Tee, westindischer Zucker, englischer Käse, spanischer Wein, russischer Kaviar vereinigt sein können, ohne als Luxus aufzufallen«. Der Erdball, sagt Gulliver (der sich hier auf den Standpunkt Varros stellt) muß dreimal umkreist werden, ehe eines unserer besseren Yahooweibchen (d. h. eine Engländerin der höheren Klassen) ihr Frühstück oder die Tasse hat, in die sie es hineintun kann. Gegenwärtig aber, wo man in dem täglichen Genüsse von Nahrungsmitteln aus andern Weltteilen nicht nur keinen tadelnswerten, sondern überhaupt gar keinen Luxus erblickt, können Varros Klagen um so weniger Zustimmung finden, als wir nicht den mindesten Grund haben zu glauben, daß die Beschaffung von Nahrungsmitteln aus Asien, Amerika und Afrika heute für Deutschland leichter und weniger kostspielig ist, als damals von den nahen Küsten des Mittelmeers für Rom, das fast eine Seestadt war. Vollends die Bevorzugung der an gewissen Orten in anerkannter Vorzüglichkeit erzeugten Eßwaren ist zu allen Zeiten eine der notwendigen Folgen der Zunahme des Wohlstands und der Erweiterung der Handelsbeziehungen gewesen. In Paris z. B., das im 13. Jahrhundert in so vielen Beziehungen für die erste Stadt Europas galt, war damals die Lebhaftigkeit des Verkehrs schwerlich so groß, der Reichtum sicherlich sehr viel geringer als zu Rom in Varros Zeit: doch »in Hinsicht auf die Bezugsquellen der einzelnen Nahrungsmittel herrschte keineswegs Gleichgültigkeit, man wußte gar wohl, welche Landschaft das eine oder das andre Produkt am besten erzeuge, und woher der Feinschmecker seine Speisekammer versorgen müsse. So hielt man die Erbsen von Vermandois über alle andern, holte die Kresse aus dem Orléanais, die Rüben aus der Auvergne, die Zwiebeln aus Corbeilles, die Schalotten aus Estampes und schätzte den Käse aus der Champagne und Brie namentlich hoch, sowie Fische aus den Teichen von Bondi, Burgunder Birnen und Äpfel aus der Auvergne. Die besten Kastanien wurden aus der Lombardei, Feigen aus Malta und Rosinen aus der Levante bezogen«; von fremden Weinen waren außer dem Moselwein besonders die spanischen, die von Cypern, griechische und italienische Sorten beliebt. Ähnliche Angaben werden sich aus allen Zeiten und Ländern mit einigermaßen entwickelten Handelsbeziehungen machen lassen, über welche wir genügend unterrichtet sind. Nicolai läßt im Leben des Sebaldus Nothanker einen gräflichen Eßkünstler die besten Nahrungsmittel nur der deutschen Provinzen aufzählen: aber dies ist ein deutscher Patriot, der das französische Essen nicht leiden kann. Er erhält posttäglich pommersche große Maränen, dreiviertel Ellen lang, Flundern von der Insel Hela, berlinische Sander; kalte Pasteten aus Hanau und gewürzte Schwartenmagen aus Frankfurt a.M. muß man nach ihm im März, Krammetsvögel vom Harz desgleichen, Fasanen aus Böhmen im Februar beziehen; Krebse aus Sonnenburg, westfälische Schinken, in Champagner gekocht, Kaviar aus Königsberg, astrachansche Mesonen und Ananas gehören ebenfalls zu seinen Bedürfnissen. Ein wie überaus armes Land Deutschland und wie unentwickelt seine Verkehrsmittel damals waren, ist allbekannt.
Liest man freilich die Äußerungen römischer Schriftsteller über die »verabscheuungswürdigen Jagden«, das Durchsuchen aller Länder und Meere nach Leckerbissen, die Ausstattung einer einzigen Tafel durch das, was viele Schiffe aus mehr als einem Meer herbeiführen: so möchte man glauben, es seien besonders umfassende Anstalten getroffen, ganze Scharen auf weite, schwierige und gefahrvolle Expeditionen ausgesandt worden, um die Tafeln der römischen Schwelger zu versorgen. In der Tat ist dies von Vitellius geschehen, der die Ingredienzien zu einer vielberufenen Riesenschüssel, Makrelenlebern, Fasanen- und Pfauengehirne, Flamingozungen, Muränenmilch, durch die römischen Flotten bis aus Spanien und Parthien holen ließ. Aber Vitellius scheint selbst unter den römischen Kaisern nur einen Nachahmer gefunden zu haben, Elagabal; viel zahlreicher dagegen unter den französischen Schlemmern des 18. Jahrhunderts. Einer derselben, Verdelet, ließ sich z. B. eine Schüssel aus den Zungen von 2000 oder 3000 Karpfen bereiten, die 1200 Livres kostete, und der Prinz von Soubise speiste oft eine von dem Koch Marin für Ludwig XV. erfundene Omelette royale aus Hahnenkämmen und Karpfenmilch, die jedesmal 100 écus kostete. Sieht man aber von jenen Ungeheuerlichkeiten der kaiserlichen Schwelgerei im alten Rom ab, so ist allem Anschein nach dort nicht mehr geschehen, als daß unter den Produkten aller Länder auch ihre Nahrungsmittel und Leckerbissen auf den Markt kamen und guten Absatz fanden. Und fragt man, welches denn die Köstlichkeiten waren, deren Beschaffung aus weiter Feme so großen Anstoß erregte, so findet man fast überall nur einige Geflügelarten genannt, den Fasan und das numidische Huhn (Perlhuhn), den Flamingo und wenige andre, die aber zum großen Teil schon in Italien gezogen wurden und dann schwerlich sehr teuer gewesen sein können: wie denn der Fasan in dem Maximaltarif Diocletians zu einem nur um ein Viertel höheren Preise angesetzt ist als die Gans. Beide Vögel lieferten Festbraten; auf der für eine kaiserliche freilich sehr frugalen Tafel des Alexander Severus, wo täglich zwei Hähne, ein Hase und viel Wild aufgetragen wurden, erschien eine Gans nur an gewöhnlichen, ein Fasan (wie auch auf der Tafel des Kaisers Tacitus) nur an hohen Festtagen.
Übrigens ist nicht bloß die Akklimatisation ausländischer Tiere und Gewächse, von welcher später ausführlich die Rede sein soll, sondern auch deren Beschaffung im Handelswege für die Tafeln Roms in größerer Ausdehnung sicher erst seit Begründung der Monarchie erfolgt, und es waren eben nur die Anfänge dieses Luxus, die Varros Unmut in so hohem Grade erregten. Denn in seiner Zeit scheinen ausländische Gerichte selbst bei üppigen Mahlzeiten noch selten gewesen zu sein. Wir haben das Verzeichnis der Speisen bei einer zwischen 74 und 63 v. Chr. gehaltenen priesterlichen Antrittsmahlzeit, und darunter ist nur eine zum Teil ausländische, und keine seltene oder kostbare Schüssel. Die Mahlzeit fand am 24. August statt. Das Voressen bestand aus Meerigeln, rohen Austern nach Belieben, zwei Muschelarten, einer Drossel auf Spargeln, einer gemästeten Henne, einem Austern- und Muschelragout, schwarzen und weißen Maronen; dann wieder verschiedene Muscheln und Meertiere mit Feigenschnepfen, Lenden von Rehen und Wildschweinen, Geflügel in einer Teigkruste, Purpurschnecken mit Feigenschnepfen. Die Hauptmahlzeit: Saueuter, Schweinskopf, Frikassee von Fischen, Frikassee von Saueuter, Enten, eine andere Art Enten gesotten, Hasen, gebratenes Geflügel, eine Mehlspeise, picentinische Brote. Das Verzeichnis des Nachtisches fehlt. Diese Mahlzeit, an der die vornehmsten Männer und Frauen des damaligen Rom (unter andern Julius Cäsar als Pontifex), teilnahmen, muß doch wohl selbst unter den wegen ihrer Schwelgerei sprichwörtlichen priesterlichen Gastmählern sich besonders ausgezeichnet haben: sonst würde ein vier bis fünf Jahrhunderte später lebender Schriftsteller den Bericht über sie kaum der Mitteilung wert gehalten haben. Es würde jedoch leicht sein, aus verschiedenen Perioden der neueren Zeit Mahlzeiten anzuführen, deren Luxus ebenso groß war, ohne daß sie besonderes Aufsehen erregten: vollends mit solchen, die im 18. und 19. Jahrhundert als ungewöhnlich köstlich, reich und verschwenderisch gegolten haben, hält jene berufene römische Priestermahlzeit nicht entfernt den Vergleich aus. In der Zeit, die zwischen ihr und den Äußerungen Varros liegt, könnte nun freilich der Bezug von Leckerbissen aus der Fremde sehr zugenommen haben. Aber auch bei dem von Horaz geschilderten Gastmahl, mit dem der reiche Nasidienus Mäcen und dessen Freunde bewirtet, kommen nur inländische Schüsseln vor, und die Satire des Dichters richtet sich hier und anderwärts nicht sowohl gegen den übermäßigen Aufwand der Tafel als gegen die lächerliche Wichtigkeit, mit der die Koch- und Eßkünstler ihre Kunst betrieben, und die dem mit den einfachsten Speisen, am liebsten mit Pflanzenkost sich begnügenden Freunde Epikurischer Lehre, doppelt töricht erscheinen mußte.
Erst nach der Schlacht bei Actium begann, wie Tacitus in der oben angeführten Stelle bestätigt, die Periode des größten Tafelluxus, wozu der Aufschwung des Handels nach Wiederherstellung des Weltfriedens und namentlich die Eröffnung des Verkehrs mit Ostindien und ganz Asien über Alexandria ohne Zweifel sehr wesentlich beitrug. Nun erst wurde Rom eine Stadt, welcher der Welthandel jahraus, jahrein im Überfluß zuführte, »was bei allen Völkern erzeugt und bereitet ward«, »wo man die Güter der ganzen Welt in der Nähe prüfen konnte«: nun erst konnten auch die seltensten und köstlichsten Erzeugnisse aller Zonen für die Tafelgenüsse der Schwelger in reichem Maße verwertet werden. Nun wurden, sagt Plinius, die verschiedenen Ingredienzien in der Art vermengt, daß jedes durch einen ihm eigentlich fremden Geschmack den Gaumen zu reizen genötigt ward, und so auch die verschiedenen Erd- und Himmelsstriche miteinander vermischt. Bei einer Speise wird Indien hinzugenommen, bei einer andern Ägypten, Cyrene, Kreta und so fort. Und selbst vor den Giften bleiben die Menschen nicht stehen, um ja nur alles zu verschlingen.
Wenn nun aber auch der Luxus der Tafel in Rom während der Periode von Augustus bis Vespasian ohne Zweifel einen sehr hohen Grad erreichte, so war er doch sicherlich weder so ausschweifend und ungeheuerlich, noch so allgemein, wie man nach manchen Äußerungen von Zeitgenossen, namentlich eben des älteren Plinius und des jüngeren Seneca, vielfach angenommen hat. Manches, was ihnen als unbedingt verdammenswert galt, erscheint uns in milderem Lichte, manches, was ihnen neu und unerhört war, sind wir gewohnt und finden es natürlich, andres hat nicht die Bedeutung, die es zu haben scheint.
Wenn große Gastmähler ungeheure Summen kosteten, so wurden diese keineswegs allein für die Bewirtung, sondern auch (und vielleicht zum größten Teil) für Ausstattung, Dekoration u.dgl. ausgegeben und gestatten daher keinen unbedingten Schluß auf den Luxus der Tafel. Bei Meimers, holländischem Gesandten in Madrid (1804-1806), wischten sich, nachdem er drei Jahre hausgehalten und täglich Leute gesehen, seine Gäste noch stets mit neuen Servietten den Mund. Zur Herstellung eines eleganten Desserts, das auf 10.000 Taler geschätzt wurde, war in Paris (1804) außer der Arbeit des Zuckerbäckers die des Dekorateurs, Malers, Architekten und Blumisten erforderlich. Bei den Lordmayorsessen in London betrug die Ausgabe für Speisen und Getränke früher die Hälfte, unter Georg III. ein Drittel, bei dem Citybankett 1853 für Napoleon nur noch ein Viertel der Gesamtausgabe; bei dem letzteren Fest wurden 1000 Lstr. für Beleuchtung, 1860 für die Anordnung der Stühle und Sitze, 1750 für die Dekoration des Raums ausgegeben. Auch das üppige Fest des Q. Metellus Pius in Spanien (72 v. Chr.) zeichnete sich vorzugsweise durch die Pracht der Dekoration und des übrigen Zubehörs aus. Bei einem Gastmahl eines der Freunde Neros kosteten die (ohne Zweifel im Winter und in großen Massen verschwendeten) Rosen mehr als 4 Millionen Sesterzen (870.000 Mark), wie denn überhaupt Gastmähler und Gelage eine Hauptveranlassung eines oft ausschweifenden Blumenluxus waren, der in neueren Zeiten schwerlich jemals auch nur annähernd erreicht worden ist. Bei einem berühmten, von dem großen Condé im April 1676 zu Chantilly gegebenen Feste kosteten die Narzissen ( jonquilles), mit denen alle Räume förmlich tapeziert waren, nur 1000 écus. Allerdings hat auch dieser Luxus in den letzten Jahrzehnten außerordentlich zugenommen. In England werden zuweilen 2000 Lstr. auf Blumen für einen Ball verwendet. Zu dem (von Sachverständigen angeordneten) Schmuck der Tafel auf den Landsitzen der vornehmen Welt kommen Blumenkörbe aus Paris oder Nizza, um das Mittelstück einer aus dem Garten oder Treibhaus gelieferten Gruppe zu bilden. Die seltensten Orchideen schmücken »Bankette, die eines Lucull nicht unwürdig sind«, und riesige Blumensträuße finden auch außerhalb der Saison Käufer zu Preisen, die von drei Guineen bis zum Fabelhaften steigen.
Eine andre Verschwendung wurde im Altertum bei großen Bewirtungen durch die Sitte veranlaßt, Geschenke unter die Gäste zu verteilen oder zu verlosen. Bei den Verlosungen wählte man öfters Gewinne von sehr verschiedenem Werte: so gewann man bei Festen Elagabals zehn Kamele oder zehn Fliegen, zehn Pfund Gold oder Blei, zehn Strauße oder zehn Hühnereier u. dgl. Auch bei den von Martial für solche Verlosungen gedichteten Distichen sind immer zwei Gewinne, je ein wertvoller und ein geringer, paarweise zusammengestellt. Dazu gehören Schreibmaterialien, Toilettengegenstände, Kleider, Geräte, Geschirre und Instrumente aller Art (auch musikalische), Eßwaren, Spiele, Käfigvögel, Möbel, Waffen, Kunstwerke, Bücher, Tiere (auch ein zur Jagd abgerichteter Habicht) und Sklaven; es sind Gegenstände von bedeutendem Werte darunter, wie Scharlachmäntel, Pokale von alten Meistern, Gefäße aus Kristall und Murrha, goldene und silberne Statuetten, auch Sklaven mit besonderen Eigenschaften: eine Tänzerin, ein Stenograph, ein Zwerg, ein Narr, ein Koch, ein Kuchenbäcker. Bei einem Gastmahl, das L. Verus für 6 Mill. Sesterzen (1,305.000 Mark) gab, scheinen die Geschenke sämtlich kostbar gewesen zu sein; genannt werden schöne Sklaven, lebendige Tiere, Gefäße aus den wertvollsten Materialien, Kränze aus Blumen andrer Jahreszeiten mit goldenen Bändern, silberbeschlagene Wagen mit Maultiergespannen und den dazugehörigen Treibern.
Wenn also die Kosten jenes Mahls des Lucullus im Apollosaal auf 200.000 Sesterzen (35.000 Mark) angegeben werden, wenn die Arvalen bis auf die Zeit Gordians zu 100 Denaren (87 Mark) das Kuvert speisten: so bleibt es ungewiß, wieviel von solchen Summen auf Kränze, Blumen, Wohlgerüche (mit denen bei Gelagen vielleicht der größte Luxus getrieben wurde), Beleuchtung, Schmuck des Lokals und der Dienerschaft, Aufführungen und Schauspiele, Gastgeschenke usw. verwandt wurde. Daß aber die Pracht und der Aufwand bei römischen Gastmählern ebenso wie das Raffinement derselben in späteren Zeiten vielfach überboten worden sind, wird sich aus zahlreichen, unten anzuführenden Angaben und Beschreibungen ergeben. Hier sei nur erwähnt, daß die Verlosungen von Geschenken in Frankreich im 17. Jahrhundert aus Italien eingeführt wurden. Bei einem zu Ehren der Königin von England im Louvre veranstalteten Feste Mazarins, wo alle Lose gewannen, war der Hauptgewinn ein Diamant im Werte von 4000 écus; bei einem von dem Oberintendanten Foucquet am 17. August 1661 dem Könige gegebenen Feste waren die Gewinne Juwelen, prachtvolle Anzüge, kostbare Waffen und Luxuspferde.
Übrigens kommt die Verschwendung für üppige Gastmähler im kaiserlichen Rom, namentlich aber die hohen Preise, die für einzelne Leckerbissen gezahlt wurden, nicht allein auf Rechnung der Schwelgerei, sondern auch auf die der Mode, der Prahlerei, der Sucht, sich hervorzutun und in den Kreisen der Genußkünstler von sich reden zu machen, und dasselbe gilt von vielen andern Erscheinungen des damaligen Luxus. »Die Verschwender«, sagt Seneca, »streben danach, ihr Leben fortwährend zum Gegenstand der Gespräche zu machen. Bleibt es verschwiegen, so glauben sie, ihre Mühe verloren zu haben. Sooft etwas, was sie tun, dem Gerücht entgeht, sind sie mißvergnügt. Es gibt viele, die ihr Vermögen verprassen, viele, die Maitressen halten: um sich unter diesen einen Namen zu machen, genügt es nicht, üppig zu leben, man muß es in auffallender Weise tun, eine gewöhnliche Verschwendung verursacht in einer so beschäftigten Stadt kein Gerede.« »Du bist nicht zufrieden, Tucca,« sagt Martial, »ein Schlemmer zu sein, du wünschest auch als solcher zu erscheinen und genannt zu werden.« Eben das Bestreben, Gerede zu verursachen, ist es gerade gewesen, was z. B. mehr als einen Verschwender bewogen hat, jene großen Summen für Exemplare der Seebarbe ( mullus) von ungewöhnlichem Gewicht zu zahlen, die so oft als Beweise beispielloser Üppigkeit angeführt worden sind. So erkaufte ein P. Octavius, ein hochgestellter Mann, mit der Summe von 5000 Sesterzen (1087 Mark) für ein 4½ Pfund (römisch = 1,47 kg) schweres Exemplar den Ruhm, einen Fisch erstanden zu haben, der nicht nur dem Kaiser Tiberius, sondern auch seinem Rivalen Apicius zu teuer gewesen war, »und erlangte damit unter seinesgleichen großes Ansehen«. Diese und gewiß noch manche andere Preise gehören also zu den Eitelkeitspreisen, deren Höhe nur von den Zahlungsmitteln der Käufer begrenzt wird. Juvenal spricht von Leuten, die ohne Rücksicht auf die Preise alle Elemente nach Leckerbissen durchsuchen und im Grunde das am liebsten haben, was am meisten kostet; sie richten sich zugrunde, um Schüsseln auftragen zu lassen, die 400 Sesterzen kosten. Daß eine solche Summe (87 Mark) für enorm galt, zeigt wieder, daß der damalige Maßstab für die Preise von Luxusnahrungsmitteln ein kleinerer war als der gegenwärtige. In der Tat kostete von einer der teuersten Delikatessen, der nur in geringen Quantitäten zu verwendenden, aus den inneren Teilen der Makrele ( scomber) bereiteten Fischsauce ( garum), ein Liter aus der berühmten Fabrik in Cartagena ( garum sociorum) nur 33 Mark im heutigen Gelde. Um 1596, in der Zeit einer Hungersnot, gab es in Paris Bankette, bei denen die Schüssel 45 écus (etwa 440 Frcs. in jetzigem Gelde) kostete; bei einem Abendessen des Marschalls de l'Hospital (in der Zeit Mazarins) kosteten einzelne Schüsseln 400 écus. In Petersburg gaben in Potemkins Zeit die Großen für die den Glanzpunkt schwelgerischer Gastmähler bildende, aus Stör bereitete Fischsuppe, in deren Preisen man einander zu überbieten suchte, bis 300 Rubel aus; bei seinen eigenen Bällen (1791), deren jeder 14.000 Rubel gekostet haben soll, erschien auf der Tafel jedesmal eine Fischsuppe im Werte von 1000 Rubeln in einem Silbergefäß, das gegen 300 Pfund wog. Die Kosten einer von der Stadt Genf dem Erzkanzler Cambacérès gesandten Riesenforelle nebst Sauce sollen vom Rechnungshof auf 6000 Frcs. veranschlagt worden sein. Plinius sagt mit übertreibender Phrase, daß Köche in seiner Zeit mehr kosteten als vormals ein Triumph, und schon der Geschichtschreiber Sallust soll dem Koch Dama, Freigelassenen des Nomentanus, ein Jahresgehalt von 100.000 Sesterzen (17.550 Mark) gezahlt haben; aber schwerlich erhielten die Köche damals so hohe Bezahlungen wie im 19. Jahrhundert in London und Paris. Anton Carême, der bei Lord Steward, Talleyrand, Rothschild und Kaiser Alexander angestellt war, erhielt bei letzterem monatlich 2400 Frcs. Gehalt, und seine Ausgaben für die Küche beliefen sich monatlich auf 80.000 bis 100.000 Frcs.; nach dem Fürsten von Pückler-Muskau gab es in England Köche, die ein Gehalt von 1200 Lstr. bezogen. Seneca erzählt von einer »berühmten, zum Stadtgespräch gewordenen Schüssel« wie von einer Monstrosität: es waren darin die feinsten Leckerbissen, die sonst auch bei großen Gastmählern nacheinander aufgetragen wurden (wie Austern und andre Schaltiere, Seeigel, ausgegrätete Seebarben), so durcheinander gemischt und mit der gleichen Brühe übergossen, daß man das einzelne nicht unterschied: »der Auswurf eines Erbrechenden könnte nicht mehr durcheinander gemengt sein«. Wenn ein solches Gericht wirklich großes Aufsehen erregte, möchte man glauben, daß die Kochkunst der Neronischen Zeit an Raffinement der modernen französischen sehr nachgestanden habe. Auch der rohe (als Plinius schrieb, gewöhnliche) Luxus, den P. Servilius Rullus etwa in Sullas Zeit eingeführt hatte und der in der Zeit der Regentschaft in Paris wieder Mode wurde, ganze Eber für wenige Gäste auftragen zu lassen, erregt Zweifel an dem Raffinement der römischen Tafelgenüsse, zu denen das wilde und zahme Schwein, das man auf fünfzig Arten zu bereiten verstand, zu allen Zeiten sehr beliebte Beiträge geliefert hat. Ein vielgenanntes, von Aelius Verus erfundenes Lieblingsgericht Hadrians, der ein Freund guter Mahlzeiten war, das noch auf der Tafel des Alexander Severus erschien, bestand aus Fasanen, Pfauen, Eberfleisch oder Saueuter und Schinken in einer Teigkruste.
Endlich muß hier noch erwähnt werden, daß der Gebrauch von Brechmitteln nach der Mahlzeit keineswegs ein so unbedingter Beweis für Unmäßigkeit und Völlerei ist, wie es nach heutigen Begriffen scheint. Wenn Cäsar, der nichts weniger als unmäßig war, nach einem reichlichen Mahle bei Cicero ein Brechmittel nahm und der letztere dies ohne jede Mißbilligung erwähnt, so folgt daraus nicht, daß damals eine viehische Maßlosigkeit im Genusse so allgemein war, daß sie niemandem mehr auffiel, sondern vielmehr, daß das gegenwärtig nur in Krankheitszuständen angewandte Mittel damals auch als ein rein diätetisches angesehen und gebraucht wurde, wie in der Zeit unserer Großväter der Aderlaß und das Purgieren. Ein jeder, sagt Seneca, kennt die Mängel seiner Leibesbeschaffenheit; daher erleichtert der eine den Magen durch ein Brechmittel, ein andrer stärkt ihn durch reichliche Nahrung, ein dritter leert und reinigt ihn durch Einschaltung eines Fastens. Auch die alten Ägypter, nach Herodot die gesündesten Menschen, brauchten in jedem Monate drei Tage hintereinander Brechmittel und Klistiere, und das regelmäßige Purgieren auch durch Vomitive war von der größten ärztlichen Autorität des griechischen Altertums, von Hippokrates, ebenfalls empfohlen worden: ihm schließen sich die späteren Ärzte, die nur den Mißbrauch widerraten, wenigstens zum großen Teil an. Daß Asklepiades den diätetischen Gebrauch der Brechmittel in seinem Buche über Erhaltung der Gesundheit ganz verworfen habe, wollte Celsus nicht tadeln, wenn er durch die Unsitte mancher, sie täglich zu nehmen, dazu veranlaßt worden sei: der Schlemmerei wegen dürfe es allerdings nicht geschehen, doch wußte Celsus aus Erfahrung, daß das Mittel, hin und wieder angewandt, der Gesundheit nur zuträglich sein könne. Auch der berühmte Arzt Archigenes (unter Trajan) erklärt den zwei- bis dreimaligen Gebrauch im Monat für erstaunlich heilsam, Galen rät ihn mehr vor als nach der Mahlzeit an. Zu denen, die das Mittel nur in Krankheiten angewandt wissen wollten, gehören Plinius und Plutarch. Immerhin mag unter den Schlemmern, für welche das Essen ein Lebenszweck war, die für sich allein sieben Gänge auftragen ließen, sich auf die Zubereitung feiner Schüsseln verstanden und eine so große Kennerschaft erwarben, daß sie beim ersten Biß zu sagen wußten, von welcher Küste eine Auster stammte, – unter solchen mag auch die Zahl derer groß genug gewesen sein, welche »spien, um zu essen, aßen, um zu speien, und die aus allen Weltteilen zusammengebrachten Mahlzeiten nicht einmal verdauen wollten«, wenigstens in Neros Zeit, wo Seneca dies schrieb. Aber die Äußerungen einiger zum Übertreiben und Generalisieren geneigter Schriftsteller berechtigen schwerlich zu dem Glauben, daß die ekelhafte Unsitte des täglichen Vomierens mit all ihren schlimmen und widerlichen Folgen auch nur in größeren Kreisen allgemein war, selbst in der Zeit der größten Schwelgerei, geschweige denn in einer späteren. Von den Kaisern, deren Lebensgewohnheiten die Biographen bis ins kleinste angeben, ist, außer dem durch beispiellose Gefräßigkeit ausgezeichneten Vitellius, Claudius der einzige, von dem berichtet wird, daß er sich der Brechmittel gewohnheitsmäßig bediente. Vielleicht war er nicht unmäßiger als Karl V., dessen »Heldentaten ekelhafter Schlemmerei« bei seinen vier täglichen Mahlzeiten im Kloster San Juste seinen »entsetzten« Arzt zur Verordnung reichlicher Senna- und Rhabarbertränke nötigten.
Wie die bisherige Betrachtung ergibt, hat der Tafelluxus der Kaiserzeit hauptsächlich deshalb als ausschweifend und unnatürlich gegolten, weil man auch hier Ausnahmen für die Regel angesehen, die Klagen der Alten über die Maßlosigkeit der Schwelgerei als durchaus berechtigt und die von ihnen angeführten Tatsachen als vollgültige Beweise für die Richtigkeit ihrer Urteile angenommen hat, ohne sie zu prüfen und ohne den Maßstab anzulegen, den die Vergleichung derselben Form des Luxus in andern Zeiten und Ländern bietet. Zur Beantwortung der Frage, ob und inwieweit der römische Tafelluxus seit dem Untergange der antiken Kultur überboten worden ist, mögen außer den bereits mitgeteilten Angaben noch folgende als Anhaltspunkte dienen.
Im frühen Mittelalter ist im Reich der Kalifen sowohl das Raffinement der Schwelgerei als die Pracht und der Aufwand bei festlichen Bewirtungen sehr groß gewesen. Der Sohn Gabriels, des Leibarztes des Kalifen Harun Rashyd, speiste im Sommer in einem durch Schnee gekühlten Raume, im Winter in einem Gewächshause, dessen Wärme durch Kohlen von wohlriechendem Holze unterhalten wurde; unter den für ihn aufgetragenen köstlichen Speisen waren gebratene Hühner, die man mit Mandeln und Granatäpfelsaft gefüttert hatte. Bei dem Beschneidungsfeste des Sohns des Kalifen Motawakki war der Boden mit Teppichen aus Goldstoff belegt, die mit Edelsteinen gestickt waren; darauf waren Figuren aus einer Paste von Ambra, Aloe und Moschus angeordnet; vor den Gästen wurden Haufen von Gold- und Silberstücken ausgeschüttet, mit denen sie nach Belieben ihre Taschen füllen konnten, zum Schluß erhielt jeder ein Ehrenkleid. Auch in dem durch alle Künste des Luxus ausgezeichneten maurischen Spanien scheint das Raffinement der Kochkunst groß gewesen zu sein.
Im christlichen Europa, und so auch in Deutschland, waren überall die Klöster Hauptstätten des Tafelluxus. Auch dort gehörten Fasanen und Pfauen zu den ausgesuchten Speisen großer Tafeln, beide kommen in den Küchenzetteln der Klöster am Bodensee im 11. Jahrhundert vor. Auch dort verwandte man ausländische Nahrungsmittel und Ingredienzien; im Kloster zu Hirsau kannte und brauchte man unter Abt Wilhelm (1069 bis 1091) eine Anzahl von ausländischen Fischen, von fremden Früchten (Zitronen, Feigen, Kastanien), von fremden Gewürzen (Pfeffer und Ingwer). Peter von Clugny klagt um 1130, daß manche Mönche sich nicht mit den auserlesenen heimischen Speisen begnügen, sondern ausländische suchen. Übrigens war auch der Aufwand der adligen Herren im Mittelalter für ihre Tafeln nicht gering, und sogar die (wie im Goldenen Hause Neros) zum Herabschütten von wohlriechenden Essenzen und Zuckerwerk auf die Gäste eingerichteten Zimmerdecken nicht unbekannt.
In Frankreich war die Kochkunst schon im 14. Jahrhundert verhältnismäßig entwickelt; noch größere Fortschritte machte sie im fünfzehnten. Die Köche aus der Schule des berühmten Kochs Karls VII., Taillevent, bestrebten sich, durch künstlerische Dekoration der Schüsseln einen gefälligen Anblick zu bieten und zugleich die Natur der Speisen durch künstliche Bereitung unkenntlich zu machen. Der Hauptgang der Mahlzeit bestand aus süßen Speisen, unter denen ein Pfau, Fasan oder Schwan, in Haut und Federn, mit vergoldetem Schnabel auf einer Erhöhung hervorragte. Die Pfauen, die man unter Trompetenschall und Händeklatschen der Anwesenden auftrug, lieferten die geschätztesten Braten bis ins 16 und 17. Jahrhundert, wo die Truthähne und Fasanen sie allmählich verdrängten. Bei der Hochzeit des Tirolers Adam Geizkofler, Rats und Anwalts der Fugger, im Jahre 1590, wurden neben sechs Indianen noch sieben Pfauen aufgetragen. Am längsten sind sie in Spanien beliebt geblieben; in Sevilla war in altmodischen Häusern noch 1815 ein mit Nüssen gemästeter Pfau die Hauptschüssel bei großen Mahlzeiten.
In England zeichnete sich bereits die Zeit: Richards II. durch eine große Neigung zur Schwelgerei aus; eine gewöhnliche anständige Mahlzeit eines Manns von Stande bestand zu Ende des 14. Jahrhunderts aus drei Gängen von je sieben, fünf und sechs Schüsseln; bei größeren Festen wurden neun, elf und zwölf Schüsseln aufgetragen. Auch im 15. Jahrhundert war die Schwelgerei groß. Bei der Ernennung von George Neville zum Erzbischof von York, im Jahre 1466, fand ein ungeheures Bankett statt, bei dem außer 4000 kalten Wildpasteten usw. 104 Pfauen und 200 Fasanen verzehrt wurden.
Von dem größten italienischen Fest- und Tafelluxus des 15. Jahrhunderts gibt die Beschreibung des Gastmahls eine Vorstellung, welches der Florentiner Benedetto Salutati, ein Enkel des berühmten Kanzlers, mit seinen Handelsgenossen am 16. Februar 1476 den Söhnen König Ferantes I. in Neapel gab. Die Treppe des Hauses war mit gewirkten Teppichen und Taxusgewinden behangen, der große Saal mit figurenreichen Teppichen geschmückt, während von der mit Tuch in den aragonischen Farben überzogenen Decke zwei Wachslichter tragende Kronleuchter von geschnitztem, vergoldetem Holz herabhingen. Dem Haupteingang gegenüber stand auf einer mit Teppichen belegten Estrade die Speisetafel, feinste Leinwand war darauf über einer gewirkten Decke ausgebreitet. Eine andre Seite nahm der große Kredenztisch ein, gefüllt mit etwa achtzig Schaustücken, meist silbern, einige golden, außer dem silbernen Tischgeräte (gegen dreihundert Teller verschiedener Art, Näpfe, Becher, Schalen). Unter dem Schall der Trommeln und Pfeifen nahmen die Gäste Platz. Erst kam die Vorkost, für jeden eine kleine Schüssel mit vergoldetem Kuchen von Pinienkernen und ein kleiner Majolikanapf mit einer Milchspeise. Es folgten acht Silberschüsseln mit Gelatine von Kapaunerbrust, mit Wappen und Devisen verziert, die für den vornehmsten Gast, den Herzog von Calabrien, bestimmte Schüssel mit einer Fontäne in der Mitte, welche einen Regen von Orangenblütenwasser sprühte. Die erste Abteilung des Mahls bestand aus zwölf Gängen verschiedener Fleischgattungen, Wild und Kalb, Schinken, Fasanen, Rebhühner, Kapaune, Hühner, Blankmanger: am Schlusse wurde vor den Herzog eine große silberne Schüssel hingestellt, aus welcher bei Aufhebung des Deckels zahlreiche Vögelchen emporflogen. Auf zwei mächtigen Präsentierschüsseln sah man zwei Pfauen, dem Anscheine nach lebend und das Rad schlagend, im Schnabel brennende, duftende Essenzen, auf der Brust an seidenem Band des Herzogs Wappenschild. Die zweite Abteilung bestand aus neun Gängen süßer Speise verschiedener Art, Torten, Marzipane, leichtes zierliches Backwerk mit Hippokras (wie man den mit Zucker, Zimt und andern Gewürzen vermischten Wein nannte). Die Weine waren meist einheimische, italienische und sicilische, und zwischen je zwei Gästen lag eine Liste der fünfzehn Gattungen. Am Ende des Mahls wurde jedem wohlriechendes Wasser zum Händewaschen gereicht, und dann das Tischtuch weggenommen, worauf man eine große Schüssel auf die Tafel stellte; darin war ein aus grünen Zweiglein geformter Berg mit kostbaren Essenzen, deren Duft sich durch den Saal verbreitete. Während und nach der Mahlzeit wurden die Gäste durch Musik und eine Mummerei unterhalten. Der nach etwa einer Stunde aufgetragene Nachtisch bestand aus verschiedenem Zuckerwerk in silbernen Schüsseln mit Deckeln aus Wachs und Zucker, auf denen sich Wappen und Devisen befanden. Gegen die fünfte Stunde der Nacht schieden die Gäste, nachdem sie beinahe vier Stunden verweilt hatten.
Im 16. Jahrhundert sind vielleicht die Feste der Venezianer die prachtvollsten in ganz Italien gewesen. Bei einem 1552 von dem Kardinal Grimani, einem Neffen des Papstes, dem Ranuccio Farnese, gegebenen Bankett wurden auf einer Tafel, die hundert Gäste faßte, 90 Schüsseln aufgetragen, und das Essen dauerte vier Stunden. Bei gewöhnlichen Festschmäusen gaben die venezianischen Bürger in der Regel 400 bis 500 Dukaten aus. Nicht bloß Gewürze und Wohlgerüche wurden bei der Bereitung der Speisen verschwenderisch angewandt, sondern auch Gold hinzugetan. Bei einem dem Könige Heinrich III. in den Gemächern der Zehn gegebenen Frühstück bestand alles aus Zucker, aus dem auch Tischtücher, Gedecke, Teller, Brot aufs täuschendste hergestellt waren. Die Dekoration der Speisesäle und Tafeln war überaus kunstvoll, prächtig und mannigfaltig. Zu den Tafelaufsätzen gehörten z. B. einmal weiße, radschlagende Pfauen, über und über mit Bändern von Gold und Seide in allen Farben und mit vergoldetem Zuckerwerk behängt, die ganz wie lebend aussahen, in ihren brennenden Schnäbeln Wohlgerüche und zwischen den Füßen Liebesdevisen hatten; ferner drei vier Palmen hohe Figuren aus Marzipan usw. Gesänge, Gedichte, Aufführungen von Opern und andre der verschiedensten Arten erheiterten diese Mahlzeiten. Von den Gastmählern Agostino Chigis hat seine Biographie drei beschrieben, bei denen Papst Leo X. zugegen war. Nach einem derselben (das verhältnismäßig bescheiden sein sollte, aber 2000 Dukaten kostete) fehlten 11 schwere Silberschüsseln; doch Chigi verbot der Dienerschaft, danach zu forschen, und äußerte seine Verwunderung, daß von so vielen nicht mehr vermißt würden. Vor einem andern, im Sommer in einer Kolonnade am Tiber veranstalteten waren Netze im Wasser unter der Oberfläche gespannt worden, und nach jedem Gange wurde das gesamte dabei gebrauchte Silbergeschirr vor den Augen der Gäste in den Fluß geworfen, so daß kein Stück zweimal auf die Tafel kam, und die übriggebliebenen Speisen unter das zahlreich versammelte Volk verteilt. Bei einem dritten, wo außer dem Papst zwölf Kardinäle und andre Vornehme zugegen waren, fand jeder Gast auf dem Silber, von dem er speiste, sein Familienwappen fehlerlos eingraviert, und rechtzeitig abgegangene, an diesem Tage wieder eintreffende Läufer brachten jedem aus seiner Heimat das dort am meisten geschätzte Gericht in der landesüblichen Zubereitung ganz frisch.
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts bestanden in Rom, nach dem Kochbuch des Bartolomeo Scuppi, Leibkochs von Pius V. (1566-72), Festmahle aus vier Gängen, und zwar der erste aus verzuckerten Früchten und Pasteten, welche die Wappen des Papstes darstellten und mit kleinen Vögeln gefüllt waren. Die übrigen waren aus einer Menge von Speisen aller Art gebildet: das Geflügel mit seinen Federn, in Flaschen gekochte Kapaunen, Fisch, Wildbret, Fleisch und süße Speisen wechselten ab in einer unseren kulinarischen Begriffen widerstrebenden Weise. Es gab Gerichte, welche mit Rosenwasser bereitet wurden, und auf derselben Schüssel fand man die heterogensten Stoffe zu einem Ganzen verarbeitet. Die Vereinbarung der Gegensätze galt für die höchste Leistung der Kochkunst. Vor dem Nachtische ward abgedeckt, man wusch sich die Hände, und die Tafel wurde mit verzuckerten Eiern und Syropen besetzt, welche betäubende Wohlgerüche verbreiteten. Am Ende der Mahlzeit ließ der Hausherr Blumensträuße verabreichen. Welche Rolle wohlriechende Substanzen in der damaligen Küche spielten, ergibt sich namentlich aus ihrer Anwendung bei Fleischspeisen, die Montaigne, ein großer Freund der Wohlgerüche, mit Beifall erwähnt. Bei einem Besuche, den der Bei von Tunis Karl V. in Neapel abstattete, hatte man die Speisen des ersteren mit wohlriechenden Spezereien von solcher Kostbarkeit gefüllt, daß ein Pfau und zwei Fasanen auf 100 Dukaten zu stehen kamen; und als man sie zerlegte, erfüllten sie nicht nur den Saal, sondern alle Gemächer des Palastes und selbst die Häuser der Nachbarschaft mit einem sehr lieblichen Duft, der sich nicht so bald verlor. Bei der sehr prachtvollen Hochzeit eines Signor Gottofredo in Rom (1588) kostete das Abendessen 500 Scudi.
Überhaupt nahm Italien im 16. Jahrhundert in der Kochkunst ebenso unbestritten die erste Stelle unter den Ländern Europas ein wie in allen übrigen Künsten. Montaigne erzählt, daß ihm der Haushofmeister des Kardinals Caraffa, ein Italiener, »eine Rede von dieser Wissenschaft des Schlundes hielt, mit einer magisterhaften Haltung, als wenn er von einem großen Problem der Theologie gesprochen hätte. Er enträtselte mir die Verschiedenheit des Appetits, den man vor der Mahlzeit und den man nach dem zweiten, und dritten Gange hat; die Mittel, ihn in kunstloser Weise zu befriedigen und ihn zu erregen und zu reizen. Er erörterte die Behandlung seiner Saucen, erstens im allgemeinen, und dann die Eigenschaften und Wirkungen der Ingredienzien im besondern; die Verschiedenheit der Salate nach den Jahreszeiten, und welche kalt und welche warm aufgetragen sein wollen; die Art, sie zu schmücken und zu verschönern, um sie dem Auge gefällig zu machen. Dann vertiefte er sich in schöne und wichtige Betrachtungen über die Anordnung der Tafel, und alles das in mannigfachen und prächtigen Ausdrücken, auch solchen, die man anwendet, wenn man von der Regierung eines Reichs zu reden hat«.
Zwar hatte auch die französische Kochkunst im 16. Jahrhundert große Fortschritte gemacht, aber erst unter Ludwig XIV. »unterwarf Frankreich ganz Europa den Gesetzen seiner Küche«. Dennoch gilt den Geschichtsschreibern der französischen Kochkunst die damalige Küche (welche im wesentlichen noch immer die von Taillevent begründete war, aber auch der italienischen des 16. Jahrhunderts viel verdankte) als eine sehr unvollkommene. Von ihrer Reichhaltigkeit gibt das Menu einer Mahlzeit eine Vorstellung, die der Kriegsminister Ludwigs XIV., Louvois, dem Dauphin und mehreren andern Mitgliedern der königlichen Familie gab: 11 potages différents, 11 entrées, 13 hors-d'œuvre pour le premier service, 24 plats d'entremets, 11 hors-d'œuvre de légumes, d'omelettes, de crêmes, de foi gras et de truffes (das Dessert wird nicht erwähnt). Bei jenem von dem Oberintendanten Foucquet am 17. August 1661 dem Könige gegebenen Feste schätzte man die Kosten des für 6000 Personen bereiteten Gastmahls auf 120.000 Livres; dasselbe wurde von dem berühmten Vatel angeordnet. Es waren 80 Tafeln und 30 Büfetts errichtet, man verwandte 120 Dutzend Servietten, 500 Dutzend silberne Teller, 36 Dutzend silberne Schüsseln und ein Tafelgeschirr von massivem Golde. Nach der Tafel wurde im Garten Molières Lustspiel »Les Fâcheux« aufgeführt, wobei Molière selbst auftrat; ein prachtvolles Feuerwerk machte den Schluß. Welch hohe Bedeutung man der Kochkunst und ihren Adepten bereits einräumte, beweist der Bericht der Frau von Sévigné über den Selbstmord dieses unvergleichlichen Kochs im April 1676. Bei jenem Feste, das der große Condé Ludwig XIV. zu Chantilly gab, und das 180.000 Livres kostete (das Feuerwerk allein 16.000), waren schon einige kleinere Unglücksfälle vorgekommen, als auch die Seefische, welche aus allen Häfen verschrieben waren, nicht eintrafen: »Der große Vatel, dieser Mann von einer so hervorragenden Begabung, dessen Kopf alle Sorgen einer Staatsverfassung in sich zu fassen hingereicht hätte, konnte die Schmach, die ihm, wie er glaubte, bevorstand, nicht ertragen: er hat sich erstochen.«
Mit ihm beginnt die Reihe der großen französischen Köche, deren Namen die Geschichte verzeichnet hat: eine Ehre, die auch in den Zeiten der ausschweifendsten Schwelgerei des kaiserlichen Rom, aus welchen Namen von Gladiatoren und Zirkuskutschern zahlreich überliefert sind, keinem ihresgleichen zuteil geworden ist.
Die Zeit der Regentschaft war vielleicht nicht die Zeit der besten Küche, aber die des größten Tafelluxus: »Man dachte an nichts als an Essen«, sagte ein Zeitgenosse. In der Mitte der damaligen Tafeln prangten große Fleischmassen und Pyramiden von Wild und Geflügel: ein ganzes junges Wildschwein, ein Kalbsnierenbraten, von drei Hühnern und sechs Tauben, eine Rehkeule, von allerlei Wildbret, ein großer Stör, von Seebarben umgeben. Am weitesten wurde auch diese Art der Verschwendung in der Lawschen Periode getrieben. Für einen Liter Erbsen wurden bis 100 Pistolen bezahlt. In der Fastenzeit von 1720 reichten die Vorräte der Fleischer zur Befriedigung der Nachfrage nicht aus. Bei einer Dame in Paris wurde täglich ein Ochse, zwei Kälber, sechs Hammel verzehrt usw.
Unter Ludwig XV. war die Küche bereits ausgezeichnet; Kenner haben sogar behauptet, daß sie zu Ende seiner Regierung ihre höchste Vollendung erreicht habe. Doch sind gewichtige Autoritäten der Ansicht, daß ihre Kulmination erst unter Ludwig XVI. erfolgte. Im Jahre 1783 sprach ganz Paris vierzehn Tage lang von einem Abendessen, welches der große Gastronom Grimod de la Reynière (Sohn) für zweiundzwanzig Personen gab. Von den neun Gängen desselben bestand jeder nur aus einer Gattung Fleisch, das aber auf zweiundzwanzig verschiedene Arten zubereitet war.
Jedenfalls war das 18. Jahrhundert die Zeit »der großen Küche und der großen Köche«, unter welchen Marin, der Koch des Prinzen Soubise, der Verfasser der »Dons de Comus« (mit einer Vorrede des gelehrten Jesuiten Pater Brumoy, Übersetzers des »Théâtre de Grecs« 1748), hervorragt. Unter dem Befehl des chef de cuisine stand in großen Häusern eine ganze Schar von Gehilfen und Unterbeamten. Die Leitung des Dienstes bei der Tafel hatte der maître d'hôtel, der in reicher Kleidung, einen Degen an der Seite, einen Diamantring am Finger, eine Dose mit parfümiertem Tabak in der Hand, erschien; zuweilen hatte er zu konstatieren, daß der gnädige Herr im vergangenen Jahre 100.000 écus verzehrt habe. Ein einziges Diner, das Soubise dem Könige und dem Hofe gab, kostete mehr als 80.000 Livres. Zahlreiche Rezepte trugen die Namen hoher Personen, welche sie angegeben hatten. In der Küche des Prinzen Condé wurden wöchentlich 120 Fasanen gebraucht. Dem Herzog von Penthièvre reisten, als er die Stände von Burgund eröffnen sollte, 152 »hommes de bouche« voraus.
In der Dekoration der Tafel lösten die verschiedensten Moden einander ab. Auf künstlerisch geordnete und ornamentierte Tafelaufsätze folgten Nachahmungen von Blumenbeeten durch Tonlagen, die mit abgeschnittenen Blumen bepflanzt waren; dann Darstellungen von Gebäuden, Statuengruppen und Landschaften. Ein gewisser Carade erfand einen künstlichen Reif, den die Wärme der Mahlzeit zum Schmelzen brachte: »Man sah dann den Fluß auftauen, die Bäume grünen, die Blumen erblühen, kurz den Frühling auf den Winter folgen.« Unter Ludwig XVI. führten sogenannte »sableurs« mit gefärbtem Sande, Marmor-, Glas- oder Zuckerstaub unmittelbar vor dem Eintritt der Gäste mit unglaublicher Schnelligkeit persische Teppichmuster und andere Bilder aus, die ein Hauch, ein Wassertropfen zerstörte.

90. RETIARIUS.
(Gladiator, bewaffnet mit Netz, Dreizack und Dolch.) Tonlampe. London, British Museum
Die Revolution verursachte nur eine sehr vorübergehende Einschränkung des Tafelluxus: schon in der Zeit des Direktoriums war die Schwelgerei so groß wie nur je zuvor. Barras soll seine Pilze mit Extrapost von der Rhonemündung haben kommen lassen, übrigens auch Danton Mahlzeiten zu 400 Francs das Kuvert gegeben haben.

91. »SAMNITISCHE« GLADIATOREN.
Tonlampe, London, British Museum
Die höhere Gesellschaft in Deutschland nahm, wie in allen Stücken, so auch in der Einrichtung der Mahlzeiten die französische Sitte zum Vorbild. Lady Montague wurde bei ihrem Aufenthalte in Wien 1716 bei Gastmählern des hohen Adels wiederholt mit mehr als fünfzig in Silber angerichteten Schüsseln und einem entsprechenden Nachtisch auf dem feinsten Porzellan bewirtet; wozu öfters bis achtzehn feine Weinsorten gereicht wurden, von welchen Verzeichnisse neben den Gedecken lagen. Aber auch in bürgerlichen Kreisen war in jener überaus armen Zeit der Tafelluxus nicht gering. Bei einem gewöhnlichen Freundschaftsgebot, sagt ein Schriftsteller 1730, seien 5 bis 6 delikate Speisen genug; ein großes Bankett müsse aus 12 bis 16 Gängen ohne das Dessert bestehen. Für Überfluß halte er es, wenn manche Private bis zu 50, 60, 80 Gerichten gäben. Bei Standespersonen (Ministern u. dgl.) sei es freilich etwas anderes. Um 1780 bestand in Wien die tägliche Tafel der Leute vom Mittelstande, der geringeren Hofbedienten, Kaufleute, Künstler und besseren Handwerker aus 6, 8 bis 10 Gerichten, wozu 2, 3 bis 4 Gattungen Wein aufgesetzt wurden. In der Speiseliste einer bei der Investitur des Superintendenten Deyling zu Leipzig am 13. August 1721 veranstalteten Mahlzeit ist der Einfluß der damaligen französischen Tafelsitte unverkennbar. An der ersten Tafel von vierundzwanzig Personen, wo die hohe evangelische Geistlichkeit, der Rat, der Rector magnificus speisten, bestand der erste Gang aus sieben Schüsseln: Wildbretpastete; Potage mit angeschlagenen Rebhühnern; große Forellen, gesotten; Pörsche mit Butterbrühe, Birangen, Pistazien, Meerrettich; Hamburger Fleisch und Bohnen; zwei Schöpfkeulen mit Satellerbrühe; zwei Krebstorten. Der zweite Gang bestand aus fünf Schüsseln: Schweinsrücken mit sechs Fasanen belegt; ein ganzes gebratenes Reh; Schweinskopf mit Rindszunge belegt, allerlei Salate; zwei Babtißtorten. Die Aufstellung der Speisen und Konfitüren erfolgte nach einer vorher angefertigten Zeichnung. An drei Tafeln zu je vierundzwanzig Personen, wo die Geistlichen speisten, wurden nur je sechs Schüsseln aufgetragen. Außerdem erhielt die Frau Superintendentin folgendes »Köstgen für sechs Personen«: eine Truthühnerpastete, eine Rehkeule mit zwei gebratenen Rebhühnern, gesottene Forellen, Johannisbeertorte. Die zwölf Musikanten und die zweiunddreißig Aufwärter erhielten je vier Schüsseln. An Konfekt wurde verzehrt: dreißig Mandeltorten, dreißig Krafttorten, dreißig Schälchen Konfekt (an der ersten), achtzig Krafttorten (an den drei übrigen Tafeln), ein Korb Konfekt, eine Mandeltorte, eine Krafttorte und Obst an dem Tische der Superintendentin. Getrunken wurden drei Eimer und sechs Kannen Rheinwein, ein Eimer alter Rheinwein, zwei Faß Wurzener Bier, drei Achtel Faß Lobgünner Bier. War diese Bewirtung freilich auf Kosten der Stadt veranstaltet, so läßt sie doch immerhin einen Schluß auf den Zuschnitt der Gastmähler in den wohlhabenden Bürgerhäusern des damaligen Leipzig zu.

92. KÄMPFENDE WEIBLICHE GLADIATOREN.
Marmorrelief aus Halikarnass. London, British Museum
Doch nirgends war in Deutschland der Tafelluxus so groß wie in Hamburg, wo ihn ein Berichterstatter um 1780 »überschwenglich« fand. Ein »ländliches« Abendessen bei einem Hamburger Kaufmann (1778) hat J.H. Voß in einer eigenen Idylle besungen. Die Schilderung des vom »Kanditor« kunstvoll geformten Tafelaufsatzes (eine große, äußerst mannigfaltige Landschaft mit zahlreichen Figuren von Menschen und Tieren) geht der Beschreibung der Gerichte voraus, von denen zwölf beim Beginn der Mahlzeit bereits auf der Tafel stehen, »einige kalt nach der Regel und einige brätelnd auf Marmor, heißem, in Silber gefaßtem geründetem«. Das Menu ist folgendes: Fasan mit indischen Vogelnestern und Azia, junge Kalkuten mit Soja; Forellen in Wein gesotten, Kabeljau mit Austernsauce; ein Spanferkel mit Gallert; eine getrüffelte Rebhühnerpastete aus Bordeaux; verschiedene Gemüse mit frischen Heringen, Hummer, Elblachs, Paderborner Schinken und Göttinger Mettwurst; Ragout von Hahnenkämmen, Lämmerzungen usw. mit Pinienkernen und Kapern; der Rücken eines Rehbocks aus dem Harz, ein Häschen, ein Birkhahn aus dem Erzgebirge, Ortolane; ein überaus reiches Dessert (wobei Aprikosen und Pfirsiche aus Potsdam). Die Zahl der Weinsorten ist verhältnismäßig sehr klein: sechziger Rheinwein, Pontac und Burgunder; Sillery, Tokaier und Kapwein. In der Regel wurde in Hamburg nach dem oben erwähnten gleichzeitigen Berichte nicht bloß bei Festen, sondern auch bei den täglichen Mahlzeiten der Reichen zu jeder Speise ein besonderer Wein gegeben: »Zu jungen grünen Bohnen (die Schüssel oft für einen Dukaten) mit neuen Heringen Malaga, zu neuen grünen Erbsen Burgunder, zu Austern Champagner, zu köstlichen gesalzenen Fischen Port oder Madeira.«

93. GLADIATOREN.
Marmorrelief republikanischer Zeit. München, Glyptothek
Beispiele des sarmatischen Tafelluxus mit seinem rohen Überflusse, seiner massiven, aber geschmacklosen Pracht und seiner grenzenlosen Verschwendung bieten im 18. Jahrhundert vor allem die schwelgerischen Feste des polnischen Adels unter Stanislaw August in Warschau. Eines der prachtvollsten gab 1789 Fürst Karl Radziwill. Viertausend Einladungen waren dazu ergangen. In dem Saale, wo der König speiste, war alles Geschirr von Gold; in den drei zu einem Ganzen verbundenen Nebensälen auf einer endlosen Tafel das herrlichste Silbergerät von Augsburger Filigranarbeit gehäuft, die ebenso langen Kredenztische an den Wänden ebenfalls mit Silber überfüllt, die Tapeten, der Schmuck der Dienerschaft entsprechend prachtvoll. Die Bewirtung war die reichste. Der Imbiß begann mit Austern, die auf eigenen Wagen von Hamburg gebracht waren; einige hundert Schüsseln wurden davon geleert. Man schätzte die Kosten des Festes auf eine Million Mark.
Die Feste Potemkins, von denen oben beiläufig bereits die Rede gewesen ist, übertrafen vielleicht an Pracht alles schon Dagewesene. Mit der ausschweifendsten Verschwendung in der Bewirtung verband sich ein Luxus der Ausstattung, der die Schilderungen der Feenmärchen zur Wirklichkeit zu machen schien. Bei einem Feste, das Potemkin der Kaiserin Katharina am 1. April 1791 in Petersburg gab, lieferte das Hofkontor 16.000 Pfund Wachs für die Illumination, und man erzählte, daß außerdem noch für 70.000 Rubel Wachs aus Moskau gekommen sei. Der Wintergarten (sechsmal so groß als der im kaiserlichen Palais) hatte künstlichen Rasen, mit Kies bestreute Wege, zahllose Fruchtbäume, zum Teil allerdings mit gläsernen Früchten behangen, Jasminsträucher, Grotten mit Spiegeln, einen Springbrunnen mit eau de lavande, einen mit Kristallen und Edelsteinen geschmückten Obelisken; im Rasen sah man Nester mit Singvögelchen und große Glaskugeln mit Goldfischen, ferner Laternen in Form von Melonen und Ananas, endlich einen Tempel, dessen von sechs Säulen getragene Decke das Bild der Kaiserin überwölbte. Gegen dreitausend Gäste waren eingeladen. An das Volk wurden für mehrere tausend Rubel Geschenke verteilt; die Ballettmeister La Pica und Canziani erhielten je 5000 und 6000 Rubel. Die Gesamtkosten des Fests schätzte man auf 200.000 Rubel, gewiß viel zu niedrig.
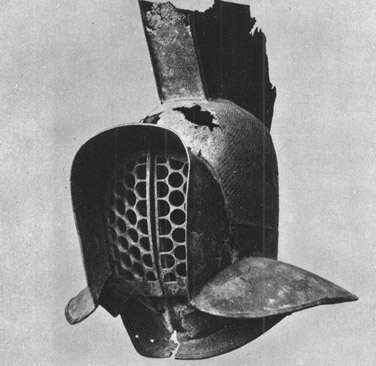
94. GLADIATORENHELM.
Gefunden am Adriatischen Meer. Berlin, Antiquarium
Von der Verschwendung für Tafelgenüsse in Nordamerika gibt die Angabe eine Vorstellung, daß im Jahre 1775, wo das Papiergeld noch wenig entwertet war, bei einem Gastmahl in Philadelphia für die Pasteten allein 800 Lstr. ausgegeben wurden.
Die bewährten Traditionen der Koch- und Eßkunst des 18. Jahrhunderts wurden im 19. vor allem von den großen Gastronomen Frankreichs festgehalten und fortgepflanzt. Im Jahre 1803 erschien der von Grimod de la Reynière herausgegebene »Almanac des Gourmands«, der einen ungeheuren Absatz fand und mehrere Auflagen erlebte, nach dem Zeugnis des Herzogs von York »das angenehmste Buch, das je die Presse verlassen hat«. Macaulay wußte vieles Ergötzliche aus diesen acht Bänden auswendig, womit er seine Tischgäste zu unterhalten liebte, z. B. daß die Austern nach dem sechsten Dutzend aufhören, den Appetit anzuregen; er konnte die Gerichte dort beschriebener erlesener Mahlzeiten vom potage brulant tel qu'il doit etre bis zum biscuit d'ivrogne herzählen. In Frankreich war das Haus Talleyrands auf dem Gebiete der Gastronomie das erste ( la première maison dinante), und die Diners im Hotel des auswärtigen Ministeriums in der Rue de Varennes hatten nicht ihresgleichen, am wenigsten konnten die des (nach dem Urteil Carêmes) als Eßkünstler unendlich überschätzten Erzkanzlers Cambacérès mit ihnen rivalisieren. Auch die Köche dieser Zeit waren würdige Nachfolger ihrer großen Vorgänger, sie wurden nicht minder hochgeschätzt und waren von der Bedeutung ihrer Kunst für die menschliche Gesellschaft nicht minder durchdrungen als jene. Der Marquis de Cussy, ein Hof- und Küchenbeamter Napoleons, rühmte sich, ein Huhn auf 365 Arten zubereiten zu können. Anton Carême wies die Stelle eines Chef de cuisine bei Georg IV. von England zurück, obwohl ihm ein Jahresgehalt von 500 Lstr. nebst ganz freier Verfügung über die für die Küche erforderlichen Summen, fünfzehn Ruhetage in jedem Monat und eine lebenslängliche Pension angeboten wurde. Er hat sein Werk »über die französische Kochkunst im 19. Jahrhundert« der Lady Morgan gewidmet, welche in ihrem Buch über Frankreich ein von der Baronin Rothschild am 6. Juli 1829 unter seiner Leitung gegebenes Diner verherrlicht und u. a. gesagt hatte, daß es weniger Genie bedurft habe, um manche epische Gedichte, als um ein solches Diner zu schaffen. In dieser Widmung erklärt er, daß ihn ein höheres Streben als das nach Reichtum beseele. Zu allen Zeiten habe es uneigennützige Charaktere gegeben, die alles für die Entwicklung und den Fortschritt der Künste und Gewerbe geopfert hätten. Er werde sich glücklich schätzen, durch sein großes Werk das Los derjenigen verbessert zu haben, die sich dem schwierigen und mühevollen Gewerbe des Kochs widmen.

95. GERÜSTETER »SAMNITISCHER« GLADIATOR.
Bronze. London, British Museum
Auch der Aufwand für Gastmähler war bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schwerlich geringer als in irgendeiner früheren Zeit. Macaulay, der im Jahre 1833 das jährliche Mittagessen der Londoner Fischhändler zwar sehr gut, aber nicht so überaus glänzend fand, wie er erwartet hatte, bemerkt, daß bei demselben das Gedeck in früherer Zeit auf 10 Guineen zu stehen gekommen sei.

96. GLADIATOR ALS »THRAEX«.
Bronze mit Silbereinlagen. Griff eines Klappmessers. Berlin, Antiquarium
Die Bedeutung, welche die Gastronomie schon in der Zeit unserer Väter zugestanden wurde, reflektiert sich in einer umfangreichen Literatur, die ihre klassischen Autoren wie Grimod de la Reynière, Rumohr und Brillat-Savarin hat, und für die es bei weitem mehr Analogien im griechischen als im römischen Altertum gibt. Selbst ein Byron hat nicht verschmäht, ein großes Diner in einer Reihe von Stanzen zu beschreiben.
Wenn nun der Tafelluxus schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hinter dem des vorigen nicht zurückstand, so hat er seitdem infolge der gewaltigen Steigerung des Weltverkehrs, die ihm in so hohem Grade Vorschub geleistet hat und noch leistet, erheblich zugenommen. Bei einem am 5. Februar 1877 in Berlin bei Gelegenheit der ersten Berliner Kochkunstausstellung veranstalteten Festessen gehörten zu den aufgetragenen Gerichten u. a.: Perigordtrüffeln, Austern vom Rocher de Cancale, Kaviar von der Wolga, Forellen aus dem Gardasee, Sterlets aus dem Schwarzen Meere, Elenziemer aus dem Bialowiczer Forst, indische Vogelnester aus Bombay, Langusten aus Ostende, Schnepfen aus den Pyrenäen, schottische Rebhühner, Wachteln aus Florenz, italienische Birnen, Tiroler Äpfel, spanische Weintrauben. Die von Zola in Pot-Bouille beschriebenen Diners im Café Anglais, die für jeden Teilnehmer 300 Frcs. kosten, bestehen ebenfalls aus den Köstlichkeiten ferner Länder nebst einer »wahrhaft königlichen« Auswahl von Weinen; außerdem aber auch aus gastronomischen Merkwürdigkeiten, »selbst ungenießbaren«, und aus Seltenheiten, die mit unverhältnismäßigen Kosten außer der Zeit erzeugt oder herbeigeschafft sind, wie Rebhühner im Juli und Pfirsiche im Dezember. U. Sinclair beschreibt ein Diner in New York, zu dem die Pfirsiche aus Südafrika, die Weintrauben aus Hamburger Treibhäusern, andere Früchte aus Japan gekommen sein sollen; ferner Wachteln aus Ägypten, Champignons aus den Gängen verlassener Gruben in Michigan, Limabohnen aus Portorico, Artischocken aus Frankreich. Man höre jetzt von Diners, die 100 Dollar das Kuvert kosten. Auf seltene, mit Überwindung der größten Schwierigkeiten aus den weitesten Fernen bezogene Leckerbissen scheint aber die chinesische Gastronomie noch größeren Wert zu legen als die europäische und amerikanische, wenn folgende Angaben über eine am 6. März 1877 in Hongkong veranstaltete Mahlzeit Glauben verdienen: »Eine Pilzart stammte von den Eisbergen des Südpolarmeers, die Walfischsehnen sollten aus dem nördlichen Eismeer, die Haifischflossen von den Südseeinseln gekommen sein; die Vogelnester waren von einer Art, die nur in einer gewissen Höhle, auf einer gewissen Insel gefunden wird.
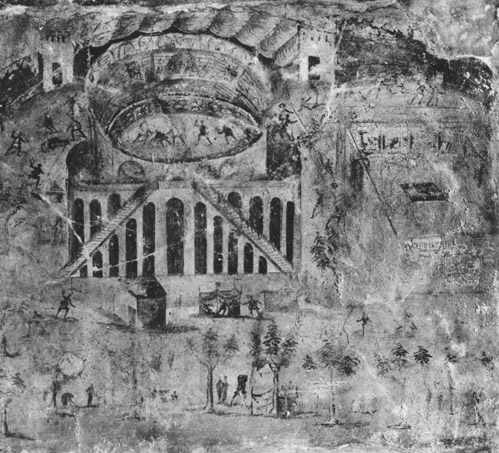
97. CIRCUS-KÄMPFE.
Pompeianisches Fresko. Neapel, Nationalmuseum
Wieviel mehr Grund hätten heutzutage Deklamationen über das Durchsuchen aller Länder und Meere nach Leckerbissen, als in den Tagen des Varro und Sallust, des Plinius und Seneca, und wie klein würde Apicius sich erscheinen, wenn er dem Gastmahl eines großen Gastronomen in einer heutigen Weltstadt beiwohnen könnte!
Der Tafelluxus hat auch im römischen Altertum keineswegs nur schädliche oder gleichgültige Wirkungen geübt; sondern dadurch, daß er die Hauptveranlassung zur Einführung fremder Kulturgewächse und eßbarer Tiere in den Ländern des Okzidents und somit zur Veredelung und Verfeinerung der Nahrungsmittel überhaupt war, ist er ebenso wie in neueren Zeiten ein nicht unwichtiger Faktor zur Verbreitung und Hebung der Gesamtkultur gewesen.
Schon in der Zeit der Republik war ein großer Teil der zur Luxusnahrung dienenden Tiere und Gewächse in Italien eingeführt worden. Bei den unbedingten Gegnern des Luxus fand nun freilich die Akklimatisation fremder Fische und Vögel zur Bereicherung der Tafelgenüsse ebenso strenge Mißbilligung wie deren Beschaffung auf dem Handelswege. Unter Tiberius gelang es dem Flottenpräfekten Ti. Julius Optatus Pontianus, einen sehr hochgeschätzten Fisch, den Scarus, aus dem Meere zwischen Kreta und Rhodus an die Westküste Italiens zwischen Ostia und Campanien zu verpflanzen; Plinius, in dessen Zeit er dort schon häufig war, sagt darüber: »So hat sich also die Schlemmerei durch Aussäen von Fischen Leckerbissen herbeigeschafft und dem Meere einen neuen Bewohner gegeben, damit man nicht erstaune, daß ausländische Vögel in Rom Eier legen!« Aus dem Tafelluxus Gewinn zu ziehen, haben freilich auch seine größten Tadler nicht für Unrecht gehalten, wie denn Varro nicht verschmäht hat, zur künstlichen Zucht von Wild, Geflügel, Fischen und Schaltieren die ausführlichsten Anweisungen zu geben, auch von solchen, die aus der Fremde eingeführt waren, wie afrikanische Perlhühner, gallische und spanische Hasen und Kaninchen, illyrische und afrikanische Schnecken.

98. TRANSPORT VON GÖTTERBILDERN IN DEN CIRCUS.
Marmorrelief. 3. Jahrhundert n. Chr. London, British Museum
Auch zu der Erfindung der künstlichen Austernbassins im Lucrinersee (durch Sergius Orata) gab nach dem Zeugnis des Plinius nicht Schlemmerei die Veranlassung, sondern Gewinnsucht. Übrigens war die künstliche Austernzucht schon früher, doch ohne Erfolg, versucht worden. Nach Aristoteles hatten einige Chier aus Pyrrha in Lesbos lebendige Austern mitgenommen und in einigen ganz ähnlichen Stellen ihres Meers versenkt. Nach längerer Zeit hatten diese zwar an Größe bedeutend zugenommen, aber ihre Zahl hatte sich nicht vermehrt. Außerhalb Italiens sind aus dem Altertume Austernparks nur in Bordeaux bekannt. Doch was im Altertume nur gewinnbringende Spekulation einzelner war, gilt der heutigen Volkswirtschaft als wichtige Erwerbsquelle für ganze Bevölkerungen, als erhebliche Vermehrung des Nationalvermögens, und der Naturwissenschaft als ein ihrer eifrigsten Bemühungen würdiges Problem. In Frankreich ist die durch Coste erfolgte Erneuerung und Einführung der künstlichen Austernzucht (die noch jetzt im Lago di Fusaro in ursprünglicher Einfachheit und Zweckmäßigkeit fortgetrieben wird) vom Staate kräftig unterstützt und glänzend belohnt worden.
Die Tiere, deren Einführung in Italien der Tafelluxus veranlaßte, waren größtenteils Vögel. Der Pfau, den Hortensius zuerst gebraten auf die Tafel brachte, war damals dort nicht mehr neu. Bei steigendem Begehr wurde die Pfauenzucht zum Gegenstand landwirtschaftlicher Industrie. Die kleinen Eilande um Italien wurden schon zu Varros Zeiten zu Pfaueninseln eingerichtet, und auch auf dem Festlande Pfauenparks angelegt. Zu Athenäus' Zeit war Rom voll von Pfauen. Das Perlhuhn ( Numidica, gallina Africana), das in Varros Zeit bereits gegessen wurde, war damals in Italien noch selten, folglich teuer; in Martials Zeit dürfte es auf größeren Geflügelhöfen schon gewöhnlich gewesen sein. Die Fasanen, die schon zur Zeit des Ptolemäus Euergetes II. (Physkon, 145-116) aus Medien, d. h. den südkaspischen Landen, nach Alexandria kamen, nennt weder Varro noch auch Horaz unter den Leckerbissen der römischen Schwelger, sondern dies geschieht erst seit Anfang der Kaiserzeit. Wenn nun auch immer so gesprochen wird, als wenn der Fasan aus seinem fernen Heimatlande bezogen worden sei, so wissen wir doch aus Martials ausdrücklicher Angabe, daß er mindestens im vorletzten Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts schon in Italien gezüchtet wurde. Dasselbe bezeugt Martial für den Flamingo, der übrigens selten erwähnt wird; seinen Genuß hatte vielleicht Apicius eingeführt, wenigstens machte er zuerst auf den vorzüglichen Geschmack seiner Zunge aufmerksam.

99. FAUSTKAMPF.
Griechisch-unteritalisches Marmorrelief. Rom, Lateran-Museum
Weil die Geflügelzucht übrigens ganz eigentlich im Gebiete der kleinen Gartenkultur gedeiht, nahm sie auch in Italien die größten Dimensionen an, wie noch heute in Europa »die romanischen Völker nach ihrem Wohnort und ihrer Tradition die vögelessenden und vögelerziehenden« sind. »In Italien hatte zur Zeit der Römer von reicher Jagdbeute nicht die Rede sein können, und das Hochwild der germanischen Wälder, das Federwild der Moore des Nordens nach Italien zu schaffen, wurde durch die Entfernung und das warme Klima unmöglich. So sahen sich die Römer auf künstliche Zucht delikater Wildvögel angewiesen, die denn auch in oft kolossalen Anstalten derart betrieben wurde und auf verschiedenen Stufen zu mehr oder minder erreichter Zähmung führte. Diese Versuche sind von der neueren Tierzucht nicht wiederholt worden, und wenn auch in Europa die Wildnis immer weitergerückt ist, so führen jetzt die Eisenbahnen die erlegten Jagdtiere der fernsten Einöden blitzschnell den großen Konsumtionszentren zu: der Markt von Paris bezieht seine Rebhühner schon aus Algier und dem nördlichen Rußland.
In weit größerem Umfang als die Einführung von Tieren erfolgte in Italien die Akklimatisation von Fruchtbäumen und eßbaren Gewächsen, die sich dann von dort in andere Länder verbreiteten. Aber auch hier hat das spätere Altertum nur fortgesetzt, erweitert und vervielfacht, was das frühere angebahnt und begonnen hatte, die Wanderungen der Kulturpflanzen nur auf fernere Gebiete ausgedehnt, und so freilich im Laufe der Jahrhunderte den Charakter der Vegetation von Süd- und Mitteleuropa völlig umgestaltet.
Wenn auch die Rebenkultur in Italien uralt ist, so werden doch die an seinen Küsten landenden griechischen Seefahrer zu ihrer Verbreitung nicht wenig beigetragen haben, und der Weinstock »gedieh an den Bergen Unteritaliens so üppig, daß schon im 5. Jahrhundert Sophokles Italien das Lieblingsland des Bacchus nennen konnte«. Auch die Ölkultur erhielten die Römer von den Griechen, und zwar, wenn die von Plinius mitgeteilte Nachricht des Chronisten Fenestella richtig ist, erst in der Zeit der Tarquinier. Der Feigenbaum dagegen ist dort wahrscheinlich so alt wie die griechische Kolonisation. Zu Varros Zeit waren chiische, lydische, chaldicidische, afrikanische und andere ausländische Feigenarten in Rom eingeführt. Noch unter Tiberius wurden syrische direkt nach Italien versetzt. Cato kennt bereits die Mandel unter dem Namen der griechischen Nuß, vielleicht auch die Kastanie ( nux calva?); »auf jeden Fall kann bei dem Mangel fester Namen an eine allgemeine Kultur dieser Bäume im damaligen Italien nicht gedacht werden«. Den Namen Kastanie nennt zuerst Vergil, die Walnüsse (Juppiters Eicheln, iuglandes) Varro und Cicero. Der Name amygdalum findet sich zuerst unter Augustus. Auch von einer allgemeinen Kultur des Pflaumenbaumes war in der Zeit Catos, der ihn einmal nennt, noch nicht die Rede; dagegen bestand sie bereits unter Augustus. Plinius, der eine verwirrende Menge von Varietäten nennt, sagt, daß die edelste, die Damascenerpflaume, schon längst, eine andere syrische Art erst seit kurzem in Italien wachse. Die Granate dagegen war in Catos Zeit in Italien schon gewöhnlich. Ebenso war die Quitte, welche die Griechen zunächst aus Kreta erhielten, in Italien alt. Die Kirsche, die bei Cato fehlt, brachte bekanntlich Lucullus von der pontischen Küste nach Rom; Varro nennt sie einmal, bei Späteren ist sie häufig. Diese für Italien neue Frucht mag eine edlere, größere, saftreiche Sauerkirsche gewesen sein; die wilde Süßkirsche (Prunus avium L.) war dort heimisch; unzweifelhafte Reste davon sind in den Pfahldörfern der Poebene nachgewiesen; eine veredelte Süßkirsche scheint es in Kleinasien schon in der Zeit des Königs Lysimachus gegeben zu haben. »Beide Hauptarten wurden rasch vermehrt, aus Asien vielfach bezogen, auf die einheimischen wilden gepfropft, und eine Menge Varietäten erzeugt.«
Von den Blumen »kam die orientalische Gartenrose früh mit den griechischen Kolonien nach Italien, und mit ihr auch wohl die Lilie«, um von hier aus in alle Welt zu gehen. »Neben Rosen, Lilien, Violen finden wir in römischen Gärten auch den orientalischen (besonders in Cilicien heimischen) Krokus.« »Doch war die Blume fremd, und sie zu erziehen ein Triumph der Akklimatisationskunst, wie die Erziehung der Casia, des Weihrauchs, der Myrrhe in römischen Gärten, mit welchen Columella den Krokus zusammenstellt. Nach Plinius lohnt es sich nicht, in Italien den Safran anzupflanzen«, doch muß es geschehen sein. Von den aus dem Orient eingeführten Futterpflanzen kennt Cato die medica und den cytisus noch nicht; Varro aber erwähnt sie bereits, sie waren also in dem zwischen beiden liegenden Jahrhundert in Italien verbreitet worden.
Man sieht, daß auch Italien schon in den letzten Jahrhunderten v. Chr., wie die antike Welt überhaupt, »in einer selbstgeschaffenen Bodenwirtschaft lebte«. Varro konnte bereits sagen, Italien sei ein großer Obstgarten, während die älteren Griechen (im Peloponnesischen Kriege und noch bis in die alexandrinische Zeit) »die Halbinsel als ein Land kennen, das im Vergleich mit ihrem eigenen und mit dem Orient einen nordischen, primitiven Charakter trug, und dessen Produktion hauptsächlich in Getreide, Vieh und Holz bestand. An die Stelle von ungeheueren, unwirtlichen Wäldern und Wildnissen mit ihren Holz- und Pech-, Jagd- und Weideerträgen war jetzt eine Waldung orientalischer Obstbäume, an Stelle der Fleisch- und Breinahrung der Alten der orientalisch-südliche Genuß von erfrischendem Fruchtsaft getreten. Die Vermittler dieser Umwandlung waren großenteils asiatische Sklaven und Freigelassene, Syrer, Juden, Phönicier, Cilicier: Gartenkunst und Freude an dem stillen, liebevollen Geschäft der Erziehung und Pflege der Pflanzen war ein Erbteil des aramäischen Stamms von altersher«.

100. FAUSTKÄMPFER.
Pompeianisches Mosaik. Neapel, Nationalmuseum
Das ungemeine Anwachsen des Weltverkehrs seit Augustus steigerte natürlich auch die Erwerbungen an orientalischen Kulturgewächsen. Schon Columella rühmt von Italien, daß es durch den Fleiß seiner Bebauer die Früchte fast der ganzen Welt tragen gelernt habe. Zu den in der früheren Kaiserzeit eingeführten Gewächsen gehört vielleicht die afrikanische Lotusfrucht, die Schalotte aus Askalon, gewiß die Pfirsichmandel und der Pfirsichnußapfel, die S. Papinius, Konsul 36 n. Chr., in der letzten Zeit des Augustus aus Afrika und Syrien nach Italien verpflanzte, die Colocasia aus Ägypten, der Rettich aus Syrien, die Hirse aus Ostindien (jener nicht lange, diese weniger als zehn Jahre, bevor Plinius schrieb, in Italien eingeführt); Reis und Mais wurde erst zu Ende des 15. oder Anfang des 16. Jahrhunderts dorthin verpflanzt. Die Aprikose und den Pfirsich »hatten gegen die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. gewerbsame Gärtner in Italien angepflanzt und ließen sich die ersten gewonnenen persischen Äpfel und armenischen Pflaumen teuer bezahlen«. Die Pistazie verpflanzte L. Vitellius (der Vater des Kaisers), der unter Tiberius Legat in Syrien gewesen war, unter mancherlei andern Gartenfrüchten von dort auf sein Landgut bei Alba. Die Melone scheint im Laufe des ersten christlichen Jahrhunderts von den Oasen am Oxus und Jaxartes in die Gärten Neapels gebracht worden zu sein; Plinius beschreibt zuerst die neuen, wunderbaren campanischen melopepones; die späteren Quellen nennen die Frucht melo. Ob die Naturalisation des Johannisbrotbaums zur Römerzeit bereits begonnen habe, ist zweifelhaft. Der Zitronenbaum dagegen, welcher die lange, als Hesperidenfrucht bewunderten medischen Äpfel trug ( arbor citri, die Zitronatzitrone, Citrus medica Riss.), ist im Laufe der ersten christlichen Jahrhunderte in Italien wirklich naturalisiert worden. Plinius erwähnt mißlungene Versuche, Bäumchen in tönernen, durchlöcherten Kübeln nach Italien überzuführen; doch hat Florentinus (wohl zu Anfang des 3. Jahrhunderts) schon eine Treibhauskultur der Zitronenbäume (wie jetzt in Oberitalien, durch Mauern gegen Norden, im Winter durch Bedeckung geschützt), endlich Palladius (im 4. oder 5. Jahrhundert) Zitronenbäume völlig im Freien auf Sardinien und in Neapel, doch nur auf erlesenem Boden. Auch der neueste, ebenso geistvolle wie gelehrte Forscher auf diesem Gebiet, der in der Kaiserzeit nur eine Epoche unrettbaren, beschleunigten Verfalls sieht, erkennt hier an, daß diese Jahrhunderte »doch auch in manchen Zweigen menschlichen Handelns, die weniger den Blick auf sich zu ziehen pflegen, wie in Austausch und technischer Verwertung der Naturobjekte der verschiedensten Länder, eine aufwärts gerichtete Entwicklung zeigen«. Von den übrigen Agrumi ist die Limone (die wir fälschlich Zitrone nennen, arabisch limûn) und die bittere Pomeranze (orange) in der Zeit der Kreuzzüge, die süße Pomeranze (Apfelsine, portogallo) im 16. Jahrhundert (durch die Portugiesen aus China), eine neue Varietät, die Mandarine, erst im 19. Jahrhundert aus China nach Europa gekommen.
Die Veredlung der Früchte und Gewächse, die Vervielfältigung der Arten hatte schon in der ersten Kaiserzeit einen so hohen Grad erreicht, daß Plinius meinte, sie sei bereits auf ihrem Gipfel angelangt und fernere Erfindungen nicht mehr möglich. Von seinem Standpunkt aus hätte er die Akklimatisation der ausländischen Gewächse ebensosehr mißbilligen müssen, wie er in der Tat ihren Bezug durch den Handel (z. B. des Pfeffers aus Indien) vom Übel fand. Doch tut er es nirgends, teils wohl, weil die Gegner des Luxus der pflanzlichen Nahrung vor der tierischen den Vorzug gaben und daher auch ihre künstliche Vermehrung und Verfeinerung eher dulden mochten, teils weil er den Widersinn einer Mißbilligung der seit Jahrhunderten im weitesten Umfange und mit offenbarstem Nutzen betriebenen Verbreitung der Gewächse zu empfinden unmöglich umhin konnte. In welchem Grade auch sie einst den Zwecken einer ausgesuchten Schwelgerei dienstbar gemacht werden würde, konnte man damals noch nicht ahnen. Ein Beispiel der modernen Akklimatisation im ausschließlichen Interesse des Tafelluxus mag hier genügen. Im Jahre 1806 berichtete der Almanac des gourmands als einen Triumph der Zivilisation, daß das große Problem der Fabrikation des echten Maraschino auf französischem Boden gelöst sei! Ein Fabrikant in Grasse hatte den Kirschbaum, dessen Frucht in Zara dazu verwendet wird, auf seinen Besitzungen angepflanzt: nach fünfzehnjährigen angestrengten und kostspieligen Bemühungen war es ihm gelungen, ihn zu akklimatisieren, und der aus seinen Früchten bereitete Maraschino übertraf nach dem Urteil mehrerer großer Kenner sogar den dalmatischen. Derselbe Industrielle hatte auch persönlich eine bei der Destillation von Likören angewandte Wurzel aus England geholt und mit Erfolg in Grasse naturalisiert. »Gesegnet«, ruft der Berichterstatter aus, »sei der arbeitsame und intelligente Bürger, dessen tätige Industrie das allgemeine Wohl mit seinem Privatinteresse zu verbinden weiß, der zugleich die Genüsse der verwöhntesten Feinschmecker verdoppelt und das Wohl seines Lands fördert. Darin besteht der wahre Patriotismus, und Herr Fargeon verdient den Namen eines Patrioten in der ehrenvollsten Bedeutung des Worts, welches der vorgebliche Civismus unserer republikanischen Revolutionäre schließlich herabgewürdigt hatte, das aber all seine Rechte und seine wahre Bedeutung unter einer Regierung der Wiederherstellung wieder aufnehmen soll.«
Wenn Plinius auch die Akklimatisation nicht tadelte, so konnte er sich doch nicht entschließen, die künstliche Garten- und Obstkultur im allgemeinen gutzuheißen, da ja in der Tat jeder ihrer Fortschritte die Entfernung von der ursprünglichen Natur vergrößerte, nach seiner Ansicht also die Unnatur der neugeschaffenen Genüsse immer augenfälliger machte. Zwar erkennt er das Verdienstliche der Veredlung der eßbaren Gewächse und Früchte gelegentlich an, klagt aber, daß infolge »der ehebrecherischen Verbindung der Bäume« (des Pfropfens), durch die man es so weit gebracht, daß ein Obstbaum in unmittelbarer Nähe Roms mehr einbringe als ehemals ein Landgut (2000 Sesterzen = 435 Mark), das Obst den Armen entzogen würde. Und wenn es auch zu ertragen sei, daß Früchte wachsen, die ihre Größe, ihr Geschmack, ihre ungewöhnliche Gestalt den Armen unerschwinglich macht, »mußten selbst bei den Kräutern Unterschiede erfunden werden, und der Reichtum auch in Speisen, die einen As kosten, Abstufungen einführen? Müssen Spargel bis zu solcher Dicke gezüchtet werden, daß der Tisch der Armen sie nicht mehr faßt? Die Natur hat wilde Spargel wachsen lassen, die jeder überall ernten konnte; jetzt sind künstliche zu sehen, und in Ravenna wiegen drei ein Pfund« (327 g). »O über die Monstrositäten der Schlemmerei!« Vollends von der gewinnreichsten Kultur könne man nicht ohne Beschämung reden: kleine mit Artischocken ( cardui) bepflanzte Felder bei Karthago und besonders bei Corduba bringen jährlich 6000 Sesterzen (= 1305 Mark) ein, »da wir ja sogar die Mißgeburten des Bodens zur Völlerei verwerten, welche selbst das Vieh verschmäht«. Ja wahrhaftig, man befördert ihr Wachstum durch Düngen und macht sie mit Essig und verdünntem Honig nebst einigen Zutaten ein, um die Artischocke nicht einen Tag im Jahre zu entbehren.
So großes Staunen übrigens die Leistungen der Gärtnerei damals erregten, so waren sie doch im Vergleich zur heutigen Gartenkultur wohl nur sehr dürftig. Im größten Handelsgarten der Umgegend Londons sah man im Jahre 1828 unter andern 435 Arten Salat, 261 Erbsen, 240 Kartoffeln usf. in gleichem Verhältnis mit allen Gegenständen des Gartenhandels. Auch dürfte die Verwertung der von der heutigen Gartenkultur erzielten Resultate eine höhere sein als im Altertum. Bei einem Rothschildschen Diner in London kostete schon damals das Dessert allein 100 Lustres. Die Trüffel, die im Altertum wenig beliebt war, da die schwarze unbekannt gewesen zu sein scheint, ist jetzt in Frankreich der Gegenstand einer Kultur und eines Exporthandels, der von Jahr zu Jahr größere Verhältnisse annimmt, und wird deshalb als »schwarzer Diamant« gepriesen. Die Ausfuhr betrug im Jahre 1865: 104.000, 1866: 120.000, 1867: 140.000 Pfund nach Rußland, England und Amerika. In einem Geschäft in Carpentras, wo 1832 nur 18.000 Pfund umgesetzt wurden, betrug der Umsatz 1866: 109.000 Pfund. Nur beiläufig sei hier noch an den ebenfalls modernen Luxus der narkotischen Genußmittel erinnert. Für Tabak wurden in Deutschland 1882/83 etwa 313 Mill. Mark ausgegeben (während die Gesamtausgabe für das Heer etwa 345 betrug), und in England beläuft sich in einzelnen Fällen die Ausgabe für Zigarren auf 5 Lustres täglich.
Bisher ist nur von den Erwerbungen Italiens an Kulturgewächsen die Rede gewesen. Von diesen teilte es, nachdem es das Zentralland eines Weltreichs geworden war, je länger je mehr auch den Provinzen mit und gestaltete so auch deren Vegetation sowie die Nahrung ihrer Bevölkerungen allmählich um.
Daß fort und fort Akklimatisationsversuche aller Art gemacht wurden zeigt unter anderm die Bemerkung Galens, daß Gewächse bei der Verpflanzung aus einem Boden in den andern, selbst nur ein wenig (2 Stadien) entfernten, auch ihre Natur verändern, wie denn namentlich die Reben auf neuem Boden auch andern Wein geben; von Nährpflanzen finde man dasselbe in landwirtschaftlichen, von andern in botanischen Werken erwähnt. Die Fruchtbäume gingen zum Teil erstaunlich schnell über die Alpen. Die Kirsche war nach Britannien schon 47 n. Chr. (4 Jahre nach der Eroberung des Lands, 120 Jahre nach der Anpflanzung in Italien) gekommen; in Belgica (zwischen Seine, Saône, Rhône, Rhein und Nordsee) und an den Rheinufern galten in Plinius' Zeit lusitanische Kirschen für die beste Sorte. Die von L. Vitellius nach Italien gebrachte Pistazie führte sein Waffengefährte, der römische Ritter Pompejus Flaccus, in Spanien ein. In Plinius' und Columellas Zeit war in der Provence schon eine große Art des Frühpfirsichs erzeugt worden. Eine ihres Wohlgeruchs halber gezogene Casia gedieh in Plinius' Zeit bereits »am äußersten Rande des Reichs, wo der Rhein anspült«, man pflanzte sie dort in Bienengärten. Ein in der Gegend von Boulogne neu angepflanzter Schattenbaum war nicht, wie Plinius angibt, die Platane, sondern wahrscheinlich der nordische Ahorn. Auch die Anfänge seiner jetzt so blühenden Obstkultur verdankt Deutschland, das Tacitus dazu noch für zu kalt hielt, so gut wie Frankreich und England den Römern.
Am folgenreichsten und wichtigsten waren die Einflüsse der römischen Kultur auf die Verbreitung des Öl- und Weinbaus. »Als das römische Weltreich fertig war, fielen seine Grenzen ungefähr mit denen des Weins und Öls zusammen.« Doch nur sehr allmählich hatte sich das Gebiet dieser beiden Nahrungsmittel auf Kosten des Biers und der Butter erweitert. Mit der Ausbreitung der griechischen, dann der römischen Kultur war auch »die edle Olive von ihrem Ausgangspunkt, dem südöstlichen Winkel des Mittelländischen Meeres, über alle Länder verbreitet worden, die ihren heutigen Bezirk bilden«. Von Massilia war sie in Gallien bis an ihre nördliche Grenze vorgerückt, von dort aus hatten sich auch die ligurischen Küsten mit Ölpflanzungen erfüllt; und wenn im Gebiet der Pomündungen der niedrige, wasserreiche Boden ihre Einführung verbot, so gediehen sie desto besser in Istrien und Liburnien; das istrische Öl wetteiferte mit dem des südlichen Spaniens. Auf der Pyrenäischen Halbinsel hatte der Ölbau sich mit der von den Küsten ins Innere fortschreitenden Zivilisation verbreitet und Bestand gewonnen.
Weit nördlichere Gebiete vermochte der Weinstock zu erobern und zu behaupten. »Columella führt aus dem älteren landwirtschaftlichen Schriftsteller Saserna den Ausspruch an, das Klima habe sich geändert, denn die Gegenden, die sonst zum Wein- und Ölbau zu kalt gewesen, hätten jetzt Überfluß an beiden Produkten.« Aber dies ist nicht geschehen, nur der Anbau beider Gewächse im Lauf der Jahrhunderte allmählich immer weiter nach Norden gerückt, während umgekehrt in neueren Zeiten sich der Weinbau aus nordischen Landstrichen, wo er nicht mehr vorteilhaft war (dem nördlichen Frankreich, südlichen England, der Mark Brandenburg, Westpreußen usw.), zurückgezogen hat. Von den Ufern des Adriatischen Meers aus erstieg die Rebe nicht bloß die Abhänge der Euganeen, sondern früh auch die Vorhügel und Südabhänge der Alpen: schon Cato hatte die rätischen (Tiroler und Veltliner) Weine gelobt. In Nordafrika war der erst durch den Islam vernichtete phönizische Weinbau uralt. Der pyrenäischen Halbinsel fehlte der Wein sowie Feigen und Oliven mit Ausnahme des Südens und Ostens nach Strabo so gut wie ganz, der Nordküste wegen der Kälte, dem Binnenlande wegen der Barbarei seiner Bewohner. Bei den biertrinkenden Lusitanern war der Wein noch selten, der aber doch damals schon in das Land des Portweins vorzudringen begann, und noch in Plinius' Zeit galt Spanien als ein vorzügliches Bierland. Wir kennen einen kaiserlichen Beamten vom Ritterstande in Bätica (Granada, Sevilla, überhaupt Andalusien) »zur Anpflanzung von Falernerreben«. Auf gallischem Boden wurde auch die Rebe ohne Zweifel zuerst in Massilia gepflanzt, verbreitete sich mit dessen Kolonien östlich und westlich längs der Küste und drang allmählich ins Innere, so daß die Römer bald im Interesse der italienischen Ausfuhr den gallischen Öl- und Weinbau beschränkten. Unmittelbar nach der Eroberung Cäsars, mit der die Romanisierung von ganz Gallien begann, gab es dort außerhalb der römischen Provinz neben dem Bier nur importierten Wein, und noch Strabo sagt, daß jenseits des Gebiets der Feige und Olive und gegen die Cevennen hin der Wein nicht mehr gut gedeihe. Doch bei Plinius und Columella erscheint »das heutige Frankreich bereits als ein selbständiges, rivalisierendes Weinland, mit eigenen Trauben und Weinsorten, mit Ausfuhr und Verpflanzung nach Italien«; sie nennen unter andern Burgunder, auch Bordeauxweine. Im Laufe der Kaiserzeit bemächtigte sich der Weinbau der Täler der Garonne, der Marne und der Mosel, verbreitete sich auch in der Schweiz, wo sich am nördlichen Ufer des Genfer Sees bei St. Prex zwischen Rolle und Morges eine inschriftliche Spur davon erhalten hat, und längs der ganzen Mosel, scheint aber am linken Rheinufer spärlich geblieben zu sein und erstreckte sich nicht auf das rechte. Vom Kaiser Probus wird berichtet, er habe den Provinzen Gallien, Spanien und Britannien, nach andern Gallien, Pannonien und Mösien den uneingeschränkten Weinbau erlaubt. Durch Pflanzung von Reben am Südabhange der Karpathen, auf dem Berge Alma bei Sirmium (Mitrovitza), wurde er der Begründer des ungarischen Weinbaus. Schon hundert Jahre nachher besang Claudian die »von Weinbergen beschattete Donau«. Doch im Altertum blieb Italien das erste Weinland der Welt. Jetzt ist es das mittlere und südliche Frankreich, und der Weinstock bringt ganz nahe an der Nordgrenze seiner Verbreitungssphäre (als Burgunder, Johannisberger usw.) den edelsten Fruchtsaft hervor.
So vollendete sich im römischen Kaiserreich unter Einflüssen, die sich nur in ihm vereinigen und wirksam erweisen konnten, der lange Assimilationsprozeß, dessen Resultat die Gleichartigkeit der Bodenkultur in allen Uferländern des Mittelmeeres war. Und wenn wir zugestehen, daß das mittlere Europa auch auf diesem Gebiet das meiste dem Süden, »in dem alle Quellen unserer Bildung liegen«, verdankt, so dürfen wir doch auch nicht vergessen, welchen Anteil an dieser Kulturarbeit die bisher mit zu großer Ungerechtigkeit beurteilte römische Kaiserzeit gehabt hat.
Der Luxus der Tracht war in jenen Jahrhunderten größtenteils auf andre Dinge gerichtet als im Mittelalter und in neueren Zeiten. Kostbare Stoffe gab es bei der geringen Entwicklung der Manufaktur und Fabrikation nur wenige. Die ältesten Kleiderstoffe waren wollene gewesen, doch wurden leinene von Frauen schon in der Republik getragen, während Männer sich der feinen Leinwand in deren letzter Zeit sowie später hauptsächlich zu Taschentüchern bedienten. Leinene Tuniken trug man allgemein in Rom mindestens schon im 3. Jahrhundert n. Chr., vielleicht schon früher. Die feinste Leinwand (Byssus) kam aus Ägypten, Syrien und Cilicien. Die ostindische Baumwolle (skr. carpasa, carbasus) war in Rom wo nicht früher so mindestens seit den asiatischen Kriegen (191 v. Chr.) eingeführt, und Musseline wurden vielleicht auch zur Kleidung verwandt. Die chinesische Seide wurde anfangs nur als Garn und Rohseide eingeführt, aber auch die fertigen Zeuge aufgelöst, gefärbt und mit Leinen oder Baumwolle zu einer leichten Halbseide verwebt. Diese durchsichtigen, bunten, halbseidenen Zeuge wurden im 1. Jahrhundert nicht nur von Frauen, sondern auch von weichlichen Männern getragen; und erst viel später brachte die zunehmende Handelsverbindung mit dem Orient die schweren, ganzseidenen Stoffe nach Europa: Elagabal war der erste, welcher solche trug. Atlas und Samt aber sind im Altertum ganz unbekannt gewesen, der erstere ( atlas arabisch = glatt) ist in der Zeit der sarazenischen Herrschaft nach Europa gekommen. Der ebenfalls orientalische Luxus der mit Gold durchwirkten, besonders seidenen Stoffe verbreitete sich zugleich mit dem übrigen Gebrauch der Seide. Dagegen beschränkte sich die Goldstickerei teils auf Teppiche, Vorhänge und Decken und die Prachtgewänder der triumphierenden Feldherrn, teils auf Borten und Auf- oder Einsatzstücke an Frauenkleidern. Kleider aus Gold- und Silberstoffen, die in neueren Zeiten so häufig waren, scheinen im Altertum selten gewesen zu sein. Der Mantel »aus gewebtem Golde ohne andern Stoff«, den die Kaiserin Agrippina bei dem Schiffskampf auf dem Fucinersee trug, war ein beispielloses Prachtstück, das nicht bloß Plinius, sondern auch Cassius Dio und Tacitus als Merkwürdigkeit erwähnen, während z. B. Karl der Kühne zur Schlacht von Granson 400 Kisten mit Silber- und Goldstoffen, darunter allein 100 gestickte goldene Röcke, für sich mitgenommen hatte. Pelzkleider hat es zwar auch in Italien seit alter Zeit zu besonderen Zwecken gegeben; eine gewöhnliche Tracht aber sind sie vor der germanischen Einwanderung im Süden nie gewesen, und auch von einem Luxus des Pelzwerks wissen wir aus dem Altertume nichts. Im Mittelalter erreichte dieser Luxus eine enorme Höhe. Marco Polo gibt den Preis der Zobelfelle, mit denen Hallen und Gemächer Kublai Chans (1214-1294) geschmückt waren, auf 2000 goldene Byzantiner an, wenn sie fehlerlos und so groß waren, daß sie ein Kleid (?) gaben; wenn sie nicht ganz ohne Fehler waren, auf 1000. Zur Fütterung eines Mantels des Königs Johann II. von Frankreich (1350-64) verwandte man 670 Marderbäuche, einer seiner Söhne ließ deren 10.000 kommen, um fünf Mäntel und fünf Frauenwämse zu füttern. Die Fütterung eines Kleids für einen seiner Enkel erforderte 2790 Felle von grauen Eichhörnchen. Der ungeheure Verbrauch des Pelzwerks steigerte die Preise entsprechend. Das der Kaiserin Eugenie gehörige, ihr 1870 nach England nachgesandte Pelzwerk hatte einen Wert von 600.000 Francs.
Dem Altertume war auch die Verschwendung der Stoffe zu übermäßiger Weite und Länge der Kleider unbekannt, sowie alle jene geflissentlichen Entstellungen der Gestalt, welche der mittelalterlichen und neueren Mode so häufig beliebt haben (wie Schnabelschuhe, Pumphosen, Hüftpolster, Fischbeinröcke, Schleppkleider, Allongeperücken), und die zum Teil sehr kostspielig waren; die gewöhnliche Allongeperücke, welche der vornehme Mann trug, kostete 150 Mark, doch gab es deren auch, die 3000 Mark kosteten. Die antiken Trachten waren aber im ganzen nicht nur naturgemäßer und geschmackvoller, sondern, wenngleich auch im Altertum die Mode vielfach wechselte, sehr viel stabiler als die modernen. Die Unterschiede zwischen Generationen erscheinen hier zuweilen größer als dort zwischen Jahrhunderten. Der Luxus also, der durch den fortwährenden Wechsel der Mode bedingt ist, war im Altertume sicherlich viel geringer als im Mittelalter und in neueren Zeiten. Endlich war die antike Tracht insofern viel einfacher als die moderne, als sie aus einer geringeren Zahl von Stücken bestand. Den Luxus der Handschuhe kannte man ebensowenig wie den der Hüte und sonstigen Kopfbedeckungen; eine solche kommt z. B. im heutigen Persien wegen der drei- bis viermaligen Erneuerung auf nahe an 60 Dukaten das Jahr zu stehen. Von den an der ganzen Südwestküste von Amerika allgemein getragenen (allerdings fast unvergänglichen) Panamahüten kostet die beste Sorte 340 Dollar, auch 50 Lstr.; die am häufigsten gewählte 20-30 Lstr. Auch waren die durch den Wechsel der Jahreszeiten herbeigeführten Veränderungen der Kleidung im Süden bei weitem nicht so vielfach und durchgreifend wie im Norden. Daß sie jedoch von manchen in lächerlicher Weise bis ins Kleinste durchgeführt wurden, zeigt der Spott Juvenals über den Stutzer, der eigene Sommerringe an den schwitzenden Fingern spielen läßt, da er das Gewicht eines größeren Edelsteines nicht zu ertragen vermag.
Ein häufiger Kleiderwechsel war im Sommer durch das Klima bedingt und ohne Zweifel (wie im heutigen Persien) die Garderobe der besser Gekleideten sehr umfangreich. Ihre Kleiderpressen enthielten Mäntel von so viel verschiedenen Farben wie die Blumen einer Wiese; ebenso bunt war das Innere der mit Tafelkleidern gefüllten Truhen, und mit den Togen aus apulischer Wolle konnte man eine ganze Tribus bekleiden. Natürlich wird man auch an demselben Tage die Kleider oft gewechselt haben. Erwähnt aber wird dies nur ein einziges Mal, und zwar ist es ein Repräsentant der ungebildeten reichen Emporkömmlinge bei Martial, der während einer Mahlzeit elfmal seine Synthesis wechselt, angeblich um nicht vom Schweiße zu leiden, in der Tat aber doch nur, um den Reichtum seiner Garderobe zu zeigen. In neueren Zeiten dagegen ist der Luxus des täglichen mehrmaligen Kleiderwechsels auch ohne eine durch das Klima herbeigeführte Nötigung nicht nur nicht selten gewesen, sondern zuweilen bis ins Lächerliche übertrieben worden. Gegen das Ende des 16. Jahrhunderts klagen in Deutschland die Geistlichen darüber; im Anfange des 17. hinterließ eine Ehefrau 32 vollständige Anzüge, während ihr Mann Hans Meinhard von Schönberg deren 72 besaß, nebst ungefähr einer gleichen Anzahl mit Gold und Silber gestickter Handschuhe und 21 Hüten, wozu 26 Stück farbige Federn gehörten. Clive bestellte (zwischen 1767 und 1770) 200 Hemden, so gut und fein sie irgend für Geld und gute Worte zu haben waren. Bis zum Unsinn trieb diesen Luxus Graf Brühl, der ein Kleid nie mehr als zweimal anzulegen pflegte, und dessen Sammlungen von abgelegten Kleidungsstücken zu einem unglaublichen Umfange anschwollen. In der Revolutionszeit wurde von Frauen auch mit den Perücken täglich mehrere Male je nach der Beschaffenheit der Toilette gewechselt. Am Anfange des 19. Jahrhunderts brauchte ein englischer Dandy wöchentlich 20 Hemden, 24 Schnupftücher, 9-10 Sommertrousers, 30 Halstücher, wenn er nicht schwarze trug, 1 Dutzend Westen, und Strümpfe à la discrétion.
Der dem Süden so sehr zusagende Luxus mit prächtigen und kostbaren Farben tritt auch in dem Kleiderluxus der römischen Kaiserzeit am meisten hervor, und zwar in der Tracht beider Geschlechter. Bei Persius trägt ein vornehmer Stutzer einen hyazinthfarbenen Mantel ( laena). Bei Martial ist jemand, der für Männer nur dunkle, graue oder braune Mäntel für anständig hält, violette oder Scharlachmäntel für weibisch erklärt, ein Heuchler, der seine Lasterhaftigkeit unter der Maske der Sittenstrenge verbirgt. Einem nachts vom Gelage heimkehrenden vornehmen jungen Manne aus dem Wege zu gehen, macht (bei Juvenal) sein großes Gefolge mit vielen Fackeln und sein Scharlachmantel rätlich. Der Freund des Statius, Atedius Melior, ließ seinen Lieblingspagen Glaucias immer die schönsten Kleider tragen, bald rote, bald grüne oder purpurne. Scharlach, vor allem aber die verschiedenen Purpursorten waren am meisten geschätzt. Ein Pfund beste (tyrische, doppelt gefärbte) Purpurwolle kostete über 1000 Denar (870 Mark), eine geringere Sorte (Amethyst- oder Veilchenpurpur) nur den zehnten Teil. Martial gibt als Preis für einen tyrischen Purpurmantel von bester Farbe nur 10.000 Sesterzen (2175 Mark) an. Der Preis müßte also, wenn auch hier die in Augustus' Zeit am höchsten geschätzte Sorte gemeint wäre, in einer Weise gesunken sein, wie es kaum glaublich ist, so daß der von Martial gemeinte Purpur wohl nur eine Mittelgattung gewesen sein kann. Die so höchst kostbare echte Purpurwolle war aber auch von fast unvergänglicher Dauer, und die daraus gefertigten Gewänder konnten also wohl, wie im Orient Schale, auf Generationen vererbt werden. Allem Anschein nach sind aber ganz purpurne Kleider in der früheren Kaiserzeit sehr selten gewesen. Gewöhnlich diente der Purpur nur streifenweise oder in Bandform zu Galonierung, als Besatz, Tresse, Saum, Falbel und Franse. Den Gebrauch ganz purpurner Gewänder schränkte schon Cäsar auf gewisse Personen und gewisse Tage ein. Augustus gestattete das Ganzpurpurgewand nur den ein Amt bekleidenden Senatoren bei den von ihnen zu veranstaltenden Spielen. Tiberius suchte der vielfach übertretenen Verordnung durch sein Beispiel Nachdruck zu geben. Nero verbot sogar den Verkauf des tyrischen und Amethystpurpurs; doch unter Domitian (vermutlich schon früher) muß er wieder erlaubt gewesen sein. Marc Aurel und Pertinax ließen die kaiserlichen, jedenfalls an Purpurgewändern reichen Garderoben öffentlich versteigern.
Mit dem Kleiderluxus neuerer Zeiten hält auch der Purpurluxus des römischen Altertums keinen Vergleich aus. In Italien war in der Zeit der Renaissance »die Kleidung so kostbar wie schön, und nur mit Verachtung würden die damaligen Kleiderkünstler auf die unsrer Gegenwart herabsehen, denn im Zeitalter der höchsten Kunstentfaltung waren auch jene wirkliche Künstler; sie arbeiteten mit den herrlichsten Stoffen von Samt, Seide und Goldstickerei, während die Farbenstimmung, den Faltenwurf und die Form der Gewänder Maler angaben. Die Kleidung war daher etwas, worauf man als eine wesentliche Bedingung der Erscheinung schöner Persönlichkeit den höchsten Wert legte«. Deshalb schreiben die Berichterstatter großer Feste jener Zeit über die Kleidung nicht bloß der hervorragenden Frauen, sondern auch der Männer mit der größten Genauigkeit. Bei einem berühmten Turnier, das Lorenzo de' Medici 1469 auf der Piazza Sta. Croce zu Florenz veranstaltete, und das ihn nach seiner eigenen Angabe gegen 10.000 Goldgulden kostete, war auch die Pracht der Anzüge sehr groß; den des Giuliano de' Medici schätzte man auf 8000 Dukaten. Benedetto Salutati hatte zur Verzierung von Schabracke und Geschirr seines Pferds 168 Pfund feinen Silbers zum Preise von 16 Dukaten das Pfund verwendet, und den Wert des Geschmeides berechnete man auf 8000 Dukaten. Daß sein silberner Helm von der Hand Antonios del Pollajuolo war, zeigt, daß mit der Verschwendung Kunstliebe Hand in Hand ging. Zu der Aussteuer der Lucrezia Borgia bei ihrer Vermählung mit Alfons von Este (1501) gehörte nach dem Berichte des Agenten des Markgrafen Gonzaga an seinen Herrn unter anderm auch ein besetztes Kleid von mehr als 15.000 Dukaten an Wert, und 200 kostbare Hemden, von denen manches Stück einen Wert von 100 Dukaten hatte; jeder einzelne Ärmel (mit Goldfransen u. dgl.) kostete allein 30 Dukaten. Ein andrer Berichterstatter schätzt ein einziges Kleid der fürstlichen Braut auf 2000, einen einzigen Hut auf 10.000 Dukaten. Welchen Wert man auf Kleiderpracht legte, ergibt sich namentlich aus folgendem. Die beiden Abgesandten Venedigs zu dieser Hochzeitsfeier mußten sich vor dem versammelten Senat in ihren neuen Mänteln von karmoisinrotem Samt mit Pelzbesatz und ähnlichen Kapuzen öffentlich vorstellen. Mehr als 4000 Personen bestaunten sie im Saale des großen Rats, und auf dem Markusplatze drängte sich das Volk, um sie zu sehen. Eben diese Mäntel (von 28 und 32 Ellen Samt) brachten die Gesandten der Herzogin Lucrezia als Brautgabe dar.
In Deutschland war der Kleiderluxus in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts »auf eine fast unglaubliche Höhe gestiegen«. Nach Geiler von Kaisersberg trug manche Bürgersfrau an Kleidern und Kleinodien oft über 300 und 400 Gulden an Wert und hatte in ihren Schränken deren für mehr als 3000. In England war es in der Zeit der Königin Elisabeth nach dem Bericht eines Zeitgenossen etwas ganz Gewöhnliches, daß 1000 Eichenstämme und 100 Ochsen zur Herstellung eines Anzugs drauf gingen, und daß ein Modenarr sein ganzes Vermögen am Leibe trug. Unter Franz I. ruinierten sich die Höflinge durch ihren Kleiderluxus; sie trugen »ihre Güter und ihre Wälder auf ihren Schultern«; wenn man nicht 30 Anzüge hatte, um an jedem Tage des Monats zu wechseln, galt man in den Kreisen des Adels für nichts. Der Luxus mit Kleiderstoffen wurde gegen Ende des 16. Jahrhunderts noch sehr überboten durch die Verzierung mit Spitzenbesatz, Stickerei und Goldborten, Perlen und Juwelen, wodurch sich zugleich der Lohn der Arbeit ins Unglaubliche steigerte, so daß dieser allein bei einem männlichen Gewände 1800 Mark betragen konnte. Ein Kleid des Marschalls Bassompierre (um 1620), an dem die Stickerei so hoch zu stehen kam, kostete 42.000 Mark. Kaum minder groß war die Kleiderpracht im 17. und 18. Jahrhundert. Bei dem Einzüge der Königin Christine von Schweden in Rom (1655) sollen die Anzüge der sie empfangenden römischen Damen 500.000-600.000 Scudi, die der Prinzessin von Rossano sogar 700.000 Scudi wert gewesen sein. Bei der Ankunft der Infantin Maria Theresia Antoinette von Spanien, der Braut des Dauphins, in Paris (1745) waren die Toilettenzurüstungen so kostspielig, daß man die Kleider nur mietete. Der Marquis von Mirepoix mietete drei für 6000 Livres, von denen er jedes nur einen Tag anlegte; bei einem Galakleide des Marquis von Stainville, aus Silberstoff mit Gold gestickt, kostete das Futter aus Marderfell allein 25.000 Livres usw. Eine Modedame jener Zeit kaufte eine bestellte Robe, deren Preis sie nicht erschwingen konnte, für eine lebenslängliche Jahresrente von 600 Livres und schloß einen Kontrakt, nach welchem ihr für 24.000 Livres jährlich an jedem Tage ein neues Kleid geliefert wurde. In Frankreich herrschte von der Regentschaft bis zur Revolution der Geschmack für Spitzen, der sich oft bis zur Leidenschaft steigerte. Selbst ernste Männer huldigten ihm, man sah Magistrate von jedem Alter, die deren an Halstuch, Jabot und Manschetten bis zum Wert von 15.000 oder 20.000 Livres trugen. Kurfürst Johann Philipp von Trier (1756-68) trug Spitzenmanschetten, von denen das Paar 30, 40, auch 60 Carolines gekostet hatte. Der nordische Kleiderluxus bestand wohl vorzugsweise in der Verschwendung kostbarer Stoffe, besonders des Pelzwerks, und Kleinodien. Bei dem überaus prachtvollen Aufzuge, den Adam Rzewuski bei seiner Abschiedsaudienz als Gesandter in Kopenhagen beim Könige hielt, soll der Sattel des Pferdes 45.000 Goldgulden (405.000 Mark) wert gewesen sein. Der Preis von ein Paar Zobelfellen stieg zu Ende des 18. Jahrhunderts in Rußland bis auf 170 und mehr Rubel, ein Zobelpelz soll damals zuweilen bis 20.000 Rubel gekostet haben.
Im 19. Jahrhundert ist der Luxus der männlichen Tracht, wenn man von außerordentlichen Veranlassungen absieht, vielleicht geringer gewesen als in irgendeiner früheren Zeit; ob auch der der weiblichen, mag dahingestellt bleiben. Die Preise einzelner kostbarer Stücke von Prachttoiletten – ein Kaschmirschal 6000 Mark, der Spitzenschleier einer reichen Braut 14.700 Mark – sowie die fabelhaft klingenden Schätzungen der jährlichen Gesamtausgaben der Königinnen der Mode in den größten Städten sprechen für das Gegenteil. Auch haben wohl in keiner Zeit die großen, künstlerisch denkenden und schaffenden Frauenschneider solche Bezahlungen erhalten und eine solche Stellung eingenommen wie in Paris unter dem zweiten Kaiserreich, wo ihnen von den Damen der höchsten Kreise eine grenzenlose Verehrung und Unterwürfigkeit entgegengebracht wurde. Dem Toilettenluxus dieser Periode gegenüber erscheint der des ersten Kaiserreichs, wo die Ausgaben der elegantesten Damen (Frau von Savary und von Maret) dafür 50.000-60.000 Francs jährlich betrugen, fast ärmlich.
Im römischen Altertume war der Luxus mit orientalischen Stoffen, Produkten und Fabrikaten, die zum Schmuck im weitesten Sinne dienten (Seide, Byssus, Edelsteine, Perlen, Wohlgerüche), schon insofern beschränkt, als er ganz vorzugsweise nur von Frauen getrieben wurde; aber auch abgesehen hiervon scheint er sich nicht über enge Kreise hinaus erstreckt zu haben. Plinius macht die (wahrscheinlich auf Verzeichnissen der Grenzsteuerämter beruhende) Angabe, daß in keinem Jahre für weniger als 55 Millionen Sesterzen (etwa 12 Millionen Mark) indische Waren in das römische Reich eingeführt, und daß für arabische, indische und syrische Waren dem Reich auch bei der geringsten Berechnung jährlich 100 Millionen Sesterzen (21¾ Millionen Mark) entzogen wurden; »so viel kosten uns unsere Liebhabereien und unsere Frauen!« Selbst wenn man dieses Zusatzes wegen annehmen dürfte, daß hier nicht von allen orientalischen Luxuswaren die Rede ist, die aus Asien eingeführt wurden, sondern vorzugsweise nur von denen, die zum Schmuck, besonders der Frauen, gehörten, so würde man diese Einfuhr nicht nur nicht sehr groß, sondern auffallend gering finden müssen, wenn sie wirklich mit den angegebenen Summen ganz bezahlt worden wäre; wobei freilich der Unwille römischer Patrioten, daß jahraus, jahrein solche Summen ins Ausland, sogar in feindliche Länder flossen, immer noch sehr berechtigt wäre. Denn diesem Goldabfluß stand keine entsprechende Goldproduktion gegenüber, und seine Jahrhunderte hindurch währende Fortdauer hat ohne Zweifel zum Verfall des römischen Münzwesens im 3. Jahrhundert n. Chr. erheblich beigetragen. Freilich betrug um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Metallausfuhr nach Asien neben einem sehr bedeutenden Warenexport jährlich durchschnittlich etwa zwölfmal so viel als in der Zeit des Plinius (13⅔ Millionen Lstr.). Nach Johann von Horneck entzogen im Anfange des 18. Jahrhunderts die wollenen, leinenen und französischen Waren, »diese wahren Blutegel des österreichischen Staats«, demselben wenigstens 15-20 Millionen Gulden (und zwar die Seidenwaren 7, französische 3 Millionen). An Deutschland setzte Frankreich schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts allein an Seide- und Galanteriewaren für 67 Millionen Livres ab, und im Jahre 1913 belief sich der Wert seiner Ausfuhr allein nach Deutschland an pflanzlichen Spinnstoffen und daraus gefertigten Waren, sowie Schmuckfedern, Fächern und Hüten auf über 123 Millionen Mark.
An dem Maßstabe des modernen Verkehrs gemessen, erscheint also der Verbrauch asiatischer Luxusartikel für das ganze römische Reich überraschend gering: mögen auch die Summen der Ausgaben für den asiatischen Gesamtimport bei Plinius deshalb hinter der Wirklichkeit zurückgeblieben sein, weil der Wert der eingeführten Waren behufs der Versteuerung an der Grenze viel zu niedrig angegeben wurde, und mag die Kaufkraft des Gelds auch damals erheblich größer gewesen sein als jetzt. Denn andrerseits waren die Preise der einzelnen orientalischen Produkte damals zum Teil sehr hoch und wohl durchweg höher als gegenwärtig. Seide wurde noch in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts mit Gold aufgewogen (eine auch in der chinesischen Literatur erwähnte Tatsache); ein römisches Pfund (327 g) Malabathrumöl konnte bis 400 (348 Mark), ein Pfund Zimtsaft bis 1500 Denar (1305 Mark) kosten: es gab Perlen, die mit einigen Millionen Sesterzen bezahlt wurden. Zu solchen Preisen veranschlagt, würde die ganze jährliche Einfuhr von Luxusartikeln aus dem Orient in einem einzigen Kaufladen der Heiligen Straße oder auf dem Forum des Friedens bequem Raum gehabt haben. Nun überstiegen freilich die in Rom gezahlten Preise die Einkaufspreise um ein Bedeutendes (nach Plinius um das Hundertfache). Aber bei der Verzollung der Waren an der römischen Grenze war schon ein großer, in vielen Fällen der größere Teil des Transports zurückgelegt, folglich eine entsprechende Preiserhöhung bereits eingetreten: auf den Angaben dieser höheren Preise aber müßte die Veranschlagung der gesamten Einfuhr auf hundert Millionen bei Plinius eben beruhen. Kostete sie wirklich nicht mehr, so müßte der damalige Luxus mit orientalischen Waren und Produkten auf Rom und einige große Städte beschränkt gewesen sein. Dies scheinen allerdings noch für das Ende des 2. Jahrhunderts einige Äußerungen Galens zu bestätigen. Er sagt, daß Seide »bei den reichen Frauen« an vielen Orten des Reichs zu finden sei, besonders in den großen Städten, wo es deren viele gebe, und bezeichnet die Nardenessenz als einen der Wohlgerüche, »die in Rom für die reichen Frauen fabriziert werden«. Im 4. Jahrhundert war infolge völlig veränderter Handelsverhältnisse der Gebrauch der Seide bei allen Ständen üblich geworden.
Vielleicht hat nun aber Plinius nur angeben wollen, was der Orienthandel dem römischen Reich an barem Geld entzogen. Denn chinesische Produktenverzeichnisse des Lands Ta-Tsin (Syrien) führen zu der Annahme, daß ein nicht geringer Teil der asiatischen Einfuhr durch eine Ausfuhr aus dem Westen gedeckt wurde. Die längste dieser Listen enthält 60 Artikel, unter denen die charakteristischen Industrieerzeugnisse des syrisch-phönizischen, auch des alexandrinischen Markts leicht zu erkennen sind. Dazu gehören die Stoffe aus Ta-Tsin (die nach einem chinesischen Autor die babylonischen weit übertrafen) mit gestickten und gewirkten Mustern von Tieren, Menschen, Bäumen, Wolken usw. in verschiedenen Farben; die Glaswaren (besonders die farbigen), die in China bis zum Anfange des 5. Jahrhunderts sehr gesucht gewesen sein müssen, da sie sehr beliebt waren und die Chinesen erst damals anfingen, von indischen, vielleicht syrischen Arbeitern unterrichtet, ihren eigenen Bedarf zu decken; die sämtlichen im römischen Reiche verarbeiteten Metalle; Auripigment und Realgar (Spezialitäten Syriens); Juwelen, Gemmen und alle zum Schmucke dienenden Artikel (wie Bernstein und Korallen), von welchen das Schönste und Beste von Händlern aus Ta-Tsin gebracht wurde; endlich Drogen. Je umfangreicher man sich die Ausfuhr dieser Waren vorstellt, desto höher muß man natürlich den Wert und die Menge der in das römische Reich eingeführten asiatischen veranschlagen. Doch möchte man nach jenen Äußerungen Galens glauben, daß Einfuhr und Ausfuhr damals noch nicht sehr bedeutend waren: beide mögen erst seit dem 3. Jahrhundert große Dimensionen angenommen haben.
Der Luxus mit Perlen und Edelsteinen kam in Rom seit dem Triumphe des Pompejus über Mithridates auf. Der Diamant, obwohl nach römischer Schätzung das kostbarste unter allen Juwelen, ist, soviel wir wissen, zum Schmucke so gut wie gar nicht verwendet worden, mit Ausnahme der Ringe, und auch diese scheinen nicht häufig gewesen zu sein. Der Diamant, den Trajan als designierter Thronfolger von Nerva, und Hadrian von Trajan empfing, war allem Anschein nach in einen Ring gefaßt; einen in Juvenals Zeit vielbesprochenen Diamantring hatte die Jüdin Berenice, die Geliebte des Titus, von ihrem Bruder, dem Judenkönig Agrippa II., zum Geschenk erhalten. Den nächsten Rang behauptete unter den Steinen der Smaragd. Die nach Plinius besten (scythischen) kamen vielleicht aus den Gruben des Ural und Altai, die auch in neuester Zeit sehr schöne Smaragde geliefert haben. An dritter Stelle schätzte man den Beryll und Opal (diese beiden scheinen besonders von Frauen getragen worden zu sein), dann folgte der (auch für die Siegelringe sehr geeignete) Sardonyx: soweit stand nach Plinius, hauptsächlich auf Grund der Entscheidung der Frauenwelt, die Rangordnung fest. In der Schätzung des Diamanten sind die Römer den Indern gefolgt. Die Perser setzten ihn im 13. Jahrhundert an die fünfte Stelle, nach der Perle, dem Rubin, Smaragd und Chrysolith. Benvenuto Cellini setzt ihn nach dem Rubin und Smaragd und nur zum achten Teil des Preises des ersteren an. Auch Garcias ab Horto (1565) erklärt den Diamant zwar für den König der Edelsteine in betreff seiner Härte, doch in bezug auf Wert und Schönheit stehen der Rubin an erster, der Smaragd an zweiter Stelle. Der bis ins 16. Jahrhundert sehr hohe Wert des Smaragds (Cellini schätzt ihn auf 400 Goldscudi das Karat) sank beträchtlich durch die Zufuhr aus den Gruben Perus und ist jetzt wieder durch das völlige Aufhören der Zufuhr aus Amerika gestiegen, so daß ein vollkommener Smaragd auf dem Juwelenmarkte zu London von allen Edelsteinen im höchsten Preise steht.
Aus dem römischen Altertum ist von Preisen edler Steine äußerst wenig bekannt. Der angebliche Smaragd, in den eine Amymone geschnitten war, und den der Flötenspieler Ismenias mit 4 Goldstücken bezahlte, kann nur ein Chrysopras gewesen sein. Geschnittene Smaragde kommen kaum vor Hadrians Zeiten vor, die besten sollen Porträts von ihm und Sabina sein; vielleicht hatte Hadrian eine Vorliebe für diesen Stein, die eine eifrigere Bearbeitung seiner Hauptfundstätte (der Gruben von Dschebel Zaburah in Ägypten) veranlaßte. Der Preis eines Jaspisrings, mit dem die Statue einer Frau im südlichen Spanien von ihrem Sohn geschmückt worden war, wird auf 7000 Sesterzen (über 1500 Mark) angegeben, was einen geschnittenen Stein voraussetzen läßt. Der Senator Nonius besaß einen zum Ring gefaßten Opal von der Größe einer avellanischen (Lamberts-, d. h. lombardischen) Nuß; wegen dieses Rings wurde er von Antonius proskribiert und nahm ihn von all seinen Besitztümern allein auf der Flucht mit. Der Preis, zu dem er geschätzt war, betrug 2 Millionen Sesterzen (435.000 Mark).
Über Nachahmung von Edelsteinen macht Plinius zahlreiche und genaue Angaben und spricht von Schriften, die Anleitung dazu gaben, namentlich falschen Smaragd durch Färbung von Kristall, Sardonyx aus Karneol herzustellen: es sei dies unter allen betrügerischen Industrien die gewinnreichste. Der Kunst der Fälschung entsprechend vervollkommneten sich auch die Methoden der Untersuchung der Echtheit: die Experten unterwarfen die zu prüfenden Steine mehr als einer Probe. Unter den äußerst zahlreich erhaltenen antiken Arbeiten in gefärbten Glasflüssen zeichnen sich ganz besonders die Glassmaragde aus, die an Farbe, Glanz und Härte die modernen Glaspasten weit übertreffen und noch gegenwärtig von Gemmenhändlern häufig als wirkliche Smaragde verkauft werden. Übrigens hat auch im Altertum die Industrie der imitierten Edelsteine sicherlich nicht allein in betrügerischer Absicht gearbeitet, sondern auch um ein unter den ärmeren Klassen verbreitetes Bedürfnis nach buntem und augenfälligem Schmuck zu befriedigen.
Der größte und deshalb am meisten gerügte Luxus wurde von Frauen mit Perlen getrieben; für diese wurden höhere Preise als für irgendwelche Edelsteine bezahlt. Die Verwendung der Perlen zum Schmuck verbreitete sich in weitere Kreise erst seit der Eroberung von Alexandria, dessen Handel die Erträge der Fischereien im Persischen Meerbusen und im Indischen Ozean nun wohl ganz vorzugsweise nach Rom führte. Durch diese regelmäßig fortgehende Einfuhr mögen sich die Perlen in Rom in ähnlichen Massen gehäuft haben wie zu Ende des 16. Jahrhunderts in Venedig, wo die dortigen Patrizierinnen ungeheure Schätze davon besaßen, die Frucht des alten Handelsverkehrs mit Ormuz am persischen Golf und all den übrigen Ländern des fernen Orients, die Venedig so lange allein ausgebeutet hatte. Die Verbote der Proveditori delle Pompe (der 1514 zur Überwachung des Luxus eingesetzten Magistrate) waren hauptsächlich gegen den Perlenluxus gerichtet. Gegenwärtig ist das an Perlen reichste Land Rußland, wo man in dem einzigen Kloster Troitza an Meßgewändern, bischöflichen Kleidungen, Altar- und Grabdecken deren vielleicht mehr findet als im übrigen Europa zusammengenommen; wo in manchen Gouvernements jede Bäuerin an ihrem Kopf- und Haarschmuck wenigstens 200-300, oft aber 1000 und mehr echte Perlen trägt, und in Nischnij Nowgorod selbst die ärmsten Fischweiber zwei bis drei Schnüre echter Perlen um den Hals haben. Nero konnte sogar ganze Sänften ( cubilia viatoria) von Perlen erbauen, d. h. ohne Zweifel ihre Wände damit tapezieren. Die römischen Frauen trugen sie besonders als Ohrgehänge; nach Plinius strebten auch »arme« Frauen nach solchen, da, wie sie sagten, eine große Perle im Ohr auf der Straße die Stelle eines vorausgehenden Liktors vertrete; doch wurden sie auch an den Schuhen angebracht und nicht bloß deren Schnüre und Bänder, sondern ganze Pantöffelchen mit Perlen besetzt. Ohne Zweifel waren die dafür gezahlten Summen oft sehr hoch, Seneca sagt wohl ohne große Übertreibung, daß Frauen zuweilen zwei oder drei Besitztümer in den Ohren trügen. Nähere Angaben fehlen. Julius Cäsar kaufte in seinem ersten Konsulat im Jahre 59, wo Perlen in Rom noch selten waren, der von ihm sehr geliebten Mutter des Marcus Brutus, Servilia, eine Perle für 6 Millionen Sesterzen (1,305.000 Mark); ein solches Liebesgeschenk des ersten Manns der damaligen Welt, der auch durch großartige Extravaganzen imponieren wollte, läßt keinen Schluß auf die durchschnittlichen höchsten Preise zu. Ebensowenig gibt einen Maßstab, was Plinius von einer der Gemahlinnen Caligulas, Lollia Paulina, berichtet. Er hatte sie, und zwar nicht bei einer großen Feierlichkeit, sondern bei einem bescheidenen Verlobungsfeste, mit einem Schmuck von Smaragden und Perlen gesehen, der den ganzen Kopf, Haare, Ohren, Hals und Finger bedeckte und einen Wert von 40 Millionen Sesterzen (8,7 Millionen Mark) hatte, was sie sogleich durch Vorzeigen von Dokumenten zu beweisen bereit war. Dieser Schmuck war nicht ein Geschenk ihres kaiserlichen Gemahls, sondern ein Familienerbstück, und stammte aus den Plünderungen, die ihr Großvater M. Lollius im Orient verübt, und deren Ruchbarkeit ihm die Ungnade des C. Cäsar zugezogen und ihn gezwungen hatte, sein Leben durch Gift zu enden (im Jahre 2 v. Chr.)
Dem enormen Juwelenreichtum in den Familien jener Männer, deren Willkür die Schatzkammern orientalischer Fürsten überlassen gewesen waren, kann man aus neueren Zeiten wohl nur den Juwelenreichtum der spanischen Konquistadoren des 16. und der englischen Nabobs des 18. Jahrhunderts zur Vergleichung gegenüberstellen. Das Hochzeitsgeschenk des Cortez an seine Braut im Jahre 1529 waren fünf, von mexanischen Juwelieren höchst kunstvoll aus Smaragden geschnittene, mit Perlen und Gold verzierte Juwelen: für eins derselben hatten genuesische Kaufleute zu Sevilla 40.000 Dukaten geboten. Der ganze Schmuck ging durch einen Schiffbruch bei der Expedition gegen Algier 1541 verloren. Die Beute Nadir Schahs bei der Einnahme Delhis, die hauptsächlich aus Edelsteinen bestand, wurde in Europa auf 70 Millionen Lstr. geschätzt. Clive, der in den Gewölben von Murshadabad zwischen Haufen von Gold und Juwelen umhergewandert war, mit voller Freiheit zu nehmen, was ihm beliebte, hatte hier und sonst in Indien große Mäßigung bewiesen; doch seine Diamantenankäufe beliefen sich in Madras allein auf 25.000 Lstr., und ein Schmuckkästchen seiner Gemahlin wurde auf 200.000 Lstr. geschätzt. Vielleicht besaß Lady Clive mehr Juwelen als die größten Fürstinnen jener Zeit. Sophie Charlotte trug bei ihrer Krönung als erste Königin von Preußen (1701) einen Schmuck von Diamanten und Perlen über eine Million Taler an Wert. Das berüchtigte Halsband, das Maria Antoinette für sich zu teuer gefunden hatte, kostete nur 1,600.000 Frcs. Noch heute ist im Orient der Perlen- und Juwelenluxus, der dort unter den Kalifen enorm war, nicht gering. In Persien tragen Frauen außer anderm Schmuck Arm- und Fußbänder von Perlen, Damen vornehmen Stands auch einen Diamantenstrauß von hohem Wert; Gürtelschnallen, mit Edelsteinen besetzt, haben oft einen Wert von 1000 bis 2000 Dukaten; auch Sättel und Pferdegeschirre sind mit Gold, Perlen und Juwelen überladen. Man trägt 15-16 Ringe, je 5-6 an einem Finger, und der Schah von Persien ist noch immer der größte Besitzer von Diamanten in der Welt.
Übrigens wurde in Europa auch im Mittelalter mit Perlen, mit welchen man z. B. Texte von Liedern auf Kleider stickte, und Edelsteinen großer Luxus getrieben, der größte am Hofe Karls des Kühnen von Burgund. Sein mit Perlen und Edelsteinen besetztes Prachtgewand wurde auf 200.000 Dukaten geschätzt; die Hofdamen seiner Gemahlin erhielten für ihren Putz jährlich 40.000 Brabanter Taler. Der Luxus mit kostbarem Geschmeide stieg aber sehr nach der Entdeckung der Neuen Welt. Maria von Medici hatte sich zu der Taufe ihres Sohnes 1606 einen Brautrock machen lassen, der mit 3200 Perlen und 3000 Diamanten besetzt war und auf 60.000 écus geschätzt wurde; aber er war so schwer, daß sie es unmöglich fand, ihn zu tragen. In dem Inventar der Schmucksachen des Meinhard von Schönberg († 1625) füllt der Schmuck an Perlen allein zwei enggeschriebene Folioseiten; darunter kommen 3 Halsbänder mit Rosen von Perlen vor, 15 große Perlen wurden für 3286 Gulden verkauft. Die Kunst, Perlen nachzuahmen, ist erst 1680 von Jacquin in Paris erfunden worden, der jährliche Export dieses Fabrikats von dort soll sich auf 40.000 Lstr. belaufen.
Inwiefern der Luxus der Tracht und des Schmucks im Altertum sich auch auf die unteren Klassen erstreckt hat, namentlich inwiefern die in vielen, besonders halbzivilisierten und südlichen Ländern bestehende Sitte, einen Teil des Vermögens (zugleich als Reservekapital) am Leibe zu tragen, verbreitet gewesen ist, darüber fehlt es so gut wie ganz an Nachrichten. Doch das lange Goldgeschmeide, das nach Juvenal die in Schenken aufwartenden Mädchen in Rom am bloßen Halse trugen, war ohne Zweifel ebenso echt wie der Goldschmuck der Frauen und Mädchen der unteren Klassen im gegenwärtigen Italien. Die Bernsteinhalsbänder, die in der Zeit des älteren Plinius die lombardischen Bäuerinnen im Norden des Po (zugleich als angebliches Mittel gegen Anschwellungen des Halses) trugen, waren schwerlich kostbar.
Der Luxus der Wohlgerüche ist seit den ältesten Zeiten im Orient heimisch gewesen. Arabien war, wie bereits Herodot wußte, das mit Wohlgerüchen am meisten gesegnete Land und selbst im höchsten Altertume dort die Vorliebe für feines Räucherwerk und Wohlgerüche allgemein verbreitet. Nach dem Buch Esther wurden die für das Bett des großen Königs bestimmten Frauen ein ganzes Jahr lang mit Wohlgerüchen »geschmückt«; sechs Monate mit Balsam und Myrrhen und sechs Monate mit »guten Spezereien«. Nach dem Talmud war es der jungen Ehefrau gesetzlich gestattet, ein Zehntel ihres eingebrachten Guts hierauf zu verwenden. In Rom ist dieser Luxus aber nicht erst mit dem übrigen asiatischen Luxus aus dem Orient, sondern schon viel früher aus Großgriechenland eingedrungen. In der Kaiserzeit dürfte er außerhalb Roms, wie gesagt, nur in den größten Städten vorgekommen sein. Nach Plinius wandten die Römerinnen Wohlgerüche so reichlich an, daß die Nähe einer vorübergehenden Frau (wie jetzt einer vornehmen Araberin) durch die aus ihren Haaren und Kleidern strömenden Düfte sich auch denen bemerkbar machte, deren Aufmerksamkeit anderweitig in Anspruch genommen war. Er fand diesen Luxus um so törichter, als der teuer erkaufte Genuß nicht nur bloß ein augenblicklicher sei, sondern auch andern weit mehr zugute komme als dem, der ihn bezahlt habe. Auch Männer machten von Parfümerien reichlichen Gebrauch, namentlich von Balsam und Zimt; der Günstling Domitians, Crispinus duftete nach der Morgentoilette stärker als zwei Leichenbegängnisse. Dasselbe ist dann wieder in der Renaissancezeit geschehen; der Vetter der Marchese von Pescara, Alfonso d'Avalos, wollte Wohlgerüche selbst im Kriege nicht entbehren, sogar die Sättel seiner Pferde dufteten von Essenzen. Die hohen Preise der teuersten Wohlgerüche im alten Rom sind bereits angegeben. Martial überlegt, ob er seiner Phyllis »10 Gelbe aus der Münze des Kaisers« (etwa 210 Mark) oder 1 Pfund (327 g) aus den Läden der damals berühmtesten Salben- und Essenzenhändler Cosmus oder Niceros schenken solle. In diesen Läden mögen manche Frauen ebenso hohe Rechnungen gehabt haben, wie Marion de Lormes, die in einem Jahre einem einzigen Parfümeur 150.000 Mark schuldig war. Von der Verschwendung der Wohlgerüche bei Totenbestattungen wird unten die Rede sein.
Doch dem orientalischen Luxus der Wohlgerüche ist der europäische offenbar weder im Altertum noch in neueren Zeiten gleichgekommen. In den Gemächern der reichen Araber standen in der Zeit der Kalifen immer, besonders an Empfangstagen, Gefäße mit stark duftendem Inhalt (meistens Moschus) oder Rauchpfannen mit Aloeholz. Selbst die strengen Gesetzesgelehrten hielten nach dem Beispiel des Propheten (dem außer den Weibern Wohlgerüche als das einzige galten, was immer für ihn Reiz hatte) darauf, stets gut parfümiert zu sein. Vor und nach dem Speisen hielt man die Kleider über eine Rauchpfanne oder beugte den Körper über dieselbe. Ebensowenig wie starkriechende Blumen durfte feines Räucherwerk an der Tafel fehlen; es wurde mit Gold aufgewogen, und man bediente sich dessen zu kostbaren Geschenken. In reichen Häusern hatte man stets einen Vorrat der verschiedenen Arten, wie graue Ambra, Aloeholz, Moschus, Kampfer, gelbe Ambra (Bernstein), und verschiedener Mischungen von wohlriechenden Stoffen, namentlich Zibet. In der Industrie der Parfümerien beherrschten in der ersten Zeit des Kalifats Irak und Persien, dessen Rosenwasser bis Spanien und China versandt wurde, den Markt, später nahm in dieser wie in allen Luxusindustrien das maurische Spanien die erste Stelle ein. Gegenwärtig gibt manche arabische Dame jährlich 500 Dollar für Parfümerien aus.
Die Nachrichten über den römischen Luxus der Tracht und des Schmucks lassen, unzusammenhängend und dürftig wie sie sind, auch nur eine sehr unvollkommene Beurteilung zu. Zu der Annahme, daß die antike Welt die moderne in diesem Luxus im allgemeinen überboten habe, geben sie durchaus keinen Anlaß, vielmehr lassen sie weit eher glauben, daß auch hier der Luxus der römischen Kaiserzeit den mancher Periode der neueren Zeit keineswegs erreicht hat.
a) Städtische Paläste
Die ersten Anfänge des Luxus in der inneren Einrichtung der Wohngebäude reichen in die Zeit zwischen dem ersten und zweiten punischen Kriege zurück: schon damals gab es Häuser, die »mit Citrus, Elfenbein, punischen Estrichen« geschmückt waren. Doch der Luxus der Bauten scheint erst im letzten Jahrhundert v. Chr. begonnen zu haben; bis dahin waren die Wohnungen selbst der Vornehmen ebenso einfach wie wohlfeil. Sulla (geb. 138), der allerdings als junger Mann in sehr knappen Verhältnissen lebte, bewohnte noch ein Erdgeschoß (das vornehmste Stockwerk) für eine Jahresmiete von 3000 Sesterzen (525 Mark), im Oberstock desselben Hauses wohnte ein Freigelassener für 2000 Sesterzen (348 Mark). Der Travertin wurde bereits im letzten Jahrhundert der Republik je länger je mehr bei Bauten, besonders zur Verkleidung der Fassaden, verwandt; dagegen der Marmor noch so gut wie gar nicht. Noch ums Jahr 92 v. Chr., nach so vielen Feldzügen und Siegen in den an Säulenbauten überreichen griechischen und orientalischen Ländern, hatte nach Plinius kein öffentliches Gebäude in Rom Marmorsäulen. Um so mehr Anstoß gab es, daß der damalige Zensor L. Crassus, einer der ersten Männer des Staats, das Atrium seines Hauses auf dem Palatin zuerst mit sechs Säulen aus hymettischem Marmor schmückte, die er übrigens nicht zu diesem Zwecke, sondern für das in seiner Ädilität erbaute Theater hatte kommen lassen; er wurde deshalb von Cn. Domitius, seinem Kollegen in der Zensur, scharf getadelt, von M. Brutus mit dem Spottnamen »Palatinische Venus« belegt. Das Haus des Crassus stand jedoch dem Hause des Besiegers der Cimbern, Q. Catulus, Konsul 102 (ebenfalls auf dem Palatin), und dem des rechtsgelehrten Ritters C. Aquilius (auf dem Viminal) nach, welches letztere damals allgemein für das schönste in Rom galt. Dann war im Jahre 78 das Haus des damaligen Konsuls M. Lepidus das schönste, dessen Schwelle aus dem bisher in Rom unbekannten numidischen Marmor (Giallo antico) ebenfalls viel üble Nachrede veranlaßte.
Aber 35 Jahre später gab es schon mehr als hundert schönere Häuser in Rom. Diese riesenhafte Zunahme der Pracht und des Luxus der Bauten, die ihm bei der Kürze des menschlichen Lebens doppelt töricht erschien, berichtet Plinius als eins der größten Wunder in der Geschichte der Stadt. Das Wunderbare ist vielmehr, daß Rom, schon lange seiner Bedeutung nach die erste Stadt der Welt, in baulicher Hinsicht bis dahin so sehr zurückgeblieben war, so daß nun die Veränderungen der Privatbauten plötzlich in großem Umfange erfolgten, die sonst in aufblühenden Städten mehr allmählich einzutreten pflegen, wie sie z. B. Macaulay für die englischen in seiner Darstellung der seit dem Ende des 17. Jahrhunderts so gewaltig fortgeschrittenen Kultur mehrfach nachgewiesen hat. In Rom wurde die Versäumnis aller früheren Zeiten in einem einzigen Menschenalter nachgeholt. Jene 35 Jahre vom Konsulat des Lepidus (dem Todesjahre Sullas) bis zum Todesjahre Julius Cäsars (78-44) waren eine Zeit der größten Eroberungen und Erwerbungen im Orient und Okzident. Es war die Zeit der Kriege des Q. Metellus Creticus, P. Servilius Isauricus, Pompejus und Lucullus im Osten, des Julius Cäsar in Gallien; das Reich erhielt die neuen Provinzen Bithynien und Pontus, Kreta, Cilicien und Syrien. In diesen Kriegen erbeuteten Feldherren, Offiziere, Zivilbeamte und Geschäftsleute – wie Pompejus' Freigelassener Demetrius, der 4000 Talente, d. i. 18,860.000 Mark hinterlassen haben soll – ungeheure Reichtümer, die zum Teil zu den glänzendsten öffentlichen Bauten (selbst temporären, wie das überprächtige Theater des Scaurus 58) verwandt wurden. Doch diese Pracht und Großartigkeit teilte sich schnell auch den Privatbauten mit. Die größten der 360 Säulen (von mehr als 11 Meter Höhe), mit denen er seine Bühne geschmückt hatte, ließ Scaurus in dem Atrium seines Hauses auf dem Palatin aufstellen; sie waren aus dem schwärzlichen Marmor von der Insel Melos, den zuerst Luculi in Rom eingeführt hatte, und der daher der Lucullische hieß. Der erste, der in seinem ganzen Hause (auf dem Cälius) nur Marmorsäulen hatte, und zwar Monolithe aus grün geädertem Cipollino (aus Carystus auf Euböa) und carrarischem Marmor, war der römische Ritter Mamurra aus Formiä, Cäsars Feldzeugmeister in Gallien. Sein Haus legte, wie Plinius sagt, ein beredteres Zeugnis von seinen schamlosen Plünderungen in Gallien ab als die bitteren Verse, in denen Catull sie ihm vorwarf. Er war auch der erste, der ganze Wände mit Marmortafeln auslegte, also die (alexandrinische) Inkrustation in Rom einführte. Sallust konnte bereits von Palästen sprechen, die nach Art ganzer Städte gebaut seien. Mit der Zunahme der Bauten stieg auch der Wert des Baugrunds – der Boden des in der belebtesten Gegend von Julius Cäsar erbauten Forums kam auf 100 Millionen Sesterzen, d. h. 17½ Millionen Mark zu stehen – und die Höhe der Wohnungsmieten. Sie war in Rom durchschnittlich viermal so hoch als in den Städten Italiens. Cälius wohnte in einem Miethause des Clodius nach Ciceros Angabe für 10.000 Sesterzen (1750 Mark) bescheiden, seine Ankläger hatten das Dreifache angegeben und ihm dies als Verschwendung vorgeworfen, zugleich damit Clodius sein Haus höher verkaufen könne. Cicero kaufte sein Haus auf dem Palatin von Crassus für 3⅓ Millionen Sesterzen (614.000 Mark). Als er es bei seiner Rückkehr aus der Verbannung als Ruine wiederfand, bot ihm der Senat 2 Millionen Entschädigung, wobei also der Wert des Bodens auf 1½ Millionen (= 43 Prozent der Gesamtsumme) veranschlagt worden wäre.
Einen neuen großen Aufschwung nahm das Bauwesen in Rom nach der Schlacht bei Actium, nicht bloß infolge des durch den Weltfrieden wiederkehrenden Gefühls der Sicherheit, des steigenden Wohlstands, des Wachstums der Bevölkerung, des Zuströmens von Kapitalien, sondern auch infolge des von Augustus ausgehenden Strebens, Rom mit dem Glanz und der Pracht auszustatten, welche die Würde der Hauptstadt einer Weltmonarchie erforderte, die Lehmstadt in eine Marmorstadt zu verwandeln. Im Zusammenhang mit diesem steigenden Bauluxus stand die, wie es scheint, im großen wohl erst in der späteren Zeit des Augustus betriebene Ausbeutung der von Vitruv noch gar nicht erwähnten Brüche von Carrara, deren Blöcke und Balken sowie sonstiges Baumaterial zur See nach Ostia und von da stromaufwärts nach Rom geschafft wurden.
Die Gedichte des Horaz, Tibull und Properz, die diesem Zeitraume angehören, sind voll von den Eindrücken, die der nun in weiten Kreisen sich verbreitende Bauluxus auf die Freunde der früheren Einfachheit machte. Die »in neuer Art« gebauten Atrien großer Paläste imponierten durch ihre Höhe; vielleicht war das des Scaurus das erste derselben gewesen, der Abstand seiner Höhe von 38 röm. Fuß (= 11,25 m) von der des Atriums des Crassus (12 röm. Fuß = 3,5 m) entspricht dem Abstände des Palastes vom Bürgerhause und hatte notwendigerweise auch eine Vergrößerung der übrigen Dimensionen zur Folge. In diesen Atrien erregten Wandpfeiler von phrygischem (violett geflecktem) Marmor (Pavonazzetto) neidisches Staunen. Balken aus (weißem) hymettischem Gestein belasteten Säulen aus rötlich-gelbem und aus grün geädertem Marmor und aus Serpentin, die in Numidien, auf Euböa und am Vorgebirge Tänarum gebrochen waren. An den vergoldeten Felderdecken, wie man sie zum ersten Male nach der Zerstörung Karthagos am kapitolinischen Juppitertempel gesehen hatte, glänzte Elfenbein. Zwischen den bunten Säulen der Höfe standen Gebüsche und Baumgruppen, plätschterten Springbrunnen, und Purpurdecken, von einem Säulendach zum andern gespannt, hielten die Sonnenstrahlen ab und warfen einen roten Schimmer auf das Pflaster oder den Moosteppich des Bodens. Wie allgemein die unter Sulla in Rom aufgekommenen Mosaikfußböden damals waren, mag man daraus entnehmen, daß Cäsar sie sogar auf Feldzügen mit sich führte, um sie in seinen Zelten auslegen zu lassen. Mit den Schilderungen des Horaz, Properz und Tibull stimmen die gleichzeitigen Angaben und Vorschriften für den Bau eines vornehmen Hauses, die Vitruv gibt, wohl überein. Für Männer von hohem Stande, sagt er, muß man königliche hohe Vorhöfe, sehr weite Atrien und Peristylien, Parks und geräumige Wandelbahnen von imposanter Wirkung, ferner Bibliotheken, Gemäldegalerien, Basiliken in derselben Großartigkeit wie bei öffentlichen Bauten anlegen. Der Palast des Freundes des Augustus, des Ritters Vedius Pollio, bedeckte »mehr Raum, als viele Städte mit ihren Mauern umschließen«; seine Stelle nahm später die von Augustus erbaute Kolonnade der Liva ein. Auch in bescheidenen Wohnungen war, wie man es in Pompeji sieht, die Zahl der für einzelne Lebenszwecke hergerichteten Zimmer eine verhältnismäßig große, die freilich bei der Kleinheit der nicht für die Repräsentation bestimmten Räume doch nur einen beschränkten Flächenraum einnahmen.
Der Luxus der Paläste war aber während der Zeit von Augustus bis auf Neros Tod in vielen Stücken noch sehr im Steigen begriffen, da die großen Familien damals noch durch fürstliche Pracht zu glänzen und einander zu überbieten strebten; und wenn auch seit Vespasian eine Abnahme des Luxus überhaupt eintrat, so werden nichtsdestoweniger auch später noch Prachtbauten genug entstanden sein, die sich mit den früheren messen konnten. Gegen das Ende von Tiberius' Regierung sagt Valerius Maximus, daß ein Palast, der mit seinem ganzen Zubehör (d. h. namentlich Garten) vier Morgen (= 1 Hektar) Lands einnahm, für eine enge Wohnung galt. Wenn dies übertrieben sein mag, so ist die gleichzeitige Äußerung des Vellejus Paterculus gewiß buchstäblich zu nehmen: wer für eine Jahresmiete von 6000 Sesterzen (1305 Mark) wohne, werde kaum für einen Senator gehalten. Diese Äußerung ist freilich zugleich geeignet, vor zu weitgehenden Vorstellungen von der Allgemeinheit des Luxus der Wohnungen zu warnen, da im heutigen London, Paris, Wien oder Berlin auch wohl die drei- oder vierfache Summe für einen Würdenträger von dem Range eines römischen Senators zur Jahresmiete kaum hinreichen würde. In Jahre 1462 betrug dieselbe für die von Edelleuten bewohnten Häuser in Venedig 50-120 Dukaten (600-1440 Frcs.) 1658 zahlte der venezianische Gesandte für das von ihm bewohnte Haus in Paris jährlich 400 Doppie (4400 Frcs.); diese wie jene Summen entsprechen höhern in heutigem Gelde. Dagegen zahlte die Gemahlin des russischen Gesandten in Wien dort 1852 für ihre Wohnung eine Miete von 11.100 Gulden Konventionsmünze (damals etwa so viel wie 9000 Mark). Bismarck wohnte als Bundestagsgesandter in Frankfurt 1851 für 4500 Fl. (für Frankfurt billig) und zahlte in Petersburg für das möblierte Hotel Stenbak 7000 Rubel als Miete, der Herzog von Ossuña für das seine (ebenfalls möblierte) 12.000. Im Jahre 1883 gab es in Paris 9985 Steuerzahler, deren Wohnungsmiete 4000 bis 8000 Frcs. betrug; 1413 Wohnungen kosteten 10.000-25.000 Frs. jährlich, etwas über 400 mehr als die letztere Summe.
Ob in Rom der Umfang der Paläste seit der Zeit des Tiberius noch zugenommen hatte, läßt sich mindestens aus der Phrase Senecas, daß sie Städten gleich waren, die Ausdehnung von Landgütern hatten, nicht entnehmen, da ja schon Sallust sich ähnlich ausdrückt. Die Bauart der großen römischen Häuser rechtfertigt diese rhetorischen Übertreibungen wenigstens einigermaßen. Schon weil sie in der Mitte immer, zuweilen wohl auch auf den Flügeln, nur ein Stockwerk hatten, nahmen sie stets ein verhältnismäßig großes Areal ein, sodann weil ihnen wohl gewöhnlich Gärten und Parks nicht fehlten und sie auch sonst eine Menge von Baulichkeiten und Anlagen umschlossen, wie sie ja zum Teil Vitruv schon erwähnt, wie Springbrunnen, Bäder, Säulenhallen und Fahrbahnen; wo denn freilich zuweilen bei aller Pracht und Großartigkeit die eigentlichen Wohnräume zu kurz gekommen waren. Den von seinem Gönner Sparsus bewohnten Petilianischen Palast nennt Martial ein Königreich. In dem Palast der Voilentilla ruhten die Giebeldächer auf unzähligen Säulen, hauchten alte Haine Kühlung aus, sprangen lebendige Quellen in Marmorbecken, war es in der Hundstagshitze kühl und im Winter lau.
Angaben über Werte und Preise solcher Besitzungen in Rom fehlen. Für den Preis von 100.000 Sesterzen (= 21.750 Mark), den Martial einmal angibt, kann nur ein kleines, ohne Luxus gebautes Haus, und auch für den doppelten Preis kein glänzendes zu haben gewesen sein. Denn nach Juvenal konnte ein Bad allein 600.000 Sesterzen (130.500 Mark) kosten, ein Säulengang noch darüber; und daß diese Summen nicht zu hoch, vielmehr für manche derartige Bauten zu niedrig gegriffen sind, zeigt die Angabe, daß Fronto, ein nicht reicher Senator, ein Bad für 350.000 Sesterzen (76.125 Mark) baute, noch mehr aber die unten anzuführende Beschreibung des Bads des Claudius Etruscus.
Ein Luxus aber, der wohl in der ganzen Geschichte der Baukunst ohne Beispiel ist, wurde mit der architektonischen Dekoration getrieben. Mit dem Gebrauch des farbigen Marmors zu Säulen kam auch die altasiatische Bekleidung der Wände mit bunten Steinarten und andern kostbaren Materialien auf, die sich ebenfalls unter Augustus zu verbreiten anfing. Vitruv berücksichtigt sie noch nicht; zuerst eifert Seneca gegen den Luxus der Wände, »die von mächtigen und kostbaren Marmorfüllungen strahlen, in denen alexandrinische Tafeln mit numidischen kontrastieren«. Neben den Bekleidungen der Wände mit Marmortafeln aus dem Vollen wurde es bereits unter Claudins Mode, Stücke aus ganzen Platten herauszuschneiden und die Vertiefungen mit andern Steinen auszulegen; so war man imstande, allerhand Gegenstände und Tiere darzustellen und, wie Plinius sagt, »mit dem Steine zu malen«. Zwei in dieser Weise eingelegte Marmorinkrustationen sind auf dem Palatin gefunden worden. Unter Nero wurden dann durch Einsetzen von bunten Adern und Drusen in Tafeln von anders gefärbten Gesteinsarten Phantasiemarmore hergestellt.
Überhaupt aber nahm die Verschwendung kostbarer und seltener, namentlich farbiger Steinarten im Laufe des 1. Jahrhunderts ungemein zu. In einem von dem Freigelassenen Caligulas, Callistus, erbauten Speisesaal sah Plinius dreißig Säulen aus orientalischem Alabaster; vier kleinere Säulen aus diesem Stein hatte Cornelius Balbus in seinem (unter Augustus erbauten) Theater der Merkwürdigkeit halber aufstellen lassen. Mit den Erwerbungen neuer Länder wuchs auch die Zahl der von den Römern ausgebeuteten Steinbrüche. So gewannen sie aus den Brüchen des Gebirgsrückens in der arabischen Wüste Ägyptens am Dschebel Dokhan Porphyr, am Dschebel Fatireh Granit, bei Hamamat die in Rom sehr beliebte ägyptische Breccia, am Dschebel Urakan den begehrten honigfarbenen orientalischen Alabaster. Doch sind die beiden ersteren Brüche erst unter Claudius eröffnet und so ohne Zweifel im Laufe der Kaiserzeit zahlreiche neue (wie unter Marc Aurel in Numidien) in Angriff genommen worden. Nach den vorhandenen Überresten müssen mehr als vierzig in Betrieb gewesen sein, die für die Architektur Roms Luxusmaterial lieferten. In dem kleinen prachtvollen Bade, das Claudius Etruscus erbaute, waren nach der Beschreibung des Statius oft gesehene, wenn auch kostbare Marmorarten angeblich als zu gering gar nicht verwendet, wie der thasische, carystische, der Schlangenmarmor ( ophites) und jener Alabaster ( onyx). Kaum war der grüne lakonische Serpentin zugelassen, um große Tafeln des weißen, violett gefleckten synnadischen (Pavonazzetto) in langen Leisten einzufassen; auch sah man hier einen schneeweißen phönizischen Marmor, den Plinius noch nicht zu kennen scheint. Die Gewölbe glänzten mit bunten Bildern aus Glasmosaik, aus silbernen Röhren sprang das Wasser in silberne Becken, durch das von Marmor eingefaßte Bassin war fließendes Wasser geleitet, so klar, daß man das bloße Marmorpflaster zu sehen glaubte; der Ballspielsaal hatte einen von unten zu erwärmenden Fußboden. Daß die Verschwendung bunter Steinarten bei Prachtbauten damals durchaus gewöhnlich war, zeigen andre Beschreibungen des Statius und Martial. Nach dem ersteren prangte der Palast der Violentilla mit afrikanischem, phrygischem und lakonischem Stein, mit Onyx und Marmorarten, die mit der Farbe des Meers und des Purpurs wetteiferten. Bei dem letzteren baut ein reicher Mann Thermen aus carystischem, synnadischem, numidischem, lakonischem Marmor. Von den Villen jener Zeit und von Domitians Palast wird unten die Rede sein. Unter Hadrian mag der Luxus der farbigen Steinarten seine größte Höhe erreicht haben, beliebt aber ist er bis ins späte Altertum geblieben.
Erst im Jahre 1867 hat die Entdeckung des antiken Marmorlagers am Flußhafen des Tiber unter dem Fuße des Aventin einen neuen, überraschenden Einblick in die Marmorpracht des kaiserlichen Rom gewährt. Man hat dort ungefähr 1000 Steinmassen gefunden, unter den Arten herrschen die zu architektonischen Zwecken dienenden farbigen ganz überwiegend vor. Wahrscheinlich ist der Neronische Brand im Jahre 64 die Veranlassung zur Einrichtung dieses Marmorlagers gewesen; doch bildete es nur den Teil des kaiserlichen Depots, in welchem sich die Sendungen aus Asien, Afrika und Griechenland (und selbst diese nicht vollständig) befanden, wogegen ägyptischer und carrarischer Marmor dort ganz fehlt. Benutzt wurde die Niederlage bis zum Anfang des 3. Jahrhunderts, und was hier an Marmor gefunden ist, kann man als den Überschuß ansehen, der von den ungeheuren Lieferungen aus den Steinbrüchen bei den Bauten der Flavier und Antonine nicht zur Verwendung gekommen ist. Daneben geben auch die wenngleich dürftigen Überreste des Marmorschmucks des Kaiserpalastes von der Größe und Mannigfaltigkeit dieser Pracht eine Vorstellung. Auch in den Provinzen ist neben einheimischen Steinarten fremder, namentlich carrarischer und griechischer Marmor, und wahrscheinlich in sehr reichem Maße, zur Verwendung gekommen. Die Wände der römischen Villen in der Gegend von Zürich sind bis zur Brusthöhe mit schön geschliffenen Tafeln von Juramarmor bekleidet, doch die reicheren, sowie die Bäder zu Baden, auch mit italienischen geschmückt. In dem Garten des erzbischöflichen Palastes zu Narbonne erinnern großartige Architekturtrümmer aus den Brüchen der Pyrenäen, Afrikas, Carraras und Griechenlands an den einstigen Glanz der römischen Marsstadt Narbo.
Die Anwendung des Glases zu dekorativen Zwecken wurde ebenfalls früh übertrieben. Schon Seneca spricht von gewölbten Decken, die hinter Spiegelglas verschwinden. »Der Boden Roms ist gleichsam übersäet mit Glasscherben, Resten von Wand- und Fußbodenbekleidungen aus künstlich gemustertem und skulpiertem Glase. Zu Veji fand man einen Fußboden von kompaktem Glase von der Größe des Zimmers. Kameenartig geschliffene, zweifarbige Gläser (nach Art der Portlandvase) finden sich zum Teil noch mit den Stucküberresten der Mauer, in die sie gefügt waren. Auch fehlt es nicht an Bruchstücken echter Glasmalerei«. Die Übertragung von Glasmosaik auf Gewölbe erwähnt Plinius als neue Erfindung. Derselbe erwähnt auch bereits die Bekleidung der Wände mit vergoldeten Platten, einen Luxus, der in dem Goldenen Hause Neros seinen Höhepunkt erreichte. »Auf dem Palatin fand man unter andern Trümmern eine ganz mit Silberblech inkrustierte Stube, und in das Silber waren edle Steine eingelassen ... Im 17. Jahrhundert fand man auf dem Aventin eine Stube, deren Wände hinter vergoldeten Bronzeplatten mit inkrustierten Medaillen verschwanden.« Auch andre Erfindungen eines ausschweifenden Luxus der Architektur rühren wohl aus Neros Zeiten her: so die Konstruktion beweglicher Felderdecken, besonders in Speisesälen, die dann bei jedem Gange der Mahlzeit einen andern Anblick boten. Zuweilen kontrastierten in den Palästen jener Zeit mit dieser Überpracht sogenannte »Armenzimmer«, deren künstliche Einfachheit ohne Zweifel den Glanz der übrigen Räume noch wirksamer machen sollte.
Doch all dieser Glanz erblich vor der Feenpracht der beiden Paläste Caligulas und Neros, »welche die ganze Stadt umfaßten«. Von dem ersteren wissen wir wenig. Der letztere, das »Goldene Haus«, nach dem Brande im Jahre 64 von neuem begonnen, lag im wesentlichen auf der Velia, dem Esquilin und dem zwischen beiden gelegenen Tale; auf dem Esquilin schloß er sich an die kaiserlichen Gärten des Mäcenas an und wurde von mehreren Straßen durchschnitten. Auf dem Vorplatz stand ein Koloß Neros von 120 Fuß (= 35 m) Höhe. Der Palast schloß unter andern dreifache Säulenhallen von der Länge einer römischen Meile (1480 m) ein; einen Teich »gleich einem Meer« (an dessen Stelle später das Flavische Amphitheater stand), umgeben von Gebäuden, nach Art einer Stadt; ländliche Anlagen mit Feldern, Weingärten, Wiesen und Wäldern, darin eine Menge zahmer und wilder Tiere aller Art. Säle und Zimmer waren mit Gold überzogen, mit Edelsteinen und Perlmutter ausgelegt. Die herrlichsten, aus Griechenland und Kleinasien zusammengeraubten Bildwerke waren zur Dekoration verwandt. Von den damaligen bei der Ausschmückung beschäftigten Künstlern nennt Plinius einen durch seine blühende Farbe ausgezeichneten Maler Famulus (vielleicht Fabullus). Reste von bemalten Wänden, die unter den Thermen des Titus und Trajan verborgen waren, zeigen einen dem letzten pompejanischen Stil verwandten, doch vornehmeren und gehalteneren Charakter, sowohl in den umrahmten Bildern wie in der Ornamentik, aus der Raffael und Giovanni da Udine Anregungen und Vorbilder für ihre »Grotesken« entnommen haben. Neue Erfindungen und Entdeckungen wurden hier verwertet: ein Fortunatempel war aus einem in Kappadocien gefundenen, so durchscheinenden Steine erbaut, daß er auch bei geschlossenen Türen hell blieb. Die elfenbeinerne Täfelung der Decken der Speisesäle konnte verschoben werden, um Blumen oder aus Röhren wohlriechende Wasser auf die Speisenden herabzuschütten. Der Hauptspeisesaal war ein Kuppelsaal, der sich Tag und Nacht um seine Achse drehte. Die Bäder enthielten Meer- und Mineralwasser. Als der Palast soweit vollendet war, daß Nero ihn beziehen konnte, äußerte er seine Zufriedenheit dahin, daß er sagte, er fange nun an, wie ein Mensch zu wohnen. Otho bewilligte zur Fortsetzung des Baus 50 Mill. Sesterzen (gegen 11 Mill. Mark), Vitellius fand das bereits Fertige einer kaiserlichen Wohnung unwürdig, Vespasian ließ den größten Teil einreißen, und er und Titus ersetzten das Zerstörte durch Gebäude, die dem Vergnügen des Volks gewidmet waren. Das Amphitheater erhob sich, wie gesagt, an der Stelle des Teichs, die Thermen des Titus auf dem Esquilin. Den Koloß Neros verwandelte Vespasian in einen Sonnengott, sein Postament ist noch vorhanden.
Unter den Palastbauten der späteren Kaiser zeichneten sich die Domitians durch ihre Pracht aus. Plutarch sagt, daß in dem von ihm erbauten (vierten) Juppitertempel auf dem Kapitol die Vergoldung mehr als 12.000 Talente (etwa 56½ Mill. Mark) gekostet habe; doch wer erst in seinem Palast einen Säulengang oder eine Halle, ein Bad oder eine Wohnung seiner Maitressen sähe, der müsse sagen: der Erbauer habe gleich Midas seine Freude daran gefunden, durch seine Berührung alles in Gold zu verwandeln. Die Decke des Speisesaals in diesem Palaste, von kolossaler Spannweite, mit einer großen Lichtöffnung, ruhte nach Statius' preisender Schilderung nicht auf sehr zahlreichen Säulen, aber auf so gewaltigen, daß sie den Himmel stützen könnten; dort wetteiferte numidischer, synnadischer, chiischer, carystischer Marmor und Granit aus Syene, nur die Postamente der Säulen waren aus carrarischem Stein: die Höhe so groß, daß der ermüdete Blick kaum die vergoldeten Deckenfelder erreichen konnte.
b) Villen und Gärten
War aber in Rom selbst der Bauluxus durch die verhältnismäßige Beschränktheit des Stadtgebiets und den hohen Wert des Bodens vielfach behindert, so konnte dagegen auf den ungeheuren Gütern der Großen die Leidenschaft des Bauens sich an den Villen um so schrankenloser befriedigen. Durch die Ungesundheit Roms im Sommer und Frühherbst wurde die Neigung zum Landleben genährt, eine regelmäßige Villeggiatur für die höheren Stände zum Bedürfnis. Ausgedehnte Besitzungen gewährten schon in der letzten Zeit der Republik die Wahl zwischen verschiedenen, gleich anmutigen Aufenthalten. Die Zunahme der Villenbauten trieb die Preise der günstig gelegenen Grundstücke sehr in die Höhe. Wenn freilich Luculi für die Misenische Villa des Marius, die von Cornelia, der Mutter der Gracchen, mit 75.000 Denar bezahlt worden war, 2,500.000 Denar zahlte, so ist unberechenbar, wieviel Verschönerungen und Bauten zu einer so enormen Preissteigerung beigetragen haben mögen.
Noch mehr griff nach der Schlacht bei Actium die Baulust in ganz Italien um sich. Bald, meinte Horaz, würden die fürstlichen Paläste dem Pfluge nur wenige Morgen Lands übriglassen, überall künstliche Teiche, größer als der Lucrinersee, sich ausdehnen, die Platane überall die rebenumschlungene Ulme verdrängen, an Stelle fruchtbarer Ölpflanzungen Myrten- und Lorbeerhaine Schatten und Violenbeete Duft verbreiten, an Stelle des naturwüchsigen Rasens Säulenhallen, vor Sonne und Nordwind Schutz gewährend, sich erheben. Die Senatoren wurden überdies wiederholt durch Senatsbeschlüsse und kaiserliche Verordnungen zu Güterankäufen in Italien genötigt, und diese Erwerbungen bewirkten natürlich auch eine Vermehrung der Villenbauten. Wollten sie im Hochsommer die reine Gebirgsluft des Sabiner- oder Albanergebirgs atmen, im Frühling oder Spätherbst von der schmeichelnden Wärme des süditalischen Himmels umfangen sein, in der berauschenden Schönheit und Pracht der Küste des Golfs von Neapel schwelgen, in der Abgeschiedenheit und Stille der Platanenhaine an einem oberitalischen See das Getriebe Roms vergessen: überall standen wohnliche Landhäuser oder glänzende Paläste zu ihrem Empfange bereit. Der jüngere Plinius, der nur ein mäßiges Vermögen besaß, hatte Besitzungen in Etrurien (bei Tifernum Tiberinum), bei Comum, im Beneventanischen, mehrere Villen am Comersee und einen Landsitz bei Laurentum. Der in jener Zeit viel genannte Redner Regulus, dessen Vermögen sich auf beinahe 60 Millionen Sesterzen (über 13 Millionen Mark) belief, besaß Güter in Umbrien, in Etrurien, bei Tusculum und in der Campagna an der Straße nach Tibur.
Nicht selten wurde der Luxus und die Kostspieligkeit der Villenbauten durch die Überwindung von Bodenschwierigkeiten gesteigert. Schon Sallust spricht von den Reichtümern, die durch das Ausbauen des Meers und Ebnen der Berge verschwendet werden. Von der Villa des Pollius Felix bei Sorrent rühmt Statius, daß die Natur sich dort dem Willen des Menschen unterworfen und Dienste tun gelernt habe. »Wo du jetzt eine Ebene siehst, war ein Berg, wo du unter Dach wandelst, eine Wildnis; wo du hohe Bäume erblickst, war nicht einmal Erde – schau hier, wie das Gestein sein Joch tragen lernt, der Palast vordringt, der Berg auf das Geheiß des Herrn zurückweicht.« Klippen im Meere waren in Weinberge verwandelt, und die Nereiden pflückten hier im Schatten der Nacht süße Trauben. In der Villa am Lago Fusaro, in welcher Servilius Vatia, ein reicher Mann von prätorischem Range, unter Tiberius sein Alter in tatenlosem Genüsse verbrachte, waren zwei mit großer Arbeit ausgeführte künstliche Höhlen von der Ausdehnung der größten Atrien; die eine traf die Sonne niemals, die andre beschien sie bis zum späten Abend. Ein Kanal, vom Meere zum Acherusischen See geführt, durchschnitt einen Platanenhain; hier wurde gefischt, wenn das Meer zu stürmisch war. Die Villa bot die Annehmlichkeiten des benachbarten Bajä ohne dessen Unannehmlichkeiten.
Die Vorliebe für das Meer und der Wunsch, es aus unmittelbarster Nähe zu genießen, veranlaßte, wie es scheint, häufig kostbare Wasserbauten, deren Mauern, wie Ovid sagt, die blauen Wellen verdrängten. Auch Horaz spricht wiederholt von den das Meer füllenden Quadermauern. Wo immer sich das Meer zu einer Bucht krümmt, sagt Seneca, da legt ihr sogleich eure Fundamente und schafft künstlich neuen Boden. Noch sind Überreste dieser ins Meer gebauten Paläste bei Antium und sonst unter dem Wasserspiegel sichtbar. Auch an den Küsten der Provinzen gab es künstliche Wasserbauten. Auf den Gütern des reichen Sophisten Damianus von Ephesus am Meer waren künstliche Inseln und Hafendämme, die für landende und abfahrende Lastschiffe die Ankerplätze sicherten. Seine Häuser in der Vorstadt waren teils nach Art der Stadtwohnungen, teils grottenartig eingerichtet, all seine Ländereien mit schattigen Fruchtbäumen bepflanzt.
Wir haben beinahe gleichzeitige Schilderungen sowohl prachtvoller als bescheiden eingerichteter Villen, die letzteren von dem jüngeren Plinius, die ersteren von Statius. Die laurentische und toscanische Villa des Plinius waren durch ebenso schöne wie gesunde Lage, die eine am Meer, die andre im Tale des Tiber am Abhänge der Apenninen, ausgezeichnet; sie boten die mannigfachsten, für alle Tages- und Jahreszeiten passenden Räume und aus allen Fenstern andre, immer reizende Aussichten. Die Einrichtung war freundlich, bequem und zierlich, doch fast ganz ohne eigentlichen Luxus. Mit Ausnahme von vier kleinen Säulen aus carystischem Marmor, die einen Weinstock in der toscanischen Villa stützten, war hier wie dort nur weißer Marmor, und selbst dieser allem Anschein nach spärlich verwendet, oder die Wände mit einfachen Malereien geschmückt; in der laurentischen Villa waren die Öffnungen von zwei bedeckten Gängen mit Frauenglas geschlossen. Sie hatte keinen Springbrunnen, die toscanische mehrere. Die Gärten und Anlagen enthielten nur die gewöhnlichsten dem Boden zusagenden Pflanzen und Bäume: dort Violen, Buchs, Rosmarin, Weinstöcke, Maulbeer- und Feigenbäume; hier Rosen, Akanthus, Buchs, Weinstöcke, Lorbeer, Platanen, zum Teil mit Efeu bekleidet, und Zypressen.
Die eine der beiden von Statius geschilderten Villen, die sich der reiche Puteolaner Pollius Felix auf der Punta della Calcarella in der Bucht zwischen den Kaps von Massa und Sorrent erbaut hatte, ist bereits wegen der großen, bei ihrer Anlage ausgeführten Bodenarbeiten erwähnt worden. Die zu ihr gehörenden Bauten, Gärten, Parks usw. bedeckten die ganze Küste zwischen der Marina di Puolo und der Ostseite des Kaps von Sorrent. Unmittelbar am Ufer erhob sich ein warmes Bad mit zwei Kuppeln, ein Tempel des Neptun und einer des Hercules; ein Säulengang führte einen gewundenen Weg entlang zur Villa hinauf. Ihre Gemächer boten die mannigfachsten Blicke auf das Meer und die Inseln. Vor allen andern Teilen des Gebäudes ragte ein Saal oder Flügel hervor, der die Aussicht gerade über den Golf nach Neapel hatte; er war mit buntem Marmor aus den gesuchtesten Brüchen Griechenlands, Kleinasiens, Numidiens und Ägyptens verschwenderisch ausgestattet. Man sah überall kostbare Gemälde und Skulpturen alter Künstler und Porträts von Feldherren, Dichtern und Philosophen. Geringe Reste dieser Pracht, wie Fußböden von buntem Marmor, Säulen usw., sind zu verschiedenen Zeiten auf den Anhöhen der dortigen Küste und an der Marina di Puolo gefunden worden.
Auf der Besitzung des Manilius Vopiscus bei Tibur standen zwei Paläste an den beiden Ufern des Anio einander gegenüber, an einer Stelle, wo der Strom ruhig dahinfloß, während er ober- und unterhalb mit lautem Krachen schäumend über Felsen stürzte; man konnte von einem Ufer zum andern sich sehen und sprechen, fast die Hände reichen. Dichter und hoher Wald trat bis an den Rand des Wassers, dessen Fläche das Laub widerspiegelte, weithin lief die Welle durch Schatten. Hier war es auch in den Tagen der Siriushitze kühl, und der Brand der Julisonne vermochte nicht ins Innere der Wohnräume zu dringen. Diese prangten mit vergoldeten Deckenbalken, mit Türpfosten aus gelbem Marmor, mit Wandbekleidungen, auf denen Malereien durch Einlegung bunter Adern ausgeführt waren, mit kostbaren Mosaikfußböden, zahlreichen Kunstwerken aus Bronze, Elfenbein, Gold und Edelsteinen von berühmten Meistern; eine Wasserleitung versah jedes Gemach mit seinem eigenen Quell. Auch hier wechselte in jedem Zimmer die Aussicht, bald blickte man auf uralte Haine, bald auf den Strom; überall war Ruhe und Stille, und das sanfte Gemurmel der Wellen wiegte die Schläfer ein: dicht am Ufer des Anio war ein warmes Bad. Mitten in einem der beiden Paläste stand ein schöner Baum, dessen Wipfel über das Dach hinausragte. Ein Obstgarten, der dem Dichter die Gärten des Alcinous und der Circe zu übertreffen schien, lag bei der Villa. Niebuhr erteilt den Gedichten des Statius das Lob, daß sie die rechte Farbe des Lands an sich tragen, daß man sie in Italien besonders gern liest; und wohl mag man sich in jenen Gegenden in sie vertiefen, wenn man sich aus Trümmern ein Schattenbild der Pracht heraufrufen will, die sich einst mit dem Zauber einer herrlichen Natur verband, um das Dasein der Reichen und Großen beneidenswert zu machen.
Vielleicht nirgends fühlt man sich zu solchen Betrachtungen so sehr aufgefordert, als wenn man die weite, von unermeßlichen Trümmern erfüllte grüne Wildnis durchwandert, die einst die tiburtinische Villa Hadrians war. Die mit zusammenhängenden baulichen Anlagen bedeckte Fläche umfaßt etwa zwei Drittel Quadratkilometer, ist also etwa viermal so groß als der ganze Palatin. Sie enthielt architektonische und ohne Zweifel auch landschaftliche Nachbildungen der Orte und Gegenden, die das Interesse Hadrians auf seinen mehrjährigen Reisen durch alle Provinzen seines Reichs am meisten erregt hatten: es gab dort ein Lyzeum, eine Akademie, eine Poikile, ein Prytaneum, ein Canopus, ein Tempe; auch eine Unterwelt. Vielleicht waren solche Nachbildungen auf den Villen der fast immer viel gereisten Großen nicht selten, wenigstens befand sich auf einer Besitzung des Septimius Severus, der die Denkmäler Ägyptens mit besonderer Aufmerksamkeit in Augenschein genommen hatte, ein Memphis, auf einer andern ein Labyrinth. Galen erzählt, daß ein reicher Mann aus dem Toten Meer eine zur Füllung eines Bassins hinreichende Quantität Wasser nach Italien gebracht habe. Unter den Villen der späteren Zeit verdient die der Gordiane an der Pränestinischen Straße Erwähnung. Sie enthielt unter anderm einen viereckigen, mit 200 Säulen von gleicher Höhe geschmückten Raum ( tetrastylum), von denen je fünfzig aus Giallo antico, Cipollino, Pavonazzetto und rotem Porphyr waren; dreihundert Fuß lange Basiliken, Thermen, wie es deren außer Rom nirgends in der Welt gab, und alles übrige in demselben Maßstabe und Stil. Von dem Luxus der Villen in den Provinzen wird später die Rede sein.
Eine Vergleichung des römischen Palast-, Villen-, Park- und Gartenluxus mit dem der neueren Zeiten wäre schon darum schwierig, weil dieser Luxus im Altertum zum Teil durch ganz andere Einflüsse bedingt und auf ganz andere Dinge gerichtet war als im modernen Europa; auch bedürfte es dazu zahlreicher genauer Beschreibungen. Hier kann nur auf einige Prachtbauten und -anlagen in verschiedenen Zeiten und Ländern hingewiesen werden.
Unter den italienischen Palästen der Renaissancezeit zeichneten sich die venezianischen schon gegen Ende des 15. Jahrhunderts durch ihre Pracht aus. In einem Gemach von nur 12 Ellen Länge, in dem eine vornehme Wöchnerin Besuche empfing, hatte die bauliche, niet- und nagelfeste Ausstattung allein 2000 Dukaten (24.000 Frcs.) gekostet. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts zählte man in Venedig fast hundert Paläste, von denen mehrere mit einem Aufwande von je 200.000 Dukaten erbaut worden waren.
Dem noch existierenden Hause, das sich Jacques Cœur um 1450 in seiner Vaterstadt Bourges erbaute, kam nach dem Urteil eines Zeitgenossen kein Schloß des Königs gleich; noch vor seiner Vollendung wurden die Kosten des Baus auf 100.000 écus (gleich 8 bis 10 Mill. Frcs. jetzt) geschätzt; außen und innen war es mit kunstvollen Skulpturen überreich geschmückt, die Gemächer mit kostbaren gestickten Tapeten, Gold- und Silbergeschirr ausgestattet. Unter den herrlichen Privatbauten Frankreichs aus der Zeit der Renaissance, von denen der Vandalismus der ersten Revolution einen großen Teil zerstört hat, ragte das Schloß Gaillon hervor, das der Minister Ludwigs XII., Georg von Amboise, Erzbischof von Rouen, erbauen ließ. Richelieu gab für sein Schloß, »die glänzendste Wohnung in Frankreich vor der Erbauung von Versailles«, 10 Millionen aus. Für die königlichen Bauten wurde unter Ludwig XIV. eine Summe ausgegeben, die sich nach heutiger Währung auf rund 300 Mill. Francs berechnet, etwa ein Drittel davon fällt allein auf das Schloß Versailles mit seinen Gärten und Wasserkünsten. Das Schloß und die Gärten des 1661 gestürzten Ministers Ludwigs XIV., Foucquet, zu Vaux hatten 18 Millionen Livres gekostet, die nach Voltaires Schätzung den Wert der doppelten Summe in seiner eigenen Zeit hatten. Die unermeßlichen Gärten nahmen den Flächenraum von drei Dörfern ein, die Foucquet behufs dieser Anlagen angekauft hatte. Sie waren zum Teil eine Schöpfung Le Nôtres und galten für die schönsten Europas; ihre springenden Wasser erschienen damals als Wunderwerke, und selbst die königlichen Lustschlösser von St. Germain und Fontainebleau waren mit dem von Vaux nicht zu vergleichen. Die Bleiröhren für Wasserleitungen wurden später für beinahe eine halbe Million verkauft. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verschlang die Anlage englischer Gärten in unmittelbarer Nähe von Paris ungeheure Summen. Man nannte dieselben daher folies; die folie Brumoy richtete ihren Gründer, den Marquis de Brumoy, einen zehnfachen Millionär, zugrunde. Der Generalpächter und Hofbankier Joseph de la Borde gab für seine folie Méréville 30 Millionen aus; er hatte dort, mitten in der Beauce, eine Alpennatur mit Wasserfällen und Tannenwäldern geschaffen; eine Teufelsbrücke über einem Abgrund fehlte nicht, welche zu einem Marmortempel der Freundschaft führte.
Die französischen Lustschlösser des 18. Jahrhunderts waren die Vorbilder für die des übrigen Kontinents. Auf Roßwalde bei Hotzenplotz in Mähren hatte Graf Hoditz mit einem Aufwande von 3 Millionen Gulden einen Feensitz gegründet. Pulawy, die Residenz Adam Czartoryskis, war ein kleines Versailles inmitten ungeheurer Gärten. Das von Felix Potocki in Tulczin mit dem Aufwande vieler Millionen erbaute weitläufige Schloß glich mehr der Residenz eines Königs als dem Hause eines Privatmanns. Mit ebenso großem Aufwande und mit der Verwendung von 10.000 Arbeitern schuf Potocki in den letzten 10 Jahren seines Lebens (1795-1805) für seine Sophie das Schloß Sofijowska, »eine aus dem Nichts entstandene Zauberwelt«.
Von den Lustschlössern des 19. Jahrhunderts sind uns die der englischen Großen besonders durch die Beschreibungen des Fürsten Pückler bekannt. Woburn Abbey, ein Schloß der Familie Bedford, bildet »mit seinen Ställen, Reitbahn, Statuen- und Bildergalerie, Gewächshäusern und Gärten eine kleine Stadt« und ist ein »so vollendetes Ganze des raffiniertesten Luxus«, wie es nur eine seit Jahrhunderten darauf gerichtete Kultur hervorbringen konnte. Unter den verschiedenen Gärten besteht z. B. eine unermeßliche Pflanzung nur aus Azaleen und Rhododendron; in dem chinesischen Garten zeichnet sich der Milchkeller aus, der als chinesischer Tempel gebaut ist, mit einem Überfluß von weißem Marmor und buntem Glase, in der Mitte ein Springbrunnen usw. Das Aviary besteht aus einem sehr großen, eingezäunten Platz und hohen Pflanzungen und einer Cottage nebst einem kleinen Teich in der Mitte; die Wohnungen der unzähligen, zum Teil ausländischen und seltenen Vögel sind von Eichenzweigen mit Draht umflochten, die Decke gleichfalls von Draht, die Sträucher Immergrün. Der Park hält vier deutsche Meilen, Ashridge Park, der Sitz der Grafen von Bridgewater, über drei im Umkreise; den letzteren zieren 1000 Stück Wild und unzählige Gruppen von Riesenbäumen; pleasureground und Gärten sind noch größer als in Cashbury Park. Und doch kostet die Unterhaltung von Cashbury Park (Sitz des Grafen Essex) mit prachtvollem Park, Gewächshäusern und Gärten jährlich 10.000 Lstr. Warwick Castle (am 3. Dezember 1871 teilweise abgebrannt) war »ein Zauberort«. Die Gesellschaftszimmer zogen sich auf beiden Seiten der Halle 340 Fuß in ununterbrochener Reihe hin. 8 bis 14 Fuß dicke Mauern bildeten in jedem Fenster, welche auch 10 bis 12 Fuß breit sind, ein förmliches Kabinett mit den schönsten und mannigfaltigsten Aussichten. Auch in bezug auf die Zahl ihrer Landsitze haben die Mitglieder der englischen Aristokratie den Vergleich mit denen der römischen nicht zu scheuen, wenn als glaubhaft erzählt wird, ein englischer Lord habe 1848 einem französischen Freunde als Zufluchtsort eines seiner Schlösser angeboten, das er zwar noch nicht kenne, das aber für sehr schön gelte, und wo täglich für den Fall seiner Ankunft eine Tafel mit 12 Gedecken und eine angespannte Kutsche bereitstehe.
Unter den Schlössern des Kontinents ragt das 1860 in Ferrières von dem englischen Architekten Paxton erbaute des Barons Alfons Rothschild durch mehr als fürstliche Pracht hervor; »der Mittelstand kann's nicht«, soll König Wilhelm gesagt haben, der es bekanntlich 1870 bewohnte. Der feenhafte Anblick seiner Halle mit ihrer gewaltigen, von herrlichen Teppichen bedeckten Galerie, in der Beleuchtung von 1100 Gasflammen, ist nach Drumont allein eine Reise dorthin wert. Freilich zeigt die geschmacklose Überfüllung aller Räume mit den Wunderwerken aller Künste und Kunstgewerbe aus vielen Jahrhunderten nur den brutalen Triumph des Reichtums und bewirkt mehr Ermüdung als Bewunderung. Im Park sind die Treibhäuser und Vogelhäuser überaus anziehend. Eins der prachtvollsten russischen Schlösser ist die palastartige, in italienischem Stil erbaute Villa zu Archangelsk bei Moskau, die der Fürst Jussupow dem Fürsten Michael Galitzin für 6 Mill. Rubel abkaufte. Sie ist von einem weiten Park umgeben, gewährt herrliche Fernsichten auf Wälder und Fluren, enthält eine große Galerie von wertvollen Bildern alter Meister, eine reich ausgestattete Hauskapelle, einen Konzertsaal, ein 500 Zuschauer fassendes Theater, zahlreiche mit kostbaren Skulpturen geschmückte Gesellschaftsräume usw. In Alupka, einer Besitzung des Fürsten Woronzow auf der Krim, sah Haxthausen 1843/44 einen Palast, der bis dahin schon 7 Millionen Rubel gekostet haben sollte und im Innern noch lange nicht vollendet war. Nach einer Beschreibung des Grafen E.M. de Vogué aus dem Jahre 1886 übertrifft er die umfangreichen Paläste des Sultans auf beiden Seiten des Bosporus »an Pracht gewisser Einzelheiten, Schönheit der Lage und der Gärten«. Die Prachtliebe des Erbauers strebte mit Tausend und einer Nacht zu wetteifern. »Nur ein Russe aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts konnte dieses orientalische Feenmärchen erdenken und ausführen. Man liebt in Rußland nur das Unmögliche und wird es schnell müde.« Die hohen maurischen Säle, die labyrinthischen Gänge des Parks von Alupka sind verödet.
Während die Pracht der englischen Schlösser das Produkt einer fortgesetzten Arbeit von Jahrhunderten ist, waren die römischen Paläste der Kaiserzeit sehr junge Bauten, da Rom, wie bemerkt, erst im letzten Jahrhundert v. Chr. palastartige Gebäude erhielt. Nichtsdestoweniger ist vielleicht der Bauluxus der Zeit von Augustus bis auf Vespasian in keiner andern Zeit erreicht worden. Vieles vereinigte sich damals, um den Luxus gerade auf diesem Gebiete zu einem beispiellosen zu machen. Die im römischen Wesen tief begründete, durch die Weltherrschaft aufs höchste entwickelte Richtung auf das Imposante und Kolossale, die leicht ins Maßlose und Ungeheure ausschweifte, konnte sich in der »Massenhaftigkeit und Weiträumigkeit« der Gebäude, und nicht bloß der öffentlichen, volles Genüge tun. Mit dem Triebe, die eigene Existenz würdig, glanzvoll und prächtig zu gestalten und darzustellen, verband sich die stolze Lust des Triumphs über scheinbar unübersteigliche Hindernisse und die durch die Sklaverei genährte und gesteigerte Gewohnheit, selbst augenblickliche Launen und Phantasien zu verwirklichen: Tendenzen, die in dem kaiserlichen Allmachtsschwindel gipfelten, aber in minder ungeheuerlichen Formen bei den Reichen und Großen dieser Zeit, die sich als Herren der Erde fühlten und fühlen durften, sehr verbreitet waren. Julius Cäsar ließ in einer Zeit, wo er noch arm und verschuldet war, eine mit großem Aufwande ganz neu erbaute Villa niederreißen, weil sie seiner Erwartung nicht entsprach. Cassius Dio erzählt, daß ein Sextus Marius, der als Freund des Tiberius zu großem Reichtum und großer Macht gelangt war, einen Nachbar, auf den er zürnte, zwei Tage lang bei sich bewirtete und während dieser Zeit die Villa desselben erst niederreißen, dann schöner und größer wieder aufbauen ließ, um ihm zu zeigen, wie sehr er als Freund zu nützen und als Feind zu schaden vermöge. Bei Horaz heißt es: wenn ein reicher Mann sein Entzücken an der Küste von Bajä geäußert hat, empfindet auch sogleich der See und das Meer die Leidenschaft des ungeduldigen Bauherrn; wandelt ihn eine neue Laune an, so müssen die Arbeiter morgen ihre Gerätschaften nach Teanum schaffen. Strabo bemerkt, daß die unaufhörlichen Verkäufe von Häusern in Rom fortwährend Veranlassungen zu Um- und Neubauten gaben. Selbstverständlich stürzte die ganz eigentlich zu den noblen Passionen dieser Zeit gehörende Leidenschaft des Bauens viele in Schulden oder richtete sie völlig zugrunde. Ein kostbares Haus, sagt Plutarch, macht manchen zum Borger. Cretonius, heißt es bei Juvenal, hatte die Bausucht ( aedificator erat) und ließ bald am gekrümmten Ufer von Gaeta, bald auf der Höhe von Tivoli, bald in den Bergen von Palestrina hochragende Villen entstehen, die mit griechischen und sonst aus der Ferne herbeigeschafften Marmorarten die Tempel der Fortuna und des Hercules überboten. So verminderte er sein Vermögen beträchtlich, immer aber blieb noch viel übrig; doch der verrückte Sohn, der neue Villen aus noch kostbarerem Marmor erbaute, ruinierte sich ganz. Auf die Kleinen, die es im Bauen den Großen gleichzutun suchten, wenden Horaz und Martial die Fabel von dem Frosch an, der sich zur Größe des Ochsen aufblasen wollte. Bei dem letzteren ist der Gerngroß ein Bezirksvorsteher ( vici magister), der mit einem Konsul wetteifert. Jener besitzt einen Palast 4 Millien vor der Stadt: auch dieser kauft sich 4 Millien vor der Stadt ein Stückchen Land; jener baut elegante Thermen aus buntem Marmor, dieser ein Bad von der Größe eines Kessels; jener hat eine Lorbeerpflanzung auf seinem Gute, dieser säet hundert Kastanien.
Die (wie bemerkt) bis zum Übermaß getriebene, für den damaligen Bauluxus besonders charakteristische Verschwendung der kostbarsten farbigen Materialien war eben nur im Mittelpunkt eines Weltreichs möglich, dem zur See Säulen, Balken und Blöcke aus den so überaus zahlreichen und mannigfaltigen Steinbrüchen der Mittelmeerländer zugeführt werden konnten, die seit dem Untergange der antiken Kultur größtenteils der Barbarei und der Verödung anheimgefallen sind. Dennoch wunderte sich Macaulay bei seinem Besuche des Vatikanischen Museums im Jahre 1838 nicht mit Unrecht, daß es in unserm so reichen und verschwenderischen Zeitalter niemand versuche, Brüche gleich denen zu eröffnen, aus welchen sich die Alten versorgten. »Der Reichtum des modernen Europa ist weit größer als der des römischen Reichs; und diese Materialien werden hoch geschätzt und enorm bezahlt. Und doch begnügen wir uns, sie in den Ruinen dieser alten Stadt und ihrer Umgebungen auszugraben, und es fällt uns nicht ein, sie in den Felsen zu suchen, aus denen die Römer sie brachen.« Seine Erwartung, daß die Niederlassung der Franzosen in Afrika und die Regierung eines bayrischen Prinzen in Griechenland derartige Unternehmungen veranlassen würden, hat sich bis jetzt nur in sehr geringem Maße erfüllt. In den Brüchen des numidischen Marmors bei Schimtu (Simitthu) werden die von den Römern begonnenen, seit einem Jahrtausend verlassenen Stollen fortgeführt, und der von römischen Meißeln behauene Block von einer Dampfsäge zerschnitten.
Mag aber die Pracht altrömischer Paläste die der englischen und sonstigen modernen Schlösser überboten haben, so standen dagegen die römischen Gärten und Parks hinter den englischen unzweifelhaft sehr zurück. Schwerlich hatten die ersteren den Umfang der letzteren. Es muß dahingestellt bleiben, ob den Großen des römischen Reichs zu derartigen Anlagen ebensoviel Raum zur Verfügung stand wie den britischen. Nach John Bright gehörte im Jahre 1866 die Hälfte des Bodens von England 150, der gesamte Boden von Schottland 10 oder 12 Personen; der Herzog von Sutherland, der größte englische Grundeigentümer, besitzt 482.676 Hektar, der Marquis von Beadalbane kann 150 Kilometer (30 lieues) in gerader Linie reiten, ohne seine Ländereien zu überschreiten. Jedenfalls befriedigte sich aber das antike Naturgefühl mehr an gartenartigen, künstlich gestalteten Szenen als an großen Landschaftsbildern und war also der Entstehung einer »Parkomanie« nicht günstig. Sodann fehlte dem Altertume der Luxus der Gewächshäuser und damit die Möglichkeit, die Vegetation fremder Zonen und Weltteile im kleinen zu reproduzieren.
Im Gegensatz zur Buntheit der Palastdekoration mangelte den römischen Gärten gerade die bunte Pracht der modernen Flora. Der Blumenluxus des römischen Altertums war nicht auf Mannigfaltigkeit der Arten, sondern auf eine zu verschwenderischem Gebrauch verfügbare Fülle einer verhältnismäßig kleinen Anzahl von Gattungen, besonders Lilien, Rosen und Violen, gerichtet. Das Übermaß dieses in seiner Art beispiellosen Luxus lernt man aus der bereits angeführten Angabe kennen, daß bei einem Gastmahl eines der Freunde Neros die Rosen mehr als 4 Mill. Sesterzen (870.000 Mark) kosteten, sowie aus den Berichten über die ganz aus Rosen und Lilien hergestellten Ruhebetten und Eßtische des Aelius Verus. Schon in Varros Zeit war die Anlage von Rosen- und Violengärten in unmittelbarer Nähe Roms einträglich, und allmählich umgab die Stadt ein immer ausgedehnterer Gartenrayon. Aber auch im weiteren Kreise bis nach Campanien und Pästum hin sorgten Blumenanlagen für ihr Bedürfnis. Bereits unter Nero verlangte man Rosen auch im Winter, die dann teils zu Schiff aus Ägypten gebracht, teils ebenso wie Lilien unter Glas getrieben wurden. Im Winter 89/90 war die Fülle Pästanischer Rosen in Rom so groß, daß alle Straßen von den überall feilgebotenen Kränzen rot schimmerten; Ägypten, sagt Martial, das sonst in dieser Jahreszeit der Hauptstadt Rosen lieferte, hätte sie damals aus ihr beziehen können.
Das neue Europa verdankt einen großen Teil seiner prächtigen Gartenflora der Blumenlust der Türken. Aus Stambul wanderte die Tulpe, der duftende Syringenstrauch, die orientalische Hyazinthe, die Kaiserkrone, die Gartenranunkel über Wien und Venedig in die Gärten des Okzidents; aber auch der Kastanienbaum (Aesculus hippocastanum), der Kirschlorbeer und die Mimosa oder Acacia Farnesiana. Die Nelke verbreitete sich in der Renaissancezeit aus Italien über die Alpen. Dann begann mit der Entdeckung von Amerika eine neue, sehr viel massenhaftere Einführung von Blumen und Ziergewächsen: wie der wilde Wein, die peruanische Kapuzinerkresse, die lombardische oder Pyramidalpappel, die amerikanische Platane, die nordamerikanische Akazie, die Bignonia Catalpa, der Tulpenbaum, jenseits der Alpen die Magnolie, der Pfefferbaum usw. Der Opuntienkaktus und die Aloe »haben den Typus der mediterranen Landschaft, die längst vom Orient her ihr strenges, stilles Kolorit erhalten hatte, durch ein völlig einstimmendes Element wesentlich ergänzt.«
Auch die so überaus große, durch Kunst ins Unendliche gesteigerte Vermehrung der Gattungen und Arten hat einen dem Altertum völlig unbekannten Luxus ins Leben gerufen, und die von Liebhabern für gesuchte oder seltene Blumen in neueren Zeiten gezahlten Preise (z. B. 70.000 Fr. 1838 für ein Georginenbeet in Frankreich, 100 Lstr. 1839 für eine vorzügliche Varietät in England) können nur mit den im Altertume für Seltenheiten und Gegenstände der Liebhaberei gezahlten Preisen verglichen werden. Ebenso unbekannt war den Alten der Luxus der exotischen Gewächse, der ebenfalls allmählich kolossale Dimensionen angenommen hat. Von den Araukarien der Villa Pallavicini in Pegli wurde 1865 kein Stück unter 10.000, eines sogar auf 30.000 Frcs. geschätzt. Eine Londoner Handelsgärtnerei (James Veitch and Sons), deren Spezialität Orchideen und fleischfressende Pflanzen sind, hatte 1879 sechs Gärtner, welche jahraus, jahrein die Länder in den Tropen und im inneren Asien, in den Dschungeln, Sümpfen und den Wäldern der Ebene sowie bis hoch in den Himalaja, nach neuen und interessanten Exemplaren durchstreiften.
Die Ausstattung der Wohnungen war im Altertum – und ist zum Teil noch heute im Süden – von der gegenwärtig in Nord- und Mitteleuropa gewöhnlichen wesentlich verschieden, sie stand zwischen dieser und der orientalischen in der Mitte. Sie war nicht auf behaglichen Aufenthalt, nicht auf Komfort berechnet, den der Süden ebensowenig kennt, wie seine Sprachen ein Wort dafür besitzen, sondern auf möglichst imposante und glanzvolle Darstellung der Würde des Besitzers. Waren schon die eigentlichen, am Tage wenig benutzten Wohnräume nach unsern Begriffen mit Hausrat und Mobilien nur spärlich ausgestattet, so enthielten vollends die hohen, weiten, zum Empfange bestimmten Räume, die sich morgens dem Schwarm der Besucher, gegen Abend den zur Mahlzeit geladenen Gästen öffneten, verhältnismäßig wenige, dafür aber um so kostbarere und gediegenere, ausschließlich oder vorzugsweise zur Dekoration bestimmte Prachtstücke: wie Tische mit Citrusplatten auf Elfenbeinfüßen, Ruhebetten mit Schildpatt ausgelegt oder reich mit Gold und Silber verziert und mit babylonischen Teppichen behängt, Prachtvasen aus korinthischer Bronze und Murrha, äginetische Kandelaber, Schenktische mit alten Silberarbeiten, Statuen und Gemälde berühmter Künstler.
Von mehreren der beliebtesten Luxusmöbel und -geräte werden Preise angegeben, die durchweg sehr hoch, zum Teil enorm sind. Äginetische Kandelaber wurden mit 25.000 Sesterzen (5437 Mark) und zuweilen selbst der doppelten Summe bezahlt. Gefäße aus Murrha, einem schon den Alten rätselhaften, orientalischen, dem Golde gleich geachteten Material (vielleicht einer Art des Achats), die zuerst Pompejus nach dem Siege über Mithridat nach Rom brachte, gab es im Privatbesitz bis zum Preise von 300.000 Sesterzen (65.250 Mark). Nero ließ daraus eine Schale machen, die eine Million kostete. Mit diesen Preisen dürften sich allenfalls die des Porzellans im 18. Jahrhundert vergleichen lassen. Graf Brühl soll ein Service für eine Million Taler besessen haben. In Paris war 20.000 Livres für ein Service von sächsischem Porzellan schon ein hoher Preis, doch gibt es auch gegenwärtig einzelne Porzellanvasen, die 15.000 Mark kosten. Auch für Bergkristalle hegten in Rom manche eine unsinnige Leidenschaft; Plinius erzählt, vor wenigen Jahren habe eine nicht reiche Frau eine Schöpfkelle daraus für 150.000 Sesterzen (32.625 Mark) gekauft. Unter Nero wurden zwei auf eine neue erfundene Art verfertigte, nicht große künstliche Trinkgläser zu 6000 Sesterzen (1305 Mark) verkauft. Die Leidenschaft für kunstvolle Silberarbeiten war schon seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. in Rom verbreitet. Schon der Redner L. Crassus (Konsul 95) besaß Gefäße, bei denen das Pfund auf 6000 Sesterzen (damals 1053 Mark) zu stehen kam, so daß der Preis der Fasson mehr als zwanzigfach den Wert der Masse überstieg; 5000 Sesterzen (1087 Mark) auf das Pfund scheint in Martials Zeit ein hoher Preis gewesen zu sein. Doch wurden angebliche oder wirkliche Arbeiten berühmter Künstler meist höher bezahlt. Babylonische gestickte Teppiche zur Bedeckung der Ruhebetten in einem Speisesaal waren schon im 2. Jahrhundert v. Chr. für 800.000 Sesterzen (damals 140.400 Mark) verkauft worden, Nero besaß solche, die 4 Millionen (870.000 Mark) gekostet hatten. Doch am weitesten ging die »Raserei« für Citrustische, die den Männern von den Frauen entgegengehalten wurde, denen jene ihre Verschwendung für Perlen zum Vorwurf machten. Schön gemaserte große Scheiben vom Stamme des Citrus, einer am Atlas wachsenden Thujaart, wurden mit unsinnigen Preisen bezahlt, da die Stämme selten die für Tischplatten erforderliche Dicke erreichten; es gab deren aber bis zu 4 Fuß Durchmesser. Cicero besaß einen noch in Plinius' Zeit existierenden Citrustisch für 500.000 Sesterzen (damals 87.750 Mark), was Plinius wegen des Geistes jener Zeit noch auffälliger findet als wegen ihrer relativen Armut. Es gab später noch teurere, bis zum Preise von 1.300.000 Sesterzen (282.750 Mark); Seneca soll 500 Citrustische besessen haben.
Daß alle diese Preise keine Durchschnittspreise sind, sondern ungewöhnlich hohe, ist selbstverständlich; als solche und ihrer Merkwürdigkeit halber werden sie ja gerade berichtet; sie können daher auch nur mit den höchsten Preisen von Luxusgeräten und -möbeln, die aus andern Zeiten bekannt sind, verglichen werden. Bedarf es noch eines Beweises, daß die Durchschnittspreise der zur häuslichen Einrichtung gehörigen Luxusartikel erheblich niedriger waren, so liefert auch diesen ein Gedicht Martials. Er schildert jemanden, der damit groß tut, daß alles, was er besitzt, von ausgezeichneter Güte und teuer bezahlt ist. Er kauft Sklaven zu hundert- und zweihunderttausend Sesterzen, trinkt uralten Wein, hat Silberarbeiten, von denen das Pfund auf fünftausend Sesterzen zu stehen kommt, eine vergoldete Karosse von dem Werte eines Grundstücks, ein Maultier, das mit dem Preise eines Hauses bezahlt ist: und seine ganze, nicht umfangreiche häusliche Einrichtung kostet ihm eine Million (217.500 Mark). Diese Summe galt also damals als hinreichend, um ein Haus (vielleicht einen Palast) glänzend auszustatten.
Aber die von Plinius mitgeteilten Preise sind nicht bloß ungewöhnlich hohe, es sind größtenteils auch sogenannte Affektionspreise, d. h. solche, die nur für Gegenstände einer besonderen Liebhaberei oder, wie Plinius wiederholt sagt, Raserei gezahlt werden. In der Tat steigern sich ja derartige Modeleidenschaften nicht selten zum Unsinn und äußern sich in krankhaften Erscheinungen. Plinius berichtet von einem Konsularen, bei dem die Leidenschaft für Murrhagefäße zur Sammelwut ausartete, daß er den Rand eines großen, fast 3 Sextarii (1,64 Liter) fassenden, mit 700.000 Sesterzen (152.250 Mark) bezahlten murrhinischen Kelchs aus Liebe angenagt habe, infolgedessen sei dieser noch sehr im Preise gestiegen. Auch in neueren Zeiten sind für Seltenheiten ganz anderer Art, die aber ebenfalls »durch die Raserei einiger weniger kostbar waren« (wie Seneca von den korinthischen Bronzen sagt), von Liebhabern, namentlich englischen, ungeheure Preise gezahlt worden: z. B. 600 Lstr. für einen Heller aus der Zeit Heinrichs VII., 2260 Lstr. (im Jahre 1812) für einen Dekameron u. dgl.; während im Altertum unter derartigen Kuriositäten hauptsächlich Gegenstände, die im Besitze berühmter Personen gewesen waren, für hohe Summen gekauft wurden, wie die Lampe des Epictet für 3000 Drachmen (2340 Mark), der Stock des Peregrinus Proteus für ein Talent (4715 Mark). Doch scheint allerdings die Höhe der damaligen Affektionspreise niemals wieder selbst annähernd erreicht worden zu sein: wie es denn überhaupt auf diesem wie auf andern Gebieten gerade vereinzelte Extravaganzen sind, in denen jene Zeit alle andern überboten hat.
Was dagegen den Luxus der Ausstattung der Wohnungen betrifft, so dürfte die größere Kostbarkeit verhältnismäßig weniger Prachtstücke in den römischen Palästen durch die ungleich größere Menge und Mannigfaltigkeit der Luxusgeräte und -möbel in modernen mehr als aufgewogen worden sein: um so mehr, als die Kostbarkeit auch dieser nicht selten eine sehr große, zum Teil enorme war und noch ist.
In der Renaissancezeit war in Italien der Zimmerschmuck nicht weniger prachtvoll als künstlerisch schön. Es gehörten dazu, außer reich ornamentierten Plafonds und Marmorkaminen, Tapeten von Goldleder oder von Seide und Samt, mit Gold und Silber gemustert, Arrazzia, Bilder in kostbaren Rahmen, Möbel von der edelsten Holzarbeit, schwere Vorhänge, orientalische Stickereien, Gefäße aus vergoldetem und emailliertem Silber, Kristall, Glas (von Murano) und Majolika, Figuren und Geräte aus Bronze, Arbeiten aus Elfenbein und andere Erzeugnisse der Kleinkunst. Unter den Palästen Venedigs, in denen der Luxus der inneren Einrichtung, namentlich des künstlerischen Schmucks, im 16. Jahrhundert die größte Höhe erreichte, zeichnete sich der Palast Vendramin Calergi durch die Verwendung kostbarer Steinarten zu Kaminen und Säulen und die Ebenholz- und Elfenbeininkrustation seiner Türen aus. In dem »Goldenen Zimmer« des Hauses Cornaro war ein prachtvoller Kamin mit goldenen Karyatiden geschmückt, die Wände mit Tapeten von Goldstoff bedeckt, die Vergoldung des Gebälks schätzt man auf 18.000 Zechinen. Im Palaste des Kardinals Wolsey waren die acht Gemächer, die man durchschreiten mußte, um in sein Audienzzimmer zu gelangen, sämtlich mit kostbaren Tapeten behängt, welche jede Woche gewechselt wurden.
In Frankreich wurde der Luxus der Wohnungseinrichtungen gegen das Ende der Regierung Ludwigs XIV. hauptsächlich durch die Geldmänner wieder ins Leben gerufen, die ihre Gemächer mit Tapeten aus Beauvais und Gobelins, Möbeln des berühmten Ebenisten Boulle, chinesischen und japanesischen Arbeiten, venezianischen und Nürnberger Spiegeln, Bildern von französischen und fremden Meistern, Silbergeschirr und kostbarem Porzellan anfüllten. Dieser Luxus, der unter der Regentschaft Ludwig XV. noch sehr zunahm, war je länger je mehr auf eine auch den Ansprüchen der äußersten Verwöhnung genügende Vereinigung von Geschmack und Komfort gerichtet. In dem Boudoir einer mit der raffiniertesten Verschwendung ausgestatteten Wohnung (1758) waren die Wände durchaus mit Spiegeln bekleidet, deren Fugen künstliche, wie in der Wirklichkeit gruppierte und belaubte Baumstämme verdeckten. Die Bäume waren mit Porzellanblüten und vergoldeten Armleuchtern geschmückt, deren rosenfarbene und blaue Kerzen ein sanftes, von den zum Teil mit Gaze verhüllten Spiegeln in stufenweise abnehmender Stärke zurückgeworfenes Licht verbreiteten. In einer ebenfalls mit Spiegeln bekleideten Nische stand ein üppiges, mit Goldfransen geschmücktes Ruhebett auf einem Parkettboden von Rosenholz. In die Farben, mit denen die Täfelung und Skulptur gemalt war, hatte man wohlriechende Ingredienzien gemischt, so daß das künstliche Boskett die Gerüche von Veilchen, Jasmin und Rosen zugleich aushauchte. Und ebenso reiche und künstlerisch geschmückte Boudoirs besaß Paris damals ohne Zweifel mehrere hundert. Unter Ludwig XVI. war der Luxus der ziselierten und vergoldeten Bronzen so groß, daß ihr Wert dem des Golds gleichkam. Die Ziselierung eines von dem berühmten Gouthière gearbeiteten Piedestals wurde von dem Künstler selbst auf 50.000 Livres geschätzt, und die Gräfin Dubarry war ihm bei ihrem Tode 756.000 Livres schuldig. Bei reichen Häusern wurden die Kosten des Rohbaus nur auf ein Viertel der Gesamtkosten veranschlagt: »die ganze Pracht der Nation offenbarte sich im Innern«. In Beaumarchais' durch seine architektonische und Gartenpracht hervorragendem Palast glichen die luxuriös ausgestatteten Prunkzimmer wahren Kunstsammlungen; sein reich bemalter Schreibtisch soll 30.000 Frcs. gekostet haben. Bonaparte hatte 1796 für die prachtvolle Einrichtung des kleinen Hotels seiner Gemahlin, das nur 40.000 Frcs. wert war, 120.000-130.000 zu zahlen. Auch dieser Luxus verbreitete sich aus Frankreich auf den übrigen Kontinent. Der Kurfürst Max Emanuel II. von Baiern z. B. zahlte (im Anfang des 18. Jahrhunderts) 60.000 bis 100.000 Taler für einen Kamin und zwei Tische im Rokokostil aus Paris; die Möbel in dem für die Gräfin Kosel eingerichteten Lustschloß Pillnitz kosteten 200.000 Taler usw.
Von dem Luxus der Wohnungseinrichtungen im 19. Jahrhundert, der in dessen letzten Dezennien so sehr gewachsen ist (auf Pariser Ausstellungen sah man Bücherschränke für 25.000, Schreibtische für 10.000 bis 15.000 Frcs., auf der Berliner Gewerbeausstellung 1879 Einrichtungen einzelner Zimmer zum Preise von 4000-14.000 Mark), soll hier nicht weiter die Rede sein. Nur von der Pracht, die auch das Innere der englischen Schlösser schmückt, mögen einige Mitteilungen des Fürsten Pückler eine Vorstellung geben. Der Wert der Einrichtung von Northumberlandhouse wird auf mehrere hunderttausende Lstr. veranschlagt. In den Zimmern von Warwick Castle glaubte man sich »völlig in versunkene Jahrhunderte versetzt«. Fast alles war dort »alt, prächtig und originell«. Man sah »die seltsamsten und reichsten Zeuge, die man jetzt gar nicht mehr auszuführen imstande sein möchte, in einer Mischung von Seide, Samt, Gold und Silber, alles durcheinander gewirkt. Die Möbel bestehen fast ganz aus alter, außerordentlich reicher Vergoldung, geschnitztem, braunem Nuß- und Eichenholz oder jenen alten französischen, mit Messing ausgelegten Schränken und Kommoden. Auch sind viele herrliche Exemplare von Mosaik wie von ausgelegten kostbaren Hölzern vorhanden. Die Kunstschätze sind unzählbar und die Gemälde fast alle von den größten Meistern«. Diese und ähnliche Beschreibungen englischer Schlösser erinnern daran, daß die römische Kaiserzeit (trotz aller Liebhabereien für Altertümer) auch den Luxus der Durchführung bestimmter historischer Stile in der Zimmereinrichtung, durch Vereinigung von gleichzeitigen Möbeln und Geräten oder künstlerische Nachbildung derselben, allem Anschein nach nicht gekannt hat.
Eine besondere Betrachtung verdient der Luxus des Silbergeschirrs. Den Gebrauch des goldenen Geschirrs hatte Tiberius bei Privatpersonen auf Opferhandlungen beschränkt, erst Aurelian gestattete ihn wieder allgemein. Doch scheint Tiberius' Bestimmung nicht streng aufrechterhalten worden zu sein, wenigstens wird goldenes Geschirr hin und wieder erwähnt und war wohl kaum seltener als in neueren Zeiten. Mit Silbergeschirr wurde großer Luxus getrieben, auch abgesehen von dem schon erwähnten Luxus derjenigen Silbergefäße, deren Hauptwert in ihrem Alter und der Kunst der Arbeit (Cälatur) bestand, und die vorzugsweise als Prunkstücke dienten. In der früheren Zeit der Republik war Silbergeschirr in Rom so selten gewesen, daß einmal die karthagischen Gesandten bei jeder Mahlzeit, zu der sie geladen wurden, dasselbe von Haus zu Haus geliehene fanden: eine lange Reihe von Erwerbungen und Eroberungen machte es allmählich allgemein. Die Eroberung Spaniens, des Peru der alten Welt (206 v. Chr.), brachte unter anderm die Silbergruben bei Neu-Karthago in den Besitz des Staats, in denen (nach Polybius) 40.000 Menschen arbeiteten, und die einen täglichen Reingewinn von 25.000 Drachmen (etwa 19.500 Mark) abwarfen. Dann häuften die Feldzüge in Syrien und Macedonien, die Eroberung von Karthago und Korinth, die Erwerbung der Provinz Asia, die Eroberung der Provence, endlich die Kriege gegen Mithridates ungeheure Massen von Edelmetall in Rom an. Ist auch die infolge der Entdeckung von Amerika erfolgte Einfuhr desselben, durch welche die sich bis dahin in Europa auf 34 Mill. Lstr. belaufende Masse am Schlusse des 16. Jahrhunderts auf 130 Mill., am Schlusse des 17. Jahrhunderts auf 297 Mill. gestiegen sein soll, ohne Vergleich größer gewesen, so war dagegen im römischen Altertum die Anhäufung des Edelmetalls auf ein kleineres Gebiet beschränkt und konnte darum ähnliche Wirkungen hervorbringen wie jene in den Jahrhunderten vom sechzehnten zum achtzehnten. Einige freilich sehr vereinzelte Tatsachen mögen von dem Gold- und Silberluxus in der letzteren Periode eine Vorstellung geben.
Schon im 15. Jahrhundert war derselbe keineswegs gering. Zwar in Florenz liehen bei Festlichkeiten die befreundeten Familien einander das kunstreiche Silbergeschirr; für den gewöhnlichen Gebrauch bediente man sich neben silbernen Löffeln und Gabeln meist messingenen Tischgeräts. Doch welche Massen von Edelmetall sich in dem Besitze einzelner befanden, zeigt das Verzeichnis der von dem Kardinal Pietro Riario, als er 1473 die Braut des Herzogs von Ferrara in seinem Palaste zu Rom beherbergte, zur Schau gestellten Kostbarkeiten: vier Leuchter der Kapelle nebst zwei Engelfiguren von Gold, der Betstuhl mit Löwenfüßen ganz von Silber und vergoldet, ein vollständiges Kamingerät ganz von Silber, ein silberner Nachtstuhl mit goldenem Gefäß darin usw.; im Speisesaal ein großes Büfett von zwölf Stufen voll goldener und silberner, mit Edelsteinen besetzter Gefäße; außerdem das Tafelgeschirr lauter Silber und nach jeder Speise gewechselt. In Frankreich nahm unter Ludwig XII. der Luxus der Vergoldung an Bauten und architektonischen Ornamenten ebensosehr zu wie der des Silbergeschirrs: große Herren und Prälaten hatten vergoldetes oder massiv goldenes. In Deutschland, das nach den Erträgen seiner Bergwerke im 15. Jahrhundert das damalige Peru Europas genannt worden ist, staunte Aeneas Silvius über die Allgemeinheit des Luxus in edlen Metallen, namentlich an Geschirren, Waffen und Schmuck. An den Tafeln der Kaufleute aß man nach Wimpheling nicht selten aus Gefäßen von Silber und Gold, und bei Reisen ins Ausland ließen sie sich solche von 30, 50, 150 Pfund Gewicht nachsenden.
Im 16. Jahrhundert erwähnt Guicciardini das massive Silbergeschirr der Bürger in Flandern, und beklagt Holinshed die Einführung silberner Löffel in England. Das Silbergeschirr des Kardinals Wolsey schätzte man auf 150.000 Dukaten. Im 17. Jahrhundert war in Spanien namentlich unter Karl II. (1665-1700) der Luxus des Silbergeschirrs enorm, während (wie bemerkt) zugleich der größte Geldmangel herrschte. Als der Herzog von Albuquerque starb, brauchte man 6 Wochen, um sein silbernes und goldenes Tafelgeschirr zu wiegen und zu verzeichnen: darunter waren u. a. 1400 Dutzend Teller, 500 große, 700 kleine Schüsseln und 40 silberne Leitern, deren man sich bei der Benutzung der Silberschränke bediente. Der Herzog von Alba, der nach seiner Ansicht nicht reich genug an Tafelsilber war, besaß 600 Dutzend Teller und 800 Schüsseln von Silber. All dies Gerät wurde schon fertig aus Mexiko und Peru bezogen. In England nahm in dieser Zeit die Verwendung des Edelmetalls zu Verzierungen und Gerätschaften sehr zu. Die Zivil- und Militärtrachten wurden mit Gold- und Silberborten und Stickereien verschwenderisch ausgestattet. Man sah bei Adligen und bei reichen Bürgern Spiegel und Gemälde in silbernen Rahmen, auch Tische, wenn nicht von massivem Silber, doch mit Silberblech bedeckt. In Frankreich besaßen viele adlige Familien Silber im Wert von 400.000-500.000 Frcs., das man um so höher schätzte, je mehr es geschwärzt und verbogen war. Im Jahre 1689 verordnete Ludwig XIV. zur Bestreitung der Kosten des Kriegs gegen die große Allianz, daß alle Möbel von massivem Silber, die man bei den Großen in ziemlich beträchtlicher Zahl sah, in die Münze wandern sollten. Er selbst beraubte sich aller seiner Tische, Kanapees, Kandelaber und sonstiger Möbel aus massivem Silber (Meisterwerke des ausgezeichneten Goldschmieds Balin nach Zeichnungen von Le Brun); sie hatten 10 Millionen gekostet und brachten 3 ein. Der Ertrag aus den Silbermöbeln der Privatpersonen belief sich auf dieselbe Summe. Neue Einschmelzungen im Jahre 1711 lieferten wieder 3 Millionen, doch wurde beide Male ein großer Teil der Geräte durch Verheimlichung gerettet. Einen kurzen Aufschwung erlebte dieser Luxus in Laws Zeit (1716-20): 20-25 Millionen Edelmetall wurden für Goldschmiedearbeiten verwandt. Ein Maler, der sich durch unsinnige Verschwendung auszeichnete, besaß außer einem fürstlichen Tafelgeschirr auch Tischchen, Spiegel, Orangenkübel, Blumentöpfe, Küchengeräte aus massivem Silber. Zu den häufig in Silber gearbeiteten Gegenständen gehörten u. a. Wasserkrüge, Lichtputzer, Salzfässer usw. In England scheint die Manufaktur von Silbergeschirr unter Königin Anna einen plötzlichen Aufschwung genommen zu haben, worauf der vermehrte Gebrauch des Tees großen Einfluß übte. In der Zeit von 1765-1780 nahm der Gebrauch von silbernen Teemaschinen, Terrinen, Tee- und Kaffeekannen, Präsentiertellern, und Weinkühlflaschen sehr zu; silberne Teller und Deckel verbreiteten sich bis in die untersten Klassen, Uhren bis zu den Ärmsten, und die Vergoldungen der inneren Wohnungsräume absorbierten bereits viel Gold. »Das Haus manches Amsterdamer Kaufherrn tat es (1792) in schwerem Prunk fürstlichen Palästen zuvor, und im Haag sah man wohl einzelne Gärten durch massive Silbergitter von der Straße geschieden«. Professor Gottfried Sell, der eine reiche Holländerin geheiratet hatte, hielt (1735) in seinem Hörsaal in Göttingen silberne Spucknäpfe und silberne Kandelaber. Die Juwelen des Grafen Wartenberg wurden bei der Taxation seines Vermögens nach seinem Tode (1711) auf 100.598 Taler, der Metallwert der silbernen Geräte und Möbel auf 18.896 Taler geschätzt.
Auch in den Palästen der russischen und polnischen Großen sah man im 18. Jahrhundert in Zimmern mit getünchten Wänden, rohem Holzwerk, plumpem und schlecht gearbeitetem Gerät große Massen von Edelmetall. Fürst W. W. Golizyn (1643-1714) besaß 400 silberne Schüsseln. In dem Palast Karl Radziwills zu Nieswiesch waren tausend goldene und silberne Kostbarkeiten zur Schau gestellt, darunter Tische aus gegossenem Silber, vor allem die Statuen der zwölf Apostel, jede zwei Fuß hoch, aus lauterem Golde gegossen.
In den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts befanden sich in England wahrscheinlich 10.000 Familien, deren jede von Artikeln verschiedener Art in Gold und Silber einen Wert (bloß nach dem Metallgewicht) von 500 Lstr., und ungefähr 150.000 Familien, deren jede für 100 Lstr. (Anschaffungskosten) Luxusartikel aus Gold und Silber besaß; kleine Artikel solcher Art, wie Ohrringe, Löffel und dgl., besaßen auch die ärmsten Tagelöhnerfamilien. Frankreich verbrauchte 1855 (nach M. Chevalier) für 60 Millionen Frcs. Gold und Silber außer der Verwendung beider Metalle als Zirkulationsmittel; 1880 wohl mehr als 70 Millionen. Fast ebenso groß ist der Bedarf Englands, wo übrigens die Verarbeitung des Golds für Schmuck und Geräte sich in einem Jahrzehnt (1870 bis 1880) mehr als verdoppelt hat, während die des Silbers in der gleichen Zeit stationär blieb.
In welchem Verhältnis der Silberluxus in Rom seit dem Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. zu dem des modernen Europa stand, wird nach den ungenügenden und vereinzelten Angaben, die wir besitzen, schwerlich mit einiger Sicherheit beurteilt werden können. Wenn es schon vor den Sullanischen Kriegen in Rom über 100 Schüsseln von je 100 Pfund (römisch, fast 33 Kilogr.) gab, deren manche ihren Eigentümern die Proskription zuzogen; und wenn ein Sklave des Claudius, Rotundus, Dispensator im diesseitigen Spanien, eine Silberschüssel von 500, mehrere seiner Begleiter solche von 250 römischen Pfund (164, bezw. 82 Kilogr.) besaßen: so hat man auch hier vielleicht eine diesen Zeiten eigentümliche Art des Luxus zu erkennen, der Mode und Eitelkeit eine ungewöhnliche Verbreitung gaben, wie z. B. in Paris im 13. Jahrhundert mit Prachtgefäßen (aus Gold, Silber, Kristall, mit Edelsteinen besetzt oder emailliert), »in deren Fertigung die mittelalterliche Goldschmiedekunst ihresgleichen suchte«, großer Luxus getrieben wurde, während die Zimmer sehr dürftig möbliert waren. »Der größte Teil des Vermögens wurde in Gold und Edelsteinen angelegt – Fürsten und Grafen häuften in Frankreich Goldmassen auf, die oft an die angestaunten orientalischen Reichtümer erinnern.«
Vermutlich wirkte aber hier, und so vielleicht auch bei dem Silberluxus des römischen Altertums, die Absicht mit ein, sich einen Reservefonds oder einen stets bereiten, der Verminderung nicht wie Geld ausgesetzten, leicht umzusetzenden oder zu verpfändenden und im Notfalle leicht fortzuschaffenden Schatz zu sichern. So legten die Bauern in Schweden zu Ende des 16. Jahrhunderts erübrigtes Geld in »starken döllpischen« silbernen Löffeln im Gewicht von 3 bis 4 Reichstalern an; selbst arme Bauern, die kein Bett besaßen, hatten deren mindestens für sich und ihre Frauen, reiche sollen bis 50, ja in älterer Zeit eine halbe Tonne voll gehabt haben. Ebenso schafften im Anfange des 19. Jahrhunderts und noch später reiche Hofbesitzer im Weichseldelta, wenn sie bereits silbernes Tee-, Kaffee- und Tischgeschirr, silberne Wagenverzierungen und Pferdegeschirr besaßen, silberne Spucknäpfe (nach glaubwürdiger Mitteilung auch silberne Nachttöpfe) an. Im Jahre 1720, wo der Lawsche Aktienschwindel sich seinem Ende näherte, ersetzte in Paris Gold und Silber das Kupfer und Zinn auch in den gemeinsten Geräten, selbst Nachttöpfen: auch diese Verwendung der Edelmetalle war doch wohl nicht allein durch das Übermaß des Luxus, sondern auch durch das Sinken der Aktien veranlaßt. Bei den jetzigen russischen und polnischen Juden sind Ankäufe von Juwelen und Geräten aus Edelmetall, die für ihr Vermögen und ihren sonstigen Besitz unverhältnismäßig groß sind, auch gegenwärtig ganz gewöhnlich; bettelhafte, mit Walnüssen handelnde Juden kaufen in Königsberg silberne Leuchter u. dgl., »um ein Pfandstück zu besitzen«. Wie im heutigen Orient, wo es »die Bedingung alles Reichtums ist, daß man ihn flüchten könne«, scheint auch im römischen Kaiserreich die Vorliebe für die Anlage in Juwelen, wenigstens in den östlichen Provinzen, bestanden zu haben: in einem Gleichnis Christi steckt der Kaufmann sein ganzes Vermögen in eine einzige Perle. Nicht wenige mögen auch ebensoviel Grund gehabt haben, stets auf alles gefaßt zu sein, wie der spätere Kaiser Galba, der unter Nero nicht einmal eine Spazierfahrt unternahm, ohne in einem zweiten Wagen eine Million Sesterzen in Gold mit sich zu führen. Die Anschaffung von Silber als Reservekapital mag infolge der seit Nero eingetretenen Münzverschlechterung je länger desto beliebter geworden sein. Der früher aus möglichst reinem Silber geprägte Denar erhielt nun einen Zusatz von unedlem Metall, der unter Nero 5-10, unter Trajan 15, unter Hadrian beinahe 20, unter Marc Aurel 25, unter Commodus 30, unter Septimius Severus 50 bis 60 Prozent betrug; und obwohl er so zu einer immer weniger vollwertigen Scheidemünze herabsank, blieb sein Münzwert doch der frühere. Schon zu Ende des 1. Jahrhunderts wurde bei größeren Summen Goldzahlung ausbedungen.
Auf die Absicht einer Verwendung des Silbergeräts als Wertobjekt läßt auch die Sitte der genauen Eingravierung von Gewichtsangaben schließen, die offenbar auch bei Inventarisierungen dienten, da der Besitz in Silber regelmäßig nach dem Gewicht angegeben wird; ferner die Sitte, bei festlichen Gelegenheiten vorzugsweise Silbergerät zu schenken. An den Saturnalien schenkten Arme oder Sparsame silberne Löffelchen, Reiche und Freigiebige silberne Schüsseln und Pokale, selbst goldene Schalen. Martial klagt über die jährliche Abnahme der Saturnaliengeschenke eines Freunds: vor 10 Jahren habe er Silbergerät im Gewicht von 4 Pfund erhalten, im fünften Jahre ein Geschenk von 1 Pfund Gewicht, im sechsten nur noch ein Schüsselchen im Gewicht von ⅔ Pfund, im siebenten ein Schälchen, das knapp ½, im achten und neunten Löffelchen, die weniger als ⅙ Pfund und als eine Nadel wogen. Bei Juvenal verschafft sich der Schlemmer die für seine kostspieligen Mahlzeiten erforderlichen Summen durch Verpfändung silberner Schüsseln und Zerbrechen eines Porträtmedaillons seiner Mutter. Ambrosius läßt den Wucherer zum Borger sprechen: er wolle, um ihm das gewünschte Geld zu schaffen, ererbtes Silbergerät zerbrechen; es sei kunstvoll gearbeitet, er werde viel verlieren, keine Zinsen könnten die getriebenen Figuren ersetzen, aber um eines Freundes willen wolle er den Verlust nicht scheuen, nach der Zurückzahlung werde er es wieder zurecht machen lassen.
Einen Begriff von der Größe des Silberluxus in der früheren Kaiserzeit gibt die Nachricht des Plinius, daß Pompejus Paullinus (Schwiegervater des Seneca) als Befehlshaber der Armee im unteren Germanien (im Jahre 58) 12.000 Pfund (also beinahe 4000 Kilogr.) Silber mit sich geführt habe. Ein so großer Vorrat war ohne Zweifel selten. Alexander Severus, dessen Haushalt für einen kaiserlichen äußerst bescheiden war, hatte an seiner Tafel auch bei Gastmählern kein goldenes Geschirr, und silbernes nicht über 200 Pfund (65½ Kilogr.). Doch mögen die Kredenztische in manchen großen Häusern sehr viel glänzender ausgestattet gewesen sein. Im Jahre 1868 hat der Silberfund in Hildesheim (im ganzen etwa 60 Stück) daran erinnert, wie reich die Tafeln römischer Feldherren, Beamten, Offiziere und Kaufleute auch in Germanien mit Silbergeschirr besetzt waren, wovon natürlich manches als Kriegsbeute oder sonst in die Hände der rechtsrheinischen Deutschen kam.
Die übrigen Angaben des Plinius sind wenig geeignet, bestimmte Vorstellungen gewinnen zu lassen, zum Teil weil sie zu hyperbolisch sind, z. B. daß Frauen andere Badewannen als silberne verschmähten. Er bestätigt aber auch, daß der Gebrauch des Silbers bis zu einem gewissen Grade in den mittleren und unteren Ständen verbreitet war. Soldaten hatten Silberbeschlag an Schwertgriffen und Gürteln, silberne Kettchen an den Schwertscheiden, Frauen aus dem Volke trugen silberne Spangen an den Füßen, und selbst Sklavinnen besaßen silberne Handspiegel. Die Ausgrabungen von Pompeji, dessen Bewohner nach der Verschüttung die meisten Häuser durchsucht und das Wertvollste daraus fortgeschafft haben, haben aus diesem Grunde an Silbergefäßen nur eine verhältnismäßig bescheidene Ausbeute ergeben; doch der 1894 in der noch unberührten Villa eines Pompejaners bei Boscoreale gefundene Silberschatz besteht allein aus 109 Stücken (wovon gegen 100 zum Tafelgeschirr gehören). Auch in den Provinzen, namentlich Spanien und Gallien, sind Silbergefäße in nicht geringer Anzahl gefunden worden: der Fund von Bernay in der Normandie (1830) bestand aus 69 Gegenständen in getriebener Arbeit.
Im Luxus der Totenbestattungen hat das römische Altertum wohl alle späteren Zeiten weit überboten. Manche im Wesen der römischen Kultur begründete Momente wirkten mit der Neigung, die Größe des Schmerzes auch durch Verschwendung zu bestätigen, und mit der Prachtliebe zusammen, um diesen Luxus zu einer außerordentlichen Höhe zu steigern: die Auffassung der Pflichten der Lebenden gegen die Toten, die Vorstellungen von deren Fortdauer und der Wunsch, ihr Andenken bei der Nachwelt als ein unvergängliches zu erhalten. Schon die Zwölftafelgesetze enthielten eine Anzahl von Bestimmungen zur Einschränkung des Bestattungsluxus. Eine derselben, daß man den Leichen kein andres Gold auf den Scheiterhaufen oder in die Gruft mitgeben solle als das, mit welchem ihre Zähne befestigt seien, zeigt zugleich, wie früh die Zahnheilkunde in Rom geübt worden ist.
Jede feierliche Bestattung verursachte beträchtliche Kosten schon durch den Leichenzug, dem Chöre von Flöten-, Horn- und Tubabläsern vorausgingen, und in welchem andre Chöre von Tänzern und Mimen Tänze und dramatische Szenen aufführten, wobei auch (wenigstens zuweilen) der Verstorbene selbst dargestellt wurde. Ganz besonders prachtvoll aber und entsprechend kostspielig waren die Leichenbegängnisse von Personen des hohen Adels, bei welchen ein den Toten zu Grabe geleitender Zug der Ahnen das Hauptschauspiel war. Zu Darstellern derselben wählte man Personen (hauptsächlich Schauspieler), welche ihnen an Gestalt und Größe soviel wie möglich glichen. Diese trugen die in den Atrien vornehmer Häuser oft seit Jahrhunderten aufbewahrten Bilder der Ahnen, d. h. deren dem Leben möglichst treu nachgebildete Wachsmasken, vor dem Gesicht und erschienen in den ehrenvollsten Trachten, zu deren Anlegung jene berechtigt gewesen waren: die kurulischen Magistrate in der purpurumsäumten Toga, die Zensoren in der Purpurtoga, die Triumphatoren im goldgestickten Purpur, unter dem Vortritt von Liktoren mit Rutenbündeln und Beilen und umgeben von allen übrigen Attributen der bekleideten Ämter und Würden. Die Zahl der Tragbahren und Wagen, auf welchen diese Gestalten der Vorzeit der Totenbahre voraus zogen, belief sich oft auf mehrere Hundert. Als im Jahre 22 n. Chr. Junia Tertulla, die Schwester des Marcus Brutus, Gemahlin des Gajus Cassius, starb, »gingen die Bilder von zwanzig der erlauchtesten (verwandten) Familien ihr voran, die Manlier, Quinctier und andre von ebenso hohem und altem Adel, doch vor allen glänzten Brutus und Cassius, gerade darum, weil ihre Bilder nicht zu sehen waren«. Auch bei dem Leichenbegängnisse des Sohnes des Kaisers Tiberius, Drusus (im folgenden Jahre) war das Schauspiel durch das Gepränge der Ahnenbilder überaus prachtvoll. Man sah Aeneas als Stammvater des Julischen Geschlechts, die sämtlichen Könige von Alba, den Gründer Roms, König Romulus, sodann den sabinischen Adel, Attus Clausus, den Urahnen des gewaltigen Stamms der Claudier, und dessen übrige Häupter in unermeßlicher Reihe vorüberziehen. Mochte auch der Apparat solcher Darstellungen größtenteils von den verwandten Familien geliefert werden, welche die Masken aus ihren Ahnensälen hergaben, so erforderte der ganze Zug doch selbstverständlich einen nicht geringen Aufwand.
Sodann wurde ein großer Luxus mit Wohlgerüchen sowohl bei dem Leichenzuge selbst als bei der Bestattung getrieben, wo man sie auf den Scheiterhaufen oder bei Begräbnissen auf die Leiche selbst schüttete und träufelte. Deshalb wurden auch von solchen, die den Toten und dessen Familie ehren wollten, Wohlgerüche zur Bestattung gesandt. Am allgemeinsten wurde der Weihrauch angewandt, »den man den Göttern körnerweise streute, zu Ehren der Leichen in Massen darbrachte«. In Ostia wurden z. B. bei der Bestattung eines dem Dekurionenstande angehörigen Jünglings auf Gemeindekosten zwanzig römische Pfund (6,55 Kilogramm), bei der Bestattung einer Frau aus der städtischen Aristokratie fünfzig Pfund (16,37 Kilogramm) Weihrauch verbraucht. Nach Plinius kostete von den drei im Handel befindlichen Sorten des Weihrauchs das römische Pfund je 6, 5 und 3 Denar (etwa 5,20, 4,35, 2,60 Mark). Andre kostbarere Wohlgerüche scheinen, wie überhaupt, so auch bei Leichenbegängnissen, außerhalb Roms selten gebraucht worden zu sein. In Rom dagegen war bei Bestattungen der Reichen und Vornehmen die Verschwendung der teuersten Wohlgerüche Arabiens und Indiens oft eine ungeheure. Der Günstling Domitians, Crispinus, der an jedem Morgen von Amomum triefte, duftete nach Juvenal »stärker als zwei Leichenbegängnisse«. Bei Sullas Bestattung sollen die Frauen Roms so viel Spezereien und Wohlgerüche herbeigebracht haben, daß zwei sehr große Figuren, Sullas und eines Liktors, »aus teurem Weihrauch und Zimmet« hergestellt werden konnten; beide wurden, wie es scheint, in dem aus 210 Wagen bestehenden Zuge der Ahnen mitaufgeführt. Bei der Bestattung Poppäas im Jahre 65 n. Chr., deren nach orientalischer Sitte mit Spezereien gefüllter Leib im Mausoleum des Augustus beigesetzt wurde, soll Nero nach der Schätzung Sachverständiger mehr Wohlgerüche haben verbrennen lassen, als Arabien in einem Jahre erzeugte. Bei der Bestattung der Annia Priscilla, Gemahlin des Flavius Abascantus, Freigelassenen und Sekretärs des Kaisers Domitian, im Jahre 95, deren Leib ebenfalls mumifiziert in einem Marmorsarkophage beigesetzt wurde, erfüllten (nach einer poetischen Beschreibung) die Ernten Arabiens und Ciliciens, der Sabäer und Inder, sowie Safran und Myrrhen und der Balsam von Jericho mit ihren Düften die Luft.
Auch die Ausstattung der Scheiterhaufen war ein Gegenstand des Luxus. Allerdings wissen wir nur von denen der Kaiser, daß sie (wenigstens im 3. Jahrhundert) in mehreren Stockwerken pyramidalisch aufgebaut, über und über mit goldgestickten Teppichen, Gemälden und Reliefs bedeckt, den Flammen preisgegeben wurden. Doch da Plinius von der Bemalung der Scheiterhaufen spricht, darf man vermuten, daß zuweilen auch bei der Bestattung von Privatpersonen diese Pracht nach Vermögen nachgeahmt wurde.
Die Urnen, in welchen die Asche, sowie die Sarkophage, in welchen die Leichen beigesetzt wurden, waren oft durch Material und Arbeit kostbar. Goldene und silberne Urnen werden selten gewesen sein (Trajans in dem Postament seiner Ehrensäule beigesetzte Aschenurne war aus Gold), dagegen waren sie offenbar häufig aus teuern und seltenen Steinarten. Eine Urne aus orientalischem Alabaster umschloß die mit Setinerwein gelöschte Asche und die Gebeine des Philetus, eines Sklaven des Flavius Ursus (etwa im Jahre 90). In einem Kolumbarium kaiserlicher Freigelassener und Sklaven aus den beiden ersten Jahrhunderten ist (außer mehreren plastisch verzierten marmornen Aschengefäßen) eine ebenfalls aus orientalischem Alabaster gearbeitete Urne eines kaiserlichen Sklaven Africanus gefunden worden, der sich dort auch laut der Inschrift »eine kleine Kapelle mit Gitter und bronzenen Ornamenten« hatte machen lassen. Eine in einem Grabe zu Pompeji gefundene gläserne Aschenurne mit weißen, erhabenen Figuren auf dunkelblauem Grunde, welche eine Weinlese von Genien darstellen, gehört zu den schönsten aus dem Altertum erhaltenen Glasarbeiten. Der Sarkophag, der die Überreste Neros enthielt, welche von seiner ehemaligen Geliebten Acte und seinen beiden Wärterinnen Ecloge und Alexandria bestattet wurden, war aus ägyptischem Porphyr; darauf stand ein Altar von carrarischem Marmor, rund herum lief eine Einfassung von thasischem (weißem) Marmor. Wie überaus reich Sarkophage und Urnen oft mit künstlerischem Schmuck ausgestattet waren, ist allbekannt.
Eine andre Art der Verschwendung wurde durch die Sitte veranlaßt, zugleich mit den Toten Gegenstände aller Art zu begraben oder zu verbrennen, deren sie sich im Leben bedient hatten, wie Kleider, Waffen, Schmuck, Geräte, Kinderspielzeug usw. Diese Sitte beruhte auf der Vorstellung einer körperlichen Fortdauer der Abgeschiedenen, zugleich aber wollte man ganz besonders in dieser Verschwendung die Größe und Leidenschaftlichkeit des Schmerzes über den erlittenen Verlust offenbaren. Bei Lucian sagt ein Witwer, daß er seine Liebe zu seiner seligen Frau durch Verbrennung ihres ganzen Schmucks und ihrer Kleider bei ihrer Bestattung bewiesen habe. Der Redner Regulus, der bei dem Verlust eines etwa 14- oder 15jährigen Sohns mit seinem Schmerze Ostentation trieb, ließ an dessen Scheiterhaufen die zahlreichen Ponys und Ponygespanne, großen und kleinen Hunde, Nachtigallen, Papageien und Amseln schlachten, die der Knabe besessen hatte. Namentlich wurden die Leichen in möglichst prachtvolle Gewänder gehüllt dem Scheiterhaufen oder der Gruft übergeben. Selbst ein so strenger Philosoph wie Cato von Utica zeigte bei dem Tode seines geliebten Halbbruders Quintus Servilius Cäpio zu Aenus in Thracien, wie sehr ihn der Schmerz überwältigte, »auch durch den Aufwand bei der Bestattung und die Verbrennung von kostbaren Gewändern und Wohlgerüchen«. Die Erben des in der weltbekannten Pyramide zu Rom bestatteten Gajus Cestius (eines Zeitgenossen des Augustus) legten den Erlös der Attalischen (mit Gold durchwirkten) Teppiche, welche sie ihm nach dem Edikt der Ädilen nicht, wie er im Testament bestimmt hatte, ins Grab mitgeben durften, zu der für die Erbauung der Pyramide erforderlichen Summe hinzu. Eine ernstliche Handhabung der den Bestattungsluxus einschränkenden Gesetze, welche den Ädilen oblag, hat übrigens in der Kaiserzeit wohl ebensowenig stattgefunden wie bei den übrigen Luxusgesetzen. Nero wurde in weißen, golddurchwirkten Teppichen bestattet, deren er sich beim Empfange am letzten Neujahr vor seinem Tode bedient hatte; die oben erwähnte Annia Priscilla in tyrischem Purpur.
Über die Gesamtkosten sowohl glänzender als bescheidener Bestattungen haben wir einige Angaben. Die Kurie, d. h. der Stadtrat von Pompeji, bewilligte bei dem Tode eines dortigen Ädilen außer dem Boden für das Grabmal 200 Sesterzen (435 Mark) für das Leichenbegängnis, dieselbe Summe (und überdies eine Reiterstatue) bei dem Tode eines Duumvirn (des höchsten städtischen Beamten): dies galt also für die Ausrichtung einer ehrenvollen Bestattung dort schon als hinreichend. Ein Veteran in Lambäsis hatte für Bestattung und Grabmal zusammen in seinem Testamente nur 2000 Sesterzen ausgesetzt, doch die Hinterbliebenen fügten noch 500 hinzu. Aber für die Bestattung eines Sorrentiners, der in seiner Vaterstadt die höchsten Ämter und Priestertümer bekleidet hatte, bewilligte der dortige Stadtrat (außer zwei Statuen und dem Boden für das Grabmal) 5000 Sesterzen (1087 Mark). Ganz andere Summen wurden natürlich in Rom ausgegeben. Ein Freigelassener, Cäcilius Isidorus, der in seinem vom 27. Januar 8 v. Chr. datierten Testament angab, daß er trotz großer Verluste 4117 Sklaven, 3600 Joch Ochsen, 257.000 Stück andern Viehs und 60 Millionen Sesterzen (über 13 Millionen Mark) bar hinterlasse, hatte für seine Bestattung eine Million Sesterzen (gegen 218.000 Mark) ausgeworfen. Diese Summe, welche Plinius ihrer Merkwürdigkeit wegen berichtet, war ohne Zweifel eine ganz exorbitante, denn auch die offenbar beträchtlichen Kosten der Bestattung Neros beliefen sich nur auf 200.000 Sesterzen (43.500 Mark). Bei der Bestattung Vespasians erhielt der Schauspieler, welcher den verstorbenen (wegen seiner Sparsamkeit viel gescholtenen und verspotteten) Kaiser darstellte, auf seine Frage, wie viel der Zug und das Leichenbegängnis koste, von den Prokuratoren zur Antwort: 10 Mill. Sesterzen; worauf er ausrief, man möchte ihm 100.000 Sesterzen geben, dann möge man ihn in den Tiber werfen. Wie groß die Pracht der Kaiserbestattungen auch schon damals gewesen sein mag, so ist es doch mindestens zweifelhaft, ob hier nicht, um die beabsichtigte komische Wirkung herbeizuführen, absichtlich eine fabelhafte Summe genannt wurde.

101. CIRCUS-RENNFAHRER.
Marmor. Rom, Vatikan
Einen noch größeren Aufwand aber als die Leichenbegängnisse selbst verursachte die Sitte angesehener und vornehmer Familien, die ganze Gemeinde an der Totenfeier teilnehmen zu lassen, indem man bei der Bestattung selbst oder später zum Gedächtnis der Verstorbenen Bewirtungen und Schauspiele, namentlich Gladiatorenkämpfe, veranstaltete. Zahlreiche Beispiele solcher Totenfeste sind bereits aus der Zeit der Republik bekannt. Oft wurden sie letztwillig angeordnet. Nach Horaz hatte ein Staberius in seinem Testamente verfügt, daß seine Erben die Summe der Hinterlassenschaft in das Grabmal einhauen, falls sie dies unterließen, ein Kampfspiel von 100 Fechterpaaren und eine öffentliche Mahlzeit nach der Bestimmung eines bekannten Verschwenders Arrius geben sollten. Auch in den Städten Italiens bestand diese Sitte schon in der Zeit der Republik. So bewirtete z. B. ein Duumvir zu Sinuessa beim Tode seines Vaters die Bürger der Stadt mit Honigwein und Gebackenem (wohl bei der Bestattung selbst), veranstaltete für sie und die Bewohner eines nahen Fleckens ein Gladiatorenspiel, und für die Bürger und alle Angehörigen seines Geschlechts ein Gastmahl. Allem Anschein nach blieb dergleichen in der Kaiserzeit häufig. Der jüngere Plinius lobt einen Freund, daß er der Stadt Verona ein Fechterspiel versprochen habe, da er dort so allgemeine Liebe und Achtung besitze und überdies dem Andenken seiner verstorbenen Frau, einer Veroneserin, eine solche Feierlichkeit schuldig sei. Freilich habe man auch so allgemein in ihn gedrungen, daß er es nicht abschlagen konnte. Doch verdiene seine Freigebigkeit in der Ausstattung noch besonderes Lob, denn gerade in solchen Dingen zeige sich ein großer Sinn. Unter anderm war zu diesem Schauspiel eine Anzahl von Panthern aus Afrika verschrieben worden. Unter Tiberius ließ einmal in einer Stadt Italiens der Pöbel den Leichenzug eines Offiziers den Marktplatz nicht eher überschreiten, als bis er den Erben das Versprechen eines Fechterspiels abgetrotzt hatte. Statt der Bewirtungen bei Totenfeiern erfolgten auch Geldverteilungen. In Gabii verteilte ein Seidenhändler bei der Einweihung des seiner Tochter errichteten Grabtempels (im Jahre 168) an die Honoratioren des ersten Stands je 5, an die des zweiten je 2, an die Ladeninhaber innerhalb der Stadtmauern je 1 Denar und zahlte außerdem 100.000 Sesterzen (21.750 Mark) an die Stadtkasse, von deren Zinsen jährlich am Geburtstage seiner Tochter die Honoratioren der beiden ersten Stände öffentlich an besonderen Tafeln gespeist werden sollten. Ähnliche Urkunden über Stiftungen zur Bestreitung jährlicher Gedächtnismahle für Tote sind zahlreich erhalten.
Endlich stand die Pracht und Großartigkeit der Grabdenkmäler sowie der Reichtum ihrer äußeren und inneren Ausstattung und Dekoration nicht bloß im Verhältnis zu dem übrigen, in seiner Art einzigen Kunstluxus jener Zeit, sondern wurde durch mannigfache Rücksichten noch sehr erhöht; auch hier haben gesetzliche Einschränkungen allem Anschein nach so gut wie nichts gefruchtet. Den so allgemeinen, oft bis zur Leidenschaft gesteigerten Wunsch, im Andenken der Nachwelt fortzuleben und auch seinen Angehörigen ein solches Fortleben zu sichern, meinte man am besten durch Bauten zu erreichen, deren hochragende, für die Ewigkeit gegründete, mit architektonischem und plastischem Schmuck aufs reichste ausgestattete Massen die staunenden Blicke noch der spätesten Geschlechter auf sich ziehen sollten. Sodann forderte der Kultus der Toten nicht bloß Räumlichkeiten und Vorrichtungen für die am Grabe abzuhaltenden Opfer, sondern veranlaßte auch öfters die Errichtung der Grabmäler in Form von Tempeln und tempelartigen Gebäuden. Endlich führte die Vorstellung von einem körperlichen Fortleben der Toten zur Anlegung der letzten Ruhestätten (der »ewigen Behausungen«) in der Art von Wohnungen (sowie ihrer Ausstattung mit Gegenständen des Gebrauches im Innern), welche auch oft mit Gärten umgeben wurden.
Bei dem Mangel an allgemeineren Begräbnisplätzen mußten diejenigen, welche nicht auf ihrem eigenen Grund und Boden Grabstätten errichten konnten, geeignete Grundstücke, gewöhnlich an Landstraßen, erwerben. Diese häufigen Familienbegräbnisse waren in der Regel nicht bloß für die Angehörigen und Nachkommen des Stifters, sondern auch für seine männlichen und weiblichen Freigelassenen und deren Nachkommen bestimmt. In der Schenkung eines Begräbnisplatzes an die Gemeinde zu Sassina in Umbrien werden für jedes einzelne Grab hundert Quadratfuß bestimmt. Dieser Raum genügte aber schon für ein Familienbegräbnis: das eines Freigelassenen des Trajan, welcher Direktor des kaiserlichen Postbureaus in Rom war, hatte nicht mehr als 10¼ Fuß im Quadrat. Doch waren größere auch in der Zeit des Verbrennens nicht ungewöhnlich. Das Grabmal des N. Istacidius zu Pompeji z. B. hat einen Flächeninhalt von 15 x 15 = 225 Quadratfuß. Der Gemüsegärtenpächter Geminius Eutyches in Rom wollte das seine auf einer Fläche von 20 Fuß im Quadrat erbauen, Grabstätten von 25 x 25 = 625 Quadratfuß, von 25 x 30 = 750 Quadratfuß, von 26 x 35 = 910 Quadratfuß (die beiden letzteren in Ostia) waren offenbar nicht ungewöhnlich. Es gab deren aber auch, die einen Morgen (28.000 Quadratfuß) umfaßten, und noch größere. Der Trimalchio des Petronius bestimmt seine Grabstätte, auf welcher sich außer dem Monumente Wein- und Obstpflanzungen, auch ein Wächterhäuschen, befinden sollten, auf 20.000 Quadratfuß. Als Preis des für das zu errichtende Grabmal gekauften Bodens werden einmal 100.000 Sesterzen angegeben.
Von der Pracht so vieler Mausoleen, die an den Landstraßen Roms und der übrigen Städte Italiens aus der unabsehbaren Menge der geringeren Grabmäler in imposanter Masse und Höhe emporragten, stehen nur noch einzelne, wie die Grabtürme der Cäcilia Metella und des Plautius (an der Straße nach Tivoli), das Torre d'Orlando genannte Denkmal des Munatius Plancus bei Gaeta und die Pyramide des Cestius. Die meisten sind spurlos oder bis auf mehr oder weniger dürftige Trümmer verschwunden, und Martials Wort hat sich erfüllt, daß man seine Gedichte noch lesen werde, wenn Feigenbäume ihre Wurzeln in die hohen Marmordenkmäler des Licinus und Messalla treiben, ja wenn diese Massen zu Staub zerfallen sein würden. Daß auch an kleineren Orten Italiens der Aufwand für Grabdenkmäler verhältnismäßig groß war, zeigen in Pompeji unter anderm die Überreste des einst sehr stattlichen Monuments der Mamia, eines tempelartigen Bauwerks mit Pilastern auf erhöhtem Unterbau. Das im Jahre 168 von dem oben erwähnten Seidenhändler in Gabii seiner Tochter errichtete Grabmal war laut der Inschrift ein Tempel mit der Bronzestatue der Verstorbenen als Venus und vier andern in Nischen aufgestellten Bronzestatuen, mit bronzenen Türen, einem Bronzealtar und sonstigem Schmuck.
Auch in den Provinzen fehlt es nicht an bedeutenden, ja prachtvollen Denkmälern. Das Grabgebäude eines begüterten Manns in Langres, wohl aus der früheren Kaiserzeit, enthielt nach dessen noch erhaltenen testamentarischen Bestimmungen in einem vorspringenden Raum wahrscheinlich zwei Statuen des Verstorbenen, wohl beide sitzend, aus bestem griechischen Marmor und bester Bronze zweiter Sorte. Vor dem Gebäude stand ein Altar »aus bestem carrarischem Marmor bestens gearbeitet«, der Asche und Gebeine des Toten in sich schloß. Auf dem dazugehörigen Grundstück befand sich ein Teich und Obstgärten, welche drei Gärtner mit ihren Lehrlingen in Ordnung zu halten hatten. Für die Instandhaltung des ganzen Komplexes von Gebäuden waren (wie ohne Zweifel in der Regel) Bestimmungen getroffen.
Hier und da haben sich römische Grabdenkmäler auch in den Provinzen erhalten. Das 23 Meter hohe, aus festem grauen Sandstein aufgeführte, reich ornamentierte und mit (ehemals polychromen) Bildwerken geschmückte der Secundinier zu Igel bei Trier gehört zu einer großen, in der Maas- und Moselgegend offenbar sehr beliebten (in kleineren Exemplaren aber auch im rechtsrheinischen Germanien bis nach Regensburg hin verbreiteten) Klasse von Denkmälern. Von vielen ähnlichen (skulpierten, mindestens 3 Meter hohen Pfeilergräbern, die auf der Vorderseite Porträts der Verstorbenen, auf den übrigen sehr realistische, ehemals bemalte Reliefdarstellungen aus ihrem Leben enthielten) sind Bruchstücke vorhanden, die teils aus Luxemburg, teils aus Arlon in Belgien stammen, besonders zahlreich aber durch Ausgrabungen in Neumagen (seit 1877/78) zutage gefördert worden sind. Die vom Volke für ein Grabmal des Pilatus gehaltene sogenannte Aiguille zu Vienne ist »eine hochragende, auf einen Janusbogen gesetzte Pyramide, von gewaltigen Steinen getürmt, ohne allen ornamentistischen Schmuck«. Das bis zur Spitze des Kegeldachs 17,90 m hohe römische Mausoleum der Julier zu St. Remy (in der Nähe von Tarascon) ist in der Zeit des Übergangs der Republik zur Monarchie einem Ehepaare von seinen drei Söhnen errichtet worden. Ein auf Stufen emporsteigender, mit malerisch bewegten Reliefdarstellungen der Taten und des Ruhms des verstorbenen Vaters geschmückter viereckiger Unterbau trägt eine ebenfalls viereckige, nach allen Seiten offene korinthische Bogenhalle, und diese wieder einen offenen Rundtempel von zehn korinthischen Säulen mit einer kegelartigen Kuppel, welcher die Statuen der beiden Gatten enthielt. Der sogenannte Turm der Scipionen bei Tarragona, ein großes, freistehendes Denkmal, rührt wohl aus Augusteischer oder wenig späterer Zeit her. In der ostjordanischen Landschaft stehen noch zahlreich die dort als römische Grabmonumente beliebten viereckigen Türme, die zugleich als Taubenhäuser dienten. Das Denkmal des Präfekten der in Lambäsis stationierten dritten Legion, Titus Flavius Maximus, ein viereckiger, auf einem Sockel stehender, von einer Pyramide gekrönter Steinbau (im ganzen 6-7 Meter hoch), wurde nach einer Erschütterung durch ein Erdbeben 1849 von der dortigen französischen Garnison von Grund aus restauriert. Die in einer bleiernen Urne (welche bei der Berührung auseinanderfiel) gefundene Asche des Toten ward in einer Umhüllung von Zink aufs neue bestattet, und ein ganzes Bataillon erwies durch eine Salve den Manen des römischen Offiziers die letzten militärischen Ehren. Das weit südlich von den Salzseen gelegene, 1894 entdeckte Mausoleum eines Appulejus Maximus von Amruni ist mit einer Darstellung des Abschieds von Orpheus und Eurydice geschmückt. Heinrich Barth kam (1850) auf seinen Wanderungen von Tripolis in das Innere des Lands und auf der Reise nach Mursuk an zahlreichen, zum Teil sehr imposanten Ruinen römischer Grabdenkmäler vorüber, die in früheren Jahrhunderten Gegenstände der religiösen Verehrung der Berberstämme gewesen waren. Am nördlichen Rande der Hamâda (31-30° n. Br.) fand er deren zwei von etwa 15 und 8 Meter Höhe, die »wie einsame Leuchttürme der Macht und Bildung aus der meerähnlichen Fläche der wüsten Hochebene ragten«, beide vortrefflich erhalten. Die Bauart ist bei beiden dieselbe: auf einer mehrstufigen Basis (welche die Grabkammer einschließt) erheben sich zwei vierseitige, mit korinthischen Ecksäulen geschmückte, reich mit Ornamenten und Skulpturen (darunter Porträts der Verstorbenen) ausgestattete Stockwerke, die von einer Pyramide gekrönt werden. Das südlichste dieser Monumente (ein vierseitiger, einstöckiger, von korinthischen Pilastern eingefaßter Bau mit hohem Hauptgesimse, auf dreistufiger Basis) bei Alt-Djerma (Garama 26° 22' n. Br.) beweist, daß die Römer längere Zeit die tripolitanische Wüstenstraße beherrscht haben.
Die Kosten der Grabdenkmäler, die oft testamentarisch bestimmt waren (wo dann zuweilen die Erben zu den angesetzten Summen freiwillig Zuschüsse machten), sind in einer Anzahl von Grabinschriften genau angegeben. Die Summen steigen von 200 bis 100.000 Sesterzen (43,5 bis 21.750 Mark). Das Grabmal eines Dekurionen des römischen Augsburg, welcher zu Epfach starb und bestattet wurde, kostete 600 Sesterzen (130 Mark); das des Legionspräfekten Flavius Maximus zu Lambäsis das Doppelte. Die Grabmäler, deren Preise wir kennen, sind aber so gut wie sämtlich für Soldaten und Offiziere niederer Grade (höchstens Legionstribunen) in Algerien und für Honoratioren der Städte Italiens und der Provinzen errichtete. Daß die Monumente der Großen Roms ganz andre Summen erforderten, zeigt schon der Preis desjenigen, das der jüngere Cato seinem Halbbruder zu Aenus in Thracien aus thasischem Marmor aufführen ließ, gegen 38.000 Mark; doch in der Kaiserzeit wird auch diese Summe schwerlich für eine ungewöhnlich hohe gegolten haben. Wenigstens verwendet die Witwe eines Sulpicius Similis – es kann wohl kaum der früher erwähnte Gardepräfekt unter Hadrian gemeint sein – in Rom auf das Grabmal ihres Gatten und ihrer beiden Söhne nebst den zugehörigen Baulichkeiten nicht weniger als 400.000 Sesterzen (87.000 Mark).
Das prachtvollste Mausoleum des gesamten römischen Altertums war das Hadrians; und mag es auch alle übrigen so weit hinter sich zurückgelassen haben wie seine Villa bei Tivoli alle andern Villen, so gibt es immerhin einen hohen Begriff von der Pracht und Großartigkeit der Denkmäler, die in der Herrlichkeit dieses unvergleichlichen Baus gipfelte. Hadrian hatte ihn schon sechs Jahre vor seinem Tode begonnen, aber erst Antoninus Pius vollendete ihn im Jahre 139. Er konnte sich wohl mit den Pyramiden Ägyptens messen und hat vielleicht selbst gewisse Details der inneren Anlage denselben entlehnt. Der jetzt verschüttete quadratische Unterbau aus parischen, ohne Bindemittel zusammengefügten Marmorquadern überragte die Stadtmauer; jede seiner Seiten war nach Procopius eine Steinwurfsweite (104 Meter) lang. Der zylindrische Mittelbau von 73 Meter Durchmesser und Höhe (die Engelsburg) gibt nur von den kolossalen Dimensionen des Ganzen eine Vorstellung, über die architektonische Gestaltung und sonstige Ausstattung der höheren Teile ist nichts Gewisses bekannt. Eine Kolossalstatue Hadrians (vielleicht auf einem Viergespann) krönte dieses Mausoleum, in welchem mit Ausnahme des Didius Julianus sämtliche Kaiser und Mitglieder des Kaiserhauses von Hadrian bis auf Commodus bestattet worden sind. Die herrlichen, wohl sämtlich kolossalen Bildwerke »von Männern und Rossen«, mit denen es ausgestattet war, standen entweder auf der Plattform des Unterbaus oder (nach der neuesten Rekonstruktion) über dem Hauptgesimse des zylindrischen Geschosses. Dieses plastischen Schmucks wurde die Plattform ganz oder größtenteils schon im Jahre 537 beraubt. Als die Römer sich damals hier gegen die unter Witigis Rom belagernden Goten verteidigten, stürzten sie die Statuen auf die Köpfe der anstürmenden Feinde herab. Eine einzige derselben ist, wenn auch verstümmelt, noch vorhanden; der sogenannte Barberinische schlafende Faun, der beim Aufräumen des die Engelsburg umgebenden Grabens gefunden wurde und jetzt zu den Zierden der Glyptothek in München gehört. Im übrigen blieb das Denkmal bis zum Jahre 1379, wo es von den Römern zerstört wurde, im ganzen wohlerhalten.
Die Anfänge des Sklavenluxus fallen mit dem Aufschwunge des Sklavenhandels infolge der Eroberungen von Karthago und Korinth zusammen, die zugleich große Reichtümer und große Massen von Gefangenen nach Rom führten. Die große Vermehrung des Sklavenbesitzes führte mit Notwendigkeit zum Sklavenluxus: der Verkauf des Überschusses der Sklavenfamilien, die sich um so schneller vermehrten, je zahlreicher sie waren, und das Einkommen aus den Nutzungssklaven, deren Kaufpreise nicht hoch und deren Unterhaltung sehr wohlfeil war, gewährte zur Bestreitung dieses Luxus reichliche Mittel. Der Ertrag der Sklavenarbeit war ein sehr viel größerer als in neueren Zeiten, weil die Sklaven Geschäfte, Handwerke und Künste aller Art teils im Dienste und für Rechnung ihrer Herren betrieben, teils von ihnen an andre zu denselben Zwecken vorteilhaft vermietet wurden, so daß in der Tat der größte Teil von dem, was im jetzigen Europa durch freie Arbeit geleistet wird, im römischen Altertume von Sklaven getan wurde. Die Sklaverei war es auch, die jenen in der modernen Welt undenkbaren Kunstluxus möglich machte, von dem später zu reden sein wird.
Der Sklavenluxus bestand teils in der Unterhaltung nutzloser Sklaven zu Luxuszwecken, teils (da sich der Luxus vorzugsweise auf die wohlfeilsten Waren wirft) in der Verschwendung der Arbeitskraft, namentlich durch eine bis zum Übermaß getriebene Arbeitsteilung, wobei auch die geringfügigsten Dienste durch besondere Sklaven versehen wurden. In dieser Beziehung glichen die römischen großen Haushaltungen denen aller Länder, in denen die Arbeitskraft fast wertlos ist, namentlich denen des früheren Rußland. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts hatten manche Paläste in Moskau bis 1000 Bediente und darüber, die so schwach beschäftigt waren, daß einer vielleicht nur das Mittagstrinkwasser, ein andrer nur das Abendtrinkwasser zu holen hatte. Auch in Bukarest, wo man 1866 bei einer Bevölkerung von etwa 100.000 Seelen 30.000 Dienstleute zählte, wimmelten damals die Häuser von Domestiken. Jeder Diener hatte eine engbegrenzte Sphäre von Pflichten, und jede Bojarenfamilie von einigem Anspruch ihre Wäscherinnen, Bleicherinnen, Plätterinnen, ihre Badefrauen, Haarkräuslerinnen, Kammermädchen und Kinderwärterinnen, und ihren Schwarm von Lakaien, Köchen, Küchenjungen, Läufern, Kutschern, Pferdewärtern, Jägern usw. In den Inschriften der gemeinsamen Begräbnisstätten von Sklaven und Freigelassenen großer römischer Häuser kommen z. B. vor: Fackelträger, Laternenträger, Obersänftenträger, Begleiter auf der Straße, Verschließer der Kleider zum Ausgehen – die Besetzung dieser einen Abteilung des Dienstes für die Ausgänge der Herrschaft gibt einen Begriff von der übrigen. Die Verschwendung der Arbeitskraft wurde auch dadurch befördert, daß manches, was jetzt durch Maschinen oder Instrumente geschieht, damals durch Menschen geleistet wurde: so hatte man statt der Uhren Sklaven, die stets die Tageszeit anzugeben wußten. Als Maßstab für die Zahl der Sklaven in großen Häusern mag es dienen, daß unter Augustus der Sänger Tigellius, der aus einem Extrem ins andre fiel, bald 200, bald 10 Sklaven hatte, und daß im Jahre 61 sich in dem Palast des Stadtpräfekten Pedanius Secundus (des höchstgestellten Manns in Rom) 400 befanden.
Sodann suchte man soviel wie möglich sich von persönlichen Anstrengungen und Bemühungen, auch geistigen, durch Übertragung auf Sklaven zu befreien. »Bediene dich der Sklaven wie der Glieder deines Leibs, eines jeden zu einem andern Zwecke«, hatte schon Demokrit gesagt; doch »das römische Haus war eine Maschine, in der dem Herrn auch die geistigen Kräfte seiner Sklaven und Freigelassenen zuwuchsen; ein Herr, der diese zu regieren verstand, arbeitete gleichsam mit unzähligen Geistern«. Nicht nur diktierte man Sekretären und Stenographen und ließ sich vorlesen, man hatte auch wahrscheinlich sehr häufig »Studiensklaven«, die für ihren Herrn lasen, Notizen, Auszüge, Vorarbeiten und Untersuchungen aller Art machten. Bezeugt ist dies allerdings nur von den Kaisern, doch bei dem großen Werte, der auf literarische Bildung und Beschäftigung gelegt wurde, darf man annehmen, daß diese Abteilung in den Sklavenfamilien vornehmer Haushaltungen gewöhnlich nicht fehlte. Nur so läßt sich z. B. die gewaltige schriftstellerische Tätigkeit des älteren Plinius bei einem durch geschäftsvolle Ämter scheinbar ganz ausgefüllten Leben begreifen, und namentlich zu seiner Naturgeschichte sind die massenhaften und vielartigen Vorarbeiten gewiß größtenteils, wenn nicht durchweg, von Sklaven und Freigelassenen gemacht worden. Und wenn Quintilian sagt, daß Seneca von denen, die in seinem Auftrage Untersuchungen anstellten, öfters durch falsche Angaben betrogen worden sei, so ist auch hier gewiß an Sklaven und Freigelassene zu denken.
Das Streben, so wenig wie möglich selbst zu tun, ja zu denken, wurde bis zur Lächerlichkeit übertrieben. Man wälzte nicht bloß die Mühe des Behaltens der Namen von Klienten und Anhängern auf das Gedächtnis der Nomenklatoren ab (»wir grüßen mit fremdem Gedächtnis«, sagt Plinius): es gab auch Leute, die sich von Sklaven erinnern ließen, um welche Zeit sie ins Bad, wann zur Tafel gehen sollten. Sie sind, sagt Seneca, so völlig erschlafft, daß es sie zu viel Anstrengung kostet, sich bewußt zu werden, ob sie Hunger haben. Einer von diesen Weichlingen hatte, als er aus dem Bade gehoben und in einen Ruhesessel niedergelassen worden war: gefragt: Sitze ich schon? Hundert Jahre später berichtet Lucian mit Erstaunen und Widerwillen, daß es bei den Vornehmen in Rom Sitte war, sich auf der Straße von vorausgehenden Sklaven benachrichtigen zu lassen, wenn irgendeine Unebenheit oder ein Anstoß zu vermeiden war, wenn der Weg eine Anhöhe hinauf oder einen Abhang hinab führte: »sie lassen sich erinnern, daß sie gehen, und wie Blinde behandeln«. Die ihnen Nahenden mußten zufrieden sein, wenn sie stumm angeblickt und statt von dem Herrn von jemandem aus dem Gefolge angeredet wurden. So konnte man auf den Gedanken kommen, selbst den Mangel eigener Bildung durch die Bildung von Sklaven zu ersetzen. Seneca erzählt, daß ein reicher Mann, den er noch gekannt hatte, Calvisius Sabinus, für unterrichtet zu gelten wünschte, obwohl er ganz ungebildet und ohne Gedächtnis war. Er ließ nun einen seiner Sklaven den ganzen Homer auswendig lernen, einen andern den Hesiod, andre die neun lyrischen Dichter: diese Sklaven mußten bei seinen Gastmählern hinter ihm stehen und ihm Verse angeben, die er in der Unterhaltung passend anbringen konnte. Jeder kam ihm auf 100.000 Sesterzen zu stehen: »ebensoviele Bücherkisten«, sagt einer seiner Parasiten, »würden dich weniger gekostet haben«. Derselbe Spötter forderte ihn auf, zu ringen, obwohl er im höchsten Grade krank und hinfällig war. Wie ist das möglich? fragte jener, ich lebe ja kaum! Sage das nicht! war die Antwort. Vergißt du denn, daß du so viele riesenstarke Sklaven hast?
Die eigentlichen Luxussklaven wurden besonders bei großen Gastmählern zur Schau gestellt, wo sie nicht nur die Gäste bedienen, sondern ihnen auch zur Augenweide und Unterhaltung dienen sollten. Sie waren nach Farbe, Rasse und Alter in Scharen abgeteilt, in welchen keiner durch einen stärkeren Flaum am Kinn, durch krauseres oder gelockertes Haar von den übrigen abstechen durfte. Schöne Knaben, »die Blüte Kleinasiens«, mit 100.000 oder gar 200.000 Sesterzen (21.750, bezw. 43.500 Mark) bezahlt, dienten als Mundschenken; man liebte es, an ihren Haaren die Hände abzutrocknen. Dagegen wurden Knaben aus Alexandrien verschrieben, weil die Bewohner dieser Stadt durch schlagfertigen und beißenden Witz berühmt waren: zu boshaften Antworten förmlich abgerichtet, hatten sie das Recht, ihren Spott voll frühreifer Verdorbenheit nicht bloß gegen den Hausherrn, sondern auch gegen seine Gäste zu richten. Frauen ließen kleine Kinder nackt um sich spielen und sich durch ihr unschuldiges Geschwätz unterhalten. Doch wurden auch, wie an den Höfen früherer Jahrhunderte, Zwerge, Riesen und Riesinnen, »echte« Kretins, angebliche Hermaphroditen und andere Abnormitäten und Mißgeburten gehalten und vorgeführt; es gab selbst in Rom einen »Markt der Naturwunder«, auf dem »wadenlose, kurzarmige, dreiäugige, spitzköpfige« Menschen zu kaufen waren; die Zwerggestalt wurde durch künstliche Vorrichtungen hervorgebracht, und zahlreiche groteske Bronzefigürchen aus jener Zeit, welche die verschiedensten Verkrüppelungen und Verkrümmungen darstellen, bezeugen die Verbreitung einer so scheußlichen Liebhaberei.
Was uns an dem römischen Sklavenluxus hauptsächlich empört, ist nicht das Übermaß der Verschwendung und Üppigkeit, sondern die frevelnde Nichtachtung der Menschenwürde: also nicht eine der Seiten des damaligen Luxus, sondern eine der jederzeit und überall eintretenden Folgen der Sklaverei. Mit Ausnahme des Sklavenluxus, für den die jetzige Welt zum Glück wenig Analogien mehr bietet, ergeben die Vergleichungen des antiken und modernen Luxus selten, daß der erstere den letzteren überbot, öfter das Gegenteil. Dieses Resultat kann nicht überraschen, wenn man erwägt, daß die zur Entwicklung des Luxus erforderlichen Bedingungen im Altertum fast auf allen Gebieten in ungleich geringerem Grade vorhanden waren als in der Gegenwart.
Man vergißt nur zu leicht, nicht bloß wie klein die Welt der Alten im Vergleich zu der jetzigen, sondern auch um wie viel ärmer sie war, um wie viel weniger damals die Erde den Menschen bot. Das römische Reich hatte noch nicht zwei Dritteile des Flächeninhalts von Europa, und von der übrigen Welt war nur ein geringer Teil zugänglich. Die Länder des Ostens, wie überhaupt die barbarischen Länder, gaben an das römische Reich nur einen kleinen Teil ihrer kostbaren Erzeugnisse ab. In einem großen Teile seiner Provinzen hatte die Kultur erst begonnen, die Produktionskraft war noch wenig entwickelt und stand auch in den am höchsten kultivierten in vielen Beziehungen weit hinter der heutigen zurück. Die Ausbeutung der Natur für die Zwecke des Menschen, die künstliche Entwicklung und Steigerung ihrer Kräfte war trotz großer Fortschritte verhältnismäßig noch unvollkommen. Die wichtigsten Erfindungen waren noch nicht gemacht, tausend Quellen zur Erhöhung des Lebensgenusses noch unentdeckt oder noch nicht erschlossen. Der Verkehr der Länder, der gegenseitige Austausch ihres Überflusses, trotz der kolossalen, mit Recht bewunderten Anstrengungen des Römertums für diese Zwecke, kam doch nicht entfernt dem heutigen gleich, und Handel und Industrie waren in vielen Beziehungen noch in der Kindheit. Dieselben Genüsse zu schaffen – mit Ausnahme derer, welche die Natur mit reicher Hand spendete –, erforderte deshalb damals fast überall größere Mittel, größere Anstrengungen und Anstalten als heute.
Die relative Kleinheit und Armut der römischen Welt bewirkte mit Notwendigkeit, daß der Maßstab der Alten für eine große Anzahl von Erscheinungen ein anderer, geringerer war als der unsere: was ihnen kolossal, enorm erschien, ist es nicht immer auch für uns. Selbst die Riesenstadt Rom, die Hauptstadt der Welt, übertraf an Größe vielleicht niemals das heutige Paris und stand weit hinter dem heutigen London zurück, von dessen Bevölkerung sie schwerlich selbst in ihrer glänzendsten Zeit auch nur die Hälfte gehabt hat. Daß aber der Luxus Roms den Zeitgenossen größer erschien, als er der heutigen Welt erscheinen würde, dazu trug außer der Verschiedenheit des Maßstabs und außer jener durch die größere Naturgemäßheit des antiken Lebens bedingten Verschiedenheit der Auffassung noch der Umstand bei, daß, wie es scheint, der höchste Grad des Luxus viel ausschließlicher auf Rom beschränkt war, als er es jetzt auf die größten und reichsten Städte ist. Je mehr der Luxus Roms in der damaligen Welt im vollen Sinne des Worts beispiellos war, um so eher konnte er auch unermeßlich und ungeheuer erscheinen. Sehr richtig sagt Höck, daß »der Luxus des Altertums sich in sehr viel engeren Grenzen sowohl der bürgerlichen Gesellschaft als auch der Verbrauchsgegenstände hielt und mit dem in unseren Tagen, wo eine Menge ausländischer Nahrungs- und Kleidungsgegenstände in die armselige Hütte eingedrungen ist und den Charakter des Unentbehrlichen angenommen hat, in keine Vergleichung zu stellen ist«.
Wenn die bisherige Betrachtung ergeben hat, daß der römische Luxus nicht so maßlos und fabelhaft war, wie er nach den Äußerungen der Alten erscheinen muß, so wird sie auch gezeigt haben, inwiefern die Ansicht Roschers der Einschränkung bedarf, daß Rom in der Kaiserzeit das großartigste Beispiel des unklugen und unsittlichen Luxus bietet, wie er bei verfallenden Nationen einzutreten pflegt. Es kann dies um so weniger unbedingt zugestanden werden, als ein großer Teil der Erscheinungen, die Roscher als charakteristisch für den gesunden Luxus reifer und blühender Nationen hervorhebt, auch in der damaligen Kultur hervortreten. Er bezeichnet als solche namentlich: die Rückkehr zur verlassenen Natürlichkeit, die Verbindung des Luxus mit Sparsamkeit, einen hohen Grad des Luxus der Reinlichkeit, die Liebe zur freien Natur. Die Erfüllung des ganzen Lebens und aller Klassen des Volks von diesem Luxus zeigt sich namentlich darin, daß gewisse feinere, zum Leben entbehrliche Waren Gegenstände der Volkskonsumtion werden. Eine solche Art des Luxus ist nur da möglich, wo keine allzu schroffe Ungleichheit des Vermögens im Volke stattfindet. Der Luxus des Staats richtet sich in Perioden höchster Kultur vornehmlich auf solche Dinge, welche vom ganzen Volke genossen werden können.
Die Dürftigkeit unserer Nachrichten läßt freilich nur sehr unvollkommen erkennen, inwiefern diese Erscheinungen der römischen Kultur in der früheren Kaiserzeit eigentümlich waren. Die verhältnismäßig große Natürlichkeit der Kleidertracht ist schon erwähnt; der einheitliche Charakter tritt hier noch weit mehr hervor als selbst in unserer jetzigen Tracht, wie vorteilhaft diese sich auch gerade dadurch vor der Tracht früherer Jahrhunderte auszeichnet. Doch freilich fand im römischen Altertume keine Rückkehr zu einer verlassenen Natürlichkeit statt: vielmehr blieb erstens das antike Leben selbst in Zeiten der Entartung der Natur vielfach näher als das moderne, sodann trat hier wie in so vielen andern Beziehungen das Kaiserreich nur die Erbschaft der Republik an, deren durch ein halbes Jahrtausend in Kraft gewesene Sitten wenigstens während der ersten Jahrhunderte der Monarchie noch ihre Nachwirkung übten. Man brauchte eben nur einen Zustand festzuhalten, zu dem die neuere Zeit erst auf weiten Umwegen gelangt ist. Dasselbe auch dem Armen erschwingliche Kleidungsstück, die Toga, blieb die Feiertracht aller Bürger, vom Kaiser bis zum ärmsten Tribulen. Vielleicht war dieser fortdauernde Hang zur Gleichförmigkeit der Grund, daß der Gedanke des Alexander Severus, den Beamten und Würdenträgern auszeichnende Trachten zu geben, nicht zur Ausführung kam. Eine »Kutschenaristokratie« kann es erst seit dem 3. Jahrhundert gegeben haben; vorher konnte in antiken Städten davon um so weniger die Rede sein, als man dort während der ersten Jahrhunderte nicht einmal reiten, geschweige denn fahren durfte. Trottoirs anzulegen wurden die römischen Städte durch Cäsars Stadtrecht verpflichtet und sind dieser Verpflichtung auch nachgekommen: »hierin wie in allen Dingen, die Wege- und Straßenbau betreffen, steht die Neuzeit durchaus auf den Schultern der Römer«. Wenn Roscher ferner auch die Verdrängung der französischen Gärten durch die englischen als Symptom der Rückkehr zur Natürlichkeit anführt, so ist zu bemerken, daß die unter Augustus aufgekommene Mode der geschorenen Hecken (und ohne Zweifel auch der übrigen architektonischen Gartenanlagen) nicht mit dem damaligen Luxus zusammenhängt, sondern ihren Grund vielmehr in einer Richtung des Naturgefühls hat, die dem Süden vorzugsweise eigen ist.
Inwiefern der römische Luxus mit Sparsamkeit verbunden war, läßt sich nur in einigen Punkten beurteilen. Daß in Rom, wo es soviel »glänzende Armut«, soviel Scheinwesen aller Art gab, die Industrie tätig war, »wohlfeile Ersatzmittel für kostbare Prunkgegenstände« zu schaffen, ist an und für sich wahrscheinlich. So hatte der Luxus mit Tischen aus kostbarem Holze schon in der ersten Kaiserzeit zur Anwendung des Furnierens geführt. Am massenhaftesten ist der Gebrauch wohlfeiler Ersatzmittel in der künstlerischen Dekoration sowohl der Wohnungen als der öffentlichen Gebäude gewesen, wie ihn vor allem die Mittelstadt Pompeji zeigt, wo Stuck, Ton, Terrakotta, Gips und Glas den Marmor und das Elfenbein, Bronze die edlen Metalle, lebhafter Anstrich das bunte Gestein, Kopien die Originale ersetzen, und der Schein einer heiteren Pracht überall mit verhältnismäßig sehr geringem Aufwande hervorgebracht ist. Wie das Kunstbedürfnis damals in einem neueren Zeiten kaum begreiflichen Umfange verbreitet war, Befriedigung verlangte und fand, daran kann hier nur im Vorübergehen erinnert werden: diese edelste Seite des römischen Luxus muß einer besonderen Besprechung vorbehalten bleiben.
Am großartigsten entwickelt war der Luxus der Reinlichkeit. Die in römischen Städten so überaus häufigen, zum Teil so imposanten Überbleibsel und Spuren von Wasserleitungen sind beschämend für die moderne, erst so spät zur vollen Erkenntnis der Wichtigkeit dieser Anstalten gekommene Welt. Ihre Allgemeinheit in allen Teilen des römischen Reichs sowie ihre Vortrefflichkeit kann hier nur durch Beispiele veranschaulicht werden. »Pompeji war eine wasserreiche Stadt; in allen nicht ganz geringen Häusern sprang das Wasser, zum Teil in größtem Überfluß; z. B. nicht weniger als 16 Strahlen im Hause der Vettier. Große Massen absorbierten die öffentlichen Bäder.« In einer Anzahl von Städten Italiens bezeugen teils Bogenreihen, teils Inschriften, die als Erbauer öffentlicher Aquädukte Kaiser, Patrone, Magistrate, Privatpersonen, auch die Gemeinden selbst nennen, teils Röhren mit städtischen Stempeln das Vorhandensein von Leitungen, deren nicht für städtische Zwecke erforderliches Wasser zum Besten der Stadtkasse verwertet wurde. Zu dieser Einnahme der Städte »steuerten außer den reicheren Hausbesitzern, die sich das Wasser ins Haus leiten ließen, und den Grundbesitzern, welche (soweit dies überhaupt aus dem Aquädukt zulässig war) ihre Felder vermittels desselben bewässerten, hauptsächlich die Handwerker, welche des Wassers zu ihrem Gewerbe bedurften, besonders die Walker; dann aber auch diejenigen, welche auf ihre Kosten Bäder (sei es für den Privatgebrauch, sei es aus Munifizenz für die Ärmeren) anlegten«.
Auch in den Provinzen war die Beschaffung guten und reichlichen Wassers überall eine Hauptsorge der Kommunen. Libanius rühmt von seiner Vaterstadt Antiochia, daß sie alle andern Städte durch die Fülle und Trefflichkeit ihres Wassers übertreffe. Die (achtzehn) Stadtbezirke suchten einander durch die Vorzüglichkeit ihrer Badeanstalten zu überbieten. »Soviel der Wohnhäuser, soviel sind auch der fließenden Wasser, ja sogar in den einzelnen Häusern oft mehrere, und auch die Mehrzahl der Werkstätten hat den gleichen Vorzug.« »Bei uns fließen die öffentlichen Brunnen zur Zierde, da jeder innerhalb der Türen sein Wasser hat. Und es ist dies Wasser so klar, daß der Eimer leer scheint, und so anmutend, daß es zum Trinken einladet.« In der Quantität des zugeführten Wassers, das gibt Libanius indirekt zu, war anderwärts ebenso Bedeutendes geleistet worden, und von Smyrna z. B. wissen wir, daß dort jedes Haus seine eigene Leitung und manche mehr als eine hatten. In den Städten Pamphyliens und Pisidiens waren im 2. Jahrhundert n. Chr. Nymphäen besonders beliebt, eine Art von »Wasserschlössern«, wo aus zahlreichen Mündungen reich verzierter Fassadenbauten Ströme sich in geräumige Bassins ergossen: das besterhaltene ist das (dem Septizonium des Septimius Severus in Rom sehr ähnliche) Nymphäum von Side, wo das Wasser aus drei Nischen einer prächtigen, säulengeschmückten Marmorwand in neun Strömen in ein 400-500 Quadratmeter großes Becken fiel. In Alexandrien mußte in Cäsars Zeit, wo das den Privathäusern zugeführte Nilwasser dort einen Klärungsprozeß durchmachte, die Masse des Volks sich seiner in ungereinigtem Zustande bedienen, in dem es gesundheitsschädlich war; doch wird später für eine Versorgung der ganzen Bevölkerung mit gereinigtem Wasser gesorgt worden sein.
Auch in den afrikanischen Provinzen haben, soweit die bisherigen Forschungen urteilen lassen, selbst kleine Orte die dort doppelt segensreiche Wohltat der Versorgung mit gutem Wasser nirgends entbehrt. Verecunda erhielt seine Wasserleitung durch Antoninus Pius, in Lambäsis wurden Aquädukte durch Diocletian und Maximian hergestellt. Eine 25 Millien (37 km) lange Leitung hatte dort 226 die dritte Legion ausgeführt. Einer ihrer Ingenieure war 152 nach Saldä (Bougie) gesandt worden, um einen Tunnel für eine dahin zu führende, schon 147-149 begonnene Wasserleitung zu bohren, der den dortigen Technikern nicht gelungen war. Die Stadt Thysdrus hatte ein vom Kaiser zur Leitung ihrer Verwaltung eingesetzter Kommissar mit genügendem Wasser versehen, es durch die Straße in Bassins geleitet und unter gewissen Bedingungen auch den einzelnen Häusern gewährt. In Groß-Leptis, wo man das gute und schmackhafte Wasser des Flüßchens, an dem die Stadt liegt, in einem verdeckten Kanal hätte leiten können, zog man es vor, reines Bergwasser hoch über der Erde in die Stadt zu führen, und leitete außerdem noch das Wasser des Cinyps herbei; von beiden Leitungen sind bedeutende Reste vorhanden. Die Lage der südlichsten römischen Stadt in dem noch wenig erforschten Mauretanien, Sala (Rebat-Saleh, 34° n. Br. am Atlantischen Meere), ist durch die Ruine eines Aquädukts bezeichnet. Bogenreihen von solchen, zum Teil sehr großartige, stehen noch bei Cäsarea (Scherschell), Cirta (Constantine) und anderwärts. In dem Nymphäum von Bulla regia fiel das Wasser der mitten in der Stadt entspringenden Quelle über mehrere Terrassen in ein Bassin, um von hier aus weitergeleitet zu werden. Die Ruinen der riesenhaften Wasserleitung von Karthago begleiten den Reisenden in einer geraden Entfernung von 60 Kilometer, die aber durch deren Windungen mindestens verdoppelt wird. Zahlreich haben sich Systeme von Behältern und Zisternen erhalten, die zum Teil noch benutzt werden.
Nicht anders war es in den westlichen und nördlichen Provinzen. Die Wasserleitung von Segovia, »frisch, wie sie aus der Hand des Meisters hervorgegangen, erhalten, erhebt sich leicht und schlank in den edelsten Verhältnissen, und doch fest und unerschütterlich über der schmutzigen Stadt und tränkt noch nach zwei Jahrtausenden die späten Abkömmlinge mit erquicklichem Wasser«. Von den vier mächtigen Aquädukten des alten Tarraco versorgt der dritte noch heute Tarragona mit Wasser, und die Bogen, auf denen der Kanal des zweiten über eine Schlucht geleitet war, stehen noch zum größten Teil. In Merida ist eine römische Wasserleitung erhalten, eine zweite bis auf wenige, sehr großartige Bogen zerstört. Ausonius kann nicht Worte genug finden, um in Burdigala die marmorüberdachte, herrlich klare Quelle Divona zu preisen, »die stürmisch mit dem bis zum Rande sie füllenden Strome durch zwölf Öffnungen hervorbricht, nie erschöpft durch des Volks vielfältige Nutzung«; im Jahre 1855 hatte Bordeaux keine stattliche Fontäne. Der großartige, in einer wilden, einsamen Talschlucht den Gardon in drei Stockwerken von Arkaden überbrückende Pont du Gard ist ein Rest der Wasserleitung, die das treffliche Wasser der Quellen Airan und Eure 9 Lieues weit nach Nîmes führte. Ein Gelehrter in Lyon macht (1854) bei Gelegenheit der von ihm herausgegebenen Inschriften der dortigen alten Röhren die bittere Bemerkung, »daß unsere Zeit, so stolz auf den Fortschritt der Mechanik und im Besitz ganz andrer Mittel, als die Alten hatten, z. B. der Dampfkraft, selbst für große Städte in dieser Hinsicht bei weitem nicht das leistet, was die Römer selbst für die kleinsten Orte unter den erheblichsten Schwierigkeiten geleistet haben. Das alte Lyon lag auf einer Höhe und war reichlich versorgt mit reinem und gesundem Quellwasser; das neue Lyon liegt in der Ebene, zwischen zwei Flüssen, die es überschwemmen, ohne ihm Trinkwasser zu gewähren, und muß sich mit stinkendem Wasser, unreinen Gräben und ungesunder Luft begnügen«. Die römische Leitung ging von den Wassern des Mont Pila aus und nahm dann die des Gien Jaunon und Furand auf; sie überschritt die Täler, zum Teil Abgründe von 70-100 Meter, auf 14 hohen Brückenbauten und durchlief eine Strecke von 15 Lieues. Die Leitungen von Trier, Metz, Mainz, Köln und manch andre führten den Städten meist kalkhaltiges, für die Römer an seiner schönen, der der Alpenseen gleichen, blaugrünen Farbe erkennbares Wasser zu, das Risse und andre kleine Schäden durch den Kalksinter, den es absetzte, bald selbst ausbesserte. Die Leitung von Köln schöpfte ihr treffliches Wasser in der Eifel 52 Kilometer von der Stadt und führte es ihr in einem fast 80 Kilometer langen, meist unterirdischen Kanale zu. Als man in neuerer Zeit bei Remagen zwei Wasserläufe zur Leitung faßte, ahnte man nicht, daß dies schon von den Römern genau an derselben Stelle geschehen war, und bewunderte nun ebensosehr die geniale Einfachheit ihres Verfahrens wie die Sorgsamkeit der technischen Ausführung. In Rom wie an manchen andern Orten hat sich an die Reste der Aquädukte die Sage geheftet, daß sie zur Leitung von Wein bestimmt gewesen seien: sie findet sich in Avenches und in Köln. Diese Sage, charakteristisch für die Vorstellung von der Größe und Herrlichkeit der untergegangenen römischen Kultur, zeigt doch zugleich auch, wie ganz das Verständnis für die wirklichen Zwecke solcher Bauten späteren Zeiten verlorengegangen war.
Die Wasserleitungen versorgten, wie gesagt, die in Italien schon seit alter Zeit weit verbreiteten, später wohl nirgends fehlenden öffentlichen und Privatbäder. In Italien gab es selbst dorfartige Orte, die mehr als eine für Geld zu benutzende Badeanstalt hatten; und vielleicht für keinen Zweck sind in den Inschriften der Städte Italiens sowie sämtlicher Provinzen Stiftungen und Vermächtnisse häufiger bezeugt als für Erbauung, Erhaltung, Ausstattung und unentgeltliche Freigebung öffentlicher warmer und kalter Bäder für Männer und Frauen, zuweilen sogar für Sklaven und Sklavinnen. Auch in den Provinzen erkannten selbst die kleinsten Kommunen es als Pflicht, ihren Angehörigen wohlfeile und gute Bäder zur Verfügung zu stellen. Nach der Gemeindeordnung eines Bergmannsdorfs im südlichen Portugal mußte der Pächter des dortigen öffentlichen Bads dasselbe von Tagesanbruch bis zur ersten Nachmittagsstunde für Männer, von da ab bis zur zweiten Nachtstunde für Frauen geöffnet halten; die ersteren hatten ein Eintrittsgeld von etwa 3, die letzteren von etwa 6 Pfennig zu zahlen (das Doppelte der in Rom üblichen Sätze); frisches, fließendes Wasser mußte in den kalten und warmen Bassins vor- und nachmittags vorhanden sein und bis zu einer bestimmten Höhenmarke reichen; die Kessel mußten monatlich gereinigt und frisch mit Fett eingerieben werden. Die Stelle des täglichen Bads war nach Galen selbst für Landbewohner allgemein geworden: hierin erkennt er insofern mit Recht eine Verweichlichung, als die Entbehrung sehr schwer ertragen wurde, während Seneca, seinem Standpunkte getreu, auch in der Zunahme der Reinlichkeit ein Symptom des Sittenverfalls erblickt, da man doch in der guten alten Zeit nur Arme und Beine täglich wusch, ein Bad aber nur am achten Tage nahm. Der Gebrauch der Seebäder, der sich bei uns so spät und mühsam durchgekämpft hat (das älteste deutsche Seebad Doberan ist erst 1793 eröffnet), war wohl an allen Küsten des Mittelmeers verbreitet, wie es von denen Italiens, Griechenlands und Ägyptens ausdrücklich bezeugt ist.
Daß auch auf den Naturgenuß – soweit das römische Altertum dafür empfänglich war – sich keine Zeit besser verstanden hat als die damalige, und daß es mindestens schon im letzten Jahrhundert der Republik »für die höheren Stände eine fast ausnahmslose Sitte geworden war, die schöne Jahreszeit auf dem Lande zuzubringen«, ist bereits ausgeführt worden. Schon damals konnten die Reichen und Vornehmen in der Regel aus verschiedenen Naturszenen und Klimaten für jede Jahreszeit das Zusagendste wählen, aber auch in der Stadt war ein großer Garten der geschätzteste Teil eines Palasts und verdoppelte dessen Wert. Die Fenster der Speisesäle sollten eine Aussicht ins Grüne gewähren. Selbst auf flachen Dächern und Balkonen blühten Sträucher und Blumen, und mag auch dieser Luxus in einzelnen Fällen übertrieben worden sein, so darf man doch die hyperbolischen Schilderungen der beiden Seneca gewiß nicht buchstäblich nehmen. Auch an den Fenstern bescheidener Wohnungen sah man Blumen und Grünes; übrigens fehlte es Rom auch nicht an großen Gärten und Parks, diesen »Lungen der großen Städte«, von denen ein Teil dem Volke offen stand. Und wenn zwei Kommunalbeamte von Signia (Segni) der Stadt einen Platz mit Gartenanlagen schenkten, so wird eine derartige Fürsorge für Gesundheit und Behagen der Stadtbewohner nicht vereinzelt gewesen sein.
Über die Verbreitung des Luxus in den unteren und mittleren Schichten der Gesellschaft haben wir nur sehr spärliche Nachrichten, und diese beziehen sich fast ausschließlich auf Italien. Ihrem glücklichen Klima verdanken die Mittelmeerländer, daß das feinste Brotkorn, dessen Genuß im Norden erst nach großen Fortschritten der Kultur und des Wohlstands allgemein geworden ist, seit alter Zeit die Volksnahrung bildete. Von Wein, Öl und Weizenmehl lebten in Italien selbst die Sklaven schon in Catos Zeit, und wie die römische Kultur den Wein in den Bierländern verbreitete, ist oben gezeigt worden. Die Ungleichheit des Vermögens war allerdings zwar nicht so groß wie in der gegenwärtigen Welt, doch immer noch groß genug. Aber erstens ist im Süden Armut nicht notwendig auch Elend. Sodann trug die Nachwirkung republikanischer Sitten in hohem Maße dazu bei, den Abstand zwischen Reichtum und Armut auszugleichen.
Von den Reichen und Großen wurde immer noch erwartet, daß sie ihren Überfluß nicht bloß zur Unterstützung der Armut verwenden würden – was ja namentlich durch das so umfassend organisierte Institut der Klientel auch in hohem Grade geleistet wurde –, sondern auch, daß sie die Armen an ihren Genüssen in reichem Maße teilnehmen lassen, ihnen Vorteile und Vergnügungen aller Art gewähren würden, von denen sie in der modernen Welt meist ausgeschlossen sind. Die Menge, sagt Plutarch, haßt mehr den Reichen, der von seinem Vermögen nicht mitteilt, als den Armen, der öffentliche Gelder stiehlt; dieses entschuldigen sie mit der Not, in jenem erblicken sie eine hochmütige Verachtung des Volks. Und nach Lucian übten die Armen sogar oft eine Tyrannenherrschaft über die Reichen aus: diese mußten für jene Bäder bauen, Wettkämpfe und andre Schauspiele veranstalten, sie durch Geldverteilungen günstig stimmen und lebten doch immer in Angst und Schrecken vor der Unzufriedenheit ihrer Mitbürger. In wie großartiger Weise die Wohlhabenden überall im römischen Reiche durch Anlagen und Bauten für den Nutzen und die Annehmlichkeiten der Gemeinden sorgten, wird später ausgeführt werden: und diese Leistungen kamen zum Teil (wie die schon erwähnten Bäder) ganz besonders den Armen zugute. »Bauen und Schenken« ziemte nach der damaligen Ansicht dem reichen Manne vor allem. Wie auf dem Gebiete der öffentlichen Anstalten und Bauten, so ging auch in der Sorge für die Ernährung des ärmeren Teils der Bevölkerung die Freigebigkeit der Wohlhabenden mit den Maßregeln der Kommunalbehörden Hand in Hand. Stiftungen, Schenkungen und Vermächtnisse zu Ankäufen von Öl und Mehl behufs unentgeltlicher Verteilung oder Lieferung zu Durchschnittspreisen waren häufig, auch Stiftungen, durch welche arme Eltern in den Stand gesetzt werden sollten, ihre Kinder bis zum erwerbsfähigen Alter zu erziehen, keineswegs ungewöhnlich; unter den uns bekannten gehört eine schon der Zeit des Augustus an. Ferner gab es deren für das hilflose Greisenalter. Begräbnisplätze für Arme wurden nicht bloß von den Gemeinden, sondern auch von einzelnen angelegt. Endlich wurden die Kommunen auf dem Gebiete des Unterrichtswesens durch den Gemeinsinn reicher Bürger unterstützt. Um das Jahr 100 n. Chr. gab es in Como noch keine Lehrer für die höchste Stufe des Unterrichts, die Beredsamkeit, und die jungen Leute, die sich darin ausbilden wollten, mußten in dem freilich sehr nahen Mailand studieren. Der jüngere Plinius zeichnete, obwohl kinderlos, den dritten Teil der für die Besoldung eines Lehrers erforderlichen Summe; und da er der Stadt auch eine Bibliothek von bedeutendem Werte schenkte und ein Kapital zur Erhaltung und Vermehrung derselben hinzufügte, dürfen wir annehmen, daß die Freigebigkeit der Munizipalpatrioten nicht selten auch für die Lehrmittel sorgte.
Freilich wurde aber noch mehr als auf diese edlen Zwecke auf öffentliche Vergnügungen und Feste verwandt, nicht bloß von den Kommunen, sondern namentlich von Reichen, welche sich die Gunst ihrer Mitbürger zu erwerben wünschten. Von diesen forderte überdies die Sitte, daß sie auch bei ihren Privatfesten einen großen Teil der Gemeinde zuzogen. Feierte ein reicher Mann seinen Geburtstag, ließ er seinen Sohn mit der Männertoga bekleiden, richtete er die Hochzeit einer Tochter aus, trat er ein städtisches Amt an, weihte er einen auf eigene Kosten erbauten öffentlichen Bau ein: in allen solchen Fällen mußte er in der Regel den Gemeinderat, oft auch noch einen großen Teil der Bürgerschaft, im ganzen viele hundert, ja tausend Personen und darüber zu Gast laden, oder ihnen statt der Bewirtung eine Gabe in Geld verabreichen. Die öffentlichen Lustbarkeiten waren hauptsächlich Bewirtungen der ganzen Gemeinde, für deren jährliche Wiederholung auch nach ihrem Tode reiche Leute zuweilen durch Stiftungen und Vermächtnisse sorgten, und Schauspiele, unter denen die des Amphitheaters, d. h. Tierhetzen und Gladiatorenkämpfe, die beliebtesten waren. Ohne Zweifel wurden die Wohlhabenden durch die Rücksicht auf die öffentliche Meinung und die keineswegs blöde geäußerten Volkswünsche zur Veranstaltung solcher Feste oft geradezu gezwungen. In der Stadt am Golf von Neapel, in welcher ein Teil des Petronischen Romans spielt, erwartet man von einem der Honoratioren eine Bewirtung und Geldverteilung, von einem andern ein dreitägiges Gladiatorenspiel; da er von seinem Vater 30 Millionen Sesterzen geerbt habe, könne er sehr wohl 400.000 Sesterzen (87.000 Mark) draufgehen lassen: dann werde er auch ewig mit Ruhm genannt werden.
Schließlich mögen aus der sehr großen Zahl von Inschriften aller Provinzen, in denen die Schenkungen von Bürgern an ihre Städte namhaft gemacht sind, beispielsweise zwei angeführt werden, um zu zeigen, welche Summen auch in Städten zweiten Rangs die Reichen für den Nutzen und das Vergnügen der Gemeinden opferten. In Philadelphia in Lydien gab von zwei Bürgern, welche die höchsten Ämter und Priestertümer bekleideten, der eine (außer einem ungenannten Beitrag an die Stadtkasse) beim Antritt der Ädilität 10.000 Denar; für ein »Kochen von 15 Tagen« (vermutlich eine Volksküche) 5000, zur Errichtung der Vorhalle der Basilika 50.000, im ganzen 65.000 Denar (über 56.000 Mark); der andre (außer mehreren nicht namhaft gemachten Schenkungen und Leistungen für sich und seine Söhne und der Veranstaltung einer Tierhetze) zum Ankauf von Getreide in verschiedenen Zahlungen 610.000 Denar, zur Erbauung eines Dachs des Theaters 10.000, den sieben Zünften der Stadt zur Errichtung je einer Statue 7000, im ganzen 627.000 Denar (etwa 545.000 Mark). In einer Stadt Pamphyliens (Sillyon oder Aspendos) spendete eine Familie (außer Geld- und Getreideverteilungen an acht Gruppen der Stadtbewohner) zur Auferziehung von Kindern 300.000 Denar (261.000 Mark). Und so bezeugen Hunderte von munizipalen Inschriften, daß in allen Städten des Reichs die ganze Einwohnerschaft von dem Vermögen der Reichen einen erheblichen Teil mitgenoß, und daß diese viel mehr davon für die Gemeinde freiwillig opferten, als es bei der höchsten Einkommensteuer der Fall gewesen wäre.
Auch der Luxus des Staats und der Regierungen war in hohem Grade »auf solche Dinge gerichtet, welche vom ganzen Volke mitgenossen werden konnten«. Auch die zum allgemeinen Gebrauche bestimmten kaiserlichen Prachtbauten Roms (vor allen die Thermen), die Schauspiele der Kaiser und Beamten, die Congiarien und Frumentationen – wie verwerflich dies alles auch zum größten Teil vom sittlichen wie vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus war – kamen doch einer ganzen Bevölkerung zugute; während bei den Luxusbauten und üppigen Festen moderner Höfe ungeheure Mittel nur zum Vorteil und Genuß einer kleinen Anzahl von Begünstigten verwandt wurden. Und denselben demokratischen Charakter hatte der öffentliche Luxus der Kommunen im ganzen römischen Reiche.
Ohne Zweifel hat der Luxus wie die ganze Kultur der früheren Kaiserzeit große Schattenseiten. Aber er war weder so töricht und unsittlich, wie ihn der einseitige Rigorismus damaliger Schriftsteller dargestellt hat, noch so fabelhaft und ungeheuerlich, wie er in der ungesichteten Kompilation von Meursius erscheint. Trotz aller Schäden und Gebrechen war jene Kultur doch eine sehr hohe und reiche: »Sie hat unzählige Keime ausgestreut, die noch heute Frucht tragen.« In der Verfeinerung des Lebensgenusses wie in der Verbreitung und Verallgemeinerung des Wohlstands und der übrigen materiellen Bedingungen eines gesunden Luxus hat diese Zeit nicht bloß das ganze übrige Altertum übertroffen: ihr Luxus hat auch gar manches hervorgebracht, was (zum Teil in verkümmerter Gestalt) in späteren Jahrhunderten segensreich fortgewirkt und das Dasein in unserem Weltteile menschenwürdiger gemacht hat; ja die damalige Menschheit hat manches Gut besessen, dessen späte Wiedererlangung noch in unserm Jahrhundert hoch angeschlagen oder gar erst angestrebt wird. So gilt denn auch hier das Wort Mommsens: »daß die römische Kaiserzeit mehr geschmäht als gekannt ist«.