
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Leichtigkeit des Reisens und die Großartigkeit und Vielfältigkeit des Verkehrs, wie beides bisher geschildert worden ist, mußte auch die Wanderlust mächtig reizen und das Verlangen, neue Eindrücke aufzunehmen, sich durch sie zu bilden und zu belehren, in weiten Kreisen verbreiten. In der Tat sind auch zu diesen Zwecken Reisen damals kaum weniger häufig unternommen worden als in der neuern Zeit. Plinius nennt die menschliche Natur »reiselustig und nach Neuem begierig«. Manche, sagt Seneca, machen Seefahrten und erdulden die Mühseligkeiten sehr langer Reisen einzig und allein, um etwas Verborgenes und Entlegenes kennenzulernen. Die Natur habe im Bewußtsein ihrer Kunst und Schönheit uns als Beschauer so großer Sehenswürdigkeiten erschaffen; wenn sie diese nur der Einsamkeit zeigte, würde sie die Frucht ihres Daseins einbüßen. Die Zahl derer war groß, die »gern durch unbekannte Städte zogen, ein neues Meer erforschten und in allen Ländern der Welt Gäste waren«. Jener Hang zum Wandern war sehr verbreitet, der Hadrian durch alle Provinzen seines Reiches führte, und der in ihm so mächtig war, »daß er alles, was er über irgendwelche Gegenden der Welt gelesen hatte, aus eigener Anschauung kennenlernen wollte«. Trotz der Unsicherheit des menschlichen Lebens, sagt der Epikureer Philodemus, sind manche, und sogar Philosophen, töricht genug, in Zukunftsplänen so viele Jahre für einen der Studien halber in Athen zu nehmenden Aufenthalt, so viele für Bereisung Griechenlands und der Barbarenländer anzusetzen.
Doch nichts wäre irriger, als aus solchen Äußerungen zu schließen, daß die Unternehmungen, die aus der Wanderlust der Alten hervorgingen, auch nur entfernt mit den Entdeckungsfahrten und Weltwanderungen in neueren Zeiten verglichen werden könnten. Der Trieb, in unbekannte Welträume vorzudringen, war im Altertum gering, und so blieb den Römern wie den Griechen die Erde nach allen Richtungen hin von verhältnismäßig nahen Grenzen umschlossen, über die hinauszuschweifen kaum die Phantasie Verlangen trug. In der Zeit seiner höchsten Ausdehnung erstreckte sich das Wissen der Alten nur über zwei Drittel unseres Festlands, über das südwestliche Viertel Asiens und über das nördliche Drittel Afrikas; und selbst auf den schon vielfach betretenen Grenzgebieten der bekannten Welt vermochte die Erkundung des Wahren nie völlig die Fabeln und Wundersagen früherer Zeiten zu verdrängen, die immer von neuem auftauchten und auch bei den Gebildeten Eingang fanden.
Noch wagte kein kühner Schiffer sich in das unermeßliche Westmeer hinaus, von dem man glaubte, daß es wie das Nordmeer in einer gewissen Entfernung von der Küste für Schiffe undurchdringlich würde; obwohl die Existenz eines Festlandes zwischen dem westlichen Europa und Asien nicht bloß von Strabo, sondern auch von Aristides für wohl möglich gehalten wurde. Auch Seneca ahnte, daß in späteren Jahrhunderten der Ozean aufhören werde, eine unübersteigliche Schranke zu bilden; dann würde ein neuer Tiphys neue Welten entdecken und Thule nicht mehr das äußerste Land sein.
»Doch mehr als die Ahnung war den Römern nicht beschieden.« Gerade die Geschichte ihrer Seefahrt lehrt, wie fern ihnen die Natur als Objekt verständiger Forschung lag. »Umfang und Grenzen des großen Reichs boten Anlaß genug, sich auf der hohen See zu versuchen. Die Weltherrscher waren im Besitz der iberischen, lusitanischen und mauretanischen Küsten«, doch die atlantischen Inseln, die das Gestade Nordafrikas beleben, blieben ihnen fast völlig unbekannt. Andalusische Schiffer, welche die Madeiragruppe (angeblich in einer Entfernung von 10.000 Stadien = 1800 km von Afrika) entdeckt hatten, schilderten dem C. Sertorius ihr mildes, durch feuchte Seewinde erfrischtes, das ganze Jahr hindurch nur geringen Änderungen unterworfenes, höchst gesundes Klima und ihre üppige Fruchtbarkeit: man glaubte dort das Elysium Homers gefunden zu haben und nannte sie die Inseln der Seligen. Sertorius überkam die Sehnsucht, sich aus den Stürmen des Krieges in die zauberische Abgeschiedenheit dieser paradiesischen Eilande zurückzuziehen; aber seine Anhänger verhinderten die Ausführung dieser Absicht, und, soviel wir wissen, hat auch später nie ein Römer die Inseln der Seligen betreten. Doch waren die Canarischen Inseln nicht bloß von dem mit einer Tochter des M. Antonius und der Cleopatra vermählten König Juba von Mauretanien, dem größten Kenner Afrikas im Altertum, sondern auch von einem Römer Statius Sebosus (in unbekannter Zeit) beschrieben worden. Pausanias hatte sich nach den Satyrn unter andern bei einem karischen Schiffer Euphemus erkundigt, der auf der Fahrt nach Italien in das äußere (Atlantische) Meer verschlagen worden war, »in das sie nicht mehr schiffen«. Dort war das Schiff des Euphemus an eine von Satyrn bewohnte Insel getrieben worden. Diese seien geschwänzte, rötliche Geschöpfe, die, ohne einen Laut von sich zu geben, einen Anfall auf die Weiber im Schiffe machten, deren eines man ihnen preisgab.
An der atlantischen Küste Afrikas war der Karthager Hanno auf seiner um die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. unternommenen Expedition noch 16 Tagefahrten über das Grüne Vorgebirge hinausgelangt; doch das von ihm gewonnene geographische Wissen ging der spätern Zeit teils ganz verloren, teils verdunkelte es sich wenigstens sehr. Strabo leugnet z. B. die Existenz der von Hanno entdeckten Insel Kerne. Hanno war an der Sierra-Leone-Küste zweimal durch das nächtliche Glühen von Gras- und Waldbränden erschreckt worden und landete auf einer Insel an der Mündung des Ceßflusses, wo er am Tage nur Wälder erblickte, bei Nacht aber durch viele Feuer, den Schall von Flöten, Cymbeln und Pauken und unzählige Stimmen erschreckt wurde, so daß er die Insel verließ. Bei der weiteren Fahrt sah er bei Nacht ein himmelhohes Feuer, das sich bei Tage als ein gewaltiger Berg erwies, den Hanno den Götterwagen nennt und in dem man mit großer Wahrscheinlichkeit den Kamerunberg erkannt hat. Seine Angaben sind ganz in Übereinstimmung mit den Berichten neuerer Reisenden, nach denen in jenen Breiten bei Tage die übermäßige Hitze die Neger zur tiefsten Ruhe zwingt, die erst bei Anbruch der Nachtkühle ihre lärmenden Feste und Tänze beginnen. Beide Teile des Hannonischen Berichtes waren verbunden und ins Fabelhafte ausgemalt bei einem Autor, auf den sowohl Pomponius Mela als der ältere Plinius zurückgehen. Doch der erstere nennt als Lokal ein Gestade südlich vom Götterberge, der zweite den Ausläufer des Atlas an der nach ihm benannten Westküste. Dieses höchst fabelhafte Gebirge sei gegen den Ozean hin rauh und wüst, gegen Afrika von schatten- und fruchtreichen Wäldern und Quellen erfüllt. Bei Tage erblicke man niemand, alles schweige im Schauer der Einsamkeit, Ehrfurcht und Grauen ergreife die Nahenden vor den über die Wolken bis in den Kreis des Mondes ragenden Höhen. Bei Nacht leuchte das Gebirge von vielen Feuern und halle von dem Lärm schwärmender Satyrn und Pane, dem Klange der Flöten und Pauken wider. Plinius, der den Atlas mit den Bergen der afrikanischen Westküste vermengt, entschuldigt die Verworrenheit und die Widersprüche in seinen Angaben mit der Indolenz der römischen Behörden in der (im Jahre 42) eingerichteten Provinz Mauretanien, wo es doch fünf römische Kolonien gab und für deren Statthalter es ein Ehrenpunkt war, bis zum Atlas vorgedrungen zu sein. Doch da sie zu träge seien, das Wahre zu erforschen, scheuten sie sich nicht, aus Scham über ihre Unwissenheit zu lügen, und die von so gewichtigen Gewährsmännern gegebenen Nachrichten fänden bereiten Glauben. Der Zug des Suetonius Paulinus im Jahre 41, vielleicht des einzigen römischen Feldherrn, der den Hohen Atlas überschritt, scheint ganz ohne Folgen geblieben zu sein. Er fand die untersten Hänge des Gebirges mit hohen, dichten Wäldern einer unbekannten Gattung von zypressenähnlichen Bäumen (wohl der jetzt ar'ar genannten), seine Gipfel mit ewigem Schnee bedeckt. Jenseits des Atlas drang er durch Wüsten von schwarzem Sande, in dem wie verbrannt aussehende Felsen ragten, und welche die Glut auch im Winter unbewohnbar machte, bis zum Flusse Ger (Gir) vor. Er erhielt Nachrichten über die nach Hundeart von rohem Fleisch lebenden Bevölkerungen einer südlichen, von wilden Tieren, besonders Elefanten und Schlangen, wimmelnden Waldregion, versuchte aber offenbar nicht, sie zu erreichen.
Viel weiter nach Süden reichten die Feldzüge der Römer sowie ihre militärischen und Handelsniederlassungen in der Mitte des Kontinents. Schon im Jahre 19 v. Chr. war L. Cornelius Balbus von Oea (Tripolis) durch das Gebiet eines in Häusern von Steinsalz wohnenden Volks und eine langgestreckte Kette schwarzer Felsen (jetzt Harudj-el-aswed) in der Landschaft Phazania (Fezzan) vorgedrungen; er hatte auf diesem Zuge zahlreiche Städte eingenommen und Stämme besiegt, deren Bilder in seinem Triumphzuge aufgeführt wurden; darunter Cidamus (Ghadâmes) und die Hauptstadt des Königs der Garamanten (Tedastämme) Garama (an der Stelle der jetzt seit lange verlassenen Stadt Djema-kadim, d. h. Alt-Djerma). Cidamus (30° 15') blieb seitdem den Römern wie den Byzantinern bis zum Einfall der Araber befreundet. Die Bewohner der Gegend bekehrten sich unter Justinian zum Christentum; der Ort nahm, ohne Zweifel für die Dauer, eine römische Besatzung auf, von welcher sich dort eine Inschrift aus der Zeit des Alexander Severus erhalten hat. So weit reichten wohl die römischen Straßen mit Meilensteinen, deren südlichsten Barth unter 31° 30' n. Br. fand. Am nördlichen Rande der Hamâda stieß derselbe Reisende auf mehrere Grabmäler, von denen zwei vortrefflich erhaltene, 15 und 8 Meter hoch, vermutlich für Befehlshaber dortiger vorgeschobener Posten der dritten Legion errichtet waren. Das südlichste dieser Monumente bei Alt-Djermi (26° 22') zeigt, daß auch hier die Niederlassungen der Römer keine ganz vorübergehenden gewesen sein können. Plinius berichtet, daß der Weg zu den Garamanten früher nicht zu finden gewesen sei, da die »Räuber dieses Volks« die (für Ortskundige in geringer Tiefe zu öffnenden) Brunnen verschüttet hatten; doch nach einem Kriege, den sie im Jahre 70 gegen Oea führten, hatte man einen um vier Tagereisen abgekürzten Weg dahin entdeckt, welcher »Am Haupt des Felsens vorbei« genannt wurde; höchstwahrscheinlich, weil diese direkte und westlichste Straße den Gebirgsabfall des Ghurian an der steilsten Stelle passierte. Plinius wiederholt über die Garamanten und die Troglodyten Äthiopiens die Nachrichten Herodots: daß bei den ersteren die Rinder rückwärts gehend weiden, und daß die letzteren sich von Schlangen nähren und ihre Sprache ein bloßes Gezisch ist. Ein Hauptgegenstand des Handels mit den Garamanten und Troglodyten waren Edelsteine, besonders, schon in der Zeit der Herrschaft von Karthago, Rubine; Balbus hatte in seinem Triumph ein Bild des Berges Gyri aufgeführt, auf welchem, wie eine vorausgetragene Inschrift lehrte, Edelsteine wuchsen. Garama war der Ausgangspunkt für zwei römische Entdeckungsreisen ins innere Afrika, von denen Ptolemäus berichtet. Septimius Flaccus gelangte von dort, drei Monate südwärts reisend, zu den Äthiopen; Julius Maternus aus Groß-Leptis (Lebida) ebenfalls von Garama, und zwar, wie noch heute reisende Europäer, unter dem Schutze eines auf Beute gegen die Äthiopen ausgezogenen Garamantenfürsten, in vier Monaten nach Agisymba, »wo die Rhinozerosse zusammenkommen«, ein Land, welches auf keinen Fall nördlicher als in der bewässerten Tiefebene des Tsad gesucht werden kann.
»Das größte Naturrätsel Afrikas«, den Ursprung des Nil, unternahm Nero zu ergründen, da er unter andern Kriegen auch einen Feldzug nach Äthiopien beabsichtigte. Die von ihm ausgerüstete Expedition »gelangte auf dem Weißen Nil bis zu den großen Schilfsümpfen an der Einmündung des Keilak und des Gazellenflusses, wo der Hauptstrom, wie man erfuhr, von den Eingeborenen Kir genannt ward. Unter den nubischen Negerstämmen, welche durch die Neronische Nilexpedition bekannt wurden, sind die Syrbotae oder die Anwohner des Syr (Kir) die heutigen Schir; die Medimni die Medin; die Olabi die Eliab; die Simbarri und Palugges des Nilreisenden Aristocreon bei Plinius die Barri-Neger und die Poludschi des Herrn Brun Rollet. Wenn die Neronischen Entdecker auch Sagen von mißgestalteten Menschen, Zwergen ohne Ohren, mit einem beinahe zugewachsenen Mund heimbrachten, so lag zwar zu allen Zeiten der Sitz der Fabelgeschöpfe immer jenseits der Grenze des Bekannten, aber der Weiße Nil ist bis auf unsere Tage vorzugsweise die Freistätte der anthropoiden Gespenster gewesen, mit denen noch vor wenigen Jahren die Eingeborenen einen kühnen Elfenbeinjäger abzuschrecken gedachten«.
Am erklärlichsten ist es, daß die Phantasie zu allen Zeiten geschäftig war, die Länder des Ostens, vor allen Indien, mit immer neuen Wundern zu schmücken. Lucrez sagt, daß viele Tausende von »schlangenhändigen Elefanten« Indien so dicht mit einem Gehege von Elfenbeinzähnen umschließen, daß man nicht ins Innere zu dringen vermöge; Vergil, die Bäume der indischen Wälder seien so hoch, daß man keinen Pfeil über ihre Wipfel schießen könne. Noch Dio von Prusa schildert Indien (und zwar nach Erzählungen von Kaufleuten, die seine Häfen besucht, aber schwerlich viel vom Innern gesehen hatten) als ein Paradies. Dort strömen Flüsse von Milch, Honig, Öl und Wein, die Erde bietet dem Menschen freiwillig seine Nahrung, die Wiesen prangen mit den schönsten Blumen, die Bäume geben aufs reichlichste Früchte und Schatten, der Gesang der Vögel ist schöner als Musik von Instrumenten, eine milde Wärme, wie im Anfang des Sommers, herrscht das ganze Jahr, die Gestirne sind zahlreicher und glänzender als in den griechischen Ländern, und die Menschen leben über vierhundert Jahre, ohne Krankheit, Alter und Armut zu kennen. Während aber das Volk jeden Tag als Fest verbringt, geben sich die Brahmanen ganz der Betrachtung und Enthaltsamkeit hin und legen sich freiwillig die Erduldung unerhörter Kasteiungen auf; sie trinken auch aus der Quelle der Wahrheit, nach der ewig dürstet, wer einmal davon gekostet hat.
Auch über den äußersten Norden behaupteten sich Sagen und wunderliche Vorstellungen hartnäckig. Den Berichten von einem seligen Hyperboreerlande, mit ewigem Frühlinge, wo die Sonne nur einmal im Jahre auf- und einmal untergeht und der Tag ein halbes Jahr dauert, mochte Plinius nicht völlig den Glauben versagen. Tacitus sagt, daß im Norden ein starres, unbewegliches Meer den Erdkreis abschließt; dorthin setze man mit Wahrheit die Grenze der Natur, denn so nahe gehe dort die Sonne unter, daß ihr Glanz die Nacht erhelle und die Sterne verdunkle, ja man wolle ihr Rauschen beim Aufgehn aus dem Meere vernommen haben. Die fabelhaften Berichte über die nördlichsten Völker, die Menschengesichter, aber Tierleiber haben sollten, wollte er als unerwiesen dahingestellt lassen. Ein gelehrter Freund Plutarchs, Demetrius aus Tarsus, hatte im kaiserlichen Auftrage oder doch auf kaiserliche Kosten eine Reise gemacht, um über die bei Britannien zerstreuten, unbewohnten Inseln Genaueres zu erfahren, von denen einige Eilande der Dämonen und Heroen genannt wurden. Er hatte zu diesem Zweck die Britannien zunächst gelegene, bewohnte Insel besucht, deren nicht zahlreiche Einwohner angeblich den Britanniern als heilig und unverletzlich galten. Als dort ein plötzliches, heftiges Unwetter die Luft erfüllte, erfuhr er von den Insulanern, dies rühre daher, daß eben die Seele eines der »Mächtigen« ausgefahren sei. Auf einer jener wüsten Inseln werde Kronos schlafend von Briareus gefangengehalten, und viele Geister seien dort als seine Dienerschaft und sein Gefolge. Die Vorstellung, daß jene Küsten und Inseln ein Teil des Totenreichs, ein Aufenthalt der abgeschiedenen Seelen seien, kehrt auch in späteren Zeiten in mehreren Formen wieder.
Aber auch innerhalb der Grenzen der bekannten Erde beschränkten sich bei weitem die meisten Reisen auf ein verhältnismäßig enges Ländergebiet. Über die Grenzen des römischen Reichs wagten sich, mit Ausnahme von Kaufleuten, offenbar nur sehr wenige. Strabo meinte, daß nicht leicht ein Geograph viel weitere Reisen gemacht haben möchte als er: er war in der Richtung von Osten nach Westen von Armenien bis an die Westküste Italiens, von Norden nach Süden vom Schwarzen Meer bis an die Grenze Äthiopiens gekommen.
Pausanias hatte auf seinen langen und weiten Reisen (in Libyen, Ägypten, Arabien, Palästina, Kleinasien, Griechenland, Italien, Sicilien) niemanden angetroffen, der in Babylon oder in Susa gewesen war. In den Donauländern waren in Trajans Zeit außer Kaufleuten und Armeelieferanten Fremde höchst selten zu finden. Im römischen Reiche selbst konnten Reisen, die ohne eigentlich wissenschaftlichen Zweck nur zum Vergnügen und zur Belehrung unternommen wurden, so gut wie nie nach den nördlichen Ländern gerichtet sein. Von diesen galt ohne Zweifel in bezug auf Reisen im allgemeinen, was Tacitus in bezug auf Auswanderungen von Germanien sagt: es war undenkbar, daß jemand Italien verlassen sollte, um diese Gegenden aufzusuchen.
Dagegen wurden allerdings in die westlichen Provinzen, wie es scheint, nicht ganz selten Reisen aus bloßer Schaulust gemacht, da namentlich Gallien und Spanien, in denen römische Sitte und Kultur in hohem Grade verbreitet war, manches Anziehende boten, und besonders das erstere ein völlig andres Land geworden war, als in Ciceros Zeit, wo es weder durch Anmut der Gegenden, noch durch Bildung und Gesittung der Menschen und Völker Fremde festzuhalten vermochte. Der afrikanische Dichter P. Annius Florus hatte, nachdem er im kapitolinischen Agon zu Rom (90 oder 94) durchgefallen war, um sich zu zerstreuen, weite Reisen unternommen: zuerst allerdings nach Sicilien, Kreta, den Cycladen, Rhodus und Ägypten; dann aber war er über Italien zu Lande nach den gallischen Alpen und den bleichen Völkern des Nordens gereist, hierauf westwärts bis an die den Alpen durch ihre Schauerlichkeit, ihre Höhe und ewigen Schnee gleichenden Pyrenäen. Zuletzt hatte er sich in Tarraco niedergelassen. In Spanien scheint besonders Gades, wo auch Posidonius sich längere Zeit aufhielt, ein vielbesuchtes Reiseziel gewesen zu sein. Schon Cicero sagt: Diejenigen meinen etwas erreicht zu haben, welche die Mündung des Schwarzen Meeres gesehen haben und jene Meerenge, durch welche zuerst die Argo eindrang, oder diejenigen, welche jenen Sund des Ozeans gesehen hatten, »wo die reißende Flut Europa von Afrika scheidet«. Auch Aristides hatte die Absicht, zwischen den Säulen des Hercules durchzuschiffen, doch wurde er durch seine Krankheit daran verhindert. Übrigens dürfte auch der weltberühmte uralte Tempel des phönicischen Hercules, d. h. des Melkart, eine Veranlassung zur Reise nach Gades gewesen sein.
Die Reisen der Provinzialen erhielten gewiß vorzugsweise durch den Wunsch, Rom zu sehen, ihre Richtung. Jener Florus traf z. B. in Tarraco mit einigen Bätikern zusammen, »welche von der Beschauung der Stadt zurückkehrten«. Dagegen schlug die weit überwiegende Mehrzahl der römischen Reisenden, insofern sie sich nicht mit Wanderungen in Italien und Sicilien begnügte, die Richtung nach Süden und Osten ein. Daß Griechenland, Kleinasien und (seit der Zeit des Augustus) Ägypten die damals von der Hauptmasse der eigentlichen Touristen ausschließlich besuchten Länder waren, kann niemandem zweifelhaft sein, der die damalige Literatur auch nur oberflächlich kennt. Ovid (geb. 711 =43 v. Chr.) war nur in Sicilien, Athen und Kleinasien gewesen. Vermutlich war es in der Zeit, wo er reiste, noch nicht gewöhnlich, auch (das erst im Jahre 724 = 30 v. Chr. zur römischen Provinz gewordene) Ägypten zu besuchen. Doch in einem während der Fahrt nach Tomi im Jahre 8/9 n. Chr. geschriebenen Gedicht nennt er es bereits als ein gewöhnliches Reiseziel: er sei nicht auf dem Wege nach Athen oder den Städten Kleinasiens, wie ehemals, oder nach der herrlichen Stadt Alexanders und den Reizen des lusterfüllten Nil. Viele sehenswerte Dinge in und bei Rom selbst, sagt der jüngere Plinius, habe man nie gesehen, ja kenne sie nicht einmal vom Hörensagen, die man aus Büchern, Erzählungen, durch eigenen Besuch kennen würde, wenn Griechenland, Kleinasien, Ägypten sie hervorgebracht hätte, oder ein andres Land, das an Merkwürdigkeiten reich wäre und sie anzupreisen verstände. Nächst den Reisen in Italien müssen also diese Länder und die in ihnen besuchten Orte Gegenstand der Betrachtung sein.
Zu kleineren Ausflügen bot Italien eine große Anzahl anziehender Punkte in allen Richtungen. Seneca schildert, wie man durch kleine Streifereien zur See und zu Lande und fortwährenden Szenenwechsel dem Mißbehagen und der Langeweile zu entfliehen suchte. Bald reiste man nach Campanien; dann ward man der lieblichen Gegend überdrüssig und verlangte nach Wildnissen, und es wurden die lucanischen und bruttischen Waldschluchten durchzogen. Doch in diesen Einöden empfand man wieder Sehnsucht nach einem freundlichen Anblick, an dem die verwöhnten Augen sich von der starren Rauheit jener Gegenden erholen sollten: so ging es nach Tarent, und endlich wieder nach Rom zurück, um nicht länger das Klatschen und Gebrause des Zirkus und Amphitheaters zu entbehren.
Doch solche Streifereien aus Langeweile wurden natürlich nur von einzelnen gemacht. Dagegen bedeckten sich im Sommer und Frühherbst alle Chausseen mit Reisenden, die der drückenden Schwüle und der Fieberluft, die dann über der Stadt brütete, entflohen, und die hohen Straßen Roms wurden leerer und leerer. Zu Sommeraufenthalten wurden namentlich die bequem zu erreichenden Orte in den nahen Gebirgen und an der Küste von Latium und Campanien gewählt, doch auch an der etrurischen. Schon die Großen der Republik pflegten in diesen Gegenden zahlreiche Villen zu besitzen; so Cicero (außer denen zu Arpinum und dem besonders geliebten Tusculanum) bei Antium, Astura, Formiä, Cumä, Puteoli und Pompeji; Pompejus zu Alba, Tusculum, Formiä, im Falernergebiet, bei Cumä, Bajä, Tarent, Alsium usw. Unter einer nicht minder großen Zahl von Landsitzen werden die Großen der Kaiserzeit für ihre Villeggiatur in der Regel die Wahl gehabt haben. Die Aurelii Symmachi besaßen im 4. Jahrhundert deren 15, teils in unmittelbarer Nähe der Stadt, teils an den beliebtesten Orten der latinischen Küste und des Gebirges, teils am Golf von Neapel. Martial und Statius geben Listen der beliebtesten Sommeraufenthalte; kaiserliche Villen fehlten vermutlich an keinem derselben. Augustus besuchte von den seinigen am häufigsten die am Meer und auf den Inseln Campaniens (wie Capri) gelegenen oder die in den nahe gelegenen Städten, wie Lanuvium, Tibur und Präneste. Als Martial sein fünftes Buch an Domitian sandte, war er ungewiß, ob der Kaiser von den albanischen Höhen die Aussicht auf den See von Nemi einerseits und das Meer andrerseits genieße; ob er sich zu Antium befinde, »wo so nahe bei Rom die glatte Woge des Meers ruht«, oder zu Cajeta, Circeji oder auf den weißen Felsen von Tarracina mit ihren heilbringenden Quellen. In Tusculum gab es mindestens 4 kaiserliche Villen, die von einem eigenen, an der Spitze eines zahlreichen Personals stehenden Prokurator verwaltet wurden; in Privatbesitz befindliche lassen sich etwa 40 nachweisen.
So war nicht nur im reichsten Maße durch Abwechslung in der landschaftlichen Szenerie für Mannigfaltigkeit des Naturgenusses gesorgt, man konnte auch das der Jahreszeit angemessene oder sonst zusagende Klima aus einer ganzen Skala wählen. In Neapel, schreibt Marc Aurel als Cäsar im Jahre 143 an Fronto, sei das Klima sehr angenehm, doch sehr wechselnd. Die Nacht zuerst lau wie in Laurentum, um die Zeit des Hahnenschreis kühl wie in Lanuvium, gegen Sonnenaufgang kalt wie auf dem Algidus, der Vormittag sonnig wie in Tusculum, der Mittag glühend wie in Puteoli, der Nachmittag und Abend gemäßigter wie in Tibur. Für Bajä war die Hauptsaison im März und April; Nero lud seine Mutter dorthin zur Feier der Quinquatrus (19.-23. März) ein. Im Hochsommer begab man sich nach Präneste, Aricia, Tibur, Tusculum, an den Anio oder auf das von Tusculum und Veliträ gegen Präneste sich hinziehende Waldgebirge des Algidus. Caligula ließ sich mit ungeheurem Aufwande ein palastähnliches Prunkschiff, ausgestattet mit Säulenhallen, Bädern und Gartenanlagen, erbauen, auf dem er an der campanischen Küste unter Musik und Gesang entlang fuhr. Viele Orte waren (wie auch die laurentinische Villa des Plinius) gleich sehr zu Sommer- wie zu Winteraufenthalten geeignet: so war z. B. der Winter an der in weitem Bogen von schützenden Felsen umgebenen Küste von Luna (Spezia) wie der Maremmen durchweg mild, aber auch der Sommer nicht zu heiß. Vorzugsweise dienten natürlich Orte im südlichen Italien als Winteraufenthalte, wie Velia und Salernum; doch vor andern lud hierzu das liebliche, für viele zugleich durch seine Abgeschiedenheit anziehende Tarent ein, wo der Winter so lau und der Frühling so lang war und die Natur in so überschwenglicher Fülle ihre Gaben spendete wie kaum in dem glücklichen Campanien.
Außer den Überresten römischer Bauten an vielen dieser Orte vergegenwärtigen gelegentliche Äußerungen römischer Autoren den Reiz der dortigen Villeggiatur. In Centumcella (Cività Vecchia) stand nach der Beschreibung des Plinius die herrliche Villa Trajans mitten in grünen Feldern, hart über dem Gestade, wo gerade damals (106/07) ein Hafen gebaut wurde, an dessen Mündung eine künstliche Insel, aus gewaltigen Felsblöcken aufgetürmt, den Anprall der See aufhalten und den Schiffen zu beiden Seiten den Eingang gewähren sollte. Schon ragte aus dem Wasser ihr steinerner Rücken hervor, an dem die Fluten sich brachen, und ringsum schäumte und toste das Meer. An die Insel sollten später Molen angebaut werden.
An Alsium (in der Nähe des heutigen Palo), wo schon Pompejus, später Verginius Rufus († 97) eine Villa, »das Nestchen seines Alters«, hatte, ziehen sich große Ruinen längs dem Meer in der Ausdehnung von etwa 450 Meter, landeinwärts von mehr als 200 Meter hin mit Trümmern von Mosaikfußböden, edlen Marmorarten, Antefixen, Bleiröhren einer Wasserleitung, Scherben von Frauenglas: vermutlich die Überreste des dortigen kaiserlichen Lustschlosses, dessen Verwaltung ein eigener Prokurator leitete. An diesen »reizenden Seeaufenthalt« hatte sich M. Aurel im Jahre 161 auf 4 Tage zurückgezogen, und Fronto machte ihm in einem dahin gerichteten Brief zärtliche Vorwürfe, daß er auch dort den Geschäften obliege, statt mittags in der Sonne zu liegen und zu schlafen, am einsamen Ufer zu schlendern, bei ruhiger Luft ein Boot zu besteigen und auf die See hinausfahrend auf die Hammersignale der Rudermeister und die entsprechenden taktmäßigen Ruderschläge zu horchen, endlich nach dem Bade ein königliches Mahl mit Muscheln, Fischen und frutti di mare aller Art sowie andern köstlichen Dingen zu halten.
An dem lieblichen Strande des im 2. Jahrhundert sehr blühenden und volkreichen Ostia, wo bereits Varro die Villa des Sejus erwähnt, wandelte Gellius an einem Sommerabend mit Favorinus und andern Philosophen in Gesprächen über den Wert der Tugend für die Glückseligkeit; und vielleicht nicht viele Jahre später begab sich in den Ferien der Weinlese der Christ Minucius Felix mit einem heidnischen und einem christlichen Freunde dorthin. Sie ergingen sich am äußersten Rande des sanftgekrümmten Ufers, wo auf hartem Sande die leichtgekräuselten Wellen ihre Sohlen bespülten, sahen an der Stelle, wo die aufs Land gezogenen Kähne auf Baumstämmen ruhten, Knaben um die Wette flache, runde Steine über die Wasserfläche hin werfen, so daß sie wiederholt aufhüpfend die Spitzen der Wellen durchschnitten, und ließen sich endlich auf den zum Schutz der Badenden weit ins Meer hinausgeführten Felsenmauern nieder, um den Wert des alten und neuen Glaubens gegeneinander abzuwägen.
An dem jetzt so öden Strande von Ostia bis Lavinium (Pratica) zog sich eine bald zusammenhängende, bald unterbrochene Reihe von Landhäusern hin, so daß man mehrere Städte zu sehen glaubte; seit Augustus' Zeit bestand hier eine eigene Villenkolonie Laurentum. Zu ihr gehörte außer der so ausführlich beschriebenen Villa des jüngeren Plinius auch eine kaiserliche, in deren kühle Lorbeerhaine sich Commodus im Jahre 188 zurückzog, um der in Rom herrschenden Seuche zu entfliehen.
Bei Astura auf der Insel, die der gleichnamige Fluß vor seiner Mündung bildet, lag eine Villa Ciceros; sie war von dichtem Walde umgeben, Land und Meer verliehen ihr die Reize der Stille und Einsamkeit, in der man ungestört dem Schmerz nachhängen konnte. Man hatte von dort die Aussicht sowohl auf Antium, als auf das ebenfalls viel besuchte Vorgebirge der Circe, »die blaue Felsensphinx, die von jedem Standpunkt sichtbar, jenseits der Pontinischen Sümpfe den Eingang in das eigentliche Paradies des Südens bewacht«. Auch in Circeji gab es eine kaiserliche Villa.
Doch alle diese Orte überglänzte die auf einer weit vorspringenden, felsigen Landspitze gelegene Prachtstadt Antium, schon in der letzten Zeit der Republik, noch mehr in der Kaiserzeit mit Tempeln und Palästen prangend, die zum Teil ins Meer hinausgebaut waren, ein Lieblingsaufenthalt der Kaiser, namentlich Caligulas und Neros, welche beide dort geboren waren. Aus den dortigen Palästen stammen viele der berühmtesten Kunstwerke (wie der Borghesische Fechter und neuerdings das sogenannte »Mädchen von Anzio«); 3 Millien weit erstrecken sich die Ruinen von Antium; auch aus dem Meer ragen Reste dieser versunkenen Herrlichkeit oder schimmern durch die durchsichtige Flut herauf; weit und breit ist das Gestade mit Stücken der kostbarsten, von den Wellen plattgeschliffenen Marmorarten (wie Verde und Giallo antico, Pavonazetto usw.) wie mit Kies bedeckt.
Dann war auch die Bucht, die sich bei Terracina öffnet (der Golf von Gaeta), von einer Reihe herrlich gelegener Seestädte eingefaßt, zwischen denen wieder überall Villen und Landhäuser sich erhoben. Martial genoß einst den ersten Frühling auf der Villa seines Freundes Faustinus bei Anxur (Tarracina), als Boden und Bäume sich mit Grün bedeckten und die Nachtigallen schlugen. Wie schön war es dort in der bloßen Tunica im Sonnenschein zu ruhen, wie schön der Hain, die Quellen, der feste Sand des von der Flut benetzten Ufers und die leuchtenden Felsenhöhen, die sich im Wasser spiegelten, wie schön das Ruhebett in jenem Zimmer, von dem man zugleich das Meer und den Fluß – den neben der Appischen Straße bis Rom hinlaufenden Kanal – sah! Nahe bei Tarracina war unter andern »gewaltigen Höhlen, welche große und prachtvolle Wohnungen in sich fassen«, die Villa Spelunca (jetzt Sperlonga) zwischen den weinbelaubten Höhen von Fundi und dem Meer, wo einst Sejan mit Tiberius in einer natürlichen Grotte speisend diesem mit eigener Gefahr das Leben rettete, als ein Teil des Felsengewölbes herabstürzte.
Dann folgten Cajeta und »das süße Ufer des milden Formiä«, wo Martials Freund Apollinaris eine Villa besaß, die er leider zu wenig besuchen konnte, und deren Reize weit mehr von den glücklichen Verwaltern und Türstehern genossen wurden als von dem Herrn. Dort kräuselte ein sanfter Wind die Fläche des stillen, doch nicht leblosen Meers und förderte den Lauf des buntbemalten Kahns. Die Angelschnur konnte man auf Polstern liegend aus den Fenstern ins Meer werfen; überdies war der Fischteich mit den köstlichsten Meerfischen gefüllt. Auch S. Julius Frontinus hatte in Formiä eine Villa. Minturnä am Liris mit dem Hain und Tempel der Nymphe Marica wird als Aufenthalt des berühmten Schlemmers Apicius genannt; auch der Verehrer des Plotinus, Castricius Firmus, hatte in jener Gegend ein Landhaus. An der Küste zwischen Cumä und Misenum lag die von Seneca beschriebene Villa des Servilius Vatia, deren Ruinen noch erhalten sind, mit zwei großen künstlichen Grotten, von denen die eine niemals, die andre den ganzen Tag von der Sonne beschienen wurde, mit einem aus dem Meere durch einen Platanenhain zum Acherusischen See (Lago di Fusaro) geführten Kanal, in dem gefischt wurde, wenn das Meer zu stürmisch war. Man genoß hier die Annehmlichkeiten des benachbarten Bajä, ohne unter den Beschwerden des dortigen Badelebens zu leiden.
Das Hauptziel der Erholung und Zerstreuung Suchenden aber war der Golf von Neapel, »jener reizende Krater«, eine »zum Trost des Gemüts geeignete Gegend«, und schon in der letzten Zeit der Republik zum Sammelplatz der feinern Welt auserkoren. Von Misenum bis zu dem »lieblichen Sorrent« säumte ihn eine fortlaufende Reihe von hellschimmernden Flecken, Städten und Villen gleich einer Perlenschnur, so daß man eine einzige zusammenhängende Stadt zu sehen glaubte; und so bot sich hier eine überreiche Auswahl der herrlichsten Aufenthalte dar. Einen Teil derselben nennt Statius in dem Gedicht an seine Frau, in dem er sie auffordert, ihn aus Rom dorthin in seine Heimat zu begleiten: wo der Winter mild und der Sommer kühl ist, die ein friedliches Meer mit schlummernden Wogen bespült, wo Friede und Sorglosigkeit und ungestörte Ruhe herrschen und das Leben müßig verträumt wird. Dort liegt das prächtige, reich geschmückte Neapel mit seinen Tempeln, seinen von unzähligen Säulen eingefaßten Plätzen, seinem bedeckten und unbedeckten Theater, wo ein dem kapitolinischen nahekommendes periodisches Festspiel gefeiert wird. Dort herrscht Heiterkeit und eine Freiheit, wie Menander sie gepredigt, in der sich römische Würde und griechische Ausgelassenheit vereinen. Die Umgegend bietet die mannigfachsten Zerstreuungen dar, möge man nun das liebliche Gestade von Bajä oder die Grotte der Sibylle zu Cumä oder Misenum besuchen wollen oder die üppigen Rebengehänge des Gaurus oder Capri, von dessen Leuchtturm den Schiffen ein mit dem Monde wetteiferndes Licht strahlt, oder die von Bacchus, doch auch von andern Göttern geliebten Höhen von Sorrent, oder die heilenden Wasser von Ischia.
Die hier genannten und noch andere Orte werden auch sonst öfters als Erholungsaufenthalte erwähnt. Ohne Zweifel flüchteten zu allen Zeiten viele wie Vergil aus dem rastlosen Treiben Roms für immer in die genußreiche, friedliche Stille Neapels, »der zu tatloser Ruhe geschaffenen Stadt«, welche die »griechische Muse, die griechischen Spiele, das gesamte künstlerische und gelehrte griechische Treiben bis zum Zusammenbruch italischen Wohlstands und italischer Bildung zu einer hellenischen Kulturinsel machten«. Andre zogen sich wenigstens nach einem geschäftsvollen Leben im Alter dorthin zurück, wie Silius Italicus, der bei Neapel mehrere, sämtlich mit Statuen und Büsten reich geschmückte Landhäuser besaß. Der Name einer der dortigen römischen Villen lebt noch heute fort. Bekanntlich heißt nach dem Pausilypon (Sorgenfrei) jenes Vedius Pollio, der seine Muränen mit Sklaven fütterte, der Bergrücken zwischen Neapel und Puteoli. Den Tunnel durch denselben ließ Agrippa durch Coccejus brechen. Seneca hatte unter dem Staube dieser mit düster brennenden Fackeln beleuchteten crypta Neapolitana zu leiden, als er einmal bei der Fahrt von Bajä nach Neapel aus Furcht vor Seekrankheit den Landweg wählte. In der Hafenstadt Puteoli, wo man sich schon in Ciceros Zeit gern anbaute, verbrachte z. B. Gellius einst die Sommerferien in Gesellschaft des Rhetors Antonius Julianus, und der große griechische Grammatiker Herodian verfaßte dort sein Gastmahl. Von Bajä wird später ausführlich die Rede sein. In Misenum ist namentlich die hochgelegene, von Luculi erbaute, später kaiserliche Villa mit weiter Aussicht auf den Golf von Neapel wie auf das Toskanische Meer bekannt, in der Tiberius sich öfters aufhielt und wo er auch starb.
Die gegenüberliegende Küste bot bis zum Jahre 79, in dem der erste bekannte Ausbruch des Vesuv die Umgegend so furchtbar verwüstete, einen ganz andern Anblick als später. Mit Ausnahme des Kraters, den man für erloschen hielt, war der ganze Berg mit Feldern und Weinbergen bedeckt; die Aussicht (von Capri) auf diese Küste war herrlich, sagt Tacitus, ehe der Brand des Vesuv die ganze Gegend verwandelte; wo jetzt alles in Asche begraben liegt, sagt Martial im Jahre 88, hatte sonst die Kelter die edelsten Trauben gepreßt; auf diesen Höhen, die Bacchus über alles liebte, hatte der Schwarm der Satyrn seine Reigentänze aufgeführt, hier hatte die Stadt der Venus (Pompeji), hier die des Hercules gestanden. Die Umgegend des mit beiden zugleich verschütteten Stabiä (Castellamare) diente, wie bereits erwähnt, bis ins 6. Jahrhundert als ländlicher Aufenthalt für Kranke, denen eine Milchkur verordnet war. Am reichsten mit Villen besetzt waren vermutlich die Höhen von Sorrent, auf deren vorspringender südwestlicher Landspitze ein Tempel der Minerva stand, deren Namen dies Kap noch heute trägt. Die Beschreibung des Statius von der dortigen Villa des Puteolaners Pollius Felix zwischen den Kaps von Sorrent und Massa gibt eine Vorstellung von der Pracht und Schönheit der Bauten und Anlagen dieser ganzen Küste. Auch sie, über deren Wein die Ansichten allerdings sehr geteilt waren, durfte sich rühmen, in besonderer Gunst des Bacchus zu stehen; zu den Göttern, die sie außerdem beschützten, scheint neben Minerva und Neptun Venus gehört zu haben, die Vergil dort anrief, ihm ihren Beistand zur Vollendung des Gedichts zu leihen, das ihren Sohn verherrlichen sollte.
Endlich Capri hatte schon Augustus, der von der Stadt Neapel die Insel sich gegen Überlassung von Ischia abtreten ließ, mit Palastbauten geschmückt. Weltbekannt ist des Tiberius dortiger zehnjähriger Aufenthalt (27-37). Von einigen der zwölf, nach den Hauptgöttern benannten Villen, die er dort erbaute, sind dürftige Trümmer übrig, bedeutendere nur von seinem eigentlichen Wohnsitz, der Villa des Juppiter, auf der höchsten Nordostspitze der Insel in der Nähe der ebenfalls noch vorhandenen Unterbauten des von Statius erwähnten Leuchtturmes. »Welch ein Anblick, denkt man sich alle diese Gipfel mit Marmorpalästen geschmückt und das schöne Eiland bedeckt mit Tempeln, Arkaden, Statuen, Theatern, mit Lusthainen und Straßen.« Mit der Aussicht, die man von jener Villa des Juppiter auf den ganzen Golf mit seinen Küsten und Inseln sowie auf den Golf von Salerno und das offene Meer genießt, dürften in der ganzen Welt wenige zu vergleichen sein.
So zog sich »das ganze Meeresufer Toscanas bis nach Terracina entlang, von Terracina bis nach Neapel und rings um den Golf und weiter über Salerno hinaus eine Reihe von Marmorpalästen, von Bädern, Gymnasien und Tempeln hin, ein fortlaufender Kranz römischer Herrlichkeit. Wer damals an diesem Strande entlang fuhr und die Menge der Lustanlagen sah, die mit den Städten wetteiferten, der mußte eines schönen Anblicks menschlicher Kultur froh werden. Heute stehen an diesen elysischen Ufern einsame verwitterte Türme des Mittelalters, welche zum Schutz gegen anlandende Sarazenen gebaut wurden«.
Daß die von Rom aus weiter entfernten und schwerer zu erreichenden Küsten Italiens seltener besucht und zu Aufenthalten gewählt wurden als die Westküste, ist selbstverständlich; unbesucht aber blieben ihre schönen Punkte gewiß nicht. Einen derselben hat Cassiodor geschildert, das an der Südostküste des heutigen Calabrien gelegene Scyllacium (jetzt Squillace an dem nach ihm benannten Golf). Die Stadt lag in traubenförmiger Gestalt auf Hügelabhängen über der Bucht ausgebreitet und gewährte einen entzückenden Blick auf grüne Fluren und die blaue Fläche des Meers. Sie war so ganz der aufgehenden Sonne zugewendet, daß deren volles Licht sie gleich nach dem Aufgange bestrahlte; sie hatte sonnige Winter, kühle Sommer, einen großen Reichtum an den Erzeugnissen des Meers, Cassiodor selbst hatte dort Fischbehälter angelegt. Überall konnte man aus der Stadt auf Weingärten, Getreidefelder und Ölwälder sehen und fühlte deshalb dort nicht das Bedürfnis, sich an der Schönheit ländlicher Natur zu erfreuen. Die reizende Lage der Stadt hatte zur Folge, daß viele, die nach Erholung verlangten, sie besuchten und der Gemeinde durch ihre Forderungen Kosten verursachten.
Daß es auch an der Ostküste an prachtvollen Lustorten und Villen nicht fehlte, geht aus gelegentlichen Erwähnungen hervor. Neros Vaterschwester Domitia hatte Besitzungen bei Bajä und bei Ravenna, welche seine Begier so sehr erregten, daß er um ihretwillen Domitia vergiftete. Er erbaute an beiden Orten Lustschlösser, die noch in der Zeit des Cassius Dio aufs beste erhalten waren. Eine Entscheidung des Juristen Celsus (unter Trajan und Hadrian) bezog sich auf Bauten eines Ballspielsaals und unter dem Boden angebrachte Heizungsanlagen in dem Park eines Aurelius Quietus bei Ravenna, in dem dieser sich in jedem Sommer aufzuhalten pflegte. Der Seehafen Altinum zwischen Patavium und Aquileja war in Martials Zeit mit prächtigen, den bajanischen gleichkommenden Villen besetzt, wie jetzt die Kanäle der Terra Ferma von Venedig, und das dortige Meeresufer so lieblich, daß Martial sein Leben hier zu beschließen wünschte, wie Horaz zu Tibur. Vermutlich wurden die Ufer des Adriatischen Meers seit der Diocletianischen Zeit mehr und mehr besucht und angebaut, namentlich aber seit Ravenna Residenz geworden war. Cassiodor preist Istrien, diese an Wein, Öl und Korn gleich reiche, köstliche Gegend, als das Campanien Ravennas, das auch sein Bajä, mehr als einen Avernus, Fischbehälter und Austernbassins besitze. »Weit und breit hin leuchtende Schlösser ( praetoria) sind dort wie Perlen aneinandergereiht.« Eine herrliche Kette von Inseln zieht sich am Ufer hin, von denen die Brionischen vor Pola die berühmtesten waren: im Val Catena auf Brione Grande haben sich bedeutende Reste römischer Wirtschafts- und Luxusvillen gefunden.
Von den Gebirgen Italiens wurden natürlich die Rom zunächst gelegenen Albaner- und Sabinerberge während der Republik wie in der Kaiserzeit am meisten zur Villeggiatur benutzt, wie sich schon aus den früheren Erwähnungen ergibt. In den Mauern der römischen Villen haben sich die Kastelle mittelalterlicher Barone und städtische Ansiedlungen eingenistet, wie Frascati und Albano, welches letztere, bereits von Constantin aus dem Lager der zweiten Parthischen Legion entstanden, auf und aus den Trümmern dortiger Villen erbaut ist, von denen die des Domitian in der Gegend der jetzigen Villa Barberini zwischen Albano und Kastell Gandolfo gelegen zu haben scheint. Auch die wildschönen Ufer des Anio waren von Reihen von Landhäusern eingefaßt, unter denen das Lustschloß Neros bei Subiaco bekannt ist. Der prachtvollste wie an landschaftlicher Schönheit reichste dieser Orte war Tivoli; seine sämtlichen Lustbauten aber, von deren Glanz die später zu erwähnende Beschreibung der Villa des Manilius Vopiscus von Statius eine Vorstellung gibt, übertraf weit die kolossale Villa Hadrians, die unter anderm architektonische und landschaftliche Nachahmungen berühmter und interessanter Punkte, namentlich Griechenlands und Ägyptens, enthielt, und deren unerschöpfliche, schon seit Alexander VI. ausgebeutete Ruinen drei Jahrhunderte hindurch die Museen und Paläste Roms mit plastischen Werken gefüllt haben und vielleicht noch immer reiche Kunstschätze in sich bergen.
Ein sehr großer Teil der Reisenden schlug die Appische Straße ein, die von Rom in schnurgerader Richtung auf das Albanergebirge zu, von da nach Campanien und den beiden Haupthäfen Italiens, Puteoli und Brundisium, führte; und auch zu kürzeren Lustfahrten wurde die schöne, belebte Straße viel benutzt. Da fuhr der reiche Mann, welcher der Stadt überdrüssig war, in einer Eile, als gälte es ein brennendes Haus zu löschen, nach seiner Villa im Albanergebirge, um sich dort zu langweilen und zu gähnen oder bald ebenso eilig nach Rom zurückzukehren. Da ließ der emporgekommene Freigelassene seine teuer gekauften Ponys sehen. Da zeigten sich üppige Frauen mit einem Gefolge von Männern. Auch Cynthia fuhr dort, wie Properz berichtet, angeblich um die Juno in Lanuvium zu verehren, sie selbst ein Schauspiel, wie sie ihre Pferde lenkte, und zum Verdrusse des Dichters begleitete sie ein Nebenbuhler auf einem reich ausgestatteten Wagen mit seidenen Vorhängen, neben dem zwei Molosserhunde mit großen Halsbändern hersprangen. Auch nach dem Dianentempel an dem waldumkränzten See von Nemi, dem »Spiegel der Diana«, wo in der heißesten Jahreszeit ein großes Fest gefeiert wurde, bei welchem See und Wald abends und nachts von Fackeln glänzten, wallfahrteten Frauen, die der Göttin ein Gelübde zu lösen hatten, zahlreich, Kränze in den Haaren und Fackeln in den Händen; und es wird nicht an jungen Männern gefehlt haben, die den Rat Ovids befolgten, diese Gelegenheit zum Anknüpfen zärtlicher Verhältnisse zu benutzen. Wie besucht der Ort war, ergibt sich schon daraus, daß in dieser Gegend (spätestens zu Ende des 1. Jahrhunderts) sich eine Art Bettlerkolonie niedergelassen hatte.
Jetzt liegt auf der »Königin der Straßen« statt des bunten, glänzenden Lebens, das damals über sie hinwogte, die tiefste Einsamkeit. Endlos dehnen sich zu beiden Seiten die hügeligen Flächen der Campagna, aus deren Grün die halbzerstörten Bogen der Wasserleitungen ragen; hier und da steht ein graues Haus am Wege. Selten rollt ein Karren, mit hochgestapelten Weinfässern beladen, über das antike Pflaster, Campagnahirten zu Pferd treiben Schaf- und Rinderherden vor sich her, und der schwermütige Gesang eines Feldarbeiters schallt aus der Ferne herüber.
Aber auch über Alba und Lanuvium hinaus blieb die Appische Straße lebendig, denn der Hauptstrom der Reisenden wälzte sich nach Campanien, um in jenem von der Natur zu tatenlosem Genuß wie bestimmten Paradiese, vor allem, wie gesagt, an dem üppigen Golf von Neapel, Erholung oder Genesung zu suchen oder sich Schwelgereien und Ausschweifungen aller Art zu überlassen. Als die Perle unter den dortigen überaus zahlreichen Lustorten galt Bajä, das erste Luxusbad der alten Welt, »das goldene Ufer der seligen Liebesgöttin, das holde Geschenk der stolzen Natur«, am ebenen Strande, doch rings von einem Kranz grüner Berge umschlossen. Es war die Herberge der Welt und zugleich die Wohnung der Nereiden und der Quellnymphen. Die Heilquellen waren mannigfacher Art, vorzüglich aber bediente man sich der an vielen Stellen der Erde entsteigenden heißen Schwefeldämpfe zu Schwitzbädern, die an Ort und Stelle angelegt waren. Auch sonst war Bajä mit großartigen Anstalten für die Kur der Kranken und glänzenden Gebäuden für den Aufenthalt und die Vergnügungen der Gesunden aufs reichste ausgestattet; es prangte mit einer Anzahl kaiserlicher Paläste, in deren Pracht jeder Monarch seine Vorgänger zu überbieten suchte. Die wichtigsten Gebäude und Anlagen an der Küste von Bajä sind mit Unterschriften wie »Leuchtturm, Teich Neros, Austernbehälter, anderer Teich, Wald (oder Park)« sehr roh auf drei der Zeit des Verfalls angehörenden Glasgefäßen dargestellt, wie dergleichen wahrscheinlich für Badegäste und andre Fremde zur Erinnerungen oder Geschenken verkauft oder auf Bestellung fabriziert wurden. Villen erhoben sich in und bei Bajä teils auf weitschauenden Höhen, teils unmittelbar am Rande des Meeres, oder waren ins Meer hinausgebaut. Daß sie in der Regel von Gärten umgeben waren, ist selbstverständlich; diese scheinen meistens kunstvoll angelegt gewesen zu sein und mit ihren Myrten- und Platanenhainen und Gängen, die von geschorenen Buchshecken eingefaßt waren, weite Räume eingenommen zu haben. Auch an schattigen Lauben fehlte es natürlich nicht. Ein Dichter findet den Ort zu einem Stelldichein für Mars und Venus besonders geeignet, weil Vulcan durch die Gewässer, der spähende Sonnengott durch den Schatten ferngehalten werde. Eine wahrhaft ländliche Besitzung, wie die von Martial beschriebene seines Freundes Faustinus, mit vollen Kornscheunen und reicher Weinlese, Viehherden, einem großen Geflügelhof, Jagd und Fischerei, war dort offenbar eine Ausnahme. Die prachtvollen Villenbauten Bajäs bildeten eine Stadt für sich, nicht kleiner als Puteoli, und vermutlich war diese in fortwährendem Wachstum begriffen. Mindestens seit dem Anfange des 2. Jahrhunderts unterschied man schon Alt- und Neu-Bajä, das nach Puteoli zu auf fiskalischem Grunde entstanden war; am ersteren Orte starb Hadrian am 10. Juli 138. Aber auch in den spätern Jahrhunderten hat sich der Ort wohl noch vergrößert, da Alexander Severus hier prachtvolle Paläste und andre Bauten aufführte und mit Meerwasser gespeiste Teiche anlegte; mindestens fünf Jahrhunderte lang blieb er der berühmteste und besuchteste Lustort der alten Welt. In Ciceros Zeit galt die Luft dort (wohl nur im Sommer) nicht für gesund; aus späterer Zeit haben sich keine Klagen darüber erhalten. Vielleicht hatte die Erweiterung des Ausbaus die schädlichen Einflüsse beseitigt; noch im 6. Jahrhundert wird die Heilsamkeit der bajanischen Luft gerühmt. Obwohl ohne Zweifel mit der Zunahme der Verödung der Einfluß der Malaria wuchs, blieb der Ort auch im Mittelalter besucht. Im Jahre 1191 beschrieb Alcadinus, Leibarzt Kaiser Heinrichs VI., 31 Bäder von Puteoli und Bajä. Petrarca nennt die Küste dieser Bucht in den Wintermonaten äußerst angenehm, doch im Sommer gefährlich. Boccaccio erwähnt wiederholt das dortige lebhafte, auch damals für die Keuschheit der Frauen gefährliche Badeleben. Die Bäder waren auch im 15. und selbst im Anfange des 17. Jahrhunderts besucht, obwohl Bajä im Jahre 1538 durch einen Erdbrand zerstört worden sein soll.
Im Altertum hatten Natur und Kunst gewetteifert, diesen Ort zu einem in seiner Art einzigen zu machen. Die unvergleichliche Schönheit der Lage, die Pracht und Großartigkeit der Paläste und Gärten, die Überfülle der Genußmittel jeder Art, die herrliche Klarheit und Milde der Luft, die tiefe Bläue des Himmels und des Meeres – alles lud hier zum Genuß des Moments, zu seliger Weltvergessenheit ein, und prachtvolle Feste, in dieser Umgebung doppelt zauberisch, reihten sich in ununterbrochener Folge aneinander. Auf den Wogen des sanftesten Meeres schaukelten zahllose leichtgezimmerte, bunte Barken und Gondeln, unter denen hier und da eine fürstliche Prachtgaleere steuerte, oder maßen sich in Wettfahrten. Heitere, rosenbekränzte Gesellschaften waren zu festlichen Schmäusen an Bord oder am Strande vereint; Betrunkene einhertaumeln zu sehen, war ein gewöhnlicher Anblick. Ufer und Meer erschallten vom Morgen bis zum Abend von Gesängen und rauschender Musik. Zärtliche Paare saßen in leisem Geflüster am stillen Strande beisammen oder ließen sich auf dem Lucriner und Averner See in kleinen Booten umherrudern, und kamen sich, wenn sie von Mücken und Sonnenbrand ein paar kleine Beschwerden zu ertragen hatten, wie neue Argonauten vor. Die Kühle des Abends und sternheller Nächte lud zu neuen Festen und Lustfahrten ein, und der Schlaf der Badegäste wurde bald durch Serenaden, bald durch das Gezänk aneinander geratener Rivalen gestört. Die Üppigkeit und Zügellosigkeit des bajanischen Badelebens war sprichwörtlich. Varro scheint es in einer besonderen Satire geschildert zu haben, aus der angeführt wird, daß dort nicht nur die Mädchen Gemeingut seien, sondern auch viele Alte zu Kindern und Knaben zu Mädchen würden. Cicero fürchtete, es werde ihm übel ausgelegt werden, daß er sich in einer Zeit öffentlichen Unglücks nach Bajä begebe. Seneca meint, der Ort habe eine Herberge der Laster zu werden begonnen: Wüstlinge, die ihre Zahlungsunfähigkeit aus Rom vertrieb, verpraßten hier das Geld ihrer Gläubiger in Austernschmäusen. Von Frauen wurde Bajä besonders viel besucht, und mancher Badegast, meinte Ovid, trug statt der gehofften Heilung eine Wunde im Herzen davon. Einst, sagt ein andrer Dichter, war das Wasser in Bajä kalt, Venus ließ Amor darin schwimmen, ein Funke seiner Fackel fiel hinein und entzündete es; seitdem verfällt, wer dort badet, in Liebe. Für weibliche Tugend galt der Ort als höchst gefährlich. Schon manches zärtliche Verhältnis, klagt Properz, habe sich hier gelöst. Ein Fall, den Martial erzählt, daß eine höchst strenge Frau, die in Bajä als Penelope ankam, es als Helena verließ, das heißt sich von einem Liebhaber entführen ließ, dürfte nicht selten gewesen sein. Diejenigen, welche wie Gellius sich in keuschen und ehrbaren Vergnügungen zu ergötzen wünschten, zogen andre Orte, wie Puteoli, vor. Freilich war, wie Symmachus sagt, die Gegend von Bajä an den dortigen Ausschweifungen unschuldig, und er selbst lebte dort »ohne Gesang auf Barken, ohne Schwelgerei bei Gastmählern«.
Nächst Italien lud am meisten durch seine bequeme Nähe Sicilien zu kürzeren Ausflügen ein, anziehend durch seine Naturwunder, vor allen den Ätna, seinen milden Winter, die Schönheit und Berühmtheit seiner Städte, endlich durch eine Fülle historischer, bis in die Sagenzeit hinaufreichender Erinnerungen. Zu diesen gehörte besonders die Sage vom Raube der Proserpina auf der Wiese bei Henna, auf welcher die Fülle der Veilchen und andrer wohlriechender Blumen so groß war, daß, wie man sagte, die Stärke des Duftes es den Jagdhunden unmöglich machte, die Spur des Wildes zu verfolgen, »ein sehenswerter Ort«; daneben der Schlund, aus dem Pluto hervorgebrochen sein sollte, und in der Stadt selbst der hochberühmte, altehrwürdige Cerestempel. Schon in der Zeit der Republik wurde Sicilien von Römern viel besucht; Cicero sagt, daß dort kaum ein ganz sonnenloser Tag vorkomme. Die meisten von euch, sagt derselbe zu den Richtern des Verres, haben die Steinbrüche bei Syrakus gesehen. Ovid hatte sich in Sicilien in Gesellschaft seines Freundes Macer längere Zeit aufgehalten. Er nennt als hauptsächlichste Sehenswürdigkeiten den Ätna, die Seen von Henna, den Anapus und die Quellen Cyane und Arethusa bei Syrakus, endlich die Seen der Paliken; zwei kleine, sehr tiefe, milchfarbene Seen, aus denen unter starkem Schwefelgeruch und lautem Geräusch fortwährend Wasser aufsprudelte; hier wurden, weil Meineide sofort von der göttlichen Strafe getroffen werden sollten, Eide geleistet. In der Nähe war ein großer und reich geschmückter Tempel, der flüchtigen Sklaven als Asyl diente. Caligula, der nach dem Tode der Drusilla, um sich zu zerstreuen, längs der Küste Campaniens und Siciliens bis Syrakus reiste, machte sich über die Merkwürdigkeiten lustig, die man ihm an den einzelnen Orten zeigte; plötzlich aber floh er in einer Nacht von Messana, aus Schreck über den Rauch und das Getöse des Ätna. Von den Besteigungen des Ätna wird unten die Rede sein. Seneca zählt die Annehmlichkeiten einer Fahrt nach Syrakus auf. Der Reisende bekommt die märchenhafte Charybdis zu Gesicht, die ruhig ist, solange der Südwind weht, dann aber sich in weitem und tiefem Schlunde öffnet und Fahrzeuge hinabreißt. Er sieht die von den Dichtern so hoch gefeierte Quelle Arethusa mit ihrem blinkenden, bis auf den Grund durchsichtigen Spiegel und eiskalten Wasser. Ferner den stillsten von allen natürlichen und künstlichen Häfen, der vor der Wut auch der heftigsten Stürme sicheren Schutz gewährt. Sodann die Stelle, wo die Macht der Athener gebrochen ward, wo die Steinbrüche, zu unermeßlicher Tiefe ausgehauen, als ein natürlicher Kerker viele Tausende umschlossen; und die gewaltige Stadt selbst mit ihrem Gebiet, das größer ist, als die Gebiete vieler Städte; endlich erfreut er sich im Winter des mildesten Klimas, in dem kein Tag ohne Sonnenschein vergeht. Der Astrolog Firmicus Maternus, der sein Werk auf Sicilien im 4. Jahrhundert verfaßte, erwähnt in der Widmung an seinen vornehmen Freund Mavortius Lollianus, daß dieser bei einem Besuch auf der Insel sich durch ihn über alle ihre Merkwürdigkeiten unterrichten ließ: die Scylla und Charybdis, die Eruptionen des Ätna, die Seen der Paliken und alles übrige, was er von wunderbaren Dingen in dieser Provinz seit frühester Jugend in griechischen und römischen Schriften gelesen hatte.
Das nächste Ziel aller weitern Reisen war Griechenland. In Griechenland verehrten die Römer schon früh das Land, von dem alle Kultur ausgegangen war, sie verehrten es um seines hohen Ruhmes, selbst um seines Alters willen; seine Vergangenheit mit ihren großen Taten und Ereignissen, selbst mit ihren Sagen war ihnen ehrwürdig. Der Ruhm, sagt ein römisches Epigramm, bleibt, die Größe ist dahin, doch sucht man die Asche der Gefallenen auf, und noch in ihrem Grabe ist sie heilig. Das Land, in dem fast jeder Zoll breit Erde eine bedeutende Erinnerung aufzuweisen hatte, in dem der Wanderer auf Schritt und Tritt durch unzählige aus jener Vorzeit stammende Denkmäler, durch die berühmtesten Werke aller Künste festgehalten wurde, dessen Städte und Tempel zum Teil noch immer so schön, so glänzend und reich wie alt und berühmt waren, hatten schon seit den punischen Kriegen die Römer von allen fremden Ländern am meisten besucht. »Die meisten von euch«, so läßt Livius die Gesandten der Rhodier 190 v. Chr. im römischen Senat sprechen, »haben die Städte Griechenlands und Asias besucht«. Aemilius Paullus bereiste Griechenland im Herbst 167 v. Chr., um jene Dinge kennenzulernen, die »durch das Gerücht verherrlicht, nach Hörensagen für größer gehalten werden, als sie sich beim Augenschein erweisen«; die Beschreibung, die Livius von dieser Reise gibt, ist aus Polybius geschöpft, der nach Autopsie schilderte. Der römische Feldherr besuchte die berühmtesten Tempel (wie zu Delphi, Lebadea, Oropus, Epidaurus, Olympia) und Städte (Athen, Korinth, Sicyon, Argos, Sparta, Pallantium, Megalopolis); Orte, die, wie Aulis, durch historische Erinnerungen oder aus andern Gründen merkwürdig waren, wie Chalkis mit der Dammbrücke über den Euripus; den größten Eindruck empfing er zu Olympia, wo ihn der Anblick des Phidiasischen Zeus wie der eines gegenwärtigen Gottes im Innersten ergriff.
Die Verheerungen, die Griechenland in den römischen Kriegen von 88 bis 31 v. Chr. erlitten hatte, hat es nie ganz verwunden. Allerdings erholte sich das Land unter der römischen Verwaltung. Das Festland der Provinz Achaja besaß unter den Antoninen neben zahlreichen Dörfern und kleinen Städten noch hundert größere Orte, in denen ein städtisches Leben fortbestand. Doch einzelne Landschaften wie Ätolien blieben völlig verödet, und auch in den begünstigteren erreichte die Bevölkerung nicht wieder die Höhe der Zeit vor den Mithridatischen Kriegen. Obwohl aber Griechenland nur noch ein Schattenbild der früheren Größe bot, vermehrte sich doch gerade dadurch seine Anziehungskraft für die Römer eher, als daß sie sich verminderte. In der Stille und Einsamkeit, die über Land und Städte gebreitet war, trat das Bild der großen Vergangenheit nur um so überwältigender vor die Seele des Wanderers und melancholische Gedanken an die Hinfälligkeit alles menschlichen Werkes drängten sich auf. Unter den Städten verdienten manche kaum noch diesen Namen, wie das einst große und herrliche Panopeus in Phokis, das in Pausanias Zeit aus ärmlichen Hütten bestand; weder ein Palast noch ein Theater, kein Marktplatz, kein Gymnasium, nicht einmal ein Brunnen war dort zu finden. In Theben war nur die Burg Kadmeia noch mäßig bewohnt, und diese wurde nun mit dem Namen Theben bezeichnet; in der Unterstadt standen nur die alten berühmten Tore und verschiedene Heiligtümer. An andern Orten weideten Schafe vor dem Rathause das Gras, und das Gymnasium war in ein Kornfeld verwandelt, aus dessen wogenden Ähren die Häupter der Marmorbilder kaum hervorragten; oft genug sah man auch leere Postamente, deren Inschriften verkündeten, weiche Statuen darauf gestanden hatten. Von vielen Städten waren nur noch Ruinen übrig, und bei der Entvölkerung des Landes konnte in menschenleeren Einöden und Wildnissen der Wanderer, der wie Dio von Prusa gern mit Hirten und Jägern verkehrte, hie und da auf abgelegene Hütten und Gehöfte stoßen, deren Bewohner kaum je eine Stadt gesehen und, in ihrer Abgeschiedenheit von der Verfeinerung wie von der Verderbnis der Zivilisation unberührt, sich die volle Einfalt und Unschuld eines ursprünglichen Zustandes bewahrt hatten.
Doch die meisten Reisenden besuchten ohne Zweifel nur die Städte, von denen auch die kleineren und halb oder ganz in Ruinen liegenden an Denkmälern und Überbleibseln aus der Vergangenheit reich waren, die größeren zum Teil ihren alten Glanz bewahrt oder unter römischer Herrschaft sich sogar noch vergrößert und verschönert hatten. Vor allen blieb Athen auch nach der Vernichtung seines Wohlstandes durch Sulla in seiner Stille und Verödung unvergleichlich schön. Ovid, der es in der Zeit wohl seines tiefsten Verfalls sah, vermochte sich vorzustellen, wie es gewesen war, als noch eine Fülle von Geist, Reichtum und festlicher Friede es erfüllte; der Dämon des Neides, sagt er, weinte vor Grimm, wenn er die makellose Herrlichkeit dieser Stadt erblicken mußte. Dem Zauber jener wundervollen Werke, mit denen die Zeit des Perikles Athen geschmückt hatte, vermochte sich auch der für Kunstschönheit wenig empfängliche römische Gast nicht zu entziehen; obwohl schon ein halbes Jahrtausend alt, erschienen sie wie neu und eben vollendet, die Zeit hatte sie nicht angetastet, ein Duft der Frische schwebte darüber, als wäre ihnen ein ewig blühendes Leben und eine nie alternde Seele eingepflanzt worden. Im 2. Jahrhundert erlebte die unter Trajan noch tief darniederliegende Stadt durch Hadrian und die Antonine eine Art von Nachblüte und Wiedergeburt. Der erstere schuf durch seine Bauten ihren südöstlichen Teil zu einer »neuen Hadrianstadt« um, deren Kern der kolossale, von 104 je 17,25 m hohen korinthischen Säulen umgebene Tempel des olympischen Zeus war; unter seinen übrigen Prachtbauten war ein Bibliotheksgebäude mit 100 Säulen aus Pavonazetto und ein Gymnasium mit 100 Säulen aus Giallo antico. Die von Hadrian begonnene Wasserleitung, die dieser Neustadt Wasser aus Kephisia zuführte, vollendete 140 Antoninus Pius. Andre Prachtbauten fügte der Sophist Herodes Atticus hinzu, namentlich das großartige Odeum am Fuße der Akropolis. Die Errichtung von Lehrstühlen für die hauptsächlichsten vier philosophischen Schulen neben der Professur der Beredsamkeit durch Marc Aurel trug durch Steigerung des Zudranges der studierenden Jugend natürlich auch zur Beförderung der Wohlhabenheit der Stadt bei. Der spätere Kaiser Septimius Severus besuchte Athen als Legionslegat, »um der Studien, der Heiligtümer (der eleusinischen Mysterien), der Bauten und der Altertümer willen«.

42. LAMPENSTÄNDER.
Bronze. London, British Museum
43. RÖMISCHE BRONZELATERNE.
London, British Museum
Unter der Regierung Marc Aurels hat Aristides Athen und ganz Attika in einer seiner überschwenglichen Prunkreden gefeiert. Er nennt die Stadt ihrem Umfange nach die größte unter den griechischen, die schönste unter den überhaupt existierenden: Natur und Kunst haben gewetteifert, Stadt und Land zu schmücken. Der Natur verdankt sie ihre Häfen, die Lage der Akropolis und »die Anmut, von der man sich überall wie von einem sanften Hauche angeweht fühlt«; ferner die herrliche Luft, die hier ausnahmsweise in der Stadt noch schöner ist als auf dem Lande, obwohl sich auch das übrige Attika durch die ungemeine Reinheit seiner Luft auszeichnet, so daß man es an dem leuchtenden Glanze seiner Atmosphäre erkennen kann. Nicht weniger hat die Kunst für Athen getan; es besitzt die größten und schönsten Tempel, die ersten Meisterwerke alter und neuer Plastik, und als einen ihm besonders eigentümlichen Schmuck Bücherschätze, wie es deren nirgends sonst gibt; überdies prachtvolle und mit Luxus ausgestattete Bäder, Rennbahnen, Gymnasien: so daß Athen auch durch äußere Schönheit diejenigen Städte übertrifft, die auf diese am stolzesten sind. Dazu kommt, daß das wie eine Insel rings vom Meer bespülte Land inmitten der Inseln liegt, die es wie ein Chor umgeben. Welche Ergötzung daher schon die Fahrt nach Attika bietet, darüber mag man diejenigen befragen, die unaufhörlich als Kaufleute oder um das Land kennenzulernen dorthin reisen: es ist, als ob die Seele, um den Anblick Athens in sich aufzunehmen, vorher gereinigt und erhoben würde. Auch das Licht ist dort voller und stärker, wie wenn Athene, wie bei Homer, den Nahenden die Nebel von den Augen nehmen wollte, und auf allen Seiten ist man von so viel und so mannigfacher Schönheit umgeben, daß man wie in einem Reigen dahinschwebt und die ganze Fahrt einem lieblichen Traume gleicht. Und wer möchte nicht die Schönheit und Anmut der Fluren bewundern, die sich unmittelbar vor der Akropolis ausdehnen und in die Stadt hinein erstrecken, die teils sich überall an den Küsten hinziehen, teils von den sie umgebenden Bergen wie Meeresbuchten abgegrenzt werden! Wer bewunderte nicht den Glanz und die Anmut dieser Berge selbst, die den Stoff zur Darbringung des Dankes gegen die Götter (den Marmor) enthalten! So ist durch die Mannigfaltigkeit der Bodenbildung Attika gewissermaßen ein Abbild der ganzen Erde, und nirgends sonst findet sich dies harmonische Ineinandergreifen von Land und Meer, die anmutvolle Vereinigung und Abwechslung von Berg und Tal.

44. RÖMISCHE SCHLÜSSEL.
London, British Museum
Wenn Athen den Freund der Kunst, des Altertums und der Wissenschaft anzog, so übte Korinth eine ganz andre, aber nicht geringere Anziehungskraft. In mancher Beziehung war der Abstand zwischen beiden Städten ein ähnlicher wie zwischen dem heutigen Rom und Neapel: dort Ernst und Stille und überall Denkmäler und Erinnerungen aus der großen Vergangenheit, hier alles modern und ein üppiges, buntes, geräuschvolles, ganz dem Genuß der Gegenwart geweihtes Leben. Korinth übertraf Athen noch durch die Schönheit seiner Lage. Die herrliche Aussicht von Akrokorinth, die nach Norden über die Bucht von Krisa und das sie umspannende Land bis zu den Schneegipfeln des Parnaß und Helikon reicht, hat schon Strabo geschildert. Gerade 100 Jahre nach der Zerstörung durch Mummius war Korinth im Jahre 46 v. Chr. durch die Neugründung Julius Cäsars als römische Kolonie Laus Julia Corinthus aus dem Schutt wieder erstanden. Die nunmehrige Residenz der Statthalter der Provinz Achaja prangte, abgesehen von andern Neubauten, auch mit einem Tempel des kapitolinischen Juppiter und erhielt durch Hadrian eine ausgezeichnete Wasserversorgung und prächtige Thermen. Infolge ihrer unvergleichlichen Lage an zwei Meeren, die bei demselben Winde die Ein- und Ausfahrt in ihren beiden Häfen Lechäum und Kenchreä möglich und sie selbst zum »Durchgangspunkt für alle Menschen« machte, wurde sie bald wieder, was sie einst war, »das reiche Korinth«, ein das ganze Jahr hindurch von allen Hellenen besuchter Markt und Festversammlungsort, eine ihnen allen gemeinsame Stadt und in Wahrheit die Metropole von Hellas. Noch mehr als in seinen Bauten mag Korinth in seiner Bevölkerung den Charakter einer ungriechischen Stadt gehabt haben. Das römische Element war in dieser, wenn nicht vorwiegend, so doch jedenfalls stark genug, um auf Leben und Sitten einen entscheidenden Einfluß zu üben: wie sich denn die Gladiatorenspiele und Tierhetzen von hier aus über Griechenland verbreiteten. Überdies strömte hier ohne Zweifel die Hefe des Orients wie des Okzidents zusammen.
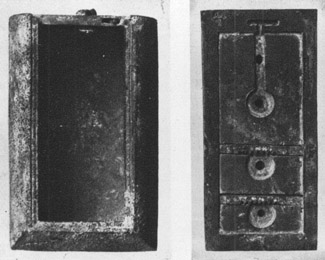
45. u. 46. EISERNE KASSE.
Gefunden bei Tarent. 1. Jahrhundert n. Chr. London, British Museum
Auch Korinth hat Aristides in einer (bei den isthmischen Spielen auf Poseidon gehaltenen) Prunkrede geschildert. Noch immer war es wie einst die Stadt der Aphrodite, die gleich dem Homerischen Gürtel der Göttin so viel Schönheit, Anmut, Reiz, Liebesgeflüster und Verführung in sich barg, daß es alle unwiderstehlich anzog und den Sinn auch der Selbstvertrauendsten berückte; ferner eine Stadt der Najaden, deren Quellen überall sprudelten, und der Horen, vor allem aber der Hof und Palast des Poseidon, der ihr die Güter und Reichtümer aller Länder in solcher Menge zuführte, daß sie gleichsam wie in einer Flut darin schwamm. Aber sie war auch reich an Bücherschätzen. Wohin man blickte, sah man solche auf den Straßen und in den Hallen, sah man Gymnasien und Schulen, deren Lehrer auch auswärtige Studierende anzogen; wie z. B. Galen dahin kam, um den Arzt Numisianus zu hören. Endlich konnte Korinth sich auch in bezug auf Sagen und Erinnerungen an eine ruhmvolle Vergangenheit mit jeder andern Stadt messen.

47. ARZNEIKÄSTCHEN.
Gefunden bei Xanten am Rhein. Berlin, Antiquarium
Nächst Korinth mag im Peloponnes das Heiligtum des Äskulap zu Epidaurus von den Römern am meisten besucht gewesen sein, das sich in der Kaiserzeit zu neuer Geltung erhob. Die natürliche Abschließung des heiligen Kurortes durch die Bergabhänge war durch Mauern vervollständigt. Innerhalb der Grenze des Tempelgebiets »breitete sich der dichte Hain aus, in dessen Schatten die Kurgäste sich ergingen und die Festgenossen lagerten. In dem Haine lagen die verschiedenen, den gottesdienstlichen und therapeutischen Zwecken gewidmeten Gebäude zerstreut; die Masse der Ruinen beweist die Großartigkeit der baulichen Ausstattung«. Die Freigebigkeit des römischen Senators (Major) Antoninus hatte diese Anlagen sehr erweitert; zu seinen Neubauten gehörte unter andern ein eignes Sterbe- und Entbindungshaus an der äußeren Grenze des Tempelgebiets, da in diesem niemand geboren werden und niemand sterben durfte. »Dies eingeschlossene Tal muß eine der lieblichsten Gegenden Griechenlands gewesen sein, solange es im vollen Schmucke seiner Tempel und Festgebäude zwischen den mit heiligen Anlagen besetzten Waldhöhen sich ausbreitete, ein schöner Garten und zugleich ein reiches Kunstmuseum, angefüllt mit zahllosen Denkmälern aus der ganzen Reihe von Jahrhunderten, während welcher der Ruhm des Epidaurischen Gottes aus allen Teilen der Welt Hilfsbedürftige herbeilockte«.
Eine Aufzählung auch nur der berühmteren Städte, der Tempel mit ihrer Fülle von Kunstwerken und Schätzen, der historisch merkwürdigen Punkte, der Ruinen der Vorzeit, die von Reisenden in Griechenland besucht wurden, würde allein ein Buch füllen; auch wird von den Orten und Sehenswürdigkeiten, die Freunde der Kunst, des Altertums und der Geschichte vorzugsweise aufsuchten, noch später die Rede sein. Von den Lustorten war der berühmteste Ädepsus im nördlichen Euböa, hart am Meer, mit warmen, noch jetzt von Kranken besuchten schwefelhaltigen Quellen, ein Sammelplatz für ganz Griechenland; doch fehlte es natürlich auch nicht an römischen Besuchern, schon Sulla hatte sich dort aufgehalten. Am lebendigsten war Ädepsus im Frühling. Für die Aufnahme der Gäste war durch Wohngebäude mit Hallen und Sälen, für die Bäder durch Bassins aufs beste gesorgt, und Land und Meer lieferten zu den Gastmählern, die am liebsten am Strande des Meeres veranstaltet wurden, die köstlichsten Leckerbissen in Fülle. Schwelgerei und Üppigkeit waren jedoch, wie es scheint, hier nicht so wie in Bajä an der Tagesordnung; man fand dort eine angenehme Geselligkeit und vielfache Gelegenheit zu edleren Vergnügungen. Jetzt ist das alte Ädepsus mit seinen Gebäuden unter einer Masse gelblichen Kalksinters, den die erstaunlich reichen Quellen absetzen, und der einen zehn Minuten langen und 30-40 m hohen Hügelrücken gebildet hat, förmlich begraben.
Die meisten Römer, die in Griechenland reisten, besuchten gewiß auch Kleinasien. Die Inseln des Ägäischen Meeres, einst blühend und volkreich, nun verödet und zum Teil von Verbannten bewohnt, boten den Vorüberfahrenden reichlichen Stoff zu Betrachtungen über die Vergänglichkeit alles Irdischen; um so weniger luden sie zum Aufenthalt ein. Die Verbannung nach den traurigen, nur von armen Fischern bewohnten Felseninseln, wie Seriphos, Pholegandros, Gyaros, wurde zu den härtesten Strafen gerechnet; milder war natürlich die Verweisung nach einer der größeren oder freundlicheren Inseln, wie Andros oder Naxos. Nur um Freunde oder berühmte Männer zu besuchen, die dort im Exil lebten, oder nach dessen Aufhören die Stätten ihres Leidens zu sehen, mochten Reisende an jenen kleinen Klippeneilanden anlegen. Als Musonius Rufus nach Gyaros verbannt war, schifften viele Griechen dorthin, um den berühmten Philosophen kennenzulernen, später um eine Quelle zu sehen, die er auf der sonst wasserlosen Insel entdeckt hatte. In einer Höhle auf Pholegandros sind unter den angeschriebenen Namen von Besuchern auch römische.
Auch das einst so volkreiche Delos, das, von den Römern zum Freihafen erklärt, als Hauptstation des Handelsverkehrs zwischen Orient und Okzident in den Jahren von 168-88 zu einer neuen hohen Blüte gelangt war, hatte sich von seiner völligen Zerstörung durch die Feldherren Mithridats im Jahre 88 nie wieder erholt. Die Römer gaben die Inseln den Athenern zurück, in deren Besitz sie bis in die späte Kaiserzeit blieben; Pausanias fand sie, abgesehen von der athenischen, zur Bewachung des Tempels dort liegenden Besatzung so gut wie menschenleer. Doch dürften die nach Asien reisenden Römer, wie Cicero im Jahre 703 = 51 v. Chr., häufig daselbst angelegt haben. Auch hier wurden die aus der Geschichte und Sage berühmten Orte aufgesucht. Noch immer wurde auf Delos die von Latona in ihren Geburtswehen erfaßte Palme gezeigt, unter der Apollo geboren war. Natürlich wurden auch die Tempel mit ihren Säulenhallen, die darin noch vorhandenen Weihgeschenke von Königen, der berühmte aus Hörnern (nach der Legende von Apollo als Kind) erbaute Altar in Augenschein genommen, die Menge der überall aufgestellten Statuen und andern Sehenswürdigkeiten bewundert.
Von den größern Inseln werden namentlich Chios und Samos viel besucht worden sein, am meisten nächst Rhodos aber Lesbos, dessen vielgepriesene Hauptstadt Mytilene schon Cicero eine Stadt nennt, die durch Natur und Lage, durch Regelmäßigkeit ihres Planes und Schönheit ihrer Gebäude berühmt, deren Umgebung lieblich und fruchtbar sei. Hierher zog sich Agrippa zurück, da er den Schein vermeiden wollte, als ob er dem zum Thronfolger designierten Marcellus im Wege stehe; Germanicus nahm hier im Jahre 18 n. Chr. Aufenthalt, während dessen ihm Agrippina die Julia gebar; dem im Jahre 32 aus Italien verwiesenen Junius Gallio ward die Übersiedelung nach der »berühmten und anmutigen Insel«, als ein zu leichtes Exil, nicht gestattet. Noch sind Ruinen einer, wie es scheint, römischen Villa auf Lesbos in reizender Gegend erhalten. »Durch reichlichen Baumwuchs, durch die erquickende Nähe des Meeres und eine entzückende Aussicht auf den Meeresarm und die Höhenzüge der asiatischen Küste besonders gehoben, läßt die Lieblichkeit der Lage des Ortes, dessen ausgezeichnet gesundes Klima außerdem von den Bewohnern gerühmt wird, noch heute es lebendig begreifen, daß der vornehmen römischen Welt die Hauptstadt der Insel als einer der wünschenswertesten Aufenthaltsorte erschien«.
Doch das hauptsächlichste Reiseziel auch der Römer in diesen Meeren war ohne Zweifel die Insel Rhodos, deren Hauptstadt während dieser ganzen Zeit die bedeutendste Stadt Griechenlands blieb. Der herrlichen Rhodos, wie sie Horaz nennt, kam nach Strabo keine andre griechische Stadt gleich, geschweige daß eine sie übertroffen hätte; sie war auch in Vespanians Zeit die reichste und blühendste Stadt von Griechenland und blieb es, bis um die Mitte des 2. Jahrhunderts ein furchtbares Erdbeben sie großenteils in Trümmer legte. In einer unter dem frischen Eindruck dieser Katastrophe gehaltenen Rede sagt Aristides: die größte griechische Stadt sei von dem härtesten Schlage getroffen worden. Noch unmittelbar vorher erschien sie nach seiner Schilderung so imposant wie in der Zeit ihrer Seeherrschaft, so neu, als wäre sie eben vollendet, und so schön, daß sie sich mit Recht die Stadt des Sonnengottes nennen durfte. Die Molen ihrer stets mit Schiffen aus lonien, Karien, Ägypten, Cyprus und Phönicien gefüllten Häfen reichten weit in die See hinaus, ihre ungeheuren Schiffswerften glichen von oben gesehen schwebenden Feldern: die Trieren, Trophäen von Schiffsschnäbeln und andre Erinnerungen alter Siege riefen dort die Zeiten ihrer einstigen Macht und Freiheit zurück. Darüber erhob sich amphitheatralisch am Ufer aufsteigend die von dem berühmten Architekten Hippodamus aus Milet 408 v. Chr. angelegte Stadt. Ihre Akropolis war voll von Fluren und Hainen, ihre Straßen breit und schnurgerade, die Bauart und Ausstattung so durchaus gleichartig, daß die ganze Stadt nur ein Haus zu sein schien. Am meisten Bewunderung erregten die überaus starken Mauern, deren hohe, schöne Türme den Schiffern als Landmarke dienten; und der von den Mauern gebildete Umkreis war völlig ausgefüllt, so daß er die Stadt wie ein Kranz das Haupt umgab. Ihre Tempel und Heiligtümer prangten im reichsten Schmuck von Statuen und Gemälden: Rhodos allein war von Neros Kunsträubereien verschont geblieben. Nach der Angabe des Licinius Mucianus hatte die Stadt (wie Athen, Delphi und Olympia) 3000 Statuen. Selbst nach dem Erdbeben, sagt Aristides übertreibend, seien noch so viel Tafelgemälde und Bronzewerke übrig geblieben, daß andre Städte an einem Teil dieses Restes genug hätten. Überdies zeichnete sich die ganze Insel durch Naturschönheit und Gesundheit des Klimas aus und wurde daher von den Römern auch deshalb gern als Wohnort gewählt. Bekannt ist des Tiberius dortiger siebenjähriger Aufenthalt, während dessen er eifrig der Astrologie oblag. Sein Haus stand (wie die Villa des Juppiter auf Capri) auf einem Felsen hart über dem Meer, in das er dort die ihm verdächtig gewordenen Gehilfen seiner Arbeit hinabstürzen ließ. Auch Nero bezeichnete Rhodos als seinen künftigen Aufenthaltsort, als er, um sich der Bevormundung Agrippinas zu entziehen, die Regierung niederlegen zu wollen vorgab.
Eine wohl nicht gewöhnliche Richtung und Ausdehnung gab Germanicus seiner Reise im Jahre 18, wo er von Athen über Euböa und Lesbos die Küste Asiens, dann Perinth und Byzanz mit der Propontis besuchte und in den Pontus einfuhr, »voll Begier die alten und durch den Ruf gefeierten Orte kennenzulernen«; auf der Rückreise hielten ihn von dem Besuche Samothrakes widrige Winde zurück. Wenn diese nördlichen Küsten und Inseln wohl von der Mehrzahl der römischen Reisenden nicht besucht wurden, so versäumten dagegen gewiß die wenigsten, »Ilium und was dort durch den Wechsel des Schicksals und den Ursprung Roms ehrwürdig ist« zu sehen.
Die kleine, von äolischen Griechen bewohnte, nicht sehr alte Stadt Ilium (jetzt Hissar-lik, d. h. die Paläste) war bis auf die Besitznahme Asias durch die Römer ein dorfartiger Ort gewesen, ohne Mauern, selbst ohne Ziegeldächer; doch hatte sie den damals noch von niemandem angefochtenen Ruhm, an der Stelle der heiligen Ilios Homers zu stehen, die nach der Behauptung der Ilienser sogar nie aufgehört hatte zu existieren, sondern nach der Abfahrt der Griechen von geflüchteten Trojanern wieder aufgebaut worden war. Pallas Athene, zu der Hecuba und Andromache gebetet hatten, war die Schutzgöttin auch der neuen Stadt geblieben, Xerxes und Alexander der Große hatten ihr hier geopfert; dem letzteren waren in ihrem Tempel schon die Lyra des Paris und Rüstungen der Homerischen Helden gezeigt worden. Ebensowenig zweifelten die Römer an der Identität von Ilium und dem alten Troja. Sie machten die Stadt, von der sie ihre Abstammung herleiteten, zur Herrin der ganzen umliegenden Küste, und infolge der ihr verliehenen Steuerfreiheit und andrer mannigfacher Begünstigungen erhob sie sich zu einer nicht unbedeutenden Mittelstadt. Im Jahre 85 nahm der Marianer Fimbria das dem Sulla ergebene Ilium durch Verrat ein, zerstörte die Mauern und brannte die Stadt und sogar den Tempel der Athene nieder. Selbst bei der Einnahme durch Agamemnon, sagt Appian, hatte sie nicht so viel gelitten; kein Tempel, kein Haus, keine Statue blieb stehen; nur das Pallasbild sollte, wie einige behaupteten, unter den einstürzenden Mauern des Tempels unverletzt geblieben sein. Sulla gewährte den Iliensern manche Unterstützungen; ganz besonders tatkräftig aber bewies ihnen sein Wohlwollen Julius Cäsar, der sein Geschlecht von dem Sohne des Äneas Julus ableitete. Er vermehrte ihren Landbesitz und bestätigte ihre Selbständigkeit und Abgabenfreiheit. Als sie sich im Jahre 26 n. Chr. mit zehn andern Städten der Provinz Asia um die Ehre bewarben, dem Tiberius einen Tempel zu bauen, stützten sie ihren Anspruch darauf, daß ihre Stadt die Mutter Roms sei; sie wurden abgewiesen, weil sie eben nur den Ruhm des Altertums für sich hatten, gegen den sich also kein Zweifel erhob. Im Jahre 53 erteilte ihnen Claudius für alle Zeiten Freiheit von allen Leistungen. Als ihren Anwalt im Senat hatte man den sechzehnjährigen Nero auftreten lassen, der beredt ausführte, daß das römische Volk von Troja stamme, Äneas der Ahnherr des Julischen Geschlechts sei, »und andre sagenhafte Überlieferungen des Altertums«. Auch ein Reskript des Antoninus Pius, das ihre Freiheiten bestätigte (namentlich die Befreiung von der Vormundschaft für nicht iliensische Kinder), führte die hohe Berühmtheit der Stadt und ihre Verwandtschaft mit Rom als Motive an. Der Glaube an die Identität von Ilium und Troja war also bei den Römern ein offiziell anerkannter und ohne Zweifel allgemeiner.
Nun war freilich ein Versuch gemacht worden, den Ruhm, dem Ilium seine neue Blüte verdankte, mit den Waffen wissenschaftlicher Kritik zu vernichten. Ein berühmter Philologe Demetrius und eine als Erklärerin Homers geschätzte Schriftstellerin Hestiäa bestritten die Identität von Ilium und Troja mit gelehrten Argumenten und behaupteten, das letztere habe auf der Stelle des 30 Stadien (über 5 km) von dem ersteren entfernten »Dorfes der Ilienser« (also nicht weit von dem heutigen Bunarbaschi) gestanden. Beide waren aus Nachbarstädten (Skepsis und Alexandria Troas) gebürtig, vielleicht also durch lokale Eifersucht mit zu diesem Angriff bestimmt, der um so gefährlicher war, als er von dem Hauptsitz der griechischen Philologie und Altertumsforschung, von Alexandria, ausging. In der gelehrten Welt scheint diese neue Ansicht Anklang gefunden zu haben, wenigstens gewann sie in Strabo eine gewichtige Autorität für sich; in die weiteren Kreise der Gebildeten scheint sie nicht einmal in Griechenland gedrungen zu sein, um so weniger ließen sich römische, von Jugend auf an die Verehrung Iliums als der Mutterstadt Roms gewöhnte Reisende den Genuß, auf dem klassischen Boden jede einzelne in der Geschichte Trojas genannte Stelle wiederzufinden, durch kritische Bedenken beeinträchtigen.
Die Ilienser befriedigten übrigens auch die leidenschaftlichste Wißbegierde und Schaulust. Gewissenhafte Reisende, die sich »mit der ganzen dortigen Altertumskunde anfüllen« wollten, durchwanderten ohne Zweifel außer der Stadt und Umgebung an der Hand der Führer auch die Ebene bis zum Meer, um das Lokal der Kämpfe vor Troja gründlich kennenzulernen. Man zeigte ihnen die Standorte der beiden Heere, die Stelle, wo das Schiffslager der Griechen gestanden hatte, und alle übrigen in der Ilias erwähnten Punkte, wie den Feigenbaum (nach Strabo war es ein rauher, mit wilden Feigenbäumen besetzter Platz), die Buche, das Denkmal des Ilus, das Grab des Aiax usw.; auch die Höhle, in der Paris sein verhängnisvolles Urteil sprach. Namentlich scheinen die Gräber der dort gefallenen oder gestorbenen Helden in größter Vollzähligkeit vorhanden gewesen zu sein: zum Beweise, daß Anchises bei Mantinea in Arkadien begraben sei, führt Pausanias an, daß die Ilienser sein Grab nicht zeigten. An den Gräbern des Aiax bei Rhöteum, des Achilles, Patroclus und Antilochus bei Sigeum brachten die Ilienser Totenopfer, und vermutlich opferten dort auch viele Reisende, wie es z. B. Caracalla am Grabe Achills tat und Philostrat den Apollonius von Tyana tun läßt. Auf dem Grabe des Protesilaus standen jene Bäume, die jedesmal verdorrten, wenn ihre Wipfel hoch genug gewachsen waren, um Ilium erblicken zu können, und dann von neuem anfingen zu wachsen. Das vom Himmel gefallene, von Diomedes entführte Pallasbild konnten die Ilienser römischen Reisenden nicht wohl vorweisen, da diese Reliquie sich in Rom befand und dort zu den Beweisen der Abstammung von Troja gehörte. Ovid ließ sich in dem Tempel der Göttin die Stelle zeigen, wo es gestanden hatte. Von vorhandenen Reliquien werden außer den schon genannten auch die beiden Ambosse erwähnt, mit denen Zeus die Füße der zur Strafe aufgehängten Hera beschwert hatte.
In dem Gedichte Lucans besucht Cäsar die Gegend nach der Schlacht bei Pharsalus; ohne Zweifel hat der Dichter, der vielleicht während seines Aufenthalts in Athen einen Ausflug hierher machte, in seiner Schilderung seine eignen Reiserinnerungen verwertet. Unfruchtbare Wälder und morsche Stämme, heißt es bei ihm, lasteten auf den alten Königspalästen und wurzelten in den Tempeln der Götter; ganz Pergamum ist von Gestrüpp überwuchert, sogar die Ruinen sind verschwunden. Er sieht den Fels, an den Hesione gebunden war, und im Dickicht verborgen das Gemach des Anchises, die Höhle, in welcher der Richter der Göttinnen gesessen, die Stelle, von der Ganymed zum Himmel entrafft ward, den Fels, auf dem die Nymphe Önone spielte: kein Stein ist ohne Namen. Achtlos hatte er einen im trockenen Staube schleichenden Bach überschritten: es war der Xanthus; unbesorgt setzt er im hohen Grase seine Schritte: der Eingeborene warnt ihn, nicht auf Hectors Asche zu treten. Auseinandergeworfen lagen Steine, und keine Spur verriet, daß sie ein Heiligtum gebildet hatten: siehst du, sagte sein Führer, die Altäre nicht an, an denen Priamus fiel?
Überhaupt war aber diese Küste von Kleinasien an schönen und anziehenden Punkten sehr reich; namentlich Ionien stand hierin selbst Griechenland nicht nach, das es durch die Schönheit seines Klimas noch übertraf. Hier waren die berühmtesten, größten und ältesten Tempel (wie zu Kolophon, den auch Germanicus im Jahre 18 besuchte, um das Orakel des Klarischen Apollo zu befragen, Ephesus und Milet) und die schönsten Städte, verschwenderisch mit Prachtbauten neuerer Zeit, besonders mit Bädern, ausgestattet. Unter diesen waren Ephesus und Smyrna die bedeutendsten; beide nennt z. B. Dio von Prusa neben Tarsus und Antiochia als Vorbilder, denen seine Vaterstadt nachstreben müsse; und vermutlich wurden auch von Reisenden beide am meisten besucht. Die erste, als reicher Haupthandelsplatz des vorderen Asiens eine Schatzkammer des Landes, war unter den Römern die Hauptstadt der Provinz und galt für eine der volkreichsten und am schönsten gebauten Städte der Welt.
Doch den Ruhm, die schönste von allen zu sein, behauptete schon in Strabos Zeit Smyrna, obwohl damals ihre Straßen wegen Mangel an Abzugsgräben noch sehr schmutzig waren. Diesem Übelstande wurde vermutlich später abgeholfen, und überhaupt vergrößerte und verschönerte sich die Stadt in den beiden ersten Jahrhunderten immer mehr, so daß sie sich mit Wahrheit »die erste Stadt Asias an Größe und Schönheit, die glänzendste, und Metropole von Asia« nennen durfte. Lucian nennt sie die schönste von allen ionischen Städten, Philostrat sogar die schönste von allen, die unter der Sonne sind, und der Beiname »die schönste«, den sie auf Inschriften (des 3. Jahrhunderts) führt, scheint ein allgemein anerkannter gewesen zu sein: denn bei Aristides heißt sie »die nach ihrer Schönheit benannte«. Der letztere hat sie in seiner Weise geschildert, bevor ein Erdbeben sie (im Jahre 178) verwüstete. In herrlicher Lage amphitheatralisch vom Meere und Hafen zu den Höhen ansteigend, bot sie überall einen gleich prachtvollen Anblick, man mochte von oben herab auf das Panorama des Meeres, der Vorstädte und der Stadt blicken oder von der Einfahrt in den Hafen aus. Den Anblick aus der Ferne aber übertraf noch das Innere. So durchaus in Anmut blühend lag sie da, als wäre sie nicht allmählich erbaut, sondern auf einmal aus dem Boden entsprossen. Überall glänzte sie mit Gymnasien, Plätzen, Theatern, Tempeln und Tempelbezirken. Bäder so viele, daß man in Verlegenheit war, zu welchem sich wenden; Wandelbahnen von jeder Gestalt, bedeckte und offene, eine schöner als die andre; Quellen und Brunnen, Haus für Haus und mehr als Häuser; Straßen wie Plätze, in rechten Winkeln einander durchschneidend, marmorgepflastert, von ein- und zweistöckigen Arkaden eingefaßt. Dazu Unterrichtsanstalten und Bildungsmittel aller Art, einheimische und fremde, ein Überfluß von Wettkämpfen, Schauspielen und andern Ergötzlichkeiten, ein Wettstreit zwischen den Erzeugnissen menschlicher Arbeit und Kunst und den Erzeugnissen des Meeres und des Landes; endlich das schönste Klima, da auch im Sommer und Frühling die von der See herwehenden Westwinde die Stadt zu einem Lustort schufen. Kurz es war eine Stadt, beiden Nationen (d. i. Griechen und Römern) am meisten gemäß, gleichviel, ob man sein Leben in Erholung verbringen oder sich aufrichtig um Bildung bemühen wollte. Ihre Schulen wurden, wie bereits erwähnt, von Studierenden aus allen drei Weltteilen besucht. Der berühmte Sophist Scopelianus (zu Ende des 1. Jahrhunderts) erwählte sie, wie Philostrat sagt, als den seiner würdigsten Ort: denn, wenn ganz Ionien als ein großer Musensitz eingerichtet sei, so nehme doch Smyrna die hauptsächlichste Stelle ein, wie bei den musikalischen Instrumenten der Steg, über den die Saiten gespannt sind. Es fehlte dort wohl niemals an namhaften Lehrern für sämtliche Wissenschaften: Galen begab sich in seinem 21. Jahre (150) nach Smyrna, um den Pelops, einen Schüler des Numisianus, und den Platoniker Albinus zu hören.
Über die so leicht zu erreichende Provinz Asia erstreckten sich wohl Reisen, die nicht zu eigentlich wissenschaftlichen Zwecken, sondern zur Belehrung und zum Vergnügen unternommen wurden, auch zu Lande selten nach Osten und Süden hinaus. Auch die Insel Cyprus wurde wohl in der Regel nicht als eigentliches Reiseziel, sondern nur als Station auf der Reise nach Syrien oder Ägypten besucht: so von Titus, als er im Jahre 70 sich von Korinth nach Judäa begab und Lust empfand, den von Einheimischen und Fremden gepriesenen Tempel der Venus zu Paphos kennenzulernen. Er sah die Spitzsäule, die dort statt eines Bildes der Göttin stand, die Tempelschätze und Weihgeschenke der Könige, »und was sonst die Griechen, die ihre Lust an Altertümern haben, der ungewissen Vorzeit andichten«, und befragte das Orakel. Reisen nach Syrien, Phönicien und Palästina, die nicht durch Geschäfte oder Amtspflichten veranlaßt waren, scheinen in den ersten Jahrhunderten selten gewesen zu sein. Zwar boten auch diese Länder des Merkwürdigen und Sehenswerten genug, aber die weite und beschwerliche Seefahrt schreckte gewiß die meisten Touristen von ihrem Besuche zurück, und vor dem 3. Jahrhundert kamen wohl nach Hierosolyma, das Plinius, vielleicht nach Agrippa, die berühmteste Stadt des ganzen Orients nennt, die wenigsten römischen Reisenden, und auch griechische, wie Pausanias, der am Jordan und am Toten Meere gewesen war, wohl nur ausnahmsweise. Die prachtvolle Hauptstadt Syriens, Antiochia, wird in der Literatur der beiden ersten Jahrhunderte ebenso selten, wie Alexandria häufig genannt; von dem älteren Plinius z. B. nur zweimal bei geographischen Angaben und einige Male als Standort gewisser Pflanzen, offenbar aus griechischen Quellen.
Sehr groß war dagegen die Zahl derer, die jahraus jahrein von Italien wie von Griechenland aus Ägypten besuchten, das namentlich mit Italien während der Zeit der Schiffahrt durch einen lebhaften und ununterbrochenen Verkehr verbunden war. Die zwischen beiden Ländern regelmäßig befahrene Linie ging von Alexandria nach Puteoli. Dies war seit der Versandung der Flußmündung bei Ostia bis zur Vollendung eines neuen Tiberhafens (Portus) durch Claudius und Trajan der eigentliche Hafen Roms, insbesondere für den Verkehr mit dem Orient. Ein griechischer Dichter unter Augustus und Tiberius, Antiphilus, fragt, weshalb Puteoli so gewaltiger, weit in die See hinausreichender Molen bedürfe. Die Antwort ist: sein Hafen müsse eine Flotte fassen, die aus den Fahrzeugen der ganzen Welt bestehe; blicke man auf Rom, so erscheine er noch klein. Glasgefäße und Abbildungen der Küste, wie Badegäste von Bajä sie als Andenken mit in die Heimat zu nehmen pflegten, zeigen auch Bauwerke von Puteoli, insbesondere die Molen ( pilae), von welchen 16 gemauerte Pfeiler noch vorhanden sind (die sogenannte Brücke des Caligula); es sollen deren 25 gewesen sein, die 24 Bogen trugen. Von der Landseite betrat man sie durch ein Eingangstor. Seneca schildert, wie ganz Puteoli auf die Molen hinausströmte, wenn die Ankunft der alexandrinischen Kornflotte gemeldet wurde. Das Erscheinen der ihr vorausgehenden sogenannten Postschiffe ( tabellarie) war für ganz Campanien eine Freude. Man erkannte sie aus allen andern Segeln heraus, wie viele auch das Meer bedeckten; sie allein behielten nach der Durchfahrt zwischen Capri und dem Vorgebirge, »wo von umwetterter Höh' auf die Flut Minerva herabschaut« (Kap Campanella), ein Topsegel, das die andern Schiffe dann fallen lassen mußten. In dem jetzt so stillen Becken des Hafens von Pozzuoli drängten sich damals Mast an Mast Schiffe von allen Küstenländern des Mittelmeers. Die Grabschrift eines aus Rom stammenden Schiffsreeders, der zugleich Sevir der Augustalen zu Lyon und zu Pozzuoli war, läßt auf einen direkten Verkehr zwischen beiden Orten schließen. Den Umfang des spanischen Exporthandels konnte man nach Strabo aus der Größe und Menge der von Spanien nach Puteoli und Ostia gehenden, mit Getreide, Wein, Öl, Wachs, Honig, Pech, Scharlach und Mennig befrachteten Kauffahrteischiffe erkennen. Ihre Zahl war nicht viel geringer als die der afrikanischen. Bei Philostrat heißt es, daß von den vielen Schiffen in dem Hafen von Puteoli die einen nach Afrika segeln, die andern nach Ägypten, nach Phönicien und Cyprus, nach Sardinien oder über Sardinien hinaus. Die Vermietung der dortigen Speicher und Magazine war schon in der letzten Zeit der Republik sehr gewinnbringend. Neben dem Korn Afrikas und Ägyptens, dem Öl und Wein Spaniens, dem Eisen von Elba (das hier und in andern Häfen der Westküste von Großhändlern gekauft und zu Werkzeugen verarbeitet wurde, die dann wieder in alle Welt gingen) und den sonstigen Rohprodukten der westlichen Länder lagerten hier auch die Fabrikate Alexandrias, wie Leinwand, bunte Teppiche, Glaswaren, Papier, Weihrauch usw., und die kostbarsten Erzeugnisse und Waren des äußersten Südens und Ostens, die der alexandrinische Transithandel dorthin brachte. Eine spätestens aus der ersten Kaiserzeit stammende Inschrift ist von Kaufleuten gesetzt, die von Puteoli aus mit Alexandria, Asia und Syrien Geschäfte machten. Augustus, der in seinen letzten Tagen bei der Vorüberfahrt an diesem Hafen durch jubelnde Zurufe von der Bemannung eines alexandrinischen Schiffes erfreut worden war, schenkte jedem seines Gefolges 40 Goldstücke unter der Bedingung, sie nur für alexandrinische Waren auszugeben. Gewiß galt von vielen Bewohnern Puteolis, was jener C. Octavius Agathopus von sich sagt, daß er nach ermüdenden Reisen vom Orient zum Okzident hier ausruhe. Die Bevölkerung war sehr stark mit orientalischen Elementen versetzt. Griechen und Juden, Ägypter und Syrier ließen sich hier zahlreich auf die Dauer nieder, die großen Handelsstädte des Ostens, wie Hierapolis, Berytus und Tyrus und ohne Zweifel noch viele andere, hatten in Puteoli ihre Faktoreien und Gottesdienste. An dem dort gefundenen Postament einer kolossalen Statue des Tiberius sind 14 Städte der Provinz Asia abgebildet, die Tiberius nach Erdbeben in den Jahren 17, 23 und 29 wiederhergestellt hatte, darunter Ephesus, Sardes, Cibyra u. a., die Augustalen von Puteoli, die diese Statue errichten ließen, stammten wohl teils aus diesen Städten, teils standen sie mit ihnen in Handelsbeziehungen. So hatte der Reisende, der sich hier einschiffte, in dem Getümmel des Hafens, wo alle Trachten und Bildungen der orientalischen Völker zu sehen, ihre Mundarten zu vernehmen waren, ihre Produkte und Waren feilgeboten wurden, bereits ein Stück des Orients vor Augen.
Gewiß lagen in diesem Hafen in der Zeit der Schiffahrt stets alexandrinische Schiffe vor Anker, von allen Größen und Gattungen, von dem kleinen, leichtgebauten Schnellsegler bis zu dem riesigen Last- und Kornschiff, wie sie außerhalb Ägyptens besonders in Nicomedia gebaut wurden. Lucian hat ein solches Riesenschiff beschrieben, das, durch Sturm in den Piräus verschlagen, dort als seltenes Schauspiel eine Menge von Neugierigen herbeilockte; die »Isis«, ein Dreimaster, maß in der Länge über 53 m, in der größten Breite mehr als den vierten Teil der Länge, in der größten Tiefe gegen 13 m, wonach sich ihre Tragkraft auf etwa 1575 Tonnen berechnen läßt; sie kam also einem großen Vollschiff gleich; sie brachte ihrem Besitzer wohl zwölf attische Talente (rund 56.500 Mark) und darüber jährlich ein. Sie war bemalt, hatte zu jeder Seite des Vorderteils ein Bild der Gottheit, von der sie den Namen trug, und manchen andern Schmuck; Besucher des Hafens, die noch nichts Ähnliches gesehen hatten, versäumten nicht, sich überall herumführen zu lassen, und betrachteten mit Bewunderung Masten und Segel, Tauwerk, Anker und Winden und die Kajüten auf dem Verdeck und sahen mit Staunen die braunen, fremd redenden Matrosen furchtlos in den Tauen umherklettern. Ägyptische Steuermänner galten als die seekundigsten und waren vermutlich allgemein gesucht. Als die höchste Zahl von Menschen, die ein ägyptisches Schiff fassen konnte, nennt Aristides 1000. Das Schiff, auf dem der Kaiser Claudius, auf seiner Rückkehr aus dem unterworfenen Britannien, in den Hafen von Hadria einlief, war eher ein ungeheurer Palast als ein Schiff.
Übrigens standen auch die größten Kornschiffe hinter den für den Transport von Marmorblöcken und Marmorsäulen eigens gebauten und vollends hinter den zum Tragen von Obelisken bestimmten Riesenschiffen zurück. Zu diesen gehörte das alexandrinische Schiff, das unter Augustus als erstes im Hafen von Ostia eingelaufen war und den nachher im großen Zirkus (jetzt auf Piazza del Popolo) aufgerichteten Obelisken gebracht hatte; seiner Merkwürdigkeit halber hatte es der Kaiser in den Werften von Puteoli aufstellen lassen, doch war es schon verbrannt, als Plinius schrieb. Es soll 1200 Passagiere und außer dem Obelisken eine Ladung von Papier, Nitrum, Pfeffer, Leinwand und 400.000 Scheffel (etwa 34.920 Hektoliter) Weizen enthalten haben. Doch als das größte Wunder, das auf dem Meere gesehen worden sei, bezeichnet Plinius das Schiff, das auf Caligulas Befehl den für den vatikanischen Zirkus bestimmten Obelisken (jetzt auf dem Petersplatze) nebst vier Blöcken desselben Steines brachte, die sein Postament bilden sollten. Es führte als Ballast etwa 120.000 Scheffel (etwa 10.470 Hektoliter) ägyptische Linsen, sein Hauptmast konnte nur von vier Männern umspannt werden, in seiner Länge füllte es die linke Seite des Hafens von Ostia zum großen Teil aus; denn dort ließ es Claudius später versenken, nachdem er drei turmhohe Massen aus puteolanischem Mörtel darauf hatte aufführen lassen. Auch von dem Schiffe, das den von Constantius im Jahre 357 im großen Zirkus aufgerichteten größern (jetzt auf dem Platze des Lateran befindlichen) Obelisken brachte, sagt Ammian, es sei von einer bis dahin unbekannten Größe gewesen und habe eine Bemannung von 300 Ruderern gehabt. Allem Anschein nach ist erst in neuester Zeit die Größe der riesigen Transportschiffe des Altertums übertroffen worden, namentlich seitdem man die großen Schiffe nicht mehr aus Holz, sondern aus Eisen und Stahl herstellt. Noch in den Vierzigerjahren des 19. Jahrhunderts wurden Schiffe von 1500-2000 Tonnen Gehalt als Wunder angestaunt. Doch die Persia (1856), 122 m lang, 14 m breit, hatte eine Tragfähigkeit von 5400 Tonnen; der Great-Eastern (1857), 207,25 m lang, 25,14 m breit, eine Tragfähigkeit von 27.400 Tonnen; der letztere konnte 4000 Passagiere außer der Bemannung aufnehmen, neben welchen dann noch für 5000 Tonnen Güterfracht Raum blieb. Von den Ausmessungen der heutigen Riesenschiffe gibt der Turbinendampfer Vaterland (1914) mit einer Länge von 289 m, einer Breite von 30 m und einem Rauminhalt von 54.282 Br.-Reg.-Tonnen eine Vorstellung; freilich handelt es sich hier um eine Ausnahmegröße; die für lange Fahrt übliche Größe der Frachtdampfer bewegt sich zwischen 10.000 und 12.000 Tonnen, über 18.000 Tonnen hinauszugehen, gilt bei Frachtdampfern nicht als vorteilhaft.
Die durchschnittliche Dauer einer günstigen Fahrt von Puteoli nach Alexandria kann man wohl auf zwölf Tage und darüber veranschlagen, wenn nach der angeführten Angabe des älteren Plinius die schnellste bekannte Fahrt neun gedauert hatte. Ägypten war also den Römern damals noch nicht so nahe, wie Amerika uns jetzt ist. Die Fahrt ging über Sicilien und Malta. Die letztere Insel war nach Diodor wohlhabend und hatte (wie auch Gaulus und Cercina) gute Häfen; von Syrakus war sie 800 Stadien (= 80 Seemeilen, etwa eine knappe Tagereise) entfernt. Der Apostel Paulus machte die Fahrt von Malta nach Puteoli mit einem alexandrinischen Schiffe, das auf Malta überwintert hatte, den »Dioskuren«; in Syrakus und Rhegium wurde angelegt. Die weitere Reise bis Rom machte Paulus zu Lande, während Apollonius von Tyana in Puteoli das Schiff wechselte und so bis Ostia fuhr.
Die Nähe der gefahrvollen ägyptischen Küste verkündete das Licht des Leuchtturms von Pharos schon auf 300 Stadien (30 Seemeilen). Wie ein Stern schien es durch die Finsternis der Nacht und konnte wegen der Beständigkeit seines Scheins leicht für einen solchen gehalten werden, bis dann auch am Tage der hochragende Marmorbau sich weißschimmernd aus der blauen Flut hob und endlich die Palmen auf Pharos in Sicht kamen. Der Leuchtturm, mit dessen Verwaltung in der römischen Zeit ein kaiserlicher Freigelassener beauftragt war, erhielt sich bis tief in das Mittelalter und spielt in allen arabischen Berichten über Alexandria eine große Rolle. Auf einem dreistufigen Unterbau erhob sich der Turm in drei Geschossen, von denen das untere quadratischen, das mittlere achteckigen und das oberste, das die eigentliche Laterne trug, zylindrischen Grundriß hatte, bis zur Gesamthöhe von rund 120 m: auf der Höhe des Turmes befand sich eine Spiegelanlage, die die am Horizont erscheinenden Schiffe auf weite Entfernungen zeigte, später auch als Brennspiegel verwendet wurde; der Sage nach wurde sie im frühen Mittelalter durch byzantinische List zertrümmert. Nachdem im Jahre 796 die Spitze durch ein Erdbeben zerstört worden war, erfolgte die erste Restauration durch den kraftvollen Herrscher Ahmed ibn Tulun (868-883), der oben darauf eine kleine Moschee setzte, die auch bei den späteren Wiederherstellungen des allmählich immer kleiner werdenden Bauwerks ihren Platz stets behauptete. Es waren ausschließlich elementare Gewalten, die Brandung des Meeres und die Erdbeben und Winterstürme, die eine beständige Schädigung und Gefährdung und schließlich am Anfange des 14. Jahrhunderts den völligen Einsturz herbeiführten. An seiner Stelle baute 1477 der Mamelukensultan Kaitbey das nach ihm benannte, heute noch stehende Kastell. Heutzutage gibt keine Landmarke ein fernes Signal, als etwa im Westen der Araberturm, und gegen Alexandria Gruppen von Dattelpalmen und die Pompejussäule.
Der Grieche oder Römer, der den Boden Ägyptens betrat, fand sich dort wie in einer neuen Welt. War das Nilland ihnen von jeher als ein einziges, von allen übrigen durchaus verschiedenes erschienen, so mußte dies in jener Zeit noch in höherem Grade der Fall sein. Denn je länger die römische Weltherrschaft dauerte, desto einförmiger wurde die Welt. Mehr und mehr nivellierte im Westen die ausschließlich römische, im Osten die griechisch-römische Kultur die nationalen und landschaftlichen Eigentümlichkeiten. In Ägypten allein erhielten sich gleichsam mumienartig Reste einer Kultur, mit deren Uralter verglichen die griechische und römische von heute und gestern zu sein schien, und so ragte dies Land der Vergangenheit mit seinen Wundern und Geheimnissen wie in fossiler Erstarrung in die lebendige Gegenwart hinein. Seine Natur regte die Wißbegier wie keine andre an. Mit Ehrfurcht sah der Fremde den heiligen, als Gott verehrten Strom, den berühmtesten der Welt, seine mächtigen, segenspendenden Fluten wälzen, deren Ausfluß das Meerwasser angeblich weiter von der Küste ab trinkbar machte, als das Land sichtbar blieb. Sein in Dunkel gehüllter Ursprung reizte mächtig den Forschungstrieb des ganzen Altertums. Lucan läßt Cäsar in Alexandria sagen, er möchte kein Geheimnis lieber ergründen als dies: würde ihm eine sichere Aussicht geboten, die Quellen des Nil zu sehen, so wolle er den Bürgerkrieg im Stiche lassen. Bei Lucian wünscht sich Timolaus einen Zauberring, der die Kraft besäße, ihn im Fluge in ferne Länder zu tragen; dann würde er in alle unbekannten Teile der Erde vordringen und allein die Quellen des Nils kennen.
Die Schwellung des Nils verwandelte im Hochsommer ganz Unterägypten in eine weite Wasserfläche, aus der Städte, Flecken und Häuser, auf natürlichen oder künstlichen Anhöhen erbaut, gleich Inseln ragten; unzählige Fahrzeuge, manche nur aus gehöhlten Baumstämmen oder gar aus zusammengebundenem Tongeschirr bestehend, durchkreuzten sie. In einer um die Zeit der Annexion Ägyptens geschriebenen Stelle spricht Vergil von dem glücklichen Volke, das an den Ufern des seeartig austretenden Nils wohnt und seine Ländereien auf bunten Kähnen umschifft. Wie lebhaft die Eindrücke der eigentümlichen Vegetation und Tierwelt Ägyptens die Phantasie der Römer beschäftigten, davon geben die zahlreichen ägyptischen Landschaften auf Mosaiken und Wandgemälden Zeugnis, mit denen man Wohnzimmer und andre Räume schmückte. Auf Gewässern, die dicht mit den weißen Blumen des Lotus bewachsen sind, sieht man hier Sumpfvögel schwimmen; zwischen hohen Schilf- und Staudengewächsen verbirgt sich der Hippopotamus, lauert das Krokodil; am Ufer schleicht der Ichneumon, züngelt die Schlange, putzt sich der Ibis mit seinem krummen Schnabel; hoch über dem Dickicht wiegen Palmen auf schlanken Stämmen ihre befiederten Kronen. Auch für den Kaiser Septimius Severus hatte die Reise durch Ägypten besonders wegen der Neuheit der Tiere und der Gegenden Reiz. Das Interesse an der Tierwelt des Landes zeigt am meisten das Mosaik von Palestrina, dessen obere Hälfte eine öde Berglandschaft darstellt, die verschiedenen wirklichen und fabelhaften Tieren als Aufenthalt dient; in der untern, wo man angebaute Gegenden am Nil mit vieler Architektur und das menschliche Treiben in denselben sieht, dienen zur Staffage der Nillandschaften Ibisse, Wasservögel, Krokodile und Flußpferde, welche letztere von Jägern auf einer Nilbarke mit Lanzen gejagt werden. Da auch ein Taubenhaus dort abgebildet ist, scheint es, daß diese schon damals in Ägypten häufig waren; gegenwärtig bilden sie in Form kegelartiger Aufsätze, namentlich in Oberägypten, eine Art von zweitem Stockwerk der Hütten in den Dörfern. Daß übrigens die Wunder Ägyptens ins Fabelhafte erweitert wurden, zeigt unter anderm die Sage vom Phönix: daß dieser Vogel in Ägypten zu gewissen Zeiten gesehen werde, war nach Tacitus nicht zweifelhaft. Plinius berichtet von einer Palme in Unterägypten, die mit dem Phönix zugleich absterben und darauf aus sich selbst neu erwachsen sollte; er fügt hinzu, als er dies schrieb, habe sie eben Frucht getragen. Auch an die Existenz der Pygmäen, mit denen die ägyptischen Landschaften gern staffiert wurden, glaubte man, und zwar wie neuere Forschungen gelehrt haben, nicht ganz ohne Grund. Der Epicureer Philodemus gibt an, daß dergleichen in Akoris (in Mittelägypten am östlichen Nilufer) gezeigt werde. Man hatte auch Nachahmungen ägyptischer Architekturen und Gegenden im großen, wie Hadrian in seiner Villa zu Tibur ein Canopus, Sever, wie es scheint, ein Labyrinth und ein Memphis.
Und wie die Natur Ägyptens ewig dieselben wunderbaren Schauspiele bot, so auch seine Monumente, die ältesten, kolossalsten, staunenswürdigsten, die das Altertum kannte. An diesen künstlichen Steinbergen, Riesentempeln und Riesenpalästen, unermeßlichen, in Felsen gegrabenen Gängen und Höhlen, den Wäldern von Kolossen und Sphinxen, den zahllosen, mit farbenprangenden Bildern und geheimnisvollen Schriften überdeckten Wänden schien die Zeit machtlos vorüberzugehen. Es war immer dasselbe, was schon seit Jahrhunderten Tausende und Abertausende angestaunt, beschrieben und geschildert hatten, und doch immer neu und überwältigend. Keine modernen Bauten und Gebilde störten die Einheit dieser übermenschlichen Werke, da auch neuere Tempel und Skulpturen den alten nachgebildet und Hieroglyphen nach wie vor angewendet wurden.
Endlich erhielten sich dort manche fremdartige und in der ganzen übrigen Welt unerhörte Sitten und Gebräuche: dahin gehörte z. B. das künstliche Ausbrüten der Hühnereier durch Mistwärme, das auch das Interesse der über Ägypten nach dem heiligen Lande reisenden Pilger des Mittelalters erregte und noch heute (besonders in Kairo) betrieben wird; ferner das ebenfalls noch jetzt geübte Erklettern der Palmen in der Weise, daß die Kletternden ein Seil zugleich um ihren Leib und den Stamm schlingen und innerhalb dieser Schlinge von einem Knoten des Stammes zum andern aufsteigen. Doch am fremdartigsten und merkwürdigsten erschien den Besuchern Ägyptens immer der dortige Gottesdienst, in welchem begreiflicherweise die Verehrung der Tiere ihre Neugier und Verwunderung am meisten erregte.
So blieb das Interesse für Ägypten nicht nur immer gleich lebendig, sondern es hatte auch immer den gleichen Inhalt; noch gegen Ende des 3. Jahrhunderts waren nach dem Verfasser der »äthiopischen Geschichten«, Heliodor, Erzählungen und Berichte von Ägypten für griechische (und gewiß auch römische) Ohren die anziehendsten, und die Hörer wurden nicht müde, nach den Pyramiden, den Königsgräbern und all den andern Wundern des Fabellandes zu forschen. Von den vorzugsweise oder ausschließlich aus Interesse für Ägypten unternommenen Reisen einiger Kaiser, Kaiserinnen und kaiserlichen Prinzen, wie des Germanicus im Jahre 19, des Hadrian (130), des Septimius Severus, der in Begleitung von Caracalla und Julia Domna bis zur Grenze Äthiopiens gelangte (199/200), wird später die Rede sein. Titus besuchte auf der Rückkehr von Judäa im Jahre 70 von Alexandria aus wenigstens Memphis, die Absicht Caligulas und Neros, nach Ägypten zu reisen, blieb unausgeführt; doch M. Aurel ist dort gewesen, wahrscheinlich auch L. Verus. Römischen Senatoren war seit Augustus der Aufenthalt in Ägypten ohne besondre kaiserliche Erlaubnis verboten, die aber in einzelnen Fällen erteilt worden ist.
Die Hauptstadt Ägyptens, Alexandria, bot dem Fremden ganz andre Eindrücke als das übrige Land. Eine relativ moderne, nicht ägyptische, sondern griechisch-orientalische Stadt, war sie in Bauart und Anlage von andern in der macedonischen Zeit entstandenen Städten nicht wesentlich verschieden, wie das die Ruinen dieser in Kleinasien, Syrien, Cyrene bestätigen. Über die Anlage Alexandrias haben die auf Veranlassung Napoleons III. durch den Hof-Astronomen des Vizekönigs von Ägypten Mahmud-Bey veranstalteten, im Jahre 1867 vollendeten Ausgrabungen neues Licht verbreitet. Die Zuverlässigkeit ihrer Ergebnisse ist durch neue, 1898 bis 1902 ausgeführte Grabungen im allgemeinen bestätigt worden. Wenn Mahmuds Straßennetz, das aus der vierten Bauperiode der Stadt stammt, auch erst der nachhadrianischen Zeit anzugehören scheint, ist es doch von dem ursprünglichen so gut wie gar nicht abgewichen. Nach Mahmud betrug der ganze Umfang der Stadt innerhalb der Mauern 15.800 Meter oder ungefähr 86 Stadien, so daß bei den zum Teil höhern Angaben der Alten die Vorstädte eingerechnet sein müssen. Die Nachgrabungen haben ein völlig rechtwinkliges Netz von 7, der Länge nach von WSW nach ONO, und 12, der Breite nach von NNW nach SSO die Stadt durchschneidenden Hauptstraßen erwiesen. Die eigentliche Zentralverkehrsader unter den Längsstraßen, welche nach Osten hin die Stadt in ihrer mittleren Breite durchschnitt und weiterhin nach Canopus führte (und vielleicht die canopische, sicher »der Korso« δρόμος hieß), ist fast ihrer ganzen Länge nach Hauptstraße geblieben. Ihre Breite, die Strabo auf 36 Meter angibt, beträgt in der Tat nicht volle 20. An beiden Seiten zogen sich, die Fußwege vom Fahrdamm abschließend, in der ganzen Länge der Straße (30 Stadien = 5,4 km) Säulengänge hin, von denen sich vielfache Spuren erhalten haben. In den dieser Hauptstraße parallellaufenden Längsstraßen betrug die Pflasterbreite nur 6,65 Meter. Die ebenfalls mit Säulengängen eingefaßte (wahrscheinlich von dem Tor der Sonne nach dem des Mondes führende) Hauptquerstraße hatte dieselbe Breite wie die canopische. Das Straßenpflaster besteht aus Blöcken der härtesten Gesteine (Basalt und harter Kalkstein) und ist an den Seiten durch eine ununterbrochene Reihe oblonger Quadern fest eingefaßt. Die 12 in der Richtung nach dem Meere laufenden Hauptstraßen waren sämtlich mit verdeckten Kanälen versehen. Die stattlichen, massiv aus Stein gebauten, sämtlich mit fließendem Wasser ausgestatteten Häuser hatten flache Dächer. Nach Strabo bildete das Quartier der Königspaläste mit den dazu gehörigen Lustgärten, dem Museum und der Königsgruft, die auch den Leichnam Alexanders des Großen in einem gläsernen Sarge enthielt, den vierten Teil der (griechischen) Stadt. Unter den Prachtbauten, von denen sie voll war, hebt er besonders das Gymnasium mit mehr als 1 Stadium langen Säulengängen und das Paneum hervor, einen künstlichen Hügel, dessen Spitze man auf Schneckenwegen erstieg, um von dort das ganze Panorama der Stadt zu übersehen. Das von Strabo nur beiläufig erwähnte, dem ersten Kaiser geweihte Cäsareum oder Augusteum, ein von Cleopatra als Tempel des Antonius begonnener Bau, mag seine Vollendung erst später erhalten haben; Philo beschreibt es als einen weiten Tempelbezirk mit Portiken, Sälen, Bibliotheken, Hainen, Propyläen, voll von Weihgeschenken, Statuen und Gemälden, in Gold und Silber prangend. Das ebenfalls von Strabo nur beiläufig genannte Serapeum ist vielleicht von Hadrian, der auch Alexandria mit Bauten reich ausstattete, sehr erweitert und verschönert worden. Es bestand aus einem Säulenhof, dessen Mitte die Pompejussäule einnahm, davor zwei Obelisken; hinter den Hallen lagen Räume für Kultuszwecke und die nachmals von den Arabern verbrannte Bibliothek, vor ihnen ein Propyläum mit Kuppel. Ammian sagt, daß es mit seinen gewaltigen Säulenhallen, lebenatmenden Statuen und der übrigen Masse von Kunstwerken so reich geschmückt erschien, daß es nur hinter dem römischen Kapitol zurückstand; in der unter Constantius verfaßten Weltbeschreibung wird es ein in der ganzen Welt einziger Anblick genannt.
Schon in Diodors Zeit hatte Alexandria nach amtlichen Angaben mehr als 300.000 freie Einwohner. Da nun der Wohlstand der Stadt seit der Schlacht von Actium ungemein wuchs und sie überdies durch die Leichtigkeit des Erwerbs und die lockendsten Genüsse eine fortwährende Einwanderung aus den übrigen Städten und vom Lande herbeigezogen haben muß, dürfte sich die Bevölkerung während der ersten Jahrhunderte mehr als verdoppelt und mit Einschluß der Fremden und Sklaven über eine Million betragen haben. Die Folge dieses Wachstums war eine Erweiterung der Stadt: die in Strabos Zeit verödete Insel Pharos wurde (vielleicht nebst dem Heptastadion) neu besiedelt, und die Neugründung erhielt den in zwei Inschriften des 2. Jahrhunderts vorkommenden Namen Neapolis. Die Bevölkerung bestand teils aus Ägyptern, Griechen und Juden, teils war sie eine Mischbevölkerung, hauptsächlich, doch keineswegs ausschließlich, aus der Vermischung der beiden ersten Nationen hervorgegangen. Römer und andre Europäer müssen hier, auch abgesehen von der starken, zum großen Teil aus der Bürgerschaft und dem Lager von Alexandria rekrutierten, wenig Occidentalen enthaltenden Garnison und dem großen Beamtenpersonal, immer in nicht geringer Zahl vorübergehend oder auf die Dauer ansässig gewesen sein. Dazu führte der Welthandel die afrikanischen und asiatischen Völkerschaften in Menge aus den weitesten Fernen wie in keiner andern Stadt der Erde zusammen: Äthiopier, Libyer und Araber sah man hier neben Skythen, Persern, Baktrern und Indern.

48. DER MUNDSCHENK.
Marmorrelief. Trier, Provinzialmuseum
Der Hafen von Alexandrien war der einzig sichere auf der ganzen, 5000 Stadien (900 km) langen Strecke der asiatischen und afrikanischen Küste zwischen Joppe und Parätonium. An der Mündung der einzigen Wasserstraße eines unermeßlich reichen Hinterlandes, »im Angelpunkt dreier Weltteile, an der Schwelle zwischen Orient und Occident und an der Straße nach Indien« gelegen, war Alexandria, wie Dio von Prusa sagt, ein Mittelpunkt der ganzen Erde, der die fernsten Völker, wie der Markt die Bewohner einer Stadt, versammelte und miteinander bekannt machte. Diese beispiellos günstige Lage machte Alexandria zum ersten Handelsplatz, ja vor der Kaiserzeit in den Augen mancher zur ersten Stadt der alten Welt. Später behauptete es unbestritten die zweite Stelle nach Rom, welche ihm auch im 3. Jahrhundert nur Karthago und Antiochia allenfalls streitig machen konnten. Aber erst seit Ägypten ein Glied dieses ungeheuren Handelsgebiets geworden war, konnten all jene Vorteile seiner Lage ihre volle Wirkung üben. Der Handel nahm sogleich einen gewaltigen Aufschwung, und die Alexandriner erkannten dankbar den ungemeinen Gewinn an, den ihnen die Annexion ihres Landes durch Augustus brachte. Sie verehrten ihn in dem erwähnten Tempel als Beschützer der Schiffahrt, sie feierten ihn als den Herrscher des Meeres und des Festlandes, als Zeus's Befreier, als den Stern von Hellas, den der rettende Zeus habe aufgehen lassen; und als er in seinen letzten Tagen bei Puteoli vorüberfuhr, brachte ihm die Bemannung eines dort eben gelandeten alexandrinischen Schiffes, bekränzt und in weißen Kleidern, wie einem Gotte Weihrauchspenden dar; sie priesen ihn als den, dem sie das Leben, die Schiffahrt, den Genuß der Freiheit und aller Glücksgüter verdankten. Die Einfuhr aus Arabien und Indien betrug schon 6 Jahre nach der Schlacht bei Actium weit mehr als das Sechsfache von dem, was sie unter den letzten Ptolemäern betragen hatte: damals waren kaum 20 Schiffe jährlich nach Indien ausgelaufen, im Jahre 25 v. Chr. gingen allein aus Myos-Hormos dorthin 120; nicht minder steigerte sich die Einfuhr aus dem Innern Afrikas; und der Absatz der Waren, die den Gegenstand dieses alexandrinischen Transithandels bildeten, nach Italien und dem Westen muß mit dem Steigen des Luxus und dem Fortschritt der Kultur in den Provinzen während der ersten Jahrhunderte noch sehr zugenommen haben. Karawanen und Handelsflotten brachten Jahr aus Jahr ein die Schätze des Südens und Ostens, selbst der fernsten Fabel- und Wunderländer hierher. Das Köstlichste und Seltenste, was die Welt kannte, lagerte hier in Massen. Goldstaub, Elfenbein und Schildkrötenschalen aus dem Troglodytenlande, Gewürze und Wohlgerüche aus Arabien, Perlen vom Persischen Meerbusen, Edelsteine und Byssus aus Indien, Seide aus China – all diese und unzählige andre Waren, meist von der höchsten Kostbarkeit, wurden hier aufs neue verladen, um in Rom und anderwärts zum Teil zum Hundertfachen des Einkaufspreises abgesetzt zu werden. Schon in Strabos Zeit war die Ausfuhr bedeutender als die Einfuhr.
Neben diesem Welthandel, der Tausenden Lebensunterhalt, Wohlstand und Reichtum gab, von dem großen Kaufmann, dessen Schiffe nach der Malabarküste und Puteoli segelten, bis herab zu den Lastträgern des Hafens, hatte Alexandria eine großartige Industrie. Die dortigen Webstühle lieferten die in alle Welt, selbst nach Britannien versendete, berühmte Leinwand aus dem einheimischen Flachs in allen Graden der Feinheit; für den Export nach Arabien und Indien wurden die Kleider der Nationaltracht des Volks, für das sie bestimmt waren, entsprechend gearbeitet. Wollenstoffe, die noch im Mittelalter ihren Ruf behaupteten, darunter kostbare Zeuge mit eingewirkten Figuren von Tieren und Menschen, auch ganzen Szenen, zu Kissenüberzügen, Teppichen und Gewändern. Aus den Glasbläsereien gingen die buntesten, künstlichsten und kostbarsten Gläser in allen Gestalten und Farben hervor; aus den Papyrusfabriken alle Arten des Schreibmaterials, vom dünnsten Blatt bis zum gröbsten Packpapier. Der Ertrag der Papierfabriken des Firmus, der unter Aurelian als Kronprätendent auftrat, war so groß, daß er sich rühmte, von Papyrus und Leim ein Heer unterhalten zu können. Auch die wohlriechenden Öle und Essenzen von Alexandria erfreuten sich eines großen Rufs. In den Weihrauchoffizinen mußten die Arbeiter, um Entwendungen zu vermeiden, mit angesiegelten Schürzen und Masken oder dichten Netzen vor dem Gesicht arbeiten und nackt die Werkstatt verlassen.

49. RÖMISCHE KÜCHE.
Pompeii, Haus der Vettier
Das rastlose Treiben einer so ungeheuren erwerbenden, arbeitenden und schaffenden Bevölkerung imponierte um so mehr, wenn man es mit dem müßiggängerischen und unproduktiven Gewühl und Getümmel Roms verglich. Es war dies, was neben der in einem Welthafen natürlichen Vermischung und Verwirrung der Religionen und Kulte von allem Staunen bei einem Besucher von Alexandria erregte. Niemand, so heißt es in einem auf den Namen des Kaisers Hadrian gefälschten Briefe, ist hier untätig, jeder treibt irgendein Gewerbe. Die Podagrischen haben zu schaffen, die Blinden haben zu tun, nicht einmal wer das Chiragra hat, geht müßig. Das Geld ist ihr Gott, ihn beten Juden, Christen und alle andern an.

50. KÜCHENGERÄTE.
Bronze. Trier, Provinzialmuseum
Daß die Bevölkerung der reichen Fabrik- und Handelsstadt in hohem Grade übermütig war, ist natürlich. Zu dem Kaufmannsstolz gesellte sich »bei der aufgeblasenen und frechen Nation« das Bewußtsein der Unentbehrlichkeit Ägyptens für Rom, dessen Existenz zum großen Teil auf dem Ausfall der dortigen Ernten und der Kornzufuhr von dort beruhte. Wenn jemand den Nil lobt, sagt Dio von Prusa den Alexandrinern, seid ihr so stolz, als kämt ihr selbst aus Äthiopien geflossen. Wo die ungeheuersten Reichtümer gewonnen wurden, wo Millionen in Umlauf waren und auch der Proletarier mit leichter Mühe genug erwarb, um seine Mahlzeit von frischen oder geräucherten Fischen mit Knoblauch, Schnecken, Mehl- oder Linsenbrei oder einem aus Gekröse bereiteten Gericht in einer Garküche zu halten und sich in dem beliebten Gerstenbier zu berauschen – da war natürlich auch die Üppigkeit und Ausgelassenheit groß. Die den Ägyptern eigentümliche Witzelei und Spottlust war hier unbezähmbar und steigerte sich bis zur zügellosen Frechheit; selbst die Mächtigsten, selbst die Kaiser, selbst ihre Wohltäter blieben nicht verschont, auch die Gefahr konnte die Ausbrüche dieses Hanges nicht zurückhalten. Dio von Prusa betrachtete es als Beweis von Mut, daß er vor den Alexandrinern aufzutreten wagte, ohne ihren Lärm, ihr Gelächter, ihren Zorn, ihr Pfeifen und Zischen und ihren Spott zu fürchten, womit sie alle in Schrecken setzten. Seneca durfte es seiner mütterlichen Tante zum Ruhme anrechnen, daß sie als Gemahlin des Vizekönigs von Ägypten während einer Zeit von sechzehn Jahren von aller üblen Nachrede verschont geblieben sei, in einer Stadt, »die so geistreich und redefertig ist, wo es die Verunglimpfung ihrer Regierung gilt«. Der milde Vespasian wurde durch die Schmähungen, mit denen die Alexandriner ihn wegen der ihnen auferlegten Steuererhöhung überhäuften (sie nannten ihn u. a. den »Salzfischhändler«), so aufgebracht, daß er sie ernstlich zu bestrafen beabsichtigte; als Titus für sie gebeten hatte, riefen sie diesem zu: »Wir verzeihen ihm: er versteht noch nicht, sich als Kaiser zu benehmen!« Caracalla rächte sich für die Spöttereien der Alexandriner, die ihm zu Ohren gekommen waren, im Jahre 215 durch ein furchtbares Blutbad.
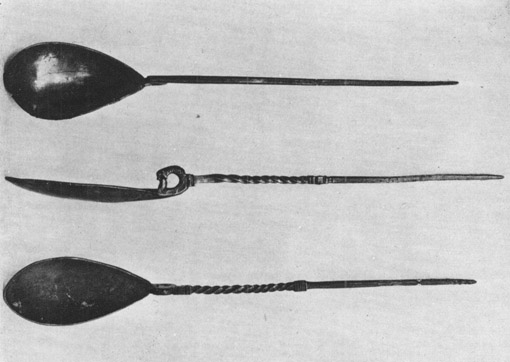
51. RÖMISCHE LÖFFEL.
Bronze. Gefunden in Dorchester, England. London, British Museum
So war also dort, wie auch Dio rügt, Scherz, Gelächter und Lustbarkeit überall, Ernst und Sammlung für höhere Interessen nirgends zu finden. Auch hier drehte sich alles um Brot und Schauspiele. Obwohl Alexandria schon in Strabos Zeit ein Amphitheater hatte, waren wenigstens hundert Jahre später die Spiele der Rennbahn und des Theaters am meisten beliebt, und neben Possen, Vorstellungen von Gauklern und Tierkämpfen war es vor allem Tanz und Musik, woran das Volk mit Leidenschaft hing. Die Bevölkerung von Alexandria war so musikverständig wie keine andre; auch Leute, die nicht einmal lesen und schreiben konnten, hörten jede falsche Note eines Kitharaspielers heraus. Die alexandrinischen Künstler waren im Spiel der Saiten- und Blasinstrumente gleich geschickt. Gesang und Saitenspiel war in Alexandria ein unfehlbares Beschwichtigungsmittel der lärmenden Massen, eine Panacee für alle Übel, und Sänger, Sängerinnen und Kitharaspieler entzückten das Volk bis zur Raserei. Auch die leidenschaftliche Teilnahme für den Ausgang der Wagenrennen führte häufig zu tumultarischen, ja blutigen Szenen.
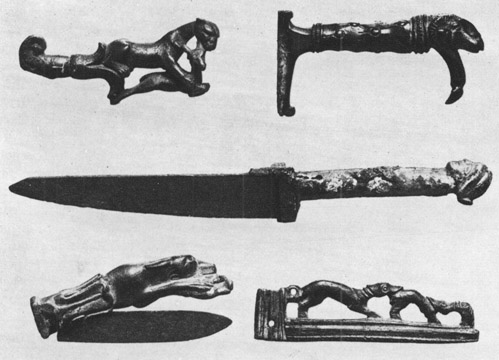
52. Römisches Messer, Messergriffe und zusammenlegbares Taschenmesser.
London, British Museum
Überhaupt war der Pöbel von Alexandria besonders gefährlich, nicht bloß, weil es der Pöbel einer großen Seestadt war, sondern auch, weil er aus der Hefe verschiedener Nationen und einer daraus hervorgegangenen Mischlingsbevölkerung bestand. Es bedurfte nur eines Funkens, um den hier immer bereiten Zündstoff in Brand zu setzen: ein Nichts konnte diese üppige, vergnügungssüchtige Stadt in ein wildgärendes Chaos verwandeln. Aufwiegler und Demagogen bedienten sich zur Erregung von Unruhen hauptsächlich der vielen aus zahlreichen Mitgliedern bestehenden Genossenschaften (Θίασοι), in denen, wie Philo versichert, Trunkenheit, Ausgelassenheit und Frechheit herrschte. Diese sprachen und handelten einmütig nach der von den Führern erteilten Parole. Auf die geringsten Anlässe, wie eine vernachlässigte Begrüßung, eine Beschlagnahme von Lebensmitteln, die Abweisung eines unbedeutenden Gesuchs, die mißfällige Bestrafung eines Sklaven, rotteten sich Massen zusammen, blitzten Waffen, flogen Steine: und wenn diese Aufstände sich auch zuweilen in ein Absingen von Gassenliedern auflösten, so mußten doch mehr als einmal bedeutende Truppenmassen aufgeboten werden, um sie zu dämpfen. Noch in einer Beschreibung des römischen Reiches aus dem 4. Jahrhundert heißt es, daß die Statthalter Alexandria nur mit Zittern und Zagen betreten, weil sie die Volksjustiz fürchten; denn auf jedes ihrer Vorgehen folgt sogleich Brandlegung und Schleudern von Steinen.
Auch der religiöse Fanatismus der Ägypter veranlaßte vermutlich nicht selten Unruhen. Diodor erzählt als Augenzeuge, daß, als ein Römer unter dem Könige Ptolemäus Auletes in Ägypten unabsichtlich eine heilige Katze tötete, weder die sehr große Furcht des Volkes vor Rom noch die Vermittlung des Königs ihn vom Tode retten konnte. Unter Hadrian erregten die von verschiedenen Gemeinden an einen nach vielen Jahren aufgefundenen Apisstier erhobenen Ansprüche zu Alexandria einen Aufruhr. Und wenn auch in dem Welthafen die Vertreter der verschiedensten Religionen zusammenströmten, so standen diese doch im schroffsten Gegensatze zueinander, und diese Gegensätze, durch den Rassenhaß geschärft und gesteigert, werden nicht selten zu Ausbrüchen geführt haben, wie die von Philo geschilderte große Judenverfolgung unter Caligula und die Kämpfe der Juden mit den Griechen im Jahre 66. Bei diesen letztern verwandte der Präfekt Tiberius Alexander, ein jüdischer Renegat, um den Widerstand seiner ehemaligen Glaubensgenossen zu brechen, außer den in Alexandria stehenden zwei Legionen noch 2000 auf dem Durchmarsch befindliche Soldaten; 50.000 Juden sollen damals ums Leben gekommen sein.
Unter den gewiß sehr verschiedenen Klassen von Reisenden, welche die große, prachtvolle und in so vieler Beziehung eigentümliche Stadt anzog, verdienen diejenigen besondere Erwähnung, die dort Genesung, und diejenigen, die wissenschaftliche Belehrung suchten. Eine Seereise nach Ägypten wurde (wie erwähnt) von den Ärzten namentlich gegen beginnende Abzehrung empfohlen. Unter dem milden Himmel, wo nie Schnee fiel, auch im Winter die Rosen blühten und kein Tag ohne Sonnenschein verstrich, während zugleich die Sommerhitze durch die Monsune gemildert wurde, hoffte mancher Kranke, für den das Klima Italiens sich als zu rauh erwiesen hatte, von seinem Bluthusten zu genesen. Auch waren die Ärzte Alexandrias die berühmtesten, und in den dortigen medizinischen Schulen fand man die beste Gelegenheit zur Ausbildung in der Heilkunde. Galen, der selbst in Alexandria studiert hatte, sagt, daß die dortigen Ärzte ihren Schülern Gelegenheit verschafften, die Knochen aus Anschauung kennenzulernen, und schon allein aus diesem Grunde müsse man danach streben, nach Alexandria zu kommen; auch erwähnt er, daß er dort oft die schnelle und schmerzlose Hinrichtung von Verbrechern durch Natterbiß gesehen habe. Zu allen Zeiten hielten zahlreiche Jünger dieser Kunst sich hier auf; es war für einen jungen Arzt eine wirksame Empfehlung, in Alexandria seine Studien gemacht zu haben; und so kam von dieser Stadt Gesundheit für die ganze Welt.
Aber auch für die meisten andern Wissenschaften waren dort die besten Lehrer und Unterrichtsanstalten, die fort und fort zahlreiche Fremde, natürlich vorzugsweise aus den Ländern griechischer Zunge, herbeizogen. Alexandria blieb bis in die letzte Zeit des Altertums und zum Teil sogar noch später eine hohe Schule für Philosophie, Musik, Rechtswissenschaft, Philologie und Literaturwissenschaft, Mathematik und Astronomie, an die sich Astrologie, Alchemie, Magie und andre Geheimwissenschaften anschlossen, in welche die Ägypter am tiefsten eingedrungen zu sein sich rühmten. Den Mittelpunkt jener Studien bildete auch jetzt noch die von den Ptolemäern gegründete Akademie (das Museum) und die Bibliothek, die ohne Zweifel stets eine große Zahl von Schreibern beschäftigte, so daß die Kunst des Schön- und Schnellschreibens, wie es scheint, sehr verbreitet war.
Endlich werden auch religiöse Zwecke zahlreiche Reisen nach Alexandria veranlaßt haben. Nirgends, heißt es in der unter Constantinus verfaßten Weltbeschreibung, werden die Mysterien der Götter so gut gefeiert wie dort von alters her und noch heute. Die größte Anziehungskraft auf die Gläubigen aller Länder übte wohl der Kultus des hier ganz besonders hochverehrten, in so vielen Gefahren hilfreichen Gottes Sarapis. Der Kaiser Septimius Severus legte auf seine Reise in Ägypten besonders auch darum Wert, weil sie ihm Gelegenheit gab, dem Sarapis seine Verehrung zu bezeigen, und Caracalla nahm dies zum Vorwande seines Erscheinens in Alexandria im Jahre 215. Auch an Pilgerinnen zu den Tempeln der im ganzen römischen Reiche von den Frauen so allgemein verehrten Isis wird es nicht gefehlt haben, die sich zugleich das bei deren Kultus erforderliche Nilwasser in unzweifelhafter Echtheit verschaffen wollten.
Besonders anziehend war für die Alexandriner wie für die Fremden, die sich dort aufhielten, die Ostküste mit ihren berühmten Lust- und Badeorten, vor allen Canopus, etwas westlich von Abukir, die sämtlich jahraus, jahrein von Gästen gefüllt waren. Die Ufer des etwa 20 Kilometer langen Kanals, der Canopus mit Alexandria verband, waren mit üppig eingerichteten Gasthäusern besetzt. Die griechische Inschrift eines solchen (oder des Versammlungslokals eines geselligen Vereins), in elegischem Versmaß, hat sich teilweise erhalten. Diese Mauern, heißt es darin, sind stets von Gelagen belebt, von Scharen junger Männer erfüllt; nicht der Ton der Trompete, nur der der Flöten erschallt hier, Blut von Stieren, nicht von Männern, rötet die Erde, Gewänder schmücken uns, nicht Waffen, und bekränzte Chöre, den Kelch in der Hand, feiern in nächtlichen Gesängen den großen Gott Armachis. Auch die hier gelegene Vorstadt Eleusis, »ein Anfang der canopischen Schwelgerei«, hatte zahlreiche Fremdenwohnungen, zum Teil mit Vorrichtungen für Fernsichten versehen und überhaupt mit allem Luxus ausgestattet; noch mehr Canopus selbst, ein Ort zur Lust geschaffen, wo man bei dem erfrischenden Hauch der sanften Seewinde, dem leisen Gemurmel der Wellen, unter dem sonnigsten Himmel träumen konnte, der Welt entrückt zu sein. Der alexandrinische Gelehrte Apio fand dort das elysische Gefilde Homers. Kranke besuchten vor allem den berühmten, vor andern heilig gehaltenen Tempel des Sarapis, um daselbst im Schlaf die orakelhaften Anweisungen des Gottes zu ihrer Herstellung zu empfangen. Ein großer Teil der Gäste aber suchte Canopus auf, um sich den zügellosesten Ausschweifungen zu überlassen, als deren Schauplatz diese Stadt wie kein andrer Vergnügungsort in der damaligen Welt berüchtigt und sprichwörtlich war. Tag und Nacht war in Strabos Zeit der Kanal mit Barken gefüllt, die Gesellschaften von Männern und Frauen von Alexandria dorthin führten. Manche dieser mit Gemächern (die vergitterte Fenster hatten) versehenen Barken legten im Schatten des hoch aus dem Wasser ragenden Gesträuchs der (später ebenso wie der Papyrus in Ägypten untergegangenen) ägyptischen Bohne (Nymphaea Nelumbo L.) an, und hier sah man die Lustfahrenden mitten in Duft und Blütenpracht ihre Mahlzeiten halten, auf andern beim Schall der Flöte Tänze von der äußersten Ausgelassenheit aufführen. Mehrere Darstellungen solcher Szenen haben sich in Pompeji erhalten; auch das Mosaik von Palestrina zeigt ein Gelage, bei dem eine Flötenspielerin Musik macht, unter einer Weinlaube, die von einem Ufer eines mit den Blüten der ägyptischen Bohne gefüllten Wassers zum andern gespannt ist.
Aber welche Fülle von Schauspielen und Anregungen Alexandria und seine Umgegend auch bot, die Reisenden, welche, wie Germanicus, Ägypten besuchten, um seine Altertümer kennenzulernen, konnte es auf die Dauer nicht fesseln. Denn die Stadt mit ihrem Leben und Treiben gehörte ganz und ausschließlich der Gegenwart. Aber nach einer kurzen Reise ins Land auf Kamelen oder stromaufwärts auf der Nilbarke war man aus dem Gewühl und Getöse, aus Glanz und Pracht in Schweigen und Einsamkeit entrückt und fühlte sich überall vom Hauch einer unendlich fernen Vergangenheit angeweht. Ohne Zweifel fehlte es nicht an Reisenden, die wie Apollonius von Tyana bei Philostrat gewissenhaft von Ort zu Ort zogen, um jede Sehenswürdigkeit in Augenschein zu nehmen, und deshalb fortwährend von einem Ufer auf das andre übersetzten, um keine Stadt und keinen Tempel unbesucht zu lassen.
Doch das nächste Ziel der Mehrzahl war vermutlich Memphis, nicht weil es auch damals an Größe und Volksreichtum die zweite Stadt Ägyptens war, sondern wegen der hochberühmten Denkmäler des uralten Königssitzes. Zwar die Paläste der ältesten Pharaonen waren Ruinen, die Reihen von Sphinxen, die zum Sarapistempel führten, halb oder ganz unter Flugsand begraben; aber die Pyramiden hatten die Jahrhunderte nicht zu versehren vermocht. Schon aus weiter Ferne sah man sie auf einer öden hohen Felsebene im Westen der Stadt aus zusammengewehten, schwer zu durchschreitenden Sandhügeln gleich Bergen ragen. Ihr Anblick war damals ein andrer als gegenwärtig; die stufenartig aufsteigenden Steinblöcke waren durchaus bekleidet, die Außenseiten bestanden also aus vier geneigten, glatten, mit Hieroglyphen bedeckten Flächen, die in eine Spitze zusammenliefen. Der arabische Schriftsteller Abdellatif (im Anfange des 13. Jahrhunderts) sagt, daß Kopien der Schriften auf den beiden großen Pyramiden mehr als 10.000 Seiten füllen würden. Der Abbruch der Bekleidung fand nicht vor der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts statt, bei der großen Pyramide war er nach dem Zeugnis eines französischen Pilgers 1395 schon sehr vorgeschritten; Cyriacus von Ancona konnte 1440 bereits bis auf ihre Spitze hinaufsteigen. Die Bekleidung der zweiten existierte großenteils noch 1638 nach dem Zeugnis des englischen Reisenden Greaves, die der dritten (von den Arabern die rote genannt) noch am Ende des 14. oder Anfang des 15. Jahrhunderts. Eingeborene, aus dem nahen Orte Busiris, verstanden es im Altertum, die geneigten Flächen bis zur Spitze zu erklimmen: eine Kunst, mit der sie sich ohne Zweifel, wie im Mittelalter die Araber, vor den Fremden für Geld sehen ließen. Die ägyptischen Priester versicherten, daß die Pyramiden ebenso tief in die Erde hinab, als über den Grund in die Höhe gebaut seien, eine Sage, die sich auch bei der Marienburg und vermutlich öfter bei großen und viel bewunderten Bauten findet. Griechische und römische Reisende ließen auch hier das Andenken ihrer Gegenwart durch eingehauene Inschriften verewigen, die mit der Bekleidung der Pyramiden verschwunden sind. Eine derselben haben Pilger nach dem Heiligen Lande im 14. und 15. Jahrhundert noch gelesen und abgeschrieben. Die Schwester eines C. Terentius Gentianus, der unter Trajan und Hadrian hohe Ämter (auch das Konsulat) bekleidete, hat sie dem Andenken ihres (bereits verstorbenen) »süßesten Bruders« geweiht: sie habe die Pyramiden ohne ihn gesehen, um ihn trauernd reichliche Tränen vergossen und lasse nun zur Erinnerung an ihren Gram diese Klage hier einmeißeln. Eine Anzahl von andern Inschriften sind auf der Klaue eines kolossalen Löwen mit Menschenhaupt bei der Pyramide des Chefren eingehauen, der in neuerer Zeit wieder aus dem Sande, unter dem er verschüttet war, ausgegraben worden ist.
Ein ferneres Hauptziel für römische und griechische Reisende in Ägypten waren die Ruinen von Theben, die sich auf beiden Seiten des Nil mehr als 3 Kilometer weit von Norden nach Süden erstreckten. Auch Germanicus besuchte sie im Jahre 19, und vielleicht verstand der junge Fürst die ernste Mahnung, die in diesem großen Schauspiel untergegangener Herrlichkeit auch für sein Volk enthalten war; denn was ihm ein alter Priester auf Verlangen aus der noch übriggebliebenen Hieroglyphenschrift der Denkmäler vorlas, lehrte ihn, daß das alte Reich von Theben so groß und mächtig gewesen war, wie damals allein das römische und das parthische Reich. Mit einem Heer von siebenmalhunderttausend Männern, so war dort zu lesen, hatte König Ramses (der zweite, im 13. Jahrhundert v. Chr.) Libyen, Äthiopien und einen großen Teil von Asien durchzogen und unterjocht; auch die den besiegten Völkern auferlegten Tribute an Gold und Silber, an Pferden und Waffen, an Elfenbein und Wohlgerüchen, an Getreide und Erzeugnissen jeder Art waren verzeichnet. Noch heute sind in den Ruinen von Theben umfassende Darstellungen der Kriege und Siege des Ramses in Bild und Schrift vorhanden.
Auch das tönende steinerne Bild des Memnon betrachtete Germanicus; und dies nahm, wie es scheint, bald die Aufmerksamkeit der meisten Reisenden in höherem Grade in Anspruch, als alle übrigen Überbleibsel Thebens, ja vielleicht als alle Wunderwerke Ägyptens. Auf dem westlichen Ufer des Nils war ein großes Trümmerfeld, das Philostrat im Leben des Apollonius von Tyana (vielleicht nach den Schilderungen der Kaiserin Julia Domna) wie den Marktplatz einer verlassenen Stadt beschreibt, auf dem man Reste von Pfeilern und Mauern, Steinsitze und Bildwerke, teils durch Menschenhand, teils durch die Zeit zerstört, erblicke. Aus diesen durcheinandergeworfenen Trümmern ragten zwei sitzende Kolosse, die man schon in einer Entfernung von vier Stunden sah, der Inschrift nach Standbilder des Königs Amenophis III. Jeder war aus einem Felsblock gehauen, von etwa 20 m Höbe, nackt bis auf einen Schurz, mit jugendlichem Antlitz, in aufrechter Haltung, die herabgesenkten Arme eng an den Leib geschlossen, die Hände auf den Knien ruhend. Seit ein Erdbeben, vielleicht im Jahre 27 v. Chr., den oberen Teil des einen herabgestürzt hatte, so daß nur noch die Beine mit den auf den Knien liegenden Händen an dem Throne hafteten, beobachteten Besucher der Ruinen von Theben ein seltsames Phänomen. Wenn beim Aufgange der Sonne die beiden Kolosse ihre ungeheuren Schatten über die schweigende Einöde warfen, erklang aus dem zertrümmerten ein leiser, aber deutlicher Ton. Strabo, der erste Berichterstatter über dies Phänomen, nennt es ein Geräusch, wie durch einen leichten Schlag verursacht. Andre verglichen den Ton dem einer zerspringenden Saite, wieder andre dem Schall eines kupfernen Gefäßes, an das man schlägt. Manche glaubten darin eine Ähnlichkeit mit der menschlichen Stimme zu entdecken. So entstand die Vorstellung, daß dies ein Bild Memnons sei, der nach einem seit lange bei den Griechen verbreiteten Glauben der Erbauer auch dieser Paläste war, und daß der Sohn der Morgenröte mit diesem Laut seine Mutter begrüße. Wann die Benennung des Kolosses als Memnon aufgekommen und allgemein geworden ist, läßt sich nicht bestimmt ermitteln; doch hat bereits der bekannte gelehrte alexandrinische Scharlatan Apio (unter anderm Verfasser der von Josephus widerlegten judenfeindlichen Schrift), der unter Tiberius und Caligula lebte, seinen Namen darauf mit der Bemerkung verewigt, daß er den Memnon dreimal gehört habe. Der erste Schriftsteller, der den Koloß als Memnon erwähnt, ist der ältere Plinius in seiner im Jahre 77 vollendeten Naturgeschichte. Als das tönende Bild des Sohnes der Göttin der Morgenröte erlangte der Koloß eine ganz neue Anziehungskraft für griechische und römische Reisende. Von den vielen, die seinetwegen nach Theben pilgerten, haben manche ihren Namen, zum Teil auch das Datum ihrer Anwesenheit, und längere oder kürzere Bemerkungen, selbst Gedichte, fast sämtlich in die Beine der Figur einhauen lassen, die beinahe bis zu den Knien mit diesen Inschriften bedeckt sind. Von 72 derselben sind 35 datiert, die erste aus Neros, 3 aus Domitians, eine aus Trajans Zeit, die meisten (27) aus der Hadrians; sein eigner Name, der seiner Gemahlin und verschiedener Personen seines Gefolges stehen hier zur Erinnerung an einen im November 130 abgestatteten Besuch. Außerdem liest man die Namen von 8 Vizekönigen Ägyptens, 2 Gemahlinnen von Vizekönigen, 3 Kommandanten der Thebais, von verschiedenen Offizieren, 2 Oberrichtern, einem Priester des Sarapis zu Alexandria, einem »homerischen Dichter« aus dem dortigen Museum usw. Die letzten datierten Inschriften sind aus der Zeit des Septimius Severus. Er ließ wahrscheinlich bei seiner Anwesenheit in Ägypten im Jahre 200 den Koloß restaurieren, und diese Restauration ist bis auf den heutigen Tag dauerhaft geblieben; aber der Druck der ungeheuren, auf das Fragment aufgesetzten Steinmassen verhinderte die Vibration bei dem starken Temperaturwechsel des Sonnenaufgangs, die früher jenen Ton hervorgebracht hatte. Das Bild des Memnon war nun verstummt und geriet seitdem allmählich in Vergessenheit.
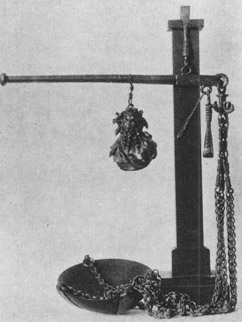
53. RÖMISCHE WAAGE.
Gefunden in Smyrna. London, British Museum
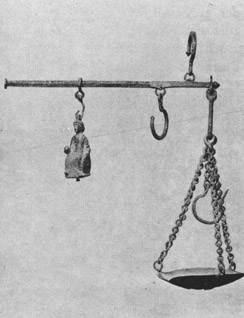
54. SCHNELLWAAGE
mit doppelter Skala für Lasten. Berlin, Antiquarium
In vielen der erwähnten Inschriften bezeugen die Reisenden dem Memnon ihre Verehrung als einem göttlichen Wesen und empfehlen sich seiner Huld, öfters tun sie dieses zugleich im Namen ferner Lieben, die sie zur Stelle wünschen, oder deren sie in andrer Weise gedenken. Und dies ist überhaupt die gewöhnlichste Form auch der später zu erwähnenden Inschriften von Reisenden in Ägypten und anderwärts. Sie enthalten großenteils eine Verehrung einer Landes- oder Ortsgottheit, in deren Tempel man sich befand, oder unter deren waltendem Schutze man hier, so fern von der Heimat und den Seinigen, zu stehen glaubte.
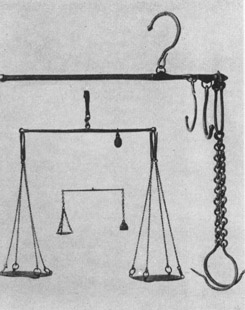
55. RÖMISCHE WAAGEN.
London, British Museum

56. SCHNELLWAAGE IM GEBRAUCH.
Marmorrelief. Trier, Provinzialmuseum
Nächst dem Memnonskoloß bewunderten Griechen und Römer bei Theben vorzugsweise die Gräber der Könige in der zweiten libyschen Bergkette im Westen von Theben. Der Anblick des Tals Biban-el-muluk war ohne Zweifel damals derselbe wie heute, wo es die traurigste Öde zum rechten Wohnplatz der Toten macht; »kein Strauch, kein Halm findet an den steilen, kahlen Wänden eine Stätte, wo er wurzeln könnte, die Felsen sind gelbbraun, mit hellem Sande überschüttet und von schwarzen Gängen durchzogen; nur der Schakal und die Hyäne wohnen in den finstern Klüften des Gesteins, hungrige Geier umkreisen die höchsten Gipfel«. Die Königsgräber sind tief in die Felsen gehauene Kammern und Gewölbe, Gänge und Hallen; die Griechen nannten sie Syringen (Röhren). Auch hier sind zahlreiche (über 100) Inschriften von Reisenden gefunden worden, bei Fackelschein flüchtig eingeritzt, oder mit roter Farbe gemalt, meist aus römischer Zeit; die datierten reichen von der Zeit Trajans bis zu der Constantins, keine ist älter als die Regierung der Ptolemäer. Die Namen Aurelius Antoninus und Lucius Aurelius scheinen die der beiden Kaiser Marc Aurel und Lucius Verus zu sein. Der größte Teil enthält nur Namen und Daten oder kurze Ausdrücke der Bewunderung. »Die, welche dies nicht gesehen haben, haben nichts gesehen«, lautet eine griechische Inschrift im Grabe des neunten Ramses; »glücklich sind, die dies geschaut haben«. Ein andrer Besucher bemerkt allerdings in schroffem Gegensatze zu dieser Begeisterung, er habe nichts andres zu bewundern gefunden als das Gestein. Ein hoher ägyptischer Finanzbeamter (etwa des 4. Jahrhunderts) bemerkt, daß er sich lange Zeit in der Kaiserstadt Rom aufgehalten und ebensowohl die dortigen Sehenswürdigkeiten gesehen habe wie die hiesigen.
Ähnliche Inschriften von Reisenden finden sich an den meisten Orten, die sich zu beiden Seiten des Nils hinziehen, auf Tempelwänden, Obelisken, Pylonen usw. eingehauen, und zwar nicht bloß bis zur Grenze von Ägypten (bis Philä und Syene), sondern bis Hiera-Sykaminos, dem Grenzort Äthiopiens und südlichsten Punkt des römischen Reichs. Wenige darunter haben ein besonderes Interesse. In den Ruinen von Groß-Apollinopolis (Edfu) in Oberägypten liest man: Es preist Gott Ptolemäus, Dionysius' Sohn, ein Jude. Preis Gott. Theodotus, Dorions Sohn, ein Jude, gerettet aus – (der hier vermutlich folgende Landesname fehlt); die Reisenden waren wohl ägyptische Juden, die von einer weiten und gefährlichen Handelsreise zurückkehrten und vielleicht aus Rücksicht auf heidnische Mitreisende dem Ausdruck ihrer Gottesverehrung eine Fassung gaben, die allenfalls auch eine Beziehung auf einen heidnischen Gott zuließ. In Philä ist u. a. der Name des C. Numonius Vala eingehauen, mit dem Horaz einst in behaglicher Muße über die klimatischen und sonstigen Vorzüge von Velia und Salernum korrespondierte; er war hier im 13. Konsulate des Augustus (2 v. Chr.) am 25. März; zehn Jahre später fand er auf der Flucht aus der Schlacht im Teutoburger Walde nach dem Rhein den Tod.
Von den übrigen Sehenswürdigkeiten der verschiedensten Art, an denen Ägypten überreich war, können hier nur einige genannt werden, die das Interesse der Fremden vorzugsweise in Anspruch nahmen. Bei den sämtlichen Heiligtümern und Tempeln machten Priester die Führer und Erklärer. Aristides sagt, daß er auf seinen vier Reisen in Ägypten kein Bauwerk ununtersucht gelassen und ihre Maße, wo er sie nicht in Büchern angegeben fand, mit Hilfe der Priester und Propheten ausgemessen habe. Die Priester zeigten namentlich auch die heiligen Tiere, wie den von Apio erwähnten unsterblichen Ibis zu Hermopolis. Diodor sagt, von dem Stier Apis in Memphis, dem Stier Mnevis in Heliopolis, dem Bock in Mendes, dem Krokodil im See Möris, dem Löwen in Leontopolis ließe sich viel erzählen; aber, wer es nicht selbst gesehen habe, werde es nicht glauben. Er beschreibt ausführlich die Wartung dieser Tiere durch die angesehensten Männer, die sie mit den besten Speisen nährten, sie mit warmen Bädern und Wohlgerüchen pflegten, ihnen prächtige Lager bereiteten, weibliche Tiere für sie zur Paarung hielten und große Summen auf ihre Bestattung verwendeten; auch zu seiner Zeit hatten solche Bestattungen hundert Talente (471.500 Mark) gekostet. Den Stier Apis, den die Priester in einem eigens dazu bestimmten Hofe sehen ließen, besuchte auch Germanicus; Titus wohnte der Einweihung eines Apis bei. Die Krokodile erkannten die Priester an der Stimme, ließen sich von ihnen berühren und öffneten den Rachen, um sich die Zähne reinigen und mit leinenen Tüchern abtrocknen zu lassen; das zahme Krokodil Suchos zu Arsinoë pflegten auch die Reisenden mit Brot, Fleisch und Wein zu füttern.
Unter den großen Baudenkmälern scheint außer den genannten das Labyrinth, unter den Wasserbauten der Mörissee am meisten bewundert worden zu sein. Zu den berühmtesten Naturschauspielen gehörte der Anblick der nahezu unter dem Wendekreise gelegenen Grenzorte Ägyptens, Elephantine und Syene, zur Zeit der Sommersonnenwende. Um die Mittagsstunde war dann dort völlige Schattenlosigkeit, und alles Aufrechtstehende leuchtete in vollem Sonnenglanz, Tempel, Obelisken und Menschen; in Syene aber war ein (jetzt verschwundener) heiliger Brunnen, auf dessen Grunde man am selben Tage und zur selben Stunde das Bild der Sonne sah, das die ganze Wasserfläche genau bis zum Rande füllte. Auch die (kleinen) Katarakten des Nils oberhalb Syene wurden viel besucht. Der Strom stürzt hier bei hohem Wasserstande über eine Reihe von Klippeninseln in der Mitte seines Bettes, während er zu beiden Seiten ruhig fließt. Kamen Statthalter und andre vornehme Personen, den Wasserfall zu sehen, so fuhren die Schiffer, um ihnen ein Schauspiel zu geben, am westlichen Ufer bis über die Klippenreihe stromaufwärts und ließen sich dann von dem Wasserfall hinabschleudern, ohne Schaden zu nehmen. Aristides erhielt auf seine Bitte von dem Kommandanten der römischen Garnison zu Syene eine militärische Begleitung, welche die Schiffer nötigenfalls zu dieser Fahrt zwingen sollte, und machte sie dann auch selbst mit. Die großen Katarakten des Nils in Äthiopien scheinen Reisende nur selten erreicht zu haben. Ebenso werden die Punkte, die von den Ufern des Nils westlich oder östlich weit entfernt waren, bloß um ihrer Sehenswürdigkeit willen so gut wie nie besucht worden sein, da ihre Erreichung mit zu großen Schwierigkeiten verknüpft war. Aristides hat Ägypten viermal in seiner ganzen Ausdehnung durchreist, ohne »die berühmten Porphyrbrüche am Roten Meer« gesehen zu haben, die seit der Zeit des Claudius in Betrieb waren (Möns Claudianus, jetzt Djebel-Dôchan), wo Hunderte von Verurteilten mitten in der wasserlosen Wüste, in sengender Sonnenglut das überaus harte Gestein zu Säulen und andrem Schmuck für die Paläste Roms verarbeiteten.
Für den Nachweis der in jener Zeit von Reisenden hauptsächlich besuchten Länder und Orte konnten griechische ebensowohl als römische Zeugnisse benutzt werden. Für die Erörterung der Gegenstände, welche die Aufmerksamkeit der Reisenden vorzugsweise in Anspruch nahmen und die mehrfach bereits berührt worden sind, kann die Benutzung der Zeugnisse nicht ganz ohne Unterschied geschehen, da die Interessen und Zwecke der Gebildeten beider Nationen oder, besser gesagt, der römisch und der griechisch Gebildeten auch in jener Zeit keineswegs durchaus zusammenfielen.
Ob die Anerkennung der sieben hauptsächlichsten Sehenswürdigkeiten der ganzen Welt als der sogenannten sieben Wunderwerke jemals die Orte, an denen sie sich befanden, zu Reisezielen gemacht hat, muß in Ermangelung von Zeugnissen dahingestellt bleiben. Die Zusammenstellung dieser sieben Werke ist offenbar in der Diadochenzeit, und zwar zwischen 284 und 220 v. Chr. gemacht, bevor der in der Regel dazu gerechnete Koloß von Rhodos durch ein Erdbeben umgestürzt ward, und zwar in Alexandria (vielleicht von Callimachus). Die Orte, wo sie sich befanden, liegen nicht bloß sämtlich innerhalb des von Alexander dem Großen eroberten Gebiets, sondern auch in einer Peripherie, von deren Zentrum Alexandria nicht zu weit entfernt ist: Olympia (mit dem Zeus des Phidias), Rhodos (mit dem Koloß), Halikarnaß (mit dem Mausoleum), Ephesus (mit dem Artemistempel), Babylon (mit den Mauern und hängenden Gärten), Memphis (mit den Pyramiden). Wenn auch die Siebenzahl festgehalten werden konnte, indem man den Koloß durch eine andre Sehenswürdigkeit ersetzte (bei Plutarch und Martial geschieht dies z. B. durch den aus Hörnern bestehenden Altar des Apollo auf Delos), so hat doch, soviel sich erkennen läßt, auf die Reisen der späteren Zeit das Bestreben, alle sieben Wunder zu sehen, keinen Einfluß geübt. Der vielgereiste Pausanias hatte, wie erwähnt, niemanden angetroffen, der in Babylon gewesen war, und schon seit der augusteischen Zeit verknüpfte sich für den Griechen und Römer mit dem Namen dieser Stadt die unrichtige, aber durch die Rhetorik genährte Vorstellung einer großen Einöde und zwischen ihren halbverfallenen Mauern hausender Tiere.
Das Interesse an der nationalen Eigentümlichkeit fremder Völker, an ihren Einrichtungen, Sitten und Gebräuchen, tritt bei den damaligen Touristenreisen der Römer am wenigsten hervor, und das ist aus zwei Gründen natürlich. Erstens waren, wie oben bemerkt, die nationalen Eigentümlichkeiten der am meisten bereisten Länder bereits bis zu einem gewissen Grade von der griechisch-römischen Kultur ausgeglichen, und die oberflächliche Betrachtung ward sie nur ausnahmsweise gewahr. Sodann aber interessierte in diesen Ländern die Vergangenheit die römischen Besucher fast überall unendlich mehr als die Gegenwart. Das Streben, die Vergangenheit in all ihren Denkmälern, Überbleibseln und Erinnerungen Schritt für Schritt zu verfolgen, tritt hier in den Vordergrund. Neben diesem ganz eigentlich historischen Interesse macht sich sodann das Streben bemerklich, die Merkwürdigkeiten und Sehenswürdigkeiten aller Art kennenzulernen, oft nicht aus unmittelbarem Interesse an den betreffenden Gegenständen, sondern um ihrer Berühmtheit willen, namentlich wenn diese eine durch vielgelesene Schriften vermittelt war, sodann aber auch wegen ihrer Seltenheit und Ungewöhnlichkeit. Inwiefern das Interesse für Kunst wesentlich, das für Natur bis zu einem gewissen Grade sich nach diesem Gesichtspunkte bestimmte, kann erst zuletzt erörtert werden.
a) Das historische Interesse
Die reichste Gelegenheit, Schaulust, Neugier und Wißbegier zu befriedigen, boten überall die Tempel; ihnen galten, nicht allein aus religiösen Gründen, gewöhnlich die ersten Schritte der Reisenden. Selbst kleine Orte hatten sehenswürdige Tempel, nicht bloß in den griechischen Ländern, sondern auch in Italien. So schreibt Marc Aurel an Fronto von Anagnia, es sei eine alte Stadt, zwar winzig, doch habe es viele Altertümer, Tempel und überaus heilige Zeremonien. Die Tempel waren die schönsten, größten, zum Teil auch die ältesten und berühmtesten Gebäude, oft in herrlicher Lage. Wie vielfach sie das Interesse erregen konnten, mag die bereits erwähnte Beschreibung zeigen, die Philo von dem großen, prachtvollen Augustustempel zu Alexandria gibt.
Die Bezirke der Tempel umschlossen oft außer zahlreichen Baulichkeiten Parks und andre Anlagen, auch Gehege von heiligen Tieren und Vögeln; man fand dort Erquickung »durch die Schönheit und Menge der Bäume, durch Kühlung aushauchende Kanäle und die Reinheit der Luft«. Den berühmten Aphroditetempel auf Knidos umgab nach Lucians Beschreibung ein herrlicher Park von fruchttragenden oder ihrer Schönheit wegen gepflanzten Bäumen, die in üppigster Fülle gediehen und reichen Schatten gewährten, namentlich Myrten und Lorbeeren, hohen Zypressen und Platanen. Alle Stämme bedeckte Efeu; weit ausgebreitete Weinstöcke hingen voll Trauben. Unter dem dichten, von dem Schwirren der Zikaden erfüllten Laube waren Sitze für die Festmahlzeiten der Opfernden angebracht. Bei dem Apollotempel zu Gryneum in Kleinasien war »ein herrlicher Park sowohl von Fruchtbäumen als von andern, die Wohlgeruch oder Augenlust geben«. Die Insel Tenos hatte einen sehenswerten Tempel des Poseidon, der in einem Haine außerhalb der Stadt lag, in dem man umfangreiche Vorrichtungen für Opfermahlzeiten sah. In der Nähe des Tempels der syrischen Göttin in Hierapolis (nicht weit vom Euphrat und der Grenze Mesopotamiens) befand sich ein großer Park für die geweihten Tiere, Ochsen, Pferde, Adler, Bären und Löwen, öfters wurden Herden heiliger Gänse bei Tempeln gehalten.
Die Tempel waren ferner reich an Weihgeschenken, Kostbarkeiten und Seltenheiten aller Art, besonders an Bildern, Skulpturen und andern Kunstschätzen, die teils in frommer Absicht hierher gestiftet wurden, teils weil die Tempel die sichersten und besuchtesten Aufbewahrungsorte waren. Die Weihgeschenke, die Augustus in fünf Tempeln Roms (dem des Juppiter auf dem Kapitol, des Divus Cäsar, des Apoll, der Vesta und des rächenden Mars) aus der Kriegsbeute hatte aufstellen lassen, kosteten nach seiner eignen Angabe im ganzen 100 Millionen Sesterzen (21¾ Millionen Mark). Der ältere Plinius sagt, er wolle seinem Werke durch die Widmung an Titus einen höheren Glanz verleihen, wie viele Dinge nur dadurch kostbar erscheinen, daß sie in Tempeln geweiht seien. Auch Bibliotheken waren mit diesen oft verbunden, und in gewisser Art vertraten sie zugleich die Stelle von Museen, da sie außer Kunstgegenständen naturwissenschaftliche, ethnographische und historische Merkwürdigkeiten enthielten; diese letzten allerdings vereinzelt und wie sie der Zufall zusammengebracht hatte, die Kunstwerke aber zuweilen in so großer Menge, wie moderne Galerien und Kabinette. Dem Apollotempel zu Rhegium (Reggio an der Meerenge von Messina) vermachte einmal jemand ein Pergamentbuch in Elfenbein gebunden, ein Elfenbeinkästchen und 18 Bilder. In Tempeln zu Athen, Delphi, Olympia, Rom, um andrer nicht zu gedenken, sah man viele der berühmtesten Bilder und Statuen, zu Rom auch Sammlungen von geschnittenen Steinen: die Gemmensammlung des Königs Mithridates stiftete Pompejus auf das Kapitol, Julius Cäsar sechs Gemmensammlungen in den Tempel der Ahnfrau Venus, der Neffe des Augustus Marcellus eine in den Tempel des palatinischen Apollo. Bekanntlich sind auch in christlichen Kirchen hin und wieder profane Kunstwerke aufbewahrt worden, wie in der Kathedrale von Girgenti der Sarkophag mit der Geschichte des Hippolyt, im Dome von Siena die Gruppe der drei Grazien.
Auch Naturseltenheiten – die ebenfalls mitunter in christlichen Kirchen ihren Platz fanden, wie z. B. ein Kaiman in der Kirche Notre Dame zu Cimiez (Nizza) – scheinen vorzugsweise in Tempeln aufbewahrt worden zu sein. In diesen konnte man nach Plinius die Größe der Elefantenzähne kennenlernen. Unglaublich große sah man zu Ciceros Zeit in einem alten Junotempel auf einem Vorgebirge von Malta; nach einer darauf befindlichen Inschrift waren sie für König Masinissa ohne dessen Wissen geraubt, doch von ihm zurückgegeben worden; außerdem befand sich dort noch eine große Masse Elfenbein und viele daraus verfertigte Stücke, namentlich Siegesgöttinnen von alter und höchst kunstvoller Arbeit: dies alles ließ Verres für sich fortnehmen. In dem Tempel der syrischen Göttin zu Hierapolis sah man barbarische Gewänder, indische Edelsteine und Elefantenzähne; alles angeblich aus der von Dionysos, dem die Erbauung zugeschrieben wurde, in Indien gemachten Beute herrührend. Pausanias beruft sich für seine Ansicht, daß die Elefantenzähne abwärts gebogene Hörner seien, auf einen Elefantenschädel in dem berühmten Tempel der Diana (Tifatina) bei Capua, an welchem man dies sehen könne. Haut und Kinnladen einer 36 Meter langen Schlange, welche im ersten punischen Kriege unter dem Befehl des Regulus beim Flusse Bagradas mit Wurfmaschinen getötet worden war, hatten sich bis zum Numantinischen Kriege zu Rom in einem Tempel erhalten. Hadrian ließ eine indische Schlange in dem von ihm erbauten Tempel des olympischen Zeus zu Athen aufbewahren, in den Erostempel zu Thespiä stiftete er das Fell einer selbsterlegten Bärin. Zu Plinius' Zeit sah man in dem Isistempel zu Cäsarea in Mauretanien ein Krokodil aus einem dortigen See, welches König Juba zum Beweise, daß daselbst der Nil entspringe, hatte aufstellen lassen. Der Karthager Hanno hatte an der Westküste von Afrika »drei behaarte wilde Weiber« gefunden und getötet, welche die Dolmetscher Gorillen nannten (und die wohl wirklich eher Gorillen als Schimpansen waren). Ihre Felle waren bis zur Zerstörung von Karthago dort in dem Tempel der Juno Astarte zu sehen gewesen. Die Soldaten des Marius stießen im Jugurthinischen Kriege in Afrika auf Tiere, die angeblich wilden Schafen ähnlich sahen, durch ihren Blick töteten und Gorgonen genannt wurden. Nachdem einige von numidischen Reitern aus der Ferne mit Wurfspießen erlegt worden waren, schickte Marius ihre Felle nach Rom, wo sie im Tempel des Hercules bei der Ara Maxima auf dem Forum Boarium aufbewahrt wurden. Eine Walfischrippe sah Pausanias im Äskulaptempel bei Sikyon. In Erythrä befanden sich in einem Heraklestempel Hörner indischer Ameisen. Häufig sah man nach Philostrat in griechischen Tempeln indische Nüsse (vermutlich Kokosnüsse) und indische Rohre in der Dicke von Bäumen; die Wurzel des Zimtbaumes sah Plinius in dem von Livia zu Ehren des Augustus erbauten palatinischen Tempel auf einer goldnen Schale; in einem Äskulaptempel zu Panticapäum wurde ein Gefäß aufbewahrt, das durch das Gefrieren des darin enthaltenen Wassers geborsten war. Auch der größte Kristall, den Plinius gesehen hatte, ein Stück von 150 (röm.) Pfunden (= 49 kg), war von Livia auf das Kapitol gestiftet worden; als Probe des schwarzen spiegelnden Obsidian hatte Augustus im Concordientempel vier daraus verfertigte Elefanten aufgestellt, einen aus britannischen Perlen verfertigten Harnisch Cäsars im Tempel der Ahnfrau Venus.
Auch merkwürdige Geräte, Instrumente und künstliche Arbeiten befanden sich in Tempeln, wie im Apollotempel zu Delphi eine bleierne Zahnzange, welche nach dem Arzte Erasistratus zeigen sollte, daß nur solche Zähne gezogen werden müßten, deren Entfernung leicht und ohne Anwendung stärkerer Instrumente erfolgen könnte. Einen Spiegel, der verzerrte Bilder zurückwarf, sah man in einem Tempel zu Smyrna. Zu Erythrä wurden in einem Tempel zwei Amphoren gezeigt, die wegen der Dünnheit ihres Tons dort aufgestellt waren; ein Meister und ein Schüler hatten gewetteifert, wer von beiden ein Gefäß von dünnerem Ton verfertigen könnte. Eine Flöte mit vier Löchern, wie sie in alter Zeit im Gebrauch gewesen waren, hatte Varro in einem Tempel des Marsyas gesehen. Der heilige Hieronymus erwähnt eine große eherne Kugel auf der Akropolis von Athen neben der Athenastatue, die zu Kraftproben für die Athleten vor der Zulassung zu den Agonen diente; er selbst hatte sie bei seiner Schwächlichkeit kaum rühren können. Auch ausländische Waffen und Geräte wurden zuweilen in Tempeln aufbewahrt; wenigstens sah Pausanias in dem Tempel des Äskulap zu Athen einen aus Pferdehufen verfertigten sarmatischen Panzer und leinene Panzer im Apollotempel zu Gryneum und anderwärts. Ein mit Gold eingefaßtes Horn des Auerstiers hatte Trajan aus der getischen Kriegsbeute dem Zeus Kasios bei Antiochia gestiftet.
Endlich dürften auch angebliche Naturwunder in und bei Tempeln nicht selten gezeigt worden sein. Die Pergamener hatten die Haut eines Basilisken für eine hohe Summe gekauft, um dadurch einen Tempel, der mit Gemälden von Apelles geschmückt war, vor Spinngeweben und dem Hineinfliegen der Vögel zu schützen. Horaz machte sich darüber lustig, daß man ihn auf der Reise nach Brundisium in Gnathia glauben machen wollte, der Weihrauch werde dort auf einem Altar ohne Feuer verzehrt; dergleichen möge ein abergläubischer Jude sich aufbinden lassen. Augustinus erzählt, daß vor einem Venustempel ein Kandelaber unter freiem Himmel gestanden habe und darauf eine Lampe, deren Flamme weder Wind noch Regen auslöschen konnte; er erklärt sich dies entweder durch Anwendung von Asbest oder durch Magie, die auch durch den im Tempel wohnenden Dämon geübt sein könne.
Doch noch häufiger wurden offenbar in Tempeln Gegenstände von historischem Interesse aufbewahrt, besonders solche, die im Besitz berühmter Personen gewesen waren, und zwar aus allen Perioden der Geschichte, von der jüngsten Vergangenheit bis zu den Anfängen der Menschheit hinauf. Das dem Vitellius überreichte Schwert Julius Cäsars war aus einem Marstempel genommen worden. Den Dolch, mit dem Otho sich getötet hatte, stiftete Vitellius in einen Tempel desselben Gottes in Köln; den Dolch, mit dem Scävinus, einer der im Jahre 65 gegen Nero Verschworenen, den Kaiser töten wollte, hatte er aus einem Tempel der Salus oder Fortuna genommen; Nero stiftete ihn später auf das Kapitol mit einer Weihung an den rächenden Juppiter. Spindel und Rocken der Tanaquil sah Varro in einem Tempel des Sancus und ein von ihr verfertigtes königliches Kleid, das Servius Tullius getragen, in einem Tempel der Glücksgöttin zu Rom. In dem verfallenen Tempel des Juppiter Feretrius sah noch Augustus den leinenen Panzer, welchen A. Cornelius Cossus dem von ihm im Zweikampfe getöteten Vejenterkönige Tolumnius abgenommen und dem Gotte dargebracht hatte. Den angeblichen Ring des Polykrates (dessen Stein ein Sardonyx war) zeigte man zu Rom im Concordientempel in einem goldnen, von Augustus geschenkten Horn. Von dem leinenen Panzer, den König Amasis von Ägypten in den Tempel der Athena zu Lindos auf Rhodus gestiftet hatte, und an dem jeder Strang aus 360 Fäden bestand, sah noch Mucianus, der Freund des Kaisers Vespasian, geringe Überreste, der größte Teil war durch das unaufhörliche Betasten zugrunde gegangen. Delphi besaß einen eisernen Stuhl Pindars. Der goldene Panzer des Masistius, der unter Mardonius die persische Reiterei führte, war im Erechtheum zu Athen, nebst einem Säbel des Mardonius, dessen Echtheit aber Pausanias bezweifelt. Die Lanze des Agesilaus sah man zu Sparta, Rüstung und Lanze Alexanders des Großen zu Gortys in Arkadien, Rüstungen Mithridats zu Nemea und Delphi; einen von Alexander in Theben erbeuteten und von ihm dem Apollo zu Cumä geweihten Kandelaber in der Form eines fruchttragenden Baums im Tempel des palatinischen Apollo zu Rom; von vier Statuen, die einmal Alexanders Zelt gestützt hatten, zwei vor dem des rächenden Mars, die beiden andern vor der Regia, dem Amtshause des obersten Pontifex.
Wahrscheinlich erregten die Reliquien aus der Heroenzeit, mit der ein großer Teil der Gebildeten durch die allgemein gelesenen Dichterwerke und den Schulunterricht vertrauter war als mit der neueren Geschichte, das größte Interesse, ohne daß ihre Echtheit im allgemeinen größeren Bedenken unterlag als die der historischen Stücke; denn auch die Sage gilt als geschichtliche Überlieferung, wenngleich als eine mit Fabeln und Märchen durchsetzte. Unter den Reliquien aus der Heroenzeit werden aber die aus der Zeit des Trojanischen Krieges und der damit zusammenhängenden Begebenheiten, wie die geschätztesten, so auch die am meisten verbreiteten gewesen sein. Man hatte deren an den verschiedensten Orten, von dem Ei der Leda, das in einem Tempel zu Sparta von der Decke herabhing (vermutlich ein Straußenei), und einem von Helena in den Athenatempel zu Lindos gestifteten Kelch aus Elektron (wie man sagte, ein Maß ihres Busens) bis zu dem noch in Justinians Zeit zu Rom befindlichen Schiffe des Äneas; damals wurde auch noch zu Geraistos auf Euböa ein von Agamemnon der Artemis geweihtes Schiff und zu Cassiope auf Corcyra das versteinerte Schiff der Phäaken gezeigt, das Odysseus nach Ithaka gebracht hatte. Das von Hephaistos ursprünglich für Zeus verfertigte Zepter des Agamemnon war zu Chäronea, sein Schild und sein Schwert in einem Apollotempel am Markte zu Sikyon; daselbst auch Mantel und Harnisch des Odysseus, Bogen und Pfeile des Teukros, das Gewebe der Penelope, das Gewand eines der Freier, Ruderstangen und Steuer der Argonauten, der Kessel, in dem die Glieder des alten Pelias aufgekocht worden waren, ein Stück der Haut des Marsyas u. a. Durch hohes Alter zu fabelhafter Winzigkeit zusammengeschrumpfte Mumien der Sibyllen wurden an mehr als einem Orte gezeigt. In einem Tempel in Lycien befand sich ein auf Papyrus geschriebener Brief des Sarpedon, worüber Plinius sich nur deshalb wundert, weil Ägypten, das Vaterland der Papyrusstaude, damals für Fremde noch nicht zugänglich war. Aber aus noch viel ferneren Zeiten gab es Reliquien, zu Panopeus in Phocis sogar Überbleibsel des Lehms, aus dem Prometheus Menschen formte, vor einer Kapelle dieses Halbgottes, sie rochen nach Menschenhaut; im Tempel von Samothrake Schalen, welche von den Argonauten geweiht waren. Vermutlich wurde nicht selten derselbe Gegenstand auch an zwei verschiedenen Orten gezeigt, wie das Haar, das Isis sich aus Schmerz über den Tod des Osiris ausgerissen hatte, zu Koptos und zu Memphis. In den beiden nicht sehr weit voneinander gelegenen Städten in Cappodocien und im Pontus, die den Namen Comana führten, sah man dieselben auf die taurische Artemis bezüglichen Altertümer in gleicher Vollständigkeit, namentlich hier wie dort das echte Schwert der Iphigenia. Selbst Orte der westlichen Länder hatten derartige Seltenheit aufzuweisen, die durch die Wanderungen der Helden oder auf andre Weise dorthin gekommen sein sollten. So war in Gades ein goldner Gürtel des Teukros, in Circeji eine Trinkschale des Odysseus, in Capua der Doppelbecher des Nestor. In Benevent sah noch Procopius die von dem angeblichen Gründer der Stadt Diomedes dort niedergelegten Hauer des Calydonischen Ebers, welche drei Spannen lang waren. Selbst in Barbarenländern stieß man auf Reminiszenzen aus der griechischen Sage, die natürlich erst von griechischen Reisenden dorthin gebracht, aber hier und da von den Landeseinwohnern festgehalten worden waren. So zeigte man auf der Insel Meninx (Djerba) an der kleinen Syrte außer andern Erinnerungen an Odysseus auch einen von ihm errichteten Altar; Schilde und Schiffsschnäbel als Erinnerungszeichen an die Irrfahrten des Odysseus sah Asklepiades von Myrlea in einem Athenatempel des südlichen Spanien, und von demselben Helden geweihte Altäre mit griechischen Inschriften zeigte man sogar am Niederrhein und in Schottland. Arrian sah bei der Mündung des Phasis einen eisernen Anker des Schiffes Argo, der ihm aber trotz seiner Größe und seines altertümlichen Aussehens zu modern erschien. Eher wollte er Überbleibsel eines andern, steinernen Ankers für echt halten. Im Kaukasus wurde ihm der Berg gezeigt, an den Prometheus geschmiedet gewesen war. Von der Stadt Apsarus in Pontus waren in Procops Zeit nur Ruinen übrig; doch zeigten die Eingeborenen dort noch damals das Grab des Bruders der Medea Apsyrtus. Joppe in Palästina galt allgemein als der Schauplatz der Befreiung der Andromeda durch Perseus; die Knochen des großen Meertiers, die diese Annahme veranlaßt haben mochten (und wegen deren die Juden die Geschichte des Propheten Jonas hierher verlegten), hatte zwar schon Scaurus nach Rom gebracht, aber noch in Josephus' Zeit zeigte man dort die Spuren von Andromedas Fesseln, noch in Pausanias Zeit ein blutfarbiges Wasser, in dem sich Perseus nach dem Kampfe mit dem Meerungeheuer gewaschen haben sollte.
Bei den Tempeln fanden die Fremden auch in der Regel für Bezahlung Führer (Periegeten) und Erklärer (Exegeten) der städtischen Sehenswürdigkeiten, falls sie nicht ein gefälliger Gastfreund damit bekannt machte. In Griechenland fehlten solche Erklärer auch in kleinen Städten nicht. Wie sicher man darauf rechnen konnte, sie an jedem fremden Ort zu finden, wo es etwas zu sehen gab, sieht man daraus, daß Lucian sie in seiner »Wahren Geschichte« auch den Besuchern der Unterwelt die Gründe für die Strafen der Verdammten angeben läßt. In der Regel versahen Priester und Tempeldiener dies Amt, und besonders angestellte Führer hatten wohl nur die größten und besuchtesten Orte. Unter diesen gab es zuweilen Männer von höherer Bildung, wie z. B. zu Hermione ein Oberarzt Perieget war; die meisten betrieben jedoch, wie sich erwarten läßt, ihr Geschäft handwerksmäßig. Wenngleich ihre Leitung den Reisenden oft erwünscht war, so konnten sie doch auch, besonders Gebildeten und zumal an Orten wie Athen und Olympia, zur Qual werden, wenn sie ihre auswendig gelernten Erklärungen und nach dem Geschmack der Menge erfundenen Geschichten in größter Ausführlichkeit hersagten oder Anweisungen zur Betrachtung der Kunstwerke gaben. Plinius erwähnt eine Hecatestatue im Artemistempel zu Ephesus aus einem Marmor von blendendem Glänze, welche die Tempeldiener den Fremden nicht lange anzusehen rieten, um ihre Augen zu schonen. Könnte man, sagt Lucian, die Sagen und Legenden aus Griechenland verbannen, so müßten die Führer Hungers sterben, denn das Wahre wollen die Fremden auch umsonst nicht hören. In einer der kleinen Schriften Plutarchs wird von einem Besuche berichtet, den eine Gesellschaft dem Tempel zu Delphi und seinen Sehenswürdigkeiten abstattet. Die Führer sind hier trotz aller Bitten nicht zu bewegen, ihre Erklärungen der Gegenstände, über deren Besichtigung man einig geworden ist, abzukürzen, und bestehen sogar darauf, die Inschriften vorzulesen; durch eine Frage aber, die außer der gewohnten Reihenfolge an sie gerichtet wird, geraten sie in Verwirrung und bleiben die Antwort schuldig.
In Griechenland und Kleinasien unterhielten die Führer die Reisenden ganz vorzugsweise mit Erinnerungen aus der Heroenzeit, für welche das Interesse lebhafter war als sonst irgendwo, und die (wie gesagt) einem großen Teil der Gebildeten näherstand als die historischen Zeiten. Dies zeigt sich auch in römischen Länderbeschreibungen überall. In der Erdbeschreibung des Pomponius Mela sind die mythologischen Reminiszenzen ungleich zahlreicher als die historischen. In der von Solinus benutzten, verlorenen Chorographie war außer Naturmerkwürdigkeiten besonders Mythologisches berücksichtigt. In dem den Itinarien angehängten Verzeichnisse der Inseln sind außer der Notiz, daß Paros einen sehr weißen Marmor liefert, alle übrigen mythologischen Inhalts, wie daß auf Samos Juno, auf Delos Apollo und Diana geboren seien, auf Naxos Ariadne von Theseus verlassen und von Bacchus gefunden wurde usw. Auch wo griechische Sagen im Orient lokalisiert waren, behaupteten sie sich mit auffallender Hartnäckigkeit: wie es die Memnonsage in Theben, die Prometheussage im Kaukasus, die Argonautensage in Kolchis, die Perseussage in Palästina beweisen. Tacitus übergeht selbst in seinem sehr kurzen Bericht über die Reise des Germanicus in Ägypten die Herleitung des Namens Kanobos von dem gleichnamigen Steuermann des Menelaus nicht. Aristides hörte allerdings von einem ägyptischen Priester, daß der Ort schon zehntausend Jahre vor der Landung des Menelaus so geheißen habe, und daß der ägyptische Name, dessen Hellenisierung Kanobos war, »goldner Boden« bedeute. Doch bei Griechen und Römern erhielt sich jene Sage, auch Ammianus Marcellinus wiederholt sie.
In Griechenland hatte es offenbar auch für römische Reisende hohen Reiz, sich die Sagen an Ort und Stelle erzählen zu lassen, die »das von so großer Liebe für die Altertümer erfüllte Volk einer ungewissen Vorzeit andichtete«. Auch wo Bauten, Ruinen und Denkmäler fehlten, wurden den Fremden die Spuren der Vergangenheit gewiesen. Fast überall hörte man nur von dem reden, was einst war, wie Aristides sagt; was man sagt, war etwa der Überrest eines Tropäum, ein Denkmal, eine Quelle, oder der Führer wies auf kaum sichtbare Spuren hin: dies sei das Gemach der Helena, oder der Harmonia, oder der Leda gewesen, und dergleichen mehr. Von diesem Tempel der Liebesgöttin zu Trözen schaute Phädra herab, wenn Hippolyt sich dort in der Rennbahn im Laufe übte; hier stand eine Myrte mit durchlöcherten Blättern, die Unglückliche hatte sie in ihrem Liebeswahnsinn mit einer Haarnadel durchbohrt. Auf diesem Steine am Hafen von Salamis hatte der alte Telamon gesessen und dem Schiffe nachgeblickt, das seine Söhne nach Aulis trug. In Aulis zeigte man eine Quelle, daneben hatte die Platane gestanden, auf der vor den Augen des versammelten Griechenheers eine Schlange den Sperling mit seinen neun Jungen fraß; ein Stück von ihrem Holze wurde dort aufbewahrt. Unweit Sparta stand an der Straße nach Arkadien eine Bildsäule der Schamhaftigkeit. Hier hatte Ikarios den Wagen eingeholt, auf dem Odysseus seine Tochter Penelope heimführte; er hatte die Einwilligung zu dieser Ehe bereut und beschwor nun die Tochter, ihn nicht zu verlassen; Odysseus hieß sie zwischen Gemahl und Vater wählen, statt der Antwort verhüllte sich Penelope. Ikarios kehrte allein zurück; die Stelle, an der die junge Gattin ihren Entschluß so kundgegeben, bezeichnete jenes Standbild. So konnte der Wanderer in dem Sagenreichen Lande kaum einen Schritt tun, ohne die Stätte eines denkwürdigen Ereignisses zu betreten, auch hier war »kein Stein ohne Namen«.
Natürlich fehlte es aber auch nicht an historischen Erinnerungen aus jüngeren Zeiten. Man besuchte die Wohnhäuser und Grabstätten berühmter Männer und andre Orte, die an sie erinnerten. Auch römische Reisende bewiesen ihre Pietät für ihr Andenken durch Opfer, die sie ihren Manen brachten. So hatte schon M. Acilius Glabrio im Jahre 191 v. Chr. den Öta bestiegen und an der sogenannten Pyra (dem Orte, wo sich Herakles verbrannt hatte) geopfert. Caracalla opferte, auch hierin Alexander den Großen nachahmend, am Grabe Achills bei Ilium, Trajan in Babylon in dem Hause, in dem Alexander der Große gestorben war, dessen Manen. Hadrian erneuerte das von der See zerstörte Grab des Ajax bei Troja, setzte auf dem des Epaminondas bei Mantinea einen Stein mit einer selbstverfaßten Inschrift, brachte ein Totenopfer am Grabe des Pompejus und stellte dessen Denkmal auf eine würdige Art wieder her. Germanicus brachte an allen Denkmälern berühmter Männer, die er berührte, Opfer; ein von ihm auf Hectors Manen verfaßtes Epigramm besitzen wir noch. Pausanias erwähnt als Grabmäler, die den Reisenden in Griechenland gezeigt wurden, das des Königs Kodros am Ilissus, des messenischen Helden Aristomenes in Rhodus, des Demosthenes auf Kalauria u. a. Jede Stadt hegte liebevoll das Andenken ihrer großen Männer und bewahrte sorgfältig ihre etwaigen Reliquien: so Theben außer dem Grabmal Pindars die Reste seines Hauses bei der Quelle Dirke. Cicero suchte in Metapont das Wohn- und Sterbehaus des Pythagoras auf, noch ehe er bei seinem dortigen Gastfreunde einkehrte. Keine Stadt war aber an großen Männern so reich wie Athen und gewiß auch keine eifriger bemüht, die Erinnerungen an sie festzuhalten; auf Schritt und Tritt sah man sich auf ihre Spuren gewiesen.
Doch das größte Interesse erregten in Griechenland vermutlich die Schlachtfelder und Lagerstätten aus den Perserkriegen. Auf der Ebene von Marathon sah man die Gräber und Denkmäler der gefallenen Helden sowie auch das des Miltiades und das marmorne Tropaion der Athener; in stiller Nacht vernahm man hier den Lärm wiehender Pferde und kämpfender Männer. Die Ruinen einiger von den Persern eingeäscherten Tempel standen noch in Pausanias Zeit. Doch wurden natürlich auch Punkte aufgesucht, die durch Ereignisse späterer Zeiten denkwürdig geworden waren. »Wir erblickten«, schreibt Arrian an den Kaiser Hadrian, »mit Freude das Schwarze Meer von derselben Stelle, von der es Xenophon sah und du.« Er fand dort Altäre von unbehauenem Stein mit schlecht und unorthographisch geschriebenen Inschriften und setzte marmorne Altäre und gute Inschriften an die Stelle.
Mit besonderer Vorliebe, so scheint es, verfolgte man in Griechenland und im Orient auch die Erinnerungen an Alexander den Großen, seine Züge und Taten. Noch in Plutarchs Zeit zeigte man eine alte Eiche am Kephissos, unter der bei der Schlacht von Chäronea sein Zelt stand; nicht fern davon war das gemeinsame Grab der Macedonier. Als König Mithridates in Phrygien einrückte, übernachtete er um der guten Vorbedeutung willen in derselben Herberge, in der einst Alexander eingekehrt war. Bei Tyrus wurde eine Quelle gezeigt, an der Alexander von dem Fang eines Satyrs träumte, was die Traumdeuter auf die Eroberung von Tyrus bezogen. Bei Minnagara (einer am untern Indus gelegenen Stadt) besuchte der ägyptische Kaufmann, der auf der Indienfahrt hier anlegte, die Stellen, wo Kapellen, Altäre, Fundamente von Lagern und tiefe Brunnen als Erinnerungen an den Aufenthalt des macedonischen Heeres gezeigt wurden. Die Gruft zu Alexandria, in der die von Ptolemaeus II. Philadelphus aus Memphis dorthin überführte Leiche Alexanders, in Honig aufbewahrt, in einem gläsernen Sarge ruhte und die vermutlich für die meisten Reisenden unzugänglich war, ließen wohl die römischen Kaiser, die dorthin kamen, niemals unbesucht. Erwähnt wird der Besuch der Gruft von Cäsar, von Augustus, von Septimius Severus, der sie verschließen ließ; nichtsdestoweniger besuchte sie auch Caracalla. Caligula hatte Alexanders Harnisch aus der Gruft nehmen lassen. Noch die Muhammedaner verehrten das Grab Alexanders zu Alexandria. »Wehe dir«, sagt Plinius in der Schilderung von Trajans Kriegsdiensten in fernen Ländern, »wie dir dort die heiligen Spuren großer Feldherren gezeigt wurden, so wird einst die Zeit kommen, wo die Nachkommen verlangen werden, zu sehen und ihren Kindern als sehenswürdig zu nennen das Feld, auf dem dein Schweiß geflossen, die Bäume, unter denen du gerastet, die Felsen, die deinen Schlummer beschützt, die Häuser, die dich als Gast aufgenommen haben«. Daß diese Prophezeiung wirklich in Erfüllung gegangen ist, bezeugt Ammianus Marcellinus, der bei seinem Bericht über den Marsch Julians durch die Euphratebene erwähnt, daß dort in der Stadt Ozogardana das Tribunal gezeigt wurde, von dem Trajan zu seinem Heere gesprochen hatte.
Erinnerungen aus der römischen Geschichte waren die einzigen, die Italien und die westlichen Provinzen zu bieten hatten, da dort eine Sagenperiode so gut wie ganz fehlte, und ohne Zweifel wurden auch diese eifrig aufgesucht. Man zeigte bei Laurentum den Ort, wo das Lager des Äneas gewesen war, Troja genannt, bei Liternum Ölbäume, die von dem ältern Scipio gepflanzt waren, und eine gewaltige Myrte, darunter eine Grotte, wo, wie es hieß, eine Schlange seine Manen bewachte; in Bajä Schmucksachen und ein Mäntelchen, das Tiberius als Kind von der Schwester des Sextus Pompejus zum Geschenk erhalten hatte, auf dem Boden der Aponusquelle bei Padua Würfel, die er hineingeworfen, auf Capri die Stelle, von wo er seine Opfer nach langen Martern hatte ins Meer stürzen lassen; das Haus des Horaz bei Tibur und allerwege die Geburtshäuser berühmter Männer, besonders der Kaiser. Obwohl Augustus zu Rom auf dem Palatin »zu den Ochsenköpfen« geboren und der betreffende Teil des Geburtshauses in eine Kapelle verwandelt worden war, galt doch in der ganzen Umgegend von Velletri ein kleiner, einer Vorratskammer ähnlicher Raum auf einem dortigen Landgute als sein Geburtsort, wo noch in Suetons Zeit jeder, der ohne Not und nicht mit reinem Sinne eintrat, angeblich durch Spuk bis zum Tode erschreckt wurde. Titus war in einem kleinen, dunkeln Zimmer eines schlechten Hauses am (älteren) Septizonium geboren, das noch in Suetons Zeit erhalten war und gezeigt wurde. »Das verehrungswürdige Haus, das so glücklich gewesen war, Domitians erstes Geschrei zu hören und seine ersten Kriechversuche zu sehen«, war von ihm in ein Heiligtum des Flavischen Geschlechts verwandelt worden und strahlte weit geöffnet ganz von Gold und Marmor. Das Haus des Pescennius Niger auf dem Juppiterfelde zu Rom wurde noch in Diocletians Zeit besucht und trug den Namen seines ehemaligen Besitzers. Seneca stellte in der Villa des Scipio Africanus bei Liternum eine Vergleichung der damaligen und der gegenwärtigen Zustände an, nachdem er den Manen des großen Mannes und seinem mutmaßlichen Sarge seine Verehrung bezeigt hatte. Er sah »die von Quadersteinen erbaute Villa, den Park von einer Mauer umgeben, von beiden Seiten Türme zum Schutz des Hauses errichtet, eine gewaltige Zisterne, in der Nähe Gebäude und Pflanzungen, ein kleines, enges, nach alter Sitte dunkles Bad«. »In diesem Winkel wusch der Mann, welcher der Schrecken Karthagos war, seinen von ländlichen Arbeiten ermüdeten Leib; denn er bebaute sein Land selbst. Unter diesem so geringen Dach hat er gestanden. Dieser schlechte Estrich hat ihn getragen« usw.
Es versteht sich von selbst, daß namentlich Geschichtsschreiber die Stätten der von ihnen darzustellenden Ereignisse zu sehen suchten; besonders gewissenhaft scheint hierin Sueton zu Werke gegangen zu sein. Appian hatte die Stelle bei Cajeta besucht, wo Cicero ermordet worden war, Plutarch das Schlachtfeld von Bedriacum und in Brixellum das Monument Othos gesehen.
Ebenso wurden auch von Juden und Christen in Palästina und anderwärts Erinnerungen aus der biblischen Geschichte überall aufgesucht. Josephus nennt als solche die Überbleibsel von Noahs Arche auf einem Berge in Armenien – andre wurden in einer Gegend von Adiabene gezeigt; die Salzsäule, in die Lots Weib verwandelt ward (er hatte sie selbst gesehen); bei Hebron die Gräber der Enkel Abrahams und eine riesige Terebinthe, die seit Erschaffung der Welt stehen sollte. Daß bei den seit dem Anfange des 4. Jahrhunderts häufigen christlichen Pilgerfahrten nach dem heiligen Lande kein Ort unbesucht gelassen wurde, an den sich Erinnerungen aus dem Alten oder Neuen Testament knüpften, versteht sich von selbst. Außer der Reiseroute für Pilger von Bordeaux nach Jerusalem im Jahre 333 ist an bezüglichen Mitteilungen auch der Bericht einer vornehmen, wahrscheinlich gallischen Pilgerin über ihre Fahrt nach den heiligen Stätten reich. Der Dornbusch, aus dem Gott im Feuer zu Moses sprach, befand sich damals in einem schönen Garten vor einer von Klöstern umgebenen Kirche, und man zeigte auch die Stelle, wo Moses gestanden hatte. Bei Carrhä in Mesopotamien zeigte man den Brunnen, aus dem die heilige Rebekka die Kamele des heiligen Abraham und den, aus welchem der heilige Jakob die Tiere der heiligen Rahel tränkte; daneben sah man den ungeheuren Stein, den der Heilige von dem Brunnen fortgewälzt hatte usw. Doch die Salzsäule, in welche Lots Weib verwandelt worden war, hatte die Pilgerin nicht gesehen, nur den Ort, wo sie gestanden haben sollte: sie wolle, sagt sie, ihre ehrwürdigen Schwestern hierüber nicht täuschen. Dagegen heißt es in der Beschreibung einer im letzten Viertel des 6. Jahrhunderts gemachten Pilgerfahrt: Lots Weib stehe noch, so wie sie war, und es sei eine falsche Angabe, daß sie von Tieren durch Lecken verkleinert werde.
b) Das Interesse für Kunst
Das historische Interesse, wie es bisher geschildert worden ist, überwog bei den Reisen der Römer jedes andre weit; und dies tritt auch in folgender Betrachtung eines römischen Dichters der frühen Kaiserzeit am Schlüsse eines Gedichts über die Wunder des Ätna unverkennbar hervor. Prächtige Tempel, merkwürdig durch Schätze und heilige Altertümer, zu schauen, ziehen wir durch Länder und Meere und bestehen Lebensgefahren; begierig forschen wir nach den Märchen alter Sage und wandern von Volk zu Volk. Jetzt freuen wir uns, die von den beiden unähnlichen Brüdern erbauten ogygischen Mauern Thebens zu sehen, und versetzen uns gern in jene fernen Zeiten, bewundern bald die Steine, die sich beim Klange des Liedes und der Lyra zusammenfügten, bald den Altar, von dem der Rauch des Doppelopfers getrennt aufstieg, dann die Taten der sieben Helden und wie Amphiaraus vom Abgrunde verschlungen ward. Dort fesselt uns der Eurotas und die Stadt des Lykurg und die heilige ihrem Führer in den Tod folgende Schar. Dann wird Athen besucht, stolz auf seine Sänger und seine siegreiche Göttin Minerva. Hier vergaß einst der treulose Theseus bei seiner Rückkehr das weiße Segel für seinen Vater aufzuziehen; auch Erigone, jetzt ein berühmtes Gestirn, ist ein Sang von Athen geworden; von dort stammte Philomele, die nun in gesangdurchtönten Wäldern, Procne, die an Dächern nistet, der wilde Tereus, der auf einsamen Feldern umherirrt. Wir bewundern die Asche Trojas und das mit Hector gefallene Pergamum, wir erblicken den kleinen Hügel des großen Hector, hier liegt auch der schnelle Achill und der Rächer des großen Hector.
Doch derselbe Dichter erwähnt nach dem historischen Interesse auch das Interesse an der Kunst als ein solches, das Reisen veranlaßte oder deren Richtung mitbestimmte. Er fährt fort: Ja auch griechische Gemälde und Bildwerke fesseln viele; bald die Anadyomene mit triefenden Haaren, bald die schreckliche Kolcherin, zu deren Füßen ihre Kleinen spielen, bald das Opfer Iphigenias mit dem verhüllten Vater, bald das berühmte Werk Myrons: diese Fülle der Werke und ihre Kunst zieht viele an, und du glaubst gefahrvolle Reisen zu Lande und zu Wasser machen zu müssen, um sie zu sehen.
Daß wißbegierige und um Bildung bemühte Römer auf ihren Reisen nicht versäumten, die Kunstwerke zu besichtigen, die namentlich Griechenland und Kleinasien in so großer Fülle besaßen, braucht nicht erst gesagt zu werden. Cicero rühmt von Pompejus, er habe sich in Griechenland durch nichts aufhalten lassen, nicht einmal sich Zeit genommen, Bilder und Statuen und die übrigen Zierden der griechischen Städte, die andre zu rauben pflegten, auch nur zu betrachten. Derselbe nennt eine Anzahl von Kunstwerken in Sicilien, die Verres geraubt und die sich vorher teils im Privatbesitz, teils in Tempeln befunden hatten: jeder Fremde war von den Einwohnern dahin geführt worden und hatte sie in Augenschein genommen. In der Kapelle des Hejus zu Messana war ein Eros von Praxiteles, ein Herakles von Myron, zwei Kanephoren von Polyclet. Jeder Römer, der nach Messana kam, ging dahin, um diese Werke zu betrachten, die täglich zu sehen waren, so daß das Haus ebensosehr der Stadt wie dem Besitzer zur Zierde gereichte. Alle Fremden, die nach Segesta kamen, besichtigten dort die Statue der Diana; als Cicero Quästor war, war sie das erste, was ihm gezeigt wurde. In Syrakus galt nichts für so sehenswert wie das Bild einer Reiterschlacht des Agathocles im Minerventempel usw. Neben den Studien des Plato, des Demosthenes und des Menander wollte sich Properz in Athen auch mit Betrachtung von Bildern und von Werken in Bronze und Elfenbein beschäftigen. Apulejus erwähnt, daß er auf dem Schilde der Athena auf der Akropolis den Porträtkopf des Phidias, den der Künstler dort angebracht, gesehen habe.
Besonders aber mußte man natürlich solche Kunstwerke aus eigner Anschauung kennen, die viel genannt und jedem Gebildeten dem Namen nach bekannt waren, wie die bedeutenderen Städte Griechenlands deren auch noch in der Kaiserzeit aufzuweisen hatten, wenn sich gleich ein Teil derer, die Cicero als Hauptzierden der Städte Griechenlands und Asias nennt, damals schon in Rom befand. Auch um ihretwillen wurden Reisen unternommen. Man besuchte in Ciceros Zeit Thespiä, das sonst durchaus nichts Sehenswürdiges besaß, einzig und allein, um den Eros des Praxiteles zu sehen, und um seiner Aphrodite willen, die manchen für das erste Kunstwerk in der Welt galt, hatten nach Plinius viele die Seereise nach Knidos gemacht. Ihr reiset nach Olympia, sagt Epictet, um den Zeus des Phidias kennenzulernen, und jeder von euch hält es für ein Mißgeschick, zu sterben, ohne ihn gesehen zu haben. Wenn diese Äußerung sich zunächst auch nur auf die Griechen bezieht und nur für diese gilt, so werden doch ohne Zweifel auch Römer nicht selten dieselbe Reise zu demselben Zweck gemacht haben.
Doch wie sehr das historische Interesse bei den Reisen der Römer das Kunstinteresse überwog, geht schon allein daraus hervor, daß jenes fast überall als das leitende hervortritt, dieses nur ganz gelegentlich und ausnahmsweise zur Sprache kommt. In der Tat war dieses Interesse meistens ein ganz oberflächliches und äußerliches, gewöhnlich durch den Namen des Künstlers und die Berühmtheit des Werkes bedingt. Man sah, um gesehen zu haben, und auch in dieser Beziehung glichen die Reisen der damaligen Römer denen der heutigen Engländer ebensosehr wie in dem eifrigen und gewissenhaften Aufsuchen historischer Erinnerungen. Wie sich Atticus bei Cicero über Athen äußert, so hat, wie wir nach allem annehmen dürfen, die große Mehrzahl der gebildeten Römer zu allen Zeiten empfunden. Orte, sagte er, an denen Spuren derer sind, die wir lieben und bewundern, machen einen gewissen Eindruck auf uns. Ja selbst meine Lieblingsstadt Athen erfreut mich nicht so sehr durch ihre griechischen Bauten und kostbaren Werke alter Künstler, als durch die Erinnerung an ihre großen Männer, wo sie gewohnt haben, wo sie zu sitzen, wo sie sich im Gespräch zu ergehen pflegten, und auch ihre Gräber betrachte ich mit Interesse.
c) Das Interesse für Natur und das Naturgefühl überhaupt
Ungleich mehr als das Kunstinteresse tritt bei den Reisen der Römer das Interesse an der Natur hervor: auch in allem, was sich auf Erholung des Gemüts und auf Genuß bezieht, sagt Atticus, hat die Natur den Vorrang. Doch zeigt sich dies Interesse meist als ein von dem modernen sehr verschiedenes. Es war ebenfalls sehr häufig kein unmittelbares, sondern hervorgerufen und bestimmt durch Berühmtheit, Seltenheit und Ungewöhnlichkeit, endlich durch Heiligkeit der betreffenden Gegenstände und Erscheinungen.
Das antike Naturgefühl unterscheidet sich von dem modernen am meisten durch seinen religiösen Charakter. Bedeutende Naturerscheinungen ergriffen die Gemüter der Alten mit einer andern Macht als die der Neueren, sie fanden sich hier einem göttlichen oder dämonischen Walten gegenübergestellt, und zu Staunen und Verwunderung gesellte sich immer religiöse Verehrung. Während aber die Phantasie der Griechen die Erscheinungen und Wirkungen der Natur zu göttlichen Personen gestaltete und sie so der menschlichen Empfindung nahe brachte, blieb den Italikern die Gottheit, wenn auch allgegenwärtig, dennoch geheimnisvoll und fremd. Sie erfaßten sie als ein die ganze Natur erfüllendes »Fluten und Weben unpersönlichen Geistes«, das aber keine feste Gestalt gewann. Der fromme Sinn, der überall und in jedem Moment die Einwirkung schützender und erhaltender Mächte empfand, wurde am stärksten durch die Eindrücke der freien Natur angeregt. »Wo immer ein heimlicher Platz liebe Erinnerungen weckte, eine schöne oder erhabene Aussicht die Seele beschwingte, eine fruchtbare Trift oder ein wohlbestellter Acker die Vorstellung göttlichen Segens erregte, liebte man es durch einen einfachen Altar und das Bild einer Schlange an die höhere Ursache und die verborgene Seele des Ortes ( genius loci) zu erinnern.« Wie sehr auch der alte Götterglaube sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hatte, das religiöse Gefühl der Natur gegenüber war den Römern zu jener Zeit so wenig wie den Griechen verlorengegangen: blieben doch auch die Erscheinungen, die es hervorriefen, immer dieselben und wirkten immer von neuem mit der alten Gewalt auf das menschliche Gemüt.
Von zahlreichen Äußerungen römischer Schriftsteller und Dichter aus jener Zeit, in denen dies religiöse Naturgefühl sich offenbart, mag hier nur eine von Seneca stehen. »Erblickst du einen Hain von dichtstehenden, alten, über die gewöhnliche Höhe aufragenden Bäumen, wo die Masse des über- und durcheinander sich erstreckenden Gezweiges den Anblick des Himmels ausschließt, dann gibt der riesige Baumwuchs, das Geheimnis des Orts und die Bewunderung des im offenen Felde so dichten und zusammenhängenden Schattendunkels dir das Gefühl von der Gegenwart einer Gottheit. Und wenn eine Grotte mit tief ausgefressenem Felsgestein sich in einen Berg hineinerstreckt, keine künstliche, sondern durch natürliche Ursachen zu solcher Weite ausgehöhlt, so wird sie dein Gemüt mit der Ahnung von etwas Höherem ergreifen. Wir verehren die Ursprünge großer Flüsse; wo ein gewaltiger Strom plötzlich aus dem Abgrunde hervorbricht, stehen Altäre, heiße Quellen haben ihren Gottesdienst, und manche Seen werden wegen ihres dunkeln oder unermeßlich tiefen Wassers für heilig gehalten.« In der Einsamkeit und Stille der Natur, wo man sich der Gottheit näher, von ihrem Walten unmittelbar berührt und ihres Schutzes bedürftiger fühlt, regten sich religiöse Empfindungen eben öfter und stärker als in dem Lärm und Gewühl der Städte, und vor dämmernden Grotten, alten Bäumen, eingehegten Hügeln verweilte der Wanderer oft in unwillkürlicher Andacht. So suchte man Orte, die sich durch eine großartige oder schöne Natur auszeichneten, nicht bloß auf, um sich an ihrem Anblick zu erfreuen, sondern zugleich um die Gottheit, der sie geweiht waren, zu verehren.
»Ganz besonders fand das lebendige Wasser, wo es ohne menschliche Vorrichtung zutage kommt, wie die Juristen sagen, als caput aquae eine perpetua causa hat, eine allgemeine, das Heidentum sogar überdauernde Verehrung.« Man bewies diese durch Hineinwerfen frommer Spenden, namentlich Münzen, die, wie bemerkt, noch jetzt auf dem Boden von Flüssen und Quellen häufig gefunden werden, und durch die Erbauung von Kapellen und Heiligtümern. So stand an den Quellen der Seine ein, wie es scheint, zu Ende des 1. Jahrhunderts gebauter Tempel, ein namentlich von Kranken, die hier Heilung suchten, vielbesuchter Wallfahrtsort. So erhob sich über der kristallhellen, in reichlichster Fülle sprudelnden Quelle des Djebel Zaghuan, welche die von den Arabern unter die Weltwunder gezählte, wohl von Sever und Caracalla erbaute Wasserleitung des römischen Karthago speiste, ein großartiger Tempel, der, mit einer weiten Halbkreisnische sich an die steile Felswand lehnend, mit seiner Öffnung »die lieblichste aller Gegenden überschaute«, und von dem noch imposante Ruinen übrig sind. So zog die Quelle des Clitumnus in Umbrien die Besucher ebensosehr durch ihre Heiligkeit wie durch ihre Schönheit an. Unter einem mit Zypressen bestandenen Hügel strömte sie hervor, eiskalt und von durchsichtigem Grün, in dem sich die Eschen der beiden Ufer spiegelten, und erweiterte sich bald zum schiffbaren Flusse, der von Landhäusern eingefaßt war. Ein alter Tempel und viele Kapellen (von denen eine, etwa in der Zeit des Theodosius für den christlichen Gottesdienst geweiht, noch existiert) standen am Ursprünge; Wände und Säulen waren von den Besuchern vollgeschrieben, die sich hier offenbar besonders zahlreich einfanden, auch Caligula machte einmal einen Ausflug nach Mevania, um den Hain und den Strom des Clitumnus zu sehen. Aber ohne Zweifel wurden auch andere schöne und merkwürdige Flüsse und Quellen viel besucht. Vom Po sagt der ältere Plinius, er entspringe aus einer sehenswürdigen Quelle.
Unter den Grotten und Höhlen waren die berühmtesten die korykische am Parnaß, die Pausanias die größte und sehenswürdigste von allen nennt, die er gesehen, und die gleichnamige bei der Stadt Korykos in Cilicien, diese letztere offenbar keine eigentliche Höhle, sondern eine überwölbte Felsschlucht, wie man sie in Süddeutschland mit dem Namen »Klamm« bezeichnet; drei andere große und merkwürdige, verschiedenen Göttern geweihte Höhlen in Kleinasien beschreibt Pausanias. Daß das Naturgefühl der Alten in diesen kühnen Wölbungen mit ihren wunderlichen Stalaktiten und anderen seltsamen Gesteinbildungen Wohnungen von Göttern (besonders von Nymphen) zu erkennen, daß man in dem Rauschen von der Decke herabtropfender oder tief unten strömender Wasser Klänge einer dämonischen Musik zu vernehmen glaubte, daß man in dem geheimnisvollen Dämmerschein oder dem von Fackellicht schwach erleuchteten Dunkel sich von unbestimmter Angst erfaßt fühlte, ist begreiflich. Das Innere der korykischen Grotte in Cilicien war nach Pomponius Mela zu schauerlich, als daß jemand darin hätte vordringen können, und blieb daher unbekannt. Wohl alle größeren Grotten waren bestimmten Gottheiten geweiht, deren Bilder auch darin standen.
Ebenso natürlich ist die Verehrung der Haine und Bäume, die sich durch Uralter und riesigen Wuchs auszeichneten. Einst, sagt Plinius, waren Bäume die Tempel der Götter, und noch jetzt weihen nach altem Brauch die einfachen Landbewohner einen hervorragenden Baum einem Gotte, und wir verehren Bilder, die von Gold und Elfenbein funkeln, nicht mehr als Haine und das in ihnen herrschende Schweigen. In der Tiefe der Haine und Wälder regte sich vor allem jenes geheimnisvolle Bangen, das den Alten die Nähe der Gottheit verkündete. Pausanias zählte die ältesten, in die graue Vorzeit hinaufreichenden Bäume in Griechenland auf, wie die Weide auf Samos, die Eiche zu Dodona, den Ölbaum auf der Akropolis zu Athen. Auch die Palme des Apollo auf Delos, die bereits Odysseus bewunderte, stand noch in Plinius' Zeit. In der Tat reicht die natürliche Lebensdauer auch der Dattelpalme nicht so weit, und seit Odysseus Zeiten hatte mehr als ein neues Exemplar das alte ersetzen müssen. Plinius nennt auch die ältesten Bäume in Rom, einen Lotosbaum auf dem Volcanal, der älter sein sollte als die Stadt selbst; eben dort eine gleichaltrige, in der letzten Zeit Neros umgestürzte Zypresse, einen Lotosbaum in dem Hofe des 375 v. Chr. gegründeten Lucinatempels, der dort schon vor dessen Erbauung gestanden und ein Alter von rund 500 Jahren haben sollte, und andere; ebenso gedenkt er der ungeheuersten, in deren Höhlungen zum Teil mehrere Menschen Platz hatten. Solche Bäume, wie die sogenannte schöne Pinie am Ida von etwa 70 Meter Höhe, die schon der erste Attalus von Pergamum beschrieben hatte, wurden offenbar viel besucht, besonders aber gewaltige Platanen. »Was konnte in den dürren Felsenlabyrinthen südlicher Sonnenländer erwünschter sein, ja mehr zur Andacht und Bewunderung stimmen, als der Baum, der mit herrlichem, hellem Laube an grünlich-grauem Stamme, mit schwebenden, breiten, tief ausgezackten Blättern, murmelnde Quellen und Bäche beschattet und noch heute den Ankömmling empfängt, wie er vor Jahrhunderten die Voreltern empfangen und mit Kühlung erquickt hat?« Pausanias erwähnt unter andern uralten Platanen auch die bei Kaphyai in Arkadien von Menelaus, nach andern von Agamemnon gepflanzte. »Griechenland hatte den Baum und die Freude an ihm aus Asien überkommen, wo die Platane wie die Zypresse von alters her bei den baumliebenden Iraniern und den vorderiranischen Stämmen Kleinasiens in religiöser Verehrung stand.« In Aulocrene in Phrygien zeigte man noch in Plinius' Zeit die Platane, die Apollo wegen ihrer Höhe gewählt hatte, um den Marsyas daran aufzuhängen. Eine der größten stand in Lycien, ohne Zweifel gleichfalls durch den Mythus geheiligt, wie immer an einer Quelle; die Weite ihrer Höhlung betrug 24 Meter, obgleich die Krone noch so kräftig grünte, daß sie ein breites, undurchdringliches Schattendach bildete; der Konsul Licinius Mucianus, »als er in dieser Platane mit achtzehn Gästen gespeist und nach dem Schmause geruht, gestand, daß sie ihm eine schönere Umgebung gewährt habe, als die gold- und bildgeschmückten Marmorsäle Roms bieten konnten«. Bei Gortyn auf Kreta stand die angeblich immergrüne Platane, unter welcher der Sage nach Zeus die Europa umarmt hatte; sie war in lateinischen und griechischen (vermutlich an ihrem Stamm befestigten) Gedichten gefeiert.
Ein zweites Moment, das auf den Ruf der Sehenswürdigkeit einer Lokalität wesentlichen Einfluß übte, war Berühmtheit, die sie der Poesie und Literatur verdankte. Durch Einflüsse, wie sie der Titan Jean Pauls mindestens bis in das 4. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts auf den Besuch der Borromeischen Inseln und der Insel Isch, und in weit höherem Grade die Dichtungen Walter Scotts auf den der schottischen Hochlande geübt haben, ist die Richtung der römischen Reisen offenbar sehr häufig bestimmt worden. War die Schilderung einer Gegend erst zum Lieblingsthema der Schriftsteller und Dichter geworden, dann vermehrten diese Schilderungen gewiß die Zahl ihrer Besucher; und dies war auch bei einem großen Teil der eben genannten Orte und Sehenswürdigkeiten der Fall. In der Beschreibung, die Pomponius Mela von der korykischen Höhle in Cilicien gibt, klingen Reminiszenzen an poetische Schilderungen durch; ebenso bei Plinius in der des Tempetals, »zu dessen beiden Seiten sanft geneigte Wände in unabsehbare Höhe hinaufragten; die schmale Sohle durchströmte der Peneus, zwischen grasigen Ufern inmitten eines schönen Hains, Vogelgesang tönte aus den Wipfeln der Bäume«. Das Tempetal war auch unter den Gegenden, mit deren Nachahmungen Hadrian seine Villa bei Tibur schmückte. Seneca erkundigte sich bei seinem Freunde Lucilius, nachdem dieser ganz Sicilien bereist hatte, nur nach der Natur des ganz allein durch die Dichtung berühmt gewordenen Charybdisstrudels; daß die Scylla ein ungefährlicher Fels sei, wußte er bereits. Noch Hieronymus erwähnt in einem kurzen Bericht über seine Reise aus Italien in den Orient, daß er bei Rhegium an der Scylläischen Küste sich die alten Sagen erzählen ließ, von der gefährlichen Fahrt des Odysseus, den Gesängen der Sirenen und dem unersättlichen Schlunde der Charybdis. Das Reisen, sagt Seneca an einer andern Stelle seiner Briefe, wird dir Kenntnis von Völkern verschaffen, wird dir neue Gebirgsformen zeigen, unbekannte Ausdehnungen von Ebenen, von unversieglichen Wassern durchrieselte Täler oder die merkwürdige Natur irgendeines Flusses: möge er nun wie der Nil in sommerlicher Anschwellung wachsen, oder wie der Tigris sich dem Blicke entreißen und nach unsichtbar vollbrachtem Laufe zu ungeschmälerter Größe sich wiederherstellen, oder wie der Mäander, ein Gegenstand für Spiel und Übungen sämtlicher Dichter, sich in häufigen Windungen schlängeln und oft, bis an sein eigenes Bett herangewunden, wieder umbiegen, bevor er in sich selbst fließt: übrigens wird es dich weder besser machen noch vernünftiger. Man sieht, diese Flüsse sind genannt, nicht weil sie durch die Schönheit ihrer Ufer, sondern weil sie durch ihre Größe, ihre Berühmtheit und merkwürdige Phänomene interessieren. Sidonius Apollinaris beschreibt seine Reise nach Rom einem Freunde, der sich erkundigt hatte, welche berühmten Städte, Schlachtfelder, heiligen Berge oder »durch die Gesänge der Dichter verherrlichten Ströme« er gesehen habe. Weil wir zu Großem geboren sind, sagt der Verfasser der Schrift vom Erhabenen, bewundern wir nicht die kleinen Flüsse, wenn sie auch klar und nützlich sind, sondern den Nil, die Donau und den Rhein, noch weit mehr aber den Ozean. Jenes Verschwinden des Tigris »tief in gähnender Kluft« und »sein Fortströmen unter dem Boden« scheint so wie ähnliche (wirkliche oder gefabelte) Phänomene an anderen Strömen auch die dichterische Phantasie viel beschäftigt zu haben. Die angeführten Worte sind Versen Neros entlehnt; außerdem haben wir Beschreibungen desselben Gegenstandes von Lucan und dem Verfasser einer griechisch geschriebenen poetischen Erdbeschreibung, Dionysius unter Hadrian.
Dies führt auf ein drittes, hier in Betracht zu ziehendes Moment, das ebenfalls bei mehreren schon genannten Punkten zur Erhöhung der Sehenswürdigkeit beitrug: die Anziehung, die alle abnormen, seltenen, von der Regel abweichenden Naturerscheinungen übten. Von den schwimmenden Inseln im vadimonischen See bei Ameria sagt der jüngere Plinius, wie bereits angeführt ist, eine solche Naturmerkwürdigkeit lasse man in Italien unbeachtet, während man Reisen mache und Seefahrten unternehme, um ähnliche, nicht sehenswertere Phänomene in andern Ländern kennenzulernen. Römer und Griechen, die sich in den westlichen Provinzen aufhielten, reisten nach Gades oder an die Westküste von Gallien, um die Ebbe und Flut des Atlantischen Ozeans zu sehen; in Gallien reiste in dieser Absicht Lucians Freund Sabinus. Auch Philostrat hatte dies Schauspiel hier gesehen; nach Gades läßt er ebendeshalb seinen Apollonius reisen und berichtet von dort die auch jetzt in Küstengegenden heimische Sage, daß Todkranke während der Flutzeit nicht sterben können, erst mit dem Eintritt der Ebbe verläßt die Seele den Körper. Strabo, Apulejus und Cassius Dio beschreiben aus eigener Anschauung einen Schlund bei Hierapolis in Phrygien, aus dem kohlensaure Dämpfe aufstiegen, die alle Menschen und Tiere töteten (mit Ausnahme, wie dort behauptet wurde, von Eunuchen); sie hatten mit Vögeln und andern Tieren Experimente angestellt. Wie sehr der Ort besucht war, geht daraus hervor, daß man einen eigenen Bau zum bequemeren Betrachten dieses Phänomens errichtet hatte; dieses Theater, wie Cassius Dio es nennt, scheint erst nach Strabos Zeit erbaut worden zu sein, der es nicht erwähnt; noch im 6. Jahrhundert wurde das Phänomen beobachtet. Es versteht sich von selbst, daß alle solche Orte, aus denen tödliche Dünste aufstiegen und die dem Volksglauben als Eingänge zur Unterwelt galten ( Averni, Χαρώνεια), eine ähnliche Beachtung fanden: zu diesen gehörte der noch heute Lago d'Averno genannte See bei Cumä, wo in alter Zeit ähnliche Erscheinungen beobachtet worden sein sollen wie jetzt an der dortigen Solfatara, und der durch Vergil, welcher dort seinen Äneas in die Unterwelt hinabsteigen läßt, weltberühmt geworden ist. Doch auch nur die berühmtesten wirklichen oder eingebildeten, oder doch fabelhaft ausgeschmückten Naturerscheinungen, die von Reisenden aufgesucht wurden, aufzuzählen, würde unmöglich sein; Beispiele zu häufen ist um so überflüssiger, als mehreres Derartige bereits früher erwähnt ist.
Das unmittelbare Interesse an der Natur tritt zunächst in der so lebhaften und so verbreiteten Vorliebe der Römer für das Landleben hervor. War diese freilich auch durch die Ungesundheit Roms im Sommer wesentlich mit bedingt, so hatte sie doch nicht minder ihren Grund in dem Verlangen, aus dem Dunst und Staube, dem Lärm und Getümmel, dem Brausen und Tosen der Stadt in die Einsamkeit, Stille und Frische der ländlichen Natur zu entfliehen und sich, wie ein griechischer Schriftsteller sagt, die Erquickung zu verschaffen, die der Anblick der Fluren zu gewähren pflegt: und wie oft regte sich dann bei der Vergleichung von Stadt und Land das Gefühl, daß gegenüber dieser immer gleichen Fülle, Pracht und Herrlichkeit alles Menschenwerk armselig und gering sei. Allerdings sind manche derartige Äußerungen des Naturgefühls unter dem Einflusse hellenistischer Poesie entstanden; auch gehörte die Vergleichung von Stadt und Land, wie ohne Zweifel die eng damit zusammenhängenden von Kunst und Natur, Überkultur und Ursprünglichkeit, zu den Gemeinplätzen der Rhetorenschulen. Doch läßt sich bei mehreren der hervorragendsten römischen Schriftsteller und Dichter ein echtes und inniges Naturgefühl nicht verkennen. Das Land, sagt Varro, hat uns die göttliche Natur gegeben, die Städte hat menschliche Kunst erbaut: er mochte lieber die Obstkammern in der Villa des Scrofa als die Bildergalerie in der des Lucullus sehen. Auch Lucrez war zufrieden, am Wasserbach im weichen Grase unter den Zweigen eines hohen Baums zu liegen, wenn die Jahreszeit lachte und die grünen Wiesen mit Blumen bestreute, während andre in prachtvollen, von Gold funkelnden Sälen bei Lampenschein unter dem Klange der Saiteninstrumente schmausten. Atticus sagt bei Cicero, er könne sich am Anblick der Inseln im Fibrenus nicht satt sehen und verachte dabei prächtige Villen mit ihren marmornen Fußböden und Felderdecken; wer wollte nicht der gegrabenen Kanäle (in den Gärten) spotten, wenn er diesen Strom sähe! Ganz ähnlich heißt es bei dem ältern Seneca: Kaum kann ich glauben, daß einer von denen, die in ihren Häusern Wälder, Meere und Flüsse nachahmen, jemals wirkliche Wälder oder weite grüne Fluren gesehen hat, auf die ein reißender Strom herabstürzt oder durch die er in der Ebene fließend ruhig dahinwallt; daß sie das Meer von einer Höhe gesehen haben, wenn es still daliegt oder im Winter durch Stürme von Grund aus aufgewühlt ist. Denn wer, der die Wirklichkeit kennengelernt hat, möchte seinen Geist an so Wertlosem ergötzen?
Allbekannt ist, wie Vergil die Landbewohner glücklich preist, wenn sie sich ihres Glücks nur bewußt wären; sein Verlangen nach der friedlichen Stille, der Reinheit und Sorglosigkeit des Landlebens; seine Freude an Tälern, die kalte Ströme erfrischen, an Wäldern, Fluren, Grotten und Seen, dem Gebrüll der Rinder, dem Schlummer unter Bäumen; seine Sehnsucht nach den in griechischer Dichtung gepriesenen Auen des Spercheus, den kühlen, von gewaltigen Laubdächern beschatteten Schluchten des Taygetus und Hämus. Vor allen andern aber hat das Land im Gegensatze zur Stadt Horaz gepriesen. Dort im Walde, am Ufer der Bäche, unter moosigen Felsen ward ihm erst wohl. Dort war der Winter lau, die Sommerhitze durch frischen Hauch gekühlt, der Schlaf ungestört; wieviel schöner das Grün des duftenden Grases als buntes Gestein, wieviel reiner die mit Gemurmel herabrinnende Quelle als das in Bleiröhren fließende Wasser der städtischen Leitungen! In demselben Sinne rühmt Properz die Pracht der sich selbst überlassenen Natur im Gegensatz zu der künstlich verschönerten, die prangenden Farben der Wiesenblumen, den kräftigen Wuchs des Efeus, des Baums in einsamer Felsschlucht, den Bach, der seinen eigenen Lauf nimmt, das von bunten Steinchen schimmernde Ufer. Auch Martial, der ein großer Freund des Landlebens war, hat ein Wort der Sympathie für die »wahre und von keiner Kultur berührte Ländlichkeit«. Ebenso bedauert Juvenal die Verkünstelung der Nymphengrotte im Hain der Egeria: wieviel unmittelbarer würde man die Nähe der Gottheit der Quelle empfinden, wenn grüner Rasen sie einfaßte und nicht Marmorbekleidung den natürlichen Tuffstein entstellte. Die Herrlichkeit der Natur im Gegensatz zu allem von Menschen Geschaffenen haben aber nicht bloß die römischen Dichter mit Vorliebe besungen, auch die Prosaschriftsteller gedenken gern der Erfrischung, die es gewährt, den Blick auf dem »schweigenden Grün, dem vorüberströmenden Flusse ruhen oder in die weite Ferne schweifen zu lassen; dem Gesange der Vögel, dem Murmeln oder Brausen der Wellen zu lauschen, den labenden Lufthauch zu atmen, in Einsamkeit und Stille die Stunden zu verträumen«; und allgemein galt den Römern die Natur als die wahre Geburtsstätte der Dichtung sowie der Gedanken.
Diese Liebe der Natur bekundete sich aber auch in der Anlage der Stadtwohnungen der Reichen und Vornehmen, zu deren Vorzügen vor allem sowohl Gärten als schöne Aussichten gerechnet wurden. Nach Plinius wäre die Anlage von Gärten bei Stadtwohnungen zuerst von Epicur eingeführt worden. Wenn diese Nachricht auch vielleicht nicht zuverlässig ist, so darf man doch annehmen, daß die Sitte sich in der Diadochenperiode ausgebildet hat, in der sich ein dem modernen bis zu einem gewissen Grade verwandtes Naturgefühl entwickelte. Auch bei der Anlage von Wohnhäusern trug diese Epoche dem Bedürfnisse nach Naturgenuß Rechnung. Ihr gehört wahrscheinlich die Erfindung der kyzikenischen Zimmer und Speisesäle an. »Diese Räume waren nach Norden orientiert, und in der Mitte mit einer Tür, zu beiden Seiten mit Türfenstern versehen und gestatteten somit von den zwei in ihnen befindlichen Triclinien nach allen Richtungen die Aussicht in das Freie. Man sieht hieraus deutlich, wie sie recht eigentlich auf den Naturgenuß in der Sommerzeit berechnet waren. Vitruv erwähnt diese Räume als Bestandteile des griechischen Wohnhauses, gibt aber zugleich an, daß sie bisweilen, wenn auch zu seiner Zeit nur selten, in italischen Häuseranlagen Platz fanden. Mit dem zunehmenden Steigen des hellenistischen Einflusses wurden auch die kyzikenischen Speisesäle in Italien häufiger. Räume dieser Art fanden sich in zwei Gärten des jüngern Plinius. Gärten und Parks hatten die Stadtwohnungen der Römer mindestens schon in Sullas Zeit. Die sechs Lotosbäume im Garten des Redners Crassus auf dem Palatin wurden im Jahre 92 v. Chr. ebenso hoch wie der Palast, zu dem sie gehörten, auf 3 Millionen Sesterzen (652.500 Mark) geschätzt. Ciceros Freund Atticus hatte sein Haus auf dem Quirinal, das früher einem Tamphilus gehört hatte, von einem mütterlichen Oheim geerbt; die Hauptschönheit desselben bestand in einem Park. Nach Sallusts Hyperbel von Palästen, »die nach Art ganzer Städte gebaut seien«, darf man vermuten, daß weitläufige Gartenanlagen damals in Rom nicht selten waren. Auch Horaz spricht wiederholt von kleinen Wäldern und Hainen zwischen den bunten Säulen der Peristylien; ein Haus wurde gelobt, welches auf weite Felder sah. Je länger je mehr strebten die Reichen und Großen, auch in ihren Stadtwohnungen soviel wie möglich die Annehmlichkeiten der Villen zu vereinigen. Martial beschreibt den auf einem der höchsten Punkte Roms gelegenen Petilianischen Palast: man konnte dort den Landaufenthalt in der Stadt genießen, die Lese im Weingarten war größer als auf einem falernischen Hügel, es gab hinreichenden Raum zur Spazierfahrt im leichten Wagen innerhalb der Hausschwelle, und kein Straßenlärm, keine zu früh eindringende Tageshelle störte den Schlaf. Bei Philostrat sagt der Besitzer eines prächtigen Hauses auf Rhodus, dessen Erbauung an 24 Talente (ungefähr 113.000 Mark) kostet, er werde wenig auszugeben brauchen, denn es seien Wandelbahnen und Haine darin. In diesen Wandelbahnen werden die auch in öffentlichen Portiken gewöhnlichen Angaben ihrer Länge nach Fuß, und wieviel Male man sie auf und ab schreiten mußte, um eine Strecke von 1000 Schritt (eine Miglie) oder eine größere zurückzulegen, nicht gefehlt haben. Selbst aus Badezimmern wollte man eine weite Aussicht haben; Seneca sagt, daß die verwöhnten Reichen Bäder ohne große, helle Fenster, in denen man nicht aus der Badewanne auf Felder und Meere blicken konnte, Bäder für Nachtschmetterlinge nannten. Das goldene Haus Neros, das der Inbegriff aller erdenklichen Pracht und Herrlichkeit werden sollte, erregte weniger durch Gold und Edelsteine, »eine längst gewöhnliche Art des Luxus«, Bewunderung, als »durch Fluren und Teiche, durch Nachahmungen der Einsamkeit der Wälder und der freien Natur und durch Fernsichten«. In einer Erörterung der Servituten von Grundstücken bei einem Juristen des 2. Jahrhunderts heißt es, sie beständen nicht in Leistungen, sondern in Zulassungen oder in Unterlassungen, also z. B. nicht darin, daß jemand in seinem Gebäude Malereien ausführe oder einen Garten anlege oder eine schöne Aussicht herstelle.
Wenn man nun schon die Aussichten bei Stadtwohnungen so hoch schätzte, so wurden um so mehr Villen auf hohen Punkten angelegt, die weite, heitere und mannigfaltige Aussichten beherrschten. Martial rühmt die auf dem Monte Mario gelegene Villa seines Freunds Julius Martialis vor allem wegen ihrer reichen Aussicht. Man überblickte von dort ganz Rom und die Campagna bis zum Albaner-Gebirge mit den darin zerstreut liegenden Ortschaften und den großen, vom Wagenverkehr belebten Landstraßen, sowie den Tiber bis Ponte Molle mit den stromabwärts gleitenden und stromaufwärts gezogenen Fahrzeugen. Die Lage der toscanischen Villa des jüngeren Plinius kann als Beispiel einer in römischem Sinne vollkommen schönen Binnenlandschaft dienen. Man überschaute von hier eine weite Ebene, die wie ein ungeheures Amphitheater ringsum von den Vorbergen des Appennin eingerahmt war; von den höheren Gipfeln zogen sich alte dichte Wälder herab, dazwischen fruchtbare, mit dem üppigsten Kornwuchs prangende Abhänge, unter diesen Weinberge, endlich Felder und Wiesen von schönstem Grün und buntester Blumenfülle, denn durch die ganze Ebene strömte der Tiber und überdies zahlreiche Bäche. Es war ein großer Genuß, diese Gegend von der Höhe aus zu betrachten, man glaubte nicht eine wirkliche Landschaft, sondern ein schönes Bild zu sehen, überall erfreute sich das Auge an der Mannigfaltigkeit, an den Linien und Umrissen, die sich ihm darboten.
Kaum wird man in der antiken Literatur eine Landschaft gelobt finden, der das Wasser mangelt, wie dies im Süden durchaus natürlich ist. Es war nicht bloß der erquickende Blick auf die grenzenlose azurne Fläche des Meers, auf die blauen und grünen Spiegel der Seen, die silberhellen Windungen der Bäche und Flüsse, die weißschäumenden Wasserstürze: es war auch die erfrischende Kühlung, die von den Wassern herwehte, die ihre Nähe so begierig aufsuchen ließ. Noch mehr, das Wasser ist in der südlichen Landschaft das eigentlich belebende Element; wo es fehlt, herrscht Dürre und Öde. An seinen Ufern ist das Grün am frischesten, das Laub am üppigsten, gewähren die Baumwipfel den dichtesten Schatten. Was kann schöner genannt werden als die Gewässer? fragt Petron. Ufer von Landseen, enge, von Bächen durchrieselte Täler und Schluchten, weite, lachende, von Flüssen durchströmte Ebenen zogen die Freunde der Naturschönheit vor allem an.
Das Tempetal, ein Ideal schöner Landschaft im Sinne der Alten, »vereinigt in seltener Weise den Charakter der Anmut eines Flußtals mit dem der Wildnis und Großartigkeit einer tiefen Felsschlucht«. Der Fluß Peneus tritt hier in eine anderthalb Stunden lange, durch die fast unmittelbar an sein Bett herantretenden Abhänge des Ossa und Olymp gebildete Schlucht, die auf beiden Seiten von beinahe senkrechten, zerklüfteten, malerisch mit Grün bewachsenen Felsenmauern eingefaßt ist. Die Abhänge des Olymp fallen fast durchweg schroff ab; dagegen ist am rechten Ufer meist ein schmaler Saum fruchtbaren Landes, der sich manchmal zu kleinen Ebenen erweitert, welche von zahlreichen Quellen erfrischt, mit üppigem Rasen bedeckt, von Lorbeer, Platanen und Eichen beschattet sind. Der Fluß fließt in stetem und ruhigem Lauf, hier und da eine kleine Insel bildend, bald breiter, bald durch die vortretenden Felsen in ein schmales Bett gedrängt, unter einem Laubdache mächtiger Platanen, durch welches die Sonnenstrahlen nicht hindurchdringen, dahin.
So erscheint in allen Naturschilderungen der Alten die Verbindung von Vegetation und Wasser als Haupterfordernis landschaftlicher Schönheit. Das schattige Tal des Horaz im Sabinergebirge, sein »süßes Versteck«, verdankte seinen Hauptreiz dem Quell Bandusia, dessen plaudernde Wellen von hohlen Steinen herabhüpften, auf denen eine alte Steineiche stand; klarer als Kristall, und selbst in der Siriushitze liebliche Kühle aushauchend. Catull liebte wie seinen Augapfel »vor allen Inseln und Halbinseln, soviele in klaren Landseen und Meereswellen rings der Wassergott hütet«, das liebliche, ohne Zweifel damals gartenartig angebaute Sirmio im blauen Gardasee, auf dem noch Trümmer römischer (wie man glaubt, von Thermen aus Constantins Zeit herrührender) Gebäude sind. Weit und breit, sagt Seneca, gab es keinen See, an dem nicht die Dächer von Villen der römischen Großen ragten, keinen Fluß, den ihre Gebäude nicht einfaßten. Plinius rühmt von Trajan, daß er nicht wie sein Vorgänger die Besitzer von ihrem Eigentum treibe, nicht wie er alle Teiche, alle Seen, alle Waldungen in einer einzigen unermeßlichen Besitzung vereinige, daß nicht mehr wie ehedem Flüsse, Quellen und Meere zur Augenweide eines Einzigen dienen. Ruinen eines Pausilypon (Sorgenfrei) aus Tiberius' Zeit (das einer Metia Hedonium gehörte) hat man am See von Bracciano gefunden. Der jüngere Plinius bezeugt, daß die reizenden, reich belaubten Ufer des Comersees mit Villen bedeckt waren. Sie waren es noch in der Zeit Cassiodors, dessen Beschreibung bei allem Schwulst ein tiefes Naturgefühl verrät. Er nennt die Lage der Stadt Comum so schön, daß sie zur Lust allein geschaffen zu sein scheine. Der See hat die Form einer Muschel, deren Umriß von der Weiße des schaumbenetzten Ufers gezeichnet wird; ihn umgeben nach Art eines Kranzes herrliche Gipfel hoher Berge, seine von glänzenden Palästen ( praetoriorum luminibus) schön geschmückten Ufer werden wie von einem Gürtel von dem immerwährenden Grün der Ölwaldungen eingefaßt. Darüber ziehen sich reich belaubte Weinpflanzungen die Abhänge hinan. Die Kämme sind von der Natur mit Kastanienwald wie mit krausem Lockenhaar geschmückt. Schneeweiße Wasserfälle stürzen von der Höhe in die Fläche des Sees. Noch in der karolingischen Zeit pries ein Dichter dessen Herrlichkeit: das wie in ewigem Frühling prangende Grün des Rasens an seinen Ufern, die sein Bett auf beiden Seiten einrahmenden Olivenhaine, die Lorbeeren und Myrten, die Granaten, Pfirsiche und Zitronen seiner Gärten. Doch auch bei viel bescheidenerer landschaftlicher Schönheit verfehlten Wasserspiegel, die von Laub eingefaßt waren, ihre Wirkung nicht. Apollinaris Sidonius schildert in einer modern klingenden Stelle die Flüsse der Lombardei, »den binsenreichen Lambro, die grüne Adda, die reißende Etsch, den trägen Mincio«; ihre Ufer säumten teils Eichen- und Ahornwälder, die von Vogelgesang ertönten, teils Schilf- und Rohrdickichte, in denen die Vögel nisteten.
Der Lauf des Anio, »des reizendsten unter allen Flüssen«, war von Wäldern beschattet und wurde von den in ununterbrochener Reihe an seinen Ufern entlang gebauten Villen gleichsam festgehalten, unter denen die Neros bei Subiaco berühmt war. Tibur mit der »tönenden Grotte der Albunea, dem Sturz des Anio, dem Hain des Tiburnus« verdankte seine Beliebtheit vor allem eben jenem berühmten Wasserfall. Auf der dortigen von Statius beschriebenen Besitzung des Manilius Vopiscus standen zwei Paläste an beiden Ufern des Flusses einander gegenüber, an einer Stelle, wo er ruhig dahinfloß, während er ober- und unterhalb mit lautem Krachen schäumend über Felsen stürzte. Dichter und hoher Wald trat bis an den Rand des Wassers, dessen Fläche das Laub widerspiegelte, weithin lief die Welle durch Schatten. Auch hier war es selbst in den Tagen der Siriushitze kühl, und der Brand der Julisonne vermochte nicht, in das Innere der Wohnräume zu dringen. Die Ufer des Tiber waren nach dem älteren Plinius vielleicht von mehr Villen besetzt als die aller übrigen Flüsse in der ganzen Welt. Herodes Atticus besaß eine seiner Villen in jenem Kephisia, das noch heute durch seine kühle Lage, seinen Reichtum an frischen Quellen, seine üppigen Gärten und Wälder von Oliven, Zypressen, Platanen und Silberpappeln »die freundliche Oase des öden attischen Lands ist«. Dort gewährten nach Gellius' Schilderung auch während der höchsten Glut des Frühherbstes ungeheure Haine Schatten und Kühlung, und von allen Seiten ertönte das melodische Rauschen der Wasser und der Gesang der Vögel.
Im Sinne des damaligen griechisch-römischen Naturgefühls und in der Weise der griechischen Sophisten schildert Josephus die den See Gennesar entlang sich erstreckende gleichnamige Gegend »als eine Landschaft von wunderbarer Natur und Schönheit«, zu deren fast unglaublicher Fruchtbarkeit und Üppigkeit übrigens die Quelle Kapharnaum sehr viel beitrug. Die früher (S. 459) erwähnte vornehme gallische Pilgerin erklärt, ein schöneres Land als das Land Gessen (d. i. Gosen) glaube sie nie gesehen zu haben; denn der Weg führte fortwährend zwischen Wein-, Balsam- und Fruchtgärten und trefflich angebauten Feldern dahin. Die zauberischen, an herrlichen Fruchtbäumen und Wasser reichen Paradiese der Römer bei Karthago, in denen die Vandalen sich der üppigsten Schwelgerei hingaben, schildern Procopius und Luxorius: der letztere rühmt die von Vogelgesang erfüllten Haine, die in moosigen Betten fließenden klaren Quellen, die duftenden Blumen, die im Grünen erbauten Pavillons und die Aussichtstürme.
Doch in erster Reihe unter den Gegenden, welche die Alten durch ihre Naturschönheit anzogen, stehen die Meeresufer; so sehr suchte man gerade hier auch den Naturgenuß, daß es möglich war, die Ausdrücke für schöne Gegenden und Strandgegenden als synonym anzusehen. Die antike Poesie und Sage bietet eine Fülle der beredtesten Zeugnisse für ein tiefes und inniges Verständnis der Schönheit und Herrlichkeit des Meers. Statt andrer mag eine Stelle Catulls hier stehen, in der er schildert,
Jetzt wie des ruhigen Meers Flutplan mit dem Atem der Frühe
Zephyrus leicht anschauernd hinauslockt hüpfende Wellen,
Wenn an der wandernden Sonne Gezelt Aurora emporsteigt;
Die anfangs schlafträge, gedrängt vom säuselnden Luftzug,
Seewärts gehn, leis rauschend, es hallt wie heimlich Gekicher;
Aber der Wind schwillt an, schon rollen sie höher und höher,
Und bald fernhin sprühn die entschwimmenden unter dem Glührot.
Auch die antike Kunst hat diesem Element die Motive zu manchen ihrer anmutigsten und prachtvollsten Darstellungen entnommen. Der Anblick des Meers war den Römern wie den Griechen der erhabenste und zugleich der schönste in der Natur. Wie groß, ruft Cicero in seiner Schilderung der Wunder der Schöpfung aus, ist die Schönheit des Meers, welches Schauspiel der Anblick des Ganzen, welche Menge und Mannigfaltigkeit der Inseln, welche Reize in seinen Ufern und Küsten! An dem Genuß dieser Schönheit sättigte man sich nie und kehrte immer wieder zu ihm zurück. Ciceros Freund M. Marius ließ auf seinem Gut bei Stabiä (Castellammare) einen Durchstich machen oder ein Gebäude abbrechen, um aus seiner Villa den freien Blick über den von der Morgensonne beschienenen Golf zu gewinnen. Cicero selbst schreibt an Atticus aus Puteoli: Du fragst, ob ich mich mehr an der Aussicht von den Höhen oder an einem Gange hart am Meere erfreue, und meinst, ich wisse das selbst nicht. In der Tat ist beides so schön, daß man zweifeln kann, welches den Vorzug verdient. Ähnliche Äußerungen finden sich noch öfters in den Briefen Ciceros wie in denen des jüngeren Plinius. Auch Apulejus sagt, ihm sei die liebste Aussicht die auf das Meer. Plutarch führt als etwas oft Gesagtes an, daß, wie eine Schiffahrt längs dem Lande, so ein Spaziergang längs dem Meere der angenehmste sei. Libanius sucht in seiner Lobrede auf Antiochia zu beweisen, daß dessen Bewohner für die Entbehrung des Blicks auf das Meer dadurch entschädigt würden, daß sie den Schattenseiten des Lebens in einer Seestadt nicht ausgesetzt wären. Doch vielleicht nichts ist für den Wert, der auf diesen Anblick gelegt wurde, so charakteristisch wie eine Bestimmung Justinians, daß in Konstantinopel niemand durch Bauten, die in einer Entfernung von weniger als 100 Fuß vom Meere aufgeführt würden, die Aussicht auf dasselbe, »die größte Annehmlichkeit« (πρᾶγμαχαριέστατον) sollte absperren dürfen. Auch Procop, der die Herrlichkeit der Lage der Stadt gebührend preist, unterläßt in der Beschreibung der hart am Ufer aufgeführten Bauten des Kaisers nicht, das Zusammenwirken der Architektur mit dem Spiegel des Meeres, das ihre Fundamente bespült, ausdrücklich hervorzuheben.
Aber weit mehr als durch die Literatur ist die Liebe der Römer für das Meer durch die Anlagen ihrer Villen bezeugt, welche, wie oben ausführlich geschildert ist, in gedrängter Reihenfolge die Küste Italiens von dem Golf von Spezia bis zu dem von Salerno und weiter hinaus säumten. Wie sehr man hier darauf bedacht war, das Meer auf jede Weise zu genießen (welchem Zwecke ja auch die öfters als Beweis eines ausschweifenden Luxus angeführten Wasserbauten dienten), wie man dafür sorgte, sich diesen Genuß durch die verschiedensten Aussichtspunkte so mannigfaltig wie möglich zu machen, zeigt außer manchen oben angeführten Angaben besonders die ausführliche Beschreibung, die der jüngere Plinius von seiner Villa bei Laurentum gibt. Hier war ein Speisesaal so weit auf die Küste hinausgebaut, daß er bei Südwestwind von der äußersten Flut der Brandung bespült wurde. Durch die Flügeltüren und bis zum Boden hinabreichende Fenster sah man auf drei Seiten das Meer. Ein Fenster eines großen Zimmers gewährte den Blick auf dessen weiter entfernte, aber ruhige Fläche. Auch beim Schwimmen in dem Warmwasserbassin hatte man es vor Augen, und aus einem Speisesaal in einem oberen Stockwerke sah man zugleich sehr weit auf seine Fläche hinaus und das Ufer mit reizenden Villen entlang. Aus drei Fenstern eines Alkovens konnte man die Aussichten auf Meer, Villen und Wald bald verbunden, bald getrennt genießen usw. Auch die Villa des Pollius Felix auf der Höhe von Sorrent bot aus jedem Fenster eine andre Aussicht, auf Ischia, Capri, Procida, aus allen aber die Aussicht auf das Meer; dort weilte die sinkende Sonne, »wenn der Tag sich neigte, der Schatten der laubgekrönten Berge in die Flut fiel und die Paläste im kristallenen Meere zu schwimmen schienen«. Von den Lustorten und Bädern an der Westküste Italiens, an der Nordküste Ägyptens ist oben die Rede gewesen. In der Gegend des alten Canopus sieht man (oder sah man früher) die Grundmauern eines Gebäudes in der Art der römischen Villen, die, von den Fluten bedeckt, ein ganzes Stück in das Meer hineinreichten; Bruchstücke von Statuen waren überall zerstreut. Auch in Griechenland stößt man auf die Ruinen römischer Villen hauptsächlich an den Küsten.
Ganz besonders tritt die Verschiedenheit des römischen Naturgefühls von dem unsern im Gartenbau hervor. Wenn es gleich an Freunden und Fürsprechern der freien, sich selbst überlassenen Natur in der augusteischen wie der nachaugusteischen Zeit keineswegs fehlte, so scheint doch seit Anfang der Kaiserzeit bis mindestens tief ins 4. Jahrhundert das Streben, die Natur künstlerisch zu gestalten, den Charakter der Gärten in Italien vorzugsweise bestimmt zu haben. Namentlich in den beiden von dem jüngeren Plinius ausführlich beschriebenen Gärten seiner laurentischen und toscanischen Villa zeigt sich die allem Anschein nach allgemein beliebte architektonische Regelmäßigkeit der Anlage, mit der dann wieder stellenweise Szenen ländlicher Natur kontrastieren. Das Ganze war teils durch Terrassen, teils durch zirkusförmige Plätze (Hippodrome), teils durch geradlinige oder in großen Kurven geführte Alleen und Gänge abgeteilt, welche letztere durch geschorene Wände oder Hecken (von Buchs oder Rosmarin), die gelegentlich auch treppenartig gezogen wurden, eingefaßt waren. Mit der Vegetation wirkte die Architektur, deren Schatten zugleich die zunächst liegenden Teile kühlte, zusammen, aber auch die ferneren Umgebungen; denn für schöne und mannigfache Aussichten war so viel wie möglich gesorgt. Dazu kam eine reiche Dekoration mit Bildwerken, zu denen auch Tierfiguren gehörten. Seen und Kanäle, Springbrunnen und Wasserkünste aller Art belebten diese Anlagen: in dem Garten der toscanischen Villa des Plinius quoll aus einer halbrunden Marmorbank das Wasser durch Röhren, als ob die Last der darauf Ruhenden es herausdrängte. Auch an allen übrigen Ruheplätzen und in dem Hippodrom plätscherten zahlreiche Wasserstrahlen. In den größten Gärten, besonders außerhalb Roms, befanden sich auch Vogelhäuser, Fischteiche und Wildparks; besonders wurden wohl Pfauen (und andre seltne und schöne Vögel) in Gärten häufig gehalten. Vielleicht waren auch Nachahmungen berühmter Landschaften und Bauwerke, wie in der tiburtinischen Villa Hadrians, nicht selten. Aussichtstürme, deren es auch in den zauberischen Paradiesen der Vandalen in Karthago gab, werden den römischen Gartenhäusern ebenfalls nicht gefehlt haben. Von Bäumen wurden in Gärten außer den Fruchtbäumen und der Platane, dem beliebtesten Zierbaume des Altertums, namentlich die immergrünen gezogen, wie Myrte, Lorbeer, Eiche Zypresse und Pinie. Sie wurden teils in Alleen oder in der Form des Quincunx, teils in großen, ganz aus Bäumen derselben Gattung bestehenden Gruppen oder kleinen Parks gepflanzt. Florentinus (zu Anfang des 3. Jahrhunderts) empfiehlt, die Bäume nicht etwa (in der Absicht, durch ihre Verschiedenheit einen angenehmen Eindruck zu erzielen) ordnungslos zu pflanzen, sondern nach Gattungen gesondert. An manchen Stellen wurde ihr Laub durch Ziehen und Beschneiden zu künstlichen, oft wunderlichen Formen gestaltet: eine Mode, deren Einführung einem Freunde des Augustus, dem Ritter C. Matius, zugeschrieben wird. Man bildete nicht bloß Namenszüge, Kegel und Pyramiden aus Buchsbaum, Zypressen und andern Bäumen, sondern auch Figuren wilder Tiere, sogar ganze Jagden und Flotten. Auch die Kultur von Zwergbäumen (namentlich Platanen und Zypressen, vermutlich aber auch andern Gattungen) war beliebt, desgleichen Künsteleien des Pfropfens, wie das Pfropfen eines Stammes mit den Reisern verschiedener Fruchtbäume. Die Blumenbeete bestanden ebenfalls vorzugsweise aus Blumen einer Gattung, vor allem Rosen und Lilien, neben denen Mohn, Violen (Levkojen), Hyazinthen (Schwertlilien?), Anemonen u. a. genannt werden. Florentinus rät die Zwischenräume der (wie es scheint geradlinig gepflanzten) Bäume mit Rosen, Lilien, Violen und Krokus auszufüllen. Der Boden wurde mit Acanthus, Wände und Säulen sowie Baumstämme mit Efeu und Weinlaub überkleidet, aus jenem Bögen von Baum zu Baum gezogen, aus diesem Schattengänge und Lauben gebildet.
Daß übrigens der hier geschilderte Gartenstil, wenn auch der herrschende, doch nicht der ausschließlich angewendete war, daß vielmehr jene Vorliebe für Szenen der sich selbst überlassenen Natur auch zu parkartigen Anlagen führte, zeigt namentlich das 1863 entdeckte, die vier Wände eines Saales der Villa in Prima Porta bei Rom umfassende, etwa der Zeit des Augustus angehörige Gemälde, das einen Lustgarten mit naturalistischer Treue darstellt. Den Vordergrund bildet ein Wiesenstreifen, der durch ein Staket aus Rohrgeflecht und eine aus Stein oder Backstein erbaute Einfriedung eingefaßt ist. Hinter der letzteren, deren gerade Linie mehrfach durch Ausbiegungen unterbrochen wird, erhebt sich aus reichem, von blühenden Blumen üppig durchwachsenem Unterholz ein höchst anmutiger Wald von hinter- und nebeneinander gruppierten Bäumen, unter denen man Pinien, Palmen, Lorbeeren und verschiedene Fruchtbäume (Granat-, Äpfel-, Quittenbäume) erkennt. In den Ausbiegungen der hinteren Einfriedung stehen (außer einigen nicht sicher zu bestimmenden Bäumen) dunkle Nadelhölzer, deren Zweige bis auf den Boden reichen. Weiter aus dem Hintergrunde ragen besonders Zypressen herüber. Die ganze Anlage ist von einer reichen und mannigfaltigen Vogelwelt belebt, und zwar der Rasen, die Stakete, das Blumendickicht von größeren, besonders hühnerartigen, die Bäume von kleineren Vögeln der verschiedensten Arten. »Das ganze blühend-bunte, fröhliche, aber nicht wilde, sondern offenbar gehegte Dickicht macht einen überaus anmutigen und die Phantasie poetisch ansprechenden Eindruck«.
Aber mögen auch Anlagen wie die hier dargestellten nicht ganz selten gewesen sein, so ist doch der Gartenbau der römischen Kaiserzeit im allgemeinen, wie gesagt, offenbar durch das Streben nach künstlicher, architektonisch regelmäßiger Gestaltung der Natur bestimmt worden, und dieser Geschmack hat sich aus dem Altertum ins Mittelalter fortgepflanzt. Die Anweisungen, die der mit den Schriften der Alten wohlbekannte Bologneser Petrus de Crescentiis (geb. 1230) in seinem Werke über den Landbau für den Gartenbau gibt, beweisen seine Fortdauer. In den Gärten der Personen des Mittelstands von drei oder vier Morgen empfiehlt er, schnurgerade Reihen von edlen Fruchtbäumen, und zwar jede Reihe nur aus Bäumen derselben Gattung, zu pflanzen, dazwischen Weinstöcke, im übrigen soll der Garten Wiesen und Lusthäuser enthalten. Von Blumen ist hier ebensowenig die Rede wie in den Anweisungen für die »Gärten der Könige und andrer erlauchter und reicher Herren«, für welche er eine Bodenfläche von 20 und mehr Morgen annimmt, die von einer Quelle durchflossen ist. Hier soll im Norden ein Park für zahmes Wild aller Art angelegt werden, im Süden ein Kasino ( palatium speciosum), das einen tiefen Schatten geben wird, und dessen Fenster auch in der Hitze eine kühle Luft einlassen und zugleich die Aussicht auf den Garten und die darin befindlichen Tiere gewähren werden. In diesem soll sich auch ein Fischteich und ein großes, über Büschen und Bäumen aus Gitterwerk errichtetes Vogelhaus befinden, das mit Fasanen, Rebhühnern, Stieglitzen, Staren, Nachtigallen, Amseln und andern Singvögeln gefüllt ist. Ferner soll in demselben Garten ein Sommerhaus mit Sälen und Gemächern aus Bäumen allein hergestellt werden, in dem der König und die Königin mit ihren Baronen und Damen sich bei schönem Wetter aufhalten können. Die Wände werden aus Reihen schnell wachsender Fruchtbäume oder noch besser Weiden und Ulmen gebildet, deren Wachstum während mehrerer Jahre durch Beschneiden und Anbinden, mit Hilfe von Latten und Pfählen, in entsprechender Weise geregelt wird. Auch kann man ein solches Haus aus trocknem Holz aufführen, das man ganz mit Weinlaub überzieht. Ferner gewähren wunderbare und mannigfaltige Inokulierungen von Pfropfreisern auf denselben Bäumen viel Ergötzung, besonders aber gereichen einem solchen Garten die immergrünen Bäume zur Zierde wie Pinien und Zypressen und Zedern und Palmen, wo sie ausdauern. Jede Gattung von Bäumen und Kräutern soll nach der Ordnung und von der andern gesondert gepflanzt werden. Endlich wird noch eine Anweisung gegeben, durch jahrelanges Binden, Beschneiden, Biegen und Nachpflanzen dichte lebendige Umfassungsmauern der Gärten und Höfe mit Zinnen und Türmen und Häuser mit grünenden Säulen und Dächern zu bilden. Auch Leon Battista Alberti, der in seinem Werke von der Baukunst (1451) zuerst einige der Züge feststellte, welche seither für den italienischen Prachtgarten bezeichnend geworden sind, zeigt sich von den Traditionen des Altertums, namentlich von Plinius, durchaus abhängig.
Diese Traditionen übten auch auf die Ausbildung des Gartenbaus im 16. Jahrhundert einen bestimmenden Einfluß. Die neuere italienische Gartenkunst »will nicht die freie Natur mit ihren Zufälligkeiten künstlich nachahmen, sondern die Natur den Gesetzen der Kunst dienstbar machen. Das Wesentliche ist vor allem die große, übersichtliche, symmetrische Abteilung in Räume mit bestimmtem Charakter. Der im nächsten Zusammenhang mit dem Gebäude der Villa stehende Prunkgarten und seine Umgebung von Terrassen mit Ballustraden und Rampentreppen erhält durch halbrunden Abschluß, durch Abstufung, durch Grotten und Fontainen eine reiche architektonische Ausbildung. Dann werden Täler und Niederungen stilisiert durch Absätze und das in stets gerader Linie durchfließende Wasser zu Bassins erweitert und womöglich zu Kaskaden aufgesammelt, deren mäßiges Träufeln durch architektonischen und mythologischen Schmuck motiviert wird. Oder es wird eine Niederung als Zirkus gestaltet; oder ein ganzes Tal, eine ganze Gegend wird auch einer bestimmten Vegetation überlassen, doch nicht bis zum vollen Eindruck des Ländlichen (wie z. B. den Pinienhain der Villa Pamfili niemand für einen wild gewachsenen Pinienwald halten wird). Sodann erhalten die sämtlich geradlinigen Gänge, die womöglich auf bedeutende Ausblicke, auch auf Brunnen und Skulpturen gerichtet sind, entweder eine bloße Einfassung oder eine Überwölbung von immergrünen Bäumen, im ersteren Falle dichte Zypressenhecken und Lorbeeren, im letzteren vorzugsweise Eichen. Der Kontrast der freien Natur oder Architektur, welche von außen in den italienischen Garten hereinschaut, der Bergfernen, der ländlichen oder städtischen Aussichten, des Meers und seiner Küsten, möchte geradezu eine Grundbedingung des Eindrucks sein«.
Übrigens hat der im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts in Italien ausgebildete, dann nach Frankreich, Deutschland, England und Holland verpflanzte und weiter entwickelte Gartenstil nicht bloß während des ganzen 17. Jahrhunderts geherrscht, sondern trotz einer seit Rousseau immer lauter werdenden Opposition vielfach noch bis tief in das 18., und bis in die neueste Zeit hat es ihm an Liebhabern durchaus nicht gefehlt. Hegel gibt der architektonischen Anlage des Gartens den Vorzug vor der malerischen, parkartigen, deren »Absichtlichkeit des Absichtslosen« und »Zwang des Ungezwungenen« er abgeschmackt findet; Vischer rühmt an dem sogenannten französischen Garten, daß man hier »den Vorteil einer von Menschenhand gepflegten, gereinigten Natur« genießt. Auch Goethe spendete ihm (1825) Lob, wenigstens für große Schlösser: »die geräumigen Laubdächer, Berceaux, Quinconces lassen doch eine zahlreiche Gesellschaft sich anständig entwickeln und vereinen, während man in unseren englischen Anlagen, die ich naturspäßige nennen möchte, allerwärts aneinanderstößt, sich hemmt oder verliert«.
Daß das Streben, die Natur der Kunst dienstbar zu machen, den Charakter der italienischen Gärten ebenso im Mittelalter und der neueren Zeit bestimmt hat wie im Altertum, ist eine um so bedeutsamere Erscheinung, als die Flora und Vegetation Italiens seit dem 16. Jahrhundert durch die Einführung einer großen Anzahl von Gewächsen, besonders Zierpflanzen aus dem Orient und Amerika, wesentlich umgestaltet worden ist. Erwägt man überdies, daß bei einer beispiellos reichen Entwicklung der bildenden Künste im Altertum wie seit der Renaissancezeit die Landschaftsmalerei im Süden nie auch nur annähernd dieselbe Bedeutung gewonnen hat wie im Norden: so muß man um so mehr anerkennen, daß das Naturgefühl unter demselben Himmel, in denselben Umgebungen sich in zwei Jahrtausenden nicht wesentlich verändert hat, außer insofern es von Einflüssen der transalpinischen Kultur berührt worden ist.
Solcher und verwandter Art waren die Naturszenen, welche Freunde landschaftlicher Schönheit im Altertum am liebsten aufsuchten, und kaum wird man in der antiken Literatur eine Spur davon finden, daß Landschaften von sehr abweichendem oder entgegengesetztem Charakter als schön gegolten hätten. Rauheit und Wildheit, furchtbare Majestät, großartige, aber düstere Monotonie der Natur schlossen das Lob der Schönheit nach antiker Empfindung aus; es war nächst dem Meeresufer auf Täler und Hügellandschaften beschränkt. Das Gebirge galt nur insofern für schön, als es eine anmutige Begrenzung des Horizonts, eine erwünschte Einrahmung der Landschaft bildete; aber für die Schönheit seines Innern sowie für die des Hochgebirges hatte jene Zeit ebensowenig ein Verständnis, wie für den schwermütigen Reiz der Einöde; für den Zauber, den auf uns der Anblick der Campagna Roms in ihrer jetzigen Gestalt übt, war sie unempfänglich. Catull, den die Halbinsel Sirmio an dem flachen Ufer von Desenzano so sehr entzückte, würde für das von schroffen Felsen eingeschlossene Riva kaum ein Wort des Lobs gefunden haben.
Das Naturgefühl der Alten war nicht weniger lebhaft, innig und tief, aber es war enger begrenzt als das der Modernen. Es ist für sein eigentliches Wesen höchst bezeichnend, daß bei den Römern Anmut ( amoenitas) das häufigste Lob einer schönen Natur, ja dasjenige Wort ist, das unserm »Naturschönheit« am nächsten kommt. Quintilian sagt einmal, das Lob der Schönheit ( species) komme unter den Gegenden »den ebenen, den anmutigen, den am Meere gelegenen« zu. Und zu diesen drei Gattungen gehören auch die Ländereien, die in dem »Schiff« Lucians (wo alle Herrlichkeiten der Welt aufgezählt werden, in deren Besitz man sich bei ungeheurem Reichtum zu setzen vermöchte) als die wünschenswertesten genannt sind: die Umgegend von Athen, das am Meere gelegene Gebiet von Eleusis, die sicyonische Flur und »überhaupt alles, was schattig, bewässert und fruchtreich in Griechenland ist«. Der Rhetor Hermogenes nennt als Beispiele von Gegenständen, die ebensowohl in der Beschreibung wie durch ihren Anblick erfreuen, die »Schönheit einer Gegend, verschiedenartige Pflanzungen und Mannigfaltigkeiten fließender Wasser u. dgl. m.«; wobei an die allbekannte Beschreibung der Platane am Bach in Platos Phädrus erinnert wird. Libanius lobt Julian den Abtrünnigen, weil er als Prinz zum Aufenthaltsort Athen statt Ioniens wählte, das ihm die begehrtesten Vorzüge, wie Gärten und Gefilde am Meeresstrande, geboten hätte.
Aber es fehlt auch nicht an noch ausdrücklicheren Äußerungen, in denen als selbstverständlich vorausgesetzt wird, daß eine Gebirgsgegend überhaupt nicht schön sein könne. Cicero führt zum Beweise für die Macht der Gewohnheit an, daß wir auch an Gegenden, in denen wir lange verweilt haben, Gefallen finden, »selbst an bergigen und waldigen«. Den von der Schönheit der Fibrenusinsel überraschten Atticus läßt er sagen, er habe sich in der Umgegend von Arpinum nur Felsen und Gebirge gedacht und sich daher gewundert, daß sein Freund an dieser Gegend solches Gefallen finde. Für die Abneigung gegen das Heroische in der Natur darf man einen Beleg auch darin finden, daß weder Cicero noch sonst jemand der beiden Fälle gedenkt, mit welchen die Isola umfassenden Arme des Liris, der eine senkrecht, der andre auf schiefer Ebene, etwa 25 Meter hoch herabstürzen. Die Bewunderung, die Vergil für den »Vater Appenninus« äußert, in dessen schwankenden Eichen es braust und der, seines schneeigen Scheitels froh, gewaltig zum Himmel aufsteigt, gilt nur dem Anblick, den das Gebirge von ferne bietet. In seinem begeisterten Preise der Schönheit Italiens rühmt Vergil seine Fruchtbarkeit an Korn, Öl und Wein, an Herden aller Art, sein herrliches Klima, seine Städte und Völker, seine Landseen und Meere, seinen Reichtum an Metallen: von seinen Bergen sagt er kein Wort. Wenn Seneca Corsica eine kahle Felsklippe von abschreckender Rauheit nennt, so ist seine Schilderung freilich von der leidenschaftlichen Abneigung des ohnedies stets übertreibenden Schriftstellers gegen den ihm aufgezwungenen Aufenthaltsort diktiert; sie zeigt aber doch auch, daß jene Zeit für die »entzückende Schönheit« der dortigen, an Farben und Formen so reichen Landschaft gar kein Verständnis hatte. Den am Fuße des Berges Casius gelegenen Stadtteil Antiochias rühmt Libanius, weil seinen Bewohnern der Schrecken der Berge nicht drohte, während er alles in Fülle bot, was Freude und Lust erwecken kann: Quellen, Bäume, Gärten, Blüten und Früchte, Vogelstimmen, und daß man dort den Frühling am frühesten genoß.
Vollends für die Wunder der Alpenwelt fehlte der damaligen Bildung das Verständnis völlig; die Empfindungen, mit denen die Römer sie betrachteten, bezeichnet der Ausdruck des Livius: »die Scheußlichkeit ( foeditas) der Alpen«. Diese Empfindungen glichen etwa denen, die neuern Reisenden die Eiswüsten des Nordpols erregen, nur ohne die jetzige Bewunderung für die schauerliche Erhabenheit solcher Szenen. In einer Zeit, wo jahraus, jahrein Hunderte, ja Tausende von Römern zahlreiche Alpenstraßen überschritten und die Schweiz ein von Römern bewohntes Land war, hatten die Alpenreisenden nur Augen für die Schwierigkeiten, Gefahren und Schrecken, die den Reisenden drohten, für die steile Steigung und die Schmalheit der Saumpfade, die sich schwindelerregend an grauenvollen Abgründen hinzogen, für die unwirtliche Öde der kolossalen Eis- und Schneewüsten, die Furchtbarkeit der abstürzenden Lawinen. Dieser Mangel an Gefühl für den Zauber des furchtbar Erhabenen in der Natur, und dieser allein ist der Grund, weshalb »von dem ewigen Schnee der Alpen, wenn sie sich am Abend oder am frühen Morgen röten, von der Schönheit des blauen Gletschereises, von der großartigen Natur der schweizerischen Landschaft keine Schilderung aus dem Altertum auf uns gekommen ist; weshalb Silius Italicus die Alpen als eine schreckenerregende, vegetationslose Einöde schildert, während er mit Liebe alle Felsenschluchten Italiens und die buschigen Ufer des Liris besingt«.
Gebirgswanderungen und Bergbesteigungen werden im ganzen Altertume äußerst selten erwähnt, und je seltener sie erfolgten, je weniger zu ihrer Erleichterung geschah, desto schwieriger und zum Teil gefahrvoller blieben sie. Wie sehr das Besteigen von Bergen in der Regel nur als Beschwerde angesehen wurde, zeigt das Lob, das Plinius den altern Naturforschern für ihre Unermüdlichkeit im Aufsuchen von Heilkräutern erteilt, da sie »auch unwegsame Berggipfel und abgeschiedene Einöden durchforscht haben«; doch freilich die Alpenpflanzen kennt keiner der antiken botanischen Schriftsteller. Polybius sagt in seiner Vergleichung der griechischen Gebirge mit den Alpen, die Höhe dieser könne man in fünf Tagen nicht erreichen, während ein rüstiger Mann jene fast sämtlich in einem Tage ersteigen könne, wie den Taygetus, Parnaß, Olymp, Pelion, Ossa, den Hämus und das Rhodopegebirge. Darf man hiernach annehmen, daß die griechischen Berge damals bereits wiederholt bestiegen worden waren, so fragt sich doch, ob es der Aussicht wegen geschehen war. Immerhin ist möglich, daß Griechen nach den Eroberungen Alexanders des Großen in Asien auch hierin »die Erbschaft der Perser antraten«, die weite Umblicke geliebt zu haben scheinen. Strabo erwähnt ein von ihnen erbautes marmornes Belvedere auf dem Tmolus bei Sardes, wo man eine weite Rundschau über das Land, namentlich die Kaysterebene hatte. Eine freilich sehr flüchtige und dürftige Beschreibung der Aussicht vom Olymp bei Apollonius Rhodius könnte möglicherweise auf eigner Anschauung beruhen: »unten erschien hier die nährende Erde und die Städte der Männer und die heiligen Ströme, dort wieder Höhen und rings das Meer«. Eine Messung der Höhe des (thessalischen) Olymps, von einem Xenagoras mit Hilfe von Instrumenten »nach der Kathete« angestellt, hatte 1879,3 m (in Wirklichkeit 2985 m) ergeben. König Philipp von Macedonien unternahm im Jahre 183 v. Chr. die Besteigung des Hämus keineswegs des Naturgenusses halber, sondern in dem Glauben, daß man dort bis ans Adriatische Meer sehen könne, und um die nächsten an dasselbe führende Straße zu ermitteln. Als Grund für die Zurücklassung seines Sohnes Demetrius gab er diesem die Gefahr des Unternehmens an. Der Gipfel wurde mit großer Mühe am dritten Tage erreicht, und darauf dem Zeus und dem Sonnengotte Altäre errichtet. Der nach der Angabe des Polybius allgemein verbreitete Glaube, daß man von dort das Adriatische und das Schwarze Meer sehen könne, erhielt sich. Strabo widerlegt diese Ansicht, aber noch Pomponius Mela wiederholt sie. Plinius gibt die Höhe des Hämus auf 6 Millien (9000 m) an! Diejenigen, welche den mit ewigem Schnee bedeckten Gipfel des Argäus bei Mazaca in Cappadocien bestiegen haben, sagt Strabo, berichten, daß man von dort zwei Meere sieht, das Issische und das Pontische, aber ihrer sind wenige; daher, sagt Solinus, glauben die Völker, daß er von einem Gotte bewohnt werde. Dagegen mag der neptunische Berg an der Nordspitze Siciliens häufig bestiegen worden sein, von dem man die Aussicht auf das Toscanische und das Adriatische Meer haben sollte.
Der einzige Berg, von dem es unzweifelhaft ist, daß er öfters bestiegen wurde, ist der Ätna. Strabo sagt, daß man zu seiner Besteigung von der kleinen Stadt Ätna an seinem Fuße aufbreche und ebendahin zurückkehre. Kurz bevor er schrieb, hatte eine Gesellschaft von mehreren Personen den Berg bestiegen, deren Angaben über den Hauptkrater er mitteilt. Bedenkt man aber, daß damals der Vesuv noch nicht als tätiger Vulkan bekannt war, so wird man es wahrscheinlich finden, daß diese Besteigungen nicht sowohl durch das Verlangen nach einem Naturgenuß von beispielloser Großartigkeit veranlaßt wurden, sondern durch Wißbegierde und naturwissenschaftliches Interesse. Seneca, der seinem Freund Lucilius, kaiserlichen Prokurator in Sicilien, auffordert, ihm zu Ehren den Ätna zu besteigen, was er übrigens ja auch aus eigner Neigung getan haben würde, hofft von ihm zu erfahren, wie weit von dem feuerspeienden Krater der ewige Schnee entfernt sei. Das von einem unbekannten Dichter der frühen Kaiserzeit herrührende Gedicht über den Ätna, das wir noch besitzen, ist rein naturwissenschaftlichen Inhalts und enthält von der Aussicht auf dem Gipfel kein Wort: während gegenwärtig auch in Berichten über Besteigungen zu rein wissenschaftlichen Zwecken Beschreibungen dieser Aussicht kaum jemals fehlen. Hadrian bestieg den Ätna, um die, eigentümliche Erscheinung der aus dem Meere auftauchenden Sonne zu beobachten, die vom Gipfel aus gesehen wie ein lang gekrümmter Schweif erscheint. Der sogenannte Turm des Philosophen auf dem Ätna, ehemals ein ausgedehntes Gebäude von mehreren Zimmern, an dem Fazello 1541 noch ein wohlerhaltenes Gewölbe von Backsteinen fand, also ohne Zweifel römischen Ursprungs, ist nach Gemellaros Vermutung erbaut worden, um Hadrian bei seiner Besteigung des Kegels als Nachtlager zu dienen. Den Berg Casius bestieg er (und nach ihm Julian), weil man von seiner Höhe die Sonne schon um die Zeit des zweiten Hahnenschreis sehen sollte. Angeblich sah man sie auch auf dem Gipfel des Ida vor Tagesanbruch.
Nach allem Angeführten muß auch dem spätern Altertum im großen und ganzen der Sinn für die Schönheit der eigentlichen Gebirgswelt abgesprochen werden. Wenn es trotzdem möglich bleibt, daß einzelne diesen Sinn besessen haben, so gibt es doch keine bestimmten Zeugnisse dafür. Wenn Seneca schildert, wie der an Genüssen Übersättigte, des Paradieses von Campanien überdrüssig, die Einöden und Wildnisse von Lucanien und Bruttien aufsucht, so liegt hierin offenbar nur eine Bestätigung der eben gemachten Behauptung; denn die Heftigkeit des Verlangens nach Abwechslung soll sich nach Seneca darin zeigen, daß es sogar dazu treibt, die schöne Natur mit der unschönen zu vertauschen. Wenn ferner Cicero in seiner Schilderung der Herrlichkeit der Schöpfung außer der unendlichen Mannigfaltigkeit der Vegetation neben kühlen, unversieglichen Quellen, klaren Strömen, grünen Ufern auch »hochgewölbte Grotten, zackige Felsen, ragende und überhangende Berge und unermeßliche Ebenen« anführt: so umfaßt diese Betrachtung, die allerdings von der Schönheit der Natur ausgeht, doch offenbar auch ihre durch Größe, Mannigfaltigkeit, Wunderbarkeit bedeutenden Erscheinungen. Dies ergibt sich schon daraus, daß Cicero seine Aufzählung noch durch »die verborgenen Adern des Goldes und Silbers und die unermeßliche Masse des Marmors« vervollständigt. Sodann ist oben gezeigt worden, daß das römische Naturgefühl Berge und Felsen als Bestandteile, besonders als Hintergründe der schönen Landschaft vollkommen gelten ließ und nur für das Rauhe, Düstere und Öde, das Groteske und Wilde, sowie das furchtbar Erhabene der eigentlichen Gebirgsnatur unempfänglich war.
Ebenso fremd wie die erst auf Grund der von Rousseau ausgehenden Anregungen mehr und mehr verbreitete subjektive Auffassung, welche die Natur beseelt und in ihr nur Spiegelbilder des eignen Innern erblickt, war dem Altertume auch die ästhetische Naturbetrachtung, welche in der Landschaft ein von der Natur gleichsam in künstlerischer Absicht geschaffenes und mit einer bestimmten Individualität ausgestattetes Ganze sieht. Auch diese Betrachtungsweise ist eine sehr moderne. Zwar hat die auf ihr beruhende Landschaftsmalerei sich als selbständig darstellende Kunst schon im 16. Jahrhundert entwickelt. Doch in der Literatur dürfte sie sich erst weit später nachweisen lassen, da die Darstellungen der Landschaft die künstlerische Anschauungsweise nur sehr allmählich dem Bewußtsein weiterer Kreise vermitteln konnten. Völlig ausgebildet findet sie sich bereits bei Diderot in seinen Beurteilungen der Pariser Gemäldeausstellungen von 1765 bis 1767, der u. a. bei der Beschreibung Vernetscher Landschaften sich den Anschein gibt, als rede er von wirklichen Naturszenen, diese aber mit Prädikaten lobt, die nur einem Bilde zukommen. Er liebte vor allen die historische Landschaft und bewunderte unter deren Meistern namentlich Poussin; sein Naturenthusiasmus war ein sehr lebhafter, dem der römischen Dichter nahe verwandter, aber (wie er glaubte) nur von wenigen geteilter.
Wie unvollkommen wir auch über die antike Landschaftsmalerei unterrichtet sind, so können wir doch mit Sicherheit behaupten, daß trotz ihrer Fähigkeit, die Formen der Gegend stilvoll zu gestalten, ihre Entwicklung nicht reich und vielseitig genug war, um eine ästhetische Naturbeschreibung ins Leben zu rufen, wie diese unter dem Einfluß künstlerischer Darstellungen im 18. Jahrhundert entstanden ist. An den zahlreichen trefflichen Naturbeschreibungen, die wir aus dem Altertume haben, vermissen wir durchaus den landschaftlichen Sinn, der immer »das Resultat langer, komplizierter Kulturprozesse ist«. Die Aufmerksamkeit ist überall mehr auf die einzelnen Erscheinungen, als auf ihr Zusammenwirken zum Ganzen gerichtet. Vor allem fehlt ganz und gar – und dies ist der wesentlichste Unterschied zwischen der heutigen und der antiken Naturbeschreibung – die Hervorhebung der Wirkungen des Lichts und ihrer Modifikationen durch das Medium der Luft. In der von Älian gegebenen Beschreibung des Tempetals z. B. ist nur einmal von der Farbe, dem frischen Grün, das überall die Augen labt, die Rede, doch nirgends von der Wirkung der Atmosphäre auf die Erscheinung der Gegenstände: sie hat im wesentlichen einen topographischen und plastischen Charakter. Ähnlich verhält es sich mit den Landschaftsschilderungen des Apollonius von Rhodus. Auch der jüngere Plinius, der in der oben angeführten Schilderung der Lage seiner toscanischen Villa von der »herrlichen Form« ( regionis forma pulcherrima) der Gegend spricht, in der man viel mehr ein Gemälde als Wirklichkeit zu erblicken glaube, scheint doch vorzugsweise die Gestaltungen und Umrisse der Landschaft im Auge zu haben, wenn er auch nicht verkannte, daß deren Wirkung durch die Mannigfaltigkeit der Farben unterstützt werde. »Alle diese Schilderungen machen den Eindruck, als sei für dieselben eine klare Luft und ein volles Licht vorausgesetzt, welche die Plastik der Gegenstände allenthalben zur vollendetsten Geltung kommen lassen.«
Allerdings werden hin und wieder auch andre Beleuchtungen erwähnt, und es fehlt in der antiken Poesie nicht ganz an schönen Ausdrücken tiefer Empfindung für die Pracht der Lichterscheinungen: des reinen Monds, der im nächtlichen Meere lächelt, unter dessen zitterndem Lichte die Flut glänzt, der bei kühlem Abendhauche die tauigen Wälder erfrischt; des von den Strahlen der Sonne geröteten Meers, der Wellen, die weithin schwimmend in purpurnem Glanze schimmern; des Taus, der im goldroten Morgenlichte gleich Diamanten auf dem Grase funkelt, wenn Seen und Ströme Nebel aushauchen und die Erde dampft. Aber so sehr sich manche dieser mit wenigen sicheren Strichen gemalten Naturbilder moderner Schilderung nähern: immer bleibt doch auch hier der Blick an der einzelnen Erscheinung haften. Von dem eigentümlichen Charakter, den die Landschaft und ihre Teile durch die Beleuchtung erhalten, ist nirgends die Rede, nirgends von den verschiedenen Wirkungen der Nähen und Fernen, nirgends von all den Abstufungen, die zwischen einem kalten Mondlicht und der Glut der Abendsonne liegen, nirgends von den wundervollen Farben, in die sich im Süden morgens und abends der Horizont und ferne Berge tauchen, und die vom zartesten Rosenrot durch alle Grade zum tiefsten Blau gehen. In der ganzen antiken Literatur wird man vergebens einen Ausdruck wie »blaue Berge«, »dämmernde Fernen« suchen, in der ganzen antiken Poesie vergebens eine Stelle, die, wenn auch nur in wenigen Zügen, ein charakteristisches Bild einer Landschaft in bestimmter Beleuchtung und Stimmung vor die Seele stellt, wie etwa jene im Faust:
Ich sah' im ew'gen Abendstrahl
Die stille Welt zu meinen Füßen,
Entzündet alle Höh'n, beruhigt jedes Tal,
Den Silberbach in goldne Ströme fließen.
In keiner der Inschriften der Memnonsäule wird auch nur mit einem Worte der landschaftlichen Wirkung der steigenden Morgenröte und des Sonnenaufgangs gedacht. Ovid sah Rom zum letzten Male im Mondschein, und wie hätte ein moderner Dichter von seiner Begabung bei dem Bilde der so beleuchteten Stadt verweilt: er, der es sonst so sehr liebt, Nebendinge auszumalen, hat kaum ein flüchtiges Wort dafür, während er über den tränenreichen Abschied von den Seinigen äußerst wortreich ist. Tacitus erzählt, daß bei einem nächtlichen Gefecht zwischen den Flavianern und Vitellianern der Mond im Rücken der ersteren aufging; aber nur, um die Nachteile zu erwähnen, welche diese Beleuchtung für die letzteren hatte, nicht um ihrer malerischen Wirkung zu gedenken, was sich auch der strengste, doch gleich Tacitus künstlerisch darstellende moderne Historiker kaum versagt hätte. Vergil vergleicht den Gang des Äneas durch das Schattenreich mit einer Wanderung durch den Wald bei trügendem Schein des verhüllten Monds, ohne hier und an einer andern ähnlichen Stelle die Wirkung des trüben Lichts auf die nächtliche Landschaft auch nur anzudeuten. Dagegen läßt er die Penaten dem Äneas in klarem, vollem Mondlicht erscheinen, so daß sie aufs deutlichste erkennbar vor ihm stehen; offenbar ohne, wie wir Modernen, etwas »Geisterhaftes« in dieser Beleuchtung zu finden, statt deren übrigens ein neuerer Dichter für eine solche Erscheinung wohl eher ein »ahnungsvolles Dämmerlicht« gewählt haben würde.
Denselben Unterschied wie zwischen antiker und moderner Naturauffassung dürfen wir nach den Philostratischen Gemäldebeschreibungen und einigen erhaltenen Bildern auch zwischen antiker und moderner Landschaftsmalerei voraussetzen. »Jene legte das Hauptgewicht auf das topographische und plastische Element und strebte danach, schöne und bedeutungsvolle Formen in übersichtlicher Weise zu einem organischen Ganzen zu entwickeln; dagegen waren die in der Gegend wirkenden Potenzen von Luft und Licht für sie von nebensächlichem Interesse, und sie hat der atmosphärischen Stimmung niemals den Platz eingeräumt, welchen dieselbe in der modernen und namentlich der modernsten Malerei einnimmt.« »Jenes Dämmernde, Träumerische, Ahnungsvolle, wie es die letztere vorwiegend durch die atmosphärische Schilderung erzielt, ist ein der Klarheit des klassischen Geistes vollständig zuwiderlaufendes Element. Die künstlerische Verwirklichung solcher Eindrücke setzt ein sentimentales Versenken in die Natur voraus, wie es den Alten stets fremd blieb und auch in der modernen Entwicklung erst spät zur vollendeten Ausbildung gekommen ist. Außerdem hat man zu bedenken, daß der südliche Himmel, welcher die antike Malerei bedingte, im Vergleich mit dem nordischen ungleich weniger Erscheinungen darbietet, die geeignet sind, eine solche träumerische oder gar schwermütige Stimmung zu befördern.« Endlich war auch der antiken Landschaftsmalerei die koloristische Stimmung, welche namentlich durch Verwirklichung atmosphärischer Erscheinungen erzielt wird, um so weniger erreichbar, je schwerer malerischer Reiz und plastisch vollendete Formenbildung, nach welcher letzteren sie vor allem strebte, sich vereinigen lassen.
Die Beschränkung der Reisen im Alterturn auf ein verhältnismäßig enges Ländergebiet war zwar zunächst und hauptsächlich durch den Mangel des germanischen Wandertriebes bedingt, doch hängt sie auch, wie es scheint, mit der Beschränkung des Naturgefühls auf ein enges Gebiet der Erscheinungen zusammen. Reisen ins Innere Afrikas blieben offenbar vereinzelt, die Inseln an seiner Westküste unbetreten. Auch das Märchenland Indien scheint die Reiselust der Römer nicht gereizt zu haben. Obwohl jahraus, jahrein große Handelsflotten von Alexandria an die Küste von Malabar segelten, und also die Gelegenheit, Indien zu sehen, stets geboten war, scheinen Reisen dorthin zu andern als kaufmännischen Zwecken in den beiden ersten Jahrhunderten äußerst selten gewesen zu sein. Dio von Prusa beruft sich bei seinen Berichten über Indien auf die Angaben solcher, die dort gewesen seien; diese hätten die Fahrt des Handels wegen gemacht und ihre Zahl sei nicht groß, auch lernten sie nur die Küstenbewohner kennen. Hin und wieder mochte jemand aus Lust an Abenteuern die Reise mitmachen, wie Lucian von einem jungen Paphlagonier erzählt, der in Alexandria studierte und sich bereden ließ, da ein Schiff an das Südende des Roten Meeres ging, nach Indien zu fahren. Das einzige Motiv solcher Fahrten, das erwähnt wird, ist nicht der Wunsch, die Tropenwelt, sondern die Lehren und die Lebensweise der Brahmanen kennenzulernen, denen, wie überhaupt den Philosophen der Barbarenländer, man nach einer schon in Alexanders des Großen Zeit verbreiteten, später namentlich durch peripatetische Gelehrte befestigten Ansicht eine überlegene Weisheit zuschrieb. Aus diesem Grunde läßt auch Philostrat unter Berufung auf das angebliche Tagebuch des Damis seinen Apollonius von Tyana nach Indien pilgern. Der Verfasser mag seine Nachrichten aus schriftlichen oder mündlichen Mitteilungen, wie man sie in Alexandria von Indienfahrern leicht erhalten konnte, geschöpft haben. Vielleicht sind seit dem 2. Jahrhundert griechische Philosophen nicht ganz selten nach Indien gewandert, um bei den hochgepriesenen indischen Weisen in die Schule zu gehen. Lucian erzählt es von einem attischen Kyniker Demetrius, der die Reise von Alexandria dorthin machte. Plotinus schloß sich, um die persische und indische Philosophie kennenzulernen, im Jahre 242 dem Zuge des Kaisers Gordian nach Persien an; nach dessen Ermordung entkam er mit Not nach Antiochia. Auch bei der Reise des Philosophen Metrodorus (eines Mannes von persischer Abkunft) nach Indien in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts war ein Besuch der Brahmanen der Zweck oder doch Vorwand, und es soll ihm gelungen sein, durch Enthaltsamkeit und Mitteilung von Erfindungen, die ihnen unbekannt waren, ihr volles Vertrauen zu gewinnen. Hieronymus wußte bereits, daß nach den indischen Gymnosophisten der Stifter ihrer Lehre Buddha von einer Jungfrau geboren sein sollte. Mögen nun aber solche Reisen auch viel öfter vorgekommen sein, als wir es durch diese spärlichen Nachrichten wissen, so blieben sie doch ohne Zweifel vereinzelt und waren ihrer Zwecke wegen nicht geeignet, eine Kenntnis der Tropenwelt zu vermitteln.
Diese Seltenheit der Reisen in ferne, besonders tropische Länder und das Fehlen der wirksamen Anregungen zu solchen Reisen stand in Wechselwirkung. Humboldt nennt solcher Anregungen hauptsächlich drei: dichterische Naturbeschreibung, Landschaftsmalerei und Kultur von tropischen Gewächsen. Bei ihm selbst haben zu einer unvertilgbaren Sehnsucht nach der Tropengegend den ersten Anstoß gegeben: Georg Forsters Schilderungen der Südseeinseln, Gemälde der Gangesufer im Hause von Warren Hastings zu London, ein kolossaler Drachenbaum in einem alten Turme des botanischen Gartens bei Berlin.
Wie sehr das Altertum diese Anregungen entbehrte, ergibt sich zum großen Teil schon aus der bisherigen Darstellung. Die Naturbeschreibung, die es bezweckt und erreicht, den Eindruck der geschilderten Szenen zu reproduzieren, die dargestellte Natur vor die Seele des Lesers zu zaubern, wie sie nächst Forster vor allen Humboldt selbst ins Leben gerufen hat, ist einer der modernsten Zweige der Literatur, und zu ihrer Entstehung hat es außer andern Bedingungen einer Verbindung der Darstellungskunst mit der Naturwissenschaft bedurft. Landschaftliche Bilder, welche die Sehnsucht nach fernen Ländern hätten erregen können, gab es im römischen Altertum nur von Ägypten. Die Kultur exotischer Gewächse war sehr beschränkt. In ihren Treibhäusern zogen die Römer nur frühe Früchte und Blumen im Winter. Von den »fremden Bäumen, die es nicht lernen wollen, anderwärts zu wachsen als in ihrem Geburtslande«, scheint die Palme im Altertum und Mittelalter in Italien allerdings häufiger gewesen zu sein, als sie es (mit Ausnahme des Palmenhaines von Bordighera) gegenwärtig ist. Schon im Jahre 291 v. Chr. wird sie in Antium erwähnt und mag auch wohl bei griechischen Städten der Westküste als Begleiterin apollinischer Heiligtümer gestanden haben. In Plinius' Zeit war sie in Italien bereits gemein. Der oben (S. 413) erwähnte Bologneser Petrus de Crescentiis empfiehlt für die Gärten nicht bloß der Fürsten und Edeln, sondern auch der Personen des Mittelstands die Anpflanzung der (wohl von den Sarazenen in Calabrien und Sicilien aufs neue eingeführten) Palmen. Die in der ersten Kaiserzeit aus Asien eingeführten Fruchtbäume, Aprikose, Pfirsich und Pistazie, verloren durch die Akklimatisation schnell den Charakter des Fremdartigen, doch die Zitronen blühten im Freien vielleicht nicht vor dem 4. Jahrhundert; und die Orangen sind bekanntlich, so wie manche andre, jetzt für die Natur Italiens als charakteristisch geltende Bäume und Gewächse, im Altertum völlig unbekannt gewesen. In Gärten sah man allerdings außer offizinellen auch einige fremde Gewürz- und Zierpflanzen, wie den Pfefferbaum und die Weihrauchstaude, die blätterreiche Cassia, Myrrhe und Krokus; aber gewiß nichts weniger als gruppenartige Zusammenstellungen exotischer Gewächse, die ein Bild der tropischen Vegetation im kleinen zu geben vermocht hätten.