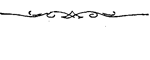|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»
Si fractus illabatur orbis,
Impavidam ferient ruinae.«
Die Stunde war da, in welcher Königin Luise zeigen sollte, ob sie die Probe zu bestehen vermöge, die das Unglück auf den im Glück gesammelten Schatz an Charakter und geistiger Stärke macht. Der Krieg wurde an Napoleon erklärt und nun war es endlich vorbei mit dem feigherzigen Hinhalten und Parlementiren.
Mochte sich nun aber auch mit der verschwundenen Ungewißheit über den zu fassenden Entschluß in manchen Kreisen, namentlich in denen der Offiziere, eine freudigere Stimmung kundgeben, – im Volke, im Heere, ja selbst beim König war hiervon so gut wie nichts zu merken. Es war, wie ein Zeitgenosse schreibt, nicht jene gesunde Begeisterung, die aus der frischen Tiefe des Gemüthes hervorquillt; es war der beschränkte Uebermuth, welcher den abgelebten, in langem Frieden verrosteten, ohne höheren, kriegerischen Sinn überlieferten militärischen Formen eine zauberische Gewalt zuschrieb.
Die höheren Offiziere zählten zwar manche treffliche Männer in ihrem Corps, im Ganzen aber war es eine wurmstichige Gesellschaft; der jüngste General war 52 Jahre alt, von den Majors waren mehr als zwei Drittheile über die fünfzig und sechzig hinaus. Dazu herrschte keine Einheit, keine straffe, durch einen dominirenden Charakter zusammengehaltene Bewegung, sondern überall eine derartige Verwirrung, daß der König, der an keinen glücklichen Ausgang mehr glauben mochte, verzweiflungsvoll ausrief: »Das kann nicht gut gehen, es ist eine unbeschreibliche Confusion; die Herren wollen das aber nicht glauben und behaupten, ich wäre noch zu jung und verstände das nicht. Ich will nur wünschen, daß ich Unrecht habe.«
Schade genug, daß der König seine durchaus nicht gering anzuschlagenden Erfahrungen im Militärwesen, die jüngeren Datums waren als die der meisten seiner Generäle, diesen gegenüber nicht kräftiger geltend gemacht hat; es wäre dadurch viel Unheil verhindert worden. Aeußerte sich doch Gneisenau, der es wohl verstehen mußte, darüber: »Der König ist der unterrichtetste von Allen, die ihn umgeben haben. Unglücklicherweise ist er fremden Meinungen gefolgt und hat seine eigene hintangesetzt.«
Und zu all der Uneinigkeit und Verwirrung im Heere kam noch die geradezu apathische Haltung des Volkes, welches sich rettungslos den Franzosen preisgegeben sah, da es die politische Leitung des Staates in so unreinen, unzuverlässigen Händen wußte, wie die der oben geschilderten Kabinetsräthe waren. Es fühlte ganz gut heraus, daß es bei Hofe seit langer Zeit eine Partei gebe, welche offen darauf hindränge, Preußen zum Anschluß an den Rheinbund zu bewegen, das wollte sagen, es zum Vasallenstaat Napoleons zu machen und dafür den verheißenen Lohn einzustreichen. Das war »die schreckliche Zeit der Frechheit und Verwilderung«, von welcher Stein spricht.
Der Oberbefehl über die Preußische Armee lag in den Händen des mehr als 70jährigen Herzogs von Braunschweig, der durch die schlechte Ausnutzung der Schlacht bei Valmy gegen die ersten französischen Revolutionsarmeen wie überhaupt nach seiner lauen Kriegführung in der Champagne am wenigsten dazu geeignet war, dem Heere und dem Volke Vertrauen einzuflößen, – er, der sich selbst in den günstigsten Stellungen nicht mehr recht getraute, entschlossen drauf und dran zu gehen.
Die Reserve wurde durch den Prinzen Louis Ferdinand kommandirt, eine edel angelegte, nur zu leidenschaftliche Natur, die sich durch ihr eigenes Ungestüm das Verderben bereitete. Wo der Herzog von Braunschweig durch Langsamkeit fehlte, sündigte der feurige Prinz durch tollkühne Ueberstürzung. Ihm gebrach es an der nothwendigen Unterwerfung unter die oberste Heeresleitung; er glaubte, den Krieg auf eigene Faust führen zu können, und betrachtete die ganze Sache mehr in dem Lichte eines zur Entwickelung persönlichen Heldenmuthes geeigneten Zweikampfes als in dem eines Feldzuges, der über das Geschick von Staaten entscheiden sollte.
Beide sind eines beklagenswerthen Todes gleich in den ersten Schlachten gestorben, Beide haben ihre Schwächen durch einen guten Tod gesühnt, – und gegen Beide hat noch nach ihrem Tode Napoleon sich in der ganzen Rohheit seines henkermäßigen Charakters gezeigt!
Die Königin Luise trennte sich in den schweren Tagen des Oktobers 1806 nicht eher von ihrem Gemahl, als bis die unmittelbar bevorstehende Schlacht ihre Entfernung erheischte, – sie wollte sein Geschick theilen, mochte es noch so traurig ausfallen. An der Seite des Königs Friedrich Wilhelm reiste sie zur Armee nach Erfurt, dann nach Weimar und ließ an beiden Orten die auf die Schlachtfelder eilenden Truppen an sich vorüberdefiliren, um sie durch den Anblick ihrer allbeliebten Königin mit Muth zu erfüllen, – für sich selber aber Trost zu schöpfen aus der kriegerischen Erscheinung so vieler braver Landeskinder.
Der 10. Oktober 1806 brachte den ersten schmerzlichen Verlust mit sich, den Tod des Prinzen Louis Ferdinand bei Saalfeld. An der Spitze eines Kavallerieregiments zum Angriff auf eine bei weitem überlegene Heeresabtheilung der Franzosen vorgegangen, mußte er bald, von allen Seiten überwältigt, sich zur Flucht wenden, die er unter tapferster Gegenwehr antrat. Hier traf ihn der tödtliche Säbelhieb eines französischen Quartiermeisters, der nur einen höheren Offizier, aber nicht einen königlichen Prinzen in ihm vermuthete. Der Prinz hatte einen trüben Ausgang des Krieges schon lange geahnt, und viele wollten wissen, daß er an jenem Oktobertage den Tod absichtlich gesucht habe. Von ihm sang Körner:
»Einmal ward's in Deiner Seele Tag,
Als Dein Herz am kühnsten Ziel des Strebens
Kalt und blutend auf der Wahlstatt lag.«
Der Eindruck dieses Unglücks auf die Armee war ein niederschmetternder, zumal auch fast 2000 Mann mit 33 Geschützen dem Feinde bei Saalfeld in die Hände fielen und die Stärke der Reserve somit schwer erschüttert war.
Tags zuvor hatte die Königin Luise im königlichen Hauptquartier die denkwürdige Unterredung mit Gentz, in der sie sich die Bewunderung dieses kaltherzigen Diplomaten in so hohem Grade zu gewinnen wußte. Ihrer Frage an ihn, wie er über den bevorstehenden Krieg denke, fügte sie gleich selber die Worte hinzu: »Ich frage nicht etwa, um aus Ihrer Antwort Muth zu schöpfen, das habe ich Gott sei Dank nicht erst nöthig. Zudem weiß ich ja, daß, wenn Sie auch eine ungünstige Meinung von der Sache hegten, Sie mir dieselbe sicher nicht kundthun werden. Allein wissen möchte ich doch gern, worauf die Männer, die in der Lage sind, den Stand der Dinge zu beurtheilen, ihre Hoffnungen gründen, um dann zu sehen, ob deren Beweggründe mit den meinen übereinstimmen.«
Gentz fiel es namentlich auf, daß die Königin Luise in dieser Audienz sorgfältig die Nennung des Namens des Herzogs von Braunschweig vermied, während sie doch der andern preußischen Generäle Erwähnung that. Sie wußte nur zu wohl, in wie schwachen Händen das Schicksal ihres Landes ruhte. Wenn sie auch »aus einem Prinzip der Ehre und folglich der Pflicht« den Krieg für nothwendig hielt, so konnte sie doch nicht ihre stets wachsende Besorgniß für dessen Ausgang verscheuchen, denn die Unordnung und Kopflosigkeit im Generalstab waren ihr nicht entgangen.
Hier im Feldlager, vor den Schlachten bei Jena und Auerstädt, war es auf einmal der Königin Luise schrecklich klar geworden, wohin das seit Jahren in der Armee geübte Verfahren führen müsse. Sie ist es auch gewesen, die dem Hauptgrunde zu dem entsetzlichen Unglück Preußens zuerst den prägnanten Ausdruck gegeben hat in dem berühmten Worte an ihren Vater: » Wir sind nicht mit der Zeit fortgeschritten, darum überholt sie uns. Wir sind auf den Lorbern Friedrichs des Großen eingeschlafen.« Niemand hatte so deutlich wie sie erkannt, daß gerade die siegesgewisse Sorglosigkeit, der unerschütterliche Leichtsinn der Generäle und Offiziere, die mit dem Namen des großen Preußenkönigs nur ihre eigene Unfähigkeit verdeckten, zum Untergange geführt hatten. Ging ja doch dieser Leichtsinn in den leitenden Kreisen so weit, daß man nicht einmal die für Rekognoscirungen und Spione erforderlichen Kosten aufzuwenden für nöthig hielt. Ein Militärschriftsteller jener Tage weiß von dem Zustande im preußischen Heere zu berichten: »Mit stolzer Ruhe und Gleichgültigkeit ließen wir es geschehen, daß in ganz Sachsen und selbst bis nach Dresden französische Offiziere unter manchen Vorwänden und Verkappungen umherstreiften und sich mit voller Muße und Gemächlichkeit von allen militärisch wissenswerthen Gegenständen aufs genaueste unterrichteten. Alle Vorschläge, uns auf ähnliche Art Nachrichten zu verschaffen, wies man als unwürdige und kostspielige Tändeleien von der Hand.« – Uebrigens hatte ja Napoleon die besten Spione im eignen Heereslager der Preußen: wurde doch allgemein behauptet, daß der Plan zur Schlacht von Jena schon vorher Napoleon in die Hände gespielt worden sei!
Die preußischen Offiziere sprachen in einer Weise über die französische Armee und deren Befehlshaber, daß man merkte, sie hatten bisher keine anderen Feinde gesehen als die eingebildeten bei den Manövern. »Ein preußischer General,« hieß es, »muß doch wohl mehr vom Kriege verstehen, als diese Parvenüs von Schneidern und Schustern. Generale, wie der Herr von Bonaparte einer ist, hat die Armee Seiner Majestät mehrere aufzuweisen.«
Ganz unübertrefflich hat in späteren Jahren der Kernmann Stein diese Misere charakterisirt, die Preußen und mit ihm Deutschland ins Verderben stürzte, als er zur Kaiserin von Rußland, die sich tadelnd über den deutschen Volkscharakter zu ihm ausließ, die mannhaften Worte sprach: »Nicht das Volk war schuld, man wußte es nur nicht zu gebrauchen.«
Das vollwichtigste Zeugniß aber für die Bravheit der preußischen Truppen bei Jena und Auerstädt wie auch später auf den Feldern von Eylau und Friedland, im Gegensatz zu dem »kaum halbdeutschen Adel« vieler Festungskommandanten, hat Napoleon selbst abgelegt, der weit davon entfernt war, seinen Feind deshalb zu unterschätzen, weil dieser einmal von ihm besiegt war. Er sagt wörtlich über die preußischen Soldaten und Offiziere: » Les troupes prussiennes sont bonnes, très-bonnes. Elles n'ont fait rien qui vaille. Pourquoi? Parce que personne ne savait les commander; si je les eusse conduites, elles se seraient battues comme des Français.« – Ebenso gut wie seine Führung wäre wohl auch die von einem Dutzend Generäle von der Art eines Blücher und Gneisenau gewesen.
Am 14. October trafen die beiden feindlichen Armeen bei Jena und Auerstädt auf einander. Das Resultat der blutigen Schlachten ist nur zu bekannt: die Armee in wilder Flucht, der Feind auf die Hauptstadt des Landes anrückend, Hilflosigkeit und Verwirrung, Verrätherei und Feigheit überall.
Die Königin Luise hatte am Tage vor der Schlacht Weimar verlassen und erhielt noch vor ihrer Ankunft in Berlin am 17. October die niederschmetternde Nachricht von den vernichtenden Verlusten. So war denn furchtbar eingetroffen, was ihr Gemahl vorausgeahnt, was sie selbst nicht aus ihrer Seele hatte bannen können: der preußische Staat sollte das Schicksal all der Länder theilen, mit denen Napoleon verfuhr wie der Krämer die Elle in der Hand mit seinen Waaren.
Während die Umgebung der Königin diese zu trösten suchte mit dem bei solchen Gelegenheiten so hoffnungslosen Trost: »es kann ja Alles noch besser werden«, – sah sie die Sache ganz so schlimm an, wie sie wirklich stand. Sie verhehlte sich nicht, daß für lange Zeit jede Rettung unmöglich sei, und das war es, was ihr Herz so tief beugte. Zu ihren beiden ältesten Söhnen gewendet, rief sie, sich zur Flucht vor dem Feinde anschickend, schmerzlich aus: »So sehe ich denn ein Gebäude an einem Tage zerstört, an dessen Erhöhung große Männer zwei Jahrhunderte gearbeitet haben. Es gibt keinen preußischen Staat, keine preußische Armee, keinen Nationalruhm mehr; der ist verschwunden wie der Nebel, der auf den Feldern von Jena und Auerstädt die Gefahren der unglücklichen Schlachten verborgen hat!«
Die Flucht aus Berlin im kalten Herbst, mit weniger in der Eile zusammengeraffter Habe, kaum dem Nothwendigsten, mit ihren zum Theil noch im zartesten Alter stehenden Kindern, – das waren die ersten Tropfen aus dem bittern Schmerzenskelch, den sie bis zur Neige leeren mußte und über dem ihr treues, großes Herz brach.
Erst in Küstrin traf die Königin Luise mit ihrem Gemahl zusammen, um dann gemeinschaftlich die Flucht an die Ostgrenze des Reiches fortzusetzen. Anfangs lauteten die Nachrichten, die ihnen nachgesendet wurden, im Einzelnen nicht gerade ungünstig, mancher brave Regimentscommandeur rettete seine Truppen aus den Händen überlegener Feindeshaufen. Namentlich zeigte sich schon damals der alte Blücher als einen der wenigen tapferen Helden, der, »da Alles versank, noch muthig auf zum Himmel den Degen schwang«; der sein gerettetes Corps erst dann in Lübeck kapituliren ließ, als dasselbe, wie er ausdrücklich im Vertrage bemerkte, kein Brot und keine Munition mehr hatte, und der unverhohlen erklärte, »wenn der König gefangen werde und ihm befehle, eine Festung zu übergeben, so würde er ihm keinen Gehorsam leisten.«
Bald aber folgte eine Hiobspost auf die andere, noch trauriger und niederdrückender als die Nachricht von verlorenen Schlachten. Was die Königin Luise bei dem Verrath der Festungskommandanten empfunden, dem schändlichsten, den je die Kriegsgeschichte zu verzeichnen hatte, das bezeugen die Klagen, die sie ihrem Tagebuch anvertraute, das bezeugen die Verse, die sie damals weinend niederschrieb von dem »Brot der Thränen.« Erst die sich in der opferfreudigsten Hingebung zeigende Liebe der treuen Unterthanen Ostpreußens vermochte in Luisens Brust den Glauben an die edlere Natur der Menschen vor dem Sinken zu bewahren, der durch den schmachvollen Abfall jener Männer von der Sache ihres Gemahls und des Vaterlandes so hart erschüttert worden war.
Die große Königin fühlte, vor edler Scham erröthend, daß alle Tapferkeit des »gemeinen Mannes«, die sich ja so reichlich noch in manchen Gefechten nach den Schlachten von Jena und Auerstädt bewährt hatte, nutzlose Aufopferung sei, wenn die hochgestellten Offiziere, denen der König den stärksten Schutz des Landes, seine Festungen, anvertraut hatte, niederträchtige Schurken und Feiglinge seien.
Es ist geradezu unglaublich, wie in den Wintermonaten von 1806/7 die Festungskommandanten förmlich mit einander wetteiferten, sich gegenseitig an Gemeinheit zu übertreffen. Derselbe Herr von Ingersleben, Kommandant von Küstrin, der wenige Tage zuvor dem gebeugten Königspaar tapferste Gegenwehr angelobt hatte, übergab ohne einen Kanonenschuß, ohne einen Schwertstreich einer Handvoll Franzosen die vielleicht stärkste Festung des Landes; obgleich Küstrin derartig durch Moräste geschützt lag, daß der Herr Oberst den Feinden selbst die Kähne schicken mußte, um sie damit in die Festung zu schaffen!
Am 8. November 1806 ergab sich Magdeburg zur größten Verwunderung Ney's, der sich auf einen erbitterten Widerstand seitens der stattlichen Besatzung gefaßt gemacht hatte. – Das Erscheinen einiger versprengter französischer Husaren vor den Mauern von Stettin genügte, um dessen »Vertheidiger«, den General von Romberg, zur Kapitulation zu bewegen. Aehnlich fielen auch Spandau, Glogau, Hameln und Nienburg in den nächsten Wochen ehrlos dem Feinde in die Hände. Die einzigen Festungen, die sich noch einige Zeit hielten, waren außer dem heldenmüthigen Kolberg und Danzig noch Graudenz, Breslau, Brieg, Schweidnitz, Neiße und Glatz; aber auch sie widerstanden größtentheils nicht lange – und Preußen war wehrlos in den Händen der Franzosen.
Das war mehr, als Königin Luise ertragen konnte. Das große Unglück, welches der eiserne Würfel des Krieges über das Land gebracht, ließ sich begreifen und darum mit Würde tragen; aber diesem feigen Selbstaufgeben, diesem sogar von den Feinden verachteten Verrath gegenüber krampfte sich ihr Herz in unsagbarem Weh zusammen und sie erkrankte gefährlich, nachdem sie kaum mit den Kindern einen vorübergehenden Ruhepunkt vor den nachrückenden Franzosen in Königsberg gefunden. Diesmal widerstand noch ihre gesunde Jugendkraft den immer schrecklicher auf sie einstürmenden Schlägen des Geschickes, jedoch der Keim zu der Krankheit, der sie nach wenig mehr als drei Jahren unterlag, blieb in ihrem Herzen haften und ließ keine rechte Freudigkeit mehr in ihr aufkommen.
Die tapfere Vertheidigung Kolbergs durch den Bürger Nettelbeck, Danzigs durch seinen nicht von der allgemeinen Entartung betroffenen Kommandanten General Kalckreuth waren zwar nur vorübergehende Sonnenblicke in den dunkeln Wintertagen an den Grenzen des Reichs, aber die Aermste klammerte sich mit dem Muthe des Gottvertrauens und der festen Zuversicht auf ein endliches Besserwerden, wenn auch zu spät für sie, an diese Beweise preußischer Ehrenhaftigkeit und preußischer Königstreue und suchte die Muthlosen in ihrer Umgebung wieder aufzurichten. »Die Königin«, schreibt die getreue Frau von Voß, »ist bei all den schrecklichen Nachrichten wirklich wie ein Engel; ihre Ergebung in den Willen Gottes und ihre Frömmigkeit lassen sie Alles mit solcher Kraft und Sanftmuth ertragen, daß es einem das Herz ergreift und erhebt.«
Hier zeigte sich die ganze Stärke des weiblichen Gemüths, das sich zwar leichter von dem ersten Ansturm des Unglücks beugen läßt als die festere Seele des Mannes, sich aber auch schneller wieder emporrichtet, sich in das Unvermeidliche zu fügen, ja es zu ändern sucht. Selbst im tiefsten Elend will die große Tochter vor ihrem greisen Vater nicht verzagt erscheinen, darum schreibt sie ihm die trostreichen Worte: »Glauben Sie ja nicht, daß Kleinmuth mein Haupt beugt!« So ward sie der prächtige Stern, der in Preußens Nacht als Leuchte für unzählige zerschlagene Herzen erstrahlte und noch nach seinem Verschwinden vom hohen Firmament eine so breite Spur in dem Andenken aller Edeln zurückließ.
Napoleon war in den letzten Tagen des October mit der Armee bis Potsdam gekommen, wo er ein paar Tage verweilte, während sein General Davoust nach Berlin vorausgeschickt wurde. In Potsdam besuchte der Kaiser auch die Gruft Friedrichs des Großen und schämte sich nicht, die Feldherrninsignien des großen Königs in Barbarenweise von dessen Sarge zu stehlen!
Am 27. October sahen ihn dann die Berliner in ihre Stadt einziehen, die bald zu einem französischen Bivouak wurde. In welcher Weise Napoleon, »diese Sonne, deren Strahlen den Erdkreis erleuchten«, wie es auf einem Transparent zu seiner Verherrlichung hieß, während seines Aufenthaltes in Berlin gehaust hat, das bezeugten die Kunstgegenstände und Trofäen, die er mit ächt römischem Triumfatorenübermuth nach seinem großen Raubstapelplatz Paris schleppen ließ.
Sein Haß gegen Preußen ließ ihn nicht lange in Berlin verweilen, er trieb ihn weiter dem fliehenden Königspaare nach, dem er die Zufluchtsstätte in Königsberg nicht gönnte. In der Provinz Preußen kam es noch einmal zwischen den sich sammelnden preußischen Truppen, die von den Tagen bei Jena und Auerstädt verschont waren, und dem überlegenen französischen Heere zur blutigen Schlacht bei Eylau, in der die Preußen Wunder der Tapferkeit thaten und den sieggewohnten Kaiser zwangen, mit König Friedrich Wilhelm III. über Friedensbedingungen zu verhandeln.
Hier war es nun wiederum des Königs und seiner Gemahlin hohes Ehrgefühl, welches sie das Festhalten an dem bis jetzt für sie so fruchtlos gewesenen russischen Bündniß für Pflicht ansehen ließ, so daß die Gelegenheit, günstige Friedensbedingungen im Angesicht einer für Preußen ziemlich glücklich ausgefallenen Schlacht zu erlangen, versäumt wurde. »Luise bat den König aufs innigste, fest zu bleiben und nur jetzt nicht den Frieden zu schließen« – so heißt es in der kleinen Chronik der Voß, was ganz übereinstimmt mit den Worten der Königin an ihren Vater: »Diese Handlungsweise wird Preußen Glück bringen, das ist mein fester Glaube!«
Bei der Nachricht von dem Anrücken der Franzosen auf Königsberg, welches die Königin kaum erreicht hatte, mußte sie dasselbe in einer der kältesten Nächte des Januar 1807 verlassen, zum Tode krank und von ihrem treuen Arzt Hufeland beinahe aufgegeben. Dazu lag ihr jüngstes Söhnchen Prinz Karl im heftigsten Fieber und in dem unwohnlichen Schlosse zu Königsberg herrschte die entsetzlichste Noth und Bedrängniß.
Wie wahrhaft himmelschreiend das Elend der Königin Luise in jenen Tagen und schon vorher gewesen, bezeugt ein Tagebuchblatt Hufelands ergreifender, als wir zu schildern uns unterfangen. Er schreibt: »Endlich ergriff der böse Typhus auch unsere herrliche Königin, an der alle Herzen und auch unser Trost hing. Sie lag sehr gefährlich darnieder, und nie werde ich die Nacht des 22. Dezember An demselben Tage war Luise vor 12 Jahren freudestrahlend in Berlin eingezogen. 1806 vergessen, wo sie in Gefahr lag, ich bei ihr wachte und zugleich ein so fürchterlicher Sturm wüthete, daß er einen Giebel des alten Schlosses, in dem sie lag, herabriß. Plötzlich kam die Nachricht, daß die Franzosen heranrückten. Sie erklärte bestimmt: »Ich will lieber in die Hände Gottes als dieses Menschen fallen!« – und so wurde sie den 3. Januar 1807 (mittlerweile hatte die Krankheit sich etwas gebessert) bei der heftigsten Kälte, bei dem fürchterlichsten Sturm und Schneegestöber in den Wagen getragen und 20 Meilen weit über die Kurische Nehrung nach Memel transportirt. Wir brachten drei Tage und drei Nächte, die Tage theils in den Sturmwellen des Meeres theils im Eise fahrend, die Nächte in den elendesten Nachtquartieren zu. Die erste Nacht lag die Königin in einer Stube, wo die Fenster zerbrochen waren und der Schnee auf ihr Bett geweht wurde, ohne erquickende Nahrung.« – –
Sechs Jahre später in derselben Nacht schlief Napoleon auf seiner Flucht aus Rußland in der Schneewüste um Wilna auf harter Bank, fröstelnd, hungrig – und schuldbeladen.
» So hat noch keine Königin die Noth empfunden! Und dennoch erhielt sie ihr Muth und ihr himmlisches Vertrauen auf Gott aufrecht und er belebte uns Alle. Selbst die freie Luft wirkte wohlthätig. Statt sich zu verschlimmern, besserte sie sich auf der bösen Reise. Wir erblickten Memel am jenseitigen Ufer: zum ersten Male brach die Sonne durch und beleuchtete mild und schön die Stadt, die unser Ruhe- und Wendepunkt werden sollte.«