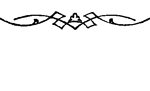|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Auch aus entwölkter Höhe
Kann der zündende Donner schlagen.
Darum in deinen fröhlichen Tagen
Fürchte des Unglücks tückische Nähe!«
Während man sich am preußischen Hofe trotz der im Westen allmählich immer bedrohlicher aufziehenden Wetterwolken in einer fast idyllischen Ruhe nicht stören ließ und ängstlich Alles vermied, was dazu angethan sein konnte, den Staat in die allgemeine Umwälzung mitzuverwickeln, war Napoleon einzig darauf bedacht, wie er dieses Preußen, das einzige Land, welches ihm bis dahin vorsichtig aus dem Wege zu gehen verstanden hatte, seine Hand fühlen lassen könnte. Und gerade das Land, in welchem die Wiege der Königin Luise gestanden, Hannover sollte den Anlaß zu dem kriegerischen Zusammenstoß Preußens mit Frankreich bilden.
Napoleon wußte nur zu gut, wie jämmerlich die Zustände des noch immer so genannten »heiligen römisch-deutschen Reiches« vornehmlich in der letzten Zeit geworden, wie es weder heilig, noch römisch, noch ein Reich mehr war. Er brauchte nur kühn zuzugreifen, um dem gräulichen Wirrwarr, der überall eingerissen, sich zu Nutze zu machen. Daß Preußen jedoch ihm hierbei leicht gefährlich werden könnte, daß auch er an der Macht, die ein Friedrich der Große geschaffen, abprallen möchte, leuchtete ihm ein. Darum war seine Intriguenpolitik darauf gerichtet, Preußen in eine schiefe Stellung zu dem westlichen Deutschland zu bringen, sich dadurch der Mithülfe des letzteren gegen seinen einzig für gefährlich gehaltenen Feind zu versichern und dann vernichtend über denselben herzufallen. Hätte er aber ahnen können, wie selbst Preußen in seinem innersten Kern durch den langen Zustand der Erschlaffung und Versumpfung erschüttert war, hätte er gewußt, daß im Herzen der Hauptstadt des gefürchteten Feindes Landesverrath und Erbärmlichkeit jeder Art ihm beim ersten Angriff so in die Hände arbeiten würde, wie das später geschah, – Preußens Schicksal wäre dann sicher schon früher besiegelt gewesen.
Der größte Fehler, den Preußen dem ränkevollen Verfahren Napoleons gegenüber begehen konnte, bestand darin, nicht selbst den Anfang des Losschlagens zu bestimmen, die vielleicht noch günstige Gelegenheit zu einem erfolgreichen Vorgehen zu versäumen und es so durch eigene Schuld dahin kommen zu lassen, daß Napoleon ihm 20 Meilen von der Hauptstadt den Krieg zu einer Zeit anbot, wo Niemand auf denselben genügend vorbereitet war.
Und hätte auch die Kabinetspolitik seiner Räthe den König Friedrich Wilhelm III. gehindert, klar zu sehen in den Folgen des gefährlichen Spiels mit dem Frieden, welches Preußen mitten unter den europäischen Wirren fortführen zu können glaubte, so hätten ihn doch die Schlag auf Schlag folgenden schamlosen Gewaltthaten Napoleons, gegen deutschen Boden und deutsche Bürger verübt, von der fürchterlichen Wahrheit überzeugen müssen, daß jetzt der Augenblick des » omnis in ferro salus« gekommen sei.
Den Anfang mit seinen Versuchen, wie weit wohl die deutsche Geduld gehe, machte Napoleon mit dem Morde des Duc d'Enghien, den er gegen alles Völkerrecht im Jahre 1804 von dem neutralen badischen Boden fortschleppen ließ. Hatte auch Deutschland keine zwingende Veranlassung, sich für einen französischen Emigranten übermäßig anzustrengen, der Napoleons Unwillen erregt hatte, so gebot doch die Heilighaltung des Gastrechts und der Schutz vor solcher Rechtsverletzung des deutschen Territoriums die schleunigste bewaffnete Abwehr eines derartigen Bubenstücks. Aber keine Stimme in Deutschland wurde laut gegen dieses Attentat eines Mörders, der nach geschehener That noch den bitter schmerzenden Spott zu der Schmach fügte, indem er solcher deutschen Muthlosigkeit gegenüber prahlte: »Es ist ein Irrthum, an eine deutsche Nation zu glauben. Es sind das höchstens Klagen Weniger am Grabe eines Volkes, welches sich selbst überlebt hat.«
Vergebens hatte Napoleon versucht, Preußens König durch den lockend in Aussicht gestellten Besitz Hannovers in seine Netze zu ziehen und ihn auf die Weise mit dem ganzen übrigen Deutschland und mit England aufs unheilbarste zu entzweien. Preußen sollte mißbraucht werden zum ersten Beispiel des Bruches der Verfassung, des Auflehnens gegen das reichsoberhauptliche Ansehen durch eigenmächtige, landfriedensbrüchige Besitzergreifungen. Der arge Versucher hatte sich aber in dem Charakter König Friedrich Wilhelms III. getäuscht, der genau so dachte wie seine Gemahlin Luise: » Von unsrer Seite wird nie etwas geschehen, was nicht mit der strengsten Ehre verträglich ist und was nicht mit dem Ganzen geht. Auf dem Wege des Rechts leben, sterben – und wenn es sein muß, Brot und Salz essen!«
Auch hier zeigte sich einmal wieder der gemeine Sinn Napoleons, der seine Machinationen nur auf die schlechtesten Leidenschaften seiner Feinde und der Menschen überhaupt basirte und dem daher der ehrenhafte Widerstand Friedrich Wilhelms III. keine Achtung abzwang, sondern die Politik des Hasses gegen Preußen nur noch mehr einschärfte.
Gerade damals bei einem so günstigen Anlaß, wo eine reiche, übrigens von Preußens Staatsmännern längst schon heiß ersehnte Beute zu gewinnen war, gab es vielleicht keinen Fürsten in ganz Europa, bei dem ein bürgerlich schlichtes Rechtsgefühl vor dem Wege zu dieser Beute so sittlich zurückschreckte wie bei Friedrich Wilhelm III. Wahrlich, das ehrenvolle Benehmen Preußens hätte ein besseres Schicksal verdient; erst spät hat sich das alte Wort »Recht muß doch Recht bleiben« an dem tief gebeugten Staate bestätigt.
Der innere, unmerklich sich vollziehende Verfall Preußens hat freilich mehr zu dessen Zusammensturze beigetragen, als alle Ränke, wie sie Napoleon Jahre lang gesponnen. Und dazu kam nun noch jene unglückselige Friedensliebe zur unrechten Zeit und dem unrechten Feinde gegenüber. Prinz Louis Ferdinand, der seine Liebe zum Vaterlande mit seinem Blute besiegelte, hatte schon lange zuvor in wahrem Seherthum ausgerufen: »Aus Liebe zum Frieden verdirbt Preußen es nach und nach mit allen Mächten.« Dieser Warnruf war ungehört verhallt, die verrätherischen Rathgeber des Königs sorgten schon dafür, daß dergleichen »Extravaganzen«, wie sie es zu nennen beliebten, nicht an sein Ohr drangen.
Wie erfolgreich der Verrath an dem Sturze Preußens gearbeitet, geht daraus hervor, daß wenige Tage, eigentlich nur zwei Schlachten an einem Tage, dazu genügten, um Napoleon den Weg in die Hauptstadt und bis an die fernste Ostgrenze der Monarchie unvertheidigt bloszulegen. Nie ist ein Staat systematischer zu Grunde gerichtet worden, nie einer jäher von einer stolzen Höhe herabgestürzt.
Napoleon war durch den von Westdeutschland und auch von Preußen geduldig hingenommenen Schimpf der Verletzung badischen Gebietes zum Zwecke einer Mordthat nur bestärkt worden in der Sicherheit des Erfolges seiner Politik. Getreu seiner nationalen Devise:
»Dies ist Korsennatur: rachsüchtig den Feind zu verfolgen,
Rauben und lügen, zuletzt leugnen der Gottheit Gewalt«
Seneka schreibt von dem Charakter der Bewohner Korsika's:
»
Prima est ulcisci lex; altera: vivere raptu;
Tertia: mentiri; quarta: negare deos!«
ging er jetzt einen Schritt weiter in seinen Angriffen gegen das völkerrechtlich geheiligte Besitzthum neutraler Fürsten. Der vereinzelte Streifen der preußischen Monarchie mit der Hauptstadt Anspach im Fränkischen war ihm auf seinem Zuge nach Oesterreich hemmend im Wege, und statt um dasselbe herumzugehen, ließ er trotz des feierlichen Protestes der geringen preußischen Besatzung seine Armee »auf sein ausdrückliches Geheiß« durch jenen Streifen Landes durchmarschiren. Das geschah am 3. October 1805.
Der Eindruck der Nachricht von diesem unerhörten Gewaltstreich mitten im Frieden auf den Berliner Hof war ein ungeheurer. Man wollte sofort mobil machen, und namentlich der König wie die Königin waren aufs Tiefste verletzt über diese ihnen und der Ehre des Landes direkt und absichtlich angethane Beleidigung. Ein Augenzeuge, der Minister Lombard, wahrscheinlich schon um jene Zeit einer der geheimen Agenten Napoleons, berichtet: »Ich habe den König noch nie so erregt gesehen wie an jenem Tage« – und der Kabinetsrath von Beyme will den König zornig haben ausrufen hören: »Ich will mit dem Menschen nichts mehr zu thun haben!«
Die Königin Luise, die schon über die Gewaltthat Napoleons gegen den Duc d'Enghien von dem heiligsten Unwillen erfüllt worden war, fühlte sich jetzt für immer abgestoßen durch diesen letzten Hohn gegen Preußen. In jenem Augenblicke, wo ganz Europa seine Augen auf ihr Land gerichtet hatte, von dessen Entschließung Napoleons Schicksal abhing, hat sie vielleicht zuerst klar den Gedanken in sich entwickelt, daß mit einem solchen Manne nur noch mit der Spitze des Schwertes zu verhandeln wäre. Damals war es, wo sich die innere Umwandlung der Königin Luise zu ihrer ganzen nachmaligen Haltung vollzog. Ihr, die sich niemals um Staatsangelegenheiten bekümmert zu haben schien, die wenigstens nie in dieselben hineingeredet hatte, konnte doch die allgemeine Lage Deutschlands dem vordringenden Napoleon gegenüber nicht entgehen, wenngleich sie sich über die Stärke Preußens, wie mit ihr alle Welt, täuschte. Aus ihrer Unterredung mit Gentz aus dem Jahre 1806 geht hervor, daß sie, stets aus der Ferne beobachtend, sich ein Urtheil über die Situation Europa's zu verschaffen gesucht hatte und darin glücklicher gewesen war als die überschlauen Diplomaten. Gentz bewunderte die politische Reife in den Anschauungen der Königin, die er keineswegs in ihr vermuthet hatte. Er schreibt hierüber in seinen Memoiren: »Ich erstaunte über die Genauigkeit, mit der sie jedes Ereigniß kannte, jedes Datum zitirte und selbst auf die unbedeutendsten Umstände aufmerksam machte.«
Von dem Tage der Anspacher Völkerrechtsverletzung stand der Entschluß der großen Königin fest, keinen Fußbreit von dem Wege der Ehre abzuweichen, den Ruhm eines Friedrichs des Großen nicht verdunkeln zu lassen durch einen abenteuernden Mörder, der längst bewiesen, daß seiner Habgier nichts heilig sei. Sie, das schwache Weib, die bis dahin vor dem Gedanken an einen Krieg Preußens und an die Gefahren, denen dadurch ihre Kinder ausgesetzt würden, erschreckt zurückgeschaudert hatte, wußte jetzt auf einmal, wohin sie zu blicken habe, wenn sie Besserung des unerträglichen und schimpflichen Zustandes für Preußen herbeiführen wollte.
Zu all den nutzlosen diplomatischen Verhandlungen, die Herr von Haugwitz nach den Andeutungen der Kabinetsräthe führte, stehen im schroffsten Gegensatz die denkwürdigen Worte, welche Königin Luise zu ihrem ältesten Sohne, dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm, an seinem zehnten Geburtstag sprach, als er in der zum ersten Male ihn schmückenden preußischen Uniform vor ihr stand, auf der Brust den Stern des Schwarzen Adlerordens, den jeder preußische Prinz an seinem zehnten Geburtstage erhält. Sie sprach: » Ich hoffe, mein Sohn, daß an dem Tage, wo Du Gebrauch machst von diesem Rocke, Dein einziger Gedanke der sein wird, Deine unglücklichen Brüder zu rächen,«– Worte, die uns unwillkürlich gemahnen an die jener spartanischen Heldenmutter, welche ihre Söhne selbst zur Schlacht rüstete und bei der Nachricht von ihrem ehrenvollen Tode stolz ausrief: »Dazu hatte ich sie geboren, daß sie für ihr Vaterland stürben, wenn dieses ihren Tod verlangte.«
Königin Luise wußte, daß für jede Nation einmal die Prüfungsstunde kommt, in der, wenn sie sich nicht selbst aufgeben will, nur eines ist, was retten kann; wo jede feigherzige Friedenspolitik vor der erröthenmachenden Schande des beleidigten Vaterlandes weichen muß; wo das Wort des Dichters in seine Rechte eintritt: »Das höchste Heil, das letzte, liegt im Schwerte, – Wasch' die Erde, – dein deutsches Land, mit deinem Blute rein!«
So dachte die Königin, – anders die Minister. Anstatt zu handeln, verhandelten sie, und Napoleon war vorsichtig genug, nicht zu früh seinem lange gehegten Groll gegen Preußen freien Lauf zu lassen. Wie der Tiger erst dann mit zerschmetterndem Sprunge über sein Opfer herstürzt, wenn demselben jeder Ausweg und jede Hülfe abgeschnitten ist und er in ihm seine sichere Beute erblickt, – so führte Napoleon mit ächter Tigerpolitik den vernichtenden Streich nicht eher gegen Preußen, als bis er alle Bundesgenossen, die demselben etwa noch geblieben sein mochten, kampfunfähig gemacht hatte. Gerade um jene Zeit der Verletzung des Anspachischen Gebietes hatte er näher liegende Pläne gegen Oesterreich im Werke; darum verschob er den Ueberfall bis auf die ihm gelegenste Zeit, ging auch bereitwillig auf die ihm vom Berliner Kabinet in ängstlicher Friedensliebe gebaute goldene Brücke, zahlte sogar eine Entschädigungssumme für seinen Bruch des Völkerrechtes, – und Preußen hatte noch die Frist eines kurzen Jahres gewonnen, um sich zu dem entscheidenden Kampfe zu rüsten.
Diese Frist aber hat es versäumt, auf halbem Wege wurde Halt gemacht, die weise Lehre Friedrichs des Großen: »nie einen Streich halb zu führen« wurde unbeachtet gelassen. So verstrich die Zeit, in der man unter den günstigsten Verhältnissen sich des Feindes hätte erwehren können, und machte der Platz, in der man es unter den ungünstigsten von der Welt thun mußte. Unabwendbar vollzog sich an dem verblendeten Staate das tragische Geschick, welches durch schlechte Diener, durch Treulosigkeit auf allen Seiten ermöglicht, aber doch hauptsächlich beschleunigt wurde durch den planlosen Zickzack politischer Wendungen und durch den Mangel an einem kräftigen Entschluß zur rechten Zeit.
Kaum hatten sich die erschreckten Gemüther über die Gewaltthat an dem Duc d'Enghien beruhigt, als schon ein neuer Mord Deutschland, diesmal viel nachhaltiger, in unbeschreibliche Aufregung versetzte. Der Buchhändler Philip Palm in Nürnberg wurde auf Befehl Napoleons seiner Familie entrissen, um wegen Verbreitung einer die gesunkenen Zustände Deutschlands aufs treffendste schildernden Schrift vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden. Ohne die gewichtigen Vertheidigungsgründe des Unglücklichen irgendwie zu berücksichtigen, verurtheilte ihn das aus sieben französischen Obersten bestehende Gericht zum Tode, und am 26. August des Jahres 1806 wurde Palm zu Braunau erschossen. Auch hier verhöhnte Napoleon in der rohesten Weise das in gerechte Entrüstung ausbrechende deutsche Volk; er fragte, »ob man denn glaubte, daß sieben französische Obersten einen falschen Spruch fällen könnten?« Und doch steht fest, daß die eigenen Worte des Kaisers dahin lauteten, »der Schuldige solle in 24 Stunden verurtheilt und hingerichtet werden.« – Das war die des Machwerks würdige Inauguration des berüchtigten von Napoleon am 17. Juli zuvor gegründeten Rheinbundes!
Nichts dient besser dazu, das strahlende Bild der edeln Königin von Preußen, der einzigen patriotischen Fürstin jener Tage, ins rechte Licht zu setzen, als das jämmerliche Treiben, welches sich damals in so üppiger Wucherblüthe an den meisten Deutschen Höfen entfaltete. Vornehmlich herrschte dies an solchen, die in kleinlichster Engherzigkeit und Kirchthurmpolitik nur die eigene Haut und das Bischen kläglicher Souveränetät von Napoleons Gnaden zu retten trachteten, und darüber das Deutsche Vaterland, ihnen nur ein Begriff fremd wie die Sprache ihrer Vorfahren, dem schimpflichsten Untergange anheimgaben. Keiner hat die Wirthschaft dieser Rheinbundsfürsten vor wie nach der Gründung der gegen das eigene Vaterland wüthenden Liga niederschmetternder gerichtet als der Freiherr von Hormayr, der würdige Landsmann Andreas Hofers, wenn er spricht von jener »das Mark des Landes auffressenden orientalischen Verschwendung und Verprassung, jenen grausamen Jagdwüthrichen, jenem mit Eigenthum, Freiheit und Leben willkürlich schallenden Minister- und Kanzlervezirat, dem Seelenverkauf auf alle möglichen Schlachtfelder, in ost- und westindische Pestlüfte oder gegen die junge Freiheit Amerika's, jener bodenlosen Maitressen- und Bastardenwirthschaft, deren Bild der populärste und tugendhafteste deutsche Dichter uns zu guter Letzt am Vorabend der französischen Revolution in »Kabale und Liebe« treu und wahr vor Augen gestellt hat.«
Uebrigens hat auch Napoleon nicht eine Spur von Achtung für dies ihm blindlings folgende » Parterre von Königen« gehegt, er hat sie behandelt wie einst Attila die ihm unterworfenen Fürsten. Nennt er doch den Getreusten der Treuen von diesen sogenannten Deutschen Fürsten in seiner rohen Kasernenmanier » vieille bête«; Anderen gegenüber spielt er den Schulmeister, der Zensuren austheilt und auch wohl gelegentlich die ungehorsamen, tölpelhaften Schüler auf die Finger klopft. Ein wahrhaft deutscher Mann aber, der Mensch ohne Menschenfurcht, Freiherr von und zum Stein, nannte sie kurzweg »Elende« und wollte auch nichts von einem suaviter in modo ihnen gegenüber hören.
So beschaffen waren jene Rheinbundfürsten, die frohlockend sich in die von dem jagenden Tiger ihnen, den bellend nachfolgenden Schakalen, zugeworfenen Ueberbleibsel des Raubes an Preußen theilten. Freilich dürfte wohl die Schuld an diesem unerquicklichen Verhältniß zwischen den beiden Haupttheilen Deutschlands ziemlich gleichmäßig auf beide sich erstrecken: der Rheinbund hätte nicht so unbedingt sich Napoleon in die Hände geliefert, wenn nicht Preußen das Bestreben neutral zu bleiben auf die Spitze getrieben hätte. Nicht wenig lockend mochte auch für Preußen die Aufforderung Napoleons gewesen sein, doch als Gegengewicht einen Nordbund zu stiften, den er dann in bekannter Zweizüngigkeit mit allen Mitteln zu hintertreiben wußte.
Wir zweifeln nicht daran, daß die Aeußerungen des Königs Friedrich Wilhelm III. nach der Gewaltthat von Anspach sowie die Worte der Königin Luise dem Franzosenkaiser sofort durch die feilen Spione, deren er nirgends entrathen konnte, entstellt berichtet wurden. Wenigstens beginnt mit dieser Zeit seine ganz persönliche, wahrhaft bestialische Verfolgung Luisens, die er ja gern als die Urheberin des Krieges darzustellen pflegte, aus dem instinktiven Gefühl heraus, daß sie eine der Wenigen sei, die seine nackte Verbrechernatur trotz des Firnisses der Lüge nicht zu düpiren vermöchte. Auf die Nachricht von der ihm drohenden Mobilmachung Preußens im Herbste 1805 rief er aus: »Der König von Preußen hat mir eine böse Viertelstunde gemacht, ich will sie ihm mit schlimmen Zinsen zurückerstatten!« Wem im Dezember 1805 nach der Unterzeichnung des für Hannover so verderblichen Preßburger Friedens Gelegenheit ward, die Talleyrand oder Davoust sich über Preußen äußern zu hören, der konnte keinen Augenblick an dem Wahnsinn der Rachgier zweifeln, der Napoleons Herz erfüllte und ihn kaum die Zeit erwarten ließ, seine Beute zu zerfleischen. Ein Gegner, den Napoleon so grimmig haßte, wie Preußen, mußte doch wohl Gefahren für ihn bergen; um so verwerflicher stellt sich darum die nahe an Hochverrath streifende Handlungsweise des Preußischen Gesandten von Haugwitz dar, der solchem für seinen Monarchen so günstigen Verhältniß keine vortheilhafte Seite abzugewinnen wußte.
Wie sehr Königin Luise in ihrem Abscheu vor dem keine Gewaltthat verschmähenden Feinde Recht gehabt, beweisen die wohlverbürgten Worte Napoleons ein Jahr nach ihrem Tode, die seine Absichten klar genug hervortreten lassen: » Je veux avoir les princes prussiens, ils me serviront de gages de la fidélité des troupes ... les princes apprendront ce que c'est que la guerre.« Das war das Schicksal, welches er den noch im Knabenalter stehenden Prinzen Fritz und Wilhelm, den Söhnen der Königin, zugedacht hatte; das Loos eines Thumelicus und Astyanax, welches er für seinen eigenen Sohn so ängstlich fürchtete, wollte er den Söhnen seines Feindes bereiten. Es bedarf wohl nur des Hinweises auf die Gefangenschaft Napoleons III., der vor König Wilhelm von Preußen den Degen senken mußte, um die wunderbare Vergeltung zu erkennen, die sich so sichtbar in den Geschicken der beiden Familien kundgibt.
Die Gewaltthat, verübt an dem preußischen Territorium, der Abfall der Rheinbundfürsten von Deutschland und vor Allem die Ermordung Palms schreckten die Königin Luise jäh auf und ließen ihr die Gefahr, der ihr Land entgegenging, in den schwärzesten Farben erscheinen. Sie stand den Sammlungen sicher nicht fern, die für die Familie des erschossenen Nürnberger Buchhändlers in Berlin veranstaltet wurden (in Süddeutschland hätte dergleichen damals schon für Hochverrath an Frankreich gegolten); sie suchte überhaupt jetzt ihren Einfluß besser zu verwerthen, als sie es in weiblicher Zurückhaltung bis dahin gethan.
Leider war gerade um die Zeit, wo Preußens Geschick durch den warmen Herzschlag seiner muthigen Königin vielleicht hätte abgewendet werden können, wo wenigstens ein freies Wort seiner geliebten Gemahlin bei dem Könige mehr vermocht hätte als die ränkevollen Machinationen der Haugwitz, Lombard, Beyme, e tutti quanti, – leider war die hohe Frau durch mütterliches Leid so angegriffen, daß sie in den Bädern von Pyrmont Erquickung suchen mußte und so dem Getriebe der preußischen Politik zur Abwehr gegen Frankreich noch ferner stand als zuvor.
Aus der Zeit von Luisens Aufenthalt in Pyrmont berichtet die Frau von Voß über ihre Gebieterin: »Sommer 1806. – Hier in dem ungezwungenen, geselligen Kreise der Badegäste ward meine geliebte Königin wahrhaft angebetet von Allen, Allen, die sie sahen. Sie vergaß sich nie, auch nicht auf einen Augenblick; aber bei dieser rührend sanften und doch so erhabenen Würde, die sie nie verließ, war ihr Wesen doch heiter, ja fröhlich, und ihre immer gleiche Freundlichkeit der Stimmung machte das Dasein Allen leicht und beglückt, die mit ihr lebten. Vor allem, wenn sie Briefe vom Könige oder von ihren anderen Angehörigen erhielt, war sie von einer strahlenden Freude, und sie beeilte ihre Rückkehr auch so viel als möglich, um nur zum Geburtstag des Königs wieder mit diesem vereint zu sein. Das Bad that ihr sichtlich gut. Ihre Freude bei dem endlichen Wiedersehen mit dem König, der ihr bis mehrere Meilen hinter Potsdam entgegenkam, war wahrhaft rührend.«
Bei diesem Wiedersehen, auf welches Luise sich so sehr gefreut hatte, erfuhr sie zum ersten Male, daß der Krieg mit Frankreich beschlossene Sache sei. Wie eine böse Vorbedeutung hat es ihr wohl später erscheinen müssen, daß im Frühling des verhängnißvollen Jahres 1806 ihr ein Söhnchen, der Prinz Ferdinand, starb. Mit diesem Trauertage fing für sie die herbe Zeit der Leiden an, die erst mit ihrem Tode ein Ende erreichte.
Preußen wurde durch die Rheinbund-Akte, dann durch die Napoleonischen Lügenkünste zur Hintertreibung des von ihm selbst angeregten Norddeutschen Bundes unter Preußens Führerschaft in seiner friedliebenden Haltung hart erschüttert. Jetzt war's aber schon zu spät geworden für einen leichten, hoffnungsvollen Krieg. Oestreich war von Napoleon niedergeworfen, und die etwaige Hülfe, die man von Rußland erwarten konnte und die Alexander I. seinem an der Gruft Friedrichs des Großen gegebenen Versprechen gemäß »seinem Waffengefährten und Freunde« Friedrich Wilhelm III. senden wollte, wurde durch das schändliche Spiel verrätherischer Botschafter vereitelt, die in den Tagen, wo Alles auf schleunigste Erledigung ankam, aus einer hochwichtigen Reise im Interesse des bedrohten Staates – eine Lustfahrt machten.
Vielleicht wäre es selbst nach der Gründung des Rheinbundes noch an der Zeit gewesen, sich mit England zu verbinden, die Festungen in Vertheidigungszustand zu setzen und sich hinter der Elbe zu sammeln; aber was half solche späte Entschlossenheit gegenüber einer landesverrätherischen Politik der Kabinetsräthe und gegenüber Festungskommandanten, wie denen von Küstrin, Glogau, Spandau, Stettin, Magdeburg etc. etc.?
Die Partei, die jetzt durch Zaudern und Zagen, durch Liebäugeln mit dem von ihr für einen Halbgott gehaltenen Napoleon im Begriffe stand, dem wankenden Staate den Todesstoß zu versetzen, war dieselbe mehr oder minder vaterlandslose, französelnde Partei, welche mit den das preußische Staatseigenthum an die Feinde verrathenden Amtleuten anfing und in einem Minister Lombard, dem Sohne eines französischen Friseurs, gipfelte.
Diese Parteigänger hatten stets der Königin Luise übelgewollt: sie war ihnen zu deutsch, zu gerade und einfach. Bei ihr wollten die frivolen Künste dieser »Polissons« nicht verfangen, wenngleich sie nicht hindern konnte, daß ihr Thun und Treiben in jedem dieser Diener ihres Gemahls einen spionirenden Aufpasser fand und sie von sich wohl klagen durfte: »Ich weiß, daß hundert Augen – Gedungen sind, mich zu bewachen, weiß, – Daß er mich an seiner Knechte Schlechtesten verkaufte – Und jede von mir aufgefangene Silbe – Dem Hinterbringer fürstlicher bezahlt, – Als er noch keine gute That bezahlte!«
Die fürstliche Bezahlung soll bei dem Lombard allerdings statt der dreißig Silberlinge fünftausend goldene Napoleons betragen haben, – die Bewunderung für Napoleon erklärt sich daraus bei ihm wie bei vielen Andern gar leicht.
Nichts charakterisirt vielleicht die dem sichern Untergange zutreibende Politik Preußens bitterer als die zornigen Worte eines Stein über den cynischen Lombard in seiner Denkschrift über die Reorganisation der inneren Verwaltung, die er der Königin Luise für den König überreichte. Da heißt es unter Anderem: »Der geheime Kabinetsrath Lombard ist physisch und moralisch gelähmt und abgestumpft. Seine Kenntnisse schränken sich auf französische Schöngeisterei ein. Die ernsthaften Wissenschaften, die die Aufmerksamkeit des Staatsmannes und des Gelehrten auf sich ziehen, haben diesen frivolen Menschen nie beschäftigt ... Sein moralisches Gefühl ist erstickt und an dessen Stelle eine vollkommene Gleichgültigkeit gegen das Gute und Böse gesetzt. In den unreinen und schwachen Händen eines französischen Dichterlings von niederer Abkunft, eines Roué, der mit der moralischen Verderbtheit eine gänzliche physische Lähmung und Hinfälligkeit verbindet, ist die Leitung der diplomatischen Verhältnisse dieses Staates in einer Periode, die in der neueren Staatengeschichte nicht ihres Gleichen findet!
Welch wachsames Auge auch die Königin Luise auf diesen Menschen gehabt, wie sie gleich der mächtigen vox populi in ihm die Hauptquelle des über Preußen gebrachten Unglücks erkannte, verbürgt die Thatsache, daß sie, selbst hilflos, dem Verrath preisgegeben, auf der Flucht mit den Kindern vor den nachdringenden französischen Truppen, in Stettin aus eigenem Antriebe der Entrüstung den Befehl gab, diesen Mann sofort zu verhaften. Leider mußte der König aus Mangel an sonnenklaren Beweisen und auch wegen der formellen Rechtsungültigkeit des Verfahrens seiner Gemahlin dem Gefangenen hinterher die Freiheit und das elende Leben schenken.
Freilich gab es auch eine Partei der Guten bei Hofe, die sich um die Königin zum Kampf gegen die Verräther schaarte; nur drang ihre Stimme nicht durch den Lärm der Franzosenfreunde. Ein Stein, ein Prinz Louis Ferdinand, York, Blücher erkannten wohl die Gefahr, wagten auch, dem Könige dieselbe vorzustellen, mußten sich aber in das Loos fügen, einer immer hoffnungsloser werdenden Sache zu dienen. York hat sicher in jenen Tagen der Königin Luise seine frühere Abneigung wegen ihrer Liebe zum Tanz, ihres vermeintlich zu großen Einflusses auf Staatsgeschäfte und dergleichen im innersten Herzen abgebeten; er wurde jetzt sogar zu einem ihrer wärmsten Anhänger und Bewunderer.
Auch die Rückkehr Luisens von Pyrmont konnte die Gefahr nicht mehr beschwören, da die Haugwitz, Zastrow und Konsorten jede ernste Rüstung, jede entschiedene Vorbereitung zum Kriege, selbst nach erlassener Mobilmachung, dem Könige als gefährlich schilderten. Wie konnte so ein glücklicher Ausgang erwartet werden? Es hätten Wunder geschehen müssen, um Preußen den Geiergriffen zu entreißen, die sich zu seiner Vernichtung zusammenkrallten. Aber die Zeit der Wunder war so lange noch nicht gekommen, als der Verrath die höchsten Staatsgeschäfte leitete und altersschwache Generäle aus der Schule einer längst von Napoleon überholten Kriegführung an der Spitze eines Heeres standen, welches nicht mit einem für die Noth des Vaterlandes erglühenden Herzen in den Kampf zog, sondern »bei Strafe zur Landesvertheidigung aufgerufen wurde.«
Noch waren die Tage von der Katzbach, von Dennewitz, von Leipzig und Waterloo fern, erst mußte über Preußen der vernichtende Sturm Napoleonischer Willkür brausen, erst die edle Königin Luise alle Leiden des tiefgekränkten Gemahls, die Sorge um die unstät von Ort zu Ort gescheuchten Kinder, das Weh über das zertretene Vaterland doppelt schmerzlich und brennend empfinden in der Noth des Exils. Zuvor mußte die beste Frau unter zu viel Gram erliegen, als schönstes Opfer des unbarmherzigen Siegers Tod, ehe die Sonne wieder aufging über einem glücklich aufathmenden Preußen, welches in dem Tedeum über seine Siege auch die Klage der Erinnerung an seinen von der Erde abgerufenen Schutzgeist ertönen ließ.