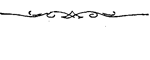|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Vergiß die treuen Todten nicht und schmücke
Auch unsre Urne mit dem Eichenkranz!«
Am 10. März 1876 feiert das Deutsche Volk ein Fest zu Ehren des hundertjährigen Geburtstages einer Königin, an deren Namen sich für die Geschichte Preußens wie Deutschlands die bedeutsamsten Erinnerungen knüpfen. Wohl sind in den letzten Jahrzehnten Jubiläen auf Jubiläen gefolgt, haben Denkmäler auf Denkmäler als beredte Zeugen der Volksdankbarkeit sich zum Himmel erhoben; aber die Feste und Monumente, die vielen weihevollen, mahnenden und begeisternden Gedächtnißreden galten der Verherrlichung von Männern, galten dem Andenken thatenreicher Helden, die mit Wort oder Schwert den höchsten Ruhm davon getragen, »sich um das Vaterland wohl verdient gemacht zu haben.«
Wenn in den Festesstunden des März, die der Erinnerung an Deutschlands edelste Fürstin geweiht sind, ein hehrer Frauennamen auf Aller Lippen schwebt und in Aller Herzen neues Leben gewinnt, wenn sich bei seinem Klange ein ganzes Volk eine hinter ihm liegende schwere Zeit, in der die Väter gelitten und gestritten, wachruft und als den Mittelpunkt jener Zeit noch heute mit aller Frische der Begeisterung junger Jahre, mit aller Liebe und Hingebung eine große Frauengestalt sich vor die Seele zaubert, – so ist das etwas so Einziges, in der Geschichte der größten Nationalfeste so unvergleichlich Dastehendes, daß schon daraus allein die hohe Bedeutung der Gefeierten für das gesammte deutsche Vaterland folgt.
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts scheint bestimmt zu sein, in immer herrlicher auftretenden Jubelfesten die Geburt der bahnbrechenden Geister zu feiern, die in den bewegtesten und empfänglichsten Zeiten der neueren Geschichte, dem 18. Jahrhundert und dem Anfänge des 19., das Samenkorn ausgestreut haben, welches jetzt, zu herrlicher Frucht aufgegangen, von der Enkel müheloseren, aber dankbaren Händen eingeerntet wird. Noch strahlt in den Herzen das Freudenfeuer der Begeisterung des Schillertages, noch tönt von dem fünfzigjährigen Gedenktage der Schlacht bei Leipzig das Jauchzen patriotischen Jubels über die Wiedergeburt des Vaterlandes zu uns herüber, – und wie zum Abschluß einer langen Reihe von Volksfesten naht sich uns der ewig erinnerungswerthe zehnte Tag des Märzen, der, einst nur in enger begrenztem Kreise der unmittelbaren Unterthanen des Preußischen Königshauses herzlich gefeiert, jetzt zu einem gemeinschaftlichen Festtage für eine ganze geeinigte Nation geworden ist.
Nicht zu rauschendem Gepränge und frohlockendem Jubel eignet sich dieser Tag, – er fordert eine weihevollere Begehung, eine von Wehmuth über das Loos einer jung gestorbenen Königin durchzitterte Stimmung. Wohl klingt erhabenen Trostes voll ein altes Dichterwort zu uns: »Wen die Götter lieb haben, den nehmen sie jung zu sich,« – aber das Menschenherz krampft sich doch jedesmal schmerzlich zusammen, wenn es hoffnungsreiches, noch nicht voll ausgelebtes Leben dem höheren Willen anheimfallen sieht; und gerade bei Denen, die wir zu früh Gestorbene nennen, erwehren wir uns nur schwer des Gefühls von dem Walten einer harten, weil uns unbegreiflichen Ungerechtigkeit des Schicksals.
Ob wir die erhabene Todte, deren Geist, wie einst in sturmbewegten Tagen, so auch heute die Stätten segnend umschweben wird, wo ihres Namens gedacht und der Preis der Nachwelt laut wird, – ob wir sie unglücklich nennen können, sie, die in der Liebe eines vortrefflichen Gemahls, in der Verehrung einer Schaar blühender Kinder und in der unbegrenzten Hingebung eines treuen Volkes den besten Beweis fand, daß sie, wie sie selbst gestand, bei so viel Liebe nie ganz unglücklich werden könnte? Für das Deutsche Volk wird doch stets das Perlenhalsband, das Königin Luise nicht ohne Absicht bei ihrer Rückkehr aus Noth und Elend unter das Dach ihres Vaters getragen, thränenbedeutend sein. Für das deutsche Volk werden die Worte Göthe's »Wer nie sein Brot mit Thränen aß, – Wer nie die kummervollen Nächte – Auf seinem Bette weinend saß, – Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte« – nie ohne wehmüthige Anwendung auf die schwergeprüfte Königin bleiben, die jene Worte in qualvoller Stunde in ihr Tagebuch geschrieben.
Königin Luise gehörte nicht zu den geistigen Heroinen, die über ihres Geschlechtes natürlicher Sphäre hinaus ihren Beruf suchen. Sie fühlte sich weniger hingezogen zur Königin Sophie Charlotte, der Vorgängerin auf dem Preußenthron, welche die Mitstrebende eines Leibnitz zu werden sich vermaß und doch mit dem Bewußtsein, unlösbaren Räthseln nachgeforscht zu haben, unbefriedigt aus der Welt schied, – als vielmehr zu der ihr ebenbürtigen Gemahlin des Großen Kurfürsten, der frommen Luise von Oranien, mit der sich auch im Namen zu begegnen sie sich stets gefreut hat.
Luisens unvergängliche Größe besteht in der fleckenlosen Reinheit ihrer Seele, in dem durch die Noth gestählten, aus ächtester zarter Weiblichkeit zum unbeugsamen Heldenmuth der Ehre sich aufrichtenden Charakter, – eine der wenigen Frauen, die von der großen Zeit nicht wie viele Männer zu klein befunden wurden; eine der wenigen Gestalten jenes Zeitalters, die, wenn das All zusammenstürzte, inmitten von Ruinen und Vernichtung aufrecht standen.
Keine äußeren Großthaten, kein unweibliches Eingreifen in die Räder des Staatsgetriebes, keine Gewaltakte, keine feierlichen theatralischen Protestationen vor versammelten Magnaten, – und doch eine größere Heldin als eine Jungfrau von Orleans, eine Charlotte Corday, eine Maria Theresia. Und warum? Weil in dieser Frau vor Allen ihres Geschlechtes und ihrer Stellung zum ersten Male eine lebensvolle Idee sich verkörperte und von ihr getragen, von ihr mit Flammenworten ausgesprochen, zur Standarte auf dem Wege wurde, den fortan ein ganzes Volk sich selbst befreiend schreiten sollte. Weil wir in dem Munde dieser Königin zum ersten Male die Worte hören » Mein vielgeliebtes Germanien,« – »Was soll aus Deutschland werden?« »Von unserer Seite wird nichts geschehen, was nicht mit dem Ganzen gehet!«
Wir werden noch Gelegenheit haben, die innerlich sich vollziehende Umwandlung im Gemüthe der Königin Luise nachzuweisen, vermöge deren aus einer wohl auch alles Preises werthen guten Landesmutter, getreuen Gattin und verständnißvollsten Erzieherin ihrer Kinder die ächt deutsche Frau wurde, die, da Alle untreu wurden, die Ehre Preußens aufrecht hielt, die zur Einigkeit, zum unentwegten Widerstande, und mußte es sein – zum unvermeidlichen Kriege mahnte; die im edelsten Selbstvergessen dem Gewaltigen der Erde unerschütterten Muthes und strafenden Wortes entgegentrat und einem Napoleon Bonaparte, vor welchem Kaiser, Papst und Könige sich beugten, Achtung und Ehrerbietung abzwang. Bei dem Anblick solches begeisternden Wirkens einer Frau hat der jugendliche Dichter ausgerufen:
»Ja, es giebt noch eine deutsche Tugend,
Welche mächtig einst die Ketten reißt!«
Königin Luise von Preußen hat schon bei ihrem Leben auf ihre Zeitgenossen, namentlich auf die weiblichen, den wohlthätigsten Einfluß ausgeübt. Die preußischen Frauen wetteiferten darin, dem Muster der Einfachheit und guten Sitte eines Hofes zu folgen, der unter allen Höfen Europa's damals, wie ja noch heute, an ächter Bürgertugend seines Gleichen suchte. Sie zeigte, wie man von den erhabensten Höhen des Lebens herab so beglückend und selbst beglückt wirken könnte; wie die Sittlichkeit, Frömmigkeit und alle besseren Triebe des Volkscharakters nur des ermuthigenden Anstoßes von oben bedürften, um sich gedeihlichster Entwicklung zu erfreuen. Sie bewies durch ihr eigenes Thun, daß das Annähern an das Volk, das Sichherablassen zu ihm eines der besten Mittel seiner Erziehung sei. Würdig und ihrer Stellung angemessen, wo es darauf ankam, das Ansehen des Königlichen Hauses fremden Mächten gegenüber auch äußerlich zu wahren, wo es galt zu repräsentiren; aber einfach und volksthümlich, wo keine überflüssige Schranke zwischen Königin und Unterthanen nöthig war, wo Herz sich frei dem Herzen zeigen wollte. Darum hatte keine Königin und Fürstin Deutschlands des Namens einer »deutschen Frau,« mit dem das Volk und seine Dichter einhellig Luise ehrten, so würdig sich zu machen gewußt wie sie, Keine hat mit so viel Recht von sich sagen können, mein Ruf ist so gut wie ich selber.
Ist es nicht eine wahrhaft staunenswerthe Erscheinung, daß von allen ihren Zeitgenossen und späteren Biographen, von Freund wie Feind des deutschen Volkes, niemals auch nur der leiseste Schatten des begründeten Vorwurfs und der gegen große Seelen so gern geübten Verkleinerungssucht sich gegen sie erhoben? Daß die Blätter der Geschichte, auf denen ihr Name prangt, vom sonnigsten Hauche der wahrempfundenen Begeisterung durchweht sind? Daß die Welt diesem Frauengebilde gegenüber ihre Neigung, das Strahlende zu schwärzen und das Erhabene in den Staub zu ziehn, einmal vergessen, und daß die Gemeinde Derer unzählig ist, die für die Königin Luise wie für das Hohe und Herrliche erglühn?
»Die Königin Luise hatte keine Feinde!« – das ist wohl das höchste Lob, was der Geschichtschreiber ihr wie überhaupt einem Sterblichen spenden kann. Selbst politische Feinde ließen ihren persönlichen Tugenden Gerechtigkeit widerfahren und ihr früher Tod rief auch jenseits der Grenzen Preußens und Deutschlands innige Theilnahme und Trauer hervor. Die Freunde aber, deren sie im Leben so überaus viele gehabt, suchten, nachdem sie nicht mehr war, mit ängstlicher Gewissenhaftigkeit sich wegen einer vielleicht unbewußt einmal gezeigten Lieblosigkeit zu entschuldigen. Eine Preußische Prinzessin schrieb damals an den Freiherrn von Stein: »In einem Briefe läßt es sich nicht Alles so auseinandersetzen, aber mündlich würde ich es Ihnen so gern sagen, wie alle Annehmlichkeit des Lebens für mich dahin ist mit ihr! Sie war so unaussprechlich gut und schwesterlich mitfühlend gegen mich, daß ich jeden Augenblick und bei jedem Ereigniß sie ach! mit ewigem Kummer vermisse. Wie bereue ich jedes Wort, was ich gegen sie kann gesagt haben, seitdem mir klar geworden ist, daß wenn ich es that, es gewiß nur der Neid war, der aus mir sprach, weil sie so viel besser war als ich!« –
Wir haben in keinem von deutscher Hand herrührenden Zeugniß über Königin Luise ein Wort zu ihrem Nachtheil gefunden, und was mehr ist, auch die Schriftsteller fremder Nationen, ja selbst einer, die uns sonst unfreundlich genug gesinnt ist, stimmen mit ein in den Chor der Bewunderung und Verehrung für die hohe Frau. Ihr vielleicht einziger persönlicher Feind, Napoleon, der ihr so viel bitteres Herzeleid anzuthun nie müde ward, der ihr, bevor er sie gesehen und mit ihr gesprochen, die verabscheuungswürdigsten Lügen nachsagte und feile Seelen kaufte, um gegen die Reine zu schreiben, konnte sich von Angesicht zu Angesicht ihr gegenüberstehend des Eindrucks der Hoheit und Würde nicht erwehren, welchen die so unglückliche, von ihm wie er wähnte in den Staub gebeugte Frau auf ihn machte. Von da ab verstummten auch die Verleumdungen, die er gegen die tadellose Gemahlin seines königlichen Gegners Friedrich Wilhelm III. hatte ausstreuen lassen, wenngleich er Hartherzigkeit genug besaß, um sich selbst von Luisens thränenvollem Flehen zu keinem Versprechen von Schonung bewegen zu lassen, und kaum aus dem Bereich des Wirkungskreises ihrer persönlichen Anmuth, der Ueberzeugungskraft der Vaterlandsliebe, die aus ihren Worten sprach, die edleren Eindrücke von seiner Seele »gleichwie von einem Wachstuch« herunterwischte, – wie er selbst an die Französische Kaiserin darüber berichtete.
Und was hatte ihr der von den Flüchen der geknechteten Völker, von dem Unwillen seiner eigenen Unterthanen verfolgte schonungslose Eroberer vorzuwerfen? Was anderes, als daß sie die Einzige am preußischen Hofe war, die gleich ihrem Gemahl die Ehre einer großen Vergangenheit nicht mit einem Schlage vernichtet sehen wollte, daß sie, ein schwaches Weib gegenüber dem rauhen Despoten, gewagt hatte, an Widerstand, an Krieg gegen den Kriegsgewaltigen zu denken, – daß sie den zum Frieden geneigteren König zu bestimmen wußte, seinem Lande lieber auf der Bahn zu einem ehrenvollen, von den Nationen bewunderten Untergange voranzuschreiten, als einen schimpflichen Friedensvertrag zu unterzeichnen, der Preußens Schicksal an den Triumphwagen des über zertretenem Völkerglück einherfahrenden Imperators ketten sollte! Das hat ihr der Rachsüchtige nicht vergessen, der, wie ein mit seiner Jugendentwicklung vertrauter Zeitgenosse treffend bemerkte, die Beleidigungen des fünfzehnjährigen Knaben noch im späten Mannesalter rächte. Das mußte den Sieggewohnten gegen die Königin Luise aufbringen, daß in einer Zeit, wo Männer – Weiber, Fürsten – Sklaven wurden, sie ihm die Stirne bot, unbesorgt um den Zorn des Tyrannen.
Der unvertilgbare, man kann sagen, instinktive Haß, den Napoleon stets besonders gegen Preußen und sein Königshaus gehegt hat, stammt daher, daß sich die schlechte Natur in ihm verletzt fühlte bei dem Zusammenstoß mit edlen, ehrenhaften Naturen, und nichts zeigt besser seine im innersten Kern tyrannische Neigung als der gänzliche Mangel an Bewunderungsfähigkeit für glaubenstreuen, überzeugungsmuthigen Widerstand. Für ihn war das griechische und römische Alterthum in seinen heroischen Erscheinungen umsonst dagewesen, an ihm war die Bekanntschaft mit den Heldengestalten Plutarchs spurlos vorübergegangen, da er den wenigen hohen Charakteren seines eigenen Zeitalters, zu denen in erster Reihe Luise zählt, nicht gerecht zu werden vermochte.
So hat auch der entsittlichte, undeutsche Geist eines Gentz sich vor der Reinheit der Königin beugen müssen, die ihm, dem würdigen Schüler seines Lehrers Metternich, mit Thränen in den Augen von der Gefahr des Vaterlandes sprach und dabei nicht nur an Preußen dachte, sondern immer das Ganze im Auge hatte, und das zu einer Zeit, wo der Gedanke eines deutschen Vaterlandes eine unerhörte Neuheit, eine Utopie erschien. Gentz war aus der pessimistischen, Alles verachtenden und doch selbst so verächtlichen Schule derer, die an wahre Tugend und Seelengröße nicht glaubten, die dergleichen nur als nicht courfähigen, zu überwindenden Standpunkt behandelten. Er gesteht selbst sehr naiv, daß er die Königin so edel sich nicht vorgestellt, wie sie ihm in der Unterredung fünf Tage vor der verhängnißvollen Schlacht bei Jena entgegengetreten, ihn zu dem Bekenntniß zwingend, »die große, unglückliche, unvergeßliche Luise habe im ganzen Zauber ihres Herzens und der vollen Hoheit ihrer Gesinnung und Haltung gestrahlt.«
Hat doch nach dem jüngsten Kriege mit Frankreich ein französischer Bischof im Hinblick auf seine Landsleute die denkwürdigen Worte über die Königin Luise geäußert: »Ich habe die Geschichte dieser edeln Frau und ihres Volkes wieder gelesen, wie sie Beide von demselben Geiste niedergedrückt waren, der von jener Zeit an auch auf Frankreich schwer und drohend gelastet hat. Ihre Geschichte hat mich erleuchtet und gestärkt und ich kann sie Denen nur empfehlen, die der Anblick unseres Unglücks beugt.« Und um dieselbe Zeit, da des geeinigten Deutschlands Heere noch auf französischem Boden standen, schrieb in dem geachtetsten Blatte seines Landes ein Franzose einen kurzen Abriß von dem Leben der großen Königin, die er bewundernd als leuchtendes Beispiel des ächten Patriotismus seinen eigenen bethörten Landsleuten vor die Seele führte.
Vor Charakteren wie der Königin Luise verstummt selbst der erklärliche Nationalhaß, verwandelt sich das Rachgefühl in Anerkennung und Achtung. Vor solchen erhabenen und doch stets im Bereiche des Reinmenschlichen, des Zartweiblichen sich haltenden Frauengestalten wagen der Spott und die Lästerung sich nicht ans Tageslicht, die einem Voltaire die Feder zur Satire gegen seine beste Landsmännin Johanna von Orleans in die Hand drückten. Luise besaß »das Kleinod in des Weibes Seele, das über allen Schein erhaben ist und über alle Lästerung, es heißt weibliche Tugend.«
Solchen doppelwerthen Zeugnissen gegenüber wollen wir die eigenen bescheidenen, zu bescheidenen Worte der Königin Luise nicht vergessen: » Die Nachwelt wird mich nicht unter die berühmten Frauen zählen, aber sie wird sagen, daß ich viel Schweres mit Geduld ertragen habe. Ach, wenn sie doch hinzufügen könnte, daß ich Prinzen das Leben gegeben habe, welche im Stande waren, das Land wieder aufzurichten!« Sie hat sich in der einen Annahme, daß man sie nicht unter die berühmten Frauen zählen werde, getäuscht, weil sie in dem Adel ihrer weiblichen Gesinnung für etwas Selbstverständliches das hinnahm, was sie um des Vaterlandes Wohl und Ehre litt, und solches nicht als des besonderen Preises der Nachwelt für würdig erachtete. Als ob standhaft um eines großen Zweckes willen leiden für eine Frau nicht mindestens ebenso rühmenswerth wäre, wie den Männern an Thatenlust gleich kommen wollen. Als ob es nicht zu den besten wenn auch stillen Thaten zählte, daß die Königin mit all ihrem Einfluß nur dahin strebte, Preußen, das Heimatland und das Resultat des Ruhms eines Friedrich des Großen, seiner eigenen Ehre zu erhalten und nichts geschehen zu lassen, was ihm vielleicht äußeres Ansehen auf Kosten innerer Schande eingebracht hätte. Solange das für groß und erhaben gilt, daß Königin Luise an den Grenzen ihres Reiches unter Kälte, Krankheit, den härtesten Entbehrungen lieber das ärgste Fürstenloos über sich ergehen lassen als dulden will, daß Preußen zu einem der in hündischer Unterwerfung aller Deutschen Ehre vergessenden Rheinbundstaaten von eines Napoleon Gnaden herabsinke, – solange dürfen wir getrost wagen, der bescheidenen Königin in dem Urtheil über ihren eigenen Werth zu widersprechen. Für solche lautlos vollbrachten Ruhmesthaten der Seele hat ihr darum auch die Nachwelt ihren reichsten Ehrenkranz gespendet.
Und wenn die Sehnsucht abgeschiedener Geister es vermag, sich über Jahrzehnte hinaus an die Stätten zu versetzen, wo einst der irdische Leib in Trübsal und Hoffnung, in Leid und Freud gewandelt, dann wird Luisens Geist auch die Erfüllung ihres Wunsches, »Prinzen das Leben geschenkt zu haben, welche das Vaterland aufrichteten,« in kaum zu ahnen gewagter Herrlichkeit schauen.
Zur glänzendsten Verwirklichung ist das Gebet der frommen königlichen Dulderin geworden: »Meine Sorgfalt ist meinen Kindern gewidmet für und für, und ich bitte Gott täglich in meinem sie einschließenden Gebete, daß er sie segne und seinen Geist nicht von ihnen nehmen möge!« Klingt das nicht wie ein gewaltig in die Zukunft vorwärts dringender Ruf aus der Nacht des Elends in das helle Licht des Tages? Ist das nicht eine wundersame Bestätigung von der unbegreiflichen Zaubermacht des Mutterherzens, das durch sein heißes Wünschen und seine inbrünstigen Gebete die Geschicke der Kinder mit zu lenken vermag?
Der älteste Sohn der großen Königin, deren Jubelfest zu begehen Deutschland stolz sein darf, sprach einst im Geiste seiner ihm vorangegangenen Mutter: »Deutschlands Einheit liegt mir am Herzen, sie ist ein Erbtheil meiner Mutter.« So hat auch Luise in Preußen die Verkörperung der deutschen Idee geahnt und zu entfalten gestrebt, wenn sie sagte: »Die großen Rettungsmittel sind ganz allein in der engsten Vereinigung aller Derer zu finden, die sich des deutschen Namens rühmen.«
Es ist ein bezeichnender Zug für das durch und durch Deutsche ihrer Gesinnung mitten in jenem französirten Zeitalter, wo ganz Europa nichts weiter war als ein schlechter Abklatsch gallischer Unsitte, daß sie da an dem Studium deutscher und preußischer Geschichte sich innerlich aufrichtete, daß sie in solcher Kraftnahrung des Geistes die Hoffnung auf die endliche Wiedergeburt des Vaterlandes fand, deren erstes Morgendämmern sie in mancher Offenbarung des Volksgeistes schon erlebte, wenn auch ihre Sonne erst in der ewigen Heimat ihr aufging. Ganz von der Liebe für Deutschland beseelt konnte sie auch einem ächt deutschen Fürsten wie Theodorich, bei dem noch kein fremdländisches Wesen der reinen Bewunderung störend in den Weg tritt, den Vorzug geben vor der gewaltigen Erscheinung eines Karl des Großen, weil dieser durch seine Eroberungssucht und sein »Frankenthum,« wie sie es mit einem Blick auf Napoleon nannte, bei ihr keine herzliche Begeisterung aufkommen ließ.
Eine unübersehbare Anzahl von Zeugnissen der besten Männer und Frauen, die mit der Königin Luise in Berührung gekommen, sprechen alle ohne Ausnahme für ihre hervorragenden herzgewinnenden Eigenschaften. In den Kreisen ihrer Unterthanen, namentlich bei den getreuen, so sehr begeisterungsfähigen Berlinern hatte sich ein förmlicher Cultus mit der allverehrten Monarchin herausgebildet. Alt und Jung wußte von ihrer Liebenswürdigkeit, ihrem Wohlthun, ihrem bis auf das Kleinste sich erstreckenden, theilnehmenden Wirken zu erzählen. Ein ganz eigener Ton hatte sich durch sie in den Bürgerkreisen gebildet, man war stolzer als selbst zu den Zeiten des großen Friedrich, sich einen Preußen zu nennen. Sänger und Bildhauer sahen durch Luisens Theilnahme auch an der idealen Entwicklung ihres Volkes eine neue Aera für die künstlerische Ausbildung des vaterländischen Geistes über Preußen gekommen.
Wenn der Königin Luise darum etwas die ewige Fortdauer ihres Namens zu verheißen im Stande ist, so ist das der Ruhm, daß sie »den Besten ihrer Zeit genuggethan und so gelebt für alle Zeiten!« Ja, für alle Zeiten, in denen man sich mit freudigem Stolze, mit stärkerem Herzschlage der Thaten der Vorfahren erinnert; für alle Zeiten, in denen die Dankbarkeit lebendig bleibt für die Fürstenfamilie, die würdig einer Mutter wie Luise so Großes für Preußen und für des Preußen weiteres Vaterland gethan hat und sicherlich noch thun wird. »Denn das ist,« sagt Göthe, »der Vorzug edler Naturen, daß ihr Hinscheiden in höhere Regionen segnend wirkt wie ihr Verweilen auf der Erde, daß sie uns von dorther entgegenleuchten als Richtpunkte, wohin wir unsern Lauf bei einer nur zu oft von Stürmen unterbrochenen Fahrt zu lenken haben, daß diejenigen, zu denen wir uns als zu Wohlwollenden und Hilfreichen im Leben hinwandten, nun die sehnsuchtsvollen Blicke nach sich ziehen als Vollendete, Selige.«
Königin Luise hat mit Thränen gesäet, was Andere, was auch wir mit Freuden geerntet haben. Sie hat ihr bestes Herzblut hingegeben für die Sache des bedrückten Vaterlandes; sie ist über Preußens Erniedrigung auf dem Schmerzenslager gestorben, einen nicht minder edlen Tod fürs Vaterland als der ist, welchen der Krieger auf dem mit seinem Blute gewonnenen Schlachtfelde stirbt. Aber aus ihren Gebeinen sind nach dem Worte des Großen Kurfürsten die rächenden Söhne erstanden, die all die Schmach ihres Landes, um welches die Mutter heiße Thränen vergossen, mit Schwerthieben tilgten, die den großen Eroberer und seinen kleinen Nachahmer so tief gebeugt haben, wie selbst Luise einst in unverschuldetem Unglück vor dem unbarmherzigen Sieger nicht dagestanden.
Wenn das preußische Volk, vertraut mit den unsäglichen Leiden, die die große Königin um ihr Land erduldet, nach den Tagen der Erhebung von 1813 noch einen innigen Wunsch hatte, so war es der, daß es ihr vergönnt gewesen wäre, mit eigenen Augen das Land der Verheißung zu schauen, welches ihr Herz so heiß, so selbstlos erfleht hatte. Das ist das Tiefschmerzliche in dem Schicksal der Frühgestorbenen, daß sie mit dem Zweifel aus dieser Welt schied, ob nicht all ihr Ringen, all ihre Entbehrungen für das Land auf lange Zeit hinaus vergebens gewesen; daß sie nicht mehr die Kanonen donnern gehört, die der Welt den herrlichsten Sieg bei Leipzig verkündeten, nicht mehr in das Tedeum eingestimmt, welches aus Millionen dankerfüllter Herzen nach der Entscheidungsschlacht des langen Völkerkrieges bei Waterloo an unzähligen Altären zum Himmel stieg.
Aber wenn sie auch nicht die ganze Herrlichkeit der Auferstehung ihres Volkes vorhersehen konnte, so hat sie doch als seliger Geist, der in den Herzen der Edelsten und Heldenhaftesten unter der deutschen Jugend seine Wohnung genommen, unendlich Großes und Gutes dazu mitgewirkt. In ihr feierte das Lied begeisterter Dichter den » Schutzgeist deutscher Sache« und zeigte ihr über den Wolken voranstrahlendes Bild als ein »In hoc signo vinces!« dem Heere, dessen jungen Kriegern die Väter und Mütter von der edlen Preußenkönigin erzählt hatten, während noch der Landesfeind in den Mauern der Städte stand und sich doch schon jedes Herz Genugthuung für die ihm selbst durch das Leid Luisens angethane Trübsal zu erkämpfen schwur. Wie einst begeisternd ein zartes Mädchen den Franzosen in ihrem gerechten Kampfe gegen englische Eroberer die Oriflamme in den Händen voranschritt, so schwebte damals unsichtbarlich und doch von Jedem gefühlt der gute Geist der Deutschesten Frau um die todesmuthigen Schaaren der ergrauten Krieger und unbärtigen Jünglinge, die die gemeinsame Noth dem gemeinsamen Feinde entgegentrieb.
Und als endlich der Kriegslärm verhallt war, als neubelebt ein Jeder unter den Segnungen des heiß errungenen Friedens im freien Vaterlande an sein Tagewerk ging, als Glück und Ueberfluß wiederzukehren versprachen in das schwer heimgesuchte Land, da empfand Jeder halb unbewußt, daß etwas ihm fehle, um vollkommen zufrieden sich der jetzt anhebenden Zeiten erfreuen zu können. Es erscheint kaum glaublich uns, die wir in dem legendenfeindlichen, so sehr »aufgeklärten« letzten Viertel des 19. Jahrhunderts leben, wenn wir hören, daß sich bald nach dem Pariser Frieden erst vereinzelt, dann immer allgemeiner namentlich unter der einfachen Bevölkerung des flachen Landes und der kleineren Städte der poetische, rührende Glaube verbreitete, die holde Königin sei gar nicht gestorben, sie lebe noch und halte sich nur einstweilen verborgen, bis Ruhe und Frieden wieder dauernd hergestellt seien. Ein schöneres Seitenstück zu der alten Sage vom Barbarossa im Kyffhäuser, der dort hinabgenommen des Reiches Herrlichkeit und einstens wiederkommen wird mit ihr zu seiner Zeit, läßt sich gar nicht denken. Das Volk wollte sich nicht den beseligenden Glauben entreißen lassen, daß die Landesmutter noch zum Segen für die Unterthanen wiederkehren werde. Das einfache Gemüth klammerte sich dem erbarmungslosen Geschicke gegenüber um so inniger an die Ueberzeugung, daß so große Schönheit, so leutselige Hoheit nicht mit einem Schlage von der Erde verschwinden könne. Und das Volk hatte so Unrecht nicht: das unsterbliche Theil der edlen Königin lebt fort mit ganzer Frische im Herzen der dankbaren Nachwelt, diesem unverletzlichsten Kyffhäuserberge.
Frauen wie Luise würden auch auf jedem anderen Piedestal wie auf dem Königsthron zu den bewunderungswürdigsten Erscheinungen zählen. Hätte ihre Wiege in einer Hütte oder im engen bürgerlichen Hause gestanden, – sie hätte in jedem Kreise des Lebens einen hohen Beruf für sich gefunden und ihre Sendung getreulich erfüllt, wenn sie auch nicht so Weittragendes hätte wirken können wie auf einem Throne. An solche Frauengestalten hat sicher auch der Dichter gedacht, als er beim Abschlusse seines Lebenswerkes die Worte als Facit unter das Ganze setzte: »Das Ewigweibliche zieht uns hinan!« Sie bedürfen gegenüber einer Königin Luise keines weiteren Kommentars. Hat sie es doch bei der Thronbesteigung erklärt, was ihr die Königinwürde so viel theurer und erhabener erscheinen lasse, – daß sie fortan mit um so reicheren Händen ihrem Triebe zum Wohlthun nachhangen könnte und nicht mehr so ängstlich jede Gabe, die sie ihren Armen zudachte, zu wägen brauchte. Hat je eine Königin ein größeres Wort gesprochen als dieses Glaubensbekenntniß einer wahrhaft deutschen Fürstin, die ihre schönste Aufgabe erfüllt sah in dem Glück und der Liebe auch ihrer ärmsten Unterthanen?
Einen eigentlich stehenden Beinamen, wie manche Kaiser und Könige sich denselben erworben, hat ihr das Volk nicht beigelegt, wohl wissend, daß zu dem Namen » Luise« Jeder ihr ein schmückendes Beiwort giebt; aber wenn König Friedrich Wilhelm III. sich im Andenken der Nachwelt des Namens »der Gute« erfreut, so hat an diesem Ehrentitel, den das Volk verleiht, Königin Luise ihren vollen Antheil.
An dem Tage, da Deutschland und namentlich Preußen die hundertjährige Feier des Geburtstages der guten, großen Königin begeht, sind die meisten Zeugen jener ereignißreichen Periode, in der sie gelitten, von dem Schauplatz ihrer Thaten längst abgetreten. Todt ist der König Friedrich Wilhelm III., dessen hundertjähriges Geburtsfest in den Augusttagen des Jahres 1870 so bedeutungsvoll durch den von jenseits des Rheins wieder einmal herüberdonnernden Kanonenlärm unterbrochen wurde, – »Meine Zeit ist in Unruhe« steht ja über seiner Gruft geschrieben. Todt ist auch der älteste Sohn und Nachfolger des hohen Königspaares, sein Herz liegt zu den Füßen seiner Eltern in der stillen Halle des Mausoleums in Charlottenburg begraben. Todt sind die Getreuen, in deren Armen, an deren Brust die Königin Luise den letzten Athemzug gethan, – todt ist der Mann, der ihr das größte Weh bereitet, todt all die Helden, die das Andenken ihrer Herrin an den übermüthigen Feinden gerächt haben. Nur einige hohe Gestalten ragen noch zu uns herüber, die in der Geschichte der traurigen Tage in Königsberg und in Memel an den Grenzen des Reiches als harmlose, zum ersten Male rauh vom Schicksal angefaßte Knaben uns begegnen. Sie lebten getreu dem mahnenden Zuruf ihrer königlichen Mutter in den Schreckenstagen des Oktober 1806: »Ach, meine Söhne, ihr seid schon in dem Alter, wo euer Verstand diese schweren Heimsuchungen fassen kann. Rufet künftig, wenn eure Mutter und Königin nicht mehr lebt, diese unglückliche Stunde in euer Gedächtniß zurück! Weinet meinem Andenken Thränen, wie ich sie jetzt in diesem schrecklichen Augenblick dem Umsturze meines Vaterlandes weine. Aber begnügt euch nicht mit den Thränen allein. Handelt, entwickelt eure Kräfte! Vielleicht läßt Preußens Schutzgeist sich auf euch nieder. Befreiet dann euer Volk von der Erniedrigung, worin es schmachtet! Suchet den jetzt verdunkelten Ruhm eurer Vorfahren von Frankreich zurückzuerobern, wie euer Ahnherr der Große Kurfürst einst bei Fehrbellin die Niederlage und Schmach seines Vaterlandes an den Schweden rächte. Ach, meine Söhne, lasset euch nicht von der Entartung dieses Zeitalters hinreißen! Werdet Männer, Helden, würdig des Namens von Prinzen und Enkeln des Großen Friedrich. Und wenn ihr den niedergebeugten Staat nicht wieder aufrichten könnt, so suchet den Tod, wie ihn Louis Ferdinand gesucht hat!« –
Die Tage von Leipzig, Paris, Gravelotte und Sedan haben den ältesten überlebenden Sohn Luisens, König Wilhelm, gesehen, Blick und Arm dem fliehenden Feinde des Vaterlandes zugewendet. Er hat auch getreulich den Lieblingswunsch der Königin, die Vereinigung ihres »vielgeliebten Germaniens« nach hartem Kampfe ausgeführt. Fühlbar und sichtbar ruht auf den in bewegter Zeit früh gestählten Nachkommen jenes Königspaares der Segen, der den Kindern Häuser baut, und so werden sie auch nach des Dichters Wort »noch glänzen, die spätsten Geschlechter!«
Das Sekularfest der Königin Luise folgt nur um wenige Monate auf die Enthüllungsfeier der Statue des Reorganisators seines Landes, des Freiherrn von Stein. Er hat die Königin, seine hohe Gönnerin, um ein ganzes Menschenalter überlebt, er hat die Neuentfaltung Preußens noch gesehen und thätigen Antheil daran genommen. Ihm hat denn auch das Volk als dem Träger derselben Ideen, von denen Königin Luise ihr Lebelang beseelt war, nur wenige Jahre später seinen Dankbarkeitstribut abgetragen als dem »Vater des Vaterlandes« Friedrich Wilhelm III.
Nicht gilt es an diesem hundertjährigen Gedenktage der Königin, ihr ein öffentliches Denkmal inmitten der geschäftigen, lärmenden Hauptstadt zu errichten, die so oft sich früher zu ihrem Empfange in feierliches Festgewand gehüllt, – ihr Bild ruht mit unauslöschlichen Zügen in der Brust jedes deutschen Mannes und jeder deutschen Frau, denen die schönste Erinnerung der Vorzeit lieb und werth ist. Wer aber der äußeren Anregung zur inneren Sammlung an solchem Tage bedarf, der suche dann hinter dem Schlosse zu Charlottenburg in den geweihten Räumen des Mausoleums das marmorne Bild der Königin Luise auf, versenke sich vor ihm in die wehmüthige Betrachtung all des Erdenleides, was auf dieser reinen Stirn gelastet und lasse sich hier an geheiligter Stätte, wie vor ihm so viele Tausende, von Ehrfurcht vor solcher strahlenden Weibeshoheit durchdringen!
An eben dieser Stelle haben Gemahl und Söhne der Königin in schweren Stunden gekniet und um Beistand bei verhängnißvollen Schritten zum Himmel gefleht, – und noch in späten Jahrhunderten wird sie ein Wallfahrtsort für alle Diejenigen sein, welchen die Grabstätte der Mutter des ersten Deutschen Kaisers Deutscher Nation heilig ist.