
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wie's wieder siedet, wieder glüht!
Wo so ein Köpfchen keinen Ausgang sieht,
Stellt es sich gleich das Ende vor,
Goethe.
Im Dezember 1778
Erich will wieder kommen; er will das Weihnachtsfest mit uns verleben, wie in den vorigen Jahren. Welch eine Zeit steht mir bevor! Was soll ich ihm entgegnen, wenn er seine Werbung erneuert, wenn mein Vater davon Kenntnis erhält? Ich werde Erichs trauriges Gesicht sehen, er wird an meiner Güte, meiner Aufrichtigkeit zweifeln – o wie soll ich mich retten? Wie soll ich ausweichen, ohne Schmerz zu bereiten, ohne den wahren Zustand meines Herzens zu verraten?
Er ist mit meinem Bruder Max angekommen. Vater war zur Post gegangen und brachte sie, so heiter gelaunt wie selten, gleich ins Wohnzimmer. Erich eilte auf mich zu; ich vermochte es nicht, ihm einen Schritt entgegenzugehen. Es schien mir, er wolle die Arme ausbreiten, mich zu umfangen, ich aber wich zurück und reichte ihm die Hand. Und doch, als ich ihn ansah, wie gut gefiel er mir! Das offene, frische Gesicht, das blonde, gelockte Haar, die stattliche, schlanke Gestalt; als ob ich seine Schwester wäre, wallte ihm mein Herz entgegen, und ich hätte ihn ebenso gern umarmt wie Bruder Max. Er aber meint es nicht so, das sehe, das fühle ich aus jedem Blick und Wort!
Die beiden waren den Abend sehr munter, sie freuten sich auf Weimars Lustbarkeiten, taten sich gütlich am warmen Punsch, und Vater lebte mit auf. Sie erzählten so viele Späße und Anekdoten, lachten, schwuren und wetteten, daß ich und die gute Tante Barbara doch nicht hätten zum Wort kommen können, wenn mir auch plauderlustig zu Mut gewesen wäre.
Erich wollte nur manchmal meine Meinung wissen, wandte sich zu mir und sagte: »So sprich doch nur irgend etwas, damit ich wenigstens deine Stimme höre, nach der ich mich stets gesehnt habe!«
Die beiden durcheilen die Stadt, Besuche zu machen; es geht in unserem Hause jetzt fröhlicher zu als sonst. Täglich kommen Gäste und Einladungen von allen Seiten. Ich muß mich putzen, muß mitgehen, tanzen, lächeln und immer und immer Erichs Entgegenkommen zurückweisen, obwohl ich doch weiß, es hilft nichts, er will endlich ein »Ja« auf seine Frage.
Und er, mein hoher Gebieter, dem ich jetzt oft nahen darf, ihm – ach, das fürchte ich – ihm bin ich nichts als das Veilchen am Wege, das sein Fuß achtlos zertritt! Aber sind Liebe, Bewunderung, Anbetung keine starken selbständigen Empfindungen? Was ist gegen diesen jauchzenden Lebensodem meiner Brust, der mich so viele Jahre lang schon erhält, das schwächliche Gefühl mühsam aufgezogener Gegenliebe? Halb Eitelkeit und halb Dankbarkeit. Und so manches Herz mag sich damit begnügen?
Nein, ich kann diese Alltagskost nicht nehmen, nicht geben. Goethe behandelt mich wie alle anderen Mädchen; er tanzt fast an jedem Ballabend mit mir, sagt mir hier und da auch etwas Gutes, Artiges; mehr empfangen die anderen auch nicht. Den bösen Gedanken, daß er die Stein liebt, habe ich ganz aufgegeben. Wie sollte er eine Frau lieben? Eine ältere, hochgestellte, die so kühl ist, so vornehm und würdevoll! Mag er viel dort im Hause sein, junge Männer schätzen den unbefangenen Verkehr in einer Familie, er hat die Knaben gern, geht ein und aus nach Belieben, warum sollte man ihm das nicht gönnen?
Gestern sahen wir die »Geschwister«, das kleine, rührende Stück, in dem er selbst den Wilhelm so trefflich spielte. Mir ist, als hätte er's mit einer tiefen Sehnsucht nach ehelichem Glück geschrieben, als wünschte er selbst, solch eine zärtliche Marianne zu finden. Wie stürmisch mein Herz vor Sehnsucht schlug, ach und vor Eifersucht, als er zum Schluß Korona-Marianne in die Arme schloß. Beneidenswertes Geschöpf, dachte ich, und doch, losgelassen zu werden und zu fühlen: das was mich beseligte war Spiel und Schein – nein, das muß ein Entsetzen sein, als ob man von Bergeshöhe in eine finstere Kluft gestoßen wird!
Auf dem Nachhauseweg nahm Vetter Erich so entschieden meinen Arm, Vater und Max folgten so langsam, daß ich mit Zittern fühlte, jetzt schlägt die große Prüfungsstunde!
»Christel,« sagte er weich, »dort haben sich zwei, die bislang geschwisterlich miteinander lebten, in Liebe gefunden. Während des ganzen Stückes habe ich gedacht, so muß es uns auch gehen. Ja, liebste Christel, endlich mußt du mir angehören. Meine scheue Taube, flieg mir nicht wieder davon! Sieh, geduldig wartete ich, auf deinen Wunsch, Jahr und Tag. Jetzt hoffe ich auf dein Jawort, jetzt halte ich's nicht länger aus. Deines Vaters Segen habe ich; was zaudern wir? Die Welt hält uns längst für einig, und warum wollen wir unser Glück, unser wonniges Zusammensein, nicht noch reizvoller genießen? O Christel, sage ›ja‹, sei endlich mein!«
So etwa sprach der gute Vetter; armer lieber Erich! Ich habe dir wohl recht unzusammenhängend geantwortet? Es ist auch gleichviel, was ich sagte.
Wir waren nahe am Hause und traten ein. Tante Barbara kam uns mit Licht entgegen; dann standen wir plötzlich alle in der Wohnstube. Vater nahm meine und Erichs Hand, fügte sie ineinander und sprach feierlich: »So segne denn Gott euren Bund, meine Kinder! Mir erfüllt sich ein großer Wunsch. Du, liebe Tochter, verschönst mir die letzten Tage eines vielgetrübten Lebens! Mit Zuversicht lege ich dich in die Arme dieses tugendhaften Jünglings, an dessen Seite dir ein glückliches Los beschieden sein wird. Ein Leben geheiligt durch das Gebet eures Vaters!«
Er war so beredt, so gerührt, wie ich ihn nie zuvor gesehen.
Wir umarmten uns alle untereinander, oder vielmehr, sie umarmten alle mich.
Ich war starr, wie früher so oft, und weiß nicht, wie ich mit Barbara in meine Kammer gekommen bin. Die gute Alte kleidete mich aus, wie sie es jeden Abend tut, und sprach vielerlei zu mir; ich hörte nur Ton und Worte, den Sinn begriff, ich nicht; in derselben Starre brachte ich die halbe Nacht zu, während der anderen Hälfte saß ich aufrecht und weinte. O, was soll aus mir werden?
Ertragen kann ich's nicht so, ich muß einen Versuch zu meiner Rettung wagen und mit meinem Vater sprechen. Gefaßt bin ich auf seinen fürchterlichsten Zorn, ja, wenn er will, kann er mich töten!
Ich ging zu ihm in sein selten betretenes Zimmer.
Er kam mir liebreich entgegen. »Mein Kind ist bleich,« sagte er und faßte mich am Kinn. »Frisch auf und munter, kleine Grafenbraut! Die ganze Stadt wird dich beneiden, bist auch beneidenswert! Ist ein Staatsjunge, dein Erich, mir fast lieber als mein eigener Sohn! Aller Verdruß und Grimm, den ich im Leben zu schlucken gekriegt, wird jetzt wett gemacht!«
»Vater – Vater!« stammelte ich.
»Was soll das Gejammer?«
»O, ich bitte dich aus Herzensgrund! Vater, höre, rette mich! Ich liebe Erich nicht, ja ich schaudere vor einer Ehe mit ihm, ich könnte ebenso gut Bruder Max heiraten!«
»Flausen, Hirngespinste! Warst immer ein absonderliches Ding! Jetzt aber, Fräulein Narretei, ist's Zeit, die Schrullen und Romangeschichten abzutun, sonst geht daran dreier Menschen Lebensglück zu Grunde!«
Er sprach sehr ernst, aber nicht so zornig wie sonst. Ich sagte ihm noch einmal recht eindringlich, daß ich in Verzweiflung über meinen Brautstand sei; ich bat ihn, mich nicht zu vermählen, mich bei sich zu behalten.
Erst fuhr er mich an: ob ich einen anderen liebe?
Ich erbebte und sprach in einem von der Herzensangst eingegebenen Wortstrom dagegen. Er warf sich dann plötzlich – wie ein Baum, der gefällt wird – auf einen Stuhl am Tische, nahm den Kopf in die Hände und stöhnte laut: »Es ist zu viel,« murmelte er, »zwingen – zwingen kann ich sie nicht! Geh, schick Erich fort, aber dann ist von Freude in meinem Leben nicht mehr die Rede.«
Das ergriff mich furchtbar; ich sah sein Leben voll Enttäuschungen und Kummer klar vor mir; es war mir jetzt gleichviel, was aus mir werde, wenn nur auf seinen öden Pfad noch ein Sonnenstrahl fiel!
Ich warf mich vor ihm auf die Kniee, umfaßte ihn und bat, er möge getrost sein, ich wolle seinen Willen tun.
So nehme ich also mein Leid und eine traurige Lebenslüge auf mich!
Ein wahrer Strom von Gratulanten ist heute über uns gekommen; ich neige mein Haupt und halte aus, was kann ich anderes tun? Niemand wundert sich, wenn ich schweige, man kennt mich so. Auch Erich verlangt anscheinend nichts, als daß ich da bin, daß ich seine Liebkosungen dulde, daß er zu mir reden kann.
Er ist jetzt mit Max in seine Garnison zurückgekehrt und unsere Hochzeit ist auf den Herbst angesetzt, so habe ich also noch länger als ein halbes Jahr Frist. Was kann sich in der Zeit alles zutragen! – Diese Spanne Zeit will ich leben, frei sein, ihn sehen! Vielleicht findet sich doch noch ein Entrinnen!
Im Februar 1779.
Die ganze Stadt ist in Aufregung, ein glückliches Ereignis bewegt alle Gemüter, die Frau Herzogin Luise hat eine Prinzessin geboren. Sie soll sehr schwach sein und der Herzog sehr ärgerlich, da er ganz fest auf einen Erbprinzen gerechnet hatte.
Gesellige Lustbarkeiten gab es in letzter Zeit weniger! Ich als Braut hatte mich ausschließen dürfen. Aber wie dann ihn sehen? Ihn, der trotz allem meiner Seele Entzücken ist und bleibt; so habe ich mitgemacht, was sich mir bot.
O dieser Herrliche, wie hoch stecht er über allen anderen Männern! Wie viele bewundernde Augen blicken zu ihm empor; wie unbeirrt, wie herrschend schreitet er durch die Menge! Nur wenn ich ihn nie gesehen hätte, könnte ich Erich lieben.
Es wird ein neues Stück von ihm einstudiert, es soll erhaben schön sein; man sagt, es werde am Abend des ersten Kirchgangs der Herzogin gegeben. »Iphigenie« heißt's, und er selbst spielt eine Hauptrolle.
Im April
Ich habe ihn als Orest gesehen! O Gott bewahre mir meinen Verstand, daß ich nicht hinstürze, mich ihm zu Füßen werfe, ihm wie eine Sklavin Hände und Kleider küsse! O könnte ich's nur! Orest, herrlicher, unglücklicher, angebeteter Orest; wie warst du Herz und Sinn bestrickend in deiner unvergleichlichen Schönheit! So muß der Grieche sich seinen Apoll denken. Er trug sich, ebenso wie der Herzog als Pylades, griechisch gekleidet, was ihm so über die Maßen wohl stand. Korona gab eine edle Iphigenie und Knebel den Thoas.
Am Tage nach dem Spiel traf ich ihn bei dem Kanzler von Koppenfels. Es gelang mir, als wir allein standen, ein paar Worte des Entzückens hervorzustammeln.
Ruhig antwortete er mir: »Ich hoffte eine gute Wirkung, besonders auf reine Menschen, und war selbst diese Zeit, während ich daran schuf, wie das Wasser, klar, rein und fröhlich.«
Man sagt, er habe Frau von Stein im Sinne gehabt, als er diesen Preis der lindernden Gewalt edler Weiblichkeit in der Iphigenie gestaltete. Warum die? Ich glaube, sie ist der Herzogin Luise ähnlicher, welche auch stets an Heimweh leiden soll. Wenn ich ihn gesehen und gesprochen habe, zittert mir seiner Stimme Klang wie eine hehre Melodie lange im Gemüte nach.
Er arbeitet jetzt mit Bertuch, den herzoglichen Hofgärtnern und vielen Gehilfen, um einen Park am Ufer der Ilm anzulegen. Dahin richten sich nun die Schritte aller Spaziergänger. Jeder will das rüstige Schaffen und Werden beobachten; viele aber wollen auch, wie ich – ihn sehen, das fühle, das weiß ich! Und köstlich ist's, wie er leuchtenden Blicks in freier blauer Frühlingsluft dasteht, anordnet, den Eindruck beschreibt, den das Fertige machen wird, selbst zum Grabscheit greift, Gesträuche beschneidet und ganz Leben und Feuer ist für die Sache, der er sich hingibt. Er adelt alles, was er angreift; mir erscheint jetzt das Wegeziehen und Bäumepflanzen wie eine neue Art Poesie!
Ich lebe im dämmernden Schwindel so hin, bin jeden Abend in Verzweiflung über den vergangenen Tag, der mich dem Herbste näher führt. Vater spricht oft von unserer Hochzeit; Tante' Barbara schafft viel Leinenzeug herbei, Erich schreibt von Liebe und Sehnsucht und ich – o was soll ich bei alledem, das mich fremd ansieht, fremd, verwirrend und trostlos!
Juni.
Karoline von Ilten ist mir in letzter Zeit Freundin geworden, sie leidet ja ihren Liebesschmerz wie ich. Prinz Konstantin ist jetzt, um von der Geliebten entfernt zu werden, auf Reisen geschickt, die, wie man meint, Jahre dauern können. Das arme Linchen ist untröstlich, und doch wie glücklich kann sie sein, da nur die Ungunst der Verhältnisse sie trennte. Sie sagte mir, daß Goethe voll Teilnahme für sie sei, und sie oft herzlich tröste, obgleich er auch von ihrer Heirat mit dem Prinzen abgeraten habe.
So weiß sie es selbst nicht, soll sie ihm gut oder böse sein; seine Gewalt über alle Gemüter, seine Herrlichkeit erkennt sie an, und wir sprechen oft über ihm
Juli.
Es wird eine neue Aufführung geplant, ein Stück ist es, das er vor zwei Jahren gedichtet hat. Viele Personen kommen darin vor, und ich bin auch zur Mitwirkung aufgefordert.
Ich sagte zu; nur dies noch! Ihn täglich in den Proben sehen, ihn deklamieren, anordnen hören, nein, ich kann nicht darauf verzichten!
Vater runzelte die Stirn und sagte: »Wenn Erich nur zufrieden ist, daß du die Narrenspossen mitmachst?«
Ich nahm die Verantwortung auf mich. Unsere Hochzeit ist auf den 25. August festgesetzt, am 23. kommt Erich. Am 22. soll zur Rückkehr der Herzogin Amalie, die verreist ist, jenes seltsame Stück: »Der Triumph der Empfindsamkeit«, aufgeführt werden. Das ist also mein Letztes!
Nur genießen bis so lange; nur ihn sehen! Nie werde ich es mehr, wenn ich mit Erich in seine Garnison gehe. Hinter dem 25. liegt das ganze Dasein schwarz und öde. Es sind noch zweiunddreißig Tage bis dahin!
Linchen weint viel Sehnsuchtstränen um ihren holden Konstantin; ich weine nicht, mein Weh erstarrt und verwirrt mich recht von innen heraus.
Die Proben nehmen ihren Fortgang, jetzt nur noch zwanzig Tage!
Oft suche ich mir eine versteckte Ecke, sehe ihn an und präge sein Bild fest in meine Seele.
Heute setzte er sich zu mir und sprach mit mir. Mein ganzes Wesen weitete und milderte sich, wie von einem innersten Aufatmen, es kam wie lauter Licht und Klarheit in meine verfinsterte Seele; o du wunderbarer, heißgeliebter Mensch!
Großer Gott, nur noch neun Tage und dann – Tante Barbara tadelt mich, daß ich mich nicht um meine Ausstattung kümmere. Heute sagte sie: »Christel, wie bist du jetzt so vergnügungssüchtig?«
Diesen Nachmittag ist Probe bei der Stein; um alles möchte ich nicht fehlen!
Was habe ich gesehen, erlebt! – O Elend, grausames Elend!
Das Stück war durchprobiert, in den Zimmern ward es warm, man öffnete die Türen zu der Terrasse; die Gesellschaft zerstreute sich, spazierte draußen auf den neuen Parkwegen, verteilte sich in den Zimmern.
Ich saß allein im Eckkabinett, wo es dämmerig war, und konnte vom offenen Fenster aus ihn, mit Frau von Stein, auf der Terrasse hin und her gehen sehen; dann und wann drang der Ton seiner Stimme oder ein Wort von ihm zu mir; es war so schön!
Endlich setzten sie sich unter meinem Fenster nieder. Anfänglich wollte ich aufstehen, aber seine Nähe berauschte und bannte mich, daß ich in meine alte Starrheit verfiel und mich nicht rühren konnte. Sein Kopf mit den dunklen Locken ragte etwas über die Bank des offenen Fensters hervor, an dem ich saß; ich hätte sein Haar küssen können, ohne daß er's merkte; aber ich vermochte kein Glied zu bewegen. Mir war so verschleiert zu Mut von seliger Empfindung, daß selbst seine Rede mich nicht weckte, sie rauschte, wie ein süß murmelnder Bach, an meinem Ohr dahin.
Dann antwortete Frau von Stein, dabei erholte ich mich, so daß ich verstand, was er nun sagte, obwohl seine Stimme gedämpft war und einen wunderbar zärtlichen Klang hatte.
»Ich werde müde an den Menschen und habe keine Sprache mehr für sie, wenn ich nicht eine Weile mit dir bin, lieb Gold; entziehe dich mir nicht, sonst schließt sich meine Natur wie eine Blume, wenn die Sonne sich wegwendet.«
»Ich darf meine Pflichten als Wirtin nicht vernachlässigen.«
»Hast du nicht auch Pflichten der Liebe? Du weißt, daß niemand da ist, der dich heißer liebt als ich, daß keiner dich mehr bedarf.«
Also doch! schrie es in mir, also doch! Sie besitzt sein Herz; ihr gehört er an. O Elend, o Nacht des Jammers!
Ich barg meinen Kopf in den Händen.
Undeutlich nur sah oder empfand ich, daß jemand sich zu dem Paar da draußen gesellte, daß es aufstand, daß ich allein war.
Nach geraumer Zeit kam Karoline zu mir, sagte, sie habe mich gesucht, die Gesellschaft sei fort, wir müßten aufbrechen.
Wir gingen; ich, in einem Wirbel verzweiflungsvoller Empfindungen. Er! – O großer Gott, ich konnte es nicht ausdenken, ohne daß sich mein Geist verwirrte!
Ich glaube, wir hatten einen schönen Abend; Linchen sagte es mir und meinte, ich sei so erregt und seltsam, wir wollten noch spazieren gehen, das werde mir gut tun.
Wir gingen. Wohin? Was Karoline plauderte? Ich weiß es nicht.
Plötzlich standen wir am rauschenden Wehr, in der Finsternis dichtschattender Linden.
Vor uns der Fluß mit dem weißen Schaum, der stark herunterfallend plätscherte und brauste. Und dann der Flußgott; ein weißes Menschenbild, aus dem weißen Schaum auftauchend, mit langem dunklen Haar – er ist's! Es sind Wolfgangs Züge. Er warf sich nieder, schwamm, schnellte auf, jauchzte – o, und winkte mir!
Ich komme! schrie es in mir, sollst nicht vergebens locken, Neptun, Apoll, Orest, wie du heißen magst; meine Seele nennt dich Herr, gehorcht dir, ist dein! Zu dir, zu dir, in die schäumige Tiefe! Das ist Erlösung, das ist Reinbaden von aller Seelenangst; aller Zukunft, die so dräuend dasteht!
Schweigend ging ich an Linchens Seite nach Hause.
Still mein Herz; lebt wohl ihr alle – ich folge nur ihm, nur dir – ich komme!
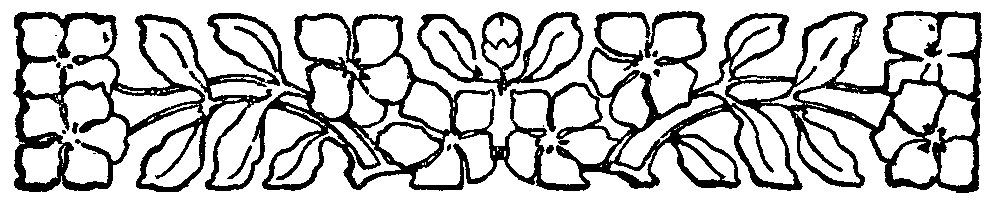
Die Sterne, die begehrt man nicht,
Man freut sich ihrer Pracht,
Und mit Entzücken blickt man auf,
In jeder heitern Nacht.
»Und mit Entzücken blickt' ich auf,
So manchen lieben Tag;
Verweinen laß die Nächte mich,
Solang ich weinen mag. «
Goethe.
Verzeihung, meine Mutter! Verzeihung!« schluchzte eine tief zur Erde gebeugte Gestalt, die auf ihren Knieen am Bett der alten Frau von Werthern lag, welche, krank und bleich, sich umsonst bemühte, der Knieenden zu antworten.
Endlich überwand die Leidende ihre Schwäche, ihre Gemütsaufregung so weit, daß sie einige Worte hervorzustammeln vermochte.
»Steh auf, Emilie! – Unglückliches Kind! Sprich – erkläre mir alles!«
Die Knieende ergriff der Kranken abgezehrte Rechte, preßte wiederholt ihre brennenden Lippen darauf und rief: »O, ein gutes Wort von Ihnen, Dank, glühenden Dank! – Mutter, wie habe ich mich nach Ihnen gesehnt! Welch ein Furchtbares ist es, sich selbst zu den Toten geworfen zu haben!«
Die alte Dame bat sie, sich auf den Stuhl neben ihrem Bett zu setzen, dann fuhr sie, mühsam und leise sprechend, fort: »Ich kann's noch nicht fassen, daß du es wirklich bist, Emilie, die vor drei Jahren Gestorbene! Mein liebes Schmerzenskind – für dessen Tod ich Gott mit tausend Tränen dankte. Emilie erstanden! Ist's auch keine Fieberphantasie? Laß dich betasten, komm näher. Nein, so greiflich kann eine Vision nicht sein!«
»Ich bin's, o Mutter, ich bin's! Ich halte und küsse Ihre lieben Hände, ich streichle Ihre Wangen, ich darf Sie wieder anblicken, darf es wagen, Ihnen mein armes, jammervolles, beladenes Herz auszuschütten?«
»Nur ruhig, Kind, ich ertrage deinen Ansturm nicht; setze dich dahin; meine Hand magst du halten, und dann erzähle, beichte, wie du es nennst, ich verstehe von allem Vorgefallenen gar nichts.«
»Wo soll ich beginnen, Mutter? Sie waren voll Sorge für mich, des Herzogs halber; der ward mir nicht gefährlich, er meinte es auch gar nicht ernstlich. Er war noch so jung, wollte lustig sein. Dies Spiel, diese harmlose Torheit half mir so gut über mein elendes Zusammenleben mit Werthern hinweg!« Emilie schilderte nun ausführlich, wie ihre Leidenschaft zu dem Hausgenossen, dem stillen Gelehrten Moritz von Einsiedel, sich angesponnen, wie die Trennungsstunde sie zueinander geführt habe. Wie sie, auf dem Gute des Bruders, das Scheiden von Moritz nicht zu überstehen vermocht, und wie sie endlich miteinander beschlossen, eine Komödie ins Werk zu setzen, die sie rette.
»Während ich heimlich mit dem Geliebten entwich,« fuhr sie bewegt fort, »ließ mein treuer Bruder eine Puppe statt meiner beisetzen und schrieb meine Todesanzeige.
Aber das kühne Abenteuer hat sich bitter gerächt. Die Ausbeutung der Goldbergwerke in Afrika ist eine verfehlte Spekulation gewesen, wir haben Jahre schwerster Kämpfe durchgemacht.«
»Und was nun, unglückliches Kind?« fragte die Mutter.
»Moritz will den Herzog bitten, ihn wieder im Bergfach anzustellen, und dann hoffen wir, uns nach tausendfältigem Elend, nach vollem Ausgestoßensein, wieder im Leben und in der Menschen Achtung herzustellen.«
»Du hast viel gelitten, Emilie? Ich sehe, ich fühle es!«
»Furchtbar, Mutter! Not und Elend jeder Art hat uns heimgesucht; wir haben es aber treulich miteinander getragen. Auch Gewissensqual wegen unserer törichten Handlungsweise lag schwer auf uns, aber in unserer ausharrenden Liebe fand sich eine große Hilfe! Glauben Sie mir, teure Mutter, es war eine Schule des Lebens, die Ihrer leichtsinnigen Emilie genützt hat.«
Die Rückkehr der hübschen und beliebten Frau von Werthern aus dem Lande des Todes rief in Weimars höheren Gesellschaftskreisen einen wahren Sturm der Aufregung hervor.
Der Herzog stürzte wütend über die Komödie, welche man ihm gespielt, zu Goethe, ließ diesen kaum zu Worte kommen und schalt auf den unerhörten Betrug, welchen man sich gegen ihn erlaubt habe.
»Schade,« erwiderte endlich Goethe mit voller Ruhe, »daß in dieser platten Werkeltagswelt nichts Außerordentliches mehr zu stande gebracht wird.«
Karl August stutzte.
»Wie, du verteidigst die Landstreicherin?«
»Ich meine nur, daß mein lieber gnädiger Herr, der allem Abenteuerlichen so hold ist, seine Freude an dem Streich der beiden Leutchen haben müßte, die, wie Wertherns Ehe beschaffen war, im Grunde nichts Klügeres tun konnten.«
Der Herzog lachte und gab nach einigem Hin- und Herreden dem Freunde recht. Aber dieser wollte noch mehr.
Moritz von Einsiedel, der Goethes Interesse für das Bergfach, sowie seinen Einfluß kannte, hatte ihn frühmorgens aufgesucht, ihm alle Verhältnisse mitgeteilt und um seine Verwendung beim Herzog gebeten. Einsiedel galt von jeher für einen tüchtigen und pflichttreuen Beamten, so betrachtete Goethe seine Wiederanstellung als Gewinn und zauderte nicht, dieselbe bei seinem fürstlichen Freunde zu befürworten.
Es gelang ihm auch, den Herzog milder zu stimmen und demselben endlich die Überzeugung zu geben, daß Einsiedels Wiederaufnahme nicht völlig zu verwerfen sei; damit war vorläufig genug erreicht.
Karl August forderte den Freund zu einem Spaziergang auf. Es war ein herrlicher Nachmittag, die Geselligkeit ruhte heute, morgen sollte die Generalprobe für den »Triumph der Empfindsamkeit« stattfinden, und dann, übermorgen, am 22., die Heimkehr der Herzogin- Mutter mit dem Spiel gefeiert werden. Die beiden Männer schlenderten unter lebhaftem Gespräch dem Parke zu, erfreuten sich am Gedeihen der neuen Anpflanzungen, planten Weiteres und kamen endlich an die Ilm, deren feuchten, kühlen Duft sie an dem warmen Tag wohltuend empfanden.
Da sahen sie plötzlich mehrere Parkarbeiter und Mühlenknechte in der Nähe des Wehrs zusammeneilen, ein Kahn stieß vom Ufer, man hantierte mit Stangen und hob endlich einen Körper in den Nachen.
»Das scheint ein Ertrunkener!« rief der Herzog.
»Ich glaube, es ist eine Frau, ich sah ein weißes Kleid,« entgegnete Goethe, während beide ihre Schritte beschleunigten, um zur Stelle zu gelangen.
Die Männer hoben eben Christel von Laßbergs schlanke, leblose Gestalt an das Ufer und legten sie auf den Rasen.
»Großer Gott, ist sie tot? Wie ist das Unglück geschehen?« rief der Herzog.
Goethe kniete zu ihr nieder, legte sein Ohr an ihren Mund, versuchte seinen Odem in ihre kalten Lippen zu blasen, lauschte auf ihren Herzschlag, untersuchte ihren Puls, rieb ihr die Hände, hielt sie aufgerichtet im Arm und tat alles, um sie zu beleben.
»Geben Sie sich keine Mühe mit ihr, Herr,« sagte ein alter Parkaufseher, der dazu trat, »sie liegt schon seit gestern abend darin und muß festgehakt sein, sonst wäre sie weiter getrieben. Als ich spät meine Runde machte, sah ich eine weiße Gestalt durch die Büsche fliegen, sie verschwand hier am Ufer – es hätte mir fast gegraut. Es war zu dunkel, um etwas im Wasser zu erkennen, dachte auch, ich könne mich geirrt haben, aber heute morgen fand ich diesen seidenen Stöckelschuh, da wußte ich, daß es eine Vornehme gewesen, die ich gestern abend hatte laufen sehen.«
»Gestern abend habe ich hier gebadet!« rief Goethe bewegten Tons, »wär's später gewesen, würde ich sie gerettet haben. Ja, sie ist tot, hoffnungslos tot!«
Der Herzog stand daneben, und die Arbeiter zogen sich ehrfurchtsvoll zurück.
»Welch ein süßes Geschöpf sie war,« fuhr Goethe fort, ihren bleichen Kopf noch immer im Arm haltend. »Mir deucht, wir haben, als sie lebte, den Reiz dieses Mädchens nie so gekannt, sie gleicht einer geknickten weißen Rose.«
Der Herzog flüsterte: »Sie war Braut des Grafen Wrangel, die Hochzeit sollte in diesem Monat noch gefeiert werden; der Bräutigam wird sich doch keiner Treulosigkeit schuldig gemacht haben? Denn hier liegt offenbar Selbstmord vor.«
»Sie trägt ein Buch in ihren Gürtel geschoben, es ist fest mit einem Seidentuch umwunden, wir wollen es an uns nehmen; wenn sie fortgetragen wird, möchte es herabfallen, vielleicht findet sich hier schon eine Aufklärung.«
Goethe zog das eingehüllte Buch aus Christels Gürtel und löste das Seidentuch, sie hatte es gut verwahrt. Erstaunt las er auf dem Umschlag seinen Namen.
»Es ist an mich adressiert, so darf ich es als mein Eigentum betrachten.« Er riß Schnur und Siegel auf und öffnete das Buch.
Sein Werk, »Werthers Leiden«, fiel ihm entgegen, ein Heft beschriebenen Papiers lag in demselben. Erschrocken und verletzt schob er es in die Tasche.
»Sie scheint das Opfer einer sentimentalen Verirrung zu sein,« sagte er düster.
Der Herzog rief die Parkarbeiter herbei und gebot ihnen, die Leiche in das nächstgelegene Haus, dasjenige des Oberstallmeisters von Stein, zu tragen.
Frau von Stein kam ihnen erschrocken entgegen, sie ließ das unglückliche Mädchen, welches gestern noch ihr Gast gewesen, auf ein Bett legen.
Man sprach hin und her über das Ereignis; Herr von Stein ging, den Obersten von Laßberg zu benachrichtigen, der Herzog verließ mit ihm das Haus, und Goethe blieb mit Frau von Stein im Zimmer neben der Kammer, in welcher Christel lag. Er saß am Fenster und blätterte in den Papieren, die er dem Buch entnommen hatte. Es waren Christels Aufzeichnungen. Sehr bald übersah er mit tiefem Herzensweh den Zusammenhang, hütete sich aber, den Schmerz dieser Entdeckung der Freundin mitzuteilen, da er sich sagen mußte, es werde Frau von Stein tief betrüben, die unschuldige Ursache von Christels Kummer gewesen zu sein.
Während er über das Schicksal des unglücklichen Mädchens nachsann, nahm Frau von Stein einen Strauß frischer Blumen, welche Goethe heute morgen aus seinem Garten geschickt, aus der Vase, verließ damit das Zimmer und trat zu der bleichen Toten heran.
Sie löste das Band, welches den Strauß zusammenhielt, und schmückte das zarte Mädchen mit den frischgefärbten Blüten des Hochsommers, ordnete ihr Kleid gefälliger, um dadurch dem unglücklichen Vater, der jeden Augenblick eintreten konnte, das schreckliche Ereignis milder vor Augen zu führen.
Als Goethe Herrn von Stein mit dem heftig zuschreitenden Oberst von Laßberg auf das Haus zukommen sah, verließ er, getrieben von einem Unbehagen, das ihn wie Schuldbewußtsein drückte, durch Hintertüren Zimmer und Haus. Christels Vermächtnis hielt er aber fest auf seiner Brust geborgen.
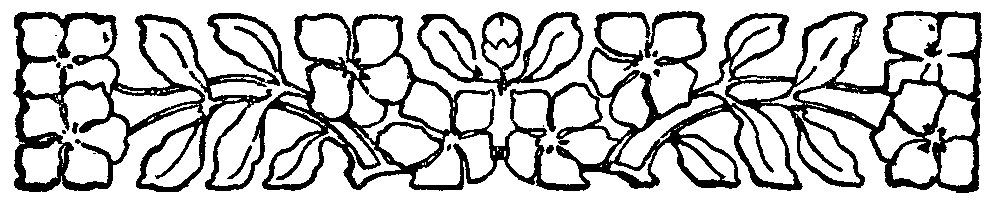
Was ihr den Geist der Zeiten nennt,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.
Goethe.
Goethe kam in einer unsäglich zwiespältigen Stimmung in seinem Hause an; er begab sich sogleich auf seinen Altan, wo er in Ruhe die Tagebuchblätter der armen Christel zu lesen und still für sich über ihr Wesen, Leiden und Tun zu sinnen dachte.
Die Sonne stand schon tief, ein warmes, rötliches Licht flammte über die ihm so liebe und beruhigende Rundsicht. Es tat ihm wohl, hier Frieden und unverändertes Sein zu finden, wo er sich so aufgestört fühlte, und ihm schien, als müsse vieles um ihn her verschoben sein.
Nie war ihm eine Ahnung von Christels Neigung aufgestiegen; ihre stille Gefühlsseligkeit hatte ihn nicht angesprochen. Er konnte nur beklagen, wenn sein »Werther« diese Richtung ihres Wesens gefördert hatte. Auch ihn beherrschte einst jene Gefühlsschwelgerei, welche jetzt aber weit hinter ihm lag. Er selbst – das wußte er bestimmt und ersah es auch aus ihren Aufzeichnungen – hatte ihr keinen Anlaß zu jener unseligen Leidenschaft gegeben, und daß sie seine Neigung zur Stein sich zu etwas Ungeheuerlichem aufgebauscht, stieß ihn als Ungesundheit ab.
Endlich war das Tagebuch durchflogen. Welch eine traurige Verirrung, welch ein Schwelgen in süßem Weh! Wie gänzlich abgewandt allen Forderungen des Lebens und der Pflicht! Halb verzogen, halb verwahrlost erschien ihm diese Seele, die doch wieder so viel Innigkeit besaß, daß sie unter verständiger Führung Schmuck und Glück eines Manneslebens hätte werden können.
Dann dachte er an Emilie von Werthern, die plötzlich wieder aus Irrfahrt und Irrtum aufgetaucht war. An die traurig schmachtende und schmälende Karoline von Ilten, an die kühle und erhabene Korona, die leichtfertige Auguste von Seckendorf, welche als Frau ihr Spiel der Gefallsucht fortsetzte, an die kindische, kokette Adelaide von Waldner, um hoch über alle sie zu stellen, die er treu als sein Idol im Herzen trug, sie, seine edle Charlotte! Ihr ebenbürtiger Geist war es, der ihn fesselte; an ihrem ernsten, erprobten Charakter wollte er den seinen stählen. Nur in der nahen Verbindung mit einem starken, guten Menschen konnte er glücklich sein, nur ein solcher konnte ihm helfen weiter zu streben, zu immer größerer Klarheit und Wahrheit.
Je mehr er aber von Charlottens Wert überzeugt wurde, je bestimmter sagte er sich, daß er sie nicht in ihrer Pflicht beirren, sie nicht aus ihrem Kreise losreißen, nicht versuchen dürfe, sie als Gefährtin an sich zu fesseln. Ja, darin hatte Christel recht, es war etwas Unerhörtes, eine Frau wie Charlotte von Stein mit begehrlichem Egoismus zu lieben!
»Die Sterne, die begehrt man nicht, man freut sich ihrer Pracht,« murmelte er vor sich hin und faßte den Entschluß, seine stürmische Leidenschaft, mit der die edle Frau oft von ihm beunruhigt war, zu bezwingen und dankbar zu genießen, was ihm das Geschick in Charlottens Freundschaft gewährt hatte.
Während er also nachdachte, hörte er leichte Schritte hinter sich herantrippeln, schaute sich um und begrüßte Luise von Göchhausen, welche knickste und mit möglichst ernsten Mienen sich und ihren plötzlichen Besuch einführte. Würdevoll sagte sie: »Meine Frau Herzogin, eben unerwartet zurückgekehrt, hörte von dem stattgehabten Unglücksfall, sie wagte weder zu Laßbergs noch zu Steins zu schicken, wo das arme Kind liegt, um sich des näheren zu informieren, deshalb erbot ich mich nachzufragen und sprach: ›Durchlaucht, ich eile zum Doktor Wolf, der sieht den Leuten als Dichter und Denker ins Herz!‹ Ist es wahr, daß jener perfide Schwede die Ärmste sitzen ließ?«
»Erst erholen Sie sich und nehmen Sie Platz bei mir, Thusnelda,« sagte Goethe zu der atemlosen kleinen Dame. »Dann will ich Ihre brennende Neugier mit tröpfelnden Andeutungen, soweit ich darf, zu löschen suchen.«
Die Göchhausen setzte sich ihm gegenüber und blickte ihn mit ihren klugen Augen scharf an.
»Geben Sie, so wenig Sie wollen, ich werde mir den Rest kombinieren.«
»Wohlan; die arme Christel war eine undisziplinierte Natur, die sich in eingebildete Liebesleidenschaft warf, eine Leidenschaft, von welcher der Betreffende keine Ahnung hatte; so geriet sie in einen Konflikt mit ihrem Heiratsplan und wußte keine andere Lösung als den Tod.«
»Natürlich sind Sie, der Stern Weimars, der Hätschelhans, jener heimlich Geliebte? Aber Sie haben recht, das nicht auszusprechen. Packen wir ferner alle Schuld dieses Vorfalls auf den schlanken Schweden; der ist weit vom Schuß und wird sich schwerlich hier wieder sehen lassen. Eine recht betrübte Geschichte! Unerhörtes ist es aber nicht. Wo viele Lose geworfen werden, fliegt manchem ein leeres Blatt zu; und es ist eben nach Art und Anlage, wie man eine Niete trägt.«
Sie sah, indem sie dies sagte, plötzlich so tief bekümmert, ja düster aus, daß Goethe sie mit lebhaft aufwallender Teilnahme fixierte.
»Thusnelda, auch Sie ein Herzensweh?«
»Sonderbar, nicht wahr, daß unterm Buckel sich auch dergleichen einnistet?«
»Sie? – Karl August?« fragte Goethe fast unwillkürlich.
»Ja. Während alle wie Närrchen in Sie verliebt waren, ging ich meinen eigenen Weg. Was kümmert's ihn, wenn ich ihn liebe? Es ist ja auch kein sentimentales Schmachten, mit irgendwelchem Anspruch. Sie sind redlicher Kamerad genug, diese verzwickte Schrulle des kleinen Kobolds nicht an die große Glocke zu hängen, darum mag's meinethalben Ihnen zugestanden sein. Was kann man dafür, wenn einen elementare Kräfte packen? Schlimm genug für das Wesen von Fleisch und Bein, in solche Stampfe zu geraten, und nur gesundes Wollen kann da retten, auf daß man nicht zum Brei alberner Gefühlsseligkeit zerstoßen werde. Passons là dessus! Oder zu deutsch: Schuppst die Grillen weg!«
Goethe reichte ihr voll Freundschaft und Anerkennung die Hand. Wie heiter trug sie ihre völlige Hoffnungslosigkeit auf Liebesglück; welch ein tapferer Geist barg sich hinter ihrem spottenden, scherzenden Wesen!
»Ich brauche Ihnen keine Verschwiegenheit zu geloben, Luise,« sagte er herzlich. »Sie haben ganz recht, auf unsere gute Kameradschaft zu zählen. Mir dämmerte hier und da eine Ahnung von Ihrem Gemütszustande auf, aber man läßt sich immer wieder durch den Schein täuschen und nimmt Ausnahmen an, wo gewisse, allgemein menschliche Gefühle die Regel sind.«
»Ein Märchen von Tausend und einer Nacht habt Ihr hier in dem Neste in Szene gesetzt,« sprach Thusnelda wie einer, der von einem Höhepunkte aus Rundschau hält. »Aus Euren Märchenträumen wächst jetzt allgemach die Wirklichkeit in seltsameren Formen auf, als wenn Ihr den alten Schlendrian hättet bestehen lassen. Wundert Euch nicht, wenn die Rebe andere Früchte trägt als die Küchenbohne; es sprießt allemal nur die Saat auf, die man gepflanzt hat! Ihre Dichternatur wird damit zufrieden sein; sie kränzt sich mit den Ranken der Rebe, keltert süßen Wein aus den zerstampften Früchten und berauscht sich und andere. Ist es nicht so, Meister Wolf?«
Goethe hatte sinnend zugehört; als er sich anschickte, ihr zu antworten, ward die Tür zum Altan aufgestoßen, und der Herzog trat zu den beiden.
»So, so,« sagte er leicht grüßend, »hier haben sich schon zwei zu ihrer inneren Aufrichtung zusammengefunden, zwischen denen ich gern der dritte bin. Wo unsere muntere Thusnelda ist, da bleibt Erheiterung nicht aus.«
»Durchlaucht zu dienen, dero Hofnärrin!« sagte sie in alter schelmischer Weise knicksend.
»Sie sind wirklich unverwüstlich in Ihrem Humor, Thusel.«
»Oben schwimmend wie ein Korkstöpsel und ebenso leicht geartet.«
»Was sagen Sie zu dem heutigen Ereignis?«
»Daß jeder auf seine Weise mit dem Leben fertig wird.«
»Das süße Geschöpf! Selbst Sie würden Mitleid mit der Ärmsten empfunden haben, wenn Sie diesen holden, bleichen Körper, diesen triefenden Rest einer entblätterten Blume gesehen, wenn Sie von der stummen Verzweiflung des Vaters gehört hätten.«
»Mitleid?« fragte die Göchhausen in ihrer alten, unbekümmerten Weise, »wozu Mitleid? Sie bedarf dessen jetzt nicht mehr, und vorher, als sie litt, wußte niemand davon und kümmerte sich auch keiner darum. Der Vater aber hat sich von jeher so wenig um sein Kind bemüht, daß er sich nicht wundern darf, wenn es ihn jetzt nicht um Rat fragte.«
»Unverbesserliche! Aber gut so, um uns wieder einige Festigkeit zu geben, meinst du nicht auch, Wolfgang?«
Thusnelda lachte: »Eure Durchlaucht werden sich trösten, ich aber berichte, was ich gehört, und schlüpfe dann ins Eia Popeia mit dem frommen Wunsche, daß die vieledlen Herren nicht von Nixen träumen!«
Die Göchhausen grüßte, wandte sich zum Gehen und Goethe begleitete sie bis ins anstoßende Zimmer, wahrend der Herzog mit verschränkten Armen am Rande des Altans lehnte und seinen ernsten Blick in die rosigen Wolkenumrandungen der scheidenden Sonne tauchte.
Indem Goethe zum Lebewohl der kleinen Hofdame die Hand drückte, flüsterte er ihr zu: »Mut, Luise, bleiben Sie sich selbst treu, und so über Gräber vorwärts!«
Sie sah ihn groß, mit dem Aufblitzen aller ihrer Energie im Auge an und flüsterte zurück: »Unbesorgt, Freund Wolf, bin schon in Übung und werde nicht aus der Rolle fallen.«
Bewegten Gemütes kehrte er zum Herzog zurück.
»Trotz alles Schmerzes und Gespöttes Thusneldens,« sagte dieser, »ist mir's doch unmöglich, nach solchem ergreifenden Ereignis gleich wieder zur platten Tagesordnung zurückzukehren. Mein Herz sehnt sich mehr denn je nach etwas Ungekanntem, nie Besessenem! Es ist ein Drang in mir, der mich in deine Freundesbrust treibt und sich vielleicht in einem ernsten Gespräch mit dir Genüge verschafft.«
»Darf ich als treuer Freund diesem Drange Richtung und Namen geben?«
»Nun?«
»Es ist nichts Neues, was ich Ihnen nenne, mein teurer gnädiger Herr, nur ein lieber, lang gekannter Name: Luise!«
»Luise?« sprach Karl August sinnend, »mir ist, als hätte ich sie lange nicht gesehen. Sie lebt nur für ihr Kind und zieht sich jetzt ganz aus der Welt und Gesellschaft zurück. Seit ein paar Monaten ist sie in Belvedere, ich war nur selten da und nie allein mit ihr.«
»Und ist die Kleine Ihnen noch immer nichts?«
»Was willst du? Ein rosenrotes Fröschchen, wie kann das einen Mann interessieren?«
»Sie müssen dem lieben kleinen Menschengeschöpf Zeit lassen zu werden.«
»Ja, wenn es ein Sohn wäre! Jemand, für den man arbeitet, sorgt, der die eigenen Ideen und Pläne weiterführt!«
»Ich denke, Sie können auch an einer Tochter Freude erleben, sie zu einem edlen, trefflichen Wesen erziehen, und der Sohn und Erbe kommt hoffentlich später.«
Nach einer Pause sagte der Herzog, indem er mit großen Schritten den engen Raum des Altans durchmaß: »Denkst wohl, das stete Tröpfeln höhlt den Stein? Nun, einen Stein fühle ich hier in meiner linken Seite just nicht. Und du magst recht haben, daß den schmerzlichen Drang, mich nach alle dem Herzbewegenden anzuschließen, ein Weib am besten stillen könnte. Sind es doch Weiber, von denen der Schmerz ausgeht. Erst die Lügnerin, die wiedererstandene Milli, und nun dies arme Wasserjüngferlein! Das war ein wunderbarer Tag! Also Luise heißt die Summe deines Trostes? Nach ihr sehen kann ich ja morgen.«
»Tun Sie das; gebe euch Gott eine glückliche Stunde!«
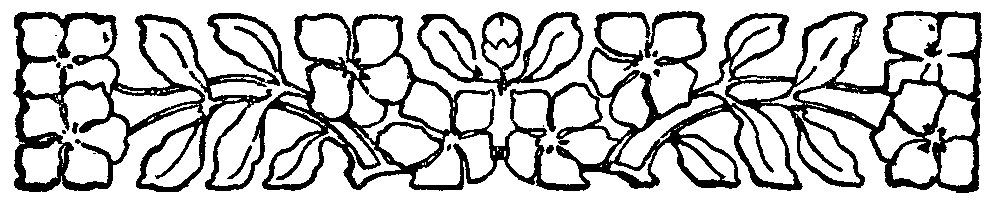
Was fragst du viel: wo will's hinaus,
Wo oder wie kann's enden?
Ich dächte, Freund, du bliebst zu Haus
Und sprächst mit deinen Wänden.
Goethe.
Seit der Geburt der kleinen Prinzessin war die Herzogin Luise etwas weniger zurückhaltend; sie liebte es jetzt, mit anderen jungen Müttern über die Pflege und das Gedeihen kleiner Kinder zu reden, umgab sich nicht mehr so ängstlich, jeden anderen Verkehr ablehnend, mit ihren Hofdamen und hatte sich besonders in Freundschaft, soweit sie solche geben konnte und bedurfte, Frau von Stein angeschlossen. Sie korrespondierte mit ihr, wenn sie sich nicht an demselben Orte befanden, und sah die feinsinnige Frau oft bei sich.
Frau von Stein, welche von jeher eine liebevolle Verehrung für die edle, sittenstrenge, junge Fürstin gefühlt, hatte oft versucht, ihr näher zu treten. Sie ging daher jetzt mit Vergnügen auf die Artigkeiten Luisens ein und folgte auch am Morgen nach dem Todestage der armen Christel von Laßberg einer Aufforderung der Herzogin, sie zu besuchen.
Die beiden Damen saßen im Gesellschaftssalon zu Belvedere an den offenen Flügeltüren, die auf Terrasse und Park hinaus führten. Die Wiege der kleinen Prinzessin, welche jetzt sieben Monate alt war, stand zur Seite, und friedlich schlummerte das liebliche, kleine Wesen in den weißen Kissen.
Frau von Stein erzählte ausführlich von den gestrigen Ereignissen, von denen nur eine unvollkommene Kenntnis in die Einsamkeit der hohen Frau gedrungen war.
Schwermütigen Blickes lauschte diese dem Bericht der Vertrauten, die wohl wußte, daß Emilie von Werthern in der Herzogin ein ganz anderes und viel größeres Interesse wachrufen mußte, als die arme kleine Laßberg. So verweilte sie auch länger bei der Schilderung von Emiliens Rückkehr mit allen darauf bezüglichen Nebenumständen.
Die Herzogin hing ihren Gedanken nach und lauschte endlich kaum noch dem Geplauder der Freundin.
Also Milli, welche sie sich in dem nächsten Verhältnis zu ihrem Gatten gedacht hatte, ließ sich damals von einem anderen Liebhaber entführen? Sie mußte diesem schon zu jener Zeit sehr nahe gestanden haben, da sie ihm freudig in die ungewisse Ferne folgte. Mit Beschämung fiel ihr die Stunde ein, in der sie voll eifersüchtigen Stolzes, in reizbarer Aufwallung jenen großen Riß zwischen sich und dem Herzog herbeiführte, der noch heute nicht ganz geschlossen war.
Wie oft hatte sie sich seitdem gesagt: die Möglichkeit einer rechten Liebe zu ihrem Gemahl sei mit Milli von Werthern im Erbbegräbnis zu Leitzkau eingesargt! Und nun war diese Milli erstanden unter Umständen, die Karl August freisprachen! So hatte sie also, falschem Scheine folgend, drei Jahre lang ihr Herz dem verschlossen, der ein geheiligtes Recht auf ihre Liebe besaß! O, wie sollte sie diese Pflichtverletzung, dies traurige Mißverständnis wieder gutmachen? Wie sollte sie ihren Gemahl von der für ihn aufwallenden warmen Empfindung überzeugen?
»Meine liebe Stein,« sagte sie plötzlich, »hörten Sie vielleicht, wie der Herzog die Rückkehr der Werthern aufnahm?«
»Er schalt auf den Betrug, und mit Recht.«
»Ja, das ist's, wollte die Frau durchaus ihre Ehe lösen, so mußte sie es voll mutiger Offenheit und in loyaler Weise tun.«
»Die Scheidung soll jetzt, wie ich höre, eingeleitet werden, und Herr von Einsiedel bewirbt sich um eine Anstellung. Diesen Morgen lauteten auch leider die Nachrichten über den Zustand der trefflichen alten Frau von Werthern, die Milli jetzt pflegt, äußerst bedenklich.«
In diesem Augenblick meldete der Lakai den Wagen der Frau Oberstallmeister.
Beide Damen erhoben sich. Luise war zu sehr mit ihren Gedanken beschäftigt, um die Freundin noch zurückhalten zu mögen; sie schlug jedoch vor, man solle den schöneren und längeren Weg über die Terrasse und durch den Park nach dem vorderen Hofplatze wählen, wo der Wagen am Portal hielt.
Wenige Minuten, nachdem die Damen durch die Terrassentür den Salon verlassen hatten, trat der Herzog, aus dem vorderen Schloß kommend, in das leere Gemach.
Er hatte, als er vom Pferde stieg, mit Befriedigung gehört, daß Frau von Stein bei seiner Gemahlin sei; noch immer empfand er eine unbestimmte Scheu vor dem Alleinsein mit Luisen. Jetzt, da er niemand im Zimmer fand, atmete er erleichtert auf.
Er hatte sich Goethes neue Erinnerung vielfach überlegt; die Liebeleien, welche sein Herz anderweitig gefesselt hatten, waren sämtlich in nichts verflogen. Milli, Gretchen und alle die Frauen und Mädchen, die seine Phantasie beschäftigten, denen er vorübergehend huldigte, ließen ihm keinen tieferen Eindruck zurück. Der Freund traf doch vielleicht die Wahrheit, wenn er sagte, daß Luise die Reizendste von allen sei. Vielleicht gelang es ihm auch noch, ihre Kälte zu besiegen und mit ihr sich zu einem unbefangen traulichen Bunde zu vereinigen, wie er es so lebhaft begehrte? Der Versuch dazu mußte noch einmal gemacht werden, hierin hatte Goethe recht!
Als der Herzog sich in dem leeren Salon umsah, traf sein Blick auf die Wiege, in der sein Kind schlief. Er fühlte sein Herz lebhafter schlagen in einer plötzlichen und natürlichen Regung für dies kleine Geschöpf, an dem er bislang so wenig teilgenommen hatte. Ja, es war sein und zugleich ein natürliches Band zwischen ihm und Luise! Er schämte sich, ein so gleichgültiger Vater gewesen zu sein, und freute sich, daß er hier ganz unbeachtet der sich lebhaft regenden Herzensempfindung folgen konnte.
Er warf die Umhänge des Bettchens zurück und neigte sich über das Kind. Weiß, rund und reizvoll in jeder Form, lag ein kleines Engelsbild vor ihm. Jetzt schlug es ein Paar lachende blaue Augen auf, hob das Köpfchen aus dem Kissen und griff nach seinen Wangen. Er beugte sich tiefer und bedeckte das zarte Gesicht mit vorsichtigen Küssen.
»Du liebes, süßes Geschöpf,« murmelte er, »und ich wußte kaum von dir und kümmerte mich nicht um dich?«
Als er sich jetzt wieder emporrichtete, streckte die Kleine ihre Arme höher nach ihm aus. Er hatte nie ein kleines Kind berührt, nun aber, als das hilflose Wesen ihn anlachte und allerlei drollige Laute plapperte, umfaßte er es, hob es heraus, drückte den weichen kleinen Körper innig an sich und erwiderte das wortlose Geplauder des Kindes auf seine Weise.
»Du beklagst dich, armes Karolinchen,« sagte er zärtlich, »daß du solch einen schlechten Vater hast, der sich gar nicht um dich kümmert, und du bist doch ein so hübsches Prinzeßchen, wie man sich nur wünschen kann. Ja, ja, armes Ding, das soll nun besser werden, wir sind jetzt gute Freunde, du bist mein Schätzchen, mein Herzenskind, und sollst es bleiben!«
Wer weiß, wie lange der junge Vater, dieser ersten liebevollen Regung folgend, sich noch der Unterhaltung mit seinem Kinde hingegeben, wenn nicht eine weiche, zitternde Frauenstimme dicht hinter ihm: »Karl!« gerufen hätte.
Er sah sich um, Luise stand da und sah ihn freundlich an.
Sorgsam legte er die Kleine wieder in ihre Wiege, dann trat er tief bewegt auf seine Frau zu.
»Vergib mir,« sagte er, ihre Hand ergreifend, »daß ich euch beide vernachlässigte. Wie das möglich war, weiß ich in diesem Augenblick wirklich nicht zu sagen.«
»O, ich wollte ja dich um Vergebung bitten! Eben bin ich mir bewußt geworden, daß ich dir mit meiner Eifersucht auf Milli bitteres Unrecht getan, daß ich in all den Jahren ohne Grund zurückhaltend und kalt gegen dich gewesen bin.«
»Luise, liebes Weib! So sollen wir uns endlich wirklich angehören?« rief er, sie beglückt in seine Arme schließend.
Inniger als es je geschehen, zärtlicher als in der ersten Zeit ihrer Ehe, umfaßten sie sich gegenseitig, fanden sich ihre Lippen.
Dann saßen sie Hand in Hand an der Wiege ihres Kindes und fingen nun an, wie ein Brautpaar, welches sich nach vielen Hindernissen vereinigt, ihre Herzen zu erschließen.
»Mich kennst du,« sagte Karl August in seiner schlichten, offenen Weise, »ich habe es nie verstanden, mich zu verstecken, mich besser zu machen, als ich bin; ich habe oft gefühlt, daß dir meine Art, mich zu geben, nicht gut genug sei, vermochte meine Natur aber nicht auf den Kopf zu stellen.«
»Vergib, wenn ich dich je dergleichen fühlen ließ! Suche mich zu entschuldigen. Ich fühlte immer, daß wir uns nicht verstanden. Ich konnte dir nichts sein, nichts mit dir teilen, und das bedrückte mich unsäglich! Jetzt weiß ich, daß es Besseres gibt, als höfische Form, als Glanz und Gepränge –«
»Und das wäre, Luise?«
»Ein häusliches Glück, dein Beifall, deine Liebe.«
»Also wirklich? Du könntest schlicht und herzlich sein?«
»Ich möchte es lernen. Lange fürchtete ich, daß meine abgeschlossene Existenz auf dich nicht wirken könne; in tiefer Verzweiflung grübelte ich über mich selbst. Zerstreuende Arbeit ist ja ein den Prinzessinnen gänzlich versagtes Glück, so saß ich und sank immer mehr in untätige Schwermut. Da schenkte Gott mir das Kind, unseren kleinen Engel! Mit Karolinchen fange ich neu an zu leben und hoffe nun auch dich zu gewinnen; das ist ein Segen über mein Verdienst!«
»Du hast mich oft durch kühle Strenge von dir entfernt, Luise; vielleicht konntest du nicht anders? Dann wieder empfand ich auch Respekt, weil deine Individualität von einer besonderen Konsequenz und Überzeugungstreue getragen wurde. Versuchen wir's nun, wie weit wir jeder dem anderen auf seinem Wege aus Liebe entgegenkommen können!«
Als der Herzog am anderen Tag dem Freunde die gute Nachricht von der endlichen, wahren Vereinigung mit seinem Weib brachte, als er sich einen glücklichen Gatten und Vater nannte und sich in hoher Gemütserregung an Goethes Brust warf, feierte der Getreue mit ihm ein Fest der innigsten Genugtuung.
»Mag Luise kein aus den Wolken herabgesenktes Ideal sein,« rief Goethe begeistert, »als welches ich sie oft ansah, Gott sei Dank, daß sie es nicht ist! Aber eines der herrlichsten Geschöpfe, wie diese Erde selten hervorbringt, aus der wir alle entsprossen, das ist sie!«
In der nächsten Zeit hielt der Herzog sich unausgesetzt bei den Seinen in Belvedere auf und feierte jetzt recht eigentlich seine Flitterwochen.
Dann aber, im Spätherbst, glaubte er, daß seiner rastlosen Natur das häusliche Behagen nicht dauernd gesund sei. Er wollte nicht, daß die neue, süße Kost ihn übersättige, und so schlug er Goethen eine Reise vor.
Dieser ging mit Freuden auf den Plan ein. Konnte er doch, nach einer neuerlichen leidenschaftlichen Unterredung mit Frau von Stein in kein ruhiges Geleise mit ihr kommen. Trotz seiner Vorsätze brach sein erregtes Gefühl durch und wurde stets aufs neue von ihr zurückgewiesen; das gab ein seltsam verstörtes Zusammensein.
»Lassen Sie uns einen abenteuerlichen Zug in die Schweiz machen, lieber gnädiger Herr,« bat Goethe. »Das Anschauen der großartigen Natur, ein Aufenthalt in dem mit Gottvertrauen und Herzenseinfalt gesegneten Lavaterschen Familienkreise wird uns wohltun und einen reinen Natursinn in uns stärken.«
»Ja, du hast recht, mein Wolf, ein solcher Abschluß mit der Vergangenheit ist gut! Neugeboren werden wir heimkehren,« sagte der Herzog zustimmend.
Mit ernstem Sinnen entgegnete Goethe: »Die Zeit, welche ich seit dem November 1775 hier im Treiben der Welt zubringe, getraue ich noch nicht abschließend zu übersehen. Gott helfe weiter und gebe Licht, daß wir uns nicht selbst zu viel im Wege stehen, lasse uns vom Morgen zu Abend das Gehörige tun und gebe uns klare Begriffe von den Folgen der Dinge! Möge die Idee des Reinen immer lichter in uns werden!«
Es bleibt nicht viel hinzuzufügen, da die »Weimarischen Brausejahre« mit der Schweizerreise, nach welcher der Herzog sowohl wie Goethe in ruhigere Bahnen lenkten, ihr Ende erreichten.
Das treue Freundesverhältnis zwischen Goethe und Karl August blieb ungetrübt bis an ihr Ende; auch die Herzogin Luise erkannte endlich in Goethe einen stets aufrichtig ergebenen Freund, dem sie später dankbar zugetan war. Die kleine am 3. Februar 1779 geborene Prinzessin starb 1784, im Jahre 1786 ward dem damals eng verbundenen Paar Ersatz zu teil in einer anderen Prinzessin, Karoline Luise, der Mutter der Herzogin Helene von Orleans, welcher noch zwei Prinzen folgten.
Die Herzogin Amalie erhielt sich bis an ihr Ende die lebensvolle Frische und blieb unzertrennlich von ihrer munteren Thusnelda.
Prinz Konstantin, von seiner Jugendliebe getrennt, knüpfte auf seinen Reisen unwürdige Verbindungen an, die den Seinigen manche Verlegenheiten bereiteten, und starb jung.
Knebel vermählte sich später mit Luise Rudorf, der bescheidenen Sängerin, zog sich vom Hofe zurück und lebte glücklich mit ihr in ländlicher Stille.
Korona Schröter wagte es nie, sich zu vermählen; Einsiedel blieb ihr treuer Freund, doch zog sie später mit ihrer Wilhelmine nach Ilmenau. Von dem Grafen Saint-Germain hörte man die wunderbarsten Gerüchte; in Weimar ward er nie mehr gesehen.
Wedel heiratete bald nach der Schweizerreise die längst geliebte Henriette von Wöllwarth.
Emilie von Werthern erlangte die Scheidung von ihrem Gemahl, beerbte ihre Schwiegermutter, die das alte Testament zu ihren Gunsten zufällig nie geändert hatte, und verband sich endlich legal mit Moritz von Einsiedel, der eine Wiederanstellung durchsetzte. Ihr gewesener Gemahl, der Rittmeister von Werthern, schloß gleichfalls eine zweite Ehe.
Als die Altensteiner Höhle unweit Liebenstein und Barchfeld entdeckt wurde, wußte der Herzog Karl August, in welchen »Hörselberg« Saint-Germain ihn einst geführt hatte, und lachte jetzt herzlich über sein jugendliches Interesse an des Wundermannes Persönlichkeit. Stets rechnete er aber dies Abenteuer zu seinen ergötzlichsten Erinnerungen.