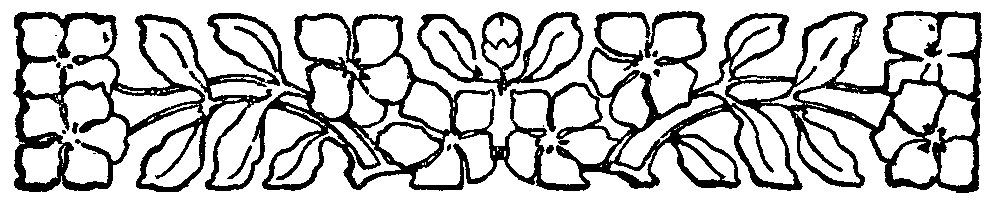|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Ach, was soll der Mensch verlangen?
Ist es besser, ruhig bleiben?
Klammernd fest sich anzuhangen?
Ist es besser, sich zu treiben?
Soll er sich ein Häuschen bauen?
Soll er unter Zelten leben?
Soll er auf die Felsen trauen?
Selbst die festen Felsen beben.
Goethe.
Eine frisch gestärkte weiße Zipfelmütze über dem rötlichen, alten Gesichte, sorglich in ein weißwollenes Neglige verpackt, die Hände resigniert über seinem Bäuchlein auf der Bettdecke gefaltet, so lag der Oberkämmerer von Göchhausen seit dem entsetzenbringenden Maskeradenabend in seinem weißumhängten Bette, der schweren Folgen für seine Gesundheit harrend, die da kommen sollten, aber nicht kamen.
Der Herzog hatte gleich am anderen Tage den Oberhofmarschall von Witzleben zu Göchhausen geschickt, um sein Bedauern über ein unglückliches Mißverständnis ausdrücken zu lassen, dessen Opfer er geworden sei. Hernach sandte er ihm seinen Leibarzt Doktor Friedrich Hufeland, der nach einer Untersuchung seines Zustandes unumwunden erklärte: Herr von Göchhausen sei durchaus gesund, er möge ruhig zu seinen früheren Lebensgewohnheiten zurückkehren. Vier Wochen im Bett sich auszuruhen und mögliche schlimme Folgen abzuwarten, schien dem alterierten Gemüte des Scheinpatienten sicherer, und so lag er seitdem gottergeben da. Jeden Morgen kam der Kammerherr von Seckendorf, um nach seinem Befinden zu sehen und Serenissimus Bericht abzustatten. Auch Graf Görtz kam oft, und so machte sich's bald, daß ein kleiner Kreis von Gesinnungsgenossen vor dem Krankenlager des höchst gesunden alten Herrn sich zusammenfand.
Luise von Göchhausen war am Morgen nach der Maskerade zu ihrem Oheim geeilt, um in wirklicher Besorgnis nach ihm zu sehen. Rohrmann und Ursula empfingen sie mit rücksichtslosem Zorn. Sie wollten ihr den Weg ins Allerheiligste des leidenden Gebieters versperren, aber Luise, unerschrocken wie immer, drang durch und versuchte wenigstens den Alten von ihrer Unschuld zu überzeugen. Da sie dies Bemühen mit zähem Eifer fortsetzte, tagte es endlich in dem Begriffsvermögen des Oberkämmerers, und er fing an, sie gnädigst, alle Tage ein Stündchen, auf dem Stuhle vor seinem Bette zu dulden.
Trafen sich die mißvergnügten Hofherren bei Göchhausen, den sie seit jenem Abenteuer innerlich zu den Ihren zählten, so waren sie sämtlich zu loyale Vasallen der Krone, um an das gesalbte Haupt selbst zu rühren. Längst hatten sie sich ein willkommenes Objekt ihres Zorns in Goethe ausersehen, von dem alle begangenen Tollheiten, alles wilde, tadelnswerte Genietreiben ausgehen sollte. Graf Görtz besonders war es, der nicht aufhören konnte, auf diesen »Verderber des allergnädigsten Herrn« hinzuweisen.
»Dieser Mensch,« sagte er eines Tages, als er mit Seckendorf bei dem Patienten zusammentraf, »der in seinem Götz den Aufruhr gepriesen, im Weither den Selbstmord verteidigt und jetzt sich sogar mit dem alten Magister Faust beschäftigen soll, welcher im Bündnis mit dem Teufel stand; dieser frivole Skribent vergiftet mit seinen laxen Grundsätzen das jugendliche Gemüt unseres allergnädigsten Herrn.«
»Es ist nicht zu verkennen,« nahm Seckendorf das Wort, »daß die wunderlichsten Dinge hier durch den Gebrauch sanktioniert werden. Ich habe sehr bald gesehen, daß meine roten Absätze und meine Hofmanieren hier Konterbande sind.» Hetzpeitschen, Reitstiefel und polnische Schnürenröcke, wallendes Haar und die sogenannte Werthermontierung, das sind die Requisiten zu der Farce, die dieser Günstling uns nach seinem Sinne aufführen läßt!«
»Ja, er und wieder er!« rief der Hofmarschall in rücksichtsloser Bitterkeit. »Wie werden wir ihn los, diesen Stein des Anstoßes?«
Hier wurden die drei Männer durch ein leises Kichern in ihrer Nähe erschreckt. Sie blickten zur Seite und sahen Luise von Göchhausen, die, hinter ihrem großen Fächer hervorblinzelnd, offenbar längst als Zuhörerin der Unterredung an der Eingangstür gestanden hatte. Sie kam näher, nickte ihrem Oheim zu und sagte: »Also unser schöner Faiseur mißfällt den Herren? Aber ist er's denn nicht, der unserer engbrüstigen Geselligkeit den eigentlichen Lebensodem einbläst? Ja, er regiert, gibt Regenwetter und Sonnenschein und hat auch mehr Konduite und Savoirfaire als alle Hofschranzen und politischen Kreuzspinnen zusammengenommen in Leib und Seele. Solange Karl August lebt, richten die Pforten der Hölle nichts gegen ihn aus!«
Sie hatte offenbar in der Heftigkeit mehr gesagt, als sie wollte; ihre klugen Augen flammten, und sie stand in ihren kleinen Hackenschuhen fest da.
»Kind, Kind! wie du mich alterierst!« rief Göchhausen.
Der Kammerherr verbeugte sich artig, gegen die Dame, schob ihr einen Stuhl hin und sprach mit seiner Ironie: »Das schöne Geschlecht erbarmt sich gern des Gescholtenen; besonders wenn es sich um einen verführerischen jungen Herzensstürmer handelt; ein überaus liebenswürdiger Zug!«
»Es mag auch die Sympathie der Eingewanderten füreinander sein, denen das strenge Behüten eines konvenablen Tons am hiesigen Hofe weniger am Herzen liegt,« sagte der Graf mit mehr Bitterkeit.
»Lediglich Überzeugungssache, meine Herren!« rief das Hoffräulein unerschrocken.
Göchhausen war längst – entsetzt über die Aufregung – in seine Kissen zurückgesunken; tastend suchte er seine Pulsschläge zu zählen.
Die beiden anderen Herren verbeugten sich stumm gegen die Verteidigerin des abwesenden Dichters und traten vom Bette zurück, an dem Luise jetzt, mit Erkundigungen nach dem Ergehen des Patienten, Platz nahm. Sehr bald räumte sie aber das Feld, da sie wohl fühlte, daß die eben ausgetauschte ernste Meinungsverschiedenheit einer weiteren unbefangenen Unterhaltung nicht günstig sei.
Abends war ein kleiner auserlesener Kreis bei der Herzogin Anna Amalie versammelt. Goethe wollte den von Lavater warm empfohlenen Schweizer Christoph Kaufmann einführen. Lavater hatte diesen jungen Mann »Gottes Spürhund« genannt und hinzugefügt: er sei ein Mensch, der nach seiner äußeren Ausrüstung und den Gesetzen der Physiognomik zufolge, alles könne!
Der Herzog, Frau von Stein, Luise von Göchhausen, Wieland und Hildebrand von Einsiedel waren bereits zugegen. Man saß um einen Tisch, auf dem einige Wachskerzen brannten und verschiedene Bücher und Silhouetten umherlagen. Die Damen schürzten Filet oder strickten; Luise leitete daneben die einfache Bewirtung mit Wein, Brot und Fleisch, Kuchen, Äpfeln und Nüssen. Sie hatte soeben, bevor Goethe kam, noch erregt von ihrer Begegnung am Nachmittage beim Oheim, von der Abneigung gesprochen, die man in gewissen Kreisen gegen den Dichter hege. Die kleine gescheite Person war keine milde Natur; sie lebte vielfach im Kampf, und es fiel ihr nicht ein, die zu schonen, welche ihr feindlich gegenüberstanden.
Der Herzog lachte laut auf. »Es ist der Neid,« sagte er spöttisch, »der sich allerorten breit macht. Ob ich einen neuen Ankömmling in meinen Hundezwinger lasse oder meinen Schranzen einen Besseren vorziehe, es gibt das gleiche Gekläff; aber den Herrn fallen sie beide nicht an. Sie zausen sich nur untereinander und der, über den sie jetzt herstürzen, ist allen gewachsen, das glaubt mir!«
Wieland, der in seiner schönen Wärme für Goethe jeglichen Angriff auf den Freund als persönliche Beleidigung nahm, nannte den Hofmarschall den schiefsten, allerschwächsten und der Natur mißlungensten Menschen, der je gewesen.
»Nur immer radikal vorwärts, mein tapferer Oberonsänger!« lachte die Herzogin zufrieden. »Sie wissen, daß auch mir der Graf zuwider ist, denn er legte es darauf an, mir meinen Sohn zu entfremden.«
Ein warmer Blick mütterlicher Liebe traf den neben ihr sitzenden Karl August. Dieser ergriff ihre volle weiße Hand und küßte sie herzlich, dann sagte er: »Das wird weder dem Görtz noch sonst jemandem gelingen! Übrigens ist der Hofmarschall mir doch mit einer gewissen Treue attachiert, wie so eine Art Hausspitz.«
Wieland schnitt ein Gesicht, sagte aber nichts, da in diesem Augenblicke Doktor Goethe mit seinem Gast angemeldet wurde.
Aller Blicke, aller Herzen öffneten sich ihm und flogen ihm entgegen!
»Da bringe ich Eurer Durchlauchten den Empfohlenen,« sagte er, seinen Begleiter dem Herzoge und der Herzogin vorstellend.
Es war der Unbekannte, welcher in Leipzig Korona aufgesucht hatte.
Christoph Kaufmann, anscheinend in den Zwanzigen, war ein blühender, kräftiger Mensch in Schweizertracht.
Herzog und Herzogin begrüßten freundlich die Gäste, man machte ihnen am Tische Platz und sie setzten sich zu den übrigen.
Der Herzog begann, den Ankömmling über Lavater zu fragen, und Kaufmann pries ihn in begeisterten Worten.
»Sie haben bei ihm die Grundsätze der Physiognomik studiert?« fragte der Herzog.
»Er hat sie an mir studiert. Nach einer Normal- oder Idealform bilden sich alle Gesetze. Er hat dieselbe in mir verkörpert gefunden. Ich bin das ›Urphänomen‹ und ausersehen, Jahrhunderte zu überdauern.«
Man sah sich erstaunt an. Die Göchhausen bot dem »Urphänomen« mit Lachen ein Glas Wein.
»Ich danke dir, Lichtkernchen,« sagte er ernsthaft, »ich genieße nur Urstoffe, Wasser oder Milch.«
Kaufmann entwickelte seine Theorie vom menschlichen Lichtkernchen. Er schilderte, wie das körperliche Häusel von innen eingehe und zuletzt als dünner Beleg ein Feuerrad umfange. Wie aus diesem sich Fühlfäden nach rückwärts ausstreckten zu den lichtstarken Genossen der Vergangenheit, um mit denselben zu verkehren.
»Alle Wetter, das wäre!« rief der Herzog halb spöttisch, halb neugierig angeregt. »Sind Sie denn solch ein Feuerrad mit glacéledernem Überzug, das mit anderen, äußerlich zu Grunde gegangenen starken Lichtleibern wieder in Verbindung treten kann? Oder zu Deutsch: bilden Sie sich ein, mit Verstorbenen kommunizieren zu können?«
Feierlich neigte der Fremde den schönen Kopf zur Bejahung.
»Ich hoffe,« sagte er schwärmerisch bewegt, »bald so weit himmlisch umgebildet zu sein. Schon ein Jahrhundert arbeite ich daran.«
»Ein Jahrhundert!« rief der Herzog staunend, »wie alt halten Sie sich denn?«
»Ich stand mit einem früheren Menschenalter in Verbindung und bin bestimmt, in einem späteren fortzuwirken!«
Alle sahen sich fragend, lächelnd, ungläubig an. Der Wundermann fuhr fort: »Als Gottes Spürhund ziehe ich durch die Lande und suche reine, kindliche Menschen, die ich wittere mit meiner, ihnen verwandten Kraft – durchsichtig wie Glas seid ihr alle meinem Auge! – Den Reinen muß ich helfen, ihren Lichtkern in die Schwingungen des Feuerrades zu bringen, und sie hierauf dem Meister zuführen.«
»Also verschiedene Grade gibt es in Ihrer seltsamen Wissenschaft?«
»Ja, verschiedene. Willst du, o Fürst, den ersten Meister aller Zeiten in diesem Wissen kennen lernen?«
»Lavater?« fragte die Herzogin gespannt und nahm diese Frage von aller Lippen.
»Nicht er! Er kann nur ahnend fühlen, wo ein Sturmbrand des Lichts im erdklebigen Stoff gefangen weilt. Nein, ein Höherer, ein ungebundenes Feuerrad geistigen Wirkens, vom aschirdnen Stoff knapp umschlossen, das alle Dimensionen durchglüht, er ist's, den ich meine!«
»Und wer wäre das?« fragte der Herzog gespannt.
»Meine Lippen dürfen seinen Namen nicht nennen! Frage das schönste Weib, welches dir während dieses Jahres Rundgang begegnet – sie trägt als Stempel seiner Herrschaft eine schwarze Samtschleife vor dem Busen – diese ist auserkoren, zwischen dir und ihm zu vermitteln.«
Des jungen Fürsten Augen blitzten.
»Der lichtreiche Unbekannte scheint nicht so gleichgültig gegen hübsche, erdklebige Schalen zu sein, wie man solchem Überwinder derselben zutrauen sollte!« rief er scharf mit lautem Auflachen. »Ich gestehe, daß vorläufig solche ›Schalen‹ mir sehr wohl gefallen, mögen sie nun von innen heraus, in Ihrem Sinne, mein Prophet, dünn oder dick sein.«
»Du täuschest dich selbst,« erwiderte Kaufmann. »Kannst du ein Auge schön finden, aus dem dir keine verständnisreiche Seele als Lichtkern entgegenstrahlt? Denk dir die schönste Form von innen verdunkelt, geistig umnachtet, und dich schaudert, ihrer Reize froh zu werden.«
Der Herzog verstummte sinnend; es lag Wahres in dieser Behauptung des Fremden.
Hildebrand Einsiedel knüpfte eine Frage nach der schönen Leibeigenen des Lichtfürsten an, bei der Goethe verständnisvoll vor sich hin lächelte. Kaufmann aber brach auf, ungezwungen wie bisher nur nach seinem Belieben, handelnd, und überhörte weitere Anreden. Er sagte, er dürfe einem einzelnen Tun nicht mehr Zeit und Kraft gönnen; wichtige Arbeiten warteten ihrer Erledigung.
»Nun, Sie werden doch heute abend nicht viel mehr tun, wir haben halb zehn Uhr,« sagte die Herzogin mit einem Blick auf ihre Rokokopendule.
»Ich schlafe nie, hohe Frau,« entgegnete der wunderliche Mann. »Wer dem Lichtkern zum Wachstum verhelfen will, darf der grobfaserigen Masse keine Herrschaft einräumen.«
»Entsetzlich!« rief Amalie und schlug staunend die Hände zusammen. »Sie schlafen nicht, Sie Ärmster, da müssen Sie ja krank werden.«
»Ich bin nie krank, ja ich vermag jeden Kranken zu heilen, der Vertrauen zu mir faßt.« Er verbeugte sich und verließ mit würdigen Schritten das Gemach.
Man atmete auf, als der Druck, den seine wunderliche Persönlichkeit ausübte, fortfiel.
»Da hat uns Lavater einen närrischen Kauz gesandt!« rief der Herzog. »Aber interessant ist solcher Gesell doch; ich werde mich näher in seine Theorien einweihen lassen.«
»Man weiß nicht, ob's der Mühe wert ist,« sagte Goethe. »Hatte Lavater ihn nicht empfohlen, ich nennte Kaufmann schlichtweg einen Lump.«
»Warum so kurzer Hand eine Persönlichkeit abtun, die wir so wenig kennen?« wandte Frau von Stein mit leisem Tadel ein.
»Ja, ja,« gab Goethe ernst zu. »Dies ist ein Gewächs, dem man an die Wurzel gehen muß; das man wohl tut, wie einen Spargel tief aus der Erde herauszuheben, und nicht bloß, so weit er grün hervorguckt, abzuschneiden.«
»Na, Ungereimtheiten hat er doch vorgebracht,« lachte Luise von Göchhausen, »die hundert Elefanten nicht wegschleppen können! Will er übrigens Kranke heilen, so möchte ich ihn gleich morgen zu meinem Oheim bringen.«
»Wir haben eine andere Kranke, an der ich großen Anteil nehme,« sagte die Herzogin ernst. »Hast du heute etwas von Laßbergs gehört, Luise?«
»Ich ging dort vor wie immer. Sie wissen, daß Christel zwei Tage munter und vergnügt bei Aulhorn Tanzunterricht hatte und dann plötzlich sehr krank wurde. Sie hat in Fieberphantasien gelegen, von einem Schuß geredet, der fallen und alles verderben müsse. Ich fand immer das gute Geschöpf, die Tante rat- und hoffnungslos, in Tränen aufgelöst, und glaube sogar, der Vater hat einmal ein Schluchzen mühsam erstickt. Jetzt lebt alles auf; Hufeland hält die Gefahr für beseitigt, Christel ist ruhiger und erkennt die Ihren.«
»Armes Ding; sie scheint sehr schwächlich.«
»Das ist die Tochter des Obersten?« fragte der Herzog. »Ich entsinne mich kaum, sie gesehen zu haben; sehr blaß, blond, unbedeutend?«
»Alles in allem,« sagte Wieland, »ist man hungrig geworden auf etwas Natürliches, Lustiges, Irdischhandgreifliches.«
»Wo aber das hernehmen?« fragte Einsiedel, der in einem Buche geblättert hatte. »Wenn heutzutage die Dichter deutscher Nation ihren Büchern gleich, etwas Tolles, Übersinnliches voranstellen, so wird dergleichen sanktioniert und dringt ins Leben. Sehen Sie hier die Gedichte der Stolberge, die Titelvignette mit den Centauren; kann man etwas Absurderes erdenken?«
»Gib her, Hildebrand,« sagte der Herzog mit einem schelmischen Seitenblick. »Dies Blatt liefert einen süperben Orden, wie ich ihn längst einer Heldin zu verleihen wünschte. Mutter, eine Schleife!«
Die Herzogin winkte der Göchhausen und diese brachte arglos ein feuerrotes Band.
Alle sahen erwartungsvoll lächelnd auf den Fürsten. Dieser schnitt die Titelvignette aus dem Buche, knüpfte oben das rote Band durch, schlang es zu einer Schleife und sprach: »Wir haben unter uns eine Heldenjungfrau, die Unendliches leistete. Sie überwand alle ihr drohenden Gefahren und zeigte sich Armin ebenbürtig, indem sie ihn siegreich anflammte. Ja, noch mehr, sie fand ein Opfer, welches sie statt ihrer durch den Dreck jagte. Dieses Opfer – in schönerer Stunde ein Tempelritter – welkt jetzt von Federbetten und Tisanen erstickt dahin. Armin erkannte an den großartigen Taten der Heldin, daß er eine ›Thusnelda‹ gefunden. Mit jenem Titel verbindet er die Verleihung eines Ordens. Der höhere Blödsinn hat diese Centauren den Werken unserer poetischen Freunde vorangestellt. Nehmen wir dies Bild als Symbol fröhlicher Torheit! Thusnelda von Göchhausen, die erste Priesterin derselben, lebe hoch!«
Alle riefen ihm lachend ihr »Hoch!« nach. Die Gläser klangen aneinander, Thusnelda schmückte sich mit ihrem Orden, und der ungebundensten Heiterkeit waren Tür und Tor geöffnet.
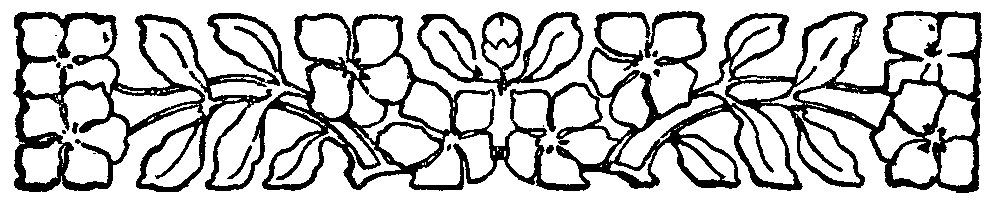
|
Übermütig sieht's nicht aus.
|
Schlanker Bäume grüner Flor
|
Der Herzog Karl August hatte sehr bald erkannt, daß sein genialer Freund nur mittels eines ernsten Lebensberufes dauernd in Weimar und an seine Person zu fesseln sei. Mochte Goethe noch so wild mit ihm darauf loswüten, wenn es galt, im Ballsaale, auf dem Eise oder zu Pferde der vollen Jugendlust genug zu tun, niemals machte er ein Hehl daraus, daß er Besseres brauche, daß er nicht ohne geregelte Beschäftigung leben könne. Aber auch in dem jungen Herzoge lag ein fester Grund edler Pflichttreue. Ihm würde kein Freund genügt haben, welcher seine volle Befriedigung aus der Dinge Oberfläche geschöpft hätte, und so begriff er auch des anderen Bedürfen.
Längst sann er also darüber nach, was er zu bieten habe, wie er Goethes Stellung in Weimar festigen und durch einen Beruf sein Leben ausfüllen könne. Er wußte, daß er mit der Anstellung dieses vielbeneideten und vielgescholtenen Fremdlings einen Sturm im Kreise seiner Beamtenwelt heraufbeschwöre; aber er war Mannes genug, seinen Willen durchzusetzen.
Seit zweiundzwanzig Jahren war der Minister von Fritsch der gewissenhafte Leiter der Regierung; dieser, der von Goethe nichts als seine schöne Erscheinung kannte, und seine Zuhörerschaft im Conseil stets gemißbilligt hatte, widersetzte sich auf das ernstlichste seiner Anstellung im Staatsdienste. Ja, er bat, wenn dieselbe stattfinden solle, um seinen Abschied.
Der Herzog erklärte aber, daß sein Beschluß, den Doktor Goethe in sein Geheimes Conseil einzuführen, feststehe, und bat, daß sein Minister sich mit dieser Maßregel aussöhne. Nachdem auch die Herzogin Anna Amalie, welcher Fritsch während ihrer Regentschaft treu zur Seite gestanden hatte, sich bittend an ihn wandte, gab der alte Staatsmann nach, und Goethes feierliche Einführung ins Conseil, als Legationsrat, wurde zur Tatsache.
So war dem Herzoge nun der Besitz des Freundes gesichert.
Goethe wußte sich auch bald durch sachlich ernste Ruhe, durch respektvolle Unterordnung unter die erfahrenen älteren Beamten eine gute Stellung im Conseil zu verschaffen und die praktischen Fragen und Sorgen der Regierung kennen zu lernen.
Sowie diese Angelegenheit geordnet war, sann der Herzog darauf, des Freundes Leben auch äußerlich behaglicher zu gestalten, als bisher. Die beschränkte Wohnung in der Belvedereallee konnte auf die Dauer nicht genügen.
Bertuchs Gartenhaus am Stern hatte Goethen einst besonders Wohlgefallen; an einem Wege gelegen, der nicht weit vom Tor sich an den Wiesen der Ilm hinzog, mit einem freundlichen Blick auf die Stadt und einem baumreichen Terrassengarten dahinter, war es ein gar einladender Sommersitz. Diesen Garten tauschte der Herzog für den Freund ein, und beglückt ging Goethe daran, sich mit Philipp das neue Heim einzurichten.
Es war im Mai, die Bäume grünten und blühten, die Wiesen an der Ilm schimmerten, mit zahllosen gelben Blumensternen besäet, in satter Smaragdfarbe; der Fluß schien klarer und munterer als bisher an den Baumwurzeln des Ufers dahin zu rauschen, der Himmel wölbte sich in dem tiefen Blau eines köstlichen Frühlingstages, die Vögel jubilierten in den Zweigen, und Spaziergänger zogen in Scharen aus dem Stadttor und den Weg vor Goethes Gartenhaus vorüber.
Eine schlanke, vornehme Frauengestalt mit einem kleinen Knaben an der Hand war unter ihnen. Goethe hatte sie von seinem Altan aus bemerkt, er eilte hinunter und kam ihr freudestrahlend an seinem Gartenpförtchen entgegen; die schlanke Frau folgte bereitwillig seiner Einladung und trat mit dem Kinde bei ihm ein. Er nahm den Kleinen auf den Arm, herzte ihn und erzählte, daß in seinem Garten prächtige Blumen für den lieben Jungen gewachsen seien, die er alle pflücken dürfe.
Hinter dem hellgetünchten kleinen Hause befand sich ein gegen Staub und unberufene Gaffer wohlgeschütztes Plätzchen. Knospendes Jelängerjelieber rankte an der Hauswand hinauf, eine Bank und ein Tisch standen daran; vor sich hatte man den schattigen und doch sonnig durchleuchteten Garten. Freundliche Lichter hüpften durch die bewegten Zweige über Blumen und Moos, und unter ihnen das jauchzende Kind in seinem Sammeleifer, die Händchen voll grüner Herrlichkeiten.
Die beiden Menschen am Hause, die sich so wohl verstanden, hatten nur wenig gesprochen, sie schwelgten in der wonnigen Natur und in dem Glück des Zusammenseins.
»Ich fühlte eine heiße Sehnsucht nach dir, und da sah ich dich kommen, es war eine schöne Erfüllung!« sagte Goethe mit tiefem Gefühl.
»Der gestrige Abend bei Baron Reinbabens lag mir schwer im Sinn,« entgegnete Charlotte von Stein, ihre weiche Gemütsstimmung bemeisternd. »Ich wollte einmal ruhig mit Ihnen unsere, Ihre Lage erwägen, deshalb kam ich heute.«
»Ich habe auch die Nacht durch manches Knäulchen Gedankenzwirn auf- und abgewickelt.«
»Ich dachte mir's. Sie wissen, daß ich Sie schätze, Sie lieb habe wie einen jüngeren Bruder oder älteren Sohn! – Aber warum dies große, warme Gefühl, das in meinem Herzen entstanden ist, da es eben am Zuschließen war, in irgend eine irdisch übliche Form gießen? – Genug, daß mich Ihr Wohl wie etwas Eigenes interessiert; daß ich sogar ohne Bedenken, wenn wir allein sind, Formen, übliche Trennungszeichen menschlicher Beziehungen, als überflüssige Schranken zwischen zwei Seelen, die so tief verbunden sind, fallen lasse; daß ich dir das schwesterliche Du gebe und es mit süßer Freude von dir annehme. Dies alles, mein Wolfgang, mein Freund, gehört aber nicht vor den Richterstuhl der tadelsüchtigen, ewig mißverstehenden Menge, die ja für unsere tiefe Sympathie kein Organ hat; die alles, was uns reinigt und begeistert, nach dem Maßstab unwürdiger Koketterie oder Liebelei mißt und danach abtut. Also törichter, unvorsichtiger Liebling! Sei auf deiner Hut vor dieser spitzzüngigen großen Welt und wahre deine glühenden Dichterworte vor denen, die sie nur mit Spott aufnehmen.«
Sie hatte warm und mit Anmut gesprochen; er hielt schon lange ihre linke Hand zwischen seinen beiden Händen gefangen; wahrend sie, in der Rechten einen blühenden Fliederzweig schwingend, mit graziösem Tändeln ihre Worte begleitete, sah er ihr glücklich lächelnd in das seine, bewegte Antlitz. Sie fuhr nach einer kleinen Pause fort: »Die Herzogin Luise, bedrückt von ihres Gatten sichtlicher Kälte gegen sie, dir anfänglich mit Wohlwollen entgegenkommend, hat jetzt den Einflüsterungen des Grafen Görtz Gehör geschenkt, sie hält dich für ihren Rivalen, für den Verführer ihres Gatten, der ihr sein Herz entfremdet, und sieht dich mit eifersüchtigem Übelwollen an.«
»Mich? Der ich sie so herzlich verehre!« rief Goethe erstaunt.
»Ja, es ist so. Wie unwillkommen du den Beamten im Conseil warst, ist dir kein Geheimnis geblieben. Der Boden ist also unsicher und glatt unter deinen Füßen, und Vorsicht, wohlüberlegtes Auftreten ein Gebot der Klugheit. Diese Vermummungen, diese geistreichen, improvisierten Scherze, wie gestern abend, sind in solchem Kreise nicht erlaubt.«
»Erlaubt ist, was gefällt!« lachte er.
»Erlaubt ist, was sich schickt,« entgegnete sie bestimmt.
Auch er ward jetzt ernster.
»Sollen wir denn immer und überall entsagen und uns beschränken?« rief er unmutig. »Der Herzog hat mich an sein Geschäft gebunden; aus der Liebschaft ist eine Ehe geworden! Ich habe hier zu Wieland, Knebel, Einsiedel und anderen eine gute, freie Stellung. Mein Freund Herder wird noch herkommen, so bin ich gedeckt und biete allen Hofschranzen die Spitze. Ich will und bedarf kaum mehr, wenn du mich nicht los läßt, Geliebteste, denn die Sicherheit meines Verhältnisses zu den einmal Erwählten, mir Gegebenen, kann ich nicht entbehren.«
»Du darfst und wirst nie an mir zweifeln,« sagte sie innig. »Was ein treuer Mensch dem anderen sein kann, bin ich dir immerdar! Laß mich dir ein Halt sein, geliebter Freund! Verstehe meine Ruhe, wenn wir uns zusammen unter Menschen befinden, ich darf ja nicht zeigen, wie hoch ich dich halte!«
Er küßte ihre Hand wiederholt und dankte ihr mit flammenden Liebesworten.
Eine frische Männerstimme rief jetzt seinen Namen, er sprang auf und eilte dem Herzog entgegen.
»Ah!« lachte Karl August schelmisch, »gewiß ein ästhetisches Conseil, das ich störe? Bitte um Verzeihung, bin aber verteufelt gern mit von der Partie und sehe nicht ein, warum ich mich an diesem goldenen Frühlingstage ennuyieren soll.«
Er setzte sich zu den beiden, die ihn artig begrüßten. Das Gespräch wandte sich bald auf Christoph Kaufmann.
Goethe erzählte, daß Kaufmann bei einem Manne, den er seinen Herrn und Meister nenne, in Kassel sei, daß er aber mit dem Gedanken umgehe, noch einmal nach Weimar zurückzukehren.
»Und wie heißt der Mann, bei dem dieser wunderliche Gast sich aufhält?«
»Graf von Saint-Germain; er ist ein berüchtigter französischer Abenteurer. Landgraf Friedrich von Hessen, der den Mäcenas spielt und die üppige französische Wirtschaft führt, zieht solche Geister an. Übrigens gibt es auch Leute genug, die auf des Grafen Wundertaten und übernatürliche Künste schwören.«
»Ich möchte auch nicht alles ablehnen, was nicht klar und plan vor mir liegt,« sagte der Herzog mit sinnendem Ausdruck, »und jenes ofterwähnten Meisters Bekanntschaft würde mich höchlich ergötzen. Görtz soll an den Hofmarschall von Bischofshausen in Kassel schreiben und wegen jenes Grafen Saint-Germain, den du als Protektor Kaufmanns nanntest, anfragen.«
»Das wird dem sehr gelegen kommen,« sagte Goethe trocken.
Frau von Stein sah ihn befremdet an, dann fragte sie: »Sie scheinen einen Wunsch oder gar die Absicht jenes Wundermannes vorauszusetzen, hierher zu kommen? Wie verstehe ich den Argwohn des Dichters diesen phantastischen Leuten gegenüber? Hat Ihr Prophet Lavater nicht unter Kaufmanns Silhouette geschrieben: er kann, was er will! Hat er ihn nicht für einen außergewöhnlich begabten Menschen erklärt?«
»Allerdings hat er das!« rief Goethe auflachend, »als Beweis, daß auch Propheten irren können.«
»Nun, streiten wir nicht,« sagte der Herzog besänftigend. »Ich für meinen Teil lasse diese kuriosen Adamssöhne noch nicht fallen; wir wollen auch nicht übersehen, daß sich in unserer Zeit mancherlei für sie regt. Man rüttelt von allen Seiten an Pforten, die in dunkle Tiefen der Natur führen und vielleicht wird sich hier oder da ein lichter Spalt auftun. Mit einem jener Absonderlichkeiten in nähere Berührung zu treten, könnte mich baß gaudieren.«
»Nur in der Kunst keine Dunkelheiten und dem Leben angewandte Spitzfindigkeiten!« rief Goethe erregt. »Mein Bestreben, meine unablenkbare Richtung ist: dem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben; wer das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen sucht, verirrt sich vom Ziel abwärts. Und sonach ist mir alles dämmerig Unnatürliche verdächtig.«
»Wenn man sich seltsame Käuze in der Nähe ansieht, ist man ihnen und ihrer ganzen Richtung ja nicht mit Haut und Haaren verfallen!« lachte der Herzog; damit stand er auf und fragte, ob Frau von Stein ihn mit dem Freunde zurückbegleiten werde.
Die kleine Gesellschaft schlug, unter fortgesetztem Geplauder, den Weg zur Stadt ein. Der Herzog sagte im Gehen, daß er sich nach einem Ausflug sehne: »Frühjahrsungeduld zappelt mir in allen Gliedern; wir müssen eine Jagdtour, einen Ritt durchs Land machen, irgend etwas unternehmen!« rief er.
»Durchlaucht sind erst ehegestern zurückgekommen!« lachte Frau von Stein. »Gestern war die Fete bei Baron Reinbabens, heute früh war Probe des Singspiels: ›Erwin und Elmire‹, morgen ist Tanz im Englischen Garten.«
»Was wollen Sie, Vortrefflichste? Man sehnt sich aus dem trockenen Hoftreiben fort, wenn man's etliche Tage genossen hat!« meinte der Herzog unwirsch.
»Ganz recht, mein lieber gnädiger Herr,« pflichtete Goethe bei. »Man kann nicht immer im Sand herum dursten!«
»Nun denn, also übermorgen!« rief Karl August vergnügt. »Wir wollen einen Plan aushecken und frische Wald- und Jagdluft genießen.«
Es begegneten ihnen öfter ehrerbietig grüßende Spaziergänger, die, obwohl die Sonne schon im Sinken war, doch noch auszogen, den schönen Abend im Freien zu genießen.
»Da kommen ein Paar bekannte Damen,« sagte Frau von Stein zu den lebhaft redenden Männern. »Es ist Auguste Kalb mit der kleinen Laßberg, die so lange krank lag.«
»Klein, nennen Sie die?« flüsterte der Herzog, »sie ist ja eine schlanke Elfe und viel größer als das dicke Gustchen.«
Man trat den jungen Mädchen entgegen und Frau von Stein fragte nach Christels Gesundheit. Mit niedergeschlagenen Augen stammelte diese, daß es ihr wohl gehe.
Der Herzog neckte Auguste mit den »Flammenküssen« der scheidenden Sonne, die, »ihren Lilienteint umwerbend, Unheil anrichten würden«.
Gustchens warme, bräunliche Haut färbte sich höher bei diesem leicht erkennbaren Spott, und sie wehrte sich in lebhafter Weise.
Goethe vermied es seit jenem Redoutenabend, ihr Artigkeiten zu erzeigen, er wandte sich also zu der eben Genesenen und sagte ihr einige teilnehmende Worte.
Hohe Glut wechselte mit Totenblässe auf den feinen Zügen des bebenden Mädchens, und sie vermochte kein Wort der Erwiderung hervorzubringen. Unter ihren beinahe geschlossenen Wimpern quollen Tränen hervor, und gleich darauf mußte Frau von Stein die Schwankende in ihren Armen auffangen.
Die Herren erschraken, man sprach davon, sie nach Goethes Haus zu tragen, eine Sänfte zu holen und dergleichen mehr. Bald aber richtete sich Christel mit großer Selbstbeherrschung auf, versicherte, indem ihre Farbe wiederkehrte, ihr sei wohl, und verabschiedete sich hastig von der Gesellschaft, indem sie den Arm ihrer Begleiterin nahm.
Die beiden Männer sahen sich erstaunt und kopfschüttelnd an, und Goethe sagte: »Welch seltsamer Windzug der Freundschaft führt diese beiden Seelen zueinander? Wie kommt's, daß gerade die sich ihre Gefühle geben? Gustchen, eine derbe und bis auf den Grund hohle Natur, und daneben diese fest geschlossene Knospe, diese Sensitive, die bei jeder Berührung erzitternd in sich selbst zurückzuschrecken scheint, süßleidender Sentimentalität hingegeben. Nun: die leeren Häuser stehen offen und die reichen sind geschlossen!«
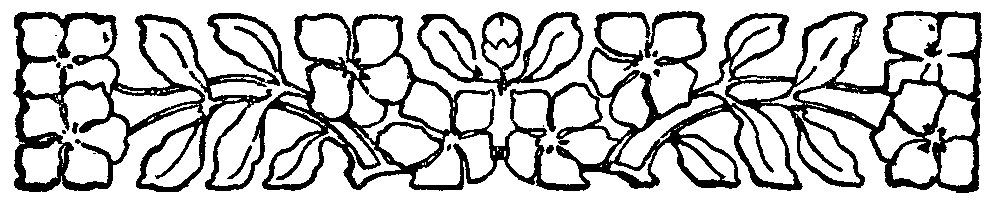
|
Über allen Gipfeln
|
Die Vöglein schweigen
|
»Ist das ein Tag!« rief Karl August, sich im abendlichen Waldesschatten auf moosigem Grunde dehnend. »Man möchte ihn immer weiter leben und dann nochmals von vorn anfangen! He, reich mir die Feldflasche, Wedel, laß sie füllen und kreisen, denn ihr werdet alle durstig sein.«
Und es war in der Tat ein Tag Ende Mai, wie man ihn nicht schöner denken konnte.
Des Herzogs »zappelnde Frühlingsungeduld« zu befriedigen, war man mit einer Gesellschaft fröhlicher Jagdkumpane Tags zuvor aus Weimar aufgebrochen. Über Berka und Stadt Ilm ging's zu Pferde nach Ilmenau, wo die Besichtigung der wieder in Angriff zu nehmenden Bergwerke Hauptanlaß des Kommens und der landesherrlichen Sorge war, da die arme Bevölkerung Verdienst brauchte.
Nach einem Abendtanz im Schießhause, wo sich die Mädchen und Burschen der Nachbarschaft versammelten, zu denen die Kavaliere in ihren Jagdkleidern sich fröhlich gesellten, hatte man die Nacht in Ilmenau zugebracht, um heute in aller Frühe die Hirschjagd zu beginnen. Jetzt lag eine ganze »Strecke« der edlen Tiere unter den Bäumen. Ein junger Spießer ward eben ausgeweidet, er sollte von einem gewandten Jagdgehilfen, am abseits lodernden Feuer, für die Abendmahlzeit gebraten werden. Man befand sich zu fern von Menschenwohnungen, um ein Nachtquartier aufzusuchen; hatte es doch auch Reiz, die laue Frühlingsnacht im Freien zuzubringen. Das Bretterhaus auf dem nahen »Gickelhahn« sollte dem Herzog als Nachtquartier dienen, für die anderen Jäger waren Laubhütten unter den Bäumen aufgeschlagen.
Auch Goethe war am Morgen mit von Ilmenau hinausgezogen; ihn reizte das Jagdvergnügen aber nicht; die Anspannung, welche dasselbe erforderte, hinderte ihn, sich der Naturbetrachtung in seiner Weise hinzugeben, und nahm ihm die Sammlung, welche er draußen in Wald und Feld begehrte.
Mit der Skizzenmappe und dem Bergstock wanderte er, dem Stande der Sonne folgend, die waldigen Berge hinan. Zuvor war die Abrede getroffen, daß er sich gegen Abend in der Nähe des Gickelhahns, wo Halali geblasen werden sollte, zum gemeinschaftlichen Abendessen wieder einfinden wolle. So hatte er einen schönen Tag nach seinem Sinn, einen Tag recht am Herzen der Natur, den er schlendernd, beobachtend, zeichnend zubringen wollte, vor sich, und tauchte tiefatmend in wohligem Freiheitsgefühl in das Meer von Grün ein, das ihn wie mit duftigen Wogen umfing.
Das Zeichnen war ihm eine Herzenssache, eine Beschäftigung, auf die er immer wieder mit Vorliebe zurückgriff. Er ermutigte auch seine Freunde, seine ganze Umgebung dazu, und obwohl er sich längst gestanden hatte, daß er zum Maler nicht geboren sei, hielt er doch an der Liebhaberei für die Kunst, an der Freude, dieselbe auszuüben, getreu fest. Ja, er legte einen besonderen Ausdruck in die graue Sprache des Stifts. Er meinte mit Empfindung zeichnen zu können und versicherte oft der Freundin, wenn er etwas für sie zeichnete, er habe es mit besonderem Gefühl getan.
Hier stieg er auf elastischem Moosteppich, dort durch raschelnd dürres Winterlaub, über Steingeröll oder ausgefahrene Geleise der Holzfuhrleute und Köhler hinan und fürbaß. Der Rain war mit jungen Erdbeerblüten bedeckt; dort schwankte noch die letzte weiße Anemone auf zartem Stengel im Luftzuge; auf sonnigen Waldwiesen mischten sich wilde blaue Salbeidolden mit Klee und weißen Sternblumen. An feucht dämmerigen Stellen schossen die frischgrünen Tüten der Maiglöckchen mit ihren duftigen Blüten auf, Brombeer- und Himbeerranken kletterten im Unterholz. Lautschallend pickte der Specht, der Kuckuck rief, Käfer und Schmetterlinge schwirrten lustig umher.
»Heilige Musen, reicht mir das Lebenselixir aus euren Schalen, daß ich nicht im öden Weltgewühl verschmachte!« flüsterte der Dichter mit der Inbrunst eines Gebets vor sich hin.
Endlich hatte er die freie Höhe des Berges erreicht, zu dem er aufstieg.
Nun stand er über dem bewegten Wipfel, blickte in das frische Laub der Buchen, sah auf düstere Kiefernstriche mit ihren lichten, kerzengleich aufstrebenden Trieben und auf schwankende, weißstämmige Birken, an Rändern und Abhängen emporschießend, und schaute tief hinein in saftgrüne Waldweiden, wo scheue Rehe ästen. Andere Bergeshäupter im köstlich grünen Mantel standen um ihn her. In blauer, sonnendurchglühter Ferne fand sich ein Durchblick zur bebauten Fläche, in der er einen Wasserfaden verfolgen und einen Kirchturm erkennen konnte.
Beseligt flammte sein Blick über das großartige Stück friedvollen Naturlebens, das vor ihm ausgebreitet lag.
»Umso näher der Gottheit, je näher man der Natur ist!« murmelte er, dann hob er sehnsüchtig die Arme: »Welche Begierde fühle ich, mich in den unendlichen Luftraum zu stürzen! Mit welchem Verlangen hole ich tiefer und tiefer Atem, wenn drüben über mir und dort unter mir der Falk in blauen Luftwellen badet. Ich aber muß immer die Höhe erkriechen, am höchsten Fels wie am niedrigsten Boden kleben. O, daß kein Flügel mich von der Erde emporträgt!«
Er warf sich auf den moosigen Grund, umfaßte den Fels und ruhte hier gleichsam am Herzen der Mutter Erde.
Dann erhob er sich mit frischer Kraft und begann umherzuspähen, wo er das Plätzchen finden könne, nach dem er sich für seinen Stift sehnte.
Die schlichte Natur schien ihm nicht zu genügen. Kaum bewußt verlangte sein plastischer Trieb nach Staffage, nach Menschenspuren und menschlichem Wirken.
Da sah er rechts in der Ferne, wie eingetaucht in grüne Wipfel, das ragende Hirschgeweih einer Försterei, er beschloß, seine Schritte dorthin zu lenken, und stieg abwärts der wohlgemerkten Stelle zu.
Nach viertelstündigem rüstigem Wandern lichtete sich der Wald, und die bräunlichen Holzwände der Försterei wurden zwischen den Stämmen sichtbar.
Die Lage des Hauses übertraf seine Erwartungen; es stand auf einer Bergwiese, von der aus nach der einen Seite hin sich ein freier Blick ins Land darbot; zur anderen Seite des schlichten Holzbaus erhob sich ein schönbewachsener Fels, von dem ein Wässerchen herabsickerte. Auf den beiden anderen Seiten begrenzte der Wald mit niederem Unterholz die Wiese.
Er wählte sich im Gebüsch einen Platz, nahm seine Mappe auf die Kniee und begann das friedlich hübsche Bild zu zeichnen.
Umfunkelt von goldenen Sonnenlichtern, lag das Idyll dieses weltverlorenen Stillebens vor ihm da. Anschließend ein Gärtchen, mit ein paar Bienenkörben darin; vor dem einen Fenster des Hauses ein Brett mit Blumenstöcken. Vor der Tür eine Holzbank mit Tisch davor. Ein Hund streckte sich in der Sonne, ein paar Hühner scharrten emsig, auf dem Schindeldache und dem Hirschgeweih saßen Tauben, und aus dem Schornstein stieg leichter Rauch geradeaus zum blauen Himmel empor. Alles still und menschenleer.
Da plötzlich vernahm er eine helle Kinderstimme, mutwillig fröhlich aufkreischend, und aus dem Hause hervor lief ein kleines Ding im Hemdchen mit bloßen Füßen, quer über die Wiese dem Walde zu. Gleich hinterher sprang die leichte Gestalt eines schlanken Mädchens: es holte den kleinen Flüchtling ein, neigte sich, redete zum Guten, hob das Kind auf den Arm und wandte sich dem Hause zu.
Rasch stand der Zeichner auf und befand sich neben dem Mädchen, bevor es noch mit dem Kinde die Haustür erreicht hatte. Als sich die beiden Blondköpfe nach ihm umwandten, ward er überrascht von der wunderbaren Schönheit des älteren. Er glaubte nie ein so frisches, schönes Angesicht gesehen zu haben. Ihre großen blauen Augen schauten ihn fragend an.
Er sagte, daß er als Zeichner komme, drüben am Waldesrande sein Gerät habe und um eine Erquickung bitte. Sie hieß ihn sich auf die Bank setzen, sie wolle nur die kleine Schwester hineintragen, dann bringe sie ihm, was er wünsche.
Einige Minuten saß er allein auf der rohgezimmerten Bank, unter den duftenden Goldlackstöcken, die im Fensterbrett standen. Der Hund legte zutraulich die kalte Schnauze auf sein Knie und ließ sich den Kopf krauen.
Bald kam das Mädchen mit Brot und Schinken, sie hielt einen Krug in der Hand und eilte zum Stalle, um frische Milch zu holen; behende war sie auch damit zurück. Sie nahm die Kleine auf den Schoß, setzte sich zum Gast, nötigte ihn zuzugreifen und plauderte mit ihm und dem Kinde.
»Mein Lenchen rannte mir weg,« sagte sie. »Gelt, Schatzel, wolltest dem Vater nach? Aber durch den wilden Wald, wo die großen Hirsche sind, kann klein Lenchen noch nicht laufen!«
»Ihr Vater ist hier der Förster?« fragte Goethe. »Er mußte wohl des Herzogs Treibjagd mitmachen, und so sind Sie allein geblieben?«
Das Mädchen bejahte; es erzählte von seinen Geschwistern, die alle schon auswärts wären, daß ihre Mutter vor einem Jahre gestorben sei, und daß sie nun das Kleinste großzuziehen habe; dabei herzte sie das Kind, und man sah, es war ihr keine schwere Pflicht.
Goethe fand, daß er von hier auf den Wald, der vor lhm emporstieg, auf die Fernsicht zur Seite und ein Stück vom Fels einen höchst malerischen Blick habe und seine Zeichnung viel bequemer auf dem Tische vor der Försterei anfertigen könne, als drüben unter den Bäumen, mit der Mappe auf den Knieen.
Als er diese Meinung aussprach, freute sich seine junge Wirtin sichtlich und rief: sie habe sich immer gewünscht, zu sehen, wie ein Bild gemacht werde.
Das Kind spielte, während er jetzt zeichnete, zu seinen Füßen mit dem Hunde, und Gretchen, das ältere Mädchen, kam und ging, sah dem Zeichner über die Schulter, staunte seine Geschicklichkeit an und plauderte dabei voll Natürlichkeit und Anmut.
Goethe betrachtete mit echter Künstlerfreude ihre tadellose Schönheit; ihr mattblondes Haar hing in zwei dicken Zöpfen lang über den Rücken hinunter, die weichen, regelmäßigen Züge konnten nicht lieblicher sein. Endlich bat er sie, sich ihm gegenüber zu setzen, er wolle sie zeichnen. Sie hatte nichts dagegen, sie müsse nur erst ihre Kuh füttern; darauf nahm sie ihren Strickstrumpf und setzte sich nach seiner Angabe.
Als sie dann des weiteren hin und her redeten, erzählte sie ihm, daß sie siebzehn Jahre alt und, wie sie mit hellem Erröten hinzufügte, einem jungen Chirurgen unten in Ilmenau verlobt sei; sie könne aber den Vater noch nicht verlassen, und ihr Bräutigam habe auch noch keine sichere Brotstelle, deshalb dürfe an Heirat noch nicht gedacht werden.
»Ja,« sagte sie überlegend, »wenn der Herzog den Johann späterhin fest anstellen wollte, könnte mein Vater – in ein paar Jahren vielleicht – mit einer guten Magd, oder einer Tante von uns fertig werden, allzubald verlasse ich ihn und mein Lenchen aber nicht.«
Als sie so erzählte und sich dabei einmal zur Seite wandte, rief sie plötzlich: »Ach, der Hansel!« und eilte ins Haus.
Goethe war überrascht ihrem Blick gefolgt; er sah einen Kapitalhirsch, vorsichtig äugend, drüben aus dem Walde auf die Wiese treten. Das stolze Tier hob und senkte langsam den Kopf mit dem mächtigen Geweih, das wie eine hohe, vielzackige Krone über der Stirn aufragte. Dann schritt es sicher und vornehm, langsam, hie und da wieder Umschau haltend, unter den breitästigen Buchen hervor.
Gretchen trat mit einigen Kastanien in der Schürze aus dem Hause, rief dem Hunde ein »Kusch!« zu und ging dem Ankömmling entgegen. Der Hirsch blieb mit stolz gehobenem Kopfe, bereit zu fliehen, aber noch vertrauend, auf seinem Flecke stehen.
Das Mädchen hielt die Schürze auf und rief das schöne Tier mit Schmeichelnamen. Es folgte langsam, äugend, darin aber ruhig aus der Schürze fressend, wobei seine Freundin ihm die Backe klopfte. Als die Kastanien verzehrt waren, kam sie zurück, während der Hirsch im Walde verschwand.
Mit Vergnügen hatte der Dichter den Vorfall beobachtet. Gretchen erzählte ihm, indem sie mit heiterem Lachen ihre schweren Zöpfe zurückwarf: ihr schöner Hansel komme schon seit langer Zeit fast täglich. Zuerst habe sie ihm sein Lieblingsfutter auf die Wiese geworfen, jetzt nehme er's zutraulich aus ihren Händen. Sie sei nur in großer Angst, daß der Herzog einmal hier im Revier jagen werde, und daß dann der prächtige Gesell dran glauben müsse.
Während sie noch hin und her plauderten, kam der Förster nach Hause. Er berichtete von der beendeten Jagd, und Goethe sah jetzt erst, daß die Sonne niedrig stand.
Als Förster Slevoigt erfuhr, daß der Gast zu des Herzogs Gefolge gehöre, erbot er sich, ihm die kürzesten Fußpfade zu weisen, auf denen er von hier aus zum Gickelhahn gelangen könne, und meinte, daß er quer durch den Wald, bei rüstigem Zuschreiten, in einer Stunde hinkommen werde.
Goethe brach auf und reichte mit herzlichem Danke Gretchen die Hand. Er wurde vom Vater eine Strecke Wegs begleitet und mit Jagdgeschichten unterhalten, auf die er nur zerstreut lauschte. Das schöne Mädchen und das Idyll dieses Tages erfüllten seine Gedanken!
Nachdem er sich von dem gefälligen Führer verabschiedet hatte und Ruhe fand, die empfangenen Eindrücke zu verarbeiten, festigte sich in ihm der Entschluß, die Försterei nie wieder aufzusuchen; auch den anderen Männern nichts von Gretchen Slevoigt zu sagen. Besonders wünschte er sie vor dem Herzoge zu hüten, nach dessen Geschmack – das wußte er – dies frische Kind des Waldes sein würde. Gretchen hatte schon ihren Weg gewählt; mochte sie still, wie eine Wunderblume, auf der grünen, von keinem fremden Fuß entweihten
Waldwiese weiterblühen, bis ihr Geliebter sie schützend an sein Herz nahm! Leise sang er vor sich hin:
»Im Walde sah ich ein Blümlein stehn,
Wie Sterne leuchtend die Äuglein schön,
Ich wollt' es brechen, da sagt' es fein:
Soll ich zum Welken gebrochen sein?«
Als er unter den hohen Bäumen am Gickelhahn ankam, sah er, daß alle Vorbereitungen zur Abendmahlzeit im Grünen getroffen waren. Ein weißes Tischtuch lag auf dem Rasen ausgebreitet, Teller, Flaschen und Gläser standen darauf, daneben Brot und kalte Küche; eben wurde als willkommene Zugabe, auf einer mächtigen Schüssel, der dampfende Hirschziemer aufgesetzt.
Eine Hornfanfare lud zum Mahle. Wedel kniete auf dem Boden und schnitt vor. Die Tafelrunde nahm Platz, alles lagerte so gut es ging im Grünen. Goethes Rückkehr wurde vom Herzoge mit einem »Hurra« begrüßt, er winkte ihn an seine Seite; und nun schmausten sie alle unter Fragen und Antworten, Gesprächen und Scherzen, mit dem gesunden Appetit solcher, welche einen Tag in lebhafter Bewegung, in Feld und Wald, bergauf und -ab, zugebracht haben.
Neben dem Feuer ließen sich's die Jäger und Diener gleichfalls wohl sein.
Goethe mußte berichten, wie er den Tag verlebt habe, er tat es wahrheitsgetreu, doch ohne des schönen Mädchens zu erwähnen.
Man saß lange beisammen, immer wieder wurde noch eine Jagdgeschichte erzählt, eine halbvergessene Tatsache aufgefrischt und manche Flasche guten Weins geleert.
Endlich sank der Abend und wob, vereint mit dem Waldesschatten, so dichte Schleier, daß man sich von einem zum anderen nicht mehr erkennen konnte. Der Herzog brach auf, er bat Goethe, ihn ins Gickelhahnhäuschen zu begleiten und dort die Nacht mit ihm zuzubringen, dann wünschte er seiner Gesellschaft eine gute Ruhe in den Laubhütten.
Schweigend stiegen die beiden Freunde das letzte Stückchen des Berges zu dem kleinen Holzhäuschen, welches den Gipfel krönte, hinan. Von wetterbraunen Brettern zusammengeschlagen, enthielt es unten einen Raum für den Forstwart und eine daneben hinaufführende Treppe. Das obere Zimmer hatte eine offene Seite nach dem Walde zu.
Der alte Forstwart fragte, ob Durchlaucht Licht befehle. Der Herzog dankte und der Mann ging.
»Unsere Nachtlampe von Gottes Gnaden ist just angezündet, schau nur, Wolfgang, da steigt sie über den Wipfeln empor!«
Beide traten an die offene Seite des Gemachs und blickten in die magisch schöne Nacht hinaus.
Stiller Frieden und doch ein Weben und Flüstern, ein Rauschen und Zittern, wie etwa in einer andächtigen Menge, die Großes erwartet; die mit angehaltenem Atem lauscht, deren Herzschlag man zu hören meint, und die kaum wagt, mit leisen Seufzern der gepreßten Brust Luft zu schaffen.
Da – mit klarem Glanz, schwebend in bläulichen Ätherwellen, kam der Erwartete, der volle Mond; blaßgoldig, friedenspendend, mit geheimnisvollen Kräften wirkend, auf seiner ewigen Bahn dahergeschwommen.
Und unter ihm schien es lebendig zu werden. Ein frischer Windzug fuhr durch die Millionen Zweige, Nadeln und Gräser zu seinen Füßen, daß es klang wie tiefes Aufatmen, wie leises Kichern und jauchzendes Frohlocken. Immer heller wurde es jetzt; man konnte den Pfad, der herausführte, einzelne Stämme und ferne Bergesformen unterscheiden. Zartes Gewölk sammelte sich um den Mond und jagte am sanftdurchleuchteten Abendhimmel vorüber. Das große Nachtgestirn aber zog unbeirrt, wie ein pflichttreuer, ernster Mensch auf seinem nur ihm bekannten Pfade dahin.
»Ohne Hast und ohne Rast'.« sagte Goethe; sein tiefstes Denken und Streben aussprechend. »So sollten wir alle vorwärtsschreiten.«
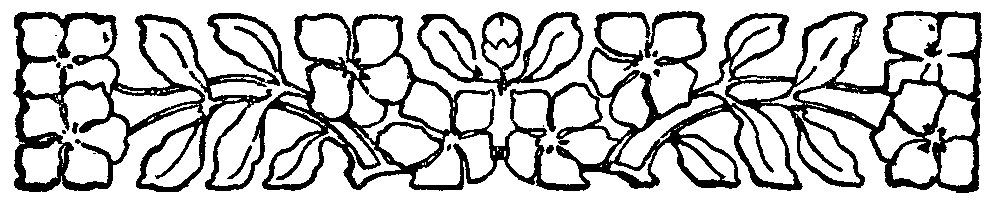
|
Die Winde sausen,
|
Lieg' ich und flehe;
|
Die alte Frau von Werthern war in der letzten Zeit mit dem Betragen ihrer Schwiegertochter außerordentlich zufrieden gewesen.
Emilie hatte es sogar neuerdings abgelehnt, in dem Goetheschen Singspiel: »Erwin und Elmire« – von der Herzogin Amalie in Musik gesetzt – die Hauptrolle zu übernehmen, zu der man sie neben Mademoiselle Rudorf auf den besonderen Wunsch des Herzogs bestimmt hatte. Sie zog sich erst zurück, nachdem schon ein paar Proben abgehalten waren, und brachte die Gesellschaft in einige Verlegenheit. Sie schützte aber Unwohlsein vor, und in der Tat konnte man ihr glauben, so seltsam bewegt, wechselnd in Farbe und Ausdruck, wie jetzt war sie früher nie gewesen. Auguste von Kalb trat nach einigen koketten Winkelzügen für sie ein und machte nun mit dem Kammerherrn von Seckendorf das zweite Paar.
Ließ auch Emiliens Verfahren an Rücksichtnahme einiges zu wünschen übrig, so verzieh ihr das die Schwiegermutter in dem tröstlichen Gefühle, daß sie den bösen Zungen, die ihre Beziehungen zu dem jungen Fürsten bespöttelten, diesmal keine Ursache zu schlimmen Bemerkungen gebe. Auch daß Emilie viel zu Hause blieb, still für sich in der Gartenlaube saß, sich höchstens von dem ungefährlichen Bergrat von Einsiedel vorlesen ließ, diente zur Beruhigung der alten Dame. Sie empfand es als ein um so größeres Glück, daß Milli plötzlich so verständig geworden war, als ihr Gatte sie ärger denn je vernachlässigte.
Der Rittmeister hatte mit der Fuchsstute ein gutes Geschäft gemacht und schwamm im Überfluß; die Zeit der kontraktlichen Rücksichtnahme für seine Frau war überstanden, er lebte jetzt also um so wilder, war oft tage- und wochenlang auf Nachbargütern, zu dienstlichen Ritten oder Jagdpartien entfernt und bekümmerte sich wenig um beide Damen.
Emilie schien die Empfindlichkeit über ihres Mannes Benehmen abgelegt zu haben. Wenn er früher tagelang nicht nach Hause kam, oder Abend für Abend ins Wirtshaus ging, hatte sie sich schweigsam mit Tränen in den Augen abgewandt. Jetzt fand er sie immer gleichmütig gestimmt. Raffte er sich zu einer Art Entschuldigung über sein Ausbleiben, seinen Lebenswandel zusammen, so pflegte sie zu entgegnen: er solle doch ja nach seinem Gefallen leben und ihretwegen sich nicht beunruhigen. Kurz, sie machte es jetzt beiden Teilen recht und war ihm eine so bequeme Frau, daß er anfing, sie auf seine Weise gern zu haben.
Es war an einem warmen Junitage, als Emilie mit ihrer Filetarbeit in der verschnittenen Lindenlaube saß, welche ihr den kleinen Stadtgarten so angenehm machte. Dies Fleckchen hinter dem von Häusern eingeschlossenen Hofplatze, eingehegt von einer Nachbarmauer, an zwei Seiten von anderen Gärten umfaßt, war trotz seiner Enge, seiner Ein- und Abgeschlossenheit, ein Paradies für die junge Frau geworden. Ein paar schmale, von Buchsbaum und Lavendel begrenzte Wege, ein alter hoher Apfelbaum voll Star- und Sperlingsgezwitscher, einige Taxusfiguren, ein Beet mit starkduftenden Narzissen und etwas Gebüsch gab die ganze Herrlichkeit ab. Die Lindenlaube war auch mehr einem Vogelbauer ähnlich als einem Aufenthalt im Freien, sie hatte eine ringsumlaufende Bank und einen runden, den mittleren Lindenstamm umfassenden Tisch, an dem Emilie jetzt ihr Nadelkissen zu einer endlosen Filetarbeit festgeschraubt hatte. Sie ließ aber oft die Hände sinken und schaute ungeduldig nach der kleinen Lattentür, die auf den Hof führte; es war ersichtlich, daß sie jemand erwartete.
Endlich öffnete sich das Pförtchen, und Moritz von Einsiedel trat in den Garten; das hübsche Gesicht der jungen Frau wurde bei seinem Erscheinen von einem hellen Rot der Freude übergossen. Er kam zu ihr in die Laube, küßte ihr die Hand und setzte sich neben sie; ein Buch, das er mitgebracht hatte, auf den Tisch legend.
»Sie sehen ernster aus als sonst, Herr von Einsiedel,« sagte Emilie, ihn ängstlich beobachtend. »Tat ich irgend etwas, das Sie verdrießt? Als Sie gingen, waren Sie mit mir zufrieden, weil ich die Rolle der Elmire auf Ihren Rat abgegeben hatte.«
»Es war verständig von Ihnen, daß Sie mir folgten; seien Sie ferner vorsichtig, auch wenn ich nicht da bin, Sie zu warnen.«
»Müssen Sie schon wieder verreisen?« rief sie erschrocken.
Er seufzte, sah sie an und murmelte gepreßt: »Ja, auf lange Zeit.«
Sie schrie fast auf: »Gehen wollen Sie? Um Gottes willen, was haben Sie vor?«
»Ich komme, dem Rittmeister die Wohnung zu kündigen, da ich ganz fort will,« sagte er hart und trocken.
Emilie war keines Wortes mächtig, endlich brach sie in Schluchzen aus. Sie legte ihren Kopf in beide Hände und weinte laut, während ihr Körper krampfhaft bebte.
Diesen rückhaltlosen Ausbruch der reizbaren Frau hatte er nicht erwartet. Auch seine Farbe wechselte; er flehte sie an, sich zu beruhigen, er wolle ganz, ganz rückhaltlos offen gegen sie sein, dann müsse und werde sie ihm recht geben. Er zog ihr die Hände von den Augen, küßte ihre tränenfeuchten Finger, sprang dann plötzlich auf, machte einen raschen Gang durch den kleinen Garten und kehrte ruhiger zu ihr zurück.
Sie erwartete ihn bleich, mit weitgeöffneten, fragenden Augen.
»Was treibt Sie fort,« stammelte sie, »warum wollen Sie mir das antun? Sie wissen ja, wie glücklich ich war, wenn Sie mir vorlasen, mit mir plauderten! Ich war nicht mehr vergnügungssüchtig, nicht mehr anspruchsvoll. Diese Laube war meine Welt. Ich konnte jetzt meine Schwiegermutter und Werthern zufrieden stellen, aber nur, weil ich durch den Verkehr mit Ihnen glücklich war.«
Es lag etwas Schlichtes, Rührendes in ihren Worten und in der demütigen Weise, in der sie sprach.
Er setzte sich ihr gegenüber; ernst und doch voll Milde und Liebe sah er das bebende junge Weib an, dann sagte er mit tiefem Atemzuge: »Ich fühlte lange, daß ein rettender Entschluß für uns beide gefaßt werden müsse. Täglich konnte ich Sie weniger entbehren, Emilie. Seit dem Winter fingen plötzlich meine Gedanken an, sich nur auf Sie zu richten. Ich war nicht mehr derselbe, ich konnte nicht bei meinen Büchern aushalten. Immer dachte ich daran, wie ich Ihnen begegnen könne. Seit einigen Wochen treffen wir uns täglich. Anfänglich ergab auch ich mich dem Reiz dieses Verkehrs ohne Gegenwehr, dann ward mein Zustand, wenn ich nicht bei Ihnen war, ein peinvoller Kampf. Wohin führte uns diese Neigung, der wir uns überließen? – Es ward nichts zwischen uns ausgesprochen, aber wir wußten, wir fühlten beide, bei jedem Blick, jedem Laut, jeder Berührung, wie teuer wir einander waren. – Ich bin kein gewissenloser Phantast, Emilie; ich will uns nicht ins Elend stürzen. Ich bin ein Mann, der ernst mit sich und seinen Leidenschaften ringt. Fest sagte ich mir: bis hierher und nicht weiter! Dann fragte ich mich, was tun? Wie der gefährlichen, der wachsenden Empfindung entgegentreten oder ihr entrinnen? – Da bot sich mir die Rettung in einer jahrelangen Trennung. – Mir wurde kürzlich von einer Kompanie zur Ausbeutung afrikanischer Goldbergwerke ein günstiges Anerbieten gemacht. Unter anderen Verhältnissen würde ich meine Stellung hier nicht aufgeben, jetzt tue ich es Ihret-, unseretwegen, Emilie. Es ist ein rettender Ausweg, den ich mit blutendem Herzen, aber getrieben von der Notwendigkeit einer Trennung, einschlage.«
»Das überlebe ich nicht!« jammerte sie mit verzweiflungsvollem Aufblick. »Verlassen von Ihnen, was soll ich anfangen? O könnte ich mich doch von Werthern scheiden lassen!«
»Scheiden, scheiden!« rief er, das Wort aufgreifend. »Scheiden; ja, das wäre nichts als ein äußerliches Betätigen des innerlich längst Geschehenen.«
»O, sagen Sie mir, was ich tun soll! Ich gehorche Ihnen, ich will nichts, als mich Ihnen unterwerfen. Soll ich zu Werthern gehen und ihm sagen, was ich wünsche? Vielleicht wird er mich schlagen, aber was schadet das! Die Mutter« – sie stockte plötzlich, ward rot und blaß, sagte noch einmal: »Die Mutter –« und brach dann wieder in Tränen aus.
»Nun?« fragte er gespannt. »Glauben Sie, daß Frau von Werthern Ihnen wesentliche Hindernisse in den Weg legen kann?«
»Meine Schwiegermutter,« stammelte Emilie, »ist ein Engel; sie besitzt alle die Tugenden, welche ihrem Stiefsohne fehlen. Sie öffnete mir ihre Arme, nahm mich in ihre Obhut und ward meine Freundin. Was sie vermochte, hat sie für mich getan. Dafür forderte sie nur, daß ich den bösen Schein meide, daß ich einen Schleier über mein trauriges häusliches Verhältnis werfe und meinem, ihrem guten Namen jedes Opfer bringe. Mit den heiligsten Eiden habe ich ihr diese Schonung zugeschworen. Ich würde sie entsetzen, wenn ich ihr von einer Scheidung sprechen wollte. Das war's, was eben wie mit Bergeslasten auf mich fiel!«
Nach einer für beide Seelen inhaltschweren Pause sagte er: »Sie haben recht, eine Scheidung ist etwas Verletzendes für alle Teile. Auch ich bange davor, dies Verfahren über Sie kommen zu sehen.«
»Aber was dann?«
»Ich wähnte sagen zu können: bis hierher und nicht weiter! – Aber eine neue Stunde bringt neue Gewalten ins Spiel; treibende, fordernde, herzbewegende Empfindungen. Eben war ich noch Herr der Verhältnisse, getrost die Wogen meines Lebensstromes teilend, jetzt schlagen mir die Sturzwellen über dem Kopfe zusammen.«
»O daß ich Sie mit mir in diese Not bringe!«
»Emilie! Not? Ist das, was ich für Sie empfinde, nicht trotz allem – Seligkeit? Ich bin wie aus einem Kerker ans Licht gestiegen. Vergraben in meine Wissenschaft, suchte und fand ich nur in ihr Zweck und Ziel. Plötzlich schmückt sich in der Liebe zu dir das Leben mit ungeahntem Reiz. Ich weiß, ich fühl's jetzt; Mann und Weib können sich hienieden das Höchste sein und geben!«
»Oder das fürchterlichste Elend bereiten,« sagte sie jammernd.
»Ja, du hast recht! Es ist eine Grausamkeit, dich, liebstes Wesen, dich, für deren Wohl ich mein Vaterland aufgebe, hier in dieser unwürdigen Lage hilflos zurückzulassen; seiner, des Rohen Gewalt preisgegeben!«
Emilie stöhnte in wortloser Qual.
Er schwieg, tief bewegt, und schaute ratlos vor sich hin.
»Wäre ich doch tot!« seufzte sie, »und läge daheim auf dem elterlichen Gut in der düsteren Familiengruft!«
»Ja, es wäre besser für dich!«
Es war ein Seufzer der Verzweiflung und zugleich der Resignation, mit dem er diesen herben Ausspruch tat.
Sie bedeckte ihr Gesicht mit den Händen, sah dann plötzlich wie von einem Entschluß erfaßt auf und sagte: »Ich will keine Eklat machende Scheidung, aber ich will Trennung; ich bleibe nicht bei ihm! Mein guter, treuer Bruder, der jetzt das elterliche Gut bewirtschaftet, verheiratet mit einer Jugendfreundin von mir, hat versprochen, mich aufnehmen zu wollen, wenn Werthern mich schlecht behandle. Ich war schon oft in Leitzkau bei den Geschwistern. Sie kennen meine Liebe und Rücksichtnahme für die herrliche alte Frau hier und billigen diese Empfindung. Ich will zu ihnen, ihnen meine Lage schildern, um ihren Beistand flehen, sie sollen mich für den traurigen Rest meines Lebens bei sich behalten.«
»Wird deine Schwiegermutter diesen Plan der Trennung billigen?«
»Ich nehme keinen Abschied von ihr; ich teile ihr meine Absicht nicht mit! Wenn sie mich wiedersehen will, muß sie auf das Gut kommen.«
»Armes Kind, wie wirst du es ertragen, ohne Zweck und Ziel, in der Einsamkeit begraben, dein Leben hinzubringen? O, könnten wir wenigstens die kurzgemessene Zeit vorher beieinander sein! Dann nehmen wir beide eine glückselige Erinnerung mit in unsere Verbannung!«
Sie griff dieses Wort auf, sie versicherte ihm: er werde als Gast ihres Bruders willkommen sein; sie malte ihm aus, wie abgeschieden und sicher vor Späherblicken man in Leitzkau lebe, wie die Geschwister ihnen ein paar Tage Seligkeit, ein paar Tage unbefangenen Sehens, Verkehrens, Sichliebens gönnen würden. – »Und sollte auch der Tod am Ende einer solchen Himmelswonne lauem!« rief sie leidenschaftlich, »er würde mir willkommen sein! Was gäbe es denn noch Höheres, Herrlicheres in der Welt zu erleben, als die genossene Seligkeit mit dir? Dann wüßte ich, weshalb ich geboren wurde, und wollte gern scheiden!«
Er schloß die Glühende in seine Arme, bedeckte ihr Gesicht mit Küssen und konnte ihrem Vorschlag keinen Widerstand entgegensetzen. Sie verfolgten ihren Plan und beschlossen, Weimar zusammen zu verlassen.
Emilie meldete sich bei ihren Geschwistern an, und der Bergrat kündigte seinem Hauswirt die Wohnung, löste seine Beziehungen und richtete alles zur Abreise ein.
Als die junge Frau über ihre angegriffene Gesundheit klagte, riet die Mutter selbst zu einem Landaufenthalt beim Bruder.
Da eben der Hof einen begünstigten Teil der Gesellschaft zu längerem Besuch auf der Ettersburg einlud, wo mancherlei Lustbarkeiten stattfinden sollten, und auch Emilie dieser Auszeichnung gewürdigt ward, trieb die sorgliche alte Dame selbst ihre Schwiegertochter, bald nach Leitzkau abzureisen, um sich die Anstrengungen der Ettersburger Feste nicht aufzuerlegen. Sie war entzückt von dem Verhalten ihres verständigen, folgsamen Kindes, das die Freuden der Hofgesellschaften aus Rücksichten und, wie sie meinte, auf ihr Zureden, opferte, und hoffte, daß sich so nach und nach immer mehr ihre gefährlichen Beziehungen zu dem jungen Herzog lösen würden.
Herr von Einsiedel zog aus dem Werthernschen Hause fort; er beabsichtigte, die letzte Nacht im Gasthofe zuzubringen.
Der Rittmeister war vor ein paar Tagen abgereist, um eine große Hofjagd in Sondershausen mitzumachen.
Emilie hatte sich den Wagen ihres Bruders zur Stadt bestellt, sie wollte am anderen Tage Weimar verlassen; diesen letzten Abend verlebte sie bei ihrer Schwiegermutter in deren wohnlichem Stübchen, aus dem sie sich so oft Trost und Liebesbeweise geholt hatte.
»Du bist wirklich sehr nervenschwach, mein liebes Kind,« sagte die alte Dame beim Abschied in ermunterndem Ton zu der Weinenden. »Es ist die höchste Zeit, daß du hier fort und auf das Gut kommst. Ich empfinde ja mit dir, mein Schäfchen, aber umsomehr lobe ich dich und halte dich in Ehren! Du wirst es nie bereuen, deiner alten, besten Freundin gefolgt zu sein.«
Das war zu viel Güte von seiten der arglosen Frau! Emilie warf sich, ergriffen von Trennungsschmerz, ihr zu Füßen, umfaßte ihre Kniee und schluchzte laut.
Frau von Werthern erschrak. »Welche Szene, mein Kind, keine Exaltation, ich bitte. Steh auf und geh, wir sehen uns hoffentlich bald und frischen Mutes wieder!«
Emilie sprang empor, noch einmal umfaßte sie die Mutter, küßte sie leidenschaftlich und stürzte wortlos hinaus.
Am anderen Morgen stand der Leitzkauer Wagen, bepackt mit ein paar Koffern, vor Emiliens Hause. Erfüllt von widerstreitenden Empfindungen, warf die Flüchtende, die auf Nimmerwiederkehr Scheidende, sich hinein. Sie hatte mit Einsiedel die Abrede getroffen, daß er zu Fuß die Stadt verlassen und draußen, an der kleinen Schleuse des Schwanensees, zu ihr in den Wagen steigen solle. Sowie sie das Tor hinter sich hatte, richtete sich all ihr Denken auf ihn. Eine wallende Freude und Spannung erfüllte ihr leichtbewegliches Gemüt, und, den Ledervorhang der Kutsche zurückschiebend, legte sie sich weit hinaus, um nach dem Ersehnten auszuspähen. Da schritt vor dem Wagen ein Mann auf die kleine Wiesenschleuse zu; das mußte er sein!
Sie gebot dem alten Kutscher aus der Heimat, bei dem Herrn drüben anzuhalten, der Mann nickte gehorsam, schlug auf seine Gäule und fuhr auf die vor ihm befindliche Gestalt zu; jetzt hielt er dicht neben dem Wanderer. Emilie bog sich weit hinaus, um ebenso rasch erschrocken zurückzufahren.
Es war der Oberkämmerer von Göchhausen, welcher, von seinem Krankenlager erstanden, den gewohnten Morgenspaziergang machte und jetzt an der Schleuse stand; sie zerstreut aus seinen wasserblauen Augen anstarrend, schlug er mit dem Stock auf das Holz und sagte pathetisch: »Louis Wilhelm von Göchhausen ist hier gewesen!«
Dann wandte er sich ab und schritt davon.
Auf der anderen Seite des Wagens aber wurde in diesem Augenblicke die Tür aufgerissen; mit raschem Satz sprang Moritz von Einsiedel zu der Geliebten herein und zog sie leidenschaftlich in seine Arme.
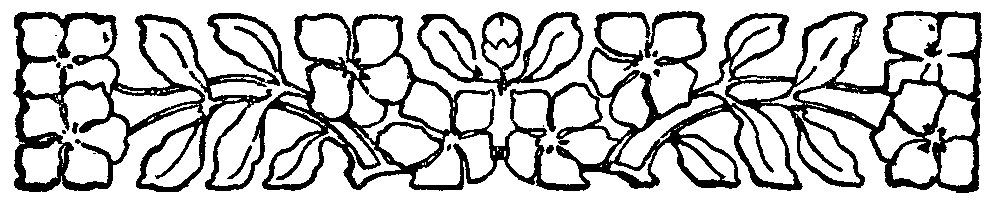
Warum ist alles so rätselhaft?
Hier ist das Wollen, hier ist die Kraft;
Das Wollen will, die Kraft ist bereit
Und daneben die schöne, lange Zeit.
So seht doch hin, wo die gute Welt
Zusammenhält!
Seht hin, wo sie auseinanderfällt!
Goethe.
Die Festlichkeiten auf der Ettersburg waren zur allseitigen Zufriedenheit abgelaufen. Die Hofgesellschaft kehrte nach Weimar zurück und bereitete sich auf neue gesellige Freuden vor, als eine Trauernachricht für kurze Zeit eine ernste Gemütsstimmung unter den lustigen Weltkindern verbreitete.
Es langte von den Verwandten Emiliens von Werthern auf Leitzkau die Anzeige ihres plötzlichen Todes in Weimar an und lief bald als Neuestes, Schreck verbreitend, von Mund zu Mund.
Die junge reizvolle Frau, bewundert und beneidet, der Ausgelassensten eine, plötzlich dahingerafft, mitten aus dem blühenden Leben fort – es war erschütternd für alle jene fröhlichen, lebenslustigen Gemüter, die kaum jemals an ein Ende solcher guten Zeit gedacht hatten, oder doch nur an ein ganz fernes, das sich lange vorher mit grauen Locken und lebensmüder Hinfälligkeit ankündigt. Das Ergreifendste aber war ein leises Gerücht, als sei die Nachricht, daß Emilie am Schlagfluß gestorben, nicht wahr, als habe sie gewaltsam und von eigener Hand geendet.
Der so plötzlich verwitwete Rittmeister von Werthern hatte die Trauerkunde nicht einmal früh genug erhalten, um zur Beerdigung hinüberzureisen. Er schien nicht sonderlich betrübt, was niemanden wundernahm, da das Verhältnis des Ehepaares zueinander kein Geheimnis geblieben war. Der Herzog ließ es sich nicht nehmen, die alte würdige Frau von Werthern persönlich aufzusuchen. Er hatte so manche frohe Stunde mit der hübschen Milli vertändelt, hatte einen pikanten Reiz in dem Spiele mit ihr, dem Kokettieren hin und her gefunden, daß er jetzt in seinem warmen, ehrlichen Herzen sich recht erschrocken und betrübt fühlte. Mochte sein eigentliches Liebesempfinden bei jenem Verkehr auch kaum gestreift sein, so war es doch die beste Kameradschaft gewesen, welche jetzt von der rauhen Hand des Todes so plötzlich getrennt wurde.
Er fand die alte Dame, bei der er seinen Besuch zuvor hatte ansagen lassen, gefaßter, als er fürchtete. Sie kam ihm mit der feinsten Form entgegen; und bald waren diese beiden ungleichen Menschen in einer ernsten Unterhaltung.
»Mein armer Liebling,« sagte Frau von Werthern mit bebender Stimme, »ist früh hinweggerafft; wie sollte aber ich darüber klagen, da für mich ja ein Wiedersehen so nahe liegt. Was mich betrifft, so will ich Eurer Durchlaucht nicht verhehlen, daß ich Gottes gnädige Fügung bewundere. Jetzt darf ich es wohl aussprechen, daß dies liebenswürdige Geschöpf nicht glücklich war; ach, und sie hatte es so sehr verdient! – Wenn ich hinzufüge, daß einer jungen, schönen Frau, die ohne Schutz und Stütze von seiten ihres Gatten dasteht, Gefahren drohen, werden Eure Durchlaucht mich gewiß verstehen. Wir sind mehrmals übereingekommen, daß der Tod besser sei als ein Verirren vom rechten Wege. Sie wollte so gern brav und tugendhaft bleiben, meine kleine leichtlebige Tochter; jetzt ist sie allen Versuchungen entrückt; wohl ihr!«
»Ich fühle den Vorwurf, der in diesen Worten liegt, verehrte Frau,« entgegnete der Herzog tiefbewegt. »In seiner ganzen Schwere verdiene ich ihn aber nicht. Es war zwischen uns immer nur auf eine flüchtige Unterhaltung abgesehen; ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich nie etwas getan habe – hoffentlich nie getan hätte – was Emilie mit ihrem Gewissen in einen Konflikt bringen konnte.«
Frau von Werthern war in ihrem loyalen Herzen gerührt, ja geradezu ergriffen von der Offenheit und Güte ihres jungen Landesherrn; sie gab diesen Empfindungen Ausdruck, und man trennte sich beiderseits mildbewegten Gemüts.
Karl August fühlte sich heute weich gestimmt. Nie war ihm bisher in seiner jungen Ehe das Bedürfnis gekommen, mit Luisen eine Verständigung zu suchen, jetzt aber empfand er Verlangen danach.
Verheiratet, ehe er den Wunsch empfunden, hatte er den Besitz der edlen Frau bis jetzt nicht zu schätzen gewußt. Es war nicht das Rechte zur rechten Zeit gewesen. Aber sollte sich nichts nachholen lassen?
Getrieben von einem warmen Impulse, verließ er die milde, alte Frau mit dem guten Vorsatz, einmal bei seinem jungen Weibe anzuklopfen.
Seine Gemahlin trauerte wie er; sie hatte gleich nach ihrer Rückkehr von der Ettersburg die Nachricht vom Tode ihrer geliebten Schwester – der Großfürstin Paul in Petersburg – erhalten, und ihm fiel ein, daß er sie in den letzten Tagen nur flüchtig und dann mit verweinten Augen gesehen habe. Mitleidige Sympathie und eine ungewöhnliche Gleichstimmung ließ ihn mit erwartungsvoll pochendem Herzen ihrer Tür nahen.
Luise saß in tiefes Schwarz gekleidet, die Hände im Schoß gefaltet, das feine, bleiche Haupt gesenkt, in ihrem Zimmer, dem Vorlesen ihrer Gesellschaftsdame, des Fräuleins Henriette von Wöllwarth, lauschend. Es war ein Gesang aus Klopstocks eben erschienenem Messias, den Henriette mit kräftig ernster Stimme und einem gewissen monotonen Pathos vortrug.
Als der Herzog, den man nicht gewohnt war, um diese Stunde hier zu sehen, plötzlich eintrat, blickten sich beide Damen erschrocken nach ihm um und erhoben sich gleichzeitig zur Begrüßung; Luise sank müde auf ihren Stuhl zurück, das Hoffräulein machte eine tiefe Verbeugung.
Karl August reichte seiner Frau mit teilnahmsvollem, zärtlichem Ausdruck seiner lebhaften Augen die Hand; Luise senkte ihre Blicke, die sie nur flüchtig erhoben hatte, sogleich wieder und verharrte in einer matten Apathie.
Sich jetzt zu dem Hoffräulein wendend, sagte der Herzog einfach: »Ich möchte mit meiner Frau allein sein.«
Henriette sah ihn erstaunt an, so ernsthaft und ruhig war ihr Gebieter nie gewesen; sie wiederholte ihre Verbeugung und verließ das Zimmer, worauf er ihren Platz einnahm.
Jetzt blickte auch die Herzogin fragend zu ihm auf.
Als er schwieg und – wie stets von ihrer Erscheinung, ihrem Ausdruck erkältet – nicht gleich das rechte Wort finden konnte, um eine Unterhaltung anzuknüpfen, rief sie: »Ist etwas Besonderes geschehen? Ist wieder eine Trauerbotschaft gekommen?«
»Nein,« entgegnete er ernsthaft, »ich dachte, wir hätten beide genug.«
»Wir?« fragte sie und lehnte sich mit kühler Gereiztheit zurück. »Bis jetzt hast du an meinem Verlust, der mich so tief schmerzt, nicht diesen persönlichen Anteil genommen.«
Er ward verlegen. Niemals sonst – nur ihr gegenüber, die es hätte vor allen verstehen sollen, ihn behaglich zu stimmen – hatte Karl August mit einer Anwandlung von Verlegenheit zu kämpfen. Und da etwas Derartiges seiner freimütigen Natur fernlag, seinem Blute ein fremder Tropfen war, dessen er sich gewöhnlich in derber Weise entledigte, ward dieser lästige Einfluß, der von ihrer Persönlichkeit auf ihn ausging, eine der Ursachen jener traurigen Entfremdung, welche zwischen ihnen bestand.
Karl August hatte in seiner geraden Arglosigkeit in der Tat gar nicht daran gedacht, daß er kaum Teilnahme von seiner Frau bei dem Verlust einer Coeur-Dame erwarten könne, die ihrer ganzen Art nach himmelweit von Luisen verschieden, dieser gewiß sehr wenig sympathisch gewesen war. Was sollte er jetzt sagen? Sollte er plötzlich über den Tod der ihm unbekannten Schwägerin mit ihr klagen, oder sollte er seinen von dem ihren so verschiedenen Herzenskummer ihr verraten? Sein gerader Charakter verschmähte alles, was einer Verstellung ähnlich sah, und so erwiderte er ihr nach kurzer gedankenvoller Pause: wie er ja über den Tod der Schwester ihr sein Bedauern längst ausgesprochen, wie sie keinen eigentlichen Schmerz von ihm erwarten könne, da er die Verstorbene nie gesehen habe, und wie er jetzt betrübt zu ihr komme, um ihre Teilnahme an dem Tode der kleinen Werthern – der ihm nahegehe – zu suchen, bei deren trefflicher, alter Schwiegermutter er eben gewesen sei.
»Die kleine Werthern?« sagte Luise kühl, »ja, ich hörte, daß sie plötzlich irgendwo auf dem Lande gestorben sei. Das mag einer so lebenslustigen Person schwer geworden sein; da sie es aber einmal überstanden hat, wüßte ich nicht, was mein Gemahl in ihr oder mit ihr verloren haben könnte?«
Sie sprach das in der allerruhigsten, gleichgültigsten Weise. Sie hätte ihm um die Welt nicht verraten mögen, welche peinvollen Stunden eifersüchtiger Sorge sie der hübschen Verstorbenen halber schon durchlitten, wie oft sie sich gekränkt gefunden, wenn sie gesehen, daß Emilie es verstand, den Herzog zu erheitern und wie viele Male sie die Leichtigkeit und Grazie jenes jungen Weibes zu besitzen gewünscht hatte. Sie tat aber jetzt, als habe sie nie geahnt, daß der Herzog Milli bevorzuge.
Er begriff diese Arglosigkeit nicht, die er für volle Nichtbeachtung seiner selbst nahm.
»Wenn ich froh und lustig bin,« sagte er jetzt in verdrießlichem Tone, »willst du nichts davon hören; wenn mich etwas betrübt, ist dir's einerlei; ich möchte wissen, wann wir uns einmal in derselben Empfindung begegnen und ob wir uns jemals verstehen werden?«
Dieser Vorwurf berührte das Herz der jungen Frau auf das schmerzlichste, da er die Wahrheit traf; die Wahrheit, welche sie anerkennen mußte, so sehr sie auch darunter litt. Was sollte sie aber tun? Wie konnte sie mit ihm über den Tod einer Frau trauern, deren Hinscheiden ihr doch die größte Erleichterung verschaffte. Sie war viel zu rein, viel zu stolz, sich mit der Lüge einer solchen Trauer zu beflecken, und fand in ihrem hilflosen Ungeschick keinen anderen Ton als den kühler Gleichgültigkeit. Ihre geringe Anlage für unbefangene, liebenswürdige Gefühlsäußerungen wurde aber unter den ihr beschiedenen Verhältnissen auch weder geweckt noch gepflegt. Karl August besaß nicht die Zartheit und Konsequenz, um ihr Empfinden herauszulocken und zu schonen. Ihre scheue Zurückhaltung, ihr Festhalten an der anerzogenen, strengen Form langweilten ihn; er wollte heitere, ankömmliche, derbe Menschen! Wagte sie sich einigemal mit leisen Symptomen ihres Empfindungslebens hervor, so beachtete er dieselben, an stärkere Reizungen gewöhnt, gar nicht, verschüchterte sie, widersprach ihr und beging täglich Dinge, die sie – wenn sie es gewagt hätte, ihn streng nach ihrem Sinne zu beurteilen – Roheiten und Taktlosigkeiten genannt haben würde. Sie liebte ihn aus Pflichtgefühl, als ihr Recht – eine davon abweichende Neigung wäre dieser Natur nicht möglich gewesen – und empfand es stets als Schmerz, ihm ihre Liebe nicht zeigen zu können. Aber ebenso, wie ihr Sein einen Druck auf ihn ausübte, so empfand sie in seiner Nähe die Scheu der zarten Seele, vor der Möglichkeit einer von ihm ausgehenden harten Berührung.
Auch diesmal fanden beide keine Verständigung.
Der Herzog ließ sich, halb aus Ärger und Eigenwillen, jetzt noch lobender über die Verstorbene und betrübter über den Verlust aus, welchen er durch ihren Tod erlitten, als er vorher gewollt hatte. Er sagte mehr, als er empfand, sagte, daß er Milli gern gehabt habe. Luise ärgerte ihn mit ihrer kühlen Passivität, mit der er nichts anzufangen wußte. Hätte er sie doch aufstacheln, beleben, einmal zur Heftigkeit reizen, bis auf den Grund, zur vollsten Offenheit, erschließen können! –
Sie war ein Wesen, das er nicht begriff; ihr schweigendes Zurückweichen hielt er für Trotz, ihr stilles Dulden für Kälte, er glaubte, es liege nur an ihrem mangelhaften, guten Willen, wenn sie sich ihm nicht so warm und offen gab, wie er sie zu finden begehrte.
Als er sie jetzt wieder so weit in sich verscheucht sah, daß sie bewegungslos mit niedergeschlagenen Augen dasaß, kein Wort sprach, kaum zu hören schien, sprang er auf, murmelte zwischen zusammengebissenen Zähnen: »Automat!« und stürzte fort.
Er fühlte sich so sehr in seinem innersten Gleichgewicht gestört, daß er aus eigener Kraft kein Behagen wiederfinden konnte und sich mächtig gedrängt fühlte, ein Aussprechen mit dem verständnisvollen Freunde zu suchen. Unverweilt eilte er nach Goethes Gartenhaus am Stern hinaus, um sein Herz dem Getreuen auszuschütten.
Es war ein schöner, warmer Sommerabend; Goethe begoß seine neben dem Häuschen gelegenen Blumenfelder. Sowie er, sich von seiner Arbeit aufrichtend, dem heranstürmenden Herzog ins Gesicht sah, las er in dessen erregten Zügen, daß etwas Besonderes vorgefallen sein müsse. Prüfend und fragend senkten sich seine Blicke in die Augen des anderen.
»Komm, Wolfgang,« sagte der Fürst gereizten Tons, »laß deine Blumen und schenke mir die Wohltat einer liebevollen Linderung meiner Herzensdürre.«
Er nahm Goethes Arm und zog ihn unter die Bäume auf schattigen Terrassenwegen hinan, auf denen sie scheinbar in der Stille und Einsamkeit eines Waldpfades miteinander allein waren und nichts des Herzens freie Sprache hinderte.
»Und nun,« – so schloß Karl August sein ehrliches Bekenntnis – »nun komme ich zu dir, um einen gesunden Atemzug zu tun, des Grimmes ledig zu werden und mich mit mir selber zurechtzufinden. O, warum sind doch zwei so verschiedene Naturen aneinandergekettet!«
»Und die Fürstin ist so verehrungswürdig,« sagte Goethe mild. »Mitleidig sehe ich sie auf ihrer einsamen Höhe; ohne Talente, ohne Wirksamkeit auf andere, abgeschlossen, schwerlebig, aber rein und klar wie Bergwasser.«
»Und ebenso unangreiflich, unter den Händen kühl verrinnend. Man kann ebensogut Wasser mit der Schere schneiden, wie Eindruck auf diese Natur machen! Dagegen das arme Ding, die Milli! Ein immerwährendes Schillern, Reizen, Ausweichen und Entgegenkommen; ein Spielzeug in lustig wechselnden Formen. Sie war mir nicht wert wie du, ich habe sie kaum recht lieb gehabt, aber sie wird mir in jeder Gesellschaft fehlen, und mein Herz kommt mir leer vor wie ein ausgeblasenes Ei.«
»Könnte man doch die rechtmäßige Bewohnerin, dein Weib, triumphierend hineinführen! Fände sich doch eine Hilfe, euren Mißklang zur Harmonie zu lösen! Aber das eigentliche Wesen der Herzogin bleibt in der Knospe. Das Zugeschlossene schließt alle zu, das Offene öffnet, vorzüglich wenn Überlegenheit in beiden ist. Trotz allem ist Luise ein Engel!«
»Hoho!« rief der Herzog und sah den Freund scharf an. »Das war ein starker Ausdruck! Gehst du zur feindlichen Partei über?«
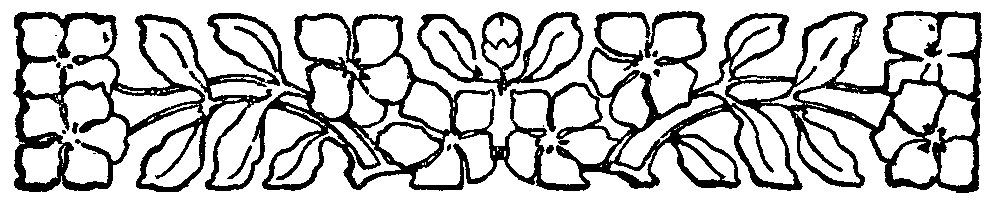
Nach ewigen, ehrnen
Großen Gesetzen
Müssen wir alle
Unseres Daseins
Kreise vollenden.
Tolle Zeiten hab' ich erlebt und hab' nicht ermangelt
Selbst auch töricht zu sein, wie es die Zeit mir gebot.
Goethe.
Der Herbst kam. Es war beschlossen, in Tiefurt ein Erntefest zu begehen; der ganze Hofkreis sollte – zu einer ländlichen Maskerade ausstaffiert – dort erscheinen und sich in ungebundener Weise ergötzen.
Das kleine Kammergut Tiefurt, an beiden Ufern der Ilm gelegen, gehörte der Herzogin-Mutter, die hier dem Prinzen Konstantin mit Knebel seinen Wohnsitz angewiesen hatte, aber selbst oft auf Wochen mit Thusnelda draußen war. Sie ließ dann nach ihrem Sinn arbeiten und bessern, und die Umgebung mehr und mehr verschönern. Wieland, der hier oft bei seiner Gönnerin weilte, nannte den Park: einen so holden Zauber, daß er ihn gegen das allerbrillanteste Stück der Feenwelt nicht vertauschen möchte!
Das Schlößchen, eigentlich nur ein zweistöckiges Wohnhaus mit fünf Fenstern in der Front und einem Wirtschaftsgebäude, wurde von prächtigen Kastanien beschattet; wilder Wein deckte das Nebengebäude und die Mauer, welche den Ökonomiehof absonderte. Unten wohnte Knebel mit seinem Prinzen und einem Kammerdiener. Auf der anderen Seite des Flurs lagen ein paar Gastzimmer, von denen das beste vorwiegend für den Herzog bestimmt war. Oben befanden sich die Gemächer der Herzogin, der Göchhausen und einige Gesellschaftsräume.
Die Herzogin Luise hatte zu dem heutigen Feste für sich und ihren Hofstaat absagen lassen; nur Henriette von Wöllwarth, die dienstfreie Hofdame, durfte erscheinen. Luise hielt sich seit jener unerfreulichen Berührung mit ihrem Gemahl, unter dem Vorwande, in Trauer zu sein, streng abgeschlossen und brütete in Trostlosigkeit über der fürchterlichen Bitternis jenes Bekenntnisses Karl Augusts: der Neigung für die Verstorbene. Luisens reine Natur konnte darüber nicht hinauskommen; sie nahm die übermütige Knabenlaune ihres Gatten für ebenso heiligen Ernst, wie solcher ihr ganzes Empfinden beseelte, und zog sich, tiefverletzt, immer mehr von ihm und in sich selbst zurück.
Die Herzogin Amalie war recht erleichtert, daß Luise mit ihrem Hofpersonal, Görtz besonders, ihr harmlos lustiges Fest nicht stören werde.
Es hatte zwei Uhr geschlagen, um drei erwartete man die Gäste aus Weimar. Alles war vorbereitet, und die Herzogin ging in ihr Schlafzimmer, um Toilette zu machen. Die Göchhausen stieg mit ihr die Treppe hinan, da ihr kleines Gemach nicht weit von dem der Gebieterin lag.
»Komm mit zu mir herein, Thusnelda,« sagte Amalie, »du wirst immer noch fertig.«
Das Hoffräulein trat mit in das Zimmer der Herrin. Demoiselle Kotzebue, die hübsche Kammerfrau der Herzogin, hielt deren ländlichen Putz bereit. Während sie ihr den Puder aus dem Haar bürstete, dasselbe mit roten Bändern in zwei starke Zöpfe flocht und sie stattlich als Wirtin und Pachtersfrau herausstaffierte, plauderte die Herzogin mit der Vertrauten.
»Deine Schulzin schläft diese Nacht natürlich im Wirtschaftshause,« sagte sie. »So leid mir's tut, Kotzebue, Sie müssen auch dahin; wir brauchen hier jedes Winkelchen für die Gesellschaft. Ihre Kammer wird Damengarderobe. Für den Herzog, für Goethe, Wieland, Einsiedel und Steins sind unten die Zimmer fertig, sie bleiben ein paar Tage hier.«
Thusnelda Göchhausen schlüpfte in ihr Gemach, wo die Schulzin sie eilig in ein drolliges kleines Bauernmädchen umwandelte.
Der Herzog, Konstantin, Goethe, Wieland und Einsiedel hatten sich, in ihrem ländlichen Putz einander belachend und neckend, schon auf dem Rasenplatz vor dem Hause eingefunden.
»Solch eine Maskerade bei hellem Tage, im Sonnenschein, zwischen den grünen Bäumen und anderen Wirklichkeiten, ist ein Götterspaß!« rief der Herzog mit jugendlicher Heiterkeit. »Nie sah ich einen würdigeren Erbonkel, als hier unseren liebwertesten Gevatter Wieland. Ein gediegeneres Prachtstück von einem Dorfältesten kann man sich nicht denken!« fügte er, den Hofrat halb umarmend, hinzu. »Und unser süßer Konstantin sieht aus, als wolle er, von seiner Lina angelächelt, ein weißes Lämmlein am Seidenband auf die elysische Weide von Kamillenblumen und Rosenblättern führen!«
Der schlanke Prinz schnitt ein Gesicht und wandte sich ab, ihm war es durchaus Ernst mit seiner sentimentalen Gemütslage. Er empfand tiefer als der burschikose ältere Bruder und trachtete voll heiliger Scheu danach, die lebhaften Regungen seines jungen Herzens zu verhüllen.
Mittlerweile fuhren die ersten Wagen der Stadtgäste in der Allee herauf; und zugleich trat Anna Amalie, mit der Göchhausen, Herrn und Frau von Stein und Knebel, alle im ländlichen Putz, vor die Tür. Die beiden Steins sollten Hofknecht und Magd vorstellen, die Göchhausen war Kleinmädchen, wie sie selbst sagte: Kükenlise – Knebel aber galt für den Hausherrn und spielte eine recht würdige Figur mit seinem breitschößigen Rock und den roten Tragbändern auf weißem Hemde.
Die Gäste, welche mit ihren Rollen und dem Festprogramm vertraut waren, fuhren unter Winken und freudigen Zurufen am Schloß vorbei auf den Pachthof, wo jeder Wagen mit Musik empfangen wurde. Einzelne Gefährte, die Gäste brachten, welche am Erntezuge nicht beteiligt waren, kamen nun auch direkt vorgefahren.
Wieland hatte sich mit zu den Hausgenossen gesellt, während der Herzog, Konstantin, Goethe und Einsiedel, durch ein Mauerpförtchen nach dem Wirtschaftshofe schlüpfend, dort die Ankömmlinge begrüßten und ihren Festzug ordneten.
Es währte nicht lange, so war alles bereit. Blasend schritten einige Dorfmusikanten voran, denen der ganze Aufzug folgte. Zuerst kam der mit vier Pferden bespannte Erntewagen, auf dem Auguste von Kalb und Henriette von Wöllwarth mit dem Erntekranz saßen; bunte Blätter flatterten und Blumengewinde hingen von oben herunter. Auf dem vordersten Sattelpferde ritt der Herzog als erster, auf dem anderen Goethe als zweiter Fuhrknecht. Mit Rechen, Sicheln, Garben, grünumwundenen Schäferstäben, Netzen, Körben und anderen Geräten folgte nun eine erlesene Schar jugendlicher Teilnehmer; alle in ländlich buntem Anzuge, phantastisch herausgeputzt.
Man nahm Aufstellung; während die Musik ein lustiges Stückchen blies, stiegen die Reiter ab, halfen den beiden Mädchen vom Wagen und trugen den Erntekranz zu dem Herrn und der Herrin. Es folgte ein Anreden- und Antwortenspiel, welches, von Hildebrand von Einsiedel verfaßt, munter von den Beteiligten vorgetragen, Sinn und Zweck der Auffahrt dartat und die Gesellschaft angenehm unterhielt. Den Schluß machte die Aufforderung der Herrin: zum Dank für die Erntemühen Bewirtung und Tänzchen anzunehmen.
Der Herzog als Großknecht antwortete für die übrigen: die Einladung freue sie herzlich. Das Spiel war zu Ende, eine angenehme Wirklichkeit folgte.
Weißgedeckte Tische standen im Fluge unter den Kastanien und füllten sich mit Tassen, Kuchenkörben und Kaffeekannen; die dörfliche Musik verstärkte sich zur herzoglichen Kapelle, nahm in einem Seitengebüsch Aufstellung, und die Gaste begrüßten sich lachend und scherzend in zwanglosem Verkehr. Man fand Platz, wie man ging und stand, die bäuerlich gekleideten Damen schenkten selbst den Kaffee ein, und alle ließen sich's wohl sein.
So scheinbar unwillkürlich und absichtslos sich die Gäste auch zusammengefunden hatten, so waren sie doch sämtlich Leute aus der großen Welt, untereinander durch verstohlene Beziehungen verknüpft oder getrennt durch Antipathien, die größtenteils von anderen geahnt und berücksichtigt wurden, und so jeden zu jeder führten, wie der Zug des Herzens es forderte.
Hier saß der schöne Wedel, als stämmiger Jägersmann, neben Henriette von Wöllwarth, der er seit einiger Zeit huldigte, und die ihm heute in ihrem grünen Rock, ihrem knappen Mieder, mit dem klugen, frischen Gesichte unter der grünbebänderten Haube, besonders gut gefiel. Sie benahm sich auch nicht so kühl, wie er sie sonst gefunden hatte, und er begann, sich ihr gegenüber mit ernsthaften Plänen zu tragen.
Ein neues Brautpaar in seiner Nähe erhöhte seine Lust zu einem gleichen Vorgehen. Es war dies Karoline Iltens ältere Schwester, die sich kürzlich mit dem Leutnant von Lichtenberg verlobt hatte; dieser, sonst ein rauher Mann und ganz Husar, tat heute als Schäfer recht zart und lieb mit seiner Schäferin.
Prinz Konstantin war bei der Rollenverteilung zur Führung der Schäferpaare bestimmt; da aber die Herzogin seine ernsthafte Neigung für Karoline nicht billigte, hatte sie ihm eine andere Dame gegeben und das betrübte Linchen, als Fischerin mit Herrn von Seckendorf verbunden. Konstantin ließ nun den Kopf hängen, gestattete seinen Augen einen Verkehr, der ihm persönlich abgeschnitten war, und konnte seinen Mißmut kaum verbergen, so sehr auch Fräulein von Klinkowström, die er führte, sich um seine Aufmerksamkeit bemühte.
Der Herzog flatterte unstet umher; er war durchaus nicht schwermütig, solche Stimmung lag seinem heiteren, derben Wesen fern, ihm fehlte aber der rechte Anreiz zum Fröhlichsein.
Wenn er an Luise dachte, geschah es mit dem Gefühl der Erleichterung, daß sie nicht da sei; Milli war auch halb vergessen, aber er neckte hie und da unbewußt schärfer als sonst, er blieb nicht lange auf demselben Platz, ihn verlangte danach, sich auszutoben, tolllustig zu sein, die Stunde zu nutzen und zu genießen.
Dort saß die jungvermählte Schwägerin der Frau von Stein, Sophie von Schardt, geborene Gräfin Bernstorf aus Holstein; ein zartes liebliches Weib, der die süße Kinderseele aus den großen, fragenden Augen blickte.
Hier versuchte Frau von Stein, Goethe zu dem braunen Trank zu überreden, der ihm zuwider war. Sie ließ sich dann – während er ihr die Kaffeekanne abnahm und sie der blonden Karoline von Ilten darreichte – an seiner Seite festhalten.
»Ihr Getränk mag ich nicht,« sagte er und fügte mit innigem Blick hinzu, »überlassen Sie die Hebepflichten den Misels, die sich was drauf wissen, zwischen den Gästen herumzuhüpfen, und gönnen Sie mir ein Viertelstündchen Wohlsein in Ihrer Nähe. Schier habe ich einen Pik auf mich, daß ich Ihnen so gut bin, da Sie mir immer aus dem Wege gehen, wie soll ich's aber ändern?«
»So lassen Sie's beim alten,« sagte sie herzlich. »Ich weiche Ihnen nicht mehr aus, als ich muß; Sie wissen, daß man sich in der guten Gesellschaft nicht absondern und ausschließen darf; sind wir miteinander allein, können wir uns in unsere Plauderei versenken.«
»Dich sehen, liebste Frau, ist für mich alles!« flüsterte er, sich zu ihr neigend. »Du bist die einzige unter den Weibern, die mir eine Liebe ins Herz gibt, welche mich glücklich macht.«
»Die Herzogin winkt!« rief sie sich erhebend und eilte, von Amalien einen Auftrag entgegenzunehmen und auszurichten, dann aber, auf den Wunsch der hohen Frau sich neben sie zu setzen.
Der Herzog ließ sich jetzt neben Goethe nieder.
»Da sie dir doch abspenstig gemacht ist, deren Farben du innerlich trägst,« sagte er neckisch, »kannst du jeden hier dulden. Wenn ich nur wüßte, bei welchen schönen Augen ich mich herumlügen und trügen soll! Gustchen ist heute nicht übel – ein bräunlich' Bauernmädel, wie's sein muß – die macht einem das Liebeln bequem; vielleicht komme ich nachher bei der Hüpferei besser vorwärts.«
Der Kaffee war getrunken, die Musik spielte einen Ländler. – Der Herzog sprang auf, wählte Auguste von Kalb und war der Erste und Unermüdlichste auf dem grünen Plan. Auch Goethe warf sich der Lust des Tanzes mit frohem Jugendmut in die Arme.
Als sich die Freunde in einer Pause wieder trafen, rief Karl August: »Mein nußbraun' Mädel hat mich angewärmt, sie spielt die Gurli pompös, und da es heut Maskerade ist, hab' ich so natürlich ein Durcheinandrium von Unsinn und Zärtlichkeit geschwatzt, daß ich beinah mir selber glauben könnte!«
»Ja!« erwiderte Goethe mit freudigem Auflachen, »man muß den Lebensrausch im geselligen Strudel vor sich her peitschen und die sinkende Lust immer wieder aufjagen!«
Und vorwärts ging es, diesem Grundsätze getreu, sowie die Musik aufs neue intonierte.
»Eben habe ich mit Thusnelda gewalzt,« sagte der Herzog, sich die erhitzte Stirn trocknend, worauf er Goethes Arm nahm und einen schattigen Boskettweg mit ihm verfolgte.
»Der Hafer sticht das kecke Ding; sie ist noch eitel Übermut ihres glücklichen Entrinnens halber, damals im Winter. Es läßt mir keine Ruhe, ich muß ihr einen Streich spielen. Diesmal soll sie mir nicht entkommen, denn alle Chancen sind für mich. Hör, sie soll für diese Nacht ihr Quartier einbüßen; es ist niemand im Hause, der ihr aushelfen kann, und ich sehe sie schon demütig kümmerlich in einem Winkel hocken. Morgen früh wollen wir dann die übernächtige Bäuerin abfassen, sie ins Grüne schleppen und mit ihr einen Rundtanz auf dem tauigen Rasen halten!« Er brach in ein übermütiges Gelächter aus.
Als Karl August sich anschickte, zur Gesellschaft zurückzukehren, sah er seinen Bruder, in zärtlichem Gespräch mit dem geliebten Linchen, den Laubengang heraufkommen; sowie das vertiefte Paar seiner ansichtig wurde, erröteten beide lebhaft. Karolinchen zog den Arm aus dem ihres Kavaliers und schlüpfte in den nächsten abzweigenden Weg, Konstantin aber blieb stehen und erwartete den Herzog.
»Na, mein Junge,« sagte dieser herankommend, »werden da wieder verbotene Früchte genascht?«
»Du hast gut reden, Karl,« entgegnete der Prinz bitter, »dir ist so früh das süße Eheglück gewährt, daß du ein sehnendes Herz gar nicht zu begreifen weißt, und eines Unglücklichen nicht noch obendrein spotten solltest.«
Der Herzog war nicht aufgelegt, sentimentale Regungen zartsinnig zu behandeln. Kurz auflachend sagte er: »Tröste dich, Kleiner, das Glück, eine Gemahlin zu besitzen, ist nicht groß.«
»Da würde ich gewiß anderer Ansicht sein,« entgegnete Konstantin innig.
»Vielleicht hat Luise noch eine wohlerzogene, vermögliche Prinzeß Cousine, mit der man dich versorgen könnte.«
»Ich danke!« rief der andere kurz und folgte seiner holden Freundin.
Wieder waren einige Tänze getanzt, als die Pause eintrat, welche dem Abendessen voranging, das gleichfalls an den Tischen unter den Kastanien eingenommen werden sollte. Der Herzog hatte – vielleicht in einem Anfall neckischer Laune gegen den Freund – sich zu Frau von Stein gesellt und diese zwischen sich und Knebel eingefangen, worauf Goethe der Aufforderung Hildebrands von Einsiedel willfahrte, mit ihm durch die Anlagen zu gehen. Sie waren achtlos des Weges auf einen Hügel im Park gelangt, von dem aus sie einen schönen Rundblick hatten und auch die Dorfstraße hinaufsehen konnten, an der Gehöfte zerstreut im Grünen unter Bäumen und Büschen lagen. Abendlicher Friede und scheidendes Sonnengold verschönten das einfache Bild. Hinter ihnen tönte das Summen und Lachen der fröhlichen Menge, Gläserklirren und das Stimmen der Instrumente, die gleich darauf einen Marsch anhoben, der zur Tafel laden sollte.
Auf der Dorfstraße kam ein bestaubter Reisewagen durch ausgefahrene Geleise dahergeschwankt; ein Frauenkopf neigte sich heraus; zwar war die Entfernung noch zu groß, um Gesichtszüge zu unterscheiden, er schien aber jung und anmutig.
»Komm, Hildebrand, die schöne Reisende müssen wir begrüßen!« rief Goethe; derbe Lebenslust kam über ihn, mit einem Satz sprang er von oben über die Hecke auf den Pachthof, riß von dem festlich geputzten Erntewagen, was er an Blumengirlanden fassen konnte, und rannte über den Hof zum Tor hinaus auf die Landstraße. Einsiedel tat ihm alles nach.
Da standen nun die idyllisch geschmückten schönen Jünglinge, die Arme voll Blumen, mit lang nachschleppenden Gewinden, und warteten tiefatmend, bis der Wagen herankam.
»Laß sie uns ansingen,« flüsterte Goethe dem Gefährten zu und stimmte sein Lied vom Heideröslein an, Einsiedel sang mit:
»Sah ein Knab' ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn.
Sah's mit vielen Freuden,
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden!«
Indem sie lautjauchzend die letzten Reihen wiederholten, stürmten sie den müden Pferden entgegen, die verdutzt stehen blieben, die jungen Männer warfen ihre Blumengewinde in und über den Wagen und schauten hinein.
Zwei halberschrockene, lächelnde Mädchengesichter tauchten hinter dem Ledervorhang auf. Es war Korona mit ihrer Freundin, der blonden Gärtnerstochter, die aus Leipzig kamen und nach Weimar übersiedelten.
Goethens Wiedersehensfreude in diesem Augenblicke begeisterter Stimmung war hinreißend feurig; er küßte wiederholt der schönen Sängerin die Hand und bat sie auszusteigen und an dem Feste teilzunehmen; daß sie willkommen sei, wolle er verbürgen.
Er hatte aber nicht mit der weiblichen Eitelkeit gerechnet, die in diesem Falle das Schicklichere traf. Korona erklärte, daß es unmöglich sei, in ihren bestäubten Reisekleidern vor dem festlich geputzten Hofkreise zu erscheinen.
»Nun, dann geleiten wir Sie ein Stück Weges!« rief Goethe entschlossen. Er hatte des Gefährten nicht geachtet; ein fragender Blick Koronas zur Seite belehrte ihn über sein Versäumnis. Sogleich bat er, die Unachtsamkeit zu verzeihen, und stellte den Hofrat und Kammerherrn von Einsiedel vor.
Beide sahen sich sekundenlang groß an; es spiegelte sich der Eindruck, den sie einander machten, in ihren leuchtenden Blicken.
»Sie sind uns ein hochwillkommener Gewinn, schöne Künstlerin!« rief der junge Hofmann begeistert. »Möchte Ihr Sein in unserem Kreise diesem festlich sonnigen Tage gleichen, an dem uns das Glück zu teil wird, Sie zu empfangen!«
»Sie fallen aus der Rolle, mein dörflicher Galan!« erwiderte Korona lächelnd, »oder sind in diesem glücklichen Landstrich alle, bis auf Fischer und Bauern herab, poetisch gebildete Leute?«
Bevor man ihr antwortet: konnte, trat grüßend ein Lakai heran und meldete, er sei von Ihrer Durchlaucht der Frau Herzogin ausgesandt, die beiden Herren zu suchen, man erwarte sie an der Abendtafel.
Nur ungern trennten sich die jungen Männer von der schönen Reisenden. Mit einem allseitigen »auf baldiges Wiedersehen in Weimar!« schied man voneinander.
»Korona ist da!« rief Goethe dem Herzoge zu, ein Wort, das mit verheißungsvollem Klang an den Tafeln widertönte. Hildebrand von Einsiedel aber setzte sich still an seinen Platz, er war sehr zerstreut, und seine Nachbarinnen vermochten ihn nicht zu fesseln.
Der Abend brach endlich herein; Windlichter und bunte Lämpchen im Park halfen der Mondsichel ein magisches Halblicht verbreiten. Man erhob sich, noch ein Tänzchen ward versucht, dann aber drängten die älteren Personen zum Aufbruch; die Wagen fuhren vor, mancher Händedruck, hie und da ein verstohlener Kuß im Boskettschatten und das schöne fröhliche Fest war zu Ende.
Jetzt standen die Hausgenossen und die Gäste, welche hier Quartier bekommen hatten, den fortrollenden Wagen nachsehend, vor der Haustür.
»Komm, Thusnelda, ich bin todmüde,« sagte die Herzogin zu ihrer Getreuen, »wir wollen uns zur Ruhe begeben.«
Das Hoffräulein schickte sich an, mit einigen ihrer drolligen Knickse und: »Gute Nacht! – Gute Nacht!« rufend, der Gebieterin zu folgen.
»Seien Sie nicht grausam, Tuselchen,« sagte der Herzog bittend, »uns schon jetzt zu verlassen, gehen Sie noch einmal mit durch den Park, ich kann noch nicht ins heiße Bett; lassen Sie uns noch plaudern, kritisieren, dumme Schnacke machen. Wer versteht das besser als Sie? Um unsere Tugend nicht in Gefahr zu bringen, soll Freund Wolf uns begleiten. Gelt, wir geben ein lustiges Kleeblatt?«
»Bist du nicht allzu müde, so tue ihm den Willen,« sagte die Herzogin gütig. »Aber höre, poltere nicht in deiner Kammer, wenn du hereinkommst, ich muß Ruhe haben.«
Die Göchhausen war bereit, des Herzogs Wunsch zu erfüllen; sie verabschiedete sich von ihrer Gebieterin; die anderen Hausgäste zogen sich in ihre Zimmer zurück, und das kleine Hoffräulein wanderte lachend am Arm des jungen Fürsten, Goethe auf ihrer anderen Seite, in den Park hinaus.
Man verlöschte eben eine der bunten Lampen nach der anderen, die Dienerschaft räumte die Tische fort und verschwand auf dem Wirtschaftshofe. Die lustigen drei tauschten in unerschöpflicher Laune kernigen Blödsinn gegeneinander aus, untermischt mit treffenden Witzen, und das Wortgefecht, das Necken und Scherzen wollte kein Ende nehmen. Endlich standen sie wieder vor der offenen Haustür und traten ein; die letzten, welche noch wach waren.
Zwei Wachskerzen brannten auf einem Seitentisch. Der Herzog überreichte mit einem zierlichen Kompliment seiner Dame die eine und Goethen die andere. Dann sagte er mit ironischer Betonung: »Wir wünschen dem süßen Fräulein, das wir morgen noch als ›Kükenlise‹ sehen werden, eine entzückende Nacht!«
»Die Kükenlise verschwindet mit Hans und Peter, den Großknechten, denen ich gleichfalls gute Ruhe wünsche!« entgegnete das junge Mädchen, die Treppe hinaufsteigend.
»Sie verschwindet nicht!« lachte der Herzog, »und macht morgen früh, in selbiger Gestalt, mit uns ein Tänzchen auf dem Rasen!« Er reckte sich dabei, blies das Licht der Göchhausen aus und folgte rasch dem vorangegangenen Freunde.
»Ich werde auch so meine Kammer finden!« rief sie ihm nach. Ein schallendes Gelächter und das Geräusch des Zuschließens der Tür antwortete.
Auf die Treppe fiel ein schwacher Mondstrahl; die Göchhausen stieg guten Mutes hinauf und bog leise – um die Herrin nicht zu stören – in den jetzt ganz finstern Gang, an dem ihr Zimmer lag.
Sie fuhr mit den Händen an der Wand hin, um tastend ihre Tür zu finden – aber da, wo ihre Tür ganz gewiß sein mußte, wo sie immer gewesen war – alles glatt, kein Holz, kein Schloß, kahle ebene Wand!
Es überlief sie kalt, wie bei einem Spuk. Wo war ihre Kammertür geblieben? Sie tastete noch einmal – vergebens! Sie kehrte zur Treppe zurück, um sich in dem matten Lichtschimmer zu erholen, sich zu besinnen, gewann die Überzeugung, daß sie verkehrt gegangen sei, sich geirrt haben müsse, und ging nochmals zurück, um aufs neue zu suchen und ebenso vergeblich umherzutasten.
Jetzt ward ihr klar, daß ihr so oder so ein Streich gespielt worden, daß die Artigkeit der jungen Männer eine List gewesen sei. Daß man sie in eine Falle gelockt habe. Sie entschloß sich also, in einem Lehnstuhl, oder auf einem Sofa der Gesellschaftszimmer zu übernachten, suchte die Türen, fand sie aber sämtlich abgeschlossen.
Was blieb ihr übrig? Es war niemand im Hause, den sie wecken oder belästigen mochte; fröstelnd und müde setzte sie sich auf die oberste Treppenstufe. Pläne, sich an den beiden Schelmen zu rächen, besonders dem Herzog über kurz oder lang einen Possen zu spielen, stiegen in ihr auf, dazwischen nickte sie öfter ein, raffte sich wieder zusammen, um nicht hinunterzufallen, und erwartete mit Sehnsucht den ersten Tagesschimmer.
Als sie in dem Gang, der nach ihrer Kammer führte, etwas erkennen konnte, machte sie sich auf, den geheimnisvollen Grund ihres Ausgeschlossenseins zu erkunden.
Siehe da – ihre Tür war zugemauert!
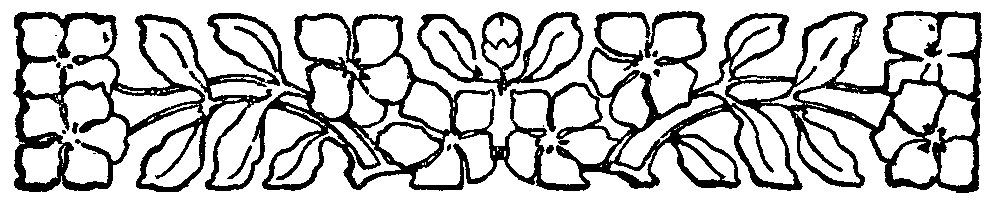
|
Weg mit den zitternden.
|
Kommt ihr entronnenen
|
Nach dem Schloßbrande 1774 hatte man, um dem Kunstbedürfnis des Hofes, besonders der Herzogin Anna Amalie zu genügen, zuerst im Fürstenhause auf einer kleinen Bühne französische Stücke gegeben. Als dann Goethe die Leitung der gesellschaftlichen Freuden in die Hand nahm, wurde in dem Saale eines Hauses an der Esplanade eine größere Bühne aufgeschlagen und schon im vorigen Winter zu verschiedenen Aufführungen deutscher Stücke benutzt. Es spielte da vor einer gewählten Gesellschaft wer irgend Talent besaß, gewöhnlich aber gaben die Kammersängerinnen sowohl im Singspiel, wie auch im Drama die Hauptrollen.
Mit dem Eintreffen Korona Schröters erhielt die Theaterlust neue Nahrung. Die Künstlerin richtete sich mit ihrer treuen Wilhelmine häuslich ein und trat bald unter großem Beifall in Konzerten und Hofgesellschaften auf.
In derselben Weise, wie im vorigen Jahre, folgten auch in diesem Winter die geselligen Freuden, gleich einem Fries bunter Märchengestalten, einander auf dem Fuße. Alle die künstlerisch wirksamen Menschen ersannen täglich Neues und fanden von allen Seiten Beifall und Verständnis für jeden geistreichen und poetischen Gedanken.
Wie die einsame Trauerweide in einem Garten voll blühender Blumen, voll fruchttragender Bäume, stand die Herzogin Luise zwischen der lebensfrohen Menge. Entschiedener noch als im ersten Winter ihrer Ehe mied sie die Freuden der Geselligkeit. Immer noch unter dem Vorwande der Trauer um den Tod der Schwester, immer noch im schwarzen Kleide, war sie nicht zu bewegen, in größere Kreise zu gehen, und schien selbst kleine Gesellschaften widerwillig zu besuchen.
Dem Herzoge ward dieses Wesen indes so unverständlich und unbequem, daß er bereitwillig den unausgesprochenen Wunsch der Gattin erfüllte und sich, wo es anging, von ihr fern hielt. Er wußte, daß die stillschweigende Trennung zwischen ihnen seit Emiliens Tode und der sich daran knüpfenden peinlichen Unterredung datiere; aber er, dem gänzlich entfallen war, was er eigentlich Verletzendes gesagt hatte, begriff nicht, wie Luise so lange zürnen konnte.
Mittlerweile suchte er sich auf andere Weise schadlos zu halten und machte verschiedenen Damen der Gesellschaft den Hof. Keine aber vermochte ihn dauernd zu fesseln. Auguste Kalb war ihm zu entgegenkommend, die Göchhausen zu wenig schön, Adelaide Waldner zu kindisch, Karoline Ilten zu verliebt in seinen Bruder, die liebliche Sophie von Schardt, der Stein junge Schwägerin, zu harmlos und tugendhaft. Endlich interessierte ihn die ehrliche, frische Henriette von Wöllwarth, doch sah er, daß er seinem treuen Kumpan Wedel damit arg ins Gehege komme, und so mußte er auch hier zurücktreten.
Goethe hatte sich entschlossen, auch den Winter über in seinem Gartenhause am Stern auszuharren. Er meinte: das alte Haus lasse sich reparieren und das Gärtchen an der Ilm sei ihm gar zu lieb. Dann verdichtete er mit Moos und Werg Fenster und Türen und richtete sich mit seinem Philipp in dem engen Neste wohnlich ein. Man betrat das Haus durch eine vom Garten hereinführende Tür; unten hauste der praktische Famulus; eine schmale Treppe führte in den oberen Stock, hier schlossen sich zwei Stuben mit einem Altan und zwei kleine Seitenkabinette dem engen Flure an.
In dem größeren Zimmer mit schlichtester Einrichtung saßen Mitte Dezember der Herzog und Goethe in traulichem Gespräch beim knisternden Holzfeuer des großen Kachelofens.
Karl August klagte endlich dem Freunde die fortdauernde Trennung von seiner Frau, über die er bislang geschwiegen, weil er Goethe auf seiten der Herzogin gesehen und sich dadurch verletzt gefühlt hatte.
»Solche Maulerei und törichte Pikiertheit, die kein Ende finden kann, ist mir unausstehlich,« sagte er jetzt rückhaltlos. »Du weißt, wir hatten im Sommer etwas wie einen Zank, ich mag wohl zu derb geworden sein, mag ein paar unbedachte Worte hingeworfen haben! Ich schwöre dir aber, daß ich von der ganzen Geschichte nichts Genaues mehr weiß; und sie spinnt sich daraus einen Trauermantel, den sie samt ihrer Duldermiene gar nicht wieder los wird. Diese Sentimentalität ist mir zu arg!«
Goethe verteidigte die Herzogin mit warmen Worten.
»Wußt ich's doch im voraus, daß du ihr Advokat sein würdest!« rief Karl August unzufrieden. »Deshalb habe ich dir auch nichts wieder von unserem Zwiste gesagt; nun aber kommt im Januar ihr Geburtstag heran; der Besuch des Cousins Ferdinand von Braunschweig ist in Sicht, da muß Luise doch ihre Trauerflöre abtun, repräsentieren und aufhören, mir ein grämliches Gesicht zu schneiden, sonst heißt es in der Verwandtschaft, wir leben wie Katze und Hund zusammen.«
»Besinne dich, womit du sie beleidigt hast, bei Millis Tode fand eure Entzweiung statt? Wenn ich Arzt sein soll, muß ich genau den Sitz des Übels kennen.«
Der Herzog beichtete; er suchte jene Unterredung, so gut er sich derselben noch entsann, wieder zusammenzustellen.
»So glaubt sie also, deine Liebe verloren zu haben?« rief Goethe bewegt, »so trauert sie um ihr verlorenes Eheglück? Und du bist nicht davon ergriffen, bist nicht in tiefster Seele gerührt? O, immer ist es doch die Individualität eines jeden, die ihn hindert, der Individualität des anderen in ihrem ganzen Umfange gewahr zu werden!«
»Rührung hin, Rührung her!« knurrte der Herzog unwirsch. »Setze sie mir zurecht, weine meinetwegen mit ihr, aber mach sie wieder entgegenkommend und vernünftig.«
»Sie verhält sich stolz und ablehnend gegen mich, sie hält mich für feindlich gegen sie gesinnt, und ich verehre sie doch so innig. Aber laß mich überlegen, ich will versuchen, ein Festspiel zu erdenken, das auf sie gemünzt, ihr vielleicht zu Herzen geht.«
Einige Wochen später ward die lustige Welt von Weimar durch die Nachricht lebhaft in Bewegung gesetzt: Goethe habe zum Geburtstage der Herzogin Luise ein neues Drama gedichtet, Seckendorf die darin vorkommenden Lieder in Musik gesetzt, Aulhorn werde Ballette arrangieren, und nun solle es an ein Verteilen der Rollen, an unterhaltende Proben und alle jene Vorbereitungen gehen, die oft ergötzlicher sind als der Festabend selbst. Die Jugend zeigte sich, wie immer, voller Bereitwilligkeit, und das Unternehmen ward mit allen Kräften in Angriff genommen. So kam der festliche Tag, der 30. Januar, heran.
Der Herzog hatte seiner Gemahlin durch die Oberhofmeisterin Gräfin Gianini sagen lassen: er hoffe sie an ihrem Geburtstage in farbiger Gesellschaftstoilette zu sehen.
Am Morgen des Tages ließ er bei ihr anfragen, wann sie ihn empfangen wolle.
Sie ließ erwidern, daß sie immer für ihn bereit sei.
Er ging also mit einem Schmuckkästchen, das ein Halsband von Türkisen enthielt, etwas unbehaglich gestimmt – denn seit jenem unliebsamen Tete a Tete hatte er nie versucht, sie allein zu sehen – zu ihr in den grünen Salon.
Luise war heute weiß gekleidet, sie sah aber ebenso bleich und niedergeschlagen aus wie immer, und sowohl ihre beiden Hofdamen, wie auch die Oberhofmeisterin befanden sich zugegen. Damit war jede Möglichkeit einer intimeren Erörterung abgeschnitten.
So sehr nun Karl August auch Versöhnung wünschte, atmete er doch erleichtert auf, als es jetzt noch nicht zu der halb gefürchteten Aussprache zwischen ihnen kommen konnte. Diese Frau hatte ein Etwas in ihrem Wesen, das ihn beklemmte, und stets fühlte er sich ihr gegenüber in einer fremden Atmosphäre. Er übergab mit einem Glückwunsch sein Geschenk, küßte seine Gemahlin auf die Wange, nahm zu einer kurzen, gleichgültigen Besuchsunterhaltung mit den Damen Platz und war froh, als die Geburtstagscour der Gratulanten das Zimmer derart anfüllte, daß von einer persönlichen Berührung nicht mehr die Rede sein konnte.
Nach einem Hofdiner in den üblichen Formen sollte zum Abend die Aufführung des lange vorbereiteten Festspiels folgen.
Der Saal, in welchem an der einen kürzeren Seite die Bühne aufgeschlagen worden, prangte heute in besonderem Schmuck. Tannengewinde und Treibhauspflanzen, reichlichere Beleuchtung als sonst, Fahnen, Inschriften und Festons bildeten ein heiter einladendes Ganze.
Die Mitglieder des Hofes, welche nicht als Darsteller im Stück beschäftigt waren, umgaben die in weiße Seide gekleidete junge Herzogin, an deren Halse der ihr vom Herzoge verehrte Schmuck glänzte, und eine befohlene große Gesellschaft füllte alle übrigen Zuschauerplätze.
Eine Festouvertüre unter Leitung des Kapellmeisters Wolf, von den sechsunddreißig Mitgliedern der Kapelle vortrefflich ausgeführt, eröffnete das Spiel.
Dann trat Karoline von Ilten, anmutig als Amor gekleidet, hinter dem Vorhang heraus, ging auf die Herzogin zu, überreichte ihr einen Theaterzettel – während die Gesellschaft durch Lakaien mit Zetteln versorgt wurde – und trug, zaghaft stockend, neben gereimten Glückwünschen die Bitte vor: das folgende Spiel, von Amor selbst ersonnen, sich wohl gefallen und zu Herzen gehen zu lassen.
Der Komödienzettel lautete:
Festspiel zu Ehren des Geburtstags Ihrer Durchlaucht der Herzogin Luise von Sachsen-Weimar-Eisenach, am 30. Januar 1777.
Lila, ein Drama mit Gesang und Tanz.
Personen:
Baron Sternthal – Seine Durchlaucht Herzog Karl August.
Lila, seine Gemahlin – Demoiselle Korona Schröter.
Marianne, seine Schwester – Fräulein Henriette von Wöllwarth. Fräulein Auguste von Kalb.
Schwestern der Lila – Fräulein Adelaide von Waldner.
Graf Altenstein – Oberstallmeister von Stein
Graf Friedrich, sein Sohn – Oberforstmeister von Wedel.
Doktor Verazio – Legationsrat Goethe.
Der Oger, der Dämon, Feen, Spinnerinnen, Gefangene.
Das Stück handelte von einem durch Mißverständnisse getrennten Ehepaare und ging mit phantastischen Erscheinungen, Tänzen und Chören ergötzlich vorüber. Lila, die aus Irrtum und Wahn den Verstand verloren hat und stets Trauerkleider trägt, wird durch Doktor Verazio-Goethe hergestellt und mit ihrem Gemahl wieder vereinigt. Zuletzt singt sie:
»Ich habe dich, Geliebter wieder,
Umarme dich, o bester Mann!
Es beben alle mir die Glieder
Vom Glück, das ich nicht fassen kann!«
Lebhafter Beifall folgte. Die Idee, der trübsinnigen jungen Herzogin ein Spiegelbild vorzuhalten, wurde auch verstanden, doch hütete man sich, laut davon zu sprechen.
Welchen Eindruck die Herzogin selbst empfangen haben mochte, war schwer zu beurteilen. Sie behielt stets in voller Selbstbeherrschung die Haltung ruhiger Würde. Wie üblich, erhob sie sich nach dem Spiel und sprach mit den vornehmsten Personen ihres Kreises. Auf ein warmes Lob des Stücks und der hübschen Vorstellung von seiten ihrer lebhaften Schwiegermutter antwortete sie mit edler Ruhe, daß es eine geschickt arrangierte Darstellung gewesen sei, die recht unterhaltend gewirkt habe. Dann fragte sie ablenkend, als eine Schar Lakaien die Stuhlreihen forträumte und die Kapelle sich anschickte, auf der Bühne Platz zu nehmen: ob man noch zu tanzen beabsichtige. Die Herzogin Anna Amalie verneinte und sagte, soviel sie wisse, solle nur ein Souper an kleinen Tischen folgen.
Eine der andächtigsten Zuschauerinnen war Christel von Laßberg an der Seite ihrer Tante Barbara gewesen. Ihre großen blauen Augen weiteten sich immer mehr, und immer lebhafter zuckte die innere Erregung in ihren zarten Gesichtszügen, je phantastischer sich die Handlung entwickelte. Es schien ihr, als lebe sie selbst zwischen diesen Spukgestalten, diesen Feen, Spinnerinnen und Gefangenen, die sämtlich dem Winke des Magus, Goethe, gehorchten.
Nach einer langen und schweren Krankheit im Frühjahre hatte Christel ihr Traumleben in aller Stille fortgeführt. Da ihr Ungeschick, sich in der großen Welt zu bewegen, noch dasselbe war, mußte sie sich auch in diesem Jahre von aller Geselligkeit fernhalten und durfte nur heute ausnahmsweise der Einladung zur Geburtstagsfeier der Herzogin folgen. Welch eine Fülle von Bildern und Eindrücken empfing sie wieder im tiefsten Heiligtum ihrer Seele! Wie köstlich schien es ihr, unbeachtet den Herrlichen in seiner Sicherheit und Schönheit als Meister des Spiels wirken und walten zu sehen. Sie vergaß ihre Sorge wegen seiner Liebe zu Frau von Stein, die so fern von ihm unter der Menge saß, und gab sich ganz der wonnigen Schaulust hin.
Zwischen den Kulissen stehend, erwartete Wedel seine Partnerin Marianne – Henriette von Wöllwarth – die jetzt zu ihm trat. Wie hübsch und stattlich sie in der rosenfarbenen Tracht der Feenkönigin aussah! Er bot ihr, sie zärtlich ansehend, den Arm, um sie die Stufen des Podiums hinunter in den Saal zu führen.
»Nun ist das hübsche Spiel und ›Liebendürfen‹ wieder vorbei, teure Marianne!« sagte er mit theatralisch wehmütigem Pathos. »Ich fürchte, es wird mir nicht gelingen, diese Maske abzulegen, diese vortreffliche Angewohnheit wieder los zu werden. Wie wäre es, wenn Sie's auch versuchten, den Schein zur Wirklichkeit zu erheben?«
Unter solchen halb scherzhaft gesprochenen, halb ernsthaft gemeinten Worten führte er Henriette unter die herzudrängende, beglückwünschende Menge.
Die Tische zum Souper waren im Saale aufgestellt; Luisens Hofmarschall, Graf Görtz, hatte es gar eilig, die für den Tisch der Herzogin bestimmten Personen zu benachrichtigen; die übrige Gesellschaft setzte sich, wie es eben kam, nach Willkür und Neigung zueinander.
Hildebrand von Einsiedel, der nur im Chor beschäftigt gewesen, führte Lila Korona zu Tisch. Goethe, der sich von Frau von Stein getrennt sah, welche an die Tafel der Herzogin befohlen war, nahm mit Adelaide von Waldner und einigen Paaren von der Schauspielergesellschaft an lustiger Tafelrunde Platz. Im stillen hatte er gehofft, heute auch mit an den Tisch der Herzogin Luise gewünscht zu werden, da er es doch war, welcher ihr Fest verherrlichte. Er erwartete verständnisvolle Rührung in ihrem ernsten Auge zu lesen, und war verstimmt, daß es ihm nicht geglückt war, der hochverehrten Frau noch vor dem Souper zu nahen. Mit Ungeduld flogen seine feurigen Blicke zu der fürstlichen Tafel und suchten nur einem Augenaufschlage von ihr zu begegnen.
Sie saß ruhig und edel da in ihrem Kreise, anscheinend unberührt von allem, was geschehen und was noch um sie geschah.
Endlich erhob sich das herzogliche Paar, die ganze Gesellschaft folgte und nun schloß noch eine ungezwungene Unterhaltung die Freuden des Abends.
Es währte nicht lange, so nahte Goethe der Herzogin.
Er stand jetzt dicht an ihrer Seite; sie schien ihn aber nicht zu bemerken und sprach angelegentlich mit der Gräfin Werthern von Neuheiligen.
Da sah der Herzog des Freundes Verlangen und kam ihm in seiner resoluten Weise zu Hilfe.
Er bot der Gräfin den Arm, rief: »Du mußt die schöne Frau auch mir einmal gönnen, Luise!« und führte die Dame im eifrigen Gespräch davon.
Die Herzogin wandte sich halb und wollte an Goethe vorüber auf die Geheimrätin von Bechtolsheim zugehen; er aber vertrat ihr den Weg und sagte, während hohe Röte über seine schönen Züge flammte: »Bin ich denn wirklich bei Eurer Durchlaucht in Ungnade gefallen?«
Luise maß ihn mit einem großen Blick: »Wünschen Sie etwas, Herr Legationsrat?« fragte sie eisig.
»Ja!« erwiderte er jetzt fest, »ich wünsche zu wissen, womit ich Eure Durchlaucht beleidigte.«
Um ihre Mundwinkel zuckte es wie Weinen, und sie flüsterte: »Halten Sie mich für so schwerfällig im Begreifen, daß ich den Sinn Ihres Festspiels nicht erfaßt haben sollte? Oder – glauben Sie, daß es einer Fürstin, einer Frau gleichgültig sein kann, wenn sie vor der ganzen Gesellschaft als eine geisteskranke Törin hingestellt wird?«
»Durchlaucht! Herzogin! Um Gottes willen, diese Auffassung?« rief er in tiefem Erschrecken.
»Still!« raunte sie ihm zu. »Verschlimmern Sie nicht alles noch durch einen Eklat!«
Graf Görtz trat in diesem Augenblick heran, er sagte höhnisch, aber in submissester Haltung: »Ein reizender Anblick, wie der Dichter aus höchster Hand seinen Lorbeer empfängt!«
Die Herzogin entgegnete gefaßt: »Die Verse des Herrn Legationsrat Goethe waren in der Tat scharmant; führen Sie mich an meinen Wagen, Graf!«
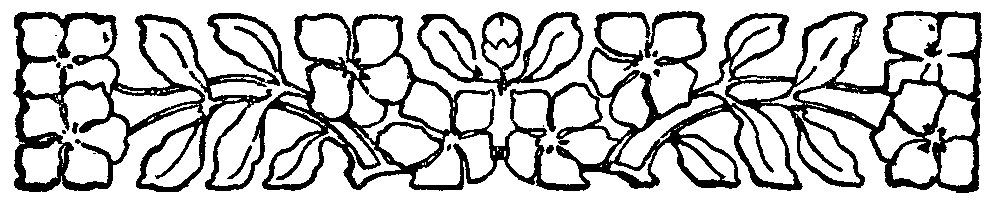
Belvedere.
Erleuchtet außen hehr vom Sonnengold
Bewohnt im Innern traulich, froh und hold.
Erzeige sich das ganze Leben so:
Nach außen herrlich, innen hold und froh!
Goethe.
Nach jener Abfertigung durch die verletzte junge Herzogin hatte Goethe eine unruhige Nacht unter Selbstvorwürfen zugebracht.
Er konnte nicht sagen wie der Herzog, dem er sogleich Luisens Äußerung mitgeteilt: »Das ist ja eine verflucht sensible Närrin.«
Er sagte: »Die Frau hat recht, und ich begreife meine Verblendung nicht!«
Am anderen Tage in aller Morgenfrühe wanderte er, um sich Rat und Trost zu holen, durch den knisternden Schnee am Stern nach Steins Hause hinüber.
Er fand die Freundin noch mit Mann und Kindern am Frühstückstische und ward von allen herzlich als Hausfreund empfangen.
Karl trug ihm einen Stuhl an den Tisch, der kleine Fritz kletterte auf seinen Schoß, Charlotte reichte ihm die Hand zum Kuß und ließ ihm eine Tasse Schokolade bringen, da er den Kaffee stets verschmähte.
Der Oberstallmeister, welcher sich in seiner Rolle als Graf Altenstein und später in seiner Verkleidung als Oger recht wohl gefallen hatte, rief vergnügt: »Na, Doktor, schon ausgeschlafen? Wohl geruht auf den Lorbeeren?«
Charlotte dagegen fand kein lobendes Wort für ihn, und Goethe fühlte, daß sie eine Kritik im Rückhalte habe, die sie ihm für eine ruhige Stunde des Alleinseins spare.
Der Hausherr besorgte die Unterhaltung in seinem Sinne und plauderte nach Herzenslust: »Unsere verehrte Frau Herzogin sah eblouissante aus in der weißen Toilette, mit dem geschmackvollen Cadeau des Herzogs, dem Türkisenkollier! Herzog Ferdinand, unser hoher Gast, der sie noch nicht kannte, äußerte sich nach dem Souper vertraulich zu mir: ›Bester Oberstallmeister,‹ sagte Höchstderselbe, ›das ist ja eine merveilleuse Prinzeß; distinguiert, voll Contenance und Savoirvivre!‹
»Heute wird die maskierte Schlittenpartie den hohen Gast angemessen unterhalten. Ich habe die Ehre, die Frau Herzogin-Mutter zu fahren. Durchlaucht der Herzog fährt Gräfin Werthern, blauer Schlitten, die Kohlfüchse davor. Herzogin Luise mit Prinz Ferdinand, silberne Muschel mit den neuen Schwarzen. Du hast dein Kostüm doch parat, Frau? Janitscharenmusik voraus, wir alle als Türken hinterdrein, ein ganzer Harem entschleiert, süperb! In Belvedere nehmen wir eine Schokolade, darauf gibt's ein kleines Konzert. Nach dem Souper Rückfahrt mit Fackeln. Auf Ihr Penchant ist auch Rücksicht genommen, Doktorchen! Exzellenz von Witzleben hat die feinste Spürnase für ein kleines Herzensfaible. Sie kommen mit der Schröterin und anderer Jugend in einen viersitzigen Schlitten. Es gibt aber noch tausend Dinge im Stall zu arrangieren,« fügte er aufstehend hinzu. »Welchen Schlitten bevorzugst du, Charlotte? Der Oberhofmarschall von Witzleben wird dich fahren. Es ist der mit dem Schwan, für die kleinen Schimmel, der rote mit der Tigerdecke und der Mohrenkopfschlitten mit dem großen Dunkelbraunen noch zur Verfügung; überlege dir, was zu deiner Toilette paßt.«
Er grüßte leicht und eilte, um seine Geschäfte zu besorgen, hinaus.
Der Hauslehrer folgte gleich darauf mit den beiden älteren Knaben.
Frau von Stein nahm Fritzchen an die Hand und lud den Freund ein, mit in ihr Zimmer zu kommen.
Während Fritz mit seinen Bauhölzern und Soldaten an der einen Fensternische spielte, saß Charlotte mit Goethe in gewohnter Weise in der anderen.
»Ich sehe es deutlich in Ihren bewegten Mienen, lieber Wolf,« hub sie teilnehmend an, »es ist etwas geschehen, was Sie quält; reden Sie, berichten Sie mir, was vorgefallen ist, dann will auch ich sagen, was ich für Sie auf dem Herzen habe.«
Aufatmend teilte Goethe der vertrauten Seele sein Mißgeschick mit. Er gestand ihr, daß er wisse, wie sehr er die Herzogin verletzt habe, statt sie – wie er nie anders gewollt und gedacht – in mildester Weise über ihre selbstgewählte trübe Lage aufzuklären und sie wie Lila versöhnt und beglückt in den Kreis der Ihren zurückzuführen. Er schilderte Charlotten, mit welcher Hingabe er es versucht habe, sich in den Gemütszustand der Herzogin zu versetzen; wie sorgsam er jedes Wort abgewogen, um für den dritten nur im Sinne seiner imaginären Person zu reden, Luisen aber doch verständlich zu werden und auf ihr Gemüt zu wirken. Wie er in liebevoller Hingabe geglaubt, dies zarte, edle Frauengemüt, das ihm so anbetungswürdig erscheine, ganz zu verstehen und auf das lindeste zu berühren; wie sein heißer Wunsch sei, in ihren Augen nicht als Hindernis ihres Eheglücks, als Verführer des Herzogs dazustehen. Und nun habe er doch ihr unvergleichlich zartes Empfinden nicht richtig beurteilt und sie tief verletzt.
Warm, hinreißend, bilderreich sprach er sich über sein Mißgeschick aus. Und wieder gewann die ruhig lauschende Freundin einen tiefen Blick in das glühende, nach hohen Zielen ringende Herz des Dichters.
»Du siehst, liebe Seelenführerin,« fuhr er fort, »daß ich wieder einmal deiner bedarf. Ich gebe sonst nichts auf das qu'en dira-t-on, wenn es mit meinem für recht Erkannten im Widerspruch steht, und packe meine Thomaseleien geduldig auf; weiß ich doch, daß alles nur Versuche und Vorbereitungen sind. Hier aber, wo es sich um andere handelt, wo ich verletzt, statt versöhnt habe, quält mich das Geschehnis auf das bängste.«
Sie hatte ihn mit keiner Silbe unterbrochen; als er sie nun, wie nach einem Urteilsspruch verlangend, mit fragenden Augen ansah, reichte sie ihm voll Teilnahme die Hand und seufzte: »Armer Freund!« Dann fuhr sie fort: »Wenn ihr Männer nicht gar so sicher gewesen, wenn ihr nur zu mir gekommen wäret, Rat zu holen! Vorher war das unter euch eine geheime Wichtigkeit und Selbstgewißheit. Als ich nun aber das Spiel sah, erkannte ich den ungeheuren Mißgriff! Ich wußte genau, das vertrug Luise nicht; das hätte auch ich nicht vertragen! Ich konnte Luisens Gesicht nicht sehen, aber aus der Art, wie sie hastig und zitternd den Fächer bewegte, wie sie sich eifrig und gezwungen in den Pausen unterhielt, erkannte ich ihre tiefe Gemütserregung. Mit Bedauern fühlte ich, daß auf lange hinaus viel verdorben sei.«
»Wenn ich sie nur allein sprechen, ihr erklären könnte – wirke mir das aus, Charlotte!«
»Das gerade wird die Herzogin ängstlich vermeiden. Es würde auch nichts helfen. Sie ist zwanzig Jahre alt geworden und in ihrer einmal fest geprägten Eigenart schwer zu ändern. Daß sie dir gestern abend ihre Seele einen Augenblick erschlossen hat, schmerzt sie heute vielleicht mehr als alles übrige; sie ist ja eine so tief innerliche Natur! Sie lebt ganz einsam in der Welt und findet alle Formen, allen Verkehr zu leicht; sie besitzt keine Freundin und sehnt sich, wie ich glaube, nach keiner, weil sie die Wonne, ihr Herz auszutun, nicht kennt.«
»Ja, wenn ich nicht in ihre Seele sähe und so warm für sie wäre, hätte sie mich schon oft erkältet!« rief er zustimmend. »Aber du kannst uns bei ihr heraushelfen, liebste Lotte, sag, was wir tun können!«
»Versuchen kann ich's diesen Abend in Belvedere,« entgegnete Charlotte nachdenklich, »aber mir ahnt, daß es nichts helfen wird.«
Goethe küßte mit dankbarer Innigkeit ihre Hand, klagte, daß er bei der Schlittenfahrt wenig von ihrer lieben Gegenwart genießen werde, und verließ sie wie immer mit der Empfindung, daß etwas in ihm ins Gleiche gerückt sei.
Zu Hause angelangt, hörte er, daß oben der Herzog auf ihn warte, er sprang hinauf und fand Karl August ungeduldig im Zimmer hin und her gehend.
»Kommst du endlich!« rief er ihm entgegen. »Mir läßt diese dumme Geschichte mit Luise keine Ruhe. Ich bin gewiß kein Poltron, aber zu ihr sprechen, sie begütigen, dafür fehlt mir absolut die Courage. Noch vor ihrer Stubentür würde ich auf der Schwelle kehrt machen! Ich bin auch gründlich erbost auf sie. Dies Versöhnungsspiel von gestern war das Äußerste, was ich noch für sie tun konnte! Weist sie die vernünftige Auffassung meines guten Willens ab, so ist unsere Trennung ihre Schuld. Irgend jemand kann ihr in meinem Auftrag ein Ultimatum stellen! Entweder oder! Ich werde mich gar nicht mehr um sie kümmern, wenn sie nicht andere Saiten aufzieht; nur soll sie dann nicht mir unser Zerwürfnis in die Schuhe schieben.«
Goethe erzählte ihm, daß er von der Stein komme, deren Vermittlung er in Anspruch genommen, und deren Zusage, einen Versuch wagen zu wollen, er empfangen habe.
»Es ist eigentlich viel zu viel Mühe, die man sich um sie gibt,« brummte der Herzog halblaut. »Übrigens, wenn die Stein es einmal übernimmt, kannst du ihr sagen, daß sie auch für mich rede.«
Am Nachmittag fand die Schlittenfahrt, bei hellem Wintersonnenschein, der in bläulichen Lichtern über den Schnee glitzerte, statt.
Voran fuhr die herzogliche Kapelle in phantastisch türkischem Aufputz; dann kamen zwei Vorreiter. Zunächst folgte die Herzogin Luise mit dem Gast in der Silbermuschel, beide in buntem, türkischem Kostüm, sie fast undurchsichtig verschleiert; die beiden herzoglichen Mohren standen in reicher Livree hintenauf; darauf kam der Herzog mit seiner Dame, seine Läufer zu beiden Seiten des Schlittens mit schellengeschmückten Stäben, dann die Herzogin Amalie, mit zurückgeworfenem Schleier und einem brillantenfunkelnden Turban, von dem ein Reiherbusch aufstrebte. Sie selbst frisch, lachend, und munter mit dem Oberstallmeister plaudernd.
Hieran schloß sich nun dem Range nach die ganze Hofgesellschaft, in kleineren einspännigen oder mehrsitzigen Schlitten. Die Musik spielte ihre lustigsten Weisen, die Schellen klingelten, die Peitschen knallten, die Zuschauer jauchzten, wo der prächtige Aufzug vorüber kam, und die helle Sonne brach sich mit Regenbogenfarben in dem schillernden Gemisch von frischem Schnee, bunten Stoffen und glitzerndem Geschmeide.
So ging es lustig die gerade Kastanienallee zum Belvedereschloß hinauf.
Bald trat das im italienischen Stil ausgeführte, zweistöckige Hauptgebäude deutlich hervor, vom tiefblauen, lichtdurchfluteten Frosthimmel sich scharf abhebend.
Zahlreiche Lakaien und Stallbediente unter Führung des Kastellans empfingen die vorfahrenden Schlitten und leiteten die Gäste in den Speisesaal, wo eine dampfende Schokolade die Gesellschaft an den Marmorkaminen mit loderndem Holzfeuer versammelte.
Nach einer durch zwanglose Unterhaltung belebten Ruhestunde begann im angrenzenden Gemach die Musik; Korona, sowie die Rudorf, dann beide zusammen, trugen unter lebhaftem Beifall beliebte Arien vor.
Man brachte Licht, und der Tanz fing an. Anna Amalie sagte lachend zur Göchhausen: »Spring dich warm, Thusnelda, um für den Rückweg einzuheizen! Wir wollen keine Neige im Glase lassen!« und eilig trat sie mit Stein zum Kontertanz an.
Die Herzogin Luise konnte dem Erbprinzen, dem Vetter ihres Gemahls, den Ehrentanz nicht weigern; auch mit dem Herzog ging sie zum folgenden Menuett. Sie gab sich Mühe, den Anschein einer zwischen ihnen waltenden Mißstimmung zu vermeiden, und das Ehepaar unterhielt sich in den Pausen über oberflächliche Dinge mit der besten Miene von der Welt; gab sich ihr äußeres Verkehren doch umso beflissener, als es galt, das wahre Verhältnis zuzudecken. Karl August fühlte dabei aber ganz genau, wie er mit ihr daran sei; sie waren anderthalb Jahre verheiratet, und wenn auch nicht durch Liebe verbunden, doch klar über ihre beiderseitige Charakterrichtung und Art sich zu geben.
Nach diesem Menuett erklärte die Herzogin gegen ihre Umgebung, sie scheue wegen der kalten Rückfahrt im offenen Schlitten die Erhitzung und wolle nicht mehr tanzen.
Sogleich fanden sich einige ältere oder ihr besonders ergebene Personen, die sich um sie scharten, zu diesen gehörte Frau von Stein, der es gelang, den Lehnsessel dicht am Sofa neben der Herzogin einzunehmen.
Goethe sah, während er Korona zum Walzer holte, wie günstig sich seiner Fürsprecherin die Gelegenheit darbot. Er warf der angebeteten Frau einen flammenden Blick hinüber und mußte sich zusammennehmen, um nicht zerstreut zu erscheinen.
Aber auch Charlotte von Stein, so bereitwillig sie jene Aufgabe übernommen, so lebhaft sie gewünscht hatte, das Ungeschick der Männer auszugleichen, fühlte sich plötzlich zerstreut, als sie Goethe – in seiner türkischen Tracht, prächtig wie ein Pascha – mit der schönen Sängerin zum Tanze gehen sah. Eine Bitterkeit stieg in ihr auf, die ihr Empfinden dem Luisens ähnlich machte. Sie bekämpfte jedoch dies Unwillkürliche, das sie völlig zu lähmen drohte, und begann sich aufraffend eine oberflächliche Unterhaltung mit der Herzogin. Als die Umsitzenden bemerkten, daß für sie augenblicklich das Ohr der hohen Frau nicht zugänglich sei – man hielt ohnehin Frau von Stein für die nächste Freundin – stand einer nach dem anderen auf und trat, um dem Tanze zuzusehen, in die offene Flügeltür des Saals.
Diese Wendung der Dinge hatte die Parlamentärin erwartet und kam zur Sache.
»Durchlaucht haben einen Unglücklichen gemacht,« flüsterte sie, sich der Herzogin zuneigend. »Der Legationsrat Goethe hat mir gestanden, daß er unter Qualen der Reue und des Bedauerns die Nacht schlaflos hingebracht habe und nichts inständiger begehre und von Höchst Ihrer Gnade erflehe, als seinen Mißgriff ausgleichen, irgend etwas tun zu dürfen, um Eurer Durchlaucht Vergebung zu erlangen!«
»Geschehenes läßt sich nicht ändern. Ich wüßte nicht, wie hier etwas gut zu machen wäre,« entgegnete die Herzogin, sich straffer aufrichtend und bleicher werdend.
»Läßt sich auch nichts ungeschehen machen, so ist Begnadigen doch das schönste Vorrecht der Fürsten. Darf ich dem reuigen Dichter, welchen sein Genius auf Irrwege lockte, den Trost der Vergebung im Auftrage meiner Gebieterin spenden?«
»Ich denke, der Herr Legationsrat wird sich gern mit der Gnade meines Gemahls begnügen.«
»Warum soll dies zweierlei sein? Warum trennen Eure Durchlaucht Ihre Getreuen in zwei Heereshaufen? Goethe ist Höchst Ihnen ebenso ergeben wie Seiner Durchlaucht dem Herzoge. Er beklagt schmerzlich das Vorurteil, als wirke er ungünstig auf seinen hohen Herrn; er möchte versöhnen, ins Gleiche rücken, die ihm verehrungswürdigsten Menschen innig verbinden.«
»Stößt aber auf Schwierigkeiten, die –« sie schwieg und wandte sich mit schmerzlich zuckender Lippe ab.
»Durchaus nicht, Herzogin! Keineswegs; auch Seine Durchlaucht der Herzog beklagt vorgefallene Störungen, verletzende Berührungen und wünscht nichts lebhafter –«
»Ah, Parlamentärin!«
»Ja, Euer Durchlaucht, nennen wir es so; ich spreche in doppeltem Auftrage und aus der Fülle meines betrübten Herzens dazu. Seien Sie versöhnlich, seien Sie gnädig und gütig für zwei Herzen, die in Liebe und Verehrung für Sie glühen.«
»Liebe? – Liebe bieten Sie, in seinem Auftrage? Weil er die kokette Werthern entbehrt, keinen interessanten Ersatz findet, deshalb, als Lückenbüßer, als Almosen – sein Weib! Großer Gott, was sage ich? Aber mag's sein. Meine Liebe kann ebensowenig aus ihrem Grabe erstehen, wo hinein er sie gebettet hat, als seine tiefbetrauerte ›Liebste‹. Ich bin deshalb nicht wahnsinnig wie Lila, aber ich bin eine Frau, die ein feinempfindendes Herz hat und auf ihre weibliche Würde hält. Ich bin und bleibe sein Weib, sein pflichttreues, sein gehorsames Weib; ich werde ihm nie, was er von mir, von meiner Stellung zu fordern hat, versagen; melden Sie ihm das auch, aber mein Herz, das nicht begehrte, das bleibt ihm für alle Zeit verloren!«
Sie stand rasch auf, trat vor nach dem Salon, gewann in kürzester Frist Beherrschung ihrer bebenden Glieder, ihrer schmerzlich verzogenen Mienen und folgte wenige Minuten später, als der Walzer zu Ende war, dem Erbprinzen von Braunschweig zum Souper.