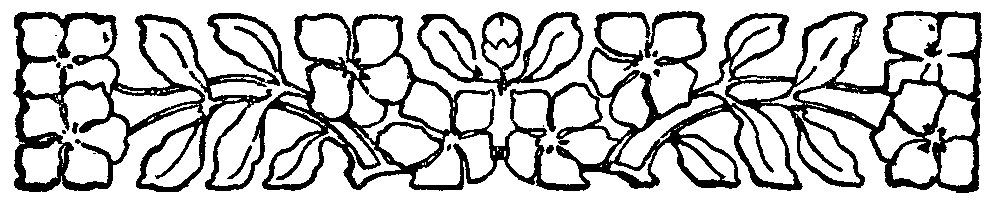|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Eines schickt sich nicht für alle!
Sehe jeder, wie er's treibe,
Sehe jeder, wo er bleibe,
Und wer steht, daß er nicht falle!
Goethe.
Das muntere gesellige Treiben dauerte nach Goethes Ankunft in Weimar ununterbrochen fort. Bälle und Diners bei Hof und in den ersten Familien, am Freitag Redouten im Stadthause, Jagdpartien, wilde Ritte und Fahrten über Land, Liebhabertheater, Vorlesungen, zu- und abgehende Gäste, mit denen gezecht und geschwärmt wurde, alles dies füllte den Winter.
Daneben zog der Herzog den Freund häufig zu Regierungsgeschäften heran und benutzte seinen juristischen Rat; auch freute er sich an Goethes warmer Menschlichkeit und seinem klaren Urteil.
Diese Beteiligung an den Geschäften befriedigte Goethe mehr als alle Lust, der er sich im Jugenddrange und Übermut hingab, die aber nie der ganze Inhalt seines Lebens sein konnte. Aus dem Freundschaftsbündnis mit dem Herzog, der tiefen, anbetenden Liebe zu Charlotte von Stein und der Aussicht, einen Beruf zu finden, schlang sich das Band, von dem er gehalten wurde.
Ernste Geschäfte und Überlegungen hinderten ihn aber nicht, mit eigener Hand den Kreisel zu treiben und in ausgelassener Jugendfreude bei allen Lustbarkeiten voranzutollen. – –
In einem kleinen Zimmer zu Tiefurt saßen der Hauptmann Karl von Knebel mit seinem Zögling, dem Prinzen Konstantin, einem schlanken, schönen Jünglinge mit schwärmerischen Augen, der – obgleich in jedem Zuge weicher gebildet als sein Bruder, der energische Karl August – doch auch große Frühreife zeigte.
»Sie sind heute von einer argen Zerstreutheit, mein Prinz,« sagte in gereiztem Ton der Hauptmann. »Schlagen Sie lieber den Tacitus zu, wenn es Sie gar nicht interessiert, was der große Geschichtschreiber über Ihr Vaterland berichtet.«
Höchst gleichmütig und vergnügt befolgte der Prinz die Erlaubnis und sprang zugleich auf. »Darf ich den Schlitten bestellen? Sie fahren doch mit?« rief er strahlenden Auges.
»Nun ja doch,« entgegnete der Ältere, zwischen einem Gefühl der eigenen Erleichterung und dem Verdruß über seine mangelhafte Autorität schwankend.
»Wir sollen ja zu meiner Mutter kommen!« fuhr Konstantin fort, »und ich freue mich so unsinnig auf den Abend.«
Das gutmütige Gesicht des dreißigjährigen Mannes heiterte sich bei dem naiven Ausbruch der Freude von seiten des Jünglings auf; vielleicht wirkte die impulsive Lust ansteckend, und er begann zu fragen, was man für den Abend vorhabe und wer da sein werde.
Karl von Knebel war groß, von soldatischer Haltung, aber von mildem, schwermütigem Gesichtsausdruck; eine klassische Bildung, poetisches Talent und strenge Pflichttreue befähigten ihn zu dem Vertrauensposten, welchen er innehatte. Er hörte jetzt teilnehmend an, was der Prinz ihm von den Plänen für die Gesellschaft erzählte, und sah eine halbe Stunde später in dem mit Pelzen ausgelegten Schlitten, der sie auf glatter Bahn rasch nach Weimar führte. Während der junge Prinz am Wittumspalais bei seiner Mutter ausstieg, ließ sich der Hauptmann bis zur schicklichen Gesellschaftsstunde nach der Belvedereallee fahren, um seinen Freund Goethe aufzusuchen, dem er seine Not mit dem Prinzen klagte.
»Du mußt dich nicht so leicht beirren lassen,« erwiderte Goethe tröstend, »dir aus Kleinem nichts machen. Schlag ein Schnippchen in der Tasche und tue schlichtweg deine Schuldigkeit.«
»Da hast du gut reden! Du, der hier aufgegangen ist wie ein Stern, zu dem jedermann aufsieht. Du fühlst, du weißt, daß du nach keiner Richtung vergeblich arbeitest. Deine Schöpfungen werden früher oder später jedem denkenden Menschen Licht und Wahrheit geben, du wirst ein Überwinder der Zeiten sein! Und was du an Karl August tust, ist auch nicht in den Brunnen geworfen.«
»Ja,« rief Goethe mit warmem Frohlocken, »unser Herzog ist ein goldener Junge, und wir werden täglich ganzer zusammen! Und doch geht es mir arg durch Kopf und Herz, ob ich bleibe oder gehe. Ein Riß und alle die siebenfachen Bastseile sind entzwei. Daß ich jetzt an seinen Regierungsgeschäften meinen Teil habe, ist das Beste, was er für mich tun kann. Der Druck eines Berufes ist sehr schön für die Seele; wenn sie entladen ist, spielt sie freier und genießt das Leben. Elender ist nichts, als der behagliche Mensch ohne Arbeit; die schönsten der Gaben werden ihm ekel.«
»Ich würde mir Arbeit suchen und im Frieden meinen Kohl bauen,« murmelte Knebel melancholisch.
»Raff dich auf, du markige Gestalt aus altem Heldenstamme!« rief der Freund lachend. »Steh fest und männlich am Steuer deines Lebensschiffleins; spielen damit auch Wind und Wellen, laß sie nicht mit deinem Mute spielen; vertraue deinem Stern, führe er dich hierhin oder dorthin!«
Bei allem Zutrauen füreinander trat die Verschiedenheit beider in jedem Gespräche hervor; mochte Goethe, der starke Hoffer, der tätige Enthusiast, auch von seinem Geiste dem anderen abzugeben trachten, Knebels schlaffe Natur ließ sich nicht dauernd aufstacheln. Wenn er auch manchmal, wie alle melancholischen Leute, aufgeweckt und bei vielseitiger Begabung interessant sein konnte, so schritt er doch ernst und ohne rege Beteiligung durch das lustige Genietreiben seiner Genossen.
In den Gesellschaftszimmern der Herzogin Amalie ging es an diesem Abend wieder heiter und lebhaft zu. Es hatten sich verschiedene Kreise und Gruppen, gebildet, in denen man sich nach Geschmack unterhielt. Der größte Teil der Gesellschaft amüsierte sich in dem mittleren Saal mit Pfänderspielen. Der Herzog, Konstantin, Goethe, der schlanke Hildebrand von Einsiedel, der schöne Wedel, auch der Neuangekommene, stattliche Kammerherr von Seckendorf, Leutnant von Lichtenberg und viele andere junge Männer führten mit Geist und Witz, mit Heiterkeit und Gewandtheit das Spiel an. Ein schöner Kranz junger Frauen und Mädchen beteiligte sich; da waren die beiden hübschen Hofdamen Luisens, da war die zum Gesellschaftsfräulein Amaliens ernannte muntere kleine Göchhausen, Auguste von Kalb und ihre Schwägerin Leonore, Milli von Werthern, die zarte blonde Karoline von Ilten mit ihrer Schwester, Luise Rudorf, die Kammersängerin der Herzogin, die einzige nichtadelige Dame, die zum Mißvergnügen vieler hier erscheinen durfte, und eine Menge anderer Schönen.
Im Nebenzimmer wurde von einem ruhigen Kreise unter dem Vorsitz der Herzogin Luise Vingt-un gespielt; sie liebte das muntere Durcheinander eines Pfänderspiels nicht; instinktiv zog sie sich vor jeder Berührung zurück, die sie aus ihrer Reserve hätte scheuchen können. Neben ihr saß Frau von Stein, für die sie eine besondere Sympathie empfand, der endlich zu ihrem Hofmarschall ernannte Graf Görtz, die steife Oberhofmeisterin Gräfin Gianini, der Kammerpräsident von Kalb und noch ein paar andere Personen. Eine ruhige, etwas oberflächliche Unterhaltung füllte die Pausen des Spiels; dann wurden wieder in bester Form Karten verteilt, Augen gezählt und streng alle Regeln des Vingt-un beobachtet.
Auf der anderen Seite des Salons lag ein hübsches Kabinett mit einem Deckengemälde von Öser, Fortuna mit bittenden Nymphen darstellend; in demselben hatte die Herzogin Amalie ihren heiteren Kreis, ihre muntere Plauderecke versammelt. Wieland war der Stammgast, Geheimrat von Fritsch, Knebel, Musäus und einige andere Männer und Frauen ab und zu gehende Teilnehmer.
In dem nächstliegenden Gemach waren in der Nähe einer dampfenden Bowle wieder andere Seelenverwandte zusammengekommen. Der Oberstallmeister von Stein schien zu präsidieren, Rittmeister von Werthern, Kammerjunker von Kalb und verschiedene Männer mittleren Alters hatten sich dazu gesellt. Die Nachricht, daß der alte Oberst von Laßberg seinen Abschied gefordert habe, bildete hier als Tagesneuigkeit das Hauptgesprächsthema.
Die Herzogin Amalie hatte eben in ihrem Kabinett Herrn von Knebel zu sich in die Ecke gewinkt.
»Mir scheint, mein lieber Hauptmann,« flüsterte sie, »Konstantin fängt da eine ernstliche Sponsade an, der wir rechtzeitig den Riegel vorschieben müssen. Der dumme Junge meinte vorhin: nächstes Jahr wäre er ebenso alt wie sein Bruder, als der heiratete. Ich sagte ihm aber, daß wir uns mit seiner Majorennitätserklärung nicht beeilen wollten, und daß es nur Bettelprinzen geben würde, wenn er da die kleine blonde Ilten freite. Seien Sie doch so gut und drücken dem jungen Herrn auch etwas fester den Daumen aufs Auge.«
Knebel seufzte. »Durchlaucht wollen verzeihen, wenn mir dies manchmal nicht recht mehr gelingt,« entgegnete er bedrückt. »Der Prinz schwimmt gar zu sehr mit hoher Flut und in den geselligen Freuden, die man ihm kaum noch verbieten kann. Er hat kein Interesse für seine Studien –«
»Schon gut, schon gut, mein Lieber!« sagte die Herzogin besänftigend. »Ich werde ein ernstes Wort mit meinem Sohne reden, ihm den begehrlichen Sinn und verdrehten Kopf zurechtsetzen.« Es lag so viel Energie im Ausdruck ihres Gesichts, als sie dies sagte, daß der Hauptmann sie erschrocken ansah.
In diesem Augenblick legte sich das muntere Durcheinander, das Lachen und Plaudern im Salon, und es erhob sich eine wohlgeschulte liebliche Mädchenstimme, die ein schlichtes Liedchen in ansprechender Weise vortrug. Beim ersten Klang dieser sympathischen Stimme verlor Knebel alle Aufmerksamkeit für die Worte seiner hohen Gönnerin; lauschend neigte er sich vor, den Blick hinausgerichtet; auch die Herzogin hörte befriedigt zu.
»Ein liebes, herziges Ding, dies hübsche Rudelchen,« sagte sie warm, als Luise Rudorf ihr Lied beendet hatte, »aber gar keine dramatische Sängerin edleren Stils.«
»Du hast ganz recht,« erwiderte der Herzog, der unbemerkt von der Mutter mit Goethe herangetreten war. »Wenn wir uns an eine größere Aufführung machen, fehlt uns immer die Hauptfigur. Wie wär's, wenn wir uns noch eine erste Kraft zulegten? Goethe hat in Leipzig eine interessante Konnexion, er hat mir schon ein paarmal von dieser Krone der Schöpfung vorgeschwärmt.«
»Es ist Korona Schröter, Durchlaucht, die in Leipzig als Konzertsängerin angestellt ist,« ergänzte Goethe. »Ich hörte sie vor Jahren und weiß, daß sie noch heute alle Welt mit ihrer unvergleichlichen Stimme und großen Schönheit entzückt.«
»Na, das wäre doch nicht übel, die hier zu haben?« rief der Herzog. »Ich werde dich nächstens bevollmächtigen, sie für uns zu kapern.«
Während die Mutter durch den ältesten Sohn gefesselt wurde, hatte Konstantin eine Pause im Spiel benutzt, um, im Salon am Fenster lehnend, mit der angebeteten Karoline zu flüstern. Sie spielte niedergeschlagenen Auges mit ihrem Fächer; jetzt erhob sie den Blick ihres scheuen Kinderauges innig zu ihm, wobei der junge Prinz vor Freude errötete.
»Ich werde am Dienstag als Schäferin erscheinen und blaue Schleifen tragen,« lispelte sie.
»O, dann weiß ich mein Kostüm!« jubelte er, »und meine süße Schäferin werde ich bald herausfinden.«
Knebel sagte der Sängerin einige freundliche Worte. »Sie singen so ganz nach meinem Geschmack, Demoiselle,« sprach er warm. »Ihre Stimme hat etwas so Wohltuendes; ich muß an flüsternde Zweige, murmelnde Wellen und zwitschernde Vögel denken, und mir wird leicht und froh dabei.«
Luise von Göchhausen hatte sich mittlerweile auch bei der Herzogin eingefunden. Man sprach eben über des Obersten von Laßberg Abschiedsgesuch, und der Herzog rief: »Glaubt der, daß ich für seine Laune das Pflaster einer Pension bereit liegen habe? Laß ihn getrost und ohne Maulerei meine Husaren weiter kommandieren; er ist noch ein strammer, alter Offizier, der sich die Schrullen wieder abgewöhnen muß.«
»Mir ahnt längst, was ihn ärgert,« sagte die Herzogin. »Er glaubt, man ästimiere ihn nicht, weil ich sein langweiliges Gänschen Tochter nicht zum Hoffräulein wollte. Göchhausen, Sie sollen mir nächstens den verdrehten alten Knaben zurechtweisen.«
»Diese diplomatische Mission ist mir eine große Ehre, Durchlaucht, wenn man aber dem Puter den roten Lappen wiederholt vorhält, gegen den er kollert, kriegt man ihn nie zur Ruhe.«
»Mit Ihrem Permiß, Göchhausen!« rief der Herzog, »sich schlichtweg als roten Lappen vorzustellen, finde ich doch gar zu bescheiden.«
»Geben Sie acht, Durchlaucht, das wird meine Maskeradenmontierung am Dienstag.«
»Ich leid's nicht. Sie kommen gar nicht hin!«
»Ich käme nicht hin; das wollen wir doch mal sehen!«
»Wetten wir.«
»Mit Vergnügen, um was Durchlaucht wollen.«
»Sie sollen Orden und Titel haben, wenn Sie's möglich machen.«
»Topp!« – Sie hielt ihre kleine Hand hin, und der Herzog schlug ein.
»Laß mir meine Göchhausen ungeschoren; was habt ihr wieder für Thomaseleien miteinander?« sagte die Herzogin.
»Dieser kleine, spitzzüngige Dämon muß geplagt werden!« lachte Karl August, »sonst ist ihm nicht wohl, nur in einer Hölle von sieben seltsamen Schnurren kann er gedeihen!«
Luise sah ihn mit eigentümlichem Ausdruck von der Seite an, es war aber nur ein weicherer Blick, dann entgegnete sie im vorigen Ton: »Ich bin ganz darauf gefaßt, daß Eure Durchlaucht mir Selbstschüsse legen und Fuchsfallen stellen, daß ich arretiert, deportiert oder arkebusiert werde; aber wehren tue ich mich aufs äußerste, und auf die Maskerade komme ich doch.«
»Plag sie nicht, neckt euch nicht, vertragt euch!« rief die Mutter heiter.
»Wir gehen ja sanft miteinander um, wie die zwei Flügel einer Taube, ist's nicht so, Göchhausen?« lachte der Herzog und sprang gleich darauf fort, um Milli von Werthern zu fragen, welches neue Gesellschaftsspiel man beginnen solle.
Goethe hatte sich schon früher davongemacht, er durchschritt die munter plaudernden Gruppen im Salon, wich den flammenden Blicken Auguste von Kalbs aus und stand jetzt hinter Frau von Stein, die schon zum unzähligsten Male mit völliger Ruhe ihre Karten aufnahm. Er neigte sich über sie und flüsterte ihr zu: »Haben Sie keinen Blick für mich? Ich ertrag's nicht mehr.«
Sie nickte nur leise darauf und machte dann eine zum Spiel gehörige Bemerkung. Er biß sich auf die Lippe; in seinen Augen funkelte und brannte die Ungeduld, seine Hände ließen die Lehne ihres Stuhls nicht los.
Endlich trat der Minister, Geheimrat von Fritsch, in einer Pause des Vingt-un an die Herzogin heran; diese erhob sich, um eingehender mit ihm sprechen zu können. Vielleicht empfand die junge Frau auch ein Verlangen, sich zu bewegen, eine Veränderung zu genießen. Ihr ganzer Kreis stand auf, und Frau von Stein trat mit Goethe in die offene Salontür.
»Endlich!« atmete er auf; er neigte sich dicht zu ihr hin und flüsterte: »Ich plage Sie wieder, liebe Frau, werden Sie's nur nicht überdrüssig! Leide, daß ich dich so lieb habe, Engel! Wenn ich jemand lieber haben kann, will ich's sagen, und dich ungeplagt lassen!«
Sie senkte ihre schönen, ernsten Augen eine Sekunde tief in die seinigen und entgegnete: »Ruhig Blut, mein feuriger Dichter! Keine Torheiten! Fassen Sie sich zusammen und lernen Sie Selbstbeherrschung!«
»Darf ich morgen zu dir kommen, Besänftigerin, liebes Gold? – Darf ich zum Essen kommen?«
Sie nickte zustimmend. Man bildete in diesem Augenblicke im Saal einen Kreis zum Blindekuhspiel; Goethe wurde hineingezogen, er faßte Frau von Steins Hand und bat, sie solle mitkommen; sie lehnte aber entschieden ab und trat zur Herzogin in das Zimmer zurück, worauf die Kette sich ohne sie schloß und ein toller Wirbeltanz begann. In der Mitte stand die zierliche Gestalt Millis mit verbundenen Augen und zwei hölzernen Kochlöffeln in den Händen, mit denen sie zum Gesang der anderen den Takt schlug. Jetzt hielt auf ihren Ruf der stürmende Kreis inne, sie ging auf ihr Opfer zu, das sich wand und auswich, sie aber faßte mit ihren beiden Löffeln wie mit einer Zange den Auserlesenen, tastete und riet den Namen; traf sie's, trat der andere für ihn ein, irrte sie, verhöhnte sie lauter Gesang, und ein neuer Rundtanz hub unter Gestampf und hellem Gelächter an.
Der neue Kammerherr Siegmund von Seckendorf hatte genug von dem lustigen Treiben der Jugend. Er war, als die Aufforderung zum Blindekuh erging, unbemerkt in das Nebenzimmer geschlüpft, wo Luisens Spieltisch stand; hier fand er die Gesellschaft noch in Gruppen verteilt und höflich plaudernd. Nachdem ein paar Damen begrüßt waren, trat er zu vertrauter Besprechung mit dem Grafen Görtz, dem früheren Führer Karl Augusts und jetzigen Oberhofmeister der Herzogin Luise, in eine Fensternische.
Es fand längst im stillen eine Verbindung solcher statt, die dem wilden Genietreiben abhold waren, die dem zurückhaltenden Benehmen der jungen Herzogin lebhaft zustimmten und schon das Wesen der Herzogin- Mutter zu zwanglos schalten.
Graf Görtz hatte früher vergeblich versucht, der Mutter den ihr so ähnlichen Sohn zu entfremden, ihn in andere Bahnen zu lenken, ihm die Exklusivität seiner Lebensstellung ans Herz zu legen. Karl August dürstete aber vor allen Dingen danach, recht mit ganzer Kraft und Seele Mensch zu sein und hierauf den Stand des Fürsten, als seinen eingeborenen Beruf, treu auszufüllen. Daß er nicht Mensch mit anderen sein, daß er die Liebe nicht begehren, sich der Freundschaft nicht in die Arme werfen, Jugendlust nicht genießen sollte, wie andere auch, das vermochte der Erzieher ihm mit aller Mühe nicht beizubringen.
Im großen Uhrwerk des menschlichen Verkehrs finden die retardierenden Gewichte immer ihren Platz! Bald gründete Görtz eine Partei. Es gelang ihm sogar, leise Zeichen der Zustimmung von den geachtetsten Männern der Stadt, dem Minister von Fritsch und dem braven Oberhofmarschall von Witzleben zu erlangen.
Seckendorf war anfänglich als Eindringling gemieden, man hatte erwartet, er werde – als Literat und Komponist – sich den Genies und ihrem Treiben vollständig anschließen. Dem war aber nicht so. Er hatte mit Vorsicht alle äußeren Punkte seiner Stellung geordnet und zeigte sich jetzt als ein Hofmann von seiner Form und kühler Zurückhaltung.
»Ich gestehe Ihnen, Herr Graf,« antwortete er auf eine Frage des anderen nach seiner Ablehnung des Spiels im Salon, »daß dies ungebärdige Geniewesen nicht nach meinem Geschmack ist. Als Seine Durchlaucht, der Herzog, mir in Baireuth die gnädigsten Avancen und Offerten machte, ahnte ich nicht, daß ich hier einen unbändigen Schöngeist, diesen Doktor Goethe, im Besitz aller Gunst und aller Freundschaft des Herzogs finden würde. Halten wir ein wenig zusammen, Exzellenz!« bat er endlich mit seinem Lächeln.
Ein allgemeiner Aufbruch der Gesellschaft unterbrach die Unterhaltung der beiden oppositionslustigen Männer und beendete für viele einen sehr vergnügten Abend.
Goethe schrieb noch einen längst beabsichtigten Brief an seinen hochverehrten Freund Lavater. Dieser hatte bei ihm angefragt, ob er einen jungen Schweizer, Christoph Kaufmann, dem er nach seinem physiognomischen System herrliche Eigenschaften zuerkannte, nach Weimar schicken dürfe. Goethe antwortete im Auftrag des Herzogs: man werde jeden gut aufnehmen, den er sende und von dem er eine so hohe Meinung hege. Schließlich berichtete er, daß er in einiger Zeit nach Leipzig reisen werde, um die schon früher bewunderte Sängerin, Korona Schröter, für Weimar zu gewinnen.
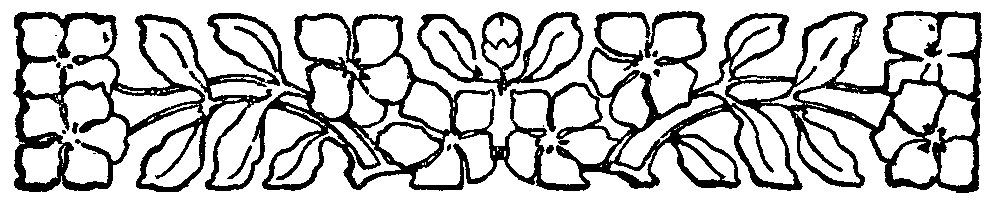
Und wäre dir auch was verloren.
Mußt immer tun, wie neugeboren;
Was jeder Tag will, sollst du fragen.
Was jeder Tag will, wird er sagen;
Mußt dich an eignem Tun ergötzen,
Was andre tun, das wirst du schätzen.
Besonders keinen Menschen hassen
Und das übrige Gott überlassen.
Goethe.
So, meine heißgeliebte Gemahlin, da wären wir!« sagte der Rittmeister von Werthern in ironischem Ton, nach der Gesellschaft bei der Herzogin-Mutter mit Emilien vor seinem Hause ankommend.
Er schloß die Haustür auf, ließ sie eintreten und fuhr dann fort: »Eben elf Uhr; solch ein angebrochener Abend ist schändlich langweilig; ich gehe noch in den ›Erbprinzen‹, mit dero Permiß, meine Gnädige!«
Eine Entgegnung nicht abwartend, schloß er hinter seiner Frau das Haus zu, steckte den Schlüssel in die Tasche und stampfte pfeifend durch den Schnee dem erwähnten Wirtshause zu.
Emilie ging im Flur an einen Tisch, auf welchem ein kleines Öllämpchen brannte, um ihr daneben stehendes Licht an demselben zu entzünden und damit ihr Schlafzimmer aufzusuchen. Sie hatte sich in der Gesellschaft sehr gut amüsiert; vom Herzog war sie wie immer ausgezeichnet, die anderen Männer folgten dem hohen Beispiele, sie war, das fühlte sie, die gefeiertste Dame ihres Kreises, und doch kam sie leer, verwirrt, tief innerlich unbefriedigt zurück. Jetzt wieder, als sie daran dachte, daß Werthern nichts für sie gehabt habe als Ironie und Kälte, durchschauerte sie's so schmerzlich, daß ihre Hand bebte, als sie den Docht ihres Lichts dem des Lampchens näherte, und siehe da, der starre Docht des Lichts verlöschte die schwache Flamme der Lampe!
Das war damals, wo es keine Zündhölzer gab, eine große Unannehmlichkeit.
Ein leiser Angstruf entfuhr ihr, sie fürchtete sich im Dunkeln und dachte zugleich mit Schreck an das Gezänk ihres Mannes, wenn er spät nach Hause kommend, das gewohnte brennende Lämpchen nicht an seinem Platze finden würde. Was beginnen? Ihr Mädchen schlief auf dem Boden, des Dieners Quartier lag am Pferdestall auf dem Hofe. Hier unten gab es nur ihren Mieter, den Bergrat von Einsiedel, und allerdings, durch die Fugen seiner Stubentür schimmerte noch Licht; sie wußte, daß der fleißige Forscher bis spät in die Nacht hinein arbeitete, aber um die Welt hätte sie nicht an sein Zimmer klopfen und ein Fünkchen Licht erbitten mögen.
Sie entschloß sich also im Dunkeln die Treppe hinaufzutappen und den Zorn ihres Mannes über sich ergehen zu lassen, und so schritt sie denn in der Richtung vor. in welcher auf dem dunklen Flur ihrer Meinung nach die Treppe liegen mußte.
Die Richtung war aber verfehlt; sie stieß an den Korb mit Holz, der neben einem Kamin stand, und klappernd fiel der überhäufte Korb um. Bebend vor Schreck lehnte sie daneben an der Wand, als die Tür ihres Hausgenossen sich öffnete und der Bergrat von Einsiedel mit dem Licht in der Hand heraustrat. Er sah sich mit seinem ruhigen Blick suchend um.
»Ach, Sie sind es, Frau von Werthern,« sagte er in artigem Ton. »Ihnen ist das Licht verlöscht; warum haben Sie mich nicht gerufen, ich bin ja sehr gern zu Ihren Diensten.«
Nach diesen Worten zündete er ihr Licht und auch das Lämpchen an. Sie war an den Tisch herangetreten, ihr Mantel lag neben dem Holzkorb, ein Spitzentuch, das sie um den Kopf getragen hatte, war zurückgefallen, ihre Wangen brannten und ihre schönen Augen erhoben sich demütig innig zu den seinen. Er sah sie mit bewegten Mienen an; sie las in seinem Ausdruck, daß er sie reizend finde. In Gesellschaften wurde sie weniger tief von diesem warmen Blick männlichen Wohlgefallens berührt, weil sie daran gewöhnt und dies die übliche Münze im Kleinhandel der Koketterie war. Hier aber, in nächtlicher Stille und Einsamkeit, diesem ernsten Gelehrten gegenüber, der ihr bisher scheinbar keine Beachtung gegönnt hatte, berührte sie dieser zärtliche Ausdruck seiner Züge bis ins tiefste Herz hinein. So standen sie ein paar Sekunden, ohne daß es beide recht wußten, im stummen Anschauen einander gegenüber.
Endlich sagte er mit unsicherer Stimme: »Darf ich Ihnen eine gute Nacht wünschen?« verneigte sich und ging.
Sie hauchte: »Ich danke Ihnen!« nahm ihren Mantel über den Arm und stieg die Treppe hinan.
Er folgte ihr – die Türklinke in der Hand – mit seinen Blicken.
Da – fast war sie oben angekommen – fiel ihr das Licht vom Leuchter, rollte ein Paar Stufen hinunter und erlosch. Sie schrie laut auf, und er stürzte vor, es aufzuraffen und ihr noch einmal anzuzünden.
Der Treppe gegenüber lag ihre Zimmertür; er öffnete sie, und beide standen jetzt neben dem runden Tisch vor ihrem kleinen Kanapee. Er setzte ihr Licht auf den Tisch und sagte lächelnd: »Jetzt sind Sie in Sicherheit. Sind Sie heute abend recht froh gewesen? Ich glaube, man ist jetzt lustig in Weimar?«
»Ein tolles Treiben, von einem zum anderen,« entgegnete sie mit dem Ton der Abneigung, die sie in der Tat, in diesem Augenblick und diesem Manne gegenüber, für die rauschende Geselligkeit empfand.
»Was haben Sie in der nächsten Zeit vor?« fragte er weiter.
»Morgen, am Sonntag, Schlittenfahrt nach Tiefurt zum Kaffee, Abends wahrscheinlich noch Tanz. Montag, am Morgen bei Steins Theaterprobe; Abends Gesellschaft bei Oberhofmarschall von Witzleben. Und am Dienstag ist ja die große Maskerade.«
»Ich möchte auch einmal vergnügt sein und mit Ihnen tanzen, obgleich ich's kaum noch kann,« sagte er, verloren in ihren Anblick, und fast wie zu sich selbst sprechend. »Verraten Sie mir Ihr Kostüm auf der Redoute und verschmähen Sie mich nicht, wenn ich komme, um eine Tour zu bitten.«
Sie sagte ihm, daß sie als maurische Fürstin erscheinen werde, und versprach mit strahlendem Lächeln so viel mit ihm zu tanzen, wie er nur möge.
»Gut denn!« rief er, indem er rasch ihre Hand an seine Lippen zog, »so will auch ich einmal froh sein und in derselben Weise glücklich, wie es andere sind!« Mit diesen Worten stürmte er fort.
Seltsam erregt, ja mit lautklopfenden Pulsen, ging Emilie in ihr Schlafzimmer und suchte vergebens der Bewegung Herr zu werden, welche ihr diese unerwartete Begegnung verursacht hatte.
Am Dienstag nach Tisch stand Luise von Göchhausen in ihrem kleinen Zimmer im Wittumspalais neben einem Tisch, auf dem ihre alte Schulzin eben das von ihr gefertigte Maskeradenkostüm für die junge Herrin ausbreitete. Luise war klug genug zu wissen, daß sie sich nicht wie schlankgewachsene, schöne Mädchen kleiden dürfe; ebenso wußte sie, daß man ihre kleine Gestalt, ihre schiefe Schulter unter allen Verhüllungen heraus erkenne; es kam für sie also nur darauf an, etwas Drolliges, Originelles zu erfinden. Sie hatte einen feuerroten Domino gewählt, und um dieser Wahl etwas Charakteristisches zu geben, wollte sie ein Flämmchen vorstellen. Sie hatte sich eine spannenlange Flamme malen und diese an einen goldenen Reif befestigen lassen, welchen sie um den Kopf trug, dazu nahm sie nur eine schwarze Florbrille und keine Maske; wozu diese Unbequemlichkeit, zu erkennen war sie ja doch!
Sie fand, indem sie jetzt ihren Stirnreif vor dem Spiegel umprobierte, daß die Flamme ihr nicht übel stand, das kecke Gesichtchen sah koboldartig, aber pikant darunter hervor.
»Hör mal, Altsche,« sagte sie jetzt überlegend zur Schulzin, »der Herzog hat ehegestern in Tiefurt und gestern abend bei Witzlebens wiederholt versichert, ich werde nicht auf die Maskerade kommen, er spielt mir also, davon sei überzeugt, irgend einen Possen. Ich war diesen Morgen in der breiten Gasse. Onkel Wilhelm geht auch zu der Hofmaskerade, er sagte, daß er ein sehr würdiges Kostüm bereit habe. Ich stellte ihm vor, daß er von meiner herzoglichen Portechaise profitieren und den Taler für seine Sänfte sparen könne; wenn er meinen Trägern eine Kleinigkeit gäbe, wäre das ausreichend. Er solle auch zuerst hinbefördert werden.
Dies alles leuchtete ihm sehr ein. Nun müsse ich mich aber bei ihm ankleiden, sagte ich, denn sonst könne ich die Portechaise nicht dorthin bestellen. Er war's zufrieden, und ich hoffe, wir ziehen so den Kopf aus der Schlinge! – Sowie es dämmert, nimmst du meine Garderobe und gehst voran. Um fünf Uhr entläßt mich die Herzogin, dann folge ich dir unbemerkt; wenn also der Herzog irgend einen Schabernack plant, mir die Tür zunageln oder sonst einen Unsinn machen will, ist der Vogel ausgeflogen.«
»O je, wie du klug bist, Kind!« sagte die alte Zofe mit vor Bewunderung glänzenden Augen.
»Der Träger sind wir doch sicher?«
»Ich habe sie bestellt, sie ließen noch niemals warten; nun muß ich natürlich noch vorgehen und sagen, daß sie zu unserem Onkel kommen.«
»Tue das. Und – mir liegt doch sehr daran, auf dem Balle zu sein – wie wär's, wenn wir eine Viertelstunde später die Portechaise nach der breiten Gasse bestellten, die der Oberkämmerer gewöhnlich nimmt? Denn sieh nur den aufgelösten Schnee, gehen könnte ich in Ballschuhen keinesfalls. Läßt uns also die Hofportechaise auf Order des Herzogs im Stich, so kann die gemietete erst Onkel und dann mich hintragen.«
»Das ist ganz vernünftig bedacht, aber du wirfst einen Taler hinaus.«
»Lieber das, als meine Wette mit dem Herzoge verlieren.«
Die Schulzin ging, um die beiden verschiedenen Sänften zu bestellen, und machte sich dann heimlich, unter einem großen Regenschirm, mit dem in ein Tuch geschlagenen Anzuge ihrer Dame auf den Weg zur Wohnung des Herrn von Göchhausen.
Luise brachte ein paar Nachmittagstunden wie gewöhnlich bei der Herzogin zu. Beide waren so lebhaft, so heiter, verstanden sich so gut, daß die Zeit ihres Zusammenseins ihnen stets rasch und genußreich verstrich.
Als die Göchhausen schon im Fortgehen war, rief die Herzogin sie noch einmal zurück und sagte: »Der alte Laßberg ist kreuzunglücklich, daß ich Sie und nicht sein langweiliges Gänschen Tochter zur Gefährtin erkoren habe. Ich möchte nun wirklich dem alten Brummbären eine Avance machen. Sein Grimm ist doch durch mich hervorgerufen; und paßt mir das blasse Kind auch nicht, so tut es mir nun doch leid, wenn die Kleine jetzt totaliter ins Haus gebannt wird. Natürlich ist er wütend auf Sie, aber fressen kann er Sie nicht, und so wär's bei Licht betrachtet gar keine so arge Betise, wenn Sie nächster Tage mal hingingen, ihn von mir grüßten und in Ihrer heiter verständigen Weise ein bißchen zurechtsetzten. Das brächte gewiß seinen in die Brüche gegangenen Humor wieder in Ordnung, vielleicht besser als ein Kabinettschreiben meines Sohnes.«
»Natürlich werde ich mich in die Höhle des alten Bären wagen, wenn Euer Durchlaucht es befehlen – aber – na, eine erfreuliche Aussicht ist's gerade nicht!«
»So nehmen Sie's als gutes Werk.«
Nach diesen Worten verabschiedete die Herzogin ihre kleine Hofdame mit einem: »Auf Wiedersehen heute abend.«
Luise von Göchhausen traf ihre getreue Alte in dem behaglich durchwärmten Gastzimmer des Oheims, mit allen Erfordernissen zur Toilette ihrer harrend, und überlieferte sich, nachdem sie zuvor eilig dem Onkel, die Hand geküßt hatte, der kunstgerechten Behandlung ihrer Zofe.
Zur festgesetzten Zeit standen Oheim und Nichte festlich gekleidet im Zimmer des alten Herrn.
»Wie findest du mich, Luise?« fragte er, indem er sich selbstgefällig von oben herunter beäugelte.
Er stellte einen Malteserritter in Gala vor; über weißen Seidenschuhen mit roten Hacken trug er weiße seidene Strümpfe und ein ebensolches Beinkleid; ein Wams von schwarzem Samt mit Kette und Kreuz und ein großer weißer Mantel mit dem achtspitzigen roten Ordenskreuz, ein Barett mit wallenden Federn,vervollständigten die kostbare Tracht. Etwas komisch sah allerdings die kleine magere Gestalt des alten Männleins und das rötliche Gesicht mit den vorstehenden wasserblauen Augen in diesem Pomp aus.
Luise versicherte ihm jedoch, daß er seinem Namen und seiner Stellung alle Ehre mache, was ihn sehr zu freuen schien.
Gleich darauf meldete Rohrmann die Ankunft der Hofportechaise.
»Bitte, benutzen Sie dieselbe zuerst, lieber Onkel,« sagte die Nichte artig, »Ehre, dem Ehre gebührt!«
» Bon enfant!« rief der Alte, »ich habe auch wenig Gout für dies Warten, es regt meine Nerven auf!«
Rohrmann legte noch einen Pelzmantel über den dünnen, weißwollenen des Maltesers; er winkte seiner Nichte einen Kuß zu und verließ das Zimmer.
Unten hatte Ursula diensteifrig die kurze Strecke des Straßenpflasters mit etlichen Strohmatten belegt. Jetzt hielt, sie einen mächtigen Regenschirm über das federnickende Haupt ihres Gebieters, so wurde er von den beiden alten Dienstboten in die Sänfte gepackt. Es rann von den Dächern; auf der Erde standen dunkle Wasserpfützen, in denen sich das schwache Licht der über den Straßen an Stricken baumelnden Öllaternen spiegelte, ein hohler Wind fuhr um die Ecken, aber in der kleinen Stadt herrschte, aus Anlaß der Redoute, ein lebhafteres Treiben als sonst.
Die Portechaise schwankte jetzt in gewohnter Weise davon, und Rohrmann kehrte mit Ursula, stolz auf den vornehmen und vornehm beförderten Gebieter, ins Haus zurück. Bald darauf kam auch die Mietsportechaise und brachte Luise als Flämmchen glücklich auf die Maskerade.
Das Fest war schon im besten Gange, als sie anlangte. Alle möglichen und unmöglichen Zeiten und Nationen hatten ihre Vertreter und Vertreterinnen geschickt. Fast alle waren in einer ganz bestimmten Charaktermaske erschienen, viele sehr unkenntlich und vermummt, andere in vorteilhaftem Putz und nur mit kleiner Flormaske versehen. Es war auch üblich, sich in zurückliegenden Zimmern, wo Dominos, Masken und Kostüme zu haben waren, im Laufe des Abends umzukleiden und so ganz unerwartet wieder zu erscheinen, die Bekannten zu necken und allerlei Scherze ins Werk zu setzen. Dies alles wurde mit der größten Wichtigkeit, ja einem wahren Feuereifer betrieben.
Die Musik schmetterte ihre lauten Fanfaren durch den Saal. In der Mitte stand, wie üblich, der Hoftanzmeister Aulhorn und dirigierte die Tänze. Um ihn her im Hauptsaal wogte das bunteste Treiben, aber auch in den zur Seite liegenden kleinen Zimmern sah man viele Masken verkehren. In einem derselben stand ein Pharaotisch, an dem es lebhaft zuging.
Luise von Göchhausen suchte mit ihren scharfen Augen nach dem Herzoge; sie brannte darauf, sich ihm vorzuführen und ihn mit dem Verlust seiner Wette zu necken. Endlich gewahrte sie einen germanischen Häuptling mit dem Bärenfell auf der Schulter, geschnürten Sandalen und einem hohen Helm mit Adlerfittichen. Es war eine sehr stattliche Maske und obwohl dieselbe eine das Gesicht völlig deckende Larve mit langem Bart und großer Nase trug, glaubte Luise doch den Herzog zu erkennen. Der Germane unterhielt sich angelegentlich mit einer schönen maurischen Fürstin, die, nur wenig maskiert, sehr kenntlich als Milli von Werthern war.
Sie drängte sich an ihn heran, haschte nach seiner Hand und schrieb seinen Namen hinein. Sowie er ihrer ansichtig wurde, geriet er in Erstaunen, vergaß seine Verpuppung und rief mit einem deutlich unter der Maske hervortönenden Gelächter: »Ei der Teufel, da ist sie ja wirklich! Diese dummen Kerls, und ich hatte sie doch so genau instruiert!«
»Vermutlich dero Banditen, denen ich mit meinem Flämmchen nach Hause geleuchtet habe!« sagte sie spöttisch knicksend. »Gestatte also, wilder Krieger!«
»Armin, direkt aus dem Teutoburger Walde,« schaltete er ein.
»Nun denn, Armin, Fürst der Cherusker, gestatte, daß ich armes Flämmchen neben dir weiter brenne.«
»Aber wie, in aller Kobolde Namen, hast du vortrefflichstes Feuerzeug, meine wohldressierten Sänftenträger ihrer Pflicht, ihrem schuldigen Gehorsam abwendig gemacht?«
»Deine Palantinbeförderer, o edler Germane?« fragte sie erstaunt.
»Nun ja, die Hofportechaisenleute.«
»Himmel! Haben Durchlaucht denen arge Aufträge für mich gegeben?« rief sie mit plötzlichem Erschrecken, indem sie sich angstvoll suchend nach ihrem Onkel, dem eleganten Malteser, umschaute.
»Still hier mit deinen Titeln, Flamme, halt Maskenordnung; aber komm in ein Nebenzimmer, es scheint etwas quer gegangen zu sein, was wir aufklären müssen.«
Sie drängten sich zusammen aus dem Gewühl. In einem Winkel angekommen, sagte er: »Ist nicht, nachdem ihr zehn Schritte im Gange wäret, dein Sitz zusammengebrochen, der Portechaiseboden herausgefallen, haben sich darauf deine Träger nicht in Trab gesetzt, dadurch dich genötigt, mit durch den Dreck zu laufen, und dich, bei festgeschlossener Tür, trotz alle deinem Geschrei, in den Portechaisenstall getragen, den sie hinter dir verriegelten?«
»Alles dies Schreckliche muß meinem armen Onkel, dem Oberkämmerer von Göchhausen, geschehen sein!« rief Luise, indem sie ihre Hände halb lachend, halb weinend zusammenschlug.
»Den Kuckuck auch, das wäre arg! Den also haben sie beim Wickel genommen, der kam in der Hofportechaise?«
»Ja, Durchlaucht, er, und ich bitte dringend, ihm so schnell wie möglich Hilfe zu senden!«
Der Herzog eilte fort, und Luise ging mit beschwertem Gewissen, obwohl sie sich unschuldig fühlte, die Herzogin-Mutter aufzusuchen.
Sowie der Herzog vorhin die schöne Maurin verlassen hatte, war ein anderer Mann zu ihr herangetreten und hatte sie um den Tanz gebeten. Es war ein Beduine, mit weißem Mantel, Waffen im breiten Seidengürtel und bräunlicher Maske.
»Wir sind Landsleute, schöne Zoraide,« flüsterte er mit innigem Ton. »Wohnst du auch jetzt in der Alhambra, stammst du doch aus den heißen Gefilden Afrikas so wie ich, der Wüste Sohn. Welch ein Glück, dich plötzlich im fernen Norden zu finden!«
Bei diesen Worten legte er seinen Arm um ihre feine Taille, zog sie fest an sich und flog mit ihr in den Reihen der Tänzer dahin.
Goethe hatte sich in der Tracht eines Eremiten möglichst unkenntlich gemacht; sein eigentliches Kostüm war das eines Troubadours; jetzt floß ein weißer Bart von einer runzelvollen Maske herab und die Kapuze seiner dunkeln Kutte deckte ihm die braunen Locken. Er wußte, daß Frau von Stein als Ritterfrau kommen werde, er wollte sie, die ihn auch als Troubadour vermutete, necken und ihr dann ein zärtliches Gedicht geben, das er in der Nachmittagstunde für sie hingeworfen hatte. Jetzt spähte er mit prüfenden Blicken nach ihr aus.
»Suchst du mich, würdiger Vater?« lispelte plötzlich eine sanfte Stimme an seinem Ohre, und ein runder Frauenarm schob sich in den seinen.
»Also hast du mich doch erkannt, Geliebteste?« entgegnete er.
»Wie sollte ich nicht?« fragte die Ritterfrau dagegen und ging an seinem Arme mit ihm weiter.
Es beglückte ihn, daß die Teure ihn unter der Hülle herausgefunden hatte, daß sie ihm die Gunst schenkte, sich zu ihm zu gesellen. Er sprach zu ihr von der Sympathie ihrer Seelen; von der Seligkeit, sich im Schwarm der großen Menge abzusondern, hier sich verständnisvoll nah zu fühlen, unter der Maske unbeobachtet zu sein.
»Mein Herz ist doch immer bei Ihnen, Liebe, Einzige, die mich glücklich macht, ohne mir weh zu tun,« sagte er zärtlich. »Doch – auch nicht ohne Schmerz lebt sich's in deiner Nähe, denn du leidest nicht immer meine Liebe, und meine ganze Seele ist doch voll von dir. Sieh, diese Zeilen schrieb ich dein gedenkend.«
»Gib!« lispelte seine Gefährtin. Er steckte ihr ein Papier zu, welches sie in ihrer an einer Kette herabhängenden Tasche barg.
Er fuhr fort: »Die Liebe zu dir hält mich über dem Wasser, elend wär' ich als Hofmann! Mich wundert, daß nicht die meisten gar Kröten und Basilisken werden; das Gekriech, die Liebedienerei hört nicht auf. Oft denke ich, auch der Schmutz ist glänzend, wenn die Sonne darauf scheint, und nehme alles hin; ich seh's aber als Vorbereitung an, und nur durch dich bin ich gestählt und dauere aus.«
Indem er so mit ernster Empfindung zu seiner Begleiterin redete, erstarrte er plötzlich. Er gewahrte die Herzogin Luise, die als Bestalin prächtig und edel in langen, goldgesäumten Gewändern dastand, ganz kenntlich, nur mit einer Florbrille. Und neben ihr eine Ritterfrau, ähnlich der, welche er am Arm führte, aber völlig bekannt für ihn nach Haltung und Formen. Auch sie trug nur eine kleine Halbmaske, so daß er den weichen, feingeschweiften Mund, das zarte und runde Kinn der angebeteten Frau ganz deutlich erkannte. Ja, sie war's, Charlotte von Stein!
Aber wem hatte er denn sein tiefstes Herz enthüllt, wer hatte sich an ihn gedrängt, sein Gedicht empfangen? Rasch wandte er sich zu seiner Dame, aber diese, ihn scharf beobachtend, hatte ihre Doppelgängerin erkannt, und leise, während er sich ganz ins Staunen versenkte, hatte sie ihren Arm aus dem seinigen gezogen und war im Gewühl verschwunden.
Er suchte ihr nachzueilen, aber das Gedränge war augenblicklich zu groß, des Tanzmeisters Kommando hemmte ihn, neu antanzende Paare kamen ihm entgegen. Einmal glaubte er noch ihr schwarzes Samtmützchen in der Ferne zu sehen. Dann hieß es: »Nicht so stürmisch, heiliger Mann!«
»Was führt dich aus deiner stillen Klause unter die fröhliche Menge?«
»Hüte dich, in die Fallstricke der Welt zu fallen und den jungen Schönen nachzulaufen!«
Als er sich endlich am Ausgang des Saals befand, als er die Freiheit fand, sich in den Nebenzimmern umzusehen, war die Gesuchte nirgends zu finden.
Verdrossen und nicht mehr aufgelegt, den beabsichtigten Scherz mit der Geliebten auszuführen, ging er sich umzukleiden und fand sich in dem schönen Kostüm eines Troubadours in geschlitzter Seide, mit zurückgeschlagenem Spitzenkragen und dem am kirschroten Bande umgehängten Saitenspiel bald wieder im Saale ein.
Die Gesuchte stand noch immer neben der herrlichen Bestalin.
Er flüsterte Frau von Stein zu, daß er ein Ausgeraubter, ein Betrogener sei, er bat sie, ihn lind zu behandeln, damit er sich, innerlich verwundet, an ihrer heilenden Nähe wiederherstellen könne.
»Armer Bertrand de Born!« sagte sie laut, »also unter die Räuber seid Ihr gefallen? Nun tröstet Euch mit der Lehre, daß wir Kleinode nicht in dieser bunten und gefährlichen Welt offen vorzeigen dürfen.«
In diesem Augenblicke, während die Instrumente zu einem neuen Kontertanz gestimmt wurden, kam ein Bauer mit einer pausbackigen ganzen Larve vor dem Gesichte auf die Herzogin Luise zu und forderte sie zum Tanzen auf.
Die hohe Frau dankte und sagte auf das Andrängen des Fremden: »Ich tanze mit keinem Unbekannten.«
»O, erhabene Römerin,« rief der Mann mit fremdlautender Fistelstimme, »weshalb kommst du denn auf das Fest der Gleichheit, der Narrheit, der Lustigkeit, wenn du von alledem nichts wissen willst?«
»Ich komme als Zuschauerin, lästiger Fremdling,« entgegnete sie hoheitsvoll.
»Du wirst dem Leben und das Leben wird dir gleichgültig bleiben, wenn du nur von fern zu stehen wagst. Noch einmal bitte ich dich, sündige nicht gegen die Gesetze dieses Festes! Genieße diese seltsame Welt wie sie ist und wirf dich mit mir in den Strudel!«
»Nein; geh, Zudringlicher!«
»Hochmütiges Weib!« sagte jetzt der Bauer mit gereizter, nicht mehr verstellter Stimme und lüftete für einen Augenblick die Maske; – es war der Herzog.
»Dacht' ich es doch,« fuhr er ärgerlich fort, »als ich dich so steif hier angenagelt sah, daß du unsere Fröhlichkeit, unsere Späße, unter deiner Würde findest!«
»Mein Gemahl sollte zufrieden mit mir sein, daß wenigstens ich es weiß, was man seiner Stellung schuldig ist!« rief die Herzogin ebenfalls in bitterem Tone.
»Ho, ho! also ich weiß es nicht? Höre meinen Grundsatz: nur der hält ängstlich die äußere Form der Würde fest, der sie nicht wirklich behaupten kann!«
Goethe hörte mit Bedauern diesen Wortwechsel; rasch legte er seine Mandoline zur Seite, trat zur Herzogin heran und bat sie, ihrem Gemahl zu beweisen, daß sie auch mit den Fröhlichen genießen könne, indem sie mit ihm tanze. Zögernd folgte sie seiner Aufforderung, worauf der Bauer mit der Ritterfrau sich anschloß.
Nicht fern davon hielt sich ein zierliches, jugendliches Schäferpaar halb umschlungen, zärtlich flüsternd aneinander gelehnt, man wurde an eine Gruppe aus dem feinsten Meißner Porzellan erinnert, wenn man diese beiden ansah.
»Welch ein köstlicher Abend, Karolinchen!« sagte der schlanke Jüngling mit dem blaubebänderten Schäferstabe. »Niemand beobachtet uns, unter der Maske ist man so sicher und geborgen; ich wollte, wir könnten unser Leben in Tiefurt als Schäfer und Schäferin hinbringen.« Es war der Prinz Konstantin, der diesen Gedanken seiner Tänzerin, Karoline von Ilten, zuflüsterte.
Ein ähnlicher Wunsch wuche nicht weit davon in einem ernsten Mannesherzen rege.
Zu einer hübschen Bäuerin, mit rotem Rock und schwarzer Schleifenmütze, die einen Korb voll ausgeblasener Eier mit Zuckerwerk gefüllt am Arme trug, neigte sich ein großer, etwas steifer Ritter herab.
»Irre ich nicht, so möchte ich ein L. R. in Ihre Hand schreiben, liebenswürdige Sängerin?«
Sie nickte und flüsterte fragend: »Herr von Knebel?«
»Ja, der, welcher Sie um Ihre ländliche Heimat, Ihren Bauernhof, Ihre gefiederten Sangesgenossen beneidet. Tanzen Sie mit mir, liebe Freundin?«
Und dahin eilten auch diese zwei, mit einer aufknospenden Sympathie in den sehnenden Herzen.
Als Goethe die Herzogin wieder an ihren Platz zurückführte, schritt eine kokett gekleidete französische Bäuerin mit hoher, weißer Flügelhaube und bauschigem geblümtem Kleide, am Arm eines eleganten Coeur- Königs, in dem man unschwer Herrn von Seckendorf erkannte, an ihm vorüber.
Sich auf ihrem hohen Absatz wendend, sah sie sich nach ihm um und flüsterte die ersten Reihen seines im Irrtum verschenkten Gedichts mit spöttischem Ton ihm zu:
»Sag', was will das Schicksal uns bereiten?
Sag', wie band es uns so ganz genau?
Ach, du warst in abgelebten Zeiten
Meine Schwester oder meine Frau!«
Erregt sprang er ihr nach; mit einer ihm wohlbekannten Gebärde warf sie ihm eine Kußhand zu und flog mit ihrem Kavalier in der Tanzkolonne davon. Es war Auguste von Kalb!
Neben dem Herzog aber stand jetzt das Flämmchen.
»Hoher Herr!« sagte es lustig, »wie du dich auch verstecken magst,' mein Spürsinn findet dich heraus. Beruhige mich, haben die Schergen deines Zorns das unschuldige Opfer aus dem Portechaisenstall erlöst?«
»Sei getrost, edelmütige Flamme, das Opfer liegt in seinem Bett und trinkt Kamillentee, um sich von seinem Abenteuer zu erholen.«
»Und mein Titel, der Gewinn meiner Wette?«
»Wahrlich, du hast dich an Edelmut dem Armin ebenbürtig bewiesen, so heiße also von heute an – Thusnelda!«
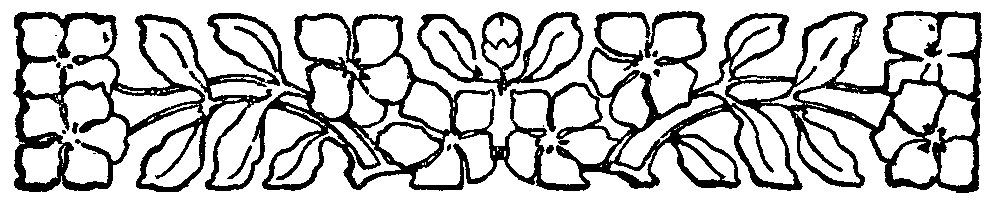
Glücklich, den ein leerer Traum beschäftigt,
Glücklich, dem die Ahnung eitel wär',
Jede Gegenwart und jeder Blick bekräftigt
Traum und Ahnung leider uns noch mehr.
Sag', was will das Schicksal uns bereiten?
Sag', wie band es uns so ganz genau?
Ach, du warst in abgelebten Zeiten
Meine Schwester oder meine Frau.
Kanntest jeden Zug in meinem Wesen,
Spähtest, wie die reinste Nerve klingt,
Konntest mich mit einem Blicke lesen,
Den so schwer ein sterblich Aug' durchdringt.
Tropftest Mäßigung dem heißen Blute,
Richtetest den wilden, irren Lauf,
Und in deinen Engelsarmen ruhte
Die zerstörte Brust sich wieder auf;
Hieltest zauberleicht ihn angebunden
Und vergaukeltest ihm manchen Tag;
Welche Seligkeit glich jenen Wonnestunden,
Da er dankbar dir zu Füßen lag!
Fühlt' sein Herz an deinem Herzen schwellen,
Fühlte sich in deinem Auge gut.
Alle seine Sinne sich erhellen
Und beruhigen sein brausend Blut!
Und von allem dem schwebt ein Erinnern
Nur noch um das ungewisse Herz,
Fühlt die alte Wahrheit ewig gleich im Innern,
Und der neue Zustand wird ihm Schmerz.
Und wir scheinen uns nur halb beseelet,
Dämmernd ist um uns der hellste Tag.
Glücklich, daß das Schicksal, das uns quälet,
Uns doch nicht verändern mag!
Goethe.
Januar 1776.
Es hat eine schwere Zeit auf unserem Hause gelastet. Vater war düsterer und bitterer als jemals vorher; nach dem unglücklichen Ballabend ist er tagelang nicht aus seinem Zimmer gegangen. Tante Barbara mußte ihm das Essen in die Vorstube setzen, und zum Dienst meldete er sich krank. Als dann gegen Weihnachten mein Bruder sich mit dem Vetter Wrangel ansagte, und beide jungen Männer aus ihrer kursächsischen Garnison herüberkamen, konnte er nicht wohl umhin, wieder am Familientische zu erscheinen, er tat's, und ich glaube, er ist seitdem weniger finster.
Gustchen war viel bei uns und vergnügte sich mit den beiden Offizieren, die sie auch hinauszulocken wußte: damit sie ein paar willfährige Tänzer mehr habe, wie sie mit kecker Zuversicht eingestand.
Ich bin so recht versunken, ohne Saft und Kraft und viel gescholten. Alle zerren und necken an mir, ich aber kann's nicht ändern, ich muß still im Schatten weiterträumen. Sie halten mich aber doch für abwesender, als ich bin. Dicht daneben saß ich, als Erich Wrangel zu meinem Bruder sagte: »Es gefällt mir gerade an ihr, daß sie so rührend einfältig ist, wie ein junges, weißes Täubchen, dem man den Hals umdreht, ohne daß es Arges merkt.«
Mein Bruder lachte, verteidigte mich; es war mir aber zu gleichgültig, um darauf zu achten.
Ja, für ihre Sprache bin ich dumm, und von der meinen wissen sie nichts; die versteht nur er, mein hoher, erhabener Dichter.
Daß er fort ist aus meiner Nähe, daß ich ihn nicht sehe, nicht höre, das ist's, was mich lahm, träumend und dumm macht! Er zog in die Belvedereallee, und so ist meine Sonne untergegangen.
Mir ist, als sitze ich allein abseits auf einem Rasenhügel; still wartend schling' ich die Hände um meine Kniee und sehe die breite, staubige Straße hinab. Wie farblose Spreu wirbelt die Menge an mir vorüber. Wie sie sich jagen, überstürzen, in lustigem Rundtanz anhalten, auseinander fliegen und der Losung folgen, die mit Windesbrausen: vorbei! vorbei! ruft.
Dann kommt er; hochaufgerichtet schreitet er durch das farblose Gesindel, sehnend breitet er die Arme der Morgenröte entgegen! Wird er anhalten, mich bemerken, schützend die Hand auf meinen Scheitel legen? Mich heraufziehen an sein Herz? Zitternd folgen meine Blicke seiner Gestalt.
Jetzt wendet er sich dem bunten Haufen zu, winkt einem Schemen, dann dem anderen; die reißen ihn hinein in ihre Kreise, Staub legt sich auf sein strahlendes Kleid, wilde Lust jagt ihn mit den anderen dahin, dorthin; bald sehe ich ihn mir näher, bald ferner.
Wird er mich nicht erkennen als von seiner Art? frag' ich mich stammelnd mit brechendem Herzen. Wird er mir nicht einen Blick der Güte schenken? Immer sehnender, immer ängstlicher harre ich – da wird auch er vorbeigewirbelt, vorbei! Und für mich, die ich zusammenbreche, alles hin, alles verloren!
Im Februar
Gustchen muß doch die Heirat nicht wollen; neulich zuckte sie die Achseln, als von ihm die Rede war, und sagte: »Er wird langweilig!« – Er! das ist zum Lachen. Er langweilig; lieber Himmel, ich glaube, Auguste verliert den Verstand! Sie machte sich auch viel mit dem Vetter zu schaffen, und als sie hörte, daß er ein großes Majorat zu erwarten habe, sagte sie: »Schatz, sei brav und tritt ihn mir ab, ich sehe, sie wollen ihn mit dir Zusammentun, aber Gräfin, reiche Gräfin sein, paßt besser für mich als für dich; du träumst ja doch dein Leben hin!«
Ich entgegnete ihr, daß sie meinetwegen alle Grafen der Welt heiraten könne, daß ich aber weder für mich noch für sie über den Vetter Erich verfüge.
»Bist du doch vielleicht in den hübschen, blonden Jungen verliebt?« fragte sie lauernd; aber ihr prüfender Blick fand mich kalt wie Eis. Nun sind die beiden längst fort, und Auguste kommt seltener.
Am 14. Februar
Heute ist hier im Hause etwas Wunderbares geschehen. Das Hoffräulein der Frau Herzogin-Mutter ist hier gewesen, und hat es erreicht, mit Vater zu sprechen. Er hörte höflich zu, und ich weiß doch, daß er innerlich gegen die Göchhausen gewütet hat. Die kleine Dame fing es sehr geschickt an, ihn zu versöhnen. Nachdem sie viel Artiges von Ihrer Durchlaucht ausgerichtet, sprach sie so gütig über mich, daß ich ganz beschämt wurde. Endlich kam sie auf den unglücklichen Ballabend, an welchem ich vorgestellt wurde, und mit voller Unbefangenheit sagte sie: »Wenn der Herr Oberst seine Husaren dem Landesherrn in der Manege vorführt, so denke ich, sie müssen etwas reiten können?« – »Den Stock auf die Kerls, wenn sie's nicht können,« brummte mein Vater.
»Ebenso erwartet die Frau Herzogin, daß ein junges Fräulein, welches ihr auf einem Ball vorgeführt wird, etwas tanzen kann.«
»Ah, war es das?« fragte er aufatmend.
Sie wurden nun sehr bald einig, daß ich bei dem Hoftanzmeister Unterricht haben müsse.
Fräulein von Göchhausen empfahl sich; sie reichte meinem Vater die Hand zum Kuß hinauf, und er neigte wirklich seinen grauen Schnurrbart darüber. Hätte das nie gedacht!
Tante Barbara lächelte mich selig an; es war, als hätte uns das kleine Fräulein die liebe Sonne im Pompadour ins Haus getragen.
Und ich? O, wie bin ich glücklich, daß ich nun doch zu ihm, in den Kreis, in dem er Leitstern und Herrscher ist, eintreten darf!
Am 16. Februar.
Der Hoftanzmeister Adam Aulhorn ist hier gewesen. Welch ein redseliges, behendes Männlein! Er wäre mir zuwider, wenn er mir nicht zu so Großem verhelfen sollte. Wie verlegen und linkisch fühlte ich mich, als er mich ein paar Versuche machen ließ! Er aber sagte, ich sei biegsam wie ein Schilfrohr, das im Winde schaukelt, und zierlich wie eine Libelle, die über den Wellen dahin schwebt. Vater schien zu lächeln, und die gute Barbara schlug außer sich vor Freude in die Hände.
Am 17. Februar.
Nun ist's aus; nun ist alles aus! Wie ein Aschenregen sinkt düstere Trauer über das Leben; kein Mund darf mehr lächeln, kein Herz mehr freudig klopfen. Wenn die Sonne scheint, ist's ein Irrtum; nur bleigraues Licht, vom Himmel herabrinnende Tränen sind das Rechte.
Der Edelste, Herrlichste, den Gott in diese Zeit gestellt hat, er ist dem Verderben verfallen!
Ja, so ist es, es kann nicht anders sein! Dies kann Gustchen nicht gelogen haben, sie hat es mir von seiner Hand geschrieben gezeigt. Er hat alles in ahnender Seele vorausgewußt, im Werther geschildert; jetzt wird sein prophetisch Vorempfinden zur schrecklichen Wahrheit an ihm selbst! O könnte ich mich in seinen Weg werfen, könnte ihn anflehen, umzukehren, oder könnte ich ein Sühnopfer für ihn sein! Ich kann nicht mehr zweifeln; ja, er liebt wie Werther – das Weib, die Gattin eines anderen!
Da steht es, das Furchtbare, das Unrecht, das Unglück, und sieht mich gespenstig an. Wolfgang Goethe weiß, wie das endet; und so wird er's durchzulesen haben und mit dem Pistol in der Hand sterben, wie sein Seelenbruder, sein Vorgänger.
O, eingeweiht sein in das, was kommen muß, und der Stunde harren, in der jener Schuß fällt, der meine Welt zusammenreißt, der mein armes Denken vernichtet, das ist eine Qual, bei der mir schon heute der Atem auszugehen droht.
Wie war er nur; was sagte sie; wie ertrug ich Gustchens Bericht?
Auguste hat mir ein Abenteuer mit ihm auf der Maskerade erzählt. Goethe machte ihr eine glühende Liebeserklärung, aber er hielt sie für eine andere, für – die Frau des Oberstallmeisters, die er anbetet.
O, mir ahnte das längst! Ich schrie auf, als Auguste dies Schreckliche aussprach. Es ward dunkel vor meinen Augen, ich sank im Stuhl zurück. Auguste beachtete das nicht, sie plauderte weiter; lange Zeit hörte ich nichts von dem, was sie sagte; endlich konnte ich wieder begreifen.
Sie berichtete, wie sie den Abtrünnigen schlecht behandle; wie sie nichts von ihm wissen wolle; daß jetzt der gewandte Kammerherr Siegmund von Seckendorf ihr huldige, ihr nicht ganz gleichgültig sei, daß sie aber sehen wolle, welche Position er am Hofe finde, ehe sie ihm Hoffnung auf ihre Hand gebe.
Endlich stammelte ich: ob sie mir das Papier zeigen könne, auf dem seine Liebeserklärung für die andere stehe.
Sie zog es sogleich hervor.
»Das führe ich als Waffe gegen ihn bei mir!« sagte sie schadenfroh. »Damit will ich ihm noch oft die Hölle heiß machen.«
»Gib!« bat ich.
Sie reichte es mir; ich raffte mich mit ganzer Kraft zusammen; ich las und versuchte zu begreifen. Ja, er beschrieb seine Glut, seine Zärtlichkeit.
Gustchen lachte höhnisch; sie wagte es, über ihn zu lachen! Das sollte sie nicht! Verzweiflung erfaßte mich, ich mußte ihn vor dem Hohn dieses Mädchens schützen – und zerriß, ehe sie es hindern konnte, das Papier in kleine Fetzen.
Gustchen schrie gellend auf und überhäufte mich mit Vorwürfen.
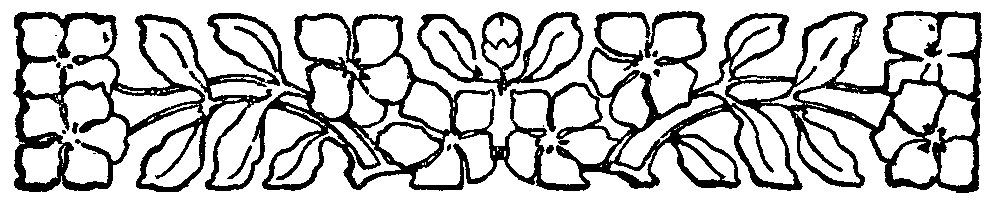
Ihr Freunde, Platz! Weicht einen kleinen Schritt!
Seht, wer da kommt und näher tritt.
Sie ist es selbst; die Holde fehlt uns nie;
Wir sind erhört, die Musen senden sie.
Ihr kennt sie wohl; sie ist's, die stets gefällt;
Als eine Blume zeigt sie sich der Welt:
Zum Muster wuchs das schöne Bild empor,
Vollendet nun, sie ist's und stellt es vor.
Es gönnten ihr die Musen jede Gunst
Und die Natur erschuf in ihr die Kunst.
So häuft sie willig jeden Reiz auf sich,
Und selbst dein Name ziert – Korona – dich.
Sie tritt herbei. Seht sie gefällig stehn!
Nur absichtslos, doch wie mit Absicht schön.
Und hocherfreut seht ihr in ihr vereint
Ein Ideal, das Künstlern nur erscheint.
Goethe.
Goethe schickte sich an, nach Leipzig zu fahren. Acht Jahre lagen zwischen der Zeit, da er, ein unreifer Jüngling, krank und mutlos dort seine Studien beschlossen hatte und zu seiner Wiederherstellung in das elterliche Haus nach Frankfurt heimgekehrt war. Unter den zahlreichen Erinnerungen an Leipziger Bekanntschaften blieb vor allem ein anmutiges Mädchenbild in seinem Gedächtnis bewahrt. Damals war die von ihm in anonymen Gedichten Gefeierte kaum dem Kindesalter entwachsen, aber als Künstlerin bereits angestaunt und angebetet. Jetzt war sie aus der holden Knospe zur vollentwickelten Blüte, aus der vielversprechenden Anfängerin zur Meisterin in der Kunst des Gesangs empor gewachsen. Goethe freute sich darauf, sie wiederzusehen, und suchte sich, während er nach Leipzig fuhr, Koronas liebes Bild zurückzurufen; hoffte er doch, sie für den schönen Kreis in Weimar zu gewinnen.
In den oberen Räumen des stillen, von einem weiten Stadtpark umgebenen Häuschens des Leipziger Kunstgärtners Probst hatte die Konzertsängerin, Korona Schröter, damals ihr zurückgezogenes Heim gegründet.
Schon nahte der Frühling, aber kahl schauten noch die Bäume des Parks in die Fenster.
Die Sängerin saß am Klavier, sie hielt die Stirn mit der Hand bedeckt und war in Träumerei versunken. Endlich fanden sich ihre Finger auf den Tasten, leise irrten sie darüber hin, bildeten eine sanfte, traurige Melodie und gingen dann in ein Gebet aus Hasses Oratorium Elena al Calvario über. Jetzt begann sie auch zu singen, und mit immer größerer Macht und Innigkeit klang ein Flehen um Erlösung aus den Banden schweren Leids von den jungen schönen Lippen.
Während dieses ergreifenden Liedes öffnete sich leise die Stubentür, und ein rundes Mädchengesicht, von blondem Haar umrahmt, schaute mit freundlichem Ausdruck herein. Als die Sängerin geendet hatte, eilte die Lauscherin auf ihre Freundin zu. Es war Wilhelmine Probst, die Tochter des Kunstgärtners.
»Reichardt war ja nur kurze Zeit bei dir,« sagte sie neugierig, »er rannte unten im Flur wie toll an mir vorbei, habt ihr euch gezankt?«
»Es ist die alte Geschichte, Mienchen, er bat um Liebe, der arme Junge.«
»O Himmel, also doch! Wie bin ich froh, kein Mann zu sein und dich also innig lieben zu dürfen, so viel ich mag!« rief das dicke kleine Mädchen, die hohe Gestalt der Freundin umfassend.
»Ja freilich,« lächelte Korona und küßte sie auf die Stirn, »wärst du ein Jüngling, müßte ich dich von mir entfernen.«
»Wie alle,« seufzte die Kleine. »Arme Korona, gebunden und doch frei; schmerzlich gefesselt an einen Entsetzlichen und doch mit sehnendem Herzen allein gelassen!«
»Sei still, Mienchen, du weißt, es schmerzt mich, daran erinnert zu werden; wir dürfen nicht davon sprechen,« bat die Sängerin mit einem tiefen Seufzer.
In diesem Augenblicke hörten die Mädchen Schritte auf der Treppe, denen ein starkes Anpochen an die Tür folgte. Gleich darauf öffnete sich dieselbe und ein großer, schöner Mann erschien auf der Schwelle. Sein dunkles Auge durchflog den Raum, aber der Blick haftete, wahrend er sprach, über den Köpfen der erstaunten Mädchen im Leeren.
»Bist du die Sängerin Korona Schröter?« fragte er.
»Ich bin's,« entgegnete diese, dem Unbekannten, der sie duzte, erstaunt einen Schritt entgegentretend. »Was wollen Sie?«
Der Mann zog langsam eine schwarze Samtschleife aus seinem Busen und sagte: »Du weißt, von wem ich komme, entferne deine Gefährtin, damit ich dir die Worte unseres Meisters überbringe.«
Korona war erbleichend zurückgetreten.
»Wilhelmine – geh!« stammelte sie bittend.
»Wieder von ihm? Mut, Korona,« flüsterte die kleine Freundin und verließ das Zimmer.
»Was befiehlt er mir?« fragte jetzt die Sängerin bebend und legte die Hände auf ihre Brust.
»Er läßt dir sagen, daß eine Forderung an dich ergehen wird, Leipzig zu verlassen; daß er dir befiehlt, jener Forderung zu folgen.«
»Ich soll Leipzig verlassen! Wohin soll ich gehen?«
»Das wirst du zur rechten Zeit erfahren; mir liegt nur ob, dir seinen Befehl auszurichten, dir, demselben zu gehorchen.«
»Ist er hier? – Da er Sie schickt, wird er also nicht selbst zu mir kommen?«
»Wir haben nichts zu fragen, nichts zu antworten; Gehorsam ist unsere einzige Pflicht!«
Nach diesen Worten entfernte sich der Unbekannte und ließ Korona in einem Taumel von Bestürzung und Neugier zurück. Stärker denn je fühlte sie sich unter dem Druck eines fremden, sie gänzlich unterjochenden Willens.
Der Unbekannte hatte mit starken Schritten das Haus verlassen; er verfolgte die den Garten kreuzende Allee und erreichte einen an der Gartenmauer sich hinziehenden Gang. Als er sich in demselben umsah, kam ein großer, hagerer Mann auf ihn zu. Schwer konnte man sagen, ob der Fremde alt oder jung sei. Er trug schwarzen Samt, die feinsten Brüsseler Spitzen und bot in seiner vornehmen, ernsten Erscheinung das Bild eines Hofmannes.
»Hast du Korona gesehen?« fragte er den herankommenden Jüngeren.
»Ja, Herr Graf.«
»Und willfährig gefunden?«
»Durchaus. Ich staune deine Macht an, mein hoher Meister. Wie hast du nur dies stolze Weib gezähmt?«
Nach kurzer Pause entgegnete der Graf: »Herrschaft über andere erringt nur der, welcher sich zuerst selbst beherrscht. Aus der Überwindung meines sinnlichen Ichs ward ich ihr Herr. Aber ich werde dir noch bessere Beweise meiner Kraft geben. Deinem völligen Gehorsam sollen sich nach und nach beseligende Geheimnisse erschließen.«
Sie verließen in lebhaftem Gespräch miteinander den Garten. – –
Etwa zu derselben Morgenzeit, in der gestern der junge Komponist Reichardt zu der Angebeteten geeilt war, schritt heute Goethes elastische Gestalt durch die Kieswege des Ziergartens auf das Gärtnerhaus zu. Vielleicht war eine ähnliche Ungeduld in ihm, wie gestern in dem liebesehnenden Musiker.
Korona trat ihm in ihrer edlen Schönheit imponierend entgegen – und empfing denselben Eindruck von seiner Persönlichkeit. Als er seinen Namen nannte, flog ein warmes Rot über ihre bewegten Züge, und sie streckte ihm erfreut, wie einem alten Bekannten, beide Hände entgegen.
»So bin ich also nicht ganz vergessen?« fragte er mit leuchtendem Blick.
»Sie haben dafür gesorgt, daß man Sie nicht vergessen konnte, Sie herzerschütternder Poet! Wie haben Sie meine ganze Seele mit Ihrem Werther erfaßt! Und wie deutlich ist mir dabei das Bild des schlanken Studenten wieder lebendig geworden.«
Sie fragte, was ihn herführe, und er richtete ihr den Auftrag des Herzogs und Anna Amaliens aus, die, sich nach einer echten Künstlerin sehnend, beschlossen hätten, sie unter vorteilhaften Bedingungen für Konzerte und Komödien nach Weimar zu berufen.
Korona wechselte, während er sprach, in großer innerer Bewegung die Farbe. So hatte also doch ihr geheimnisvoller Gebieter vierundzwanzig Stunden früher gewußt, was ihr bereitet wurde! Sie erfuhr, daß Goethe gestern abend angekommen sei; sie bat ihn, sich zu besinnen, wann und wo er von seinem Vorhaben gesprochen habe. Er versicherte, dasselbe sei zwischen den Herrschaften und ihm ein Geheimnis geblieben, und fügte lachend hinzu, um ihren sichtlichen Ernst, der ihn seltsam berührte, zu zerstreuen: »Soll man dich nicht aufs schmählichste berauben, verbirg dein Gold, dein Weggehn, deinen Glauben!«
Er gedachte nicht seines Briefes an Lavater, dem er vor mehreren Wochen – entzückt von des Herzogs Absicht – geschrieben hatte, daß man die holde Künstlerin, welche er einst schwärmerisch verehrt, auf seinen Rat nach Weimar berufen wolle.
Ihr Benehmen bei seinem Vorschlage erschien ihm rätselhaft; sie beruhigte aber sein mißmutiges Erstaunen mit einer unbedingten Zusage. Er ging oft zu ihr und sie kamen bald überein, daß Korona im Herbst nach Weimar übersiedeln solle.
Als nach langem Geplauder an einem der nächsten Tage Goethe endlich Abschied nehmen mußte, sagte er: »Ich harre des Herbstes mit Sehnsucht, der mir in Ihnen die Freuden des Frühlings und Sommers bescheren soll; aber jetzt, da ich scheide, geben Sie mir ein kleines Andenken, ein Pfand, holde Freundin, welches mir Ihr Kommen verbürgt. Schenken Sie mir die Samtschleife, die Sie stets, während dieser beglückenden Zeit unseres Wiedersehens, getragen haben. Dieser Schmuck gefällt mir ohnehin nicht an Ihnen; er scheint mir ein Fleck auf Ihrem reinen Bilde.«
Er streckte die Hand nach der erbetenen Gabe aus, die ihm unbedeutend und nur in seinem Sinne wertvoll erschien.
Die Künstlerin aber erblaßte, trat zurück und legte die Rechte schützend über ihre schwarze Schleife. Mit bebender Stimme entgegnete sie: »Fordern Sie nicht dies Band, ich kann es Ihnen nicht geben! Eine fremde Hand darf es nie – niemals berühren.«