
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die unglückliche Entwicklung, welche die religiös-politischen Bewegungen in den Niederlanden und in Frankreich genommen hatten, war Maximilian eine Rechtfertigung für sein Verhalten und zugleich ein warnendes Exempel: konnten nicht auch die österreichischen Stände durch fortgesetzten Widerstand gegen ihre religiösen Forderungen, durch das Beispiel der Niederländer und Hugenotten gereizt, zum Aufstand getrieben werden? »Wenn eine Empörung erfolgte,« so äußerte er sich, wie der venezianische Gesandte berichtet, zum päpstlichen Nuntius, »wer würde dann Ordnung schaffen, oder mich verteidigen? Habe ich Streitkräfte wie die Spanier oder andere, um sie den Ständen entgegenzuwerfen? … Ich habe sechs Söhne und keine andere Erbschaft für sie als diese paar Erblande. Wenn diese zugrunde gerichtet würden, wovon sollten sie leben?«
Maximilian vertrat keineswegs den wahnwitzigen Standpunkt seines spanischen Vetters: »Ich möchte lieber alle meine Reiche verlieren, als Glaubensfreiheit gewähren.« Schwer verübelte er es den beiden Hauptmächten der Gegenreformation, Rom und Spanien, daß sie es mehr auf die Vernichtung der Ketzer, denn auf die des heidnischen Erbfeindes abgesehen hätten. Der Vizekanzler Zasius ließ sich in seiner derb-kräftigen Ausdrucksweise sehr abfällig über Papst Pius V. aus. Auf die Nachricht vom Ableben des Landgrafen Philipp von Hessen am 7. April 1567 schreibt er Herzog Albrecht: »Uns wäre viel lieber, der heilige jetzige Papst wäre gestorben, wenn seine überschwängliche, unaussprechliche und übermäßige, unerhörte Heiligkeit noch so groß; denn derselbe tut weniger denn nichts contra infideles, das doch wohl ein recht heiliges Werk wäre, und er erstatt dazu gar das nicht, was er gelobt und zugesagt … Wolle Gott, wir hätten noch unsern nächsten Pium.« Der Papst, so klagt er ein andermal, im November 1566, dem Herzog, erzeige sich gegen den Kaiser »übler als übel«, zahle keinen Heller an der von ihm bewilligten Türkenhilfe, sondern verwende das Geld zum Bau eines Inquisitionshauses. Die Gerüchte von einem »päpstlichen Bündnis« wollten seit der Thronbesteigung des unduldsamen Pius V. gar nicht mehr verstummen – sie bildeten den Herd fortwährender Beunruhigung und Gärung im Reiche. Zu einem großen Bunde der christlichen Fürsten zum Zwecke der Bekämpfung der Türken, den der Kaiser betrieb, hatte, wie er Dietrichstein am 28. September 1567 klagt, niemand Lust und Willen, sondern nur dazu, »unnötige Empörungen« anzurichten.
Und schon waren einzelne katholische Staaten mit Gewährung der Religionsfreiheit an die protestantischen Minderheiten vorangegangen: Frankreich durch den mit den Hugenotten abgeschlossenen Frieden von Amboise im Jahre 1563 und Polen, wo der politisch überaus gewandte König Siegmund II. August 1561 dem lutherischen Livland und zwei Jahre später auch dem Adel Litauens bedeutsame religiöse Zugeständnisse machte. Ende März 1568 war der im Gefolge des niederländischen Aufstandes ausgebrochene zweite Hugenottenkrieg durch den Frieden von Longjumeau beendet und die Religionsfreiheit neuerdings verkündet worden, und zwar, wie es scheint, nicht ohne wesentliche Einflußnahme des Kaisers und der Kurfürsten, einschließlich der geistlichen, die in Fulda sehr energisch gegen den Religionskrieg an der Reichsgrenze protestiert und dem französischen König ihre Vermittlung angeboten hatten. Dieser Schritt von Kaiser und Reich, der mithalf, die von den katholischen Mächten mit Bestimmtheit erwartete Vernichtung der hugenottischen Ketzer zu verhindern, verfehlte nicht, auf Rom und Spanien den denkbar ungünstigsten Eindruck zu machen. Allein Maximilian war eben jetzt fest entschlossen, sich seiner Haut zu wehren und den gefährlichen Brand in den Deutschland benachbarten Ländern mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu ersticken, um ein Überspringen des Funkens auf sein Reichsgebiet zu verhüten. Just damals war er aber auch auf Philipp II., der die Heiratsangelegenheit des Don Carlos beständig verschleppte, sehr schlecht zu sprechen.
So war denn ein günstiger Boden geschaffen, als die protestantischen Adelsstände Niederösterreichs, die seit dem Jahre 1526 ununterbrochen um die Zulassung des Evangeliums petitioniert hatten, kurz vor Eröffnung des Landtages von 1568, dem Kaiser neuerlich eine Bittschrift um Religionsfreiheit überreichten. Nach einer am 17. August abgehaltenen Vorbesprechung erfolgte am nächsten Tage die offizielle Mitteilung, daß Maximilian entschlossen sei, den Herren und Rittern den Gebrauch der Augsburger Konfession auf ihren Schlössern, Häusern und Gütern auf dem Lande für sich und ihre Untertanen zu gestatten.
Der kaiserliche Vizekanzler Doktor Zasius, der Verfasser der Religionskonzessionsurkunde, sorgte übrigens dafür, daß die Bäume nicht in den Himmel wüchsen: er suchte sich durch Zweideutigkeiten und Unklarheiten nach beiden Seiten hin zu decken und vor allem die Grenzen des Zugeständnisses so eng wie möglich zu ziehen. So wurden gleich die landesfürstlichen Städte und Märkte von der Begünstigung ausdrücklich ausgeschlossen, und dies galt gerade von Wien, dem Sitze des »Hoflagers«. Schon im Dezemberlandtag 1566 war es der Regierung gelungen, den »vierten« Stand von den »oberen« Ständen zu trennen, nachdem dessen Vertretern Zasius in einem »guten starken Latein« zu verstehen gegeben hatte, daß sie als Untertanen des kaiserlichen »Kammergutes« kein Recht besäßen, in Religionssachen mit den Herren und Rittern zusammen zu gehen.
Und außerdem wurde die Bewilligung an eine Bedingung geknüpft, die unter den gegebenen Verhältnissen, wie sich später herausstellen sollte, überhaupt nicht erfüllt werden konnte. Die protestantischen Prediger sollten nämlich hinsichtlich der kirchlichen Dogmen und Gebräuche an eine bestimmte Ordnung, über die man sich noch zu einigen hatte, gebunden werden. Diese Norm hätte nach der ursprünglichen Absicht des Monarchen in einer Konferenz von je sechs Delegierten der Regierung und der Stände beraten werden sollen. Noch immer klammerte er sich an die Hoffnung, später eine solche Form zu finden, die es den Protestanten ermöglicht hätte, im Schoße der allgemeinen Kirche zu verbleiben, und die Trennung zu verhüten. War ja doch in der Religionskonzession ausdrücklich betont worden, daß der Gedanke des Unionswerkes, der »Universalreligion«, keineswegs aufgegeben sei. Das Ganze war so eigentlich nur ein Provisorium.
Indes, die adligen Stände zeigten sich hochbefriedigt: sie sprachen dem Monarchen für das Geschenk vom 18. August »aus inbrünstigen Herzen« ihren »höchsten, demütigisten, untertänigsten« Dank aus. Weniger erfreut war man darüber im streng katholischen Lager. Hofrat Doktor Georg Eder, ausgesprochen jesuitisch gesinnt, zeigte die ihm überraschend gekommene Neuigkeit »mit ganz betrüeptem Herzen und weinenden Augen« dem kaiserlichen Hofprediger Eisengrein an, der sofort alle Hebel in Bewegung setzte, um zu retten, was noch zu retten war. »Ich lauff auch wol herumb« bei des Kaisers Geheimen Räten, berichtet er am 28. August dem Herzog Albrecht, »aber alles vergebens«. Er wolle mit dem Kaiser sprechen, obgleich es nichts helfen werde. Es gebe nur ein Mittel: während »sie mit Verglaichung der Cäremonien umgehen, das noch ein Zeit ervordern würdt, etwa Euer fürstliche Gnaden und Ertzherzog Ferdinand, oder vielleicht der König aus Hispania sampt päpstlicher Heiligkeit ein impedimentum darin machen; allhie ist gewißlich sonst niemant, der wehren kann«. Umgekehrt sucht auch der Kaiser dem »böswilligen Geschwätz schlecht Unterrichteter« zuvorzukommen und seine Konzession bei den maßgebenden Persönlichkeiten zu rechtfertigen. Seinem Bruder Ferdinand und seinen Gesandten in Madrid und in Rom schreibt er, er habe keinen anderen Ausweg gewußt, um noch größere Religionsspaltungen, das Einreißen der Sekten und einen Aufstand der Stände zu verhindern.
Papst Pius V., dem Graf Arco am 13. September die offizielle Mitteilung machte, war tief bewegt. Mit Tränen in den Augen klagte er, daß nunmehr die Religion zugrunde gehen und es in Österreich gerade so kommen werde, wie in den Niederlanden und in Frankreich. Arco erhielt den Auftrag, seinem kaiserlichen Herrn zu melden, daß der Heilige Vater mit dem größten Schmerz von seinem Zugeständnis Kunde erhalten habe und ihn beschwöre, dem begonnenen Werk Einhalt zu tun. Man sprach bereits von der Abberufung des Nuntius am Kaiserhofe. Dies geschah wohl nicht, aber der Papst sandte seinen gewiegtesten Diplomaten, den mit den deutschen Verhältnissen wohlvertrauten Kardinal Commendone, nach Wien, damit er, wenn die Konzession noch nicht erteilt sei, alles in Bewegung setze, um sie zu vereiteln, im anderen Fall aber ihre Zurücknahme zu erwirken. Der Kardinal erhielt auf der Reise, in Innsbruck, die Aufforderung von Seiten Maximilians, sich nicht weiter zu bemühen, sondern umzukehren; er setzte sie trotzdem fort und langte am 28. Oktober am Kaiserhofe an. »Ist uns fürwahr schlechtlich willkommen gewest«, so bemerkte kurz der Vizekanzler Zasius.
Die Besorgnis des Propstes Eisengrein, man werde dem Kardinal, wenngleich er als ein »geschwinder, listiger Vogel« galt, »mit guten Worten eine Nase machen«, sollte sich alsbald als nur zu sehr begründet erweisen. Der Kaiser gab Commendone in den liebenswürdigsten Worten die Versicherung, daß er genau denselben Zweck verfolge wie der Heilige Stuhl, nur mit anderen Mitteln. Weil er indes gesehen habe, erklärte er verbindlich, daß die Religionskonferenz dem Papst »so heftig zuwider« sei, habe er sie – abgesagt. Der Kardinal berichtete jubelnd seinen Erfolg nach Rom. Er wußte nicht, daß der Kaiser, der tatsächlich die Religionskonferenz eingestellt hatte, die Verhandlungen insgeheim, in einer etwas geänderten Form weiter führen ließ. Sowohl dem Legaten wie dem spanischen Gesandten gegenüber stellte übrigens Maximilian die Religionskonzession als vollkommen belanglos hin, weil sich, wie er meinte, die Deputierten niemals einigen würden. Dem Kurfürsten August aber versicherte er am 8. Dezember in einem eigenhändigen Schreiben, daß seine Landherren und Untertanen, so Gott wolle, der Religion halben zufrieden sein würden, »dan ich mich den Bapst und die sainigen in erbern, billichen und cristlichen Sachen wenig anfechten lasse, also wenig als sie nach mier oder den mainigen fil fragen«.
Philipp II., der die Nachricht von der Erteilung der Religionskonzession aus Rom erhalten hatte, schickte sofort einen Boten mit einem Handschreiben – es ist vom 17. Oktober datiert – nach Wien. Zu dem Schmerz über den Tod seiner Gemahlin und seines Sohnes, so heißt es da, sei er nun neuerdings in heftige Bewegung geraten, und dies um so mehr, als es sich hier um Gott und die Religion handle. Maximilian möge doch bedenken, daß ihm das vom Allmächtigen verliehene Amt die Pflicht auferlege, die katholische Religion und die heilige römische Kirche zu schützen wie deren Widersacher zu verfolgen und zu züchtigen. Alle solche »Dissimulationen« und Konzessionen seien nicht im geringsten geeignet, die Staaten zu erhalten, sie richteten sie vielmehr zugrunde. Auch seine Schwester, die Kaiserin, bat er, mit allen Mitteln den Gemahl von seinem Entschluß abbringen zu wollen. Sein Botschafter Chantonnay wurde angewiesen, mit Kardinal Commendone engste Fühlung zu nehmen und ihn zu unterstützen. Er mußte auch den Vorwurf einstecken, daß er sich von den Ereignissen habe überrumpeln lassen.
Nicht zuletzt fühlte sich auch Herzog Albrecht von Bayern berufen, seinem Schwager ins Gewissen zu reden, einen letzten Sturm auf dessen Herz zu eröffnen, und was er hier vorbrachte, war allerdings geeignet, Maximilian nachdenklich zu stimmen. In seinem »geringen Verstand«, so heißt es in dem Schreiben vom 1. Oktober, könne er sich nicht vorstellen, daß die Zulassung der Augsburger Konfession der richtige Weg sei, um den Abfall vom katholischen Glauben zu verhüten. Die Konzession des Kaisers werde bis zum äußersten mißbraucht werden, und schon rühmten sich seine Landherren, daß ihnen die Augsburger Konfession bedingungslos, »pure et simpliciter«, bewilligt worden sei. Und wenn sie jetzt schon Maximilians Meinung und Wort verkehren, was für eine Konfusion werden sie erst anrichten, wenn sie daran gingen, die neue Lehre in ihren Herrschaften, Kirchen und Schulen einzuführen.
Wie hat sich doch die Augsburger Konfession seit 1530 verändert! führt der Herzog weiter aus, indem er den wundesten Punkt, den Meinungshader, unbarmherzig bloßlegte. »Seind nun die Maister nit dabei pliben, sonder von Jarn zu Jarn von einem zue dem andern gefallen, wie wollen dan ire discipuli, welche sich selbs bedunken lassen, das sie das Licht des evangelii vil heller haben als ire magistri … under einander einig bleiben!« Maximilian hätte besser getan, das eingerissene Übel derzeit noch stillschweigend zu dulden, als »den Mißglauben und die Opinionen«, die aus der Augsburger Konfession geschöpft seien, mit der kaiserlichen Autorität zu decken und gutzuheißen. Eine einhellige Religion werde der Kaiser in seinen Erblanden nicht erhalten; »dan ich halt es bestendiclich und genzlich darfür, das die Zertrennung und Dissension der neuen Predicanten anderstwoher nit als aus sonderer Gnad und Fürsehung Gottes ervolgt sei, damit wir Christen die Unbestendigkeit irer Ler umb sovil besser erkennen und uns wider zue dem Schiflein Petri, außer dessen kein Heil ist, bekeren«. Maximilian wolle die verschiedenen Sekten abschaffen, bewillige aber eine solche, »ob sie gleich für die leidlichste geachtet wird«, und öffne so wieder den anderen Tür und Tor.
Der bayerische Schwager gab weiter die für die katholische Religion verhängnisvollen Rückwirkungen auf das Reich zu bedenken. Durch das Beispiel des Kaisers angeregt, würden nun die Stände und Untertanen Bayerns und anderer katholischen Länder die oft begehrte und stets abgeschlagene »Freistellung« des Glaubens mit Gewalt zu erringen suchen. Eine babylonische Verwirrung würde daraus entstehen, wenn die Untertanen glauben dürften, was jeder wolle, und das Ende werde ein »völliger und genzlicher« Abfall sein. Niemals würden die früheren Kaiser die Augsburger Konfession eingeräumt, niemals das getan haben, was Maximilian jetzt tun wolle, daß nämlich durch Zulassung der einen Sekte die anderen ausgerottet werden sollen – dadurch gebe er ein »neues, unerhörtes und hochgefährliches« Exempel. Albrecht erinnerte dann Maximilian an die Belohnungen, die den Fürsten und Obrigkeiten, welche die wahre Religion – und das sei ohne Zweifel die katholische – erhalten und handhaben, verheißen sei, und an die Strafen für die Lässigen und Widerwärtigen. Auch dieses sei zu bedenken, wie hoch durch diesen Handel der Papst und der spanische König »offendiert« würden. Der liebe Gott, so schließt er eindringlich, möge das Herz des Kaisers erleuchten, ihm Mut und Stärke verleihen, auf daß er erkenne, was zur Ehre Gottes, zum Heile der Seele, zur Auferbauung der heiligen christlichen Kirche, zu gemeinem Frieden, zu Ruhe und Einigkeit förderlich und dienstlich sei.
Der Kaiser nahm die Vorstellungen seines Schwagers, die ihm in sehr unangenehmer Weise die Gefahren der Religionskonzession zu Gemüte führten, wie sein Vizekanzler dem Herzog Albrecht offenbarte, »nit allerdings wohl« auf, was dieser wieder sehr bedauerlich fand. Maximilian hätte seine Konzession, so meinte er einlenkend, durch Mittelspersonen ins Werk richten sollen, so als wüßte er von der ganzen Sache nichts. Auf diese Weise würde er sich in den Augen der katholischen Potentaten nicht derart geschadet und andrerseits bei den Untertanen in den Ländern nicht so großes Aufsehen erregt haben.
Kaiser Maximilian mußte diesen Generalsturm ruhig über sich ergehen lassen. Am schwersten mag ihm dabei der Vorwurf in den Ohren geklungen haben, daß er mit der Religionskonzession seinem ganzen bisher betriebenen Ausgleichswerk untreu geworden sei. Indes, er befand sich seinen Ständen gegenüber in einer Zwangslage, und bald sollte die Erklärung für sein Abspringen zutage treten. Die Stände, die für gewöhnlich, selbst da, wo es sich wie bei der Türkenhilfe um ihr eigenes Lebensinteresse handelte, nicht in Geberlaune waren, griffen diesmal tief, sehr tief in die Tasche. Sie erklärten sich bereit, die Hofschulden in der ansehnlichen Höhe von zwei Millionen Gulden zu übernehmen, um dem Kaiser Gelegenheit zu geben, seine verpfändeten Kammergüter auszulösen und seinen Hofstaat ohne weitere Anleihen zu bestreiten. Das war also zusammen mit den Interessen eine Leistung von 2 500 000 Gulden.
Der Kaiser konnte so tatsächlich sagen, daß er »wider seinen Willen« und »aus äußerster unumgänglicher Not« den Ständen, die in ihrer überwiegenden Mehrheit protestantisch waren, seine Konzession eingeräumt habe, und er konnte über den naheliegenden Vorwurf, er habe sich dieselbe »abkaufen« lassen, mit größter Seelenruhe hinweggehen. Es war leider ebenso offenkundig, daß der Wiener Hof für die Grenzverteidigung gegen die Türken alle Jahre schweres Geld zahlen mußte, wie daß er gerade in der letzten Zeit von den beiden Hauptmächten der Gegenreformation sehr wenig unterstützt wurde. Namentlich Philipp II. zeigte den Hilferufen seines kaiserlichen Schwagers gegenüber keine sehr offene Hand, und er berief sich dabei wie zur Ironie auf die wachsenden Bedrängnisse in den Niederlanden. Von Vorstellungen und Warnungen allein konnte Maximilians Reich nicht leben, er benötigte Geld, und dieses hatten ihm die Stände in ausreichendem Maße gegeben.
Allein die Religionskonzession, die bei ihrer bloßen Ankündigung die leidenschaftlichste Abwehr der Gegner des Protestantismus hervorgerufen hatte, mußte erst unter Dach und Fach gebracht werden, und darüber wurden nun zwischen den Ständen und der Regierung langwierige Verhandlungen gepflogen, bei welchen Maximilians Rat, Richard Freiherr von Strein, den Mittelsmann spielte. Nach langem Hin und Her wurde den Ständen am 14. Januar 1571 in einer eigenen Urkunde, der »Assekuration«, die Konzession bestätigt. Gern hat der Kaiser sie gewiß nicht ausgestellt; er wußte wohl, warum er einige Monate später seinem Bruder Karl, der den Ständen Innerösterreichs ebenfalls Religionsfreiheit gewährte, den Rat gab, erst »alle äußerste erdenkliche Mittel und Wege« anzuwenden, bevor er in eine schriftliche Assekuration willige.
Mit Bangen, ja Grauen mußte er sehen, wie sofort bei der Beratung der Kirchenagende und der Glaubensnorm, des sogenannten »Doktrinale«, ein erbitterter, wilder Kampf unter der Ständeschaft und ihren Predigern losging. Österreich war leider der Sammelpunkt aller Hetzprediger, der unduldsamen Flacianer, die man aus anderen Gauen des Reiches ausgewiesen hatte, geworden. Als nach vielen Fährlichkeiten endlich im Jahre 1571 die Kirchenagende im Druck erschien, setzte eine Flut von leidenschaftlichen Gegenschriften ein. Alle Versuche, dem »betrübten, jämmerlichen« Zustand durch die Aufrichtung einer festen Glaubensnorm und eines straffen Kirchenregimentes ein Ende zu machen, scheiterten an der Uneinigkeit und dem Starrsinn der Pastoren und ihrer Hintermänner im Landhause.
Der Theologe Christoph Reuter, der neben dem Professor der Rostocker Universität David Chyträus die Agende verfaßt hatte und wegen seiner gemäßigten und vermittelnden Richtung von den Flacianern als ein »Weltklügling« und »stummer Hund« begeifert wurde, gibt uns von dem evangelischen Religionswesen kein sehr schmeichelhaftes, sicherlich aber nicht übertriebenes Bild. »Vor Jahren«, so klagt er, »war es uns allein an dem gelegen: wenn wir nur möchten von der kaiserlichen Majestät allein die Religion erlangen, hofften wir, es würde alles gut. Da es nun zu dem gekommen, ist das Feuer gar im Dach. Da kommt einer von Wittenberg, der andere aus Schwaben, Bayern, Pfalz, Württemberg, Meißen, Schlesien; jeder will Hahn im Korbe sein. Ist also im Lande eitel Völlerei, Prahlerei und Zänkerei.«
Diese unerquicklichen Zustände in der jungen evangelischen Kirche Österreichs hatten wieder die Wirkung, daß der Kaiser, dem jeder theologische Hader in der Seele zuwider war, zur größten Vorsicht gemahnt wurde und die Petitionen der protestantischen Stände um Einräumung weiterer Konzessionen, wie Bewilligung einer offenen Kirche und Zulassung der Bürgerschaft zu ihrem Gottesdienst, keinen Erfolg hatten. Der »Auslauf« der evangelischen Bürger zu den Schlössern der Adligen in der Umgebung der Stadt, nach Hernals, Inzersdorf und Vösendorf, war und blieb verboten, wenn ihm auch Maximilian durch die Finger sah. Erst nach langem Sträuben erlaubte er den Ständen, in ihrem Landhause in der Herrengasse einen Gottesdienst abzuhalten, und dies auch nur wieder deshalb, weil er in diesem Landhausgottesdienst ein geringeres Übel erblickte, als wenn die Adligen in ihren Stadtwohnungen eine Hausandacht eingerichtet hätten, bei der die Bürgerschaft anwesend war – diesen »Winkelpredigten« sollte eben durch den Landhausgottesdienst vorgebeugt werden. Aber die Bewilligung desselben erfolgte in keiner authentischen Form, so daß die Stände so gut wie nichts in Händen hatten, womit sie ihren Anspruch begründen konnten – eine Tatsache, die sich später bitter rächen sollte.
So war denn die »Magna charta« des österreichischen Protestantismus nur etwas »Halbes«, das deutlich die Spuren des heftigen Kampfes zwischen dem Kaiser und den Ständen an sich trug. Maximilian reute das große Geschenk der Religionsfreiheit sozusagen schon im Geben, aber er mußte etwas tun, weil die adligen Herren sonst nichts gezahlt hätten. Dadurch aber, daß er ihnen nicht alles und nicht mit einem Schlage gewährte, hatte er sie jahrelang in der Hand, und das gleiche war bei jenen Mächten der Fall, die in der Freigabe der Augsburger Konfession einen tödlichen Schlag gegen die alte Kirche erblickten. Maximilian war sichtlich froh, gegen diese ihm oft und oft feindlich in den Weg tretenden Bannerträger der Gegenreformation einen Trumpf in der Hand zu halten, den er in seinen politischen Nöten ausspielen konnte.
König Philipp II. lebte gleich der römischen Kurie in beständiger Furcht, es könnte die Konzession noch weiter ausgedehnt werden und sie nur das Vorspiel dazu sein, daß der Kaiser für seine Person offen sich zur Augsburger Konfession bekenne.
Diese Sorge war nicht so ganz unbegründet. Es ist doch bezeichnend, daß der Kurfürst August von Sachsen auf die Nachricht von der Erteilung der Religionskonzession seinen kaiserlichen Freund zu dieser »ganz christlichen« Erklärung beglückwünschte und ihm seine Unterstützung in Aussicht stellte. Der Kaiser, so schreibt er ihm am 9. November eigenhändig, möge getrost sein und sich durch den Papst und andere nicht beirren lassen, sondern ungescheut bekennen, was er in seinem Herzen einmal für Recht erkannt habe. Und nicht weniger bezeichnend ist es, daß der spanische Botschafter Chantonnay in seinem Bericht vom 19. November die Befürchtung aussprach, der Kaiser werde in seiner Konzession weiter fortfahren, wobei der sächsische Kurfürst und andere helfen würden, von welchen sich der Wiener Hof mehr als von dem Papst erwarte. Ein halbes Jahr später, am 29. Mai 1569, gibt der Botschafter der Hoffnung Ausdruck, daß es in Ungarn nicht wieder zum Krieg komme, der die Unterstützung des Reiches und der Erbländer erforderlich mache.
Es klingt dies wie ein Einbekenntnis der finanziellen Schwäche, wie eine Rechtfertigung der vielen Klagen des Kaisers, daß er in seinem Kampf gegen die Türken von Spanien und von Rom im Stiche gelassen werde. Nur der ganz beispiellose Hochmut Philipps, der gewohnt war, scheel auf den verarmten deutschen Vetter herabzublicken, war geblieben. Der König empfand in seinem Dünkel sicherlich nicht den grotesken Widerspruch in seiner Handlungsweise, die ihn gegen die Gewährung der Religionskonzession Sturm laufen ließ, während er die Ermahnungen des Kaisers, den Niederländern nachzugeben, um die Verwüstung und schließlich den Verlust des wertvollen Landes zu verhüten, als eine anmaßende Einmischung in seine inneren Angelegenheiten entrüstet zurückwies.
Allein Philipp II. stand auch nicht an, direkte Eingriffe in die Rechte des Reiches vorzunehmen. Im Frühjahr 1571 besetzte der spanische Gouverneur von Mailand mit seinen Truppen die Markgrafschaft von Finale, das eine gute Verbindung Spaniens mit den italienischen Provinzen darstellte. Der Kaiser war aufs tiefste empört. Als Chantonnays Nachfolger Graf Monteagudo, wie er am 28. Juli berichtet, von der Kaiserin aufgefordert wurde, mit ihrem Gemahl wegen der Religionskonzession zu sprechen, weigerte sich der Diplomat mit dem Hinweise, der Kaiser sei jetzt wegen der Besetzung Finales derart aufgebracht, daß er der Sache mehr schaden würde.
So hatte Maximilian mit seiner Religionskonzession ein Mittel in der Hand, den präpotenten König einigermaßen zu zügeln – und auch gegenüber dem Papste, der sich ebenfalls einen schweren Eingriff in die Reichsrechte hatte zuschulden kommen lassen.
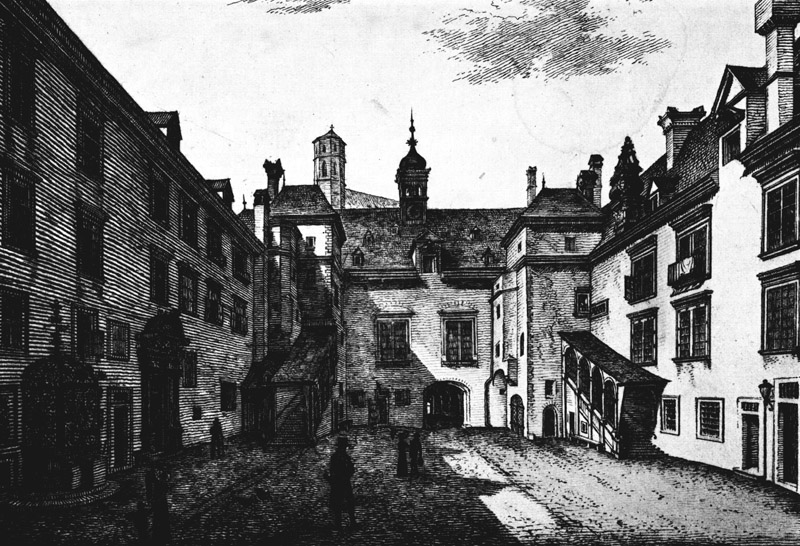
Das Alte Landhaus in Wien
Es war während des Reichstages von Speyer, als Maximilian eine ungewöhnlich scharfe Sprache gegen Pius V. führte. Er gedenke den »frechen Bischof von Rom«, so äußerte er sich erregt zum englischen Gesandten, zum apostolischen Wandel zurückzuführen. Bei einem Kriegszuge gegen Rom, setzte er drohend hinzu, würden ihn die deutschen Fürsten »nicht im Stiche lassen«, und in der Tat fürchtete man in der ewigen Stadt eine Wiederholung des »Sacco di Roma« von 1527; der Papst läßt in der Schweiz Truppen werben.
Und der Grund dieser Aufregung? Der Heilige Vater hatte den florentinischen Herzog Cosimo von Medici zum Großherzog von Toskana erhoben und am 5. März 1570 in Rom feierlich gekrönt. Diese Erhöhung des Mediceers, die »Erektion«, zu welcher der Papst nicht befugt erschien, bildete gewissermaßen nur die Krönung eines langwierigen Streites zwischen Florenz und Ferrara, der mehr als drei Jahrzehnte hindurch die diplomatische Welt in Atem hielt.
Anlaß dazu gab eine der üblichen Rangstreitigkeiten. Es hatte sich nämlich im September 1541 der schwere Fall ereignet, daß Herzog Ercole II. von Ferrara, als er sich zusammen mit Herzog Cosimo in Lucca zur Begrüßung Karls V. einfand, zur Rechten des Kaisers ritt, während der Mediceer mit der Linken vorlieb nehmen mußte, und bei dem folgenden Mahle Ercole dem Monarchen die Serviette reichen durfte. Im Dezember desselben Jahres geschah es dann, daß auch das geistliche Oberhaupt der Christenheit, Papst Paul III., dem Hause Este den Vorzug gab; bei der Weihnachtsfeier erhielt der Gesandte Ferraras in der Kapelle den Platz vor dem florentinischen. Cosimo protestierte und der Papst willigte ein, daß die Sache vor seinem Forum entschieden werde. Da aber der Herzog merkte, daß der Heilige Stuhl zu Ferrara hinneigte, appellierte er an den Kaiser, und es gelang ihm, Karl V. für sich zu gewinnen. In dessen Namen stellte Herzog Alba zugunsten Cosimos eine Erklärung aus, die dann mit Dekret vom 24. Dezember 1547 bestätigt wurde. Die Entscheidung Karls V. aber wurde dann von seinem Enkel Kaiser Ferdinand I. mit Dekret vom 21. Oktober 1560 gutgeheißen, und diese Urkunde war es, auf welche sich die Florentiner in der Folge gerne bezogen; denn es war ihnen damit in feierlichster Form die Wahrung ihres Besitzstandes, der »possessio«, zugesichert worden.
Allein kaum war ein Jahr verronnen, so kam von Kaiser Ferdinand ein zweites Dekret, vom 6. September 1561 datiert, das dem Herzog Cosimo weit weniger behagen wollte. Es wurde nämlich dem Gesandten von Ferrara, der sich durch die frühere Resolution beschwert fühlte, die Erklärung gegeben, daß diese keineswegs den Charakter einer Sentenz habe, sondern bloß im Interesse der Ordnung am Hofe, zur Verhütung von Streitigkeiten erfolgt sei. Der Kaiser habe dabei nicht die Rechte der beiden Parteien im Auge gehabt, sondern sich lediglich an die von seinem kaiserlichen Vorgänger abgegebene Deklaration gehalten. Die beiden Herzöge wurden ermahnt, sich liebevoll zu vergleichen oder des Kaisers richterliche Entscheidung einzuholen.
Hochbefriedigt zog der Gesandte Ferraras von dannen. Man hatte es jetzt schwarz auf weiß, daß der Vorrangstreit mit Florenz noch nicht entschieden sei. Es war so Zeit gewonnen, und man durfte annehmen, daß sich Ferdinand durchaus nicht beeilen werde, aus seiner neutralen Stellung herauszutreten, die ihm gestattete, die rivalisierenden Herzöge möglichst lange sich gefügig zu erhalten und zu gegenseitig sich überbietenden Höchstleistungen für den Wiener Hof anzuspornen. Kam es zu dem vom Kaiser gewünschten Kompromiß, dann konnte nur das im »Besitze« befindliche Florenz verlieren; kam es dagegen zur richterlichen Austragung vor dem Forum des Kaisers, dann durfte Ferrara auf eine günstige Sentenz hoffen; denn Ferdinands Sympathien standen damals offenkundig auf Seiten des Herzogs Alfonso. Der schlaue Mediceer, der eine sehr feine Witterung besaß, steckte sich deshalb hinter den Papst und erreichte von ihm glücklich, daß der Herzog von Ferrara unter Androhung der schwersten Kirchenstrafen von der Kurie aufgefordert wurde, innerhalb von zwei Monaten seine Rechtsgründe vorzubringen. Alfonso aber leistete dieser Zitation unter Berufung darauf, daß er den Streitfall bereits am Kaiserhofe anhängig gemacht habe, keine Folge. Es schwebten also zwei Prozesse, der eine in Rom, der andere am Wiener Kaiserhofe. Allein über das Stadium des Schwebens kamen sie weder da noch dort hinaus, weil man beiderseits die Empfindung hatte, man steche in ein Wespennest.
So standen die Dinge, als Cosimo in nähere Beziehungen zum Kaiserhause treten sollte. Der Herzog hatte durch seine große Tüchtigkeit Florenz in die Höhe gebracht; die jährlichen Einkünfte des Staates bezifferten sich auf etwa eine Million Dukaten. Aber noch stand seinem Ehrgeiz ein lockendes Ziel vor Augen: die kaufmännische Herkunft der Mediceer sollte durch die glanzvolle Verbindung mit einer Kaisertochter geadelt werden, und so sehen wir ihn denn für seinen Sohn Francesco als Werber auftreten. Ursprünglich dachte er an eine Tochter Maximilians, an Anna oder Elisabeth, an die Schwester König Philipps von Spanien, die Prinzessin Johanna, später aber wurde eine der Töchter Kaiser Ferdinands in Aussicht genommen.
Als der päpstliche Nuntius am Wiener Hofe Zaccaria Delfino im Frühjahr 1563 die Heiratsverhandlungen ernstlich in Angriff nahm, hatte er den Auftrag, um eine der drei Erzherzoginnen, nämlich die vierundzwanzigjährige Barbara, die um zwei Jahre jüngere Margareta oder um Johanna, die erst sechzehn Jahre zählte, anzuhalten, und zwar, wie er später instruiert wurde, um die für eine Ehe bestqualifizierte. In dieser Konkurrenz, aus der Margareta bald ausschied, scheint wieder die älteste, Barbara, die Palme davongetragen zu haben. Doch wurde ihre Hand einem anderen zugesagt und für Florenz die jüngste, Johanna, in Aussicht genommen, eine »Schönheit ersten Ranges«, wie der schlaue Delfino seiner Meldung hinzufügte, während die »häßliche« Barbara dem Herzog Alfonso – das war der andere – zufallen sollte. Offenbar wollte er mit diesen, der Wirklichkeit kaum entsprechenden Bemerkungen – der florentinische Gesandte Albizzi nannte beide so ziemlich gleich schön – die bittere Pille, daß der andere gerade der Herzog von Ferrara war, einigermaßen versüßen; denn daß sein Rivale, mit dem er im Vorrangstreite lag, auch eine Kaisertochter, und noch dazu die ältere, erhielt, mag dem in Präzedenzsachen höchst empfindlichen Herzog wie ein Präjudiz zugunsten Ferraras erschienen sein.
Aber schließlich und endlich mußten Cosimo und sein Sohn froh sein, daß sie überhaupt die Hand der Erzherzogin Johanna bekamen. Denn auch da war gerade in zwölfter Stunde ein sehr ernst zu nehmender Bewerber aufgetaucht, der sie aus dem Felde zu schlagen drohte: es war dies, wie bereits erwähnt wurde, der Siebenbürgerfürst Johann Siegmund Zápolya, mit dem Maximilian in Friedensverhandlungen getreten war und der nun als Unterpfand Johanna zur Frau begehrte, wobei er sich auf ältere, bis auf das Jahr 1551 zurückreichende Abmachungen berufen konnte. Nur dem Umstande, daß der Wojwode den Waffenstillstand brach und die Festung Szatmár überfiel, hatte es der Herzog zu verdanken, daß die Verhandlungen über die Heirat mit Johanna wiederum aufgenommen und zu einem glücklichen Ergebnis geführt wurden.
»Wier Brieder haben uns verglichen,« schreibt Kaiser Maximilian am 10. Januar 1565 seinem bayerischen Schwager, »main Frau Schwester Johannam dem Hertzogen zu Florenz zu verheiretn … gewe Gott, das es wol geret« – ein Segenswunsch, der sich bald als sehr gerechtfertigt erweisen sollte. Einen Monat darauf reiste der Sekretär des florentinischen Gesandten mit der Botschaft von der endgültigen Einwilligung des Kaisers nach Florenz ab, und ehe noch ein halbes Jahr um war, erschien dort in dessen Auftrag Hans Khevenhüller, um von Cosimo, dem Bankier von ganz Europa, für den bevorstehenden Türkenfeldzug ein Darlehen von 200 000 Dukaten zu verlangen.
Dies war für den Herzog der große Moment, um mit seinem alten Plan herauszurücken: er wollte durch Verleihung eines höheren Titels den Vorrang vor Ferrara erzwingen. Schon im Sommer 1560 hatte er sich mit dem Gedanken getragen, von Papst Pius IV. die Würde eines Königs von Toskana sich verleihen zu lassen, und der Nuntius Delfino verhandelte deswegen mit Kaiser Ferdinand und seinem Sohne Maximilian, die aber von diesem Vorhaben nichts wissen wollten. Nun aber, da Kaiser Maximilian als Hilfesuchender auftrat, zog Cosimo seinen zurückgestellten Lieblingsgedanken wieder hervor. Flugs wurde der Gesandte am Wiener Hofe, Julius Ricasoli, angewiesen, dem Monarchen die erfreuliche Mitteilung zu machen, daß der Herzog dem Ansuchen um ein Darlehen willfahrt und die erste Rate bereits angewiesen habe, im Anschluß an diese Verständigung aber ein Schreiben zu überreichen, in welchem die Rangerhöhung zur Sprache gebracht wurde.
In diesem Schreiben von 13. Juni 1565, einem wahren Kabinettstück von Verlogenheit, wird dem Kaiser bekanntgegeben, daß ihn der Papst seit Beginn seines Pontifikates durchaus mit einem höheren Titel beehren wollte. Bisher habe er, dem der Ehrgeiz so gänzlich fehle, diese Bemühungen zurückgewiesen. Nun aber habe der Heilige Vater die bevorstehende Vermählung des Erbprinzen mit der Erzherzogin Johanna dazu benutzt, um neuerdings mit seinem Plan hervorzutreten: Erhebung des »freien« Staates Florenz zum Erzherzogtum. In der Erwägung, daß diese Auszeichnung dem kaiserlichen Geblüte zugutekomme, habe sich Cosimo beim Papst für dessen Gnade bedankt und ihn gebeten, so lange noch mit der Verleihung der neuen Würde innezuhalten, bis der Wiener Hof seine Zustimmung erteilt hätte, denn ohne diese wolle er lieber Staat und Leben verlieren.
Gleichzeitig wandte sich der Mediceer an die Erzherzöge Ferdinand und Karl, ebenso an die zukünftige Schwiegertochter Johanna mit der Bitte um Fürsprache beim Bruder. In dem an die Erzherzogin gerichteten Schreiben erscheint die Bezeichnung des Herzogtums Florenz als eines »freien« Staates noch durch die Worte ergänzt: »und der niemand Höheren anerkennt«. Damit wollte man offenbar dem Einwand begegnen, daß der Papst zu seiner Rangerhöhung nicht berechtigt sei. Der Erbprinz Francesco unterstützte das Ansuchen seines Vaters mit einem nicht minder unterwürfigen Schreiben, worin die Rücksicht auf die Erzherzogin und ihre Nachkommen besonders hervorgehoben wird.
Von dem Königstitel war man also abgekommen und auf den eines Erzherzogs verfallen. Man wußte nämlich in Florenz nur zu gut, daß der König von Spanien niemals dazu seine Einwilligung gegeben hätte, weil er den größten Wert darauf legte, auf der apenninischen Halbinsel die führende Macht zu sein. Doch auch mit dem Erzherzogtitel hatte es, wie man richtig voraussah, seine besonderen Schwierigkeiten. Der florentinische Gesandte am Kaiserhofe erhielt deshalb genaue Verhaltungsmaßregeln, damit er gegen alle Widerstände gewappnet sei. So konnte ihm vorgehalten werden: Die Erhebung zum Erzherzogtum präjudiziere den österreichischen Erzherzögen. Der Gesandte hatte darauf – und dies war gewiß sehr schmeichelhaft – zu erwidern: Das moralische Ansehen des Erzhauses sei derart bedeutend und erhaben, daß es auch durch die Verleihung des neuen Titels keine Einbuße erleiden könne, gerade so wenig wie sich der Glanz der Sonne dadurch verringere, daß ihre Strahlen in einen ganz abgelegenen Fleck Erde dringen. Und sollte ihm eingewendet werden, daß die Rangerhöhung den anderen Fürsten Italiens präjudiziere, dann habe er auf das Beispiel von Mantua und Ferrara zu verweisen, deren Umwandlung in Herzogtümer erfolgte, ohne daß sich Mailand oder Savoyen beleidigt gefühlt hätten. Und – das wichtigste – Ferrara sei nicht frei wie Florenz. Der Papst werde sich wegen der falschen Prätensionen des Herzogs Alfonso nicht die Hände binden lassen, ja die Erhebung zum Erzherzog sei gerade ein Mittel, um jenen ein für allemal ein Ende zu bereiten.
Nun konnte noch die Frage aufgeworfen werden: Hat denn der Papst überhaupt das Recht zur »Erektion«, zur Verleihung der Rangerhöhung? Die Antwort darauf könne nur lauten: wenn der Papst selbst Kaiser zu ernennen vermöge, wenn er die Macht besitzt, die Kaiserwürde von Frankreich auf Deutschland zu übertragen, dann habe er ohne Zweifel auch das Recht, kleinere Titel zu verleihen, Titel, die sich »freie« Völker oft sogar selber geben.
Diese ganze Rechtsbelehrung sollte indes dem florentinischen Gesandten nur zur Information dienen, um gegebenenfalls zu drohen. In Wirklichkeit war man noch keineswegs gewillt, aus dieser stacheligen Kompetenzfrage die äußersten Folgerungen zu ziehen und einen Streit zwischen Papst- und Kaisertum heraufzubeschwören. So wurde denn Ricasoli dahin instruiert, den Titel eines Erzherzogs vom Kaiser selbst zu begehren, falls sich dieser auf den Standpunkt stellte und darauf beharrte, daß ihn nur er und nicht der Papst verleihen könne. Über die Frage, ob sich dies der apostolische Stuhl ruhig bieten lassen werde, brauchte man sich in Florenz nicht viel den Kopf zu zerbrechen. Man wußte hier am besten, daß der Ehrgeiz des Papstes, mit Florenz eine Rangerhöhung vorzunehmen, durchaus nicht so groß war, wie es Cosimo dem Kaiser zu schildern bemüht war, und Pius IV. das Odium eines politischen Brandes in Italien gern einem anderen überlassen würde. Der Gesandte wurde also zur Erklärung ermächtigt, man werde schon Sorge dafür tragen, daß der Papst keinen Lärm schlage.
Die Hauptsache für Cosimo war, daß man den höheren Titel erhielt – von wem, erschien ihm mehr oder weniger belanglos. Der tiefere Grund aber, warum er ihn so heiß begehrte, enthüllte sich in den vertraulichen Weisungen an Ricasoli und den päpstlichen Nuntius Delfino, der auch wieder in Bewegung gesetzt wurde. Wenn der Plan gelingt, so heißt es da, wird der Glanz der neuen Würde nicht zuletzt dem Hause Habsburg selber zufallen, und es wird dadurch auch den falschen Prätensionen ihrer Neider ein Riegel vorgeschoben – und damit war natürlich in erster Linie Ferrara verstanden, mit welchem man im Vorrangstreite sich befand.
Giulio Ricasoli entledigte sich sofort nach dem Einlangen der Depeschen, am 7. Juli, seines Auftrages wegen des Darlehens und überreichte sodann dem Kaiser das Schreiben des Herzogs, das die schwerwiegende Bitte um den Erzherzogtitel enthielt. Maximilian las es und erklärte hierauf sehr vorsichtig, er könne sich darüber nicht so rasch entscheiden, da die hier angeregte Sache auch andere interessiere. Er meinte damit seine beiden Brüder und König Philipp von Spanien. Im übrigen nahm der Monarch das Anliegen, wie der Gesandte befriedigt feststellte, »mit guter Miene« auf. Freilich – diesen Eindruck gewann Ricasoli – mußte man sich auf ein längeres Warten gefaßt machen.
Der Gesandte begann alsbald im Vereine mit dem Nuntius seine Minierarbeit bei den vertrautesten Ministern des Kaisers, den beiden Kanzlern Zasius und Weber, sowie den Geheimen Räten Harrach und Trautson, wobei mit Versprechungen, Geschenken und Gelagen keineswegs gegeizt wurde. In den vertraulichen Besprechungen fiel da von Seiten des Doktor Zasius der Vorschlag, statt des Titels eines Erzherzogs, gegen den sehr vieles spreche, den eines Großherzogs zu verlangen.
Als so der Boden gut vorbereitet war, erschien Ende Oktober der Erbprinz Francesco selber mit seinem Staatskanzler Baron Bartolomeo Concino in Wien, um den Verhandlungen den gehörigen Nachdruck zu geben. In gehobener Stimmung konnte der Mediceer, nachdem er durch reichliche Gunstbezeigungen sich überall ein gutes Andenken gesichert hatte, Anfang November den Kaiserhof verlassen, um sich zur Hochzeitsfeier, die in Tirol stattfand, zu begeben. Der in allen Künsten der Diplomatie wohlbewanderte und erprobte Concino setzte indes dem Kaiser so lange zu, bis er sich, wie der Nuntius Delfino triumphierend zu melden wußte, in einer ganz geheimen Abmachung, um die außer ihm nur noch Zasius und Harrach wußten, im Prinzip mit der Verleihung des Großherzogtitels einverstanden erklärte. Der Papst, so dachte man es sich, sollte rasch die Bulle herschicken, der Kaiser sie dann approbieren, damit sich auf diese Weise der Herzog von Ferrara vor eine vollendete Tatsache gestellt sehe.
Soweit wäre alles in schönster Ordnung gewesen, aber die Sache hatte einen großen Haken. Der Kaiser hatte nämlich diese angebliche Zustimmung nur unter gewissen Bedingungen erteilt; sie sollte geheim bleiben und ihm die Möglichkeit an die Hand gegeben werden, die Verantwortung von sich abzuweisen. Im übrigen weiß man den Inhalt dieses Übereinkommens nur aus der Darstellung des Nuntius Delfino, der aber keine sehr lautere, einwandfreie Quelle ist. Und selbst hiernach erscheint die stark verklausulierte Zusage im höchsten Grade problematisch und offensichtlich darauf gemünzt, auf eine gute Art den unbequemen Staatskanzler loszubekommen und die ganze leidige Angelegenheit weiter in Schwebe zu halten. Wer den schlauen Habsburger, dessen Geriebenheit selbst die hervorragendsten, in der Technik der machiavellistischen Staatskunst bewanderten Diplomaten immer aufs neue in Erstaunen versetzte, und seine nicht minder durchtriebenen Räte kennt, wird sich unschwer vorstellen können, daß man sich am Kaiserhofe eine oder gar mehrere Hintertüren offenhielt, um bequem entschlüpfen zu können – immer vorausgesetzt natürlich, daß es sich hier wirklich um mehr als unverbindliche Besprechungen handelt. Der gute Wille des Kaisers, dem Verlangen des Herzogs von Florenz zu willfahren, war jedenfalls nicht vorhanden, und es liegen verschiedene Anzeichen vor, daß er gerade damals am Werke war, für den anderen Schwager, der kurz vorher, im August, ebenfalls nach Wien gekommen und mit auffallender Herzlichkeit behandelt worden war, eine Lanze einzulegen, um den in Rom gleich einem Damoklesschwert schwebenden Prozeß niederzuschlagen und in Güte zu schlichten.
Indes, zur Ausführung des in Florenz schlau ersonnenen Planes ist es nicht mehr gekommen. Kurze Zeit darauf, am 9. Dezember, starb ganz unerwartet Cosimos großer Gönner Papst Pius IV. Concino wurde eiligst von Wien abberufen und nach Rom dirigiert, wo man seiner in den nun anhebenden Konklavesorgen dringender benötigte. Der neugewählte Papst Pius V. mußte erst in mühsamer Arbeit gewonnen werden, und der Kaiser zeigte begreiflicherweise nicht das geringste Verlangen, den Faden der Verhandlungen aufzunehmen. So blieb die ganze Titelangelegenheit wieder stecken. Allein die Zeit arbeitete keineswegs für Florenz.
Der Herzog Alfonso II. von Ferrara, eine glänzende Erscheinung, die Goethe in seinem »Tasso« verewigt hat, verstand es, immer mehr in der Gunst des Kaisers sich zu befestigen. Im Türkenfeldzug von 1566 leistete er, wie wir schon wissen, persönliche Gefolgschaft und in dem mehrmonatigen Beisammensein im Lager hatte er reichlich Gelegenheit, die ihm am Herzen liegenden Fragen – und das war auch für ihn nicht zuletzt die Präzedenz – mit Maximilian zu besprechen. Vielleicht geschah es damals, daß er dem Schwager einen Plan anvertraute, der diesem, immer besorgt um die Zukunft seiner vielen Söhne, gar lieblich in den Ohren geklungen haben mag. Alfonso, der jetzt schon das zweite Mal verheiratet war, hatte bisher keine Nachkommen und infolge einer schweren Verletzung, die er sich bei einem Sturz vom Pferde geholt hatte, wie es hieß, auch keine zu erwarten. Sein jüngerer Bruder aber war Kardinal und hatte den Ehrgeiz, Papst zu werden. Wie nun, wenn das herzogliche Paar einen Erzherzog adoptiert und dieser die Herrschaft über Ferrara erlangt hätte? Die Gerüchte von einem solchen Plan tauchten bald in sehr bestimmter Form auf, um nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Allerdings gingen sie, und zwar in ganz bestimmter Absicht, von Florenz aus; aber waren sie deshalb völlig aus der Luft gegriffen?
Herzog Alfonso, der überdies durch seine Mutter Renata, die bekannte Gönnerin Kalvins, in nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zum französischen Königshause stand, spielte den Mittler bei der Heiratsverbindung der Erzherzogin Elisabeth mit König Karl IX., die Maximilian so sehr am Herzen gelegen war. Und auch in religiöser Hinsicht stand der Herzog, der ob seiner Duldung Andersgläubiger und seiner Weigerung, in Ferrara die Inquisition einzuführen, bei der römischen Kurie in den Verdacht der Häresie gekommen war, dem Kaiser ungemein nahe.
Umgekehrt gestaltete sich das Verhältnis zwischen Wien und der Arnostadt von Jahr zu Jahr schlechter. Als der Kaiser wenige Monate nach der Heimführung der »Königin« Johanna, wie man sie in Florenz gerne hieß, im Frühjahr 1566 wiederum Hans Khevenhüller an den Herzogshof sandte, um für den Türkenfeldzug eine Geldhilfe zu erlangen, lehnte Cosimo dieses Begehren in aller Form ab, und der Kaiser erfuhr zu seinem nicht geringen Befremden, daß der Allerweltsbankier kein Geld zur Verfügung habe. Freilich sandte er dann, offenbar auf Betreiben Delfinos, ein ansehnliches Hilfskorps unter dem Kommando Aurelio Fregosos. In der Folge aber zeigte der Herzog auf alle Werbungen des Wiener Hofes die kalte Schulter. Cosimo, der Maximilian versichert hatte, daß ihm der Ehrgeiz so gänzlich fehle, dachte nicht bloß an eine Rangerhöhung, sondern auch an eine Erweiterung seiner territorialen Macht – hier aber begegnete er sich mit dem Kaiser, der genau dieselben Ziele verfolgte.
Wie Cosimo den Freistaat Siena, der hintereinander von den Franzosen und den Spaniern besetzt worden war, glücklich für sich gekapert hatte, so bot sich ihm jetzt die Gelegenheit, die Insel Korsika, die sich gegen die Handeslrepublik Genua erhoben hatte, zu gewinnen. Eine Gesandtschaft der Korsen wandte sich hilfesuchend nach Florenz, und Cosimo bestürmte nun seinerseits den Kaiser, er möge ihm die Erlaubnis zum Zugreifen geben. Doch Maximilian lehnte es ab – auch bei ihm waren Gesandte der aufständischen Korsen erschienen, um ihm die Besitznahme der Insel anzutragen. Der Kaiser klopfte vorsichtig bei seinem spanischen Vetter an, doch der winkte ab; worauf dann Maximilian den Rückzug antrat. Aber für Cosimo war es ein schwacher Trost, daß auch der Kaiser nichts erreicht hatte, denn Korsika war, ganz abgesehen von seiner Lage als »Schlüssel zu Italien« – freno d'Italia – ein altes Königreich, und er hätte auf diesem Wege Ansprüche auf die Führung des begehrten Titels »König« erheben können.
Herzog Cosimo säumte nicht, dem Kaiser Gleiches mit Gleichem zu vergelten. An der Meeresküste von Genua, hart an der Grenze von Frankreich und Spanien, befand sich die Markgrafschaft Finale, in der schon seit Jahren ein erbitterter Bürgerkrieg tobte. Der Markgraf Caretto, der sich durch seine Grausamkeit verhaßt gemacht hatte, war vertrieben worden und erschien schutzflehend am Wiener Hofe. Der Kaiser sandte Kommissäre nach Finale, um es zum Gehorsam unter dem angestammten Fürsten zurückzuführen. Doch umsonst, die Aufständischen erklärten trotzig, lieber auswandern oder ihr Leben lassen zu wollen, als einem »Tyrannen« zu gehorchen. Die Situation gestaltete sich für die kaiserlichen Kommissäre von Tag zu Tag bedrohlicher, und schließlich sah sich Maximilian genötigt, die Unterstützung des spanischen Gouverneurs von Mailand anzurufen, welche, bereits zugesagt, mit einem Male, auf höhere Weisung von Madrid, unterblieb. Es wurde mit jedem Tage klarer, daß König Philipp, wie schon kurz erwähnt, diesen Küstenstrich, der eine wertvolle Brücke zu Mailand, einen neuen Stützpunkt seiner militärischen Macht in Italien bildete, sich selber aneignen wollte, wie denn auch insgeheim mit den Aufständischen eifrigst unterhandelt wurde.
Die Kommissäre riefen nun – es war im Frühling 1567 – die Unterstützung Cosimos an, der sofort auf den Gedanken einer Okkupation einging und mit ihnen bis in die Einzelheiten den Kriegsplan besprach; mit Hilfe seiner Flotte sollten die Aufständischen überrumpelt und das Land sodann besetzt werden. Allein nachher fand er lauter Ausflüchte und Bedenken. Da einer seiner Einwände die Rücksichtnahme auf Spanien war, so hatte Erzherzog Karl bei seiner Mission an den Madrider Königshof auch diesen Punkt vorzubringen. Aber das Ende war dann, daß Finale von den Spaniern selbst besetzt wurde.
Nicht der letzte Grund der Verstimmung aber, die zwischen Wien und Florenz herrschte, war die Behandlung, welche die Erzherzogin Johanna am Mediceerhofe erfuhr.
Die Braut war am 16. Dezember 1565 in Florenz eingezogen, mit allem Prunk empfangen. Ehrenpforten waren errichtet worden. Johanna saß auf einem schneeweißen Zelter, ihr zur Seite ritt Herzog Cosimo und ihnen folgten der Bräutigam Francesco, sämtliche Mitglieder des Hauses Medici und Toledo, von allen Türmen und Kirchen der Stadt begrüßten sie Freudengeläute, Trompetengeschmetter, und der Jubel des Volkes erfüllte die Luft. Dazwischen donnerten die Geschütze der Festungswerke von San Miniato und del Basso. Gedrängt standen die Leute an den Fenstern, in den Straßen, um die »Deutsche« zu sehen. Mit dem Zurufe »Palle, palle – Austria, Austria!« hieß man sie willkommen. Allgemein fiel ihr reiches Goldhaar auf, das charakteristische Merkmal der Töchter Ferdinands. Zwei Tage darauf fand die Trauung statt. Der fürsorgliche Schwiegervater hatte den Palazzo vecchio zur Residenz des jungen Paares eingerichtet. An den Wänden seines lauschigen Säulenhofes prangten neue Fresken, Ansichten österreichischer Städte – alles um der Prinzessin den Aufenthalt in der Arnostadt so heimisch als möglich zu gestalten.
Allein Francesco von Medici zeigte von allem Anfang an, daß die Heirat lediglich aus politischen Gründen geschlossen wurde, und er ließ es auch an den einfachsten Rücksichten fehlen. Ein Jahr vor der Hochzeit hatte er Beziehungen zu der schönen Venezianerin Bianca Capello angeknüpft, die vor dem Abschluß der Ehe mit Johanna im geheimen, nun aber offen unterhalten wurden. Cosimo tat alles, um das Verhältnis zwischen den Gatten zu bessern, aber umsonst. Johanna fühlte sich hier unglücklich und ihre Klagen drangen bald an den Kaiserhof, der darob nicht wenig gereizt wurde.
Also Verstimmung über Verstimmung, und in demselben Maße, als sich das Verhältnis zwischen Wien und Florenz verschlimmerte, gestalteten sich die Beziehungen des Kaisers zu Herzog Alfonso immer herzlicher und verringerten sich auch Cosimos Hoffnungen, den Präzedenzstreit mit Ferrara in seinem Sinne entschieden zu sehen. Der Kaiser redete sich auf die »Doktores« aus, die berufsmäßig alles, auch die einfachsten Dinge ins Endlose verschleppten; die Räte wieder schoben die ganze Schuld auf den Kaiser, der in dieser schwierigen Frage sehr behutsam vorgehen müsse.
Im September 1568 entschloß sich Cosimo, seinem Gesandten am Wiener Hofe, Bischof Antinori, die Weisung zu erteilen, die Verhandlungen abzubrechen; die Sache sollte in Rom weiter verfolgt werden. Der Bischof entledigte sich dieses Auftrages in der schönen Form, daß er dem Kaiser erklärte, man stehe von der rechtlichen Austragung des Präzedenzstreites ab, da man sehe, welch große Schwierigkeiten sie ihm bereite. Der Gesandte hatte sich nunmehr darauf zu beschränken, vom Kaiserhofe die Bestätigung der von Ferdinand erlassenen Deklaration vom 21. Oktober 1560, die Florenz den »Besitzstand« zugesprochen, zu erlangen. Aber Maximilian, gleichzeitig auch von Ferrara bedrängt, wich aus. Die gewünschte Konfirmation der kaiserlichen Dekrete, so wurde dem florentinischen Gesandten bedeutet, halte er derzeit für unnötig, denn es wäre bisher keineswegs seine Absicht gewesen, denselben irgendwie nahezutreten.
In Florenz schäumte man vor Wut über diese »ungerechte, wenig Liebe und Dankbarkeit« bekundende Entscheidung. Indes, Herzog Cosimo machte gute Miene zum bösen Spiel, faßte die Ablehnung der Bestätigung der Ferdinandeischen Dekrete als Gewährung auf, indem er die Worte der kaiserlichen Resolution absichtlich so deutete, als hielte Maximilian die Ratifikation nur deshalb für überflüssig, weil er sie ohnehin anerkenne. Antinori bekam den Auftrag, seine Bitte in bescheidener Form zu erneuern, und richtig, er erhielt eine Resolution, die ihn ganz befriedigte. Es war nämlich darin gesagt, daß sich der Kaiser bestreben werde, alles in dem Stande zu erhalten, wie es unter Ferdinand beobachtet worden. Natürlich meinte er nicht das erste Dekret vom 21. Oktober 1560, worin Florenz der »Besitzstand« zugeschrieben wurde, sondern das zweite vom 6. September 1561, das besagte, die frühere Deklaration besäße nicht den Charakter einer Sentenz.
Bischof Antinori erhielt nochmals die Weisung, um die Anerkennung des »Possesses« anzuhalten, und zwar mit Beiseitesetzung der bisher beobachteten Bescheidenheit – indes stand am Herzogshofe bereits der Entschluß fest, den Papst zum Richter zu machen.
Am 13. Dezember 1569 herrschte in der alten Residenz der Mediceer freudigste Bewegung. Michele Bonelli, ein Neffe des Papstes Pius V., war aus Rom eingetroffen, um Herzog Cosimo die Bulle »Romanus Pontifex« einzuhändigen, die ihn zum Großherzog von Toskana erhob und ihm dazu die königlichen Insignien verlieh. Während an dem Tore des Palazzo vecchio, in welchem sich die Zeremonie der Überreichung der päpstlichen Urkunde mit großem Gepränge vollzog, das neue großherzogliche Wappen befestigt wurde, erdröhnten von den Basteien die Geschütze, die Spielleute fielen ein, und das Volk jubelte Cosimo zu, der jetzt einen lange Jahre gehegten Traum verwirklicht sah.
Einer der Festteilnehmer aber wird in den Freudentaumel kaum von Herzen eingestimmt haben: der Vertreter des Herzogs Alfonso von Ferrara, der nur zu gut fühlte, daß die mit so großem Pomp verkündete Rangerhöhung ein wohlgezielter Schlag gegen das Haus Este und sein Land sei. Indes, er wohnte der Feier bei, beglückwünschte Cosimo, wenn auch gewiß mit süßsaurer Miene, und da auch vom Kaiserhofe, auf dessen Anerkennung man natürlich den größten Wert legte, freundliche Worte signalisiert worden waren, so trübte kein Mißton die festliche Stimmung.
Bald darauf kam von Herzog Alfonso selbst ein herzlich gehaltenes Glückwunschschreiben. Er drückte darin seinem Nachbar die »größte Freude« über die diesem zuteil gewordene Auszeichnung aus und versicherte ihm, niemand vermöchte sie stärker mitzufühlen, »da es nicht möglich sei, daß Seine Exzellenz von einem Freunde mehr geliebt und verehrt werde als von ihm«. Diesen überschwenglichen Worten der Freude folgte ein dämpfender Nachsatz, der zugleich die Erklärung enthält, weshalb sich der Herzog so aufrichtig freuen konnte. Er sei nämlich überzeugt, so heißt es da, daß Seine Exzellenz mit dieser neuen Würde keinerlei Anspruch erhebe, dem »alten« – offenbar war gemeint »älteren« – Hause Ferrara irgendwie zu »präjudizieren«. Dieses wollte er ihm sagen, so schließt der Brief, mit jener Aufrichtigkeit, wie es sich unter »wahren Freunden« gezieme. Und wieder einige Wochen später traf auch vom Kaiser Maximilian ein Schreiben ein, worin er seinem Gevatter ebenfalls die »größte« Freude zu erkennen gab. Dasselbe war aber an den »Herzog« Cosimo von Florenz adressiert.
Es waren dies die ersten Vorboten eines Sturmes, der sich nun von allen Seiten gegen das junge Großherzogtum erhob. Das Signal dazu gab der kaiserliche Botschafter in Rom, Graf Arco, der mit erprobter Umsicht die Interessen seines Herrn vertrat und als Anverwandter des Hauses Este auch persönlich an dieser Frage beteiligt erschien.
Kaum war der päpstliche Abgesandte Bonelli fort, so erfuhr er auch schon den Zweck der Mission, obwohl sie mit der größten Heimlichkeit betrieben worden war. Der Graf mag nun nicht wenig erstaunt gewesen sein, als ihm von einer Seite bedeutet wurde, er brauche sich nicht gar so aufzuregen, da ja der Kaiser bereits seine Zustimmung gegeben habe. Von anderen dagegen wurde er bestürmt, diesen unerhörten Eingriff in die Rechte des Kaisers und des Reiches energisch zurückzuweisen, und schon wurde da von Krieg gesprochen. Eine dritte Gruppe endlich gab ihrer Überzeugung dahin Ausdruck, daß der ganze Handel, so sehr auch der Kaiser aufgebracht sein möge, schließlich doch in Güte sich werde schlichten lassen – und zwar durch den Erlag einer größeren Geldsumme. Daß diese Bemerkung, die ebenso taktlos war, wie sie eine intime Kenntnis der chronischen Geldnot der Großmächte, allen voran des Wiener Hofes, verriet, gerade nicht geeignet erschien, auf Maximilian beruhigend einzuwirken, ist klar. Alles dieses und noch mehr berichtete Arco nach Hause. Über den Inhalt der Bulle selbst konnte er nichts erfahren; nicht einmal die Kardinäle, bei denen er anklopfte, wußten etwas davon oder gaben es vor.
Maximilian war indes bereits von Cosimo selbst schonend vorbereitet worden. Der Feldherr Aurelio Fregoso, der im letzten Türkenfeldzug das florentinische Hilfsvolk befehligte, fand sich Ende Oktober 1569 am Kaiserhofe ein, um Maximilian zur Vermählung der Erzherzoginnen Anna und Elisabeth zu gratulieren. Er bekam nun nachträglich den Auftrag, dem Monarchen ein vom 8. November datiertes Handschreiben Cosimos zu überreichen. Von einem geheimen Freunde und intimen Familiaren des Papstes, so heißt es in diesem Schriftstück, in welchem Wahrheit und Dichtung in der ergötzlichsten Weise abwechseln, sei ihm die vertrauliche Verständigung zugekommen, daß Pius ihn mit der Verleihung der Würde eines Großherzogs von Toskana »überraschen« wolle. Die Freude über diese Auszeichnung sei um so größer, als sie von einem so heiligen Papst ganz »spontan« erfolgte, ohne daß Cosimo nur im geringsten sich darum beworben oder sie erwartet hätte. Auch habe ja der Kaiser selber, als der Erbprinz in Wien weilte, seine Zustimmung bereits erteilt, die dann aber durch den bald darauf eingetretenen Tod des Papstes Pius IV. gegenstandslos geworden sei.
Der Kaiser, dem Aurelio Fregoso am 28. November seine Werbung vorbrachte, mag über die »göttliche Inspiration« des Heiligen Vaters nicht sonderlich erfreut gewesen sein, aber Unliebenswürdigkeit war nicht seine Art, und so fertigte er den Kriegsmann mit einigen höflichen Redensarten ab, die dieser alsbald durch einen Eilboten nach Florenz weitergab, wo man eben mit den letzten Vorbereitungen zum festlichen Empfange des Überbringers der päpstlichen Bulle beschäftigt war. Daß Cosimo vom Papst zugleich auch die Königsinsignien verliehen erhalten hatte, das war dem Kaiser wohlweislich verschwiegen worden. Und ebensowenig wurde diesem etwas von der Absicht Cosimos verraten, sich in Rom vom Papste selber feierlich zum Großherzog krönen zu lassen.
Natürlich konnte die Tatsache der Romreise nicht verheimlicht werden. Cosimo entschloß sich daher, dem Kaiser offiziell davon Mitteilung zu machen, ohne indes ihren Zweck aufzudecken. Er wolle nur dem Papst, so schrieb ihm Cosimo am 17. Januar, eine Visite machen, um ihm für die so große »spontane« Gunstbezeugung seinen Dank auszusprechen. Unterfertigt war dieses Schreiben bereits mit dem neuen Titel »Großherzog von Toskana« und jenes des Erbprinzen, das beigelegt wurde, mit »Prinz von Toskana«.
Aber von anderer Seite, von seinem Geheimagenten Cusano, der an allen Türen des Vatikans horchte und meistens sich gut unterrichtet zeigte, erfuhr Maximilian, was Cosimo im Schilde führte. Sofort wurde der Botschafter Graf Arco angewiesen, sich Klarheit darüber zu verschaffen und, falls wirklich eine öffentliche feierliche Krönung in Aussicht genommen sei, ungesäumt dem Papst vertrauliche Vorstellungen zu machen: Als Oberhaupt des Reiches könne der Kaiser unmöglich dulden, daß seinen Rechten in solcher Weise präjudiziert werde, und müsse er, wenn die Kurie auf ihrem Vorhaben bestehe, mit öffentlichem Protest vorgehen.
Als Graf Arco sofort nach Erhalt seines Auftrages, am 13. Februar, im Vatikan erschien, wurde gerade der große Krönungssaal für Cosimo hergerichtet – er wußte also jetzt, daß das Gerücht nicht gelogen hatte. Sofort ließ er sich beim Papst anmelden, und es kam nun zu einer erregten Auseinandersetzung, die sich um die Rechte des Papstes und des Kaisers und die Frage drehte, ob Florenz wirklich frei und nicht, wie man kaiserlicherseits behauptete, ein Reichslehen sei. Der Heilige Vater war indes nicht zu bewegen, von der Krönung abzustehen. Aber durch das geharnischte Auftreten des kaiserlichen Gesandten doch etwas unsicher gemacht, billigte er schließlich dessen Vorschlag, Cosimo selber dadurch, daß man ihm die Folgen vorhielt, zum Verzicht zu bewegen.
Der Großherzog traf zwei Tage darauf in Rom ein. Arco nahm sofort mit ihm Fühlung und machte ihm seinen Standpunkt klar. Cosimo beteuerte, bei seiner Abreise aus Florenz keine Ahnung – er hatte indes die Krönungsinsignien mitgebracht – gehabt zu haben, was ihm hier bevorstehe, versprach aber schließlich, mit dem Papst deswegen Rücksprache nehmen zu wollen. Am nächsten Tag – es war der 18. Februar – ging Graf Arco, der gehört hatte, daß die Bulle im Konsistorium verlesen werden sollte, wieder zum Heiligen Vater und erfuhr zu seinem Erstaunen, daß Cosimo mit diesem darüber kein Wort gesprochen hatte. Der Papst schien im Gegenteil viel fester als das letzte Mal, da er mit Arco verhandelte. Schroff erklärte er, im Konsistorium das tun zu wollen, was ihm Gott eingebe, und überhaupt könne er machen, was ihm beliebe. Die Päpste waren es, fügte er gereizt hinzu, die sogar die Kaiser bestätigten und das römische Reich vom Orient auf den Okzident übertrugen.
Arco merkte aus dem veränderten Ton der päpstlichen Sprache gleich, woher der Wind wehte und in welcher Weise Cosimo sein Versprechen, auf den Papst einzuwirken, eingelöst hatte. Wenn Seine Heiligkeit, erwiderte er mit feiner Ironie, wirklich das tun werde, wozu ihn der Allmächtige inspiriere, so dürfte allerdings kein Unheil entstehen. Doch möchte er gerne verhüten, daß der Papst das tun wolle, was ihm andere einflüsterten; denn dann müßte er notgedrungen ebenfalls das vornehmen, was ihm vom Kaiser befohlen wurde. Aus dem Umstande, daß die Päpste einst die Kaiser bestätigten und das römische Reich nach dem Westen verpflanzten, folge noch keineswegs, daß sie sich in die weltliche Jurisdiktion des deutschen Reiches einmischen dürften, und man habe auch seit dreihundert Jahren kein Beispiel dafür erlebt. Übrigens hätten eine Zeitlang umgekehrt die Kaiser die Päpste bestätigt. Der Papst möge nicht das bißchen Friede auf Erden untergraben. Der Schluß war wieder, daß Pius versprach, mit Cosimo reden zu wollen.
Zwei Stunden später ging der Heilige Vater ins Konsistorium, wo alles schon zum Empfang des Großherzogs, der mit fünftausend Reitern eingezogen kam, bereitstand. Der kaiserliche Botschafter folgte ihm dahin, und als der Konsistorialadvokat geendet hatte, protestierte der Graf und erhob sich in dem Moment demonstrativ zum Gehen, da Cosimo unter großem Gepränge hereingeleitet wurde. Die Verlesung der Bulle im Konsistorium war indes nur das Vorspiel zur Krönung, die für den Sonntag Lätare, den 5. März, in Aussicht genommen wurde.
Unterdessen setzten sich geschäftige Hände in Bewegung, um den kaiserlichen Gesandten umzustimmen und eine Wiederholung des Protestes am Krönungstage zu verhüten. Doch umsonst. Arco konnte nicht umhin, seinem Ärger darüber Ausdruck zu geben, daß sich einer auf den anderen ausrede. Dem florentinischen Staatskanzler Concino, der auch noch seine Kunst versuchte, warf er den alten Rechtsgrundsatz an den Kopf: »In invitum non confertur beneficium«. Cosimo müsse, erklärte er, die ihm aufgedrungene Auszeichnung ablehnen, widrigenfalls er gegen die Krönung protestieren werde.
Und dies tat denn Arco am frühen Morgen des 5. März, da die feierliche Krönung stattfand. Er fügte seinem Protest die Ankündigung bei, daß auch der Kaiser seinerseits Verwahrung einlegen werde. Nachdem er so seine Pflicht erfüllt hatte, erstattete er seinem kaiserlichen Herrn über seine Amtshandlung einen ausführlichen Bericht und fügte Ratschläge bei, die ihm von »einigen« Freunden – und zu ihnen dürfte er sich selbst gezählt haben – zugekommen seien. Der Kaiser möge erstens die Reichsfürsten in Kenntnis setzen und deren Gutachten einholen, zweitens den Lehensmännern in Italien verbieten, Herzog Cosimo den neuen Titel zu geben; drittens endlich könnte der Kaiser im Einvernehmen mit dem König von Spanien Siena als verfallenes Lehen erklären, ihm die Führung des Titels untersagen und für den Fall, daß er nicht gehorche, ihn zitieren.
Die Mitteilungen des Grafen kamen am 16. März nach Prag, wo der Kaiser Hof hielt, und verfehlten nicht ihre Wirkung. Maximilian zeigte sich über den ihm von Rom widerfahrenen »fürsetzlichen Fürgriff und öffentlichen Despekt« ungemein aufgebracht. In großer Erregung teilte er dem spanischen Botschafter das Vorgefallene mit. Und schon nach acht Tagen reisten die beiden Hofräte Gabriel Strein von Schwarzenau und Doktor Andreas Gail nach Rom, um neuerlich vor dem Papst und den Kardinälen »in aller Form« zu protestieren.

Cosimo I., Herzog von Florenz
Am 29. März fand in der Prager Burg die feierliche Zeremonie der Protestation statt. In Gegenwart mehrerer Erzherzöge, Räte und Gesandten gab zunächst der Vizekanzler Zasius in lateinischer Sprache eine lange Erklärung des Inhaltes ab, daß sich der Kaiser genötigt gesehen habe, das, was der Gesandte in Rom getan, hier zu ratifizieren und durch diesen erweiterten Protest seinen Willen kundzutun. Darauf reichte der Kaiser die vorbereitete Staatsschrift dem Vizekanzler, dieser wieder dem Sekretär Doktor Martin Gerstmann, der sie zur Verlesung brachte. Nachdem dies geschehen, nahm sie Zasius wieder zu sich und übergab sie dem Notar Andreas Erstenberger zur endgültigen Ausfertigung. Diese Protesturkunde wurde sodann den Gesandten nachgeschickt, die befehlsgemäß ihren Weg nicht über Florenz nahmen, um den Papst mit der Note überraschen zu können, bevor er noch von Cosimo bearbeitet werden konnte.
Am 24. April fand in Anwesenheit von einundzwanzig Kardinälen der große Protestakt statt, nachdem von Seite der Kurie noch allerlei Schwierigkeiten gemacht worden waren. So hatte der Papst verlangt, daß die beiden Gesandten, von denen der eine noch dazu ein Protestant war, so daß man ihn gar nicht empfangen wollte, nach dem Fußkusse den Vortrag kniend verrichten sollten – welche Forderung aber dann dahin abgeändert wurde, daß sie in kniender Stellung bloß zu beginnen hätten, nach einer Weile aber, aufgefordert oder nicht, sich erheben dürften. Doktor Gail, der eine, las den kaiserlichen Protest herunter und schloß mit den Worten: Kaiser Maximilian zweifle nicht daran, Seine Heiligkeit werde so bald als möglich Vorsorge treffen, daß das seiner Jurisdiktion zugefügte Unrecht wieder gutgemacht würde.
Selbstverständlich gab die Anwesenheit des kaiserlichen Spezialgesandten den »Contemplativen« reichlichen Anlaß, die Folgen des kaiserlichen Einspruches eifrigst zu erörtern. Die einen meinten, es werde in Italien zum Krieg kommen, wie ja solche Gerüchte schon unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Verleihung der Großherzogswürde im Umlauf waren. Und da wollte man wissen, daß auf dem bevorstehenden Reichstag in Speyer ein energischer Schritt gegen Florenz erfolgen werde. Andere aber glaubten wieder, es werde alles im Sande verlaufen, und zwar waren es gerade die Florentiner, die dieser optimistischen Auffassung anhingen.
In etwas gedrückter Stimmung war der neue Großherzog am 21. Mai nach Florenz zurückgekehrt. Seine Heimreise geschah in aller Stille, ohne jeden Pomp. Offenbar wollte er den Kaiser nicht noch mehr reizen. Vier Tage darauf schrieb er Maximilian einen von Ergebenheit triefenden Brief, worin er die vollzogene Krönung anzeigte und sein Vorgehen rechtfertigte. Nochmals findet sich da die feierliche Versicherung, nicht gewußt zu haben, daß ihn der Papst krönen werde. Die ihm zugedachte Ehrung aber habe er nicht ausschlagen können, weil ihm das vom Heiligen Vater als Undank wäre gedeutet worden. Übrigens habe er seinen Aufenthalt in Rom dazu benutzt, bei der Kurie eine große Liga der christlichen Fürsten gegen die Ungläubigen anzuregen.
Aber dieses Schreiben mit dem verlockenden Angebot eines gemeinsamen Feldzuges gegen die Türken wurde Cosimo, der sich wieder als Großherzog unterschrieben hatte, zurückgestellt. Cosimo beantwortete den unfreundlichen Akt damit, daß er seinen Gesandten anwies, die Auszahlung der Mitgift für die Prinzessin Johanna in der Höhe von hunderttausend Gulden, die noch nicht erfolgt war, zu verlangen. Diese Demonstration scheint ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Bald ergab sich für den florentinischen Gesandten, der sich seit Jahr und Tag schmollend im Hintergrunde gehalten, eine Gelegenheit zur Aussprache mit dem Kaiser und seinen Räten, und siehe da: Maximilian schien nicht mehr so erzürnt. »Wir wollen sehen,« bemerkte der Kaiser, »was der Papst auf die Protestnote zur Antwort geben wird.« Man hatte Zeit gewonnen, um auf eine friedliche Beilegung des Streites hinzuarbeiten. Schon sprach man davon, wie der kaiserliche Geheimagent Cusano am 6. Mai aus Rom berichtete, daß sich der Kaiser nur so entrüstet gestellt habe.
War nun das Ganze wirklich nur eine Komödie? Oft schien es freilich das Gegenteil zu sein, und sowohl der apostolische Stuhl wie der Mediceerhof sollten Jahre hindurch in banger Sorge schweben. Niemals hat sich die virtuose Handhabung der diplomatischen Künste der Verstellung von Seiten Maximilians glänzender bewährt, als in diesem Kampfe um die Großherzogswürde, wo es ihm gelang, die gerissensten Staatsmänner an der Nase herumzuführen und die Welt in Spannung zu halten.
Von allem Anfang an wußte man in Wien dem Großherzogstreit eine derartige Wendung zu geben, daß das Odium dem Heiligen Vater in Rom zufiel. Auf dem Reichstage von Speyer wurde die Angelegenheit tatsächlich den Ständen mitgeteilt, und die drohende Sprache, welche die protestantischen Kurfürsten von Pfalz und von Sachsen führten, bereitete dem Papst keine geringe Sorge. Auch Spanien, das über die Titelverleihung ebenfalls verstimmt und vom Kaiser zu einem gemeinsamen Vorgehen aufgefordert worden war, zeigte sich ob dieser Wendung höchlich betroffen. Philipp II. wollte wieder ausschließlich Cosimo als den Missetäter behandelt sehen, und in Florenz gab es Momente, da man sich eines Angriffes von Seiten Spaniens versah. So war die durch den Titelstreit geschaffene Lage so gespannt wie nur möglich. Aber eben deshalb zeigte sich auch da und dort das Bestreben, der gefährlichen Situation ein Ende zu machen.
Schon bevor sich der Reichstag in Speyer versammelte, waren am Kaiserhofe vom Kardinal Delfino und dem florentinischen Gesandten Bischof Antinori die Grundzüge eines Ausgleiches entworfen worden: Cosimo nimmt die ihm vom Papst verliehene Würde aus der Hand des Kaisers und zahlt sodann eine größere Geldsumme. Freilich wie diese »Retraktion« im einzelnen vor sich zu gehen habe, darüber herrschte noch keine Klarheit, und es sollten darüber viele Jahre verstreichen. Am Kaiserhofe hatte man keine Eile, weil er aus der Verlegenheit der römischen Kurie und der Mediceer Kapital zu schlagen verstand. Maximilian hielt sich – es war die Zeit, da die österreichischen Stände auf die Bestätigung der Religionskonzession drängten – Rom und Spanien einigermaßen vom Leibe und nahm die Versicherung der Florentiner, daß er über sie, falls die Sache endlich geordnet würde, wie über »Sklaven« verfügen könne, mit sichtbarer Genugtuung entgegen. Die Geheimen Räte, vor allem der Vizekanzler Weber, der Zasius überlebte, sammelten sich aus den ihnen reichlich zufließenden Geschenken ein beträchtliches Vermögen.
Zwei Ereignisse waren es vor allem, die aus dem Labyrinth, in welchem sich die gewiegtesten Rechtsgelehrten nicht mehr zurechtfanden, ins Freie führten. Das war einmal der Tod des »Großherzogs« Cosimo, der nach langem Siechtum am 21. April 1574 eintrat und eine neue Situation schuf. Denn Francesco hatte noch zu Lebzeiten seines Vaters seinem kaiserlichen Schwager zu erkennen gegeben, daß er an der ganzen Sache unschuldig sei und einen Ausgleich herbeisehne.
In anderer Hinsicht bedeutete freilich das Hinscheiden des alten Fürsten für den Wiener Hof eine Katastrophe. Cosimo war es nämlich gewesen, der schon aus Rücksicht auf den Kaiser über seine Schwiegertochter Johanna stets die schützende Hand breitete. Kaum daß nun Francesco Medici die Herrschaft übernommen hatte, legte er alle Zurückhaltung im Verkehr mit seiner Geliebten ab. Bianca Capello trat in der Öffentlichkeit wie die eigentliche Großherzogin auf, während Johanna so knapp gehalten wurde, daß sie ihre Kleinodien versetzen mußte. Als ein Armer sie einmal, so wird erzählt, um ein Almosen anging, gab sie ihm bitter zur Antwort: Er poche an die unrechte Türe, er möge zur Venezianerin gehen.
Noch ehe ein halbes Jahr seit Cosimos Tode verstrichen war, sah sich der Kaiser genötigt, ernstlich in Erwägung zu ziehen, was mit Johanna zu geschehen habe. Er wandte sich an seine beiden Brüder und an den bayerischen Schwager, um ihr »Gutbedunken« in dieser heiklen Frage einzuholen. »Aber der Hertzog und main Schwester,« so schreibt er am 9. Oktober an Albrecht, »meo judicio laborant in extremis et medium invenire inter extrema est dificile.«
In der Tat war hier schwer ein Ausweg zu finden, wie dies auch aus der gewundenen Antwort des Bayernherzogs hervorgeht. »Wann mans«, erwidert er im Stile des delphischen Orakels am 27. Oktober, »kundt bai ainander behallten und in ain gleichen Verstandt bringen, were es wol guet, sonderlich weil der Hertzog auch kain Son hat und wenn sy schon auf beeden Tailen nachgeben und ainander nit alles so ubl aufnemen, wurde es vileicht mit der Zeit wider besser werden. Wo aber je kain Ainigkeit zu verhoffen soll sein, so dunkt mich, ja eher manns konndt mit Glimpff und Fuegen von ainander, je besser es sein solt; dann die Ding zwischen einem Eevolgkh sich je lennger je mer einreißen und hietziger werden. So haben die Walhen (= Welschen) weite Gewissen, weil er keinen Mannserben hat …«
Es kam in der Folge zu einem diplomatischen Schritt des Wiener Hofes in Florenz, der freilich keine dauernde Besserung im Verhältnis der beiden Gatten herbeiführte. Johanna brachte im Mai 1577 einen Prinzen zur Welt, doch schon ein Jahr darauf, am 11. April 1578, verschied sie im Kindbett und der Großherzog konnte – kaum zwei Monate später – Bianca, deren Gatte acht Jahre vorher ermordet worden war, die Hand zum Ehebunde reichen. »Wir muessen Gott danken,« schrieb die Herzogin Anna von Bayern an Erzherzog Ferdinand, »daß unser geliebte Schwester von irer hochbedrangten Kommernis gnediglich entledigt worden ist, und allein die Kinder dem lieben Gott befehlen.«
Das zweite Ereignis, das die Lösung des Titelstreites ins Rollen brachte, war die Kandidatur des Herzogs Alfonso von Ferrara um die polnische Königskrone nach der Flucht des Königs Heinrich von Anjou im Mai 1574. Durch diesen feindseligen Schritt – denn auch Maximilian bewarb sich, wie wir noch hören werden, um den erledigten Thron – waren die Rücksichten, die man am Kaiserhofe stets für Ferrara besaß, hinfällig geworden, und damit war das letzte Hindernis aus dem Wege geräumt. Auch jetzt dauerte es noch ein Jahr, bis die verwickelte Angelegenheit endgültig bereinigt wurde, und dies geschah auf dem Regensburger Wahltage vom Jahre 1575 in der Form, daß Francesco nach Ablegung der seinem Vater erteilten Würde vom Kaiser zum Großherzog von Toskana ernannt wurde. Ursprünglich wollte man ihm nur den Titel eines Großherzogs »in Florenz« ohne den Titel »Serenissimus« geben, aber durch ein reichliches Geldgeschenk an den Vizekanzler Weber wurde die Einschränkung verhindert. Doch wurde die Anerkennung der Unabhängigkeit des Großherzogtums vom Reiche, der »Freiheit«, versagt und damit dem späteren Anfalle des Mediceerstaates an das Haus Habsburg-Lothringen im Jahre 1737 der Weg geebnet.
Die Versicherung, die Cosimo nach seiner Rückkehr von den Krönungsfeierlichkeiten in Rom dem Kaiser gab, er sei dort für einen großen Bund aller christlichen Fürsten zur Bekämpfung der Türken eingetreten, entsprach der Wahrheit – so wenig genau er es sonst mit ihr gehalten haben mag. Eine andere Frage ist, ob er nicht damit, wie dies sofort kaiserlicherseits behauptet wurde, nur ein Manöver ausführte, um die Aufmerksamkeit von der Titelfrage abzulenken und Maximilian zu gewinnen.
In der Tat lag dem Kaiser keine andere Frage näher, als die Sicherung seiner Länder vor den Türken, die den größeren Teil Ungarns besetzt hielten und von dort, auch im Frieden, ihre verheerenden Streifzüge unternahmen. Aus diesem Grunde hatte er seit jeher allen Bestrebungen, die der gemeinsamen Bekämpfung des Erbfeindes der Christenheit galten, das regste Interesse entgegengebracht, und an solchen fehlte es die ganzen Jahre her nicht, wenn sie auch bisher von keinem greifbaren Erfolge begleitet waren.
So hatte man bei der denkwürdigen Bayonner Zusammenkunft im Sommer 1565 über eine solche Liga verhandelt. Die Anregung dazu ging von der Königin-Mutter Katharina von Medici aus, die aber, wie Herzog Alba später seinem König schrieb, derart »impertinente« Bedingungen an ihr Zustandekommen knüpfte, daß man auf sie nicht eingehen konnte. Es erscheint auch wirklich äußerst fraglich, ob es die ränkesüchtige Herrscherin, die kurz vorher einen türkischen Gesandten empfangen hatte, ernstlich darauf angelegt hatte, die geradezu schon traditionelle Freundschaft mit der Pforte aufzugeben. »Wollte Gott,« schreibt Maximilian am 30. Oktober 1565 an Dietrichstein, »daß es Frankreich ernst würde, dann es das rechte Mittel wär ad opprimendos Turcos.« Allein auch von Seiten Spaniens, das wohl stets die allerselbstsüchtigste Politik betrieb, war das Interesse für die Türkenliga nicht ganz ehrlich. Es liebäugelte mit ihr nur so lange, als die Gefahr bestand, daß die Osmanen in das Mittelmeer vorstießen und seine Lande bedrohten. Als Philipp II. auf Grund sicherer Nachrichten damit rechnen konnte, daß die Türken – man wußte das in Wien seit Anfang Mai 1565 – ihren Hauptstoß nach Ungarn, also gegen seinen deutschen Vetter, richten würden, winkte er dem Kaiser deutlich ab.
Mit dem Pontifikat Pius V., der bald darauf, im Januar 1566, den Thron bestieg, bekam der Gedanke einer Türkenliga neues Leben, denn der ganz mittelalterlich gestimmte Asket ergriff ihn mit wahrem Feuereifer. Gleich beim ersten Reichstag in Augsburg erhielt sein Legat Commendone den Auftrag, Kaiser Maximilian für diesen Plan zu gewinnen. Anstatt über die Religion herumzustreiten, ließ er sagen, sollte man über die Mittel zur wirksamen Bekämpfung des Erbfeindes reden. Allein es kam die Frage, so sympathisch ihr auch der Monarch gegenüberstand, nicht zur Behandlung – und dies hatte auch wieder seinen guten Grund. Gerade weil der zelotische Papst sie aufgeworfen hatte, setzte sich bei den Protestanten die Meinung fest, es handle sich bei der Türkenliga um nichts anderes als um ein »päpstliches Bündnis«, eine Vereinigung christlicher Fürsten zur »Ausrottung der Ketzer«, und der Argwohn war gewiß nicht ganz aus der Luft gegriffen. Kurz, man traute der Sache nicht recht, und Maximilian nahm auf diese Stimmung Rücksicht.
Um so mehr dachte der Kaiser an ein gemeinsames Vorgehen mit Spanien. Aber sein Botschafter in Madrid erkannte bald die völlige Aussichtslosigkeit aller darauf zielenden Bemühungen, »weil«, wie er dem Kaiser am 4. November 1566 schreibt, »das Mißtrauen unter den christlichen Pottentaten und Stenden so gros, daß man sich kainer Verainigung und Verbindung gegen diesen Feint bei inen zu getresten«. Im März des nächsten Jahres rät Dietrichstein auf Grund seiner intimen Kenntnis der Stimmung in Spanien dem Kaiser, mit den Türken Frieden zu schließen. Mittlerweile hatte Philipp II. mit dem Aufstand der Niederlande genug zu schaffen. »Dieweil es leider an dem,« so schreibt Maximilian am 28. September 1567 Dietrichstein, und man erkennt hier deutlich seine Verbitterung, »das niemants Lust und Willen hat, wider den Erbfeind, den Türken, zu kriegen, aber da man sonst unnötige Empörungen anzurichten und einer dem andern das Seinige zu nehmen weißt, jederman lustig und willig ist.« So müsse man denn, schloß er, das ganze Werk auf sich beruhen lassen.
Mit dem Abschluß des auf acht Jahre geltenden Adrianopler Friedens von 1568 hatte der Kaiser etwas Luft bekommen. Vollständige Ruhe trat auch jetzt nicht ein, und überdies machte sich in Ungarn selbst eine wachsende Mißstimmung gegen die kaiserliche Herrschaft fühlbar. Man klagte über Übergriffe der Besatzungstruppen, über Bevorzugung der Deutschen bei Besetzung der militärischen Befehlshaberposten, über die Erlässe der deutschen Hofkanzlei in rein ungarischen Angelegenheiten und anderes mehr. Viele namhafte Magnaten, wie der Großwardeiner Bischof Forgach, traten zum Wojwoden Zápolya über. Andere, wie Stephan Dobó und Johann Balassa, unterhielten mit Siebenbürgen geheime Verbindungen, und diese Hinneigung war umso bedenklicher, als Zápolya alle Hebel in Bewegung setzte, um einen Bruch des Friedens mit der Pforte herbeizuführen und gemeinsam mit den Türken über die habsburgische Monarchie herzufallen. Indes, Sultan Selim wollte noch in Ungarn Ruhe haben, denn er hatte die Eroberung der Insel Cypern ins Auge gefaßt.
Mitten in den Vorbereitungen zum festlichen Empfang des Großherzogs Cosimo, im Februar 1570, war in der ewigen Stadt die Nachricht eingetroffen, daß die Republik Venedig entschlossen sei, den Waffengang mit den Cypern bedrohenden Türken aufzunehmen und den Papst um Unterstützung gebeten habe. Diese Kunde erschien wohl geeignet, die ganze abendländische Christenheit in Bewegung zu versetzen. Wäre es eine Angelegenheit gewesen, die nur die stolze Dogenstadt anging, so hätte man sich so ziemlich überall herzlich gefreut und in deren Bedrängnis die wohlverdiente Strafe Gottes dafür gesehen, daß sie so oft mit den Türken gemeinsame Sache machte und die schönen Pläne der römischen Kurie durchkreuzte. Wie die Dinge aber im Augenblicke lagen, besorgte man mit Recht, daß die Ungläubigen bei Cypern nicht Halt machen würden. Spanien sah sie schon vor seinem afrikanischen Stützpunkt La Goletta und seinen eigenen Küsten.
In dem Konsistorium vom 27. Februar, wo das Hilfsgesuch der Markusrepublik zur Verhandlung kam, brachte Pius V. auch die ihm so sehr am Herzen liegende Frage der Türkenliga zur Sprache. Man sollte meinen, daß in einem Moment, da sich alle christlichen Mächte gefährdet sahen, die Anregung des apostolischen Stuhles mit Begeisterung aufgenommen worden sei – weit gefehlt! Nicht einmal das zunächst bedrohte Venedig wollte etwas von einer Liga hören, von einem Zusammengehen mit Spanien, weil es – und gewiß nicht mit Unrecht – überzeugt war, daß dieser Staat das Bundesverhältnis nur für seine eigenen Zwecke ausnützen werde. Zu frisch waren noch die Erfahrungen, die man mit der letzten Liga von 1538 gemacht, im Gedächtnis, noch hatte man nicht die eigentümliche Kriegführung Dorias vergessen, die Venedig nötigte, einen unvorteilhaften Frieden zu schließen. Die Dogenrepublik verlangte Unterstützung, aber keine Liga, die nur, wie sie fürchtete, Spanien zugute kommen würde.
Und Spanien? In dem Konsistorium verwahrte sich Kardinal Granvelle, der Hauptvertreter der spanischen Interessen an der Kurie, mit aller Entschiedenheit gegen eine Hilfeleistung an die Republik, die sie absolut nicht verdiene. Mit einem derart unzuverlässigen Staat wie Venedig in ein festes Bündnis zu treten, dagegen spreizte sich Spanien mit Händen und Füßen, und es verfolgte mit diesem Widerstand eine sehr praktische Politik: es wollte sich so, indem es sich bitten ließ, die größten Vorteile und Zugeständnisse herausschlagen und beim Abschluß des Bundes derart dastehen, daß es dabei nur gewinnen konnte, ohne etwas dabei zu riskieren.
So hing denn alles vom Heiligen Vater ab, ob er Spanien die gewünschten Konzessionen zu machen gewillt war oder nicht, und dazu standen die Aussichten nicht sehr günstig. Die finanzielle Opferwilligkeit des Papstes Pius V. war nämlich ebenso gering, wie die Anforderungen Spaniens groß waren. Da galt es also zu vermitteln, die scharf aufeinander platzenden Gegensätze zu überbrücken, die verschiedenartigen Interessen unter einen Hut zu bringen, und dieser Aufgabe unterzog sich Cosimo bei seinem Aufenthalt in Rom. Er stellte dem Papst vor, daß es sich hier nicht um Cypern oder Candia handle, sondern um ganz Italien, um die gesamte Christenheit, und entwarf einen weitgespannten Kriegsplan mit dem Ziele, den Erbfeind durch die Flotte der Verbündeten und zugleich durch ein großes Landheer in Ungarn zu fassen und zu erdrücken. Man darf annehmen, daß er auch das Wichtigste, die Kostenfrage, berührte und seine tatkräftige Unterstützung in Aussicht stellte.
Auch an den Kaiser erging von Seiten der römischen Kurie die Aufforderung, der Türkenliga beizutreten, die freilich noch nicht gebildet war. Maximilian sah sich dadurch in eine Flut widerstreitender Empfindungen versetzt. Gewiß, die Aussicht, durch eine große gemeinsame Aktion den Erbfeind aus Ungarn zu vertreiben, zum mindesten aber die Scharte vom letzten Feldzug auszuwetzen, hatte viel Verlockendes an sich, und deshalb war er ja selber dem Plan einer Liga näher getreten. Aber waren nun die Zweifel über den Erfolg solcher Bestrebungen, die ihn in der letzten Zeit befallen hatten, hinfällig gworden? Wußte er bestimmt, daß es Cosimo mit dem neuen Projekt überhaupt ernst sei? Der Gesandte Graf Arco hatte den Verdacht ausgesprochen, man wolle nur damit die Aufmerksamkeit vom Großherzogstreit ablenken. Und sein Geheimagent Cusano behauptete sogar, daß der Papst die Liga als Mittel ansehe, um, ohne Verdacht zu erwecken, Gelder zu sammeln und im Vereine mit Florenz über Ferrara herzufallen. Nun sollte er um einer derart unsicheren Sache willen den sicheren Krieg mit den Türken auf den Hals sich ziehen? Gerade jetzt herrschten in Ungarn erträgliche Zustände. Überdies hatte der Wojwode von Siebenbürgen die Absicht zu erkennen gegeben, mit dem Kaiser in ein engeres Verhältnis zu treten, und man verhandelte sogar über eine Ehe Zápolyas mit der Prinzessin Maria von Bayern, einer Nichte des Kaisers.

Don Juan d'Austria
Noch hatte der Kaiser die schwere Enttäuschung über den Ausgang des letzten Türkenfeldzuges nicht verwunden, noch hafteten viele von den damals bewilligten oder in Aussicht gestellten Geldhilfen aus. Der Bericht, den Georg Ilsung am 3. Mai 1570 dem Kaiser über die »erlegten Hülfen« erstattete, klang wenig verheißungsvoll. Danach war man mit noch 538 000 Gulden im Rückstand. Täglich müsse er von den Ständen hören, so heißt es da, wie sie durch die vergangenen Kriegsempörungen, Brandschatzungen und Plünderungen, durch Mißernten und unerhörte Teuerung an ihren Kammergütern gänzlich erschöpft seien und von ihren Untertanen aus gleichen Gründen nicht mehr die jährlichen Dienste, noch viel weniger die gewöhnlichen Steuern erhalten könnten. Wenn er die Stände wegen der ausstehenden Gelder mahne, erhalte er scharfe Antworten. So habe ihm der Kurfürst von der Pfalz öffentlich geschrieben: Er habe gegen die Hilfe protestiert. Derselbe schulde noch an die 44 000 Gulden, aber nicht einmal die Hälfte wolle er erlegen. Aus dem ober- und niedersächsischen Kreise wollten einige weltliche Fürsten gar nichts entrichten, »mit hastiger Vermeidung, daß sie selbst zu keinem Vorrat kommen, viel weniger anderen zu einem Vorrat verhelfen könnten«. Die Kurfürsten von Sachsen, von Brandenburg und von Köln, ferner die Stadt Lübeck hätten Ende April 1570 noch nicht einen Heller erlegt; die Stadt Hamburg, die 8640 Gulden entrichten sollte, habe erst 220 eingezahlt. »Die allergrößte Verhinderung« an der Türkenhilfe liege darin, »daß alle geistlichen und weltlichen Stände, wenige ausgenommen, gar übel hausen und ihre Einkommen, Land und Leute zur Erfüllung des schändlichen Prachts dermaßen versetzt und verschwendet haben, daß sie anjetzt mehrernteils nur aus der armen Untertanen Schweiß und den jährlichen Steuern leben und sich erhalten müssen«.
»Ist nicht schier zu verzweifeln,« so faßte der kaiserliche Feldoberst Schwendi den kläglichen Zustand der Indolenz im Reiche zusammen, »daß auch die höchste Not und Gefahr alle Welt kalt und lau läßt, und Fürsten und Herren, nicht angesehen, daß der Erbfeind immer näher rückt, in unchristlichem Aufwand und wilden Gesäufen dahinleben, und die armen Untertanen wohl gar um das erlegte Türkengeld betrügen dürfen? Die gegen den Feind ziehen wollen, üben sich im Saufen und Spiel.« Und ähnlich wird in dem Aufruf zum christlichen Heerzug wider die Türken aus eben demselben Jahre 1570 geklagt: »Aller Christen höchster und löblichster Intent und Ziel sollte es sein, das Reich und die Christenheit mit Aufbietung aller Kräfte zu schützen und die Freveltaten zu strafen und zu rächen. Aber da ist keiner im Reich, der sich angreifen will, jedweder wartet auf den andern, Zwieträchtigkeit regiert, bis wir alle verderben.«
Mit Mühe und Not bewilligten die Reichsstände auf dem Speyerer Reichstag von 1570 dem Kaiser für den Zweck der Grenzbefestigung, um »der Gefahr einer türkischen Invasion zu entgehen und den noch übrigen geringen Teil der Krone Ungarns als Vorwerk und Bollwerk deutscher Lande zu benützen«, einen Beitrag, der freilich auch wieder nur auf dem Papier stand. Und wären die protestantischen Reichsfürsten, die in beständiger Sorge vor dem »päpstlichen Bündnis lebten, nun bereit gewesen, dem Aufruf zu einem im Namen des Papstes geführten Offensivkrieg Folge zu leisten?«
So zögerte denn der Kaiser, dem Wunsch des Papstes, »den ganzen Erdkreis gegen den Erbfeind der Christenheit zu einigen«, für seine Person nachzukommen. Auch dem Werben des spanischen Vetters, der jetzt, wo nicht Ungarn, sondern sein eigenes Reich bedroht erschien, für die Liga großes Interesse bekundete, wich er aus. Sicherlich hat der Kaiser über die Hilfsbereitschaft Spaniens nicht anders gedacht als sein Rat und Feldoberst Schwendi, der entschieden zur Wahrung des Friedens riet. Die Türken, so äußerte sich Schwendi im Juli 1570 zum venezianischen Gesandten, seien an den Grenzen ohne Zweifel mächtiger als der Kaiser, selbst wenn dieser von Spanien und von dem Reiche Hilfe erhalte. Von Spanien aber könne man keine große Unterstützung erwarten, da man dort nur auf den eigenen Vorteil bedacht sei und den Kaiser nicht zu groß werden lassen wolle, aus Furcht, er könnte sich dann in den Niederlanden zu schaffen machen. Was aber das Reich betreffe, so wäre es für Maximilian vorteilhafter, auf die Beseitigung der zwischen den Fürsten bestehenden Differenzen als auf einen neuen Krieg zu denken. Aus dieser Stimmung heraus erteilte der Kaiser dem spanischen Gesandten Monteagudo am letzten Januartag 1571 einen Bescheid, der ihm für die Zukunft vollkommen freie Hand ließ. Es sei noch zu früh, meinte er, man wolle erst sehen, wie sich die Dinge entwickelten.
Und sie entwickelten sich sehr langsam. Erst am 21. Mai 1571 wurde die »heilige Liga« zwischen Rom, Spanien und Venedig geschlossen und drei Tage darauf feierlich beschworen. Der Krieg sollte, so vereinbarte man, mit 200 Galeeren, 100 Transportschiffen, 50 000 Mann zu Fuß und 4500 Reitern gegen die Türken und die Mauren von Tunis, Tripolis und Algier geführt, die Hälfte der Kosten von Spanien getragen werden. Zum Oberbefehlshaber der Armada wurde Don Juan d'Austria bestimmt. Es wurde auch ausgemacht, daß keine der drei Mächte ohne Wissen und Willen der anderen Frieden schließen solle. König Karl IX. von Frankreich, der wiederholt zum Beitritt aufgefordert worden war, sandte wenige Tage nach Abschluß der Liga Franz von Noailles an die Pforte, um für den Krieg, den er im Vereine mit den Hugenotten gegen Philipp II. in den Niederlanden zu führen beabsichtigte, Subsidien zu erlangen.
Die Armada der Liga kam zur Rettung Cyperns zu spät. Aber sie brachte am 6. Oktober der großen Flotte der Türken in der Bucht von Lepanto eine vernichtende Niederlage bei. Der türkische Admiral Ali Pascha fand dabei seinen Tod, 20 000 der Seinen wurden teils getötet, teils gefangen genommen und mehr als 100 ihrer Schiffe vernichtet, die übrigen gekapert. Es war ein glänzender Sieg, der in der ganzen Christenheit freudigstes Echo erweckte. Der spanische Dichter Cervantes, der als Mitkämpfer seine linke Hand verlor, nannte die Seeschlacht von Lepanto den »schönsten Tag des Jahrhunderts«. Don Juan d'Austria wurde wie ein Gott gefeiert. Man hatte das richtige Gefühl, daß die Macht der Osmanen, wenigstens zur See, einen tödlichen Schlag erlitten habe.
Freilich, die unmittelbaren Folgen des Seesieges waren keineswegs bedeutend. Die Bemühungen des Papstes, die Liga weiter auszubauen, hatten keinen Erfolg. Der Kaiser war auch jetzt nicht bereit, ihr beizutreten. Er müsse sich erst, so erklärte er, mit seinen Brüdern und den Reichsständen ins Einvernehmen setzen. Die Kurfürsten, die sich im Juli 1572 in dem thüringischen Städtchen Mühlhausen versammelt hatten, um neuerdings gegen das spanische Gewaltsystem in den Niederlanden Sturm zu laufen, gaben dem Kaiser deutlich zu verstehen, daß sie »zu dem Türkenkrieg und dem welschen Bündnis nit große Neigung oder Lust« hätten, sondern es begrüßen würden, wenn der mit den Türken geschlossene Anstand gehalten und auf eine weitere Anzahl von Jahren ausgedehnt werde. Die Angelegenheit müßte der Entscheidung eines Reichstages vorbehalten bleiben, doch brauche sich der Kaiser damit nicht zu eilen. Schon äußerte man die Sorge, daß durch den Abfall eines oder des anderen Bundesgenossen die Last, die zuvor auf allen Teilhabern der Liga gelegen, dem »heiligen« Reiche zufallen werde.
Auch der Kaiser traute der Sache nicht. Er fürchte, so schrieb er am 21. Dezember an Herzog Albrecht, daß die Liga »geschlechten Beschtand« habe, »awer«, so fügte er wehmütig hinzu, »es ist laider dahin geraten, quod quilibet querit propria et pauci publica«. Der Bayernherzog gibt demgegenüber seinem Schwager zu bedenken, daß er durch seine Zögerung oder gar Weigerung, der Liga beizutreten, Ursache zur »Zertrennung dieses christlichen Bundes« gebe. Maximilian versichert ihm darauf, in seinem Schreiben vom 24. Februar 1573, »das mier und mainen Landen nit wenig daran gelegen, ja der ganzen Christenheit, das man disen Faind mechte in die Wait bringen, und wer solle es liber sehen und befürdern als ich, mues awer mit gueter Gewißhait und gueter Versicherung beschehen«.
Gerade damals, im Februar, kam der sächsische Kurfürst August zum Besuche des Kaisers nach Wien. Maximilian brachte auch die Frage der Türkenliga zur Sprache, und er zeigte sich, wie der Kaiser bemerkte, zur Förderung dieser Angelegenheit »nit ungenaigt«. Der Pfalzgraf Johann Kasimir scheint August diese Haltung sehr verübelt zu haben, denn er schrieb später, nach dem Tode des Kurfürsten: »Sachs seliger zu Wien hätt schier die sancta liga unterschrieben; Mutter Anna – Augusts Frau – hat stark am Wagen geschoben.« Noch im April stand Maximilian in Unterhandlung mit den Kurfürsten, doch der Pfälzer sprach sich gegen die Aufnahme von Beratungen aus.
Während so der Kaiser mit den Ständen wegen des Beitritts zur Liga verhandelte, war glücklich das eingetreten, was er immer besorgt hatte – sie brach auseinander. Venedig schloß mit der Pforte einen Frieden, unter den schmachvollsten Bedingungen, indem es die Insel Zypern, derentwegen der Krieg begonnen worden, an sie abtrat und noch obendrein sich zur Zahlung einer großen Geldsumme verpflichtete. Mit schmerzlicher Genugtuung teilte der Kaiser, als er von dem »Verrat« der Dogenrepublik Kunde erhalten hatte, am 12. April 1573 seinem sächsischen Freund diese große Neuigkeit mit: Nun hätten die Venediger, so schreibt er da entrüstet, »wider aller Menschen Gedenken und Hofnung einen schantlichen Frieden beschlossen mit den Türken, wider ieren gegewnen Glauben und Trauen und zu hogsten Schaden gemainer Christenheit, und do ich mich an (ohne) merere Gewißheit in ier Liga begewen hette, ware ich gar wol ankhumen. Der Taifl traue denen Laiten«.
Doch muß zur Rechtfertigung Venedigs gesagt werden, daß auch in Spanien eine starke Partei dafür eintrat, den Bundesgenossen im Stiche zu lassen. Wie könne König Philipp, so gab ihm am 12. Februar 1573 Herzog Alba zu bedenken, angesichts der Tatsache, daß ihnen Frankreich, England und alle Ketzer Europas zu schaffen machten, es verantworten, daß man so außerordentliche Opfer für einen Fremden bringe.
Nach dem Abspringen der Markusrepublik gingen auch für Spanien die Früchte des Seesieges von Lepanto rasch verloren. Daß der ehrgeizige Führer der spanischen Armada, Don Juan d'Austria, von einem Königreich in Morea oder in Afrika träumte, war schon einmal nicht geeignet, den mißtrauischen König zur Weiterverfolgung der Liga anzuspornen. Die beiden befestigten Stützpunkte der Spanier in Afrika La Goletta und Tunis fielen in die Hand der Türken. Die Nachricht von der Einnahme La Golettas, die Mitte Oktober 1574 in Wien einlangte, erzeugte am Kaiserhofe, wie der venezianische Gesandte Tron berichtet, »unglaubliche Niedergeschlagenheit«. Man erging sich in höhnenden Worten über die »Hoffart und Eigennützigkeit« der Spanier. Der Pascha Mustafa, der mit dem Kaiser verhandelte, erlaubte sich, wie Maximilian am 5. März 1575 seinem bayerischen Schwager schreibt, die anmaßende Bemerkung: Die Türken hätten die Venezianer mit Zypern und die Spanier mit Goletta und Tunis gestraft, »jetzt manglet inen alain der Papst, aber – so heißt es mit Anspielung darauf, daß die römische Kurie den Kaiserhof bekriegte – die Pepst hetten inen so fil ansehnlicher Dienst gethon in fil Weg, das er glaub, man wer ims auf dismal hingen lassen«.
Mittlerweile hatten sich in Ungarn wichtige Ereignisse vollzogen. Am 14. Mai 1571 war der Fürst von Siebenbürgen, Johann Siegmund Zápolya, im Alter von kaum 31 Jahren gestorben. Um die Würde des Wojwoden stritten sich Békes, der Vertraute des verstorbenen Fürsten, und Stephan Báthory von Somlyo, ein außerordentlich begabter Magnat, bis endlich der letztere als Sieger hervorging. Báthory, der dem Kaiser durchaus ergeben war, wurde am 25. Mai zum Wojwoden gewählt und in dieser Eigenschaft vom Sultan bestätigt. Der Kaiser bemühte sich, bei der Pforte eine Verlängerung des Friedens durchzusetzen, was auch im November 1574 gelang. Bald darauf starb Sultan Selim und es mußte von seinem Sohne und Nachfolger Murad III. die Bestätigung des Vertrages eingeholt werden, die am 22. November 1575 erfolgte. So herrschte in Ungarn Ruhe. Doch mußte man stets auf der Hut sein, denn den Türken war, wie Kaiser Maximilian oft und oft vertraulich sich äußerte, »nit gar fil zu vertrauen«.
Mit der ungarischen Frage hing aufs innigste ein anderes Problem zusammen, das damals dem Kaiser schwere Sorgen bereiten sollte – das polnische.
Früh suchte und fand der Wiener Hof auch den Weg zu einer engeren dynastischen Verbindung mit den polnischen Jagellonen. Gerade mit Rücksicht auf die Türkengefahr mußte es wertvoll erscheinen, in dem Lande, das seiner Lage nach gegen Ungarn eine Flankenstellung einnahm, festen Fuß zu fassen. So war es denn wohl kein bloßer Zufall, daß Ferdinands älteste Tochter Elisabeth die Gemahlin des Königs Siegmund II. August wurde. Allein nach einer kurzen Ehe von zwei Jahren starb sie, wie es hieß, an Gift, das ihr von der Schwiegermutter Bona gereicht worden. Der König heiratete nun die schöne Barbara Radziwill aus einem litauischen Adelsgeschlecht. Als auch diese zweite Gemahlin – man munkelte die gleiche Todesursache – verschieden war, klopfte Siegmund August neuerdings in Wien an, und Ferdinand zögerte nicht, dem letzten Jagellonen eine zweite Tochter zur Frau zu geben. Im Juli 1553 fand in Krakau die Hochzeit mit Katharina statt.
Allein auch ihr war es nicht beschieden, Siegmund August den heiß ersehnten Thronerben zu schenken. Es hieß wohl, die Königin sehe einem freudigen Ereignis entgegen – indes, es war eine Täuschung, und um so größer mag dann die Entfremdung gewesen sein. Als Katharina dann noch in eine schwere Krankheit verfiel, war der Bruch ein derart vollständiger, daß er sich vor der Welt nicht mehr verheimlichen ließ und den Wiener Hof zu einem diplomatischen Schritt veranlaßte.
Zu Ende des Jahres 1563 ließ Maximilian, damals noch König, bei seinem polnischen Schwager vertraulich anfragen, aus welchem Grund er sich von Katharina fernhalte, »auch ir wenig und in langer Zeit gar kain eeliche Beywonung gelaistet« habe. Siegmund August bestritt diese Tatsache nicht. Er vernachlässige seine Gemahlin, so gab er zur Antwort, nur deshalb, weil sie an dem Morbus comitialis, an Epilepsie, leide, diese Krankheit aber für den Gatten eine »Gefahr der Ansteckung« bilde, weshalb er Katharina meiden müsse. Selbst wenn er sich noch so ernstlich vornehme, mit ihr zusammenzuleben, so könne er es nicht, weil sich einfach seine ganze Natur dagegen auflehne. Darüber sei er selber ganz betrübt, glaube aber, so fügte er bedeutungsvoll hinzu, die Ursache dieses seines Unglückes in dem Umstand finden zu müssen, daß Gott jene Ehen zu mißfallen pflegten, die gegen die Vorschriften des göttlichen Rechtes und der katholischen Kirche seien.
Am Kaiserhofe wußte man nur zu gut, worauf der schlaue Jagellone hinauswollte. Die kanonistischen Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der mit der Schwester seiner verstorbenen Gemahlin Elisabeth geschlossenen Ehe waren dem König, so wollte es scheinen, etwas spät gekommen. Sie waren überdies völlig unbegründet, da die römische Kurie ihre Ermächtigung dazu erteilt hatte. Und nicht besser sah es mit dem anderen Argument der Krankheit aus, abgesehen davon, daß der König, wie ihn sein Schwager belehrte, die Pflicht gehabt hätte, seiner leidenden Ehehälfte allen erdenklichen Trost und Beistand zu leisten. Maximilian bestritt übrigens sehr energisch, daß seine Schwester an der Fallsucht leide, und er konnte sich darauf berufen, daß keiner der Ärzte, die sie damals behandelten, keine der Edelfrauen, die Tag und Nacht bei ihr wachten, von diesem Leiden etwas gemerkt hätte. Sie habe bloß einen Ohnmachtsanfall gehabt. Der Jagellone, dem niemand zu große Wahrheitsliebe nachrühmen konnte, muß übrigens selbst nicht sehr viel von seiner Furcht vor »Ansteckung« gehalten haben; wenigstens behauptete er dem päpstlichen Nuntius Commendone gegenüber, daß nicht die Krankheit der Königin, sondern ihre Lebensweise, ihr Temperament und nicht zuletzt ihre fingierte Niederkunft den Bruch herbeigeführt hätten.
An all den von Siegmund August gegen Katharina vorgebrachten Beschuldigungen scheint nur so viel richtig gewesen zu sein, daß er gegen sie eine unüberwindliche Abneigung gefaßt hatte und die Scheidung anstrebte, um eine neue Ehe eingehen zu können. Allein dazu war Maximilian absolut nicht zu haben, ebensowenig der Papst, der von Wien aus beständig bearbeitet wurde, dem Begehren des Jagellonen unter keinen Umständen stattzugeben. Siegmund August hätte, um seinen heißen Herzenswunsch zu befriedigen, das Beispiel des englischen Königs Heinrich VIII. befolgen können, der sich einfach von Rom lossagte und aus eigener Machtvollkommenheit seine Ehe mit der spanischen Katharina auflöste, um die schöne Anna Boleyn zu heiraten. Doch zu einem derartig kühnen Entschluß konnte sich der Jagellonenkönig, der von den in Machiavellis Fürstenspiegel vorgezeichneten Tugenden nur die Geriebenheit, nicht aber die Tatkraft besaß und den Spottnamen »Cunctator«, »König Morgen« trug, nicht aufraffen. Der Meister in der Kunst des Aufschiebens hoffte auf einem anderen Wege sein Ziel erreichen zu können.
Siegmund August ließ seinem Schwager, der mittlerweile Kaiser geworden war, die verlockende Aussicht auf die Erbfolge des Hauses Österreich in Polen eröffnen – doch um den Preis der Scheidung. Schon im Jahre 1561 hatte der kaiserliche Gesandte Valentin Saurmann dem Habsburger im höchsten Vertrauen nahegelegt, mit dem König, der zu ihm eine »sundere Lieb und gewogenen Willen« gefaßt habe, eine Zusammenkunft abzuhalten, weil er sich nicht nur über die Königin, sondern auch über Angelegenheiten, die dem Hause Österreich »zum Besten« gereichten, aussprechen wolle. Was er mit diesen Angelegenheiten meinte, darüber konnte kein Zweifel bestehen. Wenige Jahre vorher hatte sich ein anderer Gesandter Kaiser Ferdinands I., Erasmus Heidenreich, bemüßigt gesehen, auf die große Gefahr hinzuweisen, die der Habsburger Monarchie drohte, wenn der Wojwode von Siebenbürgen, Johann Siegmund Zápolya, auf den polnischen Königsthron gelangen würde. Dieser Todfeind Österreichs, der treue Verbündete und Vasall der Türken, war als Neffe des Jagellonenkönigs entschieden der aussichtsreichste Kandidat. Der Besitz Polens war so für den Kaiser gewissermaßen eine Lebensfrage.
Auf der anderen Seite konnte sich der Wiener Hof nicht verhehlen, daß die schönsten Worte des Jagellonenkönigs nicht den Schaden aufzuwiegen imstande waren, der dem Hause Habsburg dadurch erwachsen wäre, wenn Katharina Polen verlassen hätte. Das Verbleiben der Königin im Lande war zweifellos die beste Bürgschaft für die Zukunft.

Siegmund II. August, König von Polen
Dies wußte niemand besser als Siegmund August und, was an ihm lag, tat er redlich, um seiner Gemahlin den Aufenthalt in Polen unmöglich zu machen. Wenn der Bayernherzog Albrecht in einem vertraulichen Schreiben an Maximilian der Besorgnis Ausdruck gab, es könnte Katharina »etwas hochgefährliches begegnen, das vor dieser Zeit schon geschehen – es war eine Anspielung auf die schlimmen Gerüchte, die beim Tode ihrer Schwester Elisabeth auftauchten – sein soll«, so fanden solche Bedenken bei dem gemütvollen Kaiser, der mit Liebe an seinen Geschwistern hing, gewiß lebhaften Widerhall. Die Stimmung, wie sie damals am Wiener Hofe gegen den polnischen König herrschte, war just nicht die beste. Maximilians Vizekanzler Doktor Seld nimmt sich in seinen Berichten an den Bayernherzog kein Blatt vor den Mund. Albrecht werde daraus ersehen, schreibt er am 10. Januar 1565, »was für ein sauberer Gesell dieser Pollak ist und wie hoch man sich seiner Schwagerschaft zu erfreuen«.
Um diese Zeit war Kaiser Maximilian entschlossen, wie er am 16. Januar Albrecht schreibt, »nicht weiter zu dissimulieren«, sondern durch eine neuerliche Gesandtschaft den polnischen König zu veranlassen, der demütigenden Behandlung seiner Schwester ein Ende zu bereiten. Siegmund August wurde ziemlich unsanft daran erinnert, daß er selber es war, der die Hand Katharinas verlangte. Der flatterhafte und wie es scheint etwas pervers veranlagte König, der sich zur Begründung seiner Abneigung gegen Katharina auf religiöse Bedenken stützen zu können vermeinte, wird mit schlecht verhehlter Ironie dahin belehrt, daß nach Gottes Willen der Ehebund unlöslich sei. Er möge daher in sich gehen und seine privaten Affekte bezwingen, weil der Sieg über sich selbst der »schönste Triumph« sei. Den Gesandten – es waren dies der Bischof Andreas Dudit von Fünfkirchen und der Präsident der schlesischen Kammer Wilhelm von Kurzbach – wurde eingeschärft, auf eine bestimmte, klare Erklärung des Königs zu dringen. Für den Fall einer abschlägigen Antwort hatten sie ihre Bemühungen darauf zu konzentrieren, daß Siegmund August seiner Gemahlin die Heimreise erlaube, um sich mit ihren Brüdern beraten zu können.
Die beiden Gesandten kamen am 5. März in Petrikau, wo Siegmund August Hof hielt, an und trugen ihm fünf Tage später ihre Werbung vor. Allein sie merkten gar bald, daß es den König durchaus nicht nach der Palme des »schönsten Sieges«, der Selbstbezwingung, dürstete, seine Abneigung vielmehr unüberwindlich war, daß er aber auch nicht die Absicht hatte, dies offen einzugestehen, sondern es darauf anlegte, die Entscheidung auf die lange Bank zu schieben. Nachdem sie fast zwei Monate gewartet hatten, erhielten sie endlich eine Antwort, die alles eher als eine bündige Erklärung war.
Der Jagellone führte in dieser Resolution – sie ist vom 28. April datiert – des langen und breiten aus, wie sehr er seine Gemahlin geliebt und wie sich dann, weil eben »nichts auf Erden beständig« sei, diese seine Liebe »durch verschiedenartige Zwischenfälle« in Abneigung verwandelt habe. Seine Hoffnung, sie mit der Zeit überwältigen zu können, habe sich nicht erfüllt. So habe er denn den Entschluß gefaßt, sein Ungemach als eine von Gott ihm auferlegte Prüfung geduldig und schweigend hinzunehmen. Er anerkenne die überaus fürsorgliche Absicht der kaiserlichen Intervention, wolle aber nicht die Wunden seines Schmerzes wieder aufreißen, weshalb er es unterlasse, auf die einzelnen Punkte der Werbung einzugehen. Gott wolle ihn erleuchten, auf daß er alles das tue, was zum Wohle seines Königreiches und zur Erhaltung der guten Beziehungen zu Österreich dienlich erscheine. Für den Augenblick aber halte er es nicht für angezeigt, diese wichtige Angelegenheit brieflich oder durch Gesandte mit einigen wenigen, allgemeinen Worten zu behandeln – weit besser würde sie sich unter vier Augen bereinigen lassen.
Der König steuerte also wieder auf die persönliche Zusammenkunft und das Lockmittel der Thronfolge los. Allein den Zeitpunkt der Konferenz schob er ins ungewisse hinaus. Er müsse erst, so erklärte er, nach Litauen eilen und alles für den Krieg gegen den Moskowiter vorbereiten. Die Königin war über diese »aufschübliche, listige, hochbeschwerliche« Antwort entsetzt. »Ich bitt um Gottes Willen,« so drang sie in die Gesandten, »haltet mit allem Fleiß an des Auszugs halben.« Auch den kaiserlichen Bruder bat sie, ihrem unerträglichen Zustande durch die Heimreise ein Ende zu bereiten.
Kaiser Maximilian wies jetzt die Gesandten an, vom König die Zustimmung zur Rückkehr Katharinas zu erwirken. Es handelte sich zunächst nur um eine zeitliche Entfernung, einen Urlaub, um der Königin die Möglichkeit zu geben, ihre Geschwister nach so langer Zeit wiederzusehen und an den Exequien für ihren verstorbenen Vater teilnehmen zu können. Siegmund August aber, der von dieser Lösung einer nur vorübergehenden Trennung keineswegs entzückt war, machte Schwierigkeiten. Ohne Vorwissen seiner Räte, erklärte der sonst so selbstherrlich auftretende Jagellone, könne er Katharina nicht abreisen lassen. Doch werde er trachten, längstens in zwei Wochen sich entscheiden zu können. Die Gesandten wagten es nicht, den König zu drängen, denn einige Räte machten sie im Vertrauen auf die Gefahr aufmerksam, daß er dann Katharina aus Rache die Rückkehr nach Polen verweigern könne.
Nach Ablauf von zwei Wochen erhielten die Gesandten vom König den Bescheid, daß die Räte aus hohen, wichtigen Gründen gegen die Abreise seien, weshalb auch er sie nicht bewilligen könne. Die Königin war verzweifelt. Sie weigerte sich, ihr Zimmer zu verlassen und weinte den ganzen Tag. Bischof Dudit, der eine der Gesandten, der längere Zeit bei ihr in Radom weilte, sprach in seinem Bericht vom 26. Juni ganz offen den gräßlichen Argwohn aus, man könnte die Ärmste, um Kosten zu sparen, aus dem Wege räumen. Der Kaiser sah sich gezwungen, seine Schwester zur Geduld zu mahnen und sie eindringlichst zu warnen, wider des Königs Willen abzureisen, weil, wie er ihr am 19. Oktober schreibt, »nix guets daraus werden würde«.
Anfang November endlich galt die Abreise als sicher; Siegmund August hatte seine Einwilligung dazu gegeben, und der Kaiser sich in der wärmsten Weise bedankt – da trat ein anderes, ernsthaftes Hindernis dazwischen. Es kam diesmal von den polnischen Großen, die gegen die Entfernung der »heiligen Frau«, wie sie Katharina nannten, eine regelrechte Agitation entfalteten, weil sie besorgten, sie könne zum Schaden des Landes ihren Weg nicht mehr zurückfinden. Eben als Katharina im Begriffe stand, sich über die Grenze zu begeben, wurde sie von einer Abordnung der Stände an der Weiterreise gehindert. Sie waren entschlossen, die Angelegenheit vor den Reichstag zu bringen; ja sie drohten dem König mit der Aufkündigung des Gehorsams, wenn er sich nicht mit Katharina versöhne.
Alles lief auf eine Kraftprobe zwischen dem zur Willkür neigenden König und den selbstbewußten Ständen hinaus. Kaiser Maximilian durfte jetzt wiederum Hoffnung schöpfen, das Eingreifen der Großen des Reiches zugunsten der Königin werde den lockeren Schwager zum Einlenken bringen, und so unterließ er es, auf deren Heimreise zu bestehen. Aber umgekehrt setzte nun Siegmund August alles daran, seine unbequeme Gemahlin, die sehr zu seinem Ärger zum Mittelpunkt der Ständeopposition geworden war, aus dem Lande zu entfernen, allenfalls mit – Gewalt. Die arme Katharina bekommt den Unwillen des Königs doppelt zu fühlen und wird womöglich noch schlechter als früher behandelt. Ihr Obersthofmeister Gabriel Grabowiecki verleumdet sie bei Siegmund August, daß sie verräterische Beziehungen unterhalte. Sie wird von Spionen umstellt und erfährt auch im Haushalte die entwürdigendsten Einschränkungen, wie sie denn zum Beispiel im Tage nur zwei Brote zugewiesen erhält.
Unter solchen Umständen durfte der Kaiser nicht länger zögern, den König vor eine rasche Entscheidung zu stellen. Bischof Dudit wurde Anfang April 1566 neuerdings in Bewegung gesetzt, um im Vereine mit den Großen des Landes Siegmund August zu veranlassen, entweder die eheliche Gemeinschaft mit Katharina wieder aufzunehmen oder sie ungehindert ziehen zu lassen. Dieser erneute kräftige Druck hatte Erfolg. Am 19. Juni kam die peinliche Angelegenheit in einer Geheimsitzung des Senates zur Verhandlung. Dort wurde der König, wie der Gesandte hörte, heftig bestürmt, Katharina zu sich zu nehmen. Seitdem diese im Lande sei, habe sie sich so verhalten, daß sie füglich Gott loben und zum höchsten danken müßten, der ihnen »so ein tugendreiches Frauenbild« zur Königin gegeben habe. Allgemein wurde auf die Gefahren hingewiesen, die dem Königreich erwachsen würden; denn man fürchtete, das Haus Österreich werde sich für den ihm angetanen »Spott« rächen.
Einige Tage darauf, am 28. Juni, gab der König vor den versammelten Räten die Erklärung ab, es sei ihm unmöglich, mit Katharina zusammenzuleben. Er habe überdies dem Kaiser die Einwilligung zur Heimkehr der Königin bereits gegeben, weshalb es sich nur mehr um die näheren Formalitäten derselben handle. In der Tat wurde jetzt über die Katharina für die Dauer ihrer Entfernung zu gewährende Sustentation verhandelt, doch hatte Bischof Dudit dabei recht wenig Glück. Nachdem der König anfangs unter Hinweis auf seine beschränkten Geldmittel rundwegs jede finanzielle Unterstützung abgelehnt und den Gesandten ersucht hatte, ihn nicht weiter mit dieser Forderung zu belästigen, erklärte er sich endlich bereit, für die restlichen drei Monate des Jahres die gewöhnliche Unterhaltsumme zu zahlen. Dudit mußte sich damit zufrieden geben, um die Abreise der Königin nicht noch länger hinauszuziehen.
Am 8. Oktober konnte Katharina endlich dem Lande, wo sie so viel Kummer und Leid erlebt hatte, den Rücken kehren. Vorher hatte sie aber durch den Bischof feierlich protestieren lassen: Den König, nicht sie, treffe die Schuld, daß sie Polen verlasse. Doch sei dies nicht auf ewige Zeiten beabsichtigt, sondern nur für so lange, bis Gott der Allmächtige das Herz ihres Gemahls »erleuchte«.
Am 25. Oktober traf Katharina in der Kaiserstadt ein. Erzherzog Ferdinand war ihr entgegengefahren. Vier Tage später fand sich dort auch Kaiser Maximilian ein, der eben vom Feldzuge wider die Türken heimkehrte. In die Freude des Wiedersehens nach so langer Trennung mischte sich bereits die Sorge um das zukünftige Schicksal der Königin. Der spanische Gesandte Chantonnay wollte wissen, daß sie überhaupt nicht mehr zurückzukehren gedenke. Eher werde sie sich, meinte er, in ein Kloster zurückziehen. Dazu scheint sie allerdings nur geringe Eignung besessen zu haben. Sie eröffnete ihrem kaiserlichen Bruder, wie dieser in seinem Tagebuch bemerkt, im Vertrauen, daß sie von der Anrufung der Heiligen nichts halte.
So mag es denn wahr sein, was der spanische Gesandte von zuverlässiger Seite gehört hatte, daß Katharina das Abendmahl unter beiden Gestalten zu nehmen beabsichtige. Vielleicht hat diese unangenehme Entdeckung das ästhetische Urteil des spanischen Zeloten etwas getrübt. Denn Chantonnay, der sie damals sah, gab von ihrer äußeren Erscheinung eine nichts weniger als vorteilhafte Beschreibung: »Ungemein dick«, so nennt er sie kurz, und weiß uns von ihrem rötlichblonden Haar, ihren dunklen, ausdrucksvollen Augen, wie sie die uns erhaltenen Bildnisse zeigen, gar nichts zu berichten. Merkwürdig doch: zwei Jahre später sieht sie der Gesandte des Herzogs von Mantua, Malaspina, und fand sie »schön und jünger denn je«.
Katharina, die in Linz ihren Wohnsitz aufschlug, trug nicht das geringste Verlangen danach, Polen wiederzusehen. In diesem Punkte stimmte sie ganz mit ihrem königlichen Gemahl überein. Dem Bischof Dudit, der im Februar 1567 wieder an den Königshof geschickt worden war, gab Siegmund August deutlich zu verstehen, daß sie sich, falls sie wiederkäme, keiner guten Aufnahme und Behandlung zu erfreuen haben werde. Die Briefe, die ihm Katharina schickte, schob er geflissentlich zur Seite. Von der erhofften »Erleuchtung« war bei ihm nichts zu bemerken. Er hielt sich zum besonderen Ärger seiner alternden jungfräulichen Schwester Anna eine ganze Schar von Konkubinen, von denen die Zajarzkowska und die Barbara Giese, genannt die »schöne Gizanka«, besonders viel von sich reden machten. Daneben trug er sich ganz ernstlich mit Heiratsgedanken; denn es war ihm geweissagt worden, er werde aus seiner vierten Ehe einen Erben bekommen. Man nannte die Witwe Christoph Tarnowskis, und die Besorgnisse des Kaisers waren, seitdem Katharina Polen verlassen, erheblich gestiegen.
Die Protestanten Polens hätten es natürlich gerne gesehen, wenn ihr König, um sich wieder verheiraten zu können, vom Gehorsam gegen den apostolischen Stuhl abgefallen wäre. Allein Siegmund August konnte sich auch jetzt zu einem solchen Schritt nicht entschließen. Er zog es vor, weiter auf Maximilian durch das Ausspielen des Sukzessionsprojektes einzuwirken, auf daß dieser selbst in die Ehescheidung willige. Im August 1569 sprach man, wie der spanische Gesandte meldet, am Wiener Hofe davon, Siegmund August habe seinem Schwager den Vorschlag gemacht, ihm eine seiner Töchter zur Frau zu geben. Wenn er dann innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren keinen Sohn erhalte, dann wolle er Maximilian die Regierung über Polen und Litauen gegen eine Jahrespension überlassen. Wiederum taucht der Plan einer persönlichen Zusammenkunft auf; aber am Kaiserhofe zeigte man dazu auch jetzt wenig Lust. Der Vizekanzler Zasius meinte, wie er am 18. September dem Bayernherzog schreibt, es wäre dies eine »vergebenliche Ausschüttung des Geldes«, und es würde daraus nur noch »mehr Unlust, Simultät und Widerwillen« erwachsen.
Der Kaiser ließ aber deshalb den österreichischen Sukzessionsplan keineswegs aus den Augen. Seine Gesandten, die nach Polen gingen, streckten dort unausgesetzt ihre Fühler aus. Als Bischof Dudit und Kurzbach seinerzeit, im Februar 1565, zum König geschickt worden waren, hatten sie den Ständen unter der Hand eine Reihe von Versprechungen gemacht, wie daß Maximilian so häufig als möglich ins Königreich kommen und mit ihrem Rat eine geeignete Stellvertretung bestimmen werde. Doch war den Gesandten stets eingeschärft worden, nur »mit der größten Vorsicht« zu Werke zu gehen, um nicht das Mißtrauen des Jagellonen wachzurufen. Maximilian hielt sich prompt an den Rat, den ihm Dudit gegeben, er möge Siegmund August »schön tun« und so machen, als ob er ihn und die Polen über alles liebe. So wurden denn trotz der Entrüstung, die man über des Königs Vorgehen empfand, die Verhandlungen in den liebenswürdigsten Formen fortgesetzt. Man erwägt lange Zeit hindurch den Plan, Erzherzog Karl, der noch ledig war, mit der viel älteren Anna, der Schwester des Königs, zu verheiraten. Daß dies nicht das schlechteste Auskunftsmittel war, sollte sich später zeigen, als der siebenbürgische Wojwode Bathory sich entschloß, die damals fünfzig Jahre zählende Prinzessin zum Altar zu führen.
Königin Katharina sah weder ihren ungetreuen Gemahl, noch Polen wieder. Vor der Zeit, im Alter von kaum vierzig Jahren, schloß sie am 29. Februar 1572 in Linz ihr vergrämtes Dasein. Eine grausame Ironie des Schicksals wollte es, daß Siegmund August nicht mehr in die Lage kam, seiner Freiheit sich zu freuen, denn nur wenige Monate später, am 7. Juli 1572, sank der letzte Jagellone in die Gruft.
Die Nachricht vom Tode Siegmund Augusts, die am 18. Juli in Wien eintraf, löste am Kaiserhofe, wie der spanische Botschafter Graf Monteagudo zu melden wußte, eine »große Verwirrung« aus. Maximilian entschloß sich alsbald, Schritte zu tun, um die erledigte Krone für Österreich zu gewinnen. Es war wirklich nicht eitel Ländergier, die den Habsburger die Hand danach auszustrecken bewog, sondern eine »Pflicht gegen sein Haus und gewiß auch gegen die christliche germanische Welt«; bestand doch die Gefahr, daß Polen im Besitz eines österreichfeindlichen Fürsten mit den Türken und dem Wojwoden von Siebenbürgen gemeinsame Sache gegen die Donaumonarchie machte.
Wenn ein Vorwurf den Kaiser treffen kann, so war es lediglich der, daß man das Ziel nicht mit ganzer Energie und nicht sehr geschickt ins Werk setzte. Die österreichische Diplomatie, die in Polen schon früher keine besonders glückliche Hand zeigte, benahm sich nun »geradezu ungeschickt«. Der erste Fehler war schon, daß man den päpstlichen Nuntius Commendone in das Lager der Gegner trieb. Der Kardinal hatte bereits vor des Königs Ableben mit zwei Mitgliedern der einflußreichsten litauischen Familien den Plan besprochen, einen Sohn des Kaisers zum Großfürsten von Litauen wählen zu lassen. Maximilian sollte zu diesem Zwecke einige Reiterschwadronen in der Stärke von 24 000 Mann bereithalten, die Polen würden dann sicherlich der Wahl des Erzherzogs ihre Zustimmung geben. So hatte es auch seinerzeit Siegmund August zu Lebzeiten seines Vaters gemacht. Nun, da der König tot war, sandte der Kardinal sofort seinen Sekretär Antonio Maria Graziani nach Wien, um Maximilian für sein Projekt zu gewinnen, aber dieser ging nicht darauf ein – es erschien ihm doch etwas zu kühn. Gewiß hat diese Abweisung nicht wenig dazu beigetragen, daß der päpstliche Legat die österreichische Kandidatur fallenließ und für den Rivalen des Habsburgers arbeitete.
Der zweite Fehler war, daß sich der Kaiser verleiten ließ, eine große Anzahl von Agenten nach Polen zu schicken, die ganz offen bei einzelnen Senatoren ihre Werbearbeit begannen und die in großer Zahl vorhandenen Gegner noch mehr aufreizten. Im August folgte jenen die eigentliche Gesandtschaft, die aus dem böhmischen Oberstburggrafen Wilhelm von Rosenberg und dem Kanzler Wratislaw von Pernstein bestand. Sie erregte gleich dadurch Anstoß, daß sie unangemeldet die polnische Grenze überschritt und dann, als sie angehalten wurde, den ihr von den Senatoren angewiesenen Ort verließ, um zur Prinzessin Anna zu gelangen und diese für Österreich zu gewinnen.
Gegen das Haus Habsburg wurde vor allem das Moment ausgespielt, daß es in Ungarn und in Böhmen die Wahlfreiheit unterdrückt habe, und die zahlreichen tschechischen Edelleute im Gefolge der beiden Gesandten lieferten für diese Klage zum Schaden der österreichischen Sache willkommenes Material. Man glaubte auch im Hause Habsburg die typischen Vertreter des verhaßten Deutschtums erkennen zu müssen, wobei die Erinnerung an den Kampf mit dem deutschen Ritterorden mitwirkte, und fürchtete, daß Polen infolge des Überhandnehmens des deutschen Einflusses nach dem Beispiele von Ungarn und Böhmen zu einem Nebenlande herabsinken werde. Man sah ferner voraus, daß dann Polen in einen Krieg mit den Türken verwickelt würde, und gerade diesen wollte man vermeiden. Der zahlreiche niedere Adel, die Schlachta, besorgte überdies, die Habsburger würden die politische Stellung der Magnaten erhöhen. Nicht zuletzt mag auch die Kandidatur des Erzherzogs Ernst Bedenken erregt haben. Für den in Spanien im streng katholischen Geist erzogenen Prinzen hatte sich sofort König Philipp II. eingesetzt, aber der Kurfürst August konnte sich bei seiner Anwesenheit in Wien, im Februar 1573, nicht der Bemerkung entschlagen, daß er sich gerade deshalb weniger eigne, als seine jüngeren Brüder.
Alle diese Besorgnisse fielen bei dem französischen Kandidaten Heinrich von Anjou hinweg. Frankreich war zu weit entfernt, als daß seine Macht der Selbständigkeit Polens hätte gefährlich werden können, und dazu besaß der Prinz in Jean de Montluc, Bischof von Valence, einen ganz ausgezeichneten Unterhändler, der sich nicht scheute, den Polen das Blaue vom Himmel zu versprechen und seinen Verheißungen durch reichliche Geschenke für den »verlumpten« Adel – er hatte Geld und Juwelen im Werte von 400 000 Dukaten mitgebracht – entsprechenden Nachdruck zu geben. Der Franzose verstand es dank seiner Gewandtheit sogar, in dem zum guten Teile protestantischen Lande den ungünstigen Eindruck der Bartholomäusnacht, deren Kunde mit ihm zugleich nach Polen kam, zu verwischen.
So stand es denn um die Sache Österreichs nicht gut, als man sich im April 1573 auf dem Reichstag zu Warschau zur Wahl des Königs versammelte. Zum Unglück für den Kaiser war beschlossen worden, sie »viritim«, Mann für Mann, vor sich gehen zu lassen, so daß die in Masse erschienenen Vertreter des einflußreichen, niederen Adels, welcher der überwiegenden Mehrheit nach habsburgfeindlich war, den Ausschlag gaben. Am 9. Mai wurde Heinrich von Anjou zum König ausgerufen.

Katharina von Polen
Die Erwerbung Polens für einen Bruder König Karls IX. war in der Tat ein glänzendes Ergebnis der französischen Staatskunst; denn Frankreichs Einfluß erstreckte sich jetzt bis weit in den Osten hinein und bedrohte zusammen mit dem ihm befreundeten Türkenreich den habsburgischen Gegner im Rücken. Und zu diesem großen Erfolg hatte die römische Kurie beigetragen. Man versteht es so, daß der Kaiser auf Rom im allgemeinen und auf Kardinal Commendone im besonderen äußerst schlecht zu sprechen war. »Was awer den Bapst anlangen thuet,« schreibt er am 23. Juni dem Kurfürsten August, »sorg ich lauter, das man mit falschen Karten geschpielt hatt. Glaichwol saind die Bapst gemainiklich bös kayserisch gewesen und jederzait fil Unrats geschtift.«
Den Anhängern Frankreichs aber erschien die Wahl Heinrichs zum Polenkönig nur als die erste Etappe auf dem Wege zur »europäischen Monarchie«. Schon früher hatte Kaspar von Schomberg, der in Karls Auftrag mit den deutschen Fürsten verhandelte, sein Programm entwickelt: »Wir müssen Polen um jeden Preis haben, und zwar um nachher noch höher zu steigen.« Nichts Geringeres als die Erwerbung der deutschen Kaiserkrone winkte als Ziel.
Die Frage, wer einstens, nach Maximilians Tode, die deutsche Kaiserkrone tragen werde, war nicht nur für das Reich, sondern für ganz Europa von größter Wichtigkeit. Und sie war durch die andauernde Kränklichkeit, die »Leibesschwachheit« des Kaisers, der noch in den besten Mannesjahren stand, vor der Zeit brennend geworden.
Wohlmeinende Räte, wie Lazarus von Schwendi, hielten sich für verpflichtet, den Kaiser zu mahnen, auf die Sukzessionsangelegenheit acht zu haben. In einem Schreiben vom 31. Oktober 1569 rät er deshalb Maximilian, seine beiden ältesten Söhne aus Spanien abzuberufen, zum wenigsten den Thronfolger Rudolf – »dan macht Eure Majestät dieselb nit gewis, so mag Eure Majestät genzlich darfür halten, das die innerliche Zertrennungen andere Anschlege und Vorhaben machen werden«. Auch der kursächsische Rat Christoph von Carlowitz gab ihm zwei Wochen später, am 11. November, zu bedenken: »Nit weniger were auch die höchste Zeit, daß Eure kaiserliche Majestät Ir und dem Reich zum besten und zu Abwendung der Gefahr, so sonst aus dem Interregno zu besorgen, on lengern Verzug auf einen tauglichen successorem imperii trachtete.« Die Anspielung auf das »Interregnum« bezog sich auf das sogenannte Vikariat, das nach den bestehenden Reichsgesetzen beim Tode des Kaisers den Kurfürsten von der Pfalz und von Sachsen, also zwei Protestanten, zugefallen wäre. Dadurch aber würde, wie der venezianische Gesandte Tron meinte, in Deutschland das Unterste zu oberst gekehrt werden.
Maximilian war an dem Fortbesitz der Kaiserwürde im Hause Österreich deshalb so viel gelegen, weil sich die Erblande, die jetzt noch dazu in mehrere Teile zerrissen waren, wie der venezianische Gesandte Cornaro bemerkt, nicht aus eigener Kraft, sondern nur mit Hilfe des Reiches gegen den türkischen Erbfeind behaupten konnten, und diese Unterstützung nur dann einigermaßen gesichert erschien, wenn die Habsburger die Kaiserkrone trugen. Er hatte somit ein lebhaftes Interesse daran, die Wahl eines Nachfolgers noch bei seinen Lebzeiten sicherzustellen, und das gleiche war bei den katholischen Reichsständen der Fall, die von einem Interregnum der zwei protestantischen Kurfürsten, vor allem des Pfälzers, nichts Gutes zu erwarten hatten.
Allein die Anregung zur Wahl eines Nachfolgers zu Lebzeiten des Kaisers mußte von den Kurfürsten ausgehen, und dazu die Protestanten zu bewegen, war aller Voraussicht nach keine leichte Aufgabe. Schon lange herrschte bei diesen eine Verstimmung, namentlich seit der Verheiratung seiner Töchter mit den Königen von Spanien und von Frankreich. Dieses Mißtrauen ging so weit, daß man ihn sogar für die blutige Exekution der Bartholomäusnacht neben Philipp II. verantwortlich machte. Wir kennen diese Tatsache bereits aus dem vertraulichen Schreiben, das der Kaiser nach dem erschütternden Ereignis an seinen sächsischen Freund richtete, und sie wird uns auch durch einen Bericht des florentinischen Gesandten vom 28. November 1572 bestätigt. Das Groteske war nur, daß auch nach der Schreckenstat vom 24. August deutsche Protestanten, allen voran der Pfälzer, mit dem »Mordkönig« Karl IX. weiterhin Beziehungen unterhielten und ganz ernsthaft von der »Korrespondenz« mit Frankreich und Polen und von der Übertragung des Kaisertums an das Haus Valois sprachen. Freilich, auch die Namen von deutschen Reichsfürsten, wie des Kurfürsten August, wurden genannt. Katholischerseits erscheinen der König von Spanien und der bayerische Herzog Albrecht auf der Liste der Anwärter.
Dem Kaiser mußte es unter solch unsicheren Verhältnissen als ein vielversprechender Anfang erscheinen, daß es ihm gelang, dem Kurfürsten August gelegentlich seines Wiener Besuches im Februar 1573 die Bedenken gegen die Wahl des Thronfolgers Rudolf zu zerstreuen und die Zustimmung zur Ausschreibung eines Reichstages zu deren Vornahme zu erwirken. Damit war in der Tat das Eis gebrochen, und nun setzten von beiden Seiten, von den Katholiken wie von den Protestanten, die Bemühungen ein, für den bevorstehenden Wahltag sich bestens vorzubereiten.
Die Protestanten brachten wieder die Frage der »Freistellung«, die »Toleranz« beider Religionen, auf die Bahn. Mit Sorge hatte man die Fortschritte der Gegenreformation wahrgenommen, hatte man gesehen, wie der Fuldaer Abt Balthasar von Dermbach bald nach seinem Regierungsantritt im Jahre 1571 mit Hilfe der Jesuiten in seinem Stift, allen Widerständen des Kapitels wie der Ritterschaft und allen Gegenwirkungen der protestantischen Fürsten zum Trotz, die Unterdrückung der protestantischen Religionsübung erfolgreich in Angriff genommen hatte. Und sein Beispiel wirkte bald ermunternd auf andere katholische Fürsten, zunächst auf den Erzbischof Daniel von Mainz, der im Jahre 1574 gleichfalls mit Unterstützung der Jesuiten das fast ganz protestantisch gewordene Eichsfeld katholisch zu machen begann. Namentlich beim Vorgehen des Mainzer Kurfürsten war es nicht ohne Verstöße gegen die Ferdinandeische Deklaration abgegangen, und so erscheint es als kein Zufall, daß man protestantischerseits auf Anerkennung der in Vergessenheit geratenen Urkunde drängte.
Aber auch im anderen Lager rüstete man sich, und hier hatte sich seit dem Augsburger Reichstage von 1566, wo zum letzten Male die religiöse Frage verhandelt worden, ein entschiedener Fortschritt vollzogen. Man kann sagen: die Erfolge in Fulda und im Eichsfelde waren nur die ersten Symptome einer allgemeinen Erhebung des deutschen Katholizismus. Mit der Thronbesteigung des Papstes Gregor XIII. im Mai 1572 kam ein frischerer Zug in die katholische Gegenbewegung. Er bemühte sich vor allem, eine innigere geistige Verbindung der deutschen Seelenhirten mit Rom anzuknüpfen, wobei er sich der weltumspannenden Wirksamkeit der Gesellschaft Jesu bediente. Hatte einst der Jesuit Canisius von den Bischöfen im Reiche sagen dürfen: »Sie schlafen, statt für das Wohl ihrer Herde zu wachen«, so begannen sich jetzt überall die religiösen Kräfte zu regen.
Spanien stand mit gewohntem Eifer hinter all diesen Bestrebungen, und niemand bekam diese unverwandte Fürsorge stärker und eindringlicher zu fühlen als – Kaiser Maximilian. Philipp II., der sich schon als Schwager beständig um das seelische Wohl des deutschen Habsburgers eifrigst bekümmert hatte, setzte nun in seiner neuen Eigenschaft als Schwiegersohn mit Hochdruck seine Bekehrungsversuche fort. Die Erteilung der Religionskonzession an die protestantischen Stände Österreichs, die ihn so sehr erschreckte, war noch vor dem Zustandekommen des Verlöbnisses mit Anna erteilt worden, und Philipp hegte die Hoffnung, durch die neue Bindung den Kaiser fester in seiner Hand halten zu können.
Knapp vor der Hochzeit mit Anna, im Oktober 1569, redete er Maximilian in einem längeren Schreiben ordentlich ins Gewissen. Etwas verbindlich schickte er, um dem Vorwurfe, daß er sich in fremde Angelegenheiten mische, zu begegnen, die Bemerkung voraus, er betrachte des Kaisers Wohl und Wehe als sein eigenes. Dann aber kam eine lange Reihe der schwersten Vorwürfe, nur dadurch einigermaßen gemildert, daß er erklärte, er für seine Person könne dies gar nicht glauben, aber »man erzähle es sich so«.
Maximilian bekunde schon seit langem, so fängt der König an, eine »Hinneigung« zur neuen Religion, die so weit gehe, daß er auch ihren Doktrinen Glauben schenke. Damit stehe wohl die im höchsten Grad Ärgernis erregende Tatsache im Zusammenhang, daß er seit geraumer Zeit nicht die Sakramente der Beichte und der Kommunion empfangen habe. Möglich, daß er dies im geheimen tue, aber eben dadurch komme er in den Verdacht der Begünstigung der neuen Lehre, dem noch andere bekannte Erscheinungen reichlich Nahrung gäben, so wenn ein Teil der österreichischen Stände und seine nächste Umgebung am Kaiserhofe mit seinem Vorwissen ganz offen zum Evangelium sich bekenne oder wenn er mit Protestanten in Freundschaft lebe. Ja, es heiße sogar, er wolle diesen später noch mehr seine Gunst zu erkennen geben. Sollte Maximilian am Ende glauben, durch solche Mittel seine Länder erhalten zu können, so werde er das Gegenteil erreichen. Hier handle es sich nicht bloß um die Ehre Gottes und der heiligen Kirche, sondern um sein Ansehen als Fürst, das durch sein zweideutiges Verhalten gefährdet sei.
Die Antwort des Kaisers, vom 20. November datiert, ist überaus höflich, sogar freundschaftlich gehalten, enthält aber sachlich eine schroffe Ablehnung des königlichen Standpunktes – es sind zwei Weltanschauungen, die hier unversöhnlich aufeinanderstoßen.
Philipp sei offenbar, so sagt er ihm da, von Leuten, die ihre Entzweiung herbeisehnten, falsch unterrichtet worden. Er, Maximilian, sei durchaus kein Freund der »neuen Sekten«, ja im Gegenteil verurteile er jede Trennung in der Religion, weil sie gewöhnlich auch eine Erschütterung des Gehorsams der Untertanen bewirke. Er habe sich auch stets bemüht, diesem bedauerlichen Übelstand abzuhelfen, »auf dem Wege der Belehrung, nicht aber durch die Mittel der Strenge und des Blutvergießens«, die nur zum Verderben des Guten führten. Hier befolge er übrigens ganz das Beispiel seines Vaters, nur daß er heute, vor eine vollendete Tatsache gestellt, in Anbetracht der gefahrvollen Zeitläufte nicht Veränderungen und Unruhen riskieren wolle, noch weniger freie Hand habe. Es sei auch nicht richtig, daß seine Räte jene Sekten begünstigten, denn sie, die er vom Vater übernommen, seien durchweg Katholiken. Ebensowenig Berechtigung habe der Vorwurf enger Beziehungen zu den protestantischen Fürsten, da umgekehrt diese ihn im Verdacht hätten, er unterhalte eine Liga mit dem Papst und anderen katholischen Häuptern. Auch die Behauptung, er lebe nicht wie ein Katholik, sei unwahr, denn er unterlasse es nicht, die Sakramente der Beichte und der Kommunion »in der Weise, wie es sein Vater und der Papst bestimmten«, entgegenzunehmen. Er schloß mit der Versicherung, »als katholischer Fürst leben und sterben zu wollen«.
Die Antwort des Kaisers konnte Philipp unmöglich befriedigen. Wenn sich Maximilian darin als Gegner der »Sekten« bekannte, meinte er damit auch das Luthertum? Zudem hatte er offen zugegeben, daß er das Abendmahl, wenn auch mit Genehmigung des Heiligen Vaters, unter beiden Gestalten nahm. Seine Beteuerung, als katholischer Fürst leben und sterben zu wollen, wog schließlich auch nicht zu viel, wenn man nicht wußte, was er unter »katholisch« verstand, da sich ja zahlreiche Protestanten als Anhänger der wahren katholischen Kirche zu bezeichnen pflegten. Vor allem aber trat wieder die grundsätzlich verschiedene Auffassung über die taktische Behandlung der Religionsfrage in die Erscheinung: Maximilian hielt Konzessionen für nötig, um einem Aufstand zu begegnen, Philipp hegte die Überzeugung, daß gerade durch solche die Staaten zugrunde gerichtet würden; der eine war für Milde und Güte, der andere für Strenge und Gewalt.
Mit Schreiben vom 5. Februar 1570 erging eine neuerliche Vorstellung Philipps an Maximilian. Er zweifle nicht an des Kaisers katholischer Gesinnung, so heißt es da belehrend, aber diese müsse Maximilian unbedingt auch nach außen hin bekunden. Mit Güte lasse sich da wenig richten; dem Ungehorsam der Untertanen sei mit Strenge und mit Strafen zu begegnen, denn die Fürsten hätten die Pflicht, den alten Glauben zu erhalten und im Vertrauen auf Gottes Beistand selbst alle zeitlichen Güter aufs Spiel zu setzen. Die Kommunion müsse unter allen Umständen in der von der Kirche vorgeschriebenen Weise empfangen werden, und zwar öffentlich; denn ihr geheimer Empfang bestätige nur den alten Verdacht. Die Fürsten – dahin klingt die dringende Ermahnung aus – sind gebunden, ihren Untertanen mit gutem Beispiel voranzugehen.
Als König Philipp II. diesen abermaligen Weckruf an seinen Vetter, Schwager und Schwiegervater ergehen ließ, befand sich Graf Monteagudo, der den schwer gichtkranken und seiner schwierigen Aufgabe nicht mehr gewachsenen Chantonnay abzulösen hatte, bereits auf dem Wege nach Wien, von den wärmsten Segenswünschen des Königs geleitet. Die ihm mitgegebene Instruktion, in welcher die Sorge für die katholische Kirche ausdrücklich als die wichtigste Angelegenheit bezeichnet erscheint, wies ihn an, in allen Fragen von größerer Bedeutung vorerst mit der Kaiserin sich zu besprechen. Und in der Tat schienen die frohen Erwartungen, die sich an den Botschafterwechsel, an die kräftigen Vorstellungen des Königs und nicht zuletzt an die neue Heiratsverbindung mit der Lieblingstochter Anna knüpften, in glückliche Erfüllung gehen zu wollen. Monteagudo meldete, kaum am Kaiserhofe angekommen, am 23. April 1570, die erfreuliche Tatsache, daß Maximilian den kirchlichen Feiern der Osterzeit »mit großer Strenge und Devotion« beigewohnt und sich überhaupt verändert habe.
Weniger rosig lautete der Bericht, den ein halbes Jahr später, am 27. Oktober, der Beichtvater der Kaiserin Maria, Francisco de Cordova, von Speyer aus dem König zusandte. Die religiösen Zustände in Deutschland, so schreibt er da, werden von Tag zu Tag schlimmer. Der Kaiser halte an seinem Hof nur wenig Katholiken und diese seien flau. Die Mehrheit in seiner Umgebung, und gerade die Räte, seien Ketzer, ja sogar Kalvinisten. Das größte Ärgernis bestehe darin, daß man nicht wisse, ob der Kaiser überhaupt beichte und kommuniziere; jedenfalls habe er es nicht öffentlich getan. Da diese skandalöse Tatsache im ganzen Reiche bekannt sei, müsse hier unbedingt Abhilfe geschaffen werden. Dazu komme noch der unglückselige Streit mit der römischen Kurie wegen des florentinischen Großherzogstitels, der im Falle eines Bruches mit dem Papst die Folge haben könne, daß der kümmerliche Rest von Religion auch noch verloren gehe.
Dies klang allerdings nicht sehr hoffnungsvoll. Indes, Graf Monteagudo hatte in einem seiner ersten Berichte vom Wiener Hofe eine Bemerkung einfließen lassen, die geeignet schien, den Mut wieder etwas zu beleben. Der Kaiser, so meinte er da, dürfte in Wahrheit gar nicht so »unzugänglich« sein, wie man dies gewöhnlich behaupte. Es fehle nur an der ernsten Entschlossenheit, das heikle Werk energisch anzufassen. Die Kaiserin tue es aus »Klugheit«, die anderen aus »Zaghaftigkeit« nicht. Schließlich und endlich handle es sich ja doch nur darum, die »gute Demonstration«, die Maximilian durch seine Anwesenheit bei der Messe bekunde, noch etwas weiter auszudehnen und ihn dahin zu bringen, daß er bei einem katholischen Priester die Beichte höre und das Abendmahl öffentlich und unter einer Gestalt empfange.
Monteagudo, der im ersten Eifer ein ganzes Aktionsprogramm entworfen hatte, hielt eine solche Wandlung des Monarchen für ebenso möglich wie die ausschließliche Verwendung von katholischen Räten und die öffentliche Bevorzugung der katholischen Untertanen. Die Kaiserin freilich verhielt sich zu diesem weitausschauenden Plan etwas skeptisch, namentlich was den ersten Punkt, Maximilians Verhalten im Punkte der Beichte und der Kommunion, anlangte. Sie wäre schon zufrieden, meinte sie, wenn ihr Gemahl, da er nun einmal die päpstliche Erlaubnis dazu habe, überhaupt kommuniziere – eine Äußerung, die den Botschafter, der über seine Unterredung mit Maria am 1. Februar 1571 nach Hause berichtete, zur Bemerkung veranlaßte, da falle ihm wohl die Wahl schwer.
Sah also Graf Monteagudo richtig, dann winkte noch immer die Hoffnung, bei fortgesetzter geschickter Behandlung einen Erfolg zu erzielen. Zunächst freilich kamen keine günstigen Nachrichten vom Kaiserhofe. Hatte die Kaiserin vorhin bedauert, daß ihr Gemahl die Sakramente der Beichte und der Kommunion überhaupt nicht in Empfang nehme, so war sie bald in der Lage, dem Botschafter mitzuteilen, daß dies in der Tat geschehen sei. Da Maria aber darüber sehr wenig erfreut erschien, mutmaßte der Graf, wie er am 29. April seinem König berichtet, daß Maximilian jene Sakramente aus den Händen eines Häretikers gespendet erhalten habe – ein Verdacht, den schon im Vorjahre der kaiserliche Hofprediger Lambert Gruter, Bischof von Wiener Neustadt, ausgesprochen hatte.
Das war keine gute Botschaft! Und nachdenklich stimmte es den König auch, daß Maximilian allen erneuten Vorstellungen gegenüber auf sein Schreiben vom 20. November 1569 hinwies, und damit deutlich, wenn auch in höflicher Weise, zu verstehen gab, Philipp möge ihn mit seinen religiösen Ermahnungen gefälligst in Ruhe lassen. Allein schon damals bot sich dem besorgten König eine gute Gelegenheit, dem Kaiser auf andere Weise beizukommen. Die beiden Erzherzöge Rudolf und Ernst traten nach einem Aufenthalt von fünf Jahren die von ihm solange hinausgeschobene Heimreise an. Dietrichstein, der sie in seiner Eigenschaft als Obersthofmeister nach Hause begleiten sollte, erschien just als die geeignete Persönlichkeit, um jene Angelegenheit, die Philipp, wie dieser sagte, »von allen Dingen der Welt am höchsten stand«, ins Werk zu richten. In einer ausführlichen Instruktion – sie ist vom 21. Mai 1571 datiert – wurde alles, was es wider Maximilians religiöses Verhalten zu tadeln gab, aufgezählt und dem Botschafter ans Herz gelegt, seinen kaiserlichen Herrn unausgesetzt, selbst auf die Gefahr hin, »ihm lästig zu fallen und dessen Gunst einzubüßen«, zu bearbeiten. Schon war diese Unterweisung ausgefertigt; aber im letzten Moment entschloß sich der König, die Mission Dietrichsteins einzustellen. Die Angelegenheit ruhte nun, bis ein neuer Vorfall Philipp zum Eingreifen nötigte.
Der Kaiser war am 23. November wieder von seinem alten Herzleiden heimgesucht worden. Diesmal traten die Anfälle derart heftig auf, daß die Ärzte eine Zeitlang ganz ernstlich seinen Tod befürchteten. Erst nach vierzehn Tagen erschien Maximilian soweit hergestellt, daß er, wie der bayerische Agent Winkelmayr am 11. Dezember meldet, dringlichere Geschäftsstücke statt mit dem »Trugkherl« eigenhändig unterzeichnen konnte und sich dabei befleißigte, seine Handschrift »so groß und rein zu machen, wie schon lange nicht geschehen«. Der Diplomat sah, wie er acht Tage darauf berichtet, nicht weniger als fünf Leibärzte aus dem Speisezimmer des Kaisers herausgehen, »denn sy seindt allemal darbei, wann Ire Majestät essen«. Noch viele Wochen währte es, bis der Monarch halbwegs wieder hergestellt war. Die Besserung, schreibt Maximilian am 18. Januar 1572 seinem bayerischen Schwager, geht nur langsam vonstatten und »bin zimlich matt und awkhumen«. Erst am 6. Februar konnte er dem Kurfürsten August berichten, daß es sich mit seiner »langwierigen und schweren« Krankheit Gottlob zur Besserung schicke.
Die schwere Erkrankung des Kaisers brachte auch die Religionsfrage ins Rollen. Zu der Angst für das Leben des geliebten Gatten gesellte sich bei der Kaiserin Maria die Sorge um sein Seelenheil. Denn trotz der eminenten Todesgefahr – einer der Anfälle währte 66 Stunden und der Puls hatte schon ausgesetzt – traf Maximilian keinerlei Anstalten, die Tröstungen der Kirche zu verlangen. Der spanische Gesandte, ebenfalls über das Ausbleiben der »katholischen Demonstration« im höchsten Grade beunruhigt, suchte sofort durch Vermittlung Dietrichsteins und anderer Räte den Monarchen dahin zu bestimmen, daß »die Welt von seinem Christentum befriedigt« werde. Doch wollte niemand diese unangenehme und schwierige Mission übernehmen. Nur die Kaiserin machte später, als Maximilian sich wohler fühlte, einen schüchternen Versuch, indem sie ihn an seine Pflicht erinnerte, Gott für die Genesung zu danken. Der Kaiser entgegnete kurz, er habe sich stets dem Willen des Herrn gemäß benommen. Als seine Gattin dann wieder bemerkte, dies allein genüge unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht, sondern er müsse sich als Katholik auch durch die Tat erweisen, gab ihr der Kaiser die überraschende Antwort, er werde das tun, und zwar sogleich.

Alfonso II., Herzog von Ferrara
Zur großen Bestürzung erfuhr man bald darauf, daß der Kaiser aus Linz einen lutherischen Prediger habe holen lassen, der ihm auch zu Ostern das Sakrament des Abendmahls spendete. Graf Monteagudo berichtete am 9. Dezember brühwarm diese sensationelle Entdeckung seinem König.
Es ist begreiflich, daß der Botschafter der geheimnisvollen Person die höchste Aufmerksamkeit zuwandte. Derselbe war – sein Name wird uns nicht genannt – ein ehemaliger »Meßpriester«, der sich dann verheiratete, und besaß mehrere Söhne, die gleich den Eltern vom Kaiser unterstützt wurden. Maximilian versicherte seiner Gemahlin, der Geistliche sei ein Katholik. Allein Monteagudo wollte dies nicht wahr haben. Wenn sich der Linzer Prediger, so äußerte er sich zur Kaiserin, verheiratet habe, nachdem er schon Priester war, so sei er ein Häretiker. Sollte er aber von seinem katholischen Bischof infolge einer falschen Angabe die Ordination erhalten haben, dann müsse er als Schismatiker angesehen werden. Auf jeden Fall galt es, diesen »nichtswürdigen Menschen« zu entfernen. Aber wie? Einige dachten daran, ihn durch Geld zum Verlassen des Landes zu bewegen; doch erschien dieses Auskunftsmittel sogar dem spanischen Botschafter zu gewagt.
Philipp II. wandte sich sofort nach dem Einlangen dieser Hiobsbotschaft an den Kaiser, um ihm abermals eindringlich ins Gewissen zu reden. Maximilians Krankheit, so schreibt er ihm am 4. März 1572, habe seine alte Sorge erneuert. Es genüge nicht im Herzen katholisch zu sein, man müsse seinen Glauben auch äußerlich, besonders durch den Empfang der Sakramente, bezeugen, damit die Bösen in ihren Erwartungen erschüttert und die Guten in ihren Zweifeln beruhigt würden. Das Handschreiben des Königs, das Don Pedro de Fajardo, Marquis de Veles, nach Wien brachte, fand bei Maximilian keine gute Aufnahme. Er gab auf dasselbe gar keine Antwort. So richteten sich, nach dem gründlichen Versagen der brieflichen Ermahnungen, alle Hoffnungen auf Dietrichstein, der um die Mitte Februar nach Spanien zurückgekehrt war. Die Kaiserin hatte ihrem königlichen Bruder nahegelegt, den kaiserlichen Diplomaten durch die Aussicht auf ein reichliches Geldgeschenk von 40 000 bis 100 000 Dukaten für das Bekehrungswerk zu gewinnen. Er sei, so meinte sie empfehlend, verschwiegen und kenne genau die Natur seines Herrn, so daß durch ihn wirklich etwas ausgerichtet werden könnte.
Auch von Pater Cordova, dem früheren Beichtvater Marias, der jetzt wieder in Spanien weilte, wurde Philipp gedrängt, keine Kosten zu scheuen, um den Kaiser »in den Schoß der alten Kirche zurückzuführen«. Zur Bekräftigung seiner Mahnung vertraute er Philipp an, daß Maximilian bei seiner Wahl zum römischen König dem Kurfürsten August von Sachsen das Wort gegeben habe, die Augsburger Konfession bekennen und begünstigen zu wollen. Er wies ferner auf das bedrohliche Überhandnehmen der Ketzereien in Österreich und namentlich auf den schreienden Übelstand hin, daß das Wiener Bistum schon über zehn Jahre unbesetzt sei, obwohl es nicht an geeigneten Bewerbern fehle.
So entschloß sich denn Philipp, Dietrichstein die ihm schon vor anderthalb Jahren zugedachte Aufgabe nun wirklich anzuvertrauen. Der Diplomat, vom König dazu aufgefordert, entwickelte am 11. Oktober 1572 seine Ansicht über den gegenüber Maximilian einzuschlagenden Weg. Er warnte davor, diesen irgendwie merken zu lassen, daß man an seinem Glauben zweifle. Man solle im Gegenteil ihm vertrauensvoll entgegenkommen, wenn er auch vieles getan habe, was jenen Verdacht rechtfertige. Maximilians Gesinnung sei im ganzen keine schlechte, und man müsse immer bedenken, daß sie sich entschieden besser gestaltet habe, als man zu seines Vaters Lebzeiten dachte. Würde man dem Kaiser anders begegnen, so sei zu besorgen, daß er das, was er jetzt heimlich tue, offen machen und auch vertreten werde, woraus ihnen nur ein größerer Schaden erwachsen müsse.
Adam von Dietrichstein reiste am 6. April 1573 vom Königshofe ab, mit einer ausführlichen Instruktion versehen, worin alle die im Laufe der Jahre angehäuften Beschwerden, an erster Stelle sein Verkehr mit dem offen verheirateten und religiös bemakelten Linzer Beichtvater, aufgezählt erscheinen. Er hatte seinem kaiserlichen Herrn mit besonderem Nachdruck vorzustellen, daß weltliche Rücksichten einen wahrhaft katholischen Fürsten niemals von der Pflicht, seinen Glauben zur Schau zu tragen, ablenken dürften. Sollte jedoch Maximilian den neuen Lehren auch innerlich nahestehen, so wäre er zu ersuchen, die Gründe, die ihn veranlaßten, vom Glauben seiner Väter abzugehen, gut katholisch gesinnten Männern mitzuteilen. Dietrichstein wurde mit Rücksicht auf den ungünstigen Gesundheitszustand des Kaisers der Wink erteilt, seine Aktion nicht allzulange aufzuschieben. Sie sollte im Auftrag des Königs, ganz offiziell, erfolgen, und zu diesem Zweck erhielt er ein warm gehaltenes Kredenzschreiben, worin Philipp unter Hinweis auf seine früheren Vorstellungen der Hoffnung Ausdruck gab, er werde diesmal mehr Glück haben.
Der kaiserliche Diplomat entledigte sich pünktlich seiner schwierigen Aufgabe und hatte den Erfolg, daß der Kaiser sich ausführlich und freimütig über alle gegen ihn erhobenen Anklagen äußerte. Wäre er, erklärte er, kein Katholik und hätte er nicht immer die katholische Kirche unterstützt, so stünde es um diese ganz anders. Was seinen Beichtvater betreffe, so sei er allerdings verheiratet, doch in allen anderen Punkten katholisch und ein Mann von tadellosem Lebenswandel. Die Erscheinung eines verheirateten katholischen Priesters sei in Deutschland nichts so Bedeutsames, habe doch selbst sein Vater in Rom die Konzession der Priesterehe betrieben, und sie wäre auch sicherlich erteilt worden, wofern nicht der König und andere ihm so stark entgegengearbeitet hätten. Wenn er die Kommunion unter beiderlei Gestalt nehme, so habe er, ungeachtet seiner Überzeugung, daß er in Fragen, die Gott und Christus zum Urheber hätten, nicht irren könne, beim Papst die Erlaubnis eingeholt, und er bediene sich ihrer deshalb nicht öffentlich, weil es so sein Vater gewollt und er anderen kein Ärgernis geben möchte. Der Messe und anderen kirchlichen Veranstaltungen wohne er bei, so oft es nötig sei. Wenn der König verlange, am Kaiserhofe sollten ausschließlich Katholiken verwendet werden, so wisse Dietrichstein selber, wie spärlich diese gesät seien, so daß auch sein Vater Protestanten heranziehen mußte.
Auf die Verdächtigung seiner religiösen Gesinnung übergehend, erwiderte Maximilian: Er sei wohl kein Theologe, glaube aber doch alles, was er für sein Seelenheil zu wissen brauche, zu verstehen, so daß er es nicht nötig habe, von anderen sich belehren zu lassen, um so mehr, als er überzeugt sei, daß er das, was er fühle und tue, für keinerlei Neuerung oder Abweichung von der katholischen Kirche ansehe. Wenn aber der König glaube, daß er sein religiöses Verhalten von weltlichen Rücksichten abhängig mache, so wisse jeder, der seine Natur näher kenne, daß es ihm vollständig ferne liege, »sich zu verstellen« oder eine andere Gesinnung zur Schau zu tragen.
Dietrichstein besprach dieses Thema mit dem Kaiser noch ein zweites Mal, als er auf Wunsch der Kaiserin eine andere, allerdings damit zusammenhängende Angelegenheit berührte, die ihr seit längerer Zeit schwer auf der Seele lastete. Es hieß nämlich, Maximilian beabsichtige, die zwei jüngeren Erzherzoge Matthias und Maximilian das Altarsakrament unter beiden Gestalten empfangen zu lassen. Dietrichstein gab seinem Herrn zu bedenken, welche Folgen das für das Haus Österreich und die Sukzession haben könnte, wenn ein Teil der Brüder katholisch sei und der andere nicht. Maximilian bemerkte darauf kurz, daß die Erzherzoge deshalb noch nicht aufhörten, Katholiken zu sein. Damit endete die Unterredung mit dem Kaiser.
Der bewährte Hofmann gestand dem König in seinem Bericht vom Juli 1573, daß er sich in seinem kaiserlichen Herrn nicht recht auskenne. Auf der einen Seite sehe man ihn durchaus geneigt, alles zur Erhaltung und Stärkung der katholischen Kirche Erforderliche zu tun, so daß man sich seiner Meinung nach »gar nicht mehr wünschen könne«. Andererseits freilich finde sich, daß er es auch mit ihren Gegnern halte, zum mindesten vieles Schädliche und Ärgerliche geschehen lasse, so daß man ihn für »verloren« halten möchte. Allein alles in allem neige Maximilian doch mehr auf ihre Seite, und so bestehe die Aussicht, daß die vereinigten Bemühungen des Königs und der Kaiserin Erfolg haben und die Verhältnisse wenigstens nicht schlechter würden.
König Philipp erhielt von Dietrichstein auch einige Winke, wie er sich dem Kaiser gegenüber zu verhalten habe. Auf keinen Fall dürfe man ihn »drängen« oder ihn merken lassen, daß man ihn für einen »Abtrünnigen« halte. Vielmehr müsse man sich so stellen, als habe man zu seiner katholischen Gesinnung das größte Vertrauen. So viel den Beichtvater anbelange, sei eine Veränderung wohl schwer zu erwarten, aber keineswegs ausgeschlossen. Dagegen hege er im Punkte des Altarsakramentes nicht die geringste Hoffnung auf einen Wandel und man müsse zufrieden sein, wenn er dasselbe unter den vom Papst gestellten Bedingungen zu nehmen vorgebe. Auch wäre darüber ein Auge zuzudrücken, daß er angeblich seiner vielen Arbeit und häufiger Indispositionen wegen nicht jeden Tag die Messe höre; man müsse sich schon damit begnügen, daß er ihr wenigstens an den Sonn- und Feiertagen beiwohne.
Schwerlich wird Dietrichsteins ungeduldig erwarteter Bericht am spanischen Königshofe große Freude hervorgerufen haben – bestätigte er doch die seit langem gehegten Befürchtungen, daß der Kaiser über die Pflichten eines Katholiken anders dachte als der Spanier. Immerhin war es ein großer Trost, aus dem Munde des mit seinem Charakter wohl vertrauten Oberstkämmerers zu vernehmen, daß dessen kirchliche Politik, bei aller Rücksichtnahme auf ihre Gegner, doch mehr nach der katholischen Seite hin neige. Daß man es spanischerseits nicht daran fehlen ließ, gerade jene verpönten »weltlichen« Motive auf den Kaiser wirken zu lassen, um ihn gefügig zu machen, zeigte das Gespräch, das Dietrichstein im Anschluß an seine religiösen Ermahnungen mit jenem führte. Da redete er über die Notwendigkeit, die Erbfolge im Reiche zu sichern, und bei dieser Gelegenheit meinte er, es wäre nicht gut, den Hausbesitz nach dem Vorgang Kaiser Ferdinands unter so viele Söhne zu teilen. Weit empfehlenswerter würde es sein, den jüngeren Erzherzogen Bischofssitze, womöglich mit der Kurwürde zu verschaffen. Man wußte, wie sehr dem Monarchen die Versorgung seiner zahlreichen Nachkommenschaft am Herzen lag.
Während im königlichen Staatsrat über Dietrichsteins Bericht verhandelt wurde, um über die weiteren Schritte gegen Maximilian schlüssig zu werden, ereignete sich am Wiener Hofe ein Vorfall, der nicht geeignet erschien, der im ganzen hoffnungsvollen Auffassung des kaiserlichen Oberstkämmerers Nahrung zu geben. Kurze Zeit nach seinen Besprechungen mit Maximilian war von diesem eine der zuverlässigsten Stützen der strengkatholischen, jesuitischen Richtung in Österreich, der kaiserliche Reichshofrat und Professor der Wiener Universität Dr. Georg Eder in ostentativer Weise gemaßregelt worden.
Eder hatte im September 1573 seine »Evangelische Inquisition« erscheinen lassen, eine heftige Schmähschrift gegen die Protestanten, die, wie er da meint, viel irriger und gottloser als Heiden, Türken und Mamelucken wären, vor allem aber gegen die »höflichen Christen« oder »Hofchristen«, die »neue, widerwärtige, hochschädliche Rotte«, die durch ihr »System des Mäuklens« eine solche Verwirrung anrichte, daß »niemand mehr recht verstehen noch wissen kann, was weiß oder schwarz, was recht oder unrecht, noch weniger was er tun oder lassen soll«. Diese Hofchristen, so setzt er spitz hinzu, »dissimulieren und verdrucken alles und lassen es ein gut Ding sein; schicken sich also darein, daß niemand wissen noch merken kann, welcher Religion sie seien. Etliche begeben sich in solche Leichtfertigkeit, daß sie den ganzen Religionsstreit verachten, als wolle sie derselbe nicht anfechten. Sie sind halb lutherisch, halb bäpstisch und doch keines ganz, sondern kehren den Mantel nach dem Wind und stellen sich wie die Wetterhähne … bei den Bäpstischen sind sie bäpstisch, mit den Lutherischen lutherisch … und gilt ihnen in summa eine Religion soviel als die andere; die ihnen zum meisten trägt, ist die beste … und diese sind eben die Junker, davon der heilige Paulus schreibt: Quorum deus venter est d. i. welche die Bauchfüll für ihren Gott halten«.
Niemand konnte nur einen Augenblick darüber im Zweifel sein, wer mit den »Hofchristen«, den »weltweisen Mittlern« gemeint sei: es war der Kaiser selber und die Vermittlungspartei am Wiener Hofe; in vorderster Linie sein erster Berater, der Vizekanzler Weber. Man versteht so die Entrüstung Maximilians, der sich auf derart grobe und heftige Art von einem seiner eigenen Räte angegriffen und verhöhnt sah. Dazu kam noch, daß die Hetzschrift, die den von Maximilian so sorgsam gehüteten Burgfrieden unter den beiden Konfessionen zu stören geeignet war, als mit kaiserlichem Privileg gedruckt erschien, somit seine Unparteilichkeit und Aufrichtigkeit in ein bedenkliches Licht gerückt waren.
Der Kaiser war aufs höchste aufgebracht. Er forderte in einem ganz ungewöhnlich strenge gehaltenen Dekret, unter Androhung der Amtsenthebung, Professor Eder auf, sämtliche Exempel seiner »Inquisition« abzuliefern und sich in Hinkunft jeder literarischen Tätigkeit in Religionssachen zu enthalten. Weiter aber geschah ihm nichts, obwohl das Gerücht bereits wissen wollte, daß er im Kerker schmachte und »gehenkt« werde. Eder wurde bald wieder in Gnaden aufgenommen – Maximilian war eben kein Philipp II. Aber schon das bloße Verbot der »Inquisition« wirkte in jenen Kreisen, welchen Eder aus vollster Seele gesprochen hatte, als ein »fürchterlicher Schlag«, und der mundtot gemachte Reichshofrat galt nun als der beklagenswerte Märtyrer der katholischen Sache.
Der spanische Botschafter, von der Kaiserin ermuntert, zögerte nicht, Maximilian seines Vorgehens gegen Eder wegen Vorstellungen zu machen, um ihn zur Zurücknahme seines Verbotes zu bewegen. Allein der sonst so milde und liebenswürdige Habsburger verstand in diesem Punkt, wo der Friede des Reiches und, so kann man sagen, seine persönliche Ehre auf dem Spiele standen, keinen Spaß. Der Kaiser, den Monteagudos Vorgänger »wie ein Stück Papier nach Gefallen drehen und wenden« zu können vermeint hatte, wies den Einspruch des Grafen so »schroff« ab, daß er es nicht wagte, noch ein zweites Mal für den Verfasser der »Evangelischen Inquisition« eine Lanze zu brechen.
In den spanisch-römischen Kreisen aber sah man im Vorgehen des Kaisers einen neuen Beweis seiner »bösen« Gesinnung. Man glaubte es auch mit der bevorstehenden Wahl Erzherzog Rudolfs zum römischen König in Verbindung bringen zu müssen. Offenbar wollte er, so schrieb Pater Diego Avellanada im Oktober 1573 dem König, die weltlichen Kurfürsten für sich gewinnen. In Rom wurden Besorgnisse laut, Maximilian werde noch weitergehen. Von allen Seiten wurde Philipp zu Hilfe gerufen.
Die schwere Verstimmung gegen den Kaiser kam in den Beratungen der geistlichen Kommission zum Ausdruck, die über die durch Dietrichsteins Bericht geschaffene Situation ihr Gutachten abzugeben hatte. Dieses Votum – es ist vom 24. Januar 1574 datiert – nimmt sich wie das Verdikt eines Ketzergerichtes aus, das über den Kaiser abzuurteilen hatte. Nach eingehender Erwägung aller »Defekte« kam sie zu dem Ergebnis, daß man nicht befugt sei, dem apostolischen Stuhle vorgreifend, Maximilian als »Häretiker« zu erklären und kraft der Satzungen der Heiligen Schrift den Verkehr mit ihm abzubrechen; unzweifelhaft aber sei er ein »flauer, schwacher Christ«, weshalb seiner im Kirchengebet auch weiterhin zu gedenken sei. Doch zwischen den Zeilen steht nicht undeutlich zu lesen, daß man nur aus verschiedenen Rücksichten, vor allem wohl der Königin Anna wegen, vor den äußersten Konsequenzen zurückschreckte; man wußte zudem nicht, ob Maximilian bei jenem Linzer Prediger auch wirklich beichte oder mit ihm über andere Dinge spreche und ob jener in der Frage des Laienkelches durch sein Ansuchen um die Dispens die Autorität des Papstes anerkannt habe. Dietrichstein wurde aufgefordert, seine Bemühungen um des Kaisers Seele fortzusetzen und vor allem auf die Veränderung in der Person des Beichtvaters wie auf Eders Begnadigung hinzuwirken.
Maximilian blieb, wie die Kaiserin am 24. Mai 1574 Pater Cordova schrieb, in der Erfüllung seiner kirchlichen und religiösen Pflichten »nachlässig und flau«; es schien ihr, als ob für ihn nur diese und keine andere Welt existiere. Der mysteriöse Beichtvater tauchte zu Ostern wieder für längere Zeit am Kaiserhofe auf. Und die schwere Sorge wich auch nicht, als der verhaßte Geistliche im Herbst starb; denn man hörte alsbald, daß Maximilian sich um einen entsprechenden Nachfolger umsehe, wobei ein »Lutheraner« der strengsten Richtung, wie Monteagudo am 16. November 1574 berichtete, »noch schlimmer als der Verstorbene, wenn es da überhaupt eine Verschlimmerung geben konnte«, im Vordergrund stand. Da galt es denn wieder alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Fortsetzung und Festlegung des großen Skandals zu verhindern.
In Madrid herrschte, als diese neue Alarmmeldung eintraf, die größte Verwirrung. Alle bisher angewandten Mittel hatten versagt. In dieser Not verfielen der König und der als Kenner der österreichischen Verhältnisse von ihm zu Rate gezogene Pater Cordova auf den Gedanken, die Königin Anna ins Treffen zu schicken. Man kannte des Kaisers Liebe zu seiner ältesten Tochter. Cordova, jetzt ihr geistlicher Beistand, beredete sie, ihrem Vater einen Brief zu schreiben und ihn zu bitten, als Beichtvater einen tüchtigen Katholiken zu verwenden. Der Brief, der von Cordova selbst diktiert und vom König eingesehen wurde, war absichtlich recht kunstlos gehalten, um den Anschein zu erwecken, daß er von der Königin selbst, ohne jede Beeinflussung, verfaßt wurde. Monteagudo wurde am 27. Dezember 1574 angewiesen, ihn dem Kaiser zu übermitteln.
Doch auch das Eingreifen der Tochter hatte keinen Erfolg. Der Kaiser nahm sich tatsächlich an Stelle des verstorbenen Predigers einen anderen Gewissensrat mit Namen Abraham, einen »großen Häretiker«, wie ihn der kaiserliche Obersthofmeister Trautson nannte. Der »pflichtvergessene« Monarch vertrug überhaupt, wie man in Madrid immer deutlicher erkennen sollte, in diesem Punkt nicht die geringste Einmischung und beobachtete allen Andeutungen gegenüber unverbrüchliches Schweigen; nicht einmal der Kaiserin teilte er, ganz gegen seine sonstige Gewohnheit, etwas von den aus Spanien eingelangten Ermahnungsschreiben mit.
Also: statt der erhofften »Besserung« in der religiösen Haltung Maximilians war eher eine Verschlimmerung eingetreten, und man brachte sie mit dem Näherrücken des Termines für die römische Königswahl, mit seiner steigenden »Angst« vor den protestantischen Reichsfürsten, in Zusammenhang. Dietrichstein mußte wohl an eine solche glauben, als ihn der Kaiser, der eben Nachrichten aus Deutschland erhalten hatte, wegen des religiösen Verhaltens seines ältesten Sohnes zur Rede stellte. Die protestantischen Fürsten, so erklärte er unwillig, hätten gegen Rudolf allerlei Bedenken erhoben. Er sei, so sagten sie, in seinen Lebensgewohnheiten und Anschauungen allzu spanisch und in religiöser Hinsicht »zu heilig«. Der Oberstkämmerer sah sich darauf, wie Monteagudo am 28. März 1575 meldet, veranlaßt, um die Enthebung von seinem Dienste zu bitten. Der Kaiser sagte nichts mehr, aber sicherlich war nun auch Dietrichstein die Lust gründlich vergangen, das gefährliche Thema noch einmal anzuschneiden.

Erzherzog Rudolf
Tatsächlich mehrte sich in der spanischen Umgebung des Kaisers die Unruhe, je näher der Zeitpunkt der Wahl heranrückte. Als Maximilian im April 1575 an den Hof des Kurfürsten August von Sachsen reiste, drang die Kaiserin in den spanischen Botschafter, daß er ihren Gemahl begleite, so als suchte sie, ein Gegengewicht zu den vorauszusehenden Verführungskünsten des protestantischen Freundes zu schaffen. Und diese Sorge war nicht unbegründet. Denn schwerlich wird es ihr entgangen sein, daß Maximilian bei ihrem letzten Zusammensein am Wiener Hofe im Februar 1573 seine vertraulichen Erklärungen von ehemals, da er sich als Anhänger der Augsburger Konfession bekannte, wiederholt hatte, welche Tatsache durch die indiskreten Enthüllungen des dabei anwesenden kursächsischen Rates Hassenstein in die Öffentlichkeit gedrungen war. Der Kurfürst ließ es sich auch nicht nehmen, auf die Kunde von den Umtrieben und »Praktiken« des Kardinals Commendone, der in Polen gegen den habsburgischen Thronkandidaten arbeitete, Maximilian den Rat zu geben, mit der ihm bei seiner letzten Anwesenheit in Wien und auch »forhin mehrmals« abgegebenen Erklärung, »daß er der Augsburger Confession wäre«, offen herauszutreten.
Die Hauptsache war aber, daß der sächsische Kurfürst für die Wahl Rudolfs gewonnen war; die Zustimmung der geistlichen Kurfürsten wie des Brandenburgers war dann bald erlangt. Als das Jahr 1575 heranbrach, konnte Maximilian schon erleichtert aufatmen. Nur vom Pfälzer waren wie gewöhnlich Schwierigkeiten zu erwarten. »Aber Pfalz«, so schreibt der Kaiser am 14. Januar seinem bayerischen Schwager Albrecht, »ainem alten Gebrauch nach thuet pessima officia und sahe nix lieber dan das dises Werch verhindert würde und das es zu ainem interregno khumen möchte, wie er sich dan solliches aperte gegen Maintz, Saxen und Hessen hatt vernemen lassen, in summa: lupus mutat pilum, sed non pellem. Ich bedankh mich auch zum hogsten gegen Euer Lieb des getraien Rats, so mier Euer Lieb geben maines Sons halber, wie er sich gegen den Laiten verhalten möchte, ist auch wol ain hohe Notorft, will an mainer vatterlichen Erinderung nix erwinden lassen, dan er noch fil spanischer Humores hett, ist wol vonneten, ut bene purgetur.«
Der pfälzische Kurfürst, vollständig isoliert und von seinen eigenen Gesinnungsgenossen im Stiche gelassen, sagte übrigens dann, als die kaiserliche Gesandtschaft endlich auch bei ihm offiziell anklopfte, zur Ausschreibung des Wahltages Ja und Amen. Doch war er entschlossen, die alten kirchenpolitischen Forderungen auf die Bahn zu bringen. Gewissermaßen den Abschluß der Verhandlungen bildete jener Besuch des Kaisers in Dresden, vor welchem seiner Gemahlin so bangte. Maximilian war mit seiner Familie hingekommen und der Erzherzog Rudolf tanzte einmal mit der zwölfjährigen ältesten Tochter des Kurfürsten vier Tänze, so daß man schon von einer bevorstehenden Verlobung sprach.
Hatte der Kaiser bisher vielleicht noch die Sorge gehabt, der Kurfürst strebe, wie es immer geheißen, selber nach der Kaiserkrone, so war jetzt jeder Verdacht geschwunden. Mit Ruhe konnte er dem Wahltag entgegensehen. Der Termin für dessen Eröffnung war etwas hinausgeschoben worden, weil Rudolf vorher noch zum König von Böhmen gekrönt werden sollte.
Maximilian eröffnete Ende Februar 1575 den böhmischen Landtag persönlich. Die Lutheraner überreichten ihm am 18. Mai eine Bekenntnisschrift, die »böhmische Konfession«, mit der Bitte um freie Religionsübung. Lange zögerte der Kaiser; denn er wollte weder die Katholiken noch die utraquistische Partei verletzen. Endlich, am 2. September, gab er mündlich den der lutherischen und der Brüderpartei angehörigen Ständen – Herren, Rittern und städtischen Abgeordneten – bei seiner Treue und seinem kaiserlichen Wort die Zusicherung, daß weder er noch sein Nachfolger sie in ihrem Glauben bedrücken oder hindern würde. Es war eine vollständig unverbindliche Erklärung, aber der schlaue Habsburger erreichte damit, daß Katholiken und Protestanten gleich zufrieden waren und Rudolf zum König »angenommen« wurde. Am 22. September empfing er die heilige Wenzelskrone.
Und merkwürdig: die Zusicherung Maximilians an die böhmischen Protestanten, die eine so zweifelhafte Rechtskraft besaß, verfehlte auch nicht auf die protestantischen Kurfürsten, vor allem auf den Pfälzer, eine gute Wirkung auszuüben, was gerade jetzt von großer Bedeutung war. Denn in den letzten Septembertagen trat in Regensburg der Wahltag zusammen. Bei den Verhandlungen über die Wahlkapitulation, die am 10. Oktober eröffnet wurden, kam es mit dem pfälzischen Kurfürsten, der glücklich die Frage der Bestätigung der Ferdinandeischen Deklaration zur Sprache gebracht hatte, zu einem Zusammenstoß. Doch wurde er von den anderen protestantischen Kurfürsten im Stiche gelassen, und so konnte, bevor noch der Monat zu Ende ging, die eigentliche Wahlhandlung vor sich gehen. Rudolf wurde einstimmig zum römischen König gewählt, und am 1. November fand in feierlicher Weise die Krönung statt. Maximilian war von einer schweren Sorge befreit. Auch sonst hatte sich manches zum Besseren gewendet. Der Traum einer »französischen Weltmonarchie« war wie eine Seifenblase zerstoben. König Heinrich von Anjou hatte Polen auf die Nachricht vom Tode seines Bruders Karl IX. fluchtartig verlassen. Gegen den Heimgekehrten entbrannte sofort ein neuer Krieg der Hugenotten – der fünfte – und Pfalz stellte sich offen auf ihre Seite. Von dem Kaisertum des Hauses Valois war es still geworden.
Aber nun hieß es zu den Vorgängen in Polen und in Ungarn Stellung nehmen.
Durch die Flucht König Heinrichs nach Frankreich war die polnische Königskrone schon nach Jahresfrist zum zweiten Male freigeworden. Maximilian trat wiederum für seinen Sohn Ernst als Bewerber auf. Für die Vorbereitungen war diesmal reichlich Zeit, weil die Polen den erledigten Thron für den Ausreißer eine geraume Weile offenhielten. Aber die Werbearbeit der kaiserlichen Partei war keineswegs glücklicher und erfolgverheißender als das erste Mal. Wiederum und womöglich in noch größerem Maße machte sich hier der »Fluch« des Hauses Habsburg, mit halben Mitteln zauderhaft zu streben, geltend. Maximilian greift zu, scheut aber doch davor zurück, mit gewaltsamen Mitteln vorzugehen.
Und nur durch ein kühnes Zugreifen hätte der Kaiser die ersehnte Krone erwerben können. Denn unter der zahlreichen Schlachta zählte er so gut wie gar keine Anhänger und die schon anfänglich vorhandene Mißstimmung gegen den Vertreter der Deutschen und den Unterdrücker der böhmischen Wahlfreiheit wurde noch durch eine heftig einsetzende, nicht geschickt inszenierte Agitation der kaiserlichen Partei ins Maßlose gesteigert. Allerdings konnten sich die Gegner, als sie am 12. Mai 1575 zur Wahl zusammentraten, nicht über einen anderen Kandidaten einigen. Die meisten Aussichten hatten der Zar Iwan der Schreckliche und der böhmische Oberstburggraf Wilhelm von Rosenberg, der durch seinen Gesandten die glänzendsten Geldangebote machte und die Vereinigung Böhmens mit Polen versprach. Hier gaben also durchwegs allslawische Sympathien den Ausschlag.
Allein die litauischen Senatoren wollten einen Habsburger, nicht den Zaren, der neuerdings gegen Livland vorgedrungen war. Der Hofmarschall Radziwill wurde zum Kaiser gesandt mit dem Vorschlag: Erzherzog Ernst möge in ihr Land kommen, sich zum Großfürsten wählen lassen, Anna, die Schwester des letzten Jagellonenkönigs heiraten, um sich sodann die Anerkennung der Polen zu erzwingen; Maximilian aber sollte Gesandte zum Zaren schicken, damit dieser für den Erzherzog sich einsetze und ein Bündnis gegen die Türken schließe. Aber der Kaiser geht auf diesen Antrag nicht ein. Nur dazu erklärt er sich bereit, einen Gesandten zum Zaren zu senden. Dudit, seinem alten Anhänger, ließ er sagen: »Er wünsche nicht mehr als die Ruhe und Wohlfahrt seiner Reiche, aber auch Polen-Litauens und der ganzen Christenheit, deshalb habe ihm stets jede Gewalt ferne gelegen.«
An den Zarenhof wurde Johann Cobenzl von Prossegg, der wenigstens slowenisch sprach, abgefertigt. Neben der Unterstützung der Wahl Ernsts sollte er auch die Einstellung der Feindseligkeiten gegen Livland verlangen, und noch überdies die Rückstellung Livlands an das deutsche Reich, zu welchem es seit urdenklichen Zeiten gehört habe. Es war das eine alte Forderung, die schon zum eisernen Bestand der Reichstagsvorlagen zählen durfte – aber aus Gründen der höheren Staatsklugheit gerade in diesem Augenblicke nicht hätte aufgeworfen werden sollen.
Cobenzl reiste am 16. Oktober, mit »diamantisch Cleinot« versehen, von Wien ab und kam am Zarenhofe erst am 24. Januar 1576 an. Der Gesandte bot Iwan die europäische Türkei mit dem Kaisertitel an. »Dein sei das ganze griechische Reich gegen Sonnenuntergang«, so sagte er ihm. Wenn nämlich Erzherzog Ernst in Polen-Litauen zur Herrschaft gelange, so würden der Kaiser, der Papst, der spanische König und andere christlichen Fürsten ein Bündnis »zur Vertreibung der Türken aus Konstantinopel und zur Ausrottung der mohammedanischen Religion« schließen. Und sobald nun die Türken nach Asien zurückgeworfen seien, werde Iwan vom Kaiser und vom Papst das alte oströmische Reich mit dem Titel eines orientalischen Kaisers erhalten. Was bedeuteten dann, meinte Cobenzl die paar Städte in Livland.
Der kaiserliche Gesandte hatte Iwan viel versprochen, mehr jedenfalls, als er in seinem Auftrag hatte; aber der Zar wies die Rückstellung Livlands entschieden zurück. In der Angelegenheit der polnischen Königswahl schlug er vor, daß in Polen Erzherzog Ernst, in Litauen aber, zu welchem noch Kurland und Livland geschlagen werden sollte, sein Sohn Feodor gewählt werde. Dem Gesandten gab er zu verstehen, er habe kürzlich Nachricht erhalten, daß bei der Wahl nur er und der Siebenbürger Wojwode Stephan Báthory in Betracht kämen, er also ohnedies sehr entgegenkommend sei, wenn er für seine Person auf Polen verzichte. Der Zar machte nur noch das Zugeständnis, daß Litauen für den Fall, daß es sich nicht von Polen trennen wolle, den Erzherzog Ernst wählen könne. Dagegen erwarte er, daß ihm dann neben Livland Kiew und andere Gebiete Litauens überlassen werden würden.
Mittlerweile war auf dem Wahltage von Warschau die Entscheidung gefallen. Die national gesinnte Schlachta und die Protestanten hatten alles aufgeboten, um die Wahl eines Habsburgers zu verhindern. »Wir wollen keinen Deutschen«, war das Losungswort. Aber das war auch das einzige, worin die österreichfeindliche Partei einig war. In der Auswahl eines Gegenkandidaten gingen ihre Stimmen auseinander, und deren gab es eine schwere Menge: Erzherzog Ferdinand von Tirol, Herzog Alfonso von Ferrara, König Johann von Schweden und Stephan Báthory. Wilhelm von Rosenberg, der früher so große Aussichten gehabt hatte, hatte sich bereits zurückgezogen.
Der Senat war in seiner überwiegenden Mehrheit österreichisch gesinnt. Aber die Schlachta, die bewaffnet auf dem Reichstag erschien, hinderte den Erzbischof Uchanski von Gnesen, als Primas den Erzherzog zu nominieren. Die österreichische Partei verließ darauf unter Protest den Wahltag und rief am 12. Dezember den Kaiser zum König von Polen aus. Die Schlachta wählte zwei Tage später im Lager vor der Stadt Stephan Báthory, bedang sich aber aus, daß er Anna heirate, die »männertolle alte Jungfrau, deren Verstand schwach, deren Wille aber noch schwächer war«. Zwar hatte ihr auch die österreichische Partei die Ehe mit Ernst zugesagt, falls der Kaiser gewählt würde, aber man war dadurch, daß seinerzeit auch Montluc im Namen Heinrichs von Anjou ein solches Eheversprechen, das dann nicht gehalten wurde, gegeben hatte, etwas gewitzigt worden, und die kaiserliche Partei beeilte sich nicht, die Ehe zu vollziehen.
Nach dieser Doppelwahl lag nun alles daran, daß der Kaiser so rasch wie möglich Báthory zuvorkomme. Seine Anhänger forderten ihn denn auch zur größten Eile auf. Aber Maximilian zögerte. Nie habe er in einer Sache so oft, so viel und so streng Rat gehalten, so berichtet der bayerische Agent Haberstock am 1. März seinem Herzog. Die Annahme der Wahl war wohl gleichbedeutend mit einem Krieg gegen die Türken, der für ihn umso gefährlicher gewesen wäre, als viele adlige Ungarn mit dem Wojwoden sympathisierten. Aber man mußte auch wieder bedenken, daß Polen unter Báthorys Herrschaft aus einer Vormauer der Christenheit zu einem vorgeschobenen Posten der Türken würde.
Was tun? Zunächst schickte der Kaiser seinen Rat Viehäuser zu den Kurfürsten von Sachsen und von Brandenburg, um sie als die »nächsten Interessenten« um ihre Meinung anzugehen. Beide sagten ihm ihre tatkräftige Unterstützung zu, damit er sich eines »bösen Nachbarn überhöben könnte«. Aber Erzherzog Karl riet ihm entschieden ab, indem er seinem Bruder zu bedenken gab, woher er die Mittel zum Kampf gegen die Türken und Báthory nehmen wolle. Als Viehäuser von seiner Mission zurückgekehrt war, bekam er den Eindruck, daß Maximilian die Krone ausschlagen werde. »Aber gleichwie das jetzige Wetter,« so schreibt er am 18. März Herzog Albrecht, »also wexlet und verkeret sich die Sach und gerath jetzt dahin, Ihre Majestät nemen sich derselben an oder nicht, so hat man sich doch gewissers nichts als Angriffs vom Türken zu versehen.«
Es scheint nun, daß Cobenzl, der fünf Tage vorher vom Zarenhofe zurückgekommen war, durch seinen etwas rosig gefärbten Bericht die Entscheidung gebracht hat. Am 23. März legte der Kaiser in der Augustinerkirche in die Hand der polnischen Gesandten, die er zwei Monate hatte warten lassen, den Eid auf die polnische Verfassung ab. Allein er blieb auch jetzt untätig, außer daß er, am 8. April, dem Zaren einen Brief schrieb, worin er der Hoffnung Ausdruck gab, er werde ihm im Kampf gegen den Vasallen des Sultans Waffenhilfe leisten. Stephan Báthory aber ließ sich am 1. Mai in Krakau krönen, holte sich seine fünfzigjährige Anna und gewann nahezu das gesamte Land.
Das »Rätselhafte« des Verhaltens Maximilians findet in diesem Fall rasch seine Erklärung: außer an der nötigen Tatkraft fehlte es dem schwer leidenden Kaiser an Geld, und dieses wollte er sich auf dem Reichstag verschaffen, der nach Regensburg ausgeschrieben worden war.
Der Reichstag war für den 1. Mai 1576 angesetzt worden. Eine weitere Hinausschiebung, so wurde im kaiserlichen Ausschreiben gesagt, sollte in keinem Falle stattfinden. Indes war diesmal der Kaiser selbst schuld daran, daß die Stände nicht pünktlich zusammentreten konnten, weil er, schon in einem sehr leidenden Zustand, erst am 1. Juni von Wien aufbrach. In Straubing hatte er – angeblich wegen zu reichlichen Genusses von Fischen – einen heftigen Anfall von Nierenkolik zu bestehen und mußte die Reise unterbrechen. Am 17. Juni zog er mit seiner Gemahlin, den Erzherzögen Matthias, Maximilian und Albert, seiner Tochter Elisabeth von Frankreich und dem Herzog Albrecht von Bayern in Regensburg ein. Es kamen dann die üblichen Empfänge, während deren er abermals infolge eines Diätfehlers – er aß unreifes Obst – erkrankte.
Endlich, am 25. Juni, konnte Maximilian die Reichsversammlung persönlich eröffnen. Er hielt dabei eine derart lebendige Ansprache, daß die Blicke aller Zuhörer unbeweglich an seinen Lippen hingen. Anschaulich schilderte er die Größe der Türkengefahr, der er nicht mehr allein widerstehen könne, denn die Kräfte seiner Erbländer seien in dem fünfzigjährigen Kampf, der dem Untergang König Ludwigs folgte, vollkommen erschöpft worden. Wollten die Stände des Reiches Ungarn als die Vormauer des Reiches nicht verteidigen, so würden sie bald den Brand im eigenen Hause haben. Aus diesem Grunde, so schloß er, müßten sie rechtzeitig eine stattliche, beharrliche Hilfe leisten.
Über die Religionsfrage schwieg sich die kaiserliche Proposition gründlich aus. Allein daß sie auf diesem Reichstage zur Sprache kommen werde, das war so sicher als nur irgend etwas vorauszusehen, und dafür sorgte schon der pfälzische Kurfürst Friedrich, dem die letzten Vorstöße der katholischen Gegenreformation weit mehr zu Herzen gingen, als die drohende Verwicklung im Osten. Auch auf seiten der katholischen Partei hatte man sich wohl gefaßt gemacht. Der bayerische Gesandte Nadler konnte schon am 25. Juni seinem Herzog mitteilen, daß der »katholische Haufe« sich den Protestanten einhellig widersetzen werde. Papst Gregor XIII. hatte den bewährtesten Vertreter, den Kardinal Giovanni Morone, der seit vierzig Jahren unter den schwierigsten Verhältnissen sein diplomatisches Geschick gezeigt hatte und auch beim Kaiser in hohem Ansehen stand, als Legaten entsendet, um den Widerstand der Katholiken zu beleben. Offiziell hieß es, er sei nach Regensburg gekommen, um dem Kaiser in seinen polnischen und türkischen Nöten beizustehen.
Vier Tage nach der Eröffnung des Reichstages, am 29. Juni, traten die Protestanten im pfälzischen Quartier zusammen, um sich über eine gemeinsame Suplik zu beraten, und diese wurde noch am selben Tage dem Kaiser überreicht. Ob sie sich viel davon erwarteten, ist eine andere Frage. Maximilian hatte sich bei dem acht Tage vorher gefeierten Fronleichnamsfeste derart gut katholisch erzeigt, daß man auf Seite der Protestanten sehr herabgestimmt war. Sie könnten nichts anderes daraus entnehmen, meldeten am 21. Juni die hessischen Gesandten, »denn daß man noch im Bapsttum dermaßen ersoffen, daß derowegen keine Enderung zu hoffen, es sey denn daß man dem bapstischen Legaten damit dismals sonderlich hofieren wolle«. Auf jeden Fall stehe zu besorgen, daß auf solchen »idolatricum cultum«, solchen Götzendienst, wenig Glück folgen werde.
Als Maximilian wenige Tage darauf dem Legaten eröffnete, es werde sich eine Erörterung der evangelischen Forderungen kaum vermeiden lassen, erwiderte der Kardinal kurz und bündig, daß er dann weder die Türkensteuer noch seine übrigen Absichten – er hatte den Auftrag, für den Fall eines Krieges mit Polen eine Unterstützung von 100 000 Skudi anzubieten – durchsetzen werde. Und auch die katholischen Stände drohten in diesem Falle mit der Verweigerung der Türkenhilfe. So weit gingen zunächst ihre Gegner nicht, die dem Kaiser nur zu bedenken gaben, »wie gar sehr« durch ein Eingehen auf ihre Wünsche »die vorstehende Beratschlagung der gemeinen Reichssachen gefördert werden könnte«. Indes bald sollten auch sie zu radikaleren Mitteln greifen.
So befand sich denn der Kaiser in einer recht schwierigen Lage. »Negotium religionis«, schreibt er am 18. Juli dem Bayernherzog, »ist schan auf der Baan, und hab zu thun gnueg gehabt, das ich sie bewegt in publicis fortzufaren, jedoch haben sich die Sexischen gar beschaidenlich verhalten. Sonst haben sich die Schtend der Augschpurgerischen Confession bevorbehalten, das, ob sie glaich fortfaren, so sole doch nix geschlossen oder verabschied werden, es saie dan zuvor ier Begern erlediget, welliches mir dan nit alain zu schaffen wierd machen, sonder zum beschwerlichisten fürfallet, werden auch dardurch alle Sachen in ain große Verlengerung und Beschwär geraten, do sie änderst darauf verharren sollen.«
Selbst in der nächsten Umgebung des Kaisers herrschte die Auffassung, daß man in der Frage der Deklaration Kaiser Ferdinands »etwas tun« müsse, und auch Kardinal Morone rechnete damit, daß die Bestätigung dieser Urkunde sich nicht werde vermeiden lassen, die übrigens, wie er tröstend sagte, nicht so viel zu bedeuten habe. Aber da war es wieder der sächsische Kurfürst August, der im kritischen Augenblick der katholischen Sache Waffenhilfe leistete.
August hatte dem Bayernherzog, der ihn im Namen des Kaisers in Dresden aufsuchte, um ihn zum persönlichen Erscheinen in Regensburg und zur Unterstützung der kaiserlichen Wünsche zu bewegen, die beruhigende Versicherung gegeben, daß er seinen Räten auftragen werde, sich in der Angelegenheit der Deklaration »aller Bescheidenheit nach« zu verhalten und die anderen Reichsobliegenheiten »nicht stecken zu lassen«. Maximilian verstand und atmete auf. Der Herzog habe, schreibt er am 31. Juli seinem bayerischen Schwager, »ein guetes Werk gethon und wolt Gott, man khunte dise Ding dahin bringen und verschieben, wie der Curfurscht vermainet; wäre auch das beßte Mittl, wie ich dan an mainem aißeristen Flais nix will erwinden lassen. Es ist auch ain unnotwendiger Schtreit, dan man sich billich und wol an dem Religionsfrid beniegen khan und mag, bringt auch in allen anderen Sachen nit geringe Verhinderung, wir grain (en) und zanken umb die Religion, derwail nemen die Tirkhen aines nach dem anderen ain, und da wier nit änderst an wollen, so wiert er Frid nemen mit unserm aißeristen Verderben.«

Maximilian II.
Durch den »Verrat« des sächsischen Kurfürsten, der die Verknüpfung der Religionsfrage mit der Kontributionssache ablehnte, war das Schicksal der Türkensteuer, die Maximilian so sehr am Herzen lag, so gut wie entschieden. Noch rafften sich die Protestanten zu einer Petition auf, die an Stelle des erkrankten Kaisers am 9. September seinem Obersthofmeister Trautson übergeben wurde. Aber sie hatte, obzwar Maximilian für ein gewisses Entgegenkommen geneigt schien, angesichts des entschlossenen Widerstandes der katholischen Partei keinen Erfolg. Es kam auch noch bei den Verhandlungen zu scharfen Auseinandersetzungen, in erster Linie mit dem Pfälzer, der die Ansicht vertrat, daß der Friede mit dem Sultan weniger durch die Angriffslust der Osmanen, als vielmehr durch das Verlangen Maximilians, die Haus macht zu erweitern und die kaiserliche Gewalt im Reiche zu verstärken, bedroht sei. Aber der Kaiser bekam schließlich die viel umstrittene Türkenhilfe in einer namhaften Höhe bewilligt: die hier zur Sicherung der Grenzen beschlossene Reichsbeihilfe war größer, als die 1566 für den offenen Türkenkrieg zugestandene Unterstützung.
In der polnischen Angelegenheit, die den Ständen am 28. Juli vorgelegt wurde, machte sich bei Kaiser Maximilian wiederum ein bedenkliches Schwanken bemerkbar. Die einen redeten ihm zu, die Krone anzunehmen, die anderen winkten ihm ab. Die vornehmsten Räte wie Weber und Trautson waren dagegen, ebenso der Feldoberst Lazarus von Schwendi, der, wie der sächsische Gesandte am 21. August berichtet, »unverhohlen« die Meinung vertrat, »do Ire Majestät sich zu solchem Kriegswesen vermügen lassen, so sein sie verdorben und setzen sich, die Erbländer und das ganze Reich in Gefahr«. Und die Stände des Reiches bekundeten im allgemeinen keine größere Lust dazu. Allen voran der Pfälzer, der unbedingt dafür war, daß der Kaiser auf Polen verzichte. Aber selbst jene Fürsten, die ihm bereits ihre Hilfe zugesagt hatten, rieten jetzt von einem bewaffneten Vorgehen ab. Im Kurfürstenrat sprach sich nur Köln für den Krieg aus, und ähnlich war es im Fürstenrat. Die überwältigende Mehrheit wollte von einem solchen nichts wissen. Die mit der polnischen Frage im Zusammenhang stehende, vom Legaten wieder betriebene Angelegenheit der Türkenliga kam überhaupt nicht in Behandlung.
Indes sollte der Kaiser, der noch immer nicht den Gedanken eines bewaffneten Vorgehens fallengelassen hatte, gar bald aus dem schmerzlichen Dilemma befreit werden. Das Befinden Maximilians, der schon schwer leidend nach Regensburg gekommen war, verschlimmerte sich während der Verhandlungen der Reichsversammlung in bedenklicher Weise. Zu den damit unvermeidlichen Aufregungen gesellten sich die bei dem Kaiser üblichen Diätfehler. Am 7. August trank er bei der Tafel in Eis gekühlten Wein und erlitt darauf einen Ohnmachtsanfall. Vierzehn Tage später, am 20. August, stellte sich nach reichlichem Genuß von Pfirsichen und Kirschen Erbrechen ein. »Seitdem«, so erzählt sein Leibarzt Crato, »bemerkte ich, daß es mit seinem Wohlbefinden zu Ende war«. Am 29. August hatte er einen Anfall von Nierenkolik, heftiges Erbrechen und eine Attacke seines alten Herzleidens. Zwei Tage darauf traten die Ärzte zu einem Konsilium zusammen, wobei sie sich wie gewöhnlich in die Haare gerieten. Man verordnete ihm Aloe, doch erwies sich die Dosis als zu klein und man mußte mehr geben, wie Andreas Camutius, der das gleich geraten, triumphierend vermerkte.
Zuviel Vertrauen muß übrigens Maximilian nicht in die Kunst der ihn behandelnden Ärzte gesetzt haben; denn es wurde nach seinem alten Leibarzt Julius Alexandrinus, der seit mehreren Jahren in Trient lebte, gesendet. In der Zwischenzeit aber nahm der Kaiser seine Zuflucht zu einer Kurpfuscherin aus Ulm, namens Streicher, die übrigens ihre Quacksalberkünste noch ausüben durfte, als Doktor Alexandrinus bereits in Regensburg eingetroffen war. Am 5. Oktober erfuhr die Krankheit eine so bedenkliche Wendung, daß man König Rudolf durch einen Eilboten aus Prag herbeiholte. Die Kaiserin aber sandte heimlich nach der Herzogin Anna von Bayern, der Schwester ihres Gemahls. Als diese am Abend des 7. Oktober in Regensburg einlangte, war im Befinden des Kaisers wieder eine Besserung eingetreten, die den Angehörigen von neuem Hoffnungen einflößte. Aber schon vier Tage später setzte ein rascher Kräfteverfall ein, der den Eintritt der Katastrophe stündlich befürchten ließ. Am Morgen des 12. Oktober wurde Crato zum Kaiser gerufen, der ihm die Hand reichte mit den Worten: »Crato, mit dem Puls ist's aus.«
Inzwischen hatte Maximilians Umgebung angefangen, sich um sein Seelenheil zu bekümmern. Der spanische Gesandte Graf Monteagudo, nunmehr Marquis von Almazan, verfügte sich zur Kaiserin und beschwor sie, noch einmal ihren ganzen Einfluß aufzubieten, um ihren Gemahl zum Empfang der Sterbesakramente zu bewegen. Maria ging darauf – es war am 6. Oktober – zu Maximilian, warf sich auf die Knie und bat ihn unter Tränen, die Gebete seiner Untertanen durch die Berufung eines Dieners der katholischen Kirche zu unterstützen, wobei sie auf seinen Hofprediger hinwies. Der Kaiser erwiderte kurz: »Sein Prediger sei im Himmel.« Maria wiederholte ihre Bitte, indem sie bemerkte: Der himmlische Prediger habe zur Pflege des Seelenheiles seine irdischen Diener bestellt. Doch Maximilian wehrte sie mit den Worten ab: »Es sei schon gut, er werde darüber nachdenken.« Und nicht besser erging es dem päpstlichen Kardinallegaten Morone, der unmittelbar nach Maria dem Kaiser zusprach. Dieser bedankte sich mit freundlichen Worten für seinen Eifer und versprach ihm schließlich, seine Worte in »reifliche Erwägung ziehen« zu wollen.
Vier Tage darauf, am 10. Oktober, versuchte die Herzogin Anna bei ihrem Bruder ihr Glück, doch ebenfalls umsonst. Nun trat der Marquis selber auf den Plan. Die an ihn gerichtete Bemerkung des Kaisers, sein Zustand werde anscheinend immer schlimmer, bot ihm das gewünschte Stichwort zum Eingreifen. »So, Eure Majestät,« bemerkte er nicht sehr taktvoll, »sehe ich auch Ihren Zustand, weshalb ich meine, es wäre Zeit …« Aber der Kaiser ließ ihn gar nicht ausreden; liebenswürdig winkte er mit den Worten ab: »Schon gut, Herr Marquis, ich habe nachts nicht geschlafen und wünsche ein wenig zu ruhen.« Der Spanier hätte sich indes auch jetzt noch nicht entfernt, wäre er nicht von der Umgebung des sterbenden Kaisers dazu gedrängt worden.
Kurz vor Eintritt des Todes, am frühen Morgen des 12. Oktober, versuchte die Herzogin Anna nochmals, ihren Bruder zum Empfang der Sterbesakramente zu bereden. Es war wieder vergebens – Maximilian hatte darauf nur die Worte: »Er ergebe sich in den Willen Gottes und sei sich bewußt, seine Pflicht gegen den Schöpfer erfüllt zu haben.« Die Herzogin ließ sich jedoch in ihrem Bekehrungseifer nicht beirren. Sie fragte, ob sie seinen Hofkaplan, den Bischof Lambert Gruter, rufen dürfe. Die Antwort war »Nein«. Trotzdem ließ ihn Dietrichstein holen. Der Kaiser gab seinen Unwillen über diese wider seinen Willen erfolgte Berufung dadurch zu erkennen, daß er den eintretenden Seelsorger fragte: »Weswegen sind Sie gekommen?« »Ich weiß sehr wohl,« fügte er hinzu, »daß ich sterbe, und habe mich gänzlich dem Willen Gottes ergeben.« Der Bischof erwiderte: »Er sei gekommen, seine Beichte abzunehmen und ihm das Abendmahl zu reichen.« Darauf der Kaiser, den erlöschenden Puls fühlend: »Wohlan, ich bin bereit … meine glückliche Stunde ist gekommen.« Der Bischof, unsicher geworden, fragte nun, ob er sich in den Willen des Herrn ergebe. Der Kaiser bejahte dies, ebenso die anderen Fragen, ob er bereue, Gott beleidigt zu haben, und ob er wünsche, daß ihm seine Sünden vergeben würden. Als der Bischof dann an ihn die verfängliche Frage richtete: »Glauben Eure Majestät dasjenige und halten Sie es für wahr, was unsere Heilige Mutter, die Kirche, glaubt und für wahr hält und was sie seit den Zeiten der Apostel bis auf unsere Tage lehrt?« antwortete Maximilian: »Ja, ich glaube.« Seine letzte Frage, ob er in diesem Glauben zu sterben wünsche, bejahte er, indem er hinzusetzte: »Er hoffe, Gott werde ihn bald von seinen Leiden befreien und ihn zu sich nehmen.«
So schilderte der Marquis von Almazan den Hergang. Doch muß dazu bemerkt werden, daß er das Gespräch des Kaisers mit seinem Hofkaplan schwerlich selbst gehört haben konnte, da man dem »zudringlichen Patron« den Eintritt ins Sterbezimmer verwehrt hatte. Den Worten des Kaisers, die sich als ein Bekenntnis zum römisch-katholischen Glauben auslegen lassen, ist also – abgesehen davon, daß er sich vielleicht nur durch sein »Ja, ich glaube«, Ruhe verschaffen wollte, und auch angenommen werden kann, daß er bereits halb in der Agonie lag – keine zu große Bedeutung beizulegen. Wir besitzen nämlich über Maximilians Tod noch zwei andere Berichte, wovon der eine Dietrichstein, sicher eine zuverlässigere Quelle, zum Verfasser hat. Nach dessen Zeugnis erwiderte der Kaiser auf des Bischofs Mahnung zur Versöhnung mit Gott: »Ich hab' es schon getan«, worauf dieser dann nur noch die Frage stellte, ob er seine Sünden bereue, welche Frage von Maximilian bejaht wurde.
Nach dem dritten uns vorliegenden anonymen Bericht eines anscheinend sehr gut Eingeweihten drehte sich der Kaiser beim Eintritt des Bischofs auf die andere Seite und äußerte sich zu einem Kammerherrn: »Das hab' ich nicht begehrt.« Als ihn der Kirchenfürst trotzdem zur Buße und Demut vor Gott und zum Glauben an Christi Opfer, Leiden und Sterben ermahnte, erklärte Maximilian ausweichend: »Ich habe es nie anders gewüßt noch geglaubt.« Auf Gruters fernere Frage, ob er als frommer Christ sterben wolle, bemerkte er nur: »Ja, wie anders!« Und als dann der Bischof weiter auf ihn einsprach, mahnte Maximilian: »Nicht so laut!«
Von einem römisch-katholischen Glaubensbekenntnis findet sich also in diesen zwei zuletzt erwähnten Berichten wirklich kein Sterbenswörtlein. Daß übrigens der Marquis von dem Erfolg der letzten Bekehrungsversuche nicht sehr befriedigt war, beweist die unmutsvolle Äußerung in seinem an des Königs Staatssekretär gerichteten Schreiben: »Der Unglückliche ist gestorben, wie er gelebt hatte.« Wie zur Entschuldigung fügt er bei, daß weder ihn noch die Kaiserin, weder die bayerische Herzogin noch Dietrichstein ein Vorwurf treffen könne, denn sie hätten bis zum letzten Augenblick alles getan, was menschenmöglich war, um ihrer Aufgabe zu entsprechen. »Was meine Person betrifft,« so heißt es weiter, »werde ich es jederzeit als das größte Unglück meines Lebens betrachten, von dem König, unserem Herrn, zum Teilnehmer an diesem betrübenden Schauspiele erwählt worden zu sein und den Zweck meiner Wünsche und meines Hierseins nicht erreicht zu haben.«
Der Marquis gestand also – ein schönes Schulbeispiel für die Kritik von Gesandtschaftsberichten! – dem Staatssekretär, in camera caritatis, den vollständigen Mißerfolg seiner seelenärztlichen Bemühungen ein, während er dem König selbst, um ihm nichts Unangenehmes zu sagen und seine Verdienste als Botschafter herauszustreichen, die Wahrheit vorenthielt. Ganz ähnlich verhielt sich die Herzogin Anna, die der aus der Messe heimkehrenden Kaiserin die freudige Mitteilung machte, ihr Gemahl sei katholisch gestorben, während sie ihrem Gatten den Verlauf ganz anders schilderte. »Im Vertrauen sollst Du wissen,« schreibt Albrecht dem sächsischen Kurfürsten, »daß Ihre Majestät, wie ich von meiner Gemahlin verstehe, sich in ihrem letzten Ende gehalten, wie im Leben zuvor, also daß niemand eigentlich wissen möge, ob Ihre Majestät katholisch oder konfessionistisch sei, hat sich auch weder auf die eine, noch die andere Meinung erklärt, sondern ist ohne ein wenig Redens verschieden.« Der Kaiser hatte also auch in der Todesstunde gezeigt, daß er sich trotz seiner »Bekehrung« mit der römisch-katholischen Kirche innerlich nicht ausgesöhnt hatte.
Der Kaiser hauchte seine Seele aus, gerade als die Stände auf dem Rathause die Verlesung des Reichsabschiedes vornahmen, just in dem Augenblick, wie man sich später erzählte, als die Jahre seiner Regierung in der Schlußformel verkündet wurden. Die Nachricht von seinem Hinscheiden rief überall im Reiche wie in den Erblanden aufrichtige Trauer hervor. Namentlich die Protestanten beklagten seinen Tod, wenn er auch in der letzten Zeit sich weniger entgegenkommend gezeigt hatte. Auf die Kunde von seiner schweren Erkrankung schrieb der Landgraf Wilhelm von Hessen: »Mit maßlosem Schmerz habe er vernommen, daß der fromme Kaiser so hart schwach« sei, »sintemal das Reich und die ganze Christenheit an ihm nicht nur einen vernünftigen Herrn, sondern auch einen treuen Vater verlieren würden.«
Auch im katholischen Lager zeigte man sich über den Verlust des liebenswürdigen Herrschers betrübt. Er wisse nicht, schreibt unter dem Eindruck der Todesnachricht der Mainzer Erzbischof Daniel an Wilhelm von Hessen, »ob ich an Kaiser Ferdinando und Maximiliano (mehr) ein Vatter und Bruder als ein Kaiser und Herrn verloren habe«. Und zu dem Gefühl der Trauer kam das der Sorge – denn der Thronfolger Rudolf, der jetzt vierundzwanzig Jahre zählte, machte nicht den Eindruck, daß er der schwierigen Lage, die Maximilian hinterlassen, gewachsen sei. »Wir haben einen jungen unansehnlichen König«, fügte vielsagend der braunschweigische Kanzler Mutzeltin seinem Bericht über den Tod des Kaisers hinzu. Rudolf sei »unfähig, die so schwere Last der Regierung zu tragen«, urteilte der Nuntius Delfino, und zur selben Zeit, am 18. Oktober 1576, schreibt Hubert Languet, der Gesandte, dem Kurfürsten August aus Regensburg sorgenerfüllt: »Viele fangen an zu fürchten, daß große Änderungen in der Religion bevorstehen, nicht allein in Österreich, Ungarn und Böhmen, sondern auch im Reich.«