
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Der verstorbene Kaiser hatte nach langwierigen Verhandlungen im Jahre 1562 mit den Türken auf Grund des augenblicklichen Besitzstandes einen achtjährigen Frieden geschlossen. Sehr glücklich war er gerade nicht, weil Ferdinand die schimpfliche Verpflichtung übernahm, jährlich an die Hohe Pforte ein sogenanntes »Ehrengeschenk« von dreißigtausend Dukaten – ein milderer Ausdruck für Tribut – zu senden. Die Lage in Ungarn war nun die, daß der ganze mittlere Teil des Königreiches rechts und links von der Donau bis aufwärts über Gran in der Gewalt der Türken sich befand, in Ofen ein türkischer Pascha waltete und in Siebenbürgen der Sohn des verstorbenen Gegenkönigs Johann Zápolya, Johann Siegmund, regierte, der unter der Botmäßigkeit und dem Schutze des »großmächtigen« Sultans stand und jederzeit bereit war, seine Herrschaft auf Kosten des Kaiser Ferdinand verbliebenen Restes von Ungarn auszudehnen.
Um diesen unruhigen Nachbar, der sich noch immer »König« nannte, zu gewinnen, waren auch mit ihm noch zu Ferdinands Lebzeiten Verhandlungen eingeleitet worden. Man hatte am Wiener Hofe dabei das größte Entgegenkommen gezeigt, dem als roher Trunkenbold bekannten Fürsten sogar die Hand der Erzherzogin Johanna, um die auch Herzog Cosimo von Florenz für seinen Sohn Francesco anhielt, mit reicher Mitgift versprochen. Doch war das Übereinkommen noch nicht abgeschlossen, als der Kaiser starb. Der Fürst hatte auf die Nachricht von der Thronbesteigung Maximilians nichts Eiligeres zu tun, als den Frieden zu brechen. Im September 1564 überfielen seine Truppen die an der Nordgrenze gelegene Festung Szatmár und eroberten sie, um sodann auch Nagy-Bánya einzunehmen.
Dem neuen Kaiser blieb nichts anderes übrig, als nun auch seinerseits zu den Waffen zu greifen. Die Kaiserlichen in der Stärke von siebentausend Mann unter Führung des Feldobersten Lazarus von Schwendi gewannen im Februar 1565 die beiden Bollwerke zurück und eroberten ihrerseits die Festungen Tokay und Szerencs. Bald standen sie drohend an der Grenze von Siebenbürgen. In dieser Bedrängnis ließ Johann Siegmund Unterhandlungen eröffnen. Er versprach, den Titel eines Königs von Ungarn, welche Frage bisher den Hauptstreitpunkt gebildet hatte, abzulegen und Maximilian den Eid der Treue zu leisten. Dafür verlangte er die ihm bereits versprochene Erzherzogin zur Gemahlin und die Garantie seines Besitztums auf Lebenszeit, außerdem die Zurückstellung der im letzten Feldzug von der kaiserlichen Armee eroberten Festung Tokay. Der Kaiser lehnte die Herausgabe ab und begehrte seinerseits die Abtretung von Munkács und Huszt. Auf dieser Grundlage wurde sodann ein Vertrag vereinbart. Als es jedoch zum Abschluß kommen sollte, stellte der Fürst, im Vertrauen auf die Unterstützung der Pforte, neue Forderungen. Im Juni wurden die Verhandlungen abgebrochen – wiederum sollten die Waffen sprechen.
Der Kaiser mußte sich jetzt, da auch der Krieg mit den Türken in drohende Nähe gerückt war, an die Stände der Erblande und des Reiches um eine Geldhilfe wenden, und dies war nun wieder der Moment, die Religionsfrage, die nach Kaiser Ferdinands Tode steckengeblieben war, aufzurollen. Nach der Ideologie, die sich die erbländischen Stände seit mehr als einem Menschenalter zurechtgelegt hatten, war es nur natürlich, daß sie in dem Wiederausbruch des Türkenkrieges den »Zorn Gottes« ob der Verhinderung des göttlichen Wortes sahen. Naheliegend war es ferner, daß sie dem neuen Landesfürsten die protestantenfreundliche Haltung, die er als Kronprinz gezeigt hatte, vor Augen rückten.
Die niederösterreichischen Stände überreichten in dem im Dezember 1564 zu Wien abgehaltenen Landtag als Antwort auf die Forderung einer Türkenhilfe – es war nach dem Überfall der Festung Szatmár – eine Religionsschrift, worin sie an ihre früheren, mehr als vierzig Jahre zurückreichenden Petitionen und nicht zuletzt an die ihnen vom verstorbenen Kaiser gegebene Zusicherung einer alle strittigen Religionspunkte beseitigenden »christlichen Vergleichung« erinnerten. Von der Bewilligung des Laienkelches, erklärten sie, hätten sie nicht viel gewonnen, weil sie nur im Wiener Bistum publiziert sei und so gehandhabt werde, daß es viele fromme, christliche Menschen vorzögen, das Abendmahl überhaupt nicht zu nehmen. Da der jetzige Kaiser aus Anlaß ihrer vorigen Bittschriften jederzeit sich erboten habe, in der Religionssache ein »gnädiger, guter Befürderer« zu sein, möge er sie, die der Mehrzahl nach schon von Jugend an der neuen Lehre angehörten und sich keiner der fremden Sekten, wie der Wiedertäufer, Zwinglianer und Kalvinisten teilhaftig machten, bei der »reinen und wahren Religion der Augsburger Konfession durch frei offene Kirchen« in allen Stücken bleiben lassen, gegen ihre Prediger nichts Beschwerliches, weder durch »widerwärtige Examination noch andere unziemliche Verfolgung« seitens der geistlichen Behörden vornehmen, alle Zeremonien und Mißbräuche, die ihrer Konfession zuwiderliefen, bei Spendung des Abendmahles gänzlich abstellen, das Wort Gottes öffentlich, lauter und klar nach der Heiligen Schrift verkünden und die Sakramente überall »in bekannter – das heißt deutscher – Sprache« austeilen lassen. Denn die Stände wären überzeugt, daß ihre Lehre die »wahrhaftig rechte, katholische, apostolische, und gar keine sophistische Religion, welche aus keinem Irrtum, Leichtfertigkeit, Fürwitz oder von mutwilliger Freiheit und aus einem bösen Affekt herfließt, sondern ihren Grund nach Gottes Ordnung, Willen und Befehl hat«, darstelle.
Kaiser Maximilian antwortete darauf ebenso gnädig wie ausweichend: Er werde das von seinem Vater eingeleitete Werk der Religionsvergleichung nach allen seinen Kräften fördern, damit die Religion »in einen guten, gottseligen, einhelligen Verstand gebracht und also männiglich in diesem Erzherzogtum nebeneinander friedlich und ruhig deshalb wohnen mag«. Insonderheit werde er dafür sorgen, daß ihre Seelsorger, woferne sie sich in ihrem Predigen, Lehren und Leben »dem heiligen Wort Gottes und ihrem ordentlichen Berufe gemäß« erzeigten, von niemandem wider Gebühr und Billigkeit beschwert würden. Diese Erklärung des Kaisers, die zu den Wünschen der Stände weder ja noch nein sagte, war, wie der Vizekanzler Zasius am 23. Dezember seinem bayerischen Gönner versichern konnte, ganz auf den Ton der Landtagsresolutionen Kaiser Ferdinands gestimmt.
Als der nächste Landtag Ende Juni 1565 in Wien zusammentrat, stand er bereits unter dem frischen Eindruck des unmittelbar bevorstehenden Türkenkrieges. Diesmal traten die Stände schon etwas schärfer auf. Unter Hinweis auf die Vorladungen und Examinationen ihrer Prediger, die trotz des vom Kaiser gegebenen Wortes stattgefunden hatten, verlangten sie, man möge ihnen »endlich« einen »klaren« Bescheid geben, daß sie samt ihren Angehörigen und Untertanen die Augsburger Konfession unbeschränkt und ungehindert »durch offene Kirchen in allen Stücken frei und sicher« ausüben dürften. Sie begehrten wiederum die Abschaffung aller ihrem Bekenntnis zuwiderlaufenden Mißbräuche und die Anerkennung ihrer Prediger, aber dann auch etwas Neues: die Anstellung eines evangelischen Landhauspredigers in der Stadt für den Fall, daß ein Ständemitglied während des Landtages »in Todesnöten oder sonst« eines Seelsorgers bedürfe; denn der Mangel eines solchen wäre die Ursache, daß viele Landleute einen »Abscheu« vor dem Besuch der Ständeversammlungen trügen. Und sie beriefen sich darauf, daß solche Landschaftsprediger in anderen Ländern – sie meinten die Steiermark – bereits bestünden.
Die Antwort des Kaisers auf diese Petition der Stände lautete so nichtssagend wie jene auf die frühere Vorstellung, nur weniger gnädig. Er sagte ihnen zunächst, daß ihm die letzte Supplik mit ihren »zu viel geschärften, weitläufigen, mehrfältig unnötigen, das Ziel der Bescheidenheit ziemlich überschreitenden« Ausführungen unerwartet gekommen sei, und erinnerte sie etwas unsanft an den Augsburger Religionsfrieden, der den Untertanen nicht die Wahl ihrer Religion einräume. Die Stände mögen die »schieriste« Vollendung des christlichen Einigungswerkes »mit bescheidener Geduld« abwarten und ihn mit »dergleichen heftigen Anspielungen und allerlei gehässigen Worten« billigerweise verschonen.
Diese den Ständen in Aussicht gestellte »schieriste« Vollendung des christlichen Einigungswerkes wollte jedoch nicht kommen. Der Kaiser hatte sich auf das lebhafteste bemüht, in Rom auch die Bewilligung der Priesterehe durchzusetzen, von der er sich, wie er dem Heiligen Vater persönlich am 28. November 1564 schrieb, eine für den Klerus heilsame Wirkung erwartete. Gesandte und Nuntien wurden abwechselnd in Bewegung gesetzt, aber es stellte sich heraus, daß dem Papst, der wohl für seine Person »inkliniert« schien, auch in diesem Punkte dem Wunsche des Kaisers entgegenzukommen, von anderer Seite, namentlich von König Philipp II., entgegengearbeitet wurde. Will man in Rom, so schreibt am 21. September 1565 der Kaiser seinem Madrider Gesandten drohend, die Priesterehe nicht bewilligen, so werde er gezwungen sein, sie einfach zu konnivieren, und es sei zu erwägen, was besser für den Papst sei, »ob es mit seinem Willen oder gegen seinen Willen et cum confusione angestellt werde«.
Die Verhandlungen waren noch nicht abgeschlossen, als der schon längere Zeit leidende Papst am 9. Dezember sein erfolgreiches Pontifikat beschloß. Am Kaiserhofe vernahm man das Hinscheiden dieses von einem versöhnlichen, staatsmännischen Geist erfüllten Kirchenfürsten, wie Zasius am 6. Januar 1566 dem Kurfürsten August schreibt, »nicht gern«, weil er »under vielen seinen undichtigen Vorfahren vast der best und khains bösen Gemuets gegen den Teutschen, auch zur Besserung des Religionshandls nicht übell geweßt, darinn auch gewüß etwas Nutzlichs wurde gewürkt haben, wo sein seuberlich Capittl oder Collegium, der sacrosanctus purpureus coetus, ine daran nicht mit Gewalt verhindert hette«. Zum Unterschiede von seinem »unsinnigen« Vorgänger, dem »bestialischen« Paul IV., habe sich der Verstorbene dem Kaiser Ferdinand wie seinem Sohne gegenüber »wohl erzaigt«, mit der Gestattung der Kommunion sub utraque sich »ziemlich tractabilem« erwiesen, und er würde auch wohl die Priesterehe zugestanden haben; »er ist aber durch die vorgemelte Schaar der roten Huett daran verhindert worden«. Und nicht zuletzt habe Papst Pius IV. zur Expedition gegen die Türken fünfzigtausend Kronen freiwillig gespendet und bar auszahlen lassen.

Maximilian II.
Der Kaiser setzte sich nach dem Einlangen der Todesnachricht sofort mit dem Herzog Cosimo von Florenz in Verbindung, um gemeinsam für die Wahl eines »friedlichen« Papstes zu arbeiten. Unter den von Maximilian unterstützten Kandidaten befand sich auch Giovanni Ricci, der wohl, wie der kaiserliche Gesandte Graf Arco meldete, uneheliche Kinder hatte, »aber darin hätten andere auch gefehlt«. Der Kardinal Morone, für den sich im Namen des Kaisers Kardinal Delfino einsetzte, weil man sich von ihm die Gewährung der Priesterehe erwartete, hatte sich einst – auch dies ist bezeichnend – einem Verhör vor der Inquisition unterziehen müssen, weil er im Verdacht irrigen Glaubens stand. Indes wurde am 7. Januar 1566 »ganz unerwartet« Kardinal Alessandrino, der Dominikaner und Kommissär der Inquisition, Michele Ghislieri, zum Papst gewählt.
Der »Bruder Holzschuh«, wie man den neuen Papst Pius V. nannte, war ein unduldsamer Eiferer, mit dem »noch einmal das Mittelalter den Thron besteigen sollte«. Wie weltfremd dieser kirchliche Zelot war, davon wußte der kaiserliche Agent Nikolaus Cusano in seinem Bericht aus Rom vom 19. Januar einen hübschen Beleg beizubringen. Ein Artilleriehauptmann des Kirchenstaates, so erzählt er, suchte beim neuen Papst um die Bestätigung an. Der Heilige Vater fragte ihn darauf, ob er Theologie studiert habe, und als der Kriegsmann dies verneinte, erklärte Pius V.: Dann könne er auch kein guter Soldat sein, weil des Papstes Waffen die heiligen Schriften seien, mit welchen er den Kirchenstaat schützen und den Fürsten, die ihn beleidigten, Krieg machen werde.
Kaiser Maximilian war von dem Ausgang des Konklaves recht wenig erbaut. Als ihm am 15. Januar in München die Kunde von der Wahl des Bettelmönches überbracht wurde, fing er, wie der päpstliche Nuntius Commendone berichtet, zu lachen und zu spötteln an, und der Vizekanzler Zasius machte seiner Umgebung kein Hehl daraus, daß sein kaiserlicher Herr recht unzufrieden sei. Zu Commendone äußerte sich der Kaiser kühl und höflich: Er hoffe, daß Pius V. ein guter Papst sein werde, da nach einem solchen ein dringendes Bedürfnis sei. Dem Herzog Cosimo schreibt er etwas ironisch: Er bitte Gott, daß der neue Tiaraträger mit den ihm zugeschriebenen Eigenschaften der Frömmigkeit und Tugendhaftigkeit seine ganze Sorge auf die Beseitigung der kirchlichen Mißstände, auf die Einigkeit und Einheit der Kirche und auf die Bewahrung des öffentlichen Friedens richten werde. Umgekehrt zeigte sich König Philipp von Spanien über die Thronbesteigung des kirchlichen Fanatikers hochbefriedigt. Er äußerte sich ganz entzückt, daß man in der gegenwärtigen Zeit einen solchen Pontifex brauche.
Der Kaiser befand sich gerade auf dem Wege nach Augsburg, um dort die erste Reichsversammlung zu eröffnen, die für den 14. Januar ausgeschrieben worden war. Ihr hatten beide Parteien, Katholiken wie Protestanten, mit größter Spannung entgegengesehen, und sie steigerte sich noch, als der Termin für ihren Zusammentritt immer aufs neue hinausgeschoben wurde. Den Hauptgrund der Verzögerung bildete der Ausbruch des Türkenkrieges, der eine längere Abwesenheit des Kaisers von der Residenzstadt untunlich erscheinen ließ. Und insofern kamen die ungarischen Wirren der römisch-spanischen Partei gar nicht so unerwünscht – denn auf dem Reichstage sollte auch, und nicht zuletzt, die »christliche Vergleichung«, die den Kaiser nach wie vor angelegentlichst beschäftigte, verhandelt werden. Diese Erörterung des kirchlichen Ausgleichs aber mußte um jeden Preis verhindert werden; denn der bloße Versuch, ihn in Angriff zu nehmen, erschien in Rom als eine Blasphemie: Der Heilige Vater hatte auf dem Trienter Konzil das letzte Wort gesprochen, es gab kein Paktieren der katholischen Welt mehr mit den von der kirchlichen Lehre Abgefallenen. Der Gedanke, daß eine weltliche Versammlung über die Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche verhandeln sollte, verursachte in dem mönchisch gesinnten Papst ein wahres Entsetzen.
Allen Gegenbemühungen zum Trotz hatte indes Kaiser Maximilian in seinem Einberufungsschreiben vom 12. Oktober 1565 den Religionspunkt, die Frage, wie die christliche Religion »zu richtigem Verstand zu bringen« sei, auf die Tagesordnung gesetzt, desgleichen den anderen Gegenstand, der damit im innigsten Zusammenhange stand und ihm nicht weniger am Herzen lag, die Frage nämlich, wie den »einreißenden, verführerischen« Sekten vorgebeugt werden könne.
Niemand wußte besser, worauf diese Kampfansage gegen die Sekten zielte, als der Kurfürst Friedrich von der Pfalz, der sich nach der innersten Überzeugung des Kaisers und seiner Räte durch den offenen Übertritt zum Kalvinismus außerhalb des Augsburger Religionsfriedens gestellt hatte. Aber eben darum tat der energische, glaubensstarke Fürst alles, um dem Angriff zuvorzukommen. Der entzweite Protestantismus sollte in geschlossener Phalanx der »Abgötterei« des Papsttums, von dem als der »Grundsuppe und Pfuhl« aller Sekten die Spaltung herrühre, entgegentreten. Solange in Deutschland, meinte er, dieses Papsttum bestehe, hätten alle Sekten das Recht, auch für sich Anerkennung und Duldung zu verlangen. Die protestantischen Stände, die ungeachtet aller »Nebendisputationen« ihrer Theologen doch in der Grundlage der Lehre vollkommen einig seien, müßten fest zusammenhalten, den Kaiser, der auf dem Frankfurter Wahltage sich gegen die evangelischen Fürsten so christlich und tröstlich, der wahren Religion »affectioniert« ausgesprochen habe, stärken und auf die Freistellung der Religion, auf die Beseitigung des geistlichen Vorbehaltes, dringen. Nur auf diesem Wege, nicht aber durch Verhandlungen mit den Katholiken, die zu keinem Resultate führen würden, wäre die »gottselige Concordia« zu erzielen.
Aber auch die katholischen Stände waren bereits gewappnet auf dem Kampfplatz erschienen. Noch ehe die Reichsversammlung ausgeschrieben war, hatten sie durch eine Gesandtschaft dem Kaiser in einem sehr geharnischten, resoluten Ton erklärt, daß sie durchaus nicht gesonnen seien, in eine Veränderung des Religionsfriedens zu willigen, und daher einen Antrag auf Beseitigung des geistlichen Vorbehaltes zurückweisen würden.
So hatten die feindlichen Parteien ihren Aufmarsch bereits vollzogen, als der Kaiser am 20. Januar in Augsburg erschien und im Hause Fugger auf dem Weinmarkt Quartier nahm. Alles deutete darauf hin, daß sein Verbleiben daselbst ein längeres sein, daß es zu einem erbitterten Kampfe kommen werde. Das Überraschende war diesmal, daß nun auch im katholischen Lager die Kräfte zur Abwehr sich sammelten, und dieser neue Geist, der sich auf dem ersten Reichstag in sehr bestimmter Weise bemerkbar machte, konnte gewiß schon als eine Auswirkung des Trienter Konzils ausgelegt werden. Schon hatte der Jesuitenpater Canisius im Auftrage der römischen Kurie bei den geistlichen Fürstenhöfen am Rhein seine Runde gemacht, um die Ausführung der Konzilsbeschlüsse zu betreiben.
Die wichtigste Aufgabe aber fiel dem Kardinal Giovanni Francesco Commendone zu, den Papst Pius V. als Legaten für den Augsburger Reichstag ausersehen hatte. Dieser geschäftskundige, gebildete und welterfahrene Diplomat hatte im Vereine mit dem Wiener Nuntius Melchior Biglia, der etwas beschränkteren Geistes war, für die Sache Roms zu wirken. Fürs erste sollte mit allen Mitteln verhindert werden, daß auf dem Reichstag über die Religion verhandelt werde. Dem Kaiser mußte er klarmachen, daß es unwürdig und vermessen erscheine, die vom Konzil reiflich erwogenen, durch die Autorität des apostolischen Stuhles bestätigten und alle Frommen bindenden Dekrete neuerlich in Verhandlung zu ziehen. Viel wichtiger wäre es, die Aufmerksamkeit auf die Türkengefahr zu lenken. Statt über Religion zu sprechen und den Riß in der Christenheit zu erweitern, sollte lieber die Aufrichtung einer Liga gegen den Erbfeind erwogen werden. Commendone wurde angewiesen, mit dem Vertreter Spaniens, Thomas Perrenot von Chantonnay, und dem bayerischen Herzog Albrecht in enge Fühlung zu treten. Er sollte weiter die Räte des Kaisers zu gewinnen trachten, ihnen päpstliche Gunsterweisungen in Aussicht stellen und im Verkehr mit den Protestanten darauf sehen, daß er sie weniger abstoße als an sich ziehe; denn die Kirche habe, wie es in seiner ausführlichen Instruktion heißt, »bekehrte Sünder« mehr not als gute Gläubige. In einem besonderen Memoriale wurde dem Legaten ein gesellschaftliches Auftreten, wobei auch nach deutschem Brauche Tafeln zu halten seien, ans Herz gelegt.
Maximilian hatte auf die Kunde von der Absicht des Heiligen Vaters, einen Legaten in der Person Commendones nach Augsburg zu schicken, alles getan, um diese Sendung zu verhindern, hatte indes kein Glück gehabt, weil weder der kaiserliche Gesandte noch der ihm ergebene Kardinal Delfino den Mut fanden, ihren Auftrag auszurichten. Er mag daher nicht sonderlich erfreut gewesen sein, als dieser erprobteste Diplomat der römischen Kurie am 17. Februar am Hoflager auftauchte. Mit ihm kam ein ganzer Stab von jesuitischen Beratern nach Augsburg, wo sich überdies Canisius einfand.
Der Reichstag war, als Commendone in Augsburg eintraf, noch nicht eröffnet, weil die Zahl der Teilnehmer wie gewöhnlich allzu gering war. So hatte also der Legat reichlich Zeit, den Kaiser, der ihn nicht unfreundlich empfangen hatte, im Sinne der römischen Wünsche umzumodeln – und er hatte Erfolg. Sicherlich wurde er weniger dadurch erzielt, daß es den Papst, wie Commendone versicherte, »schmerzte«, sehen zu müssen, wie die Ausgleichsbewegung auch unter den Katholiken so viele Anhänger zähle und Gott sich zur Verteidigung seiner Kirche mehr der Uneinigkeit und bösartigen Gesinnung denn der Eintracht der Altgläubigen bediene, als vielmehr durch die Aussicht, von Papst Pius eine namhafte Unterstützung – es waren 50 000 Dukaten – für den Schutz der Ostgrenzen zu erhalten. Die Türkenhilfe aber lag dem Kaiser ganz besonders am Herzen, und so darf man annehmen, daß die drohenden Nachrichten aus Ungarn, die während der Tagung an Maximilians Ohr drangen, einen Grund mehr bildeten, einen Artikel von der Tagesordnung abzusetzen, der voraussichtlich zu langwierigen Auseinandersetzungen geführt hätte. Nicht zuletzt aber wird das einheitliche, gefestigte Auftreten der Katholiken, das sich in der Reichsversammlung von Anfang an geltend machte, nicht seine Wirkung auf den Kaiser verfehlt haben. Kurz, in der kaiserlichen Proposition vom 23. März, die den Reichsständen bei der Eröffnung der Versammlung – so lange hatte sie sich hinausgezogen – verlesen wurde, fehlte bereits der Hinweis auf den kirchlichen Ausgleich.
Wohl aber erhielt die Reichstagsproposition den anderen Punkt, das Verlangen nach Abstellung der »abscheulichen« Sekten, aufrecht, und es schien, als sollte Maximilians sehnlichster Wunsch nach Ausrottung des »kalvinischen Ungeziefers« in Erfüllung gehen. Denn der Pfälzer besaß unter den Protestanten selbst grimmige Feinde, wie den ränkevollen Pfalzgrafen Wolfgang, der nur auf die Gelegenheit wartete, über den Kurfürsten im Falle seiner Verurteilung und Ächtung herzufallen. Doch rasch verzogen sich die Gewitterwolken, die über dem Haupte des frommen Kurfürsten zusammengeballt standen. In dem Kurfürstenrat erklärte mit Ausnahme des Brandenburgers, der sich heftig gegen die »Sakramentsschwärmer« ausließ, einer nach dem andern, daß in seinem Lande nichts von den eingerissenen Sekten bekannt sei. Alles lief schließlich darauf hinaus, daß die Protestanten tatsächlich die Freistellung verlangten. Da sich aber die Katholiken entschieden weigerten, auf dieses Ansinnen einzugehen, wurde beschlossen, daß jede Partei für sich mit dem Kaiser verhandle. Und ebenso ging es im Fürstenrat. Als dann die protestantischen Stände zu einer Sonderberatung zusammentraten, wußte der pfälzische Kurfürst die Situation für sich dadurch zu retten, daß er erklärte, es könne der Zwist der Theologen auch später, nach Schluß des Reichstages, durch gebührliche Mittel beigelegt werden. Es wurde vereinbart, dem Kaiser den Vorschlag zu machen, die Einigung auf einem Nationalkonzil unter seinem Vorsitz zu behandeln. Die Katholiken hielten es angesichts dieses einmütigen Vorstoßes für geraten, hinter dem Religionsfrieden sich zu verschanzen und auf dessen ungeschmälerter Aufrechterhaltung zu bestehen.
Maximilian mußte erkennen, daß er auf diesem Wege dem Pfälzer nicht beikommen könne. Darum verlegte er den Angriff vom Felde der Theologie auf das rechtliche Gebiet, und hier schien ihm auch der Erfolg zu winken. Der Kurfürst hatte sich nämlich gegen die Stifter Neuhausen und Sinsheim eine Reihe offenkundiger Gewalttätigkeiten zuschulden kommen lassen, die auch, wie die Bilderstürme, auf lutherischer Seite böses Blut machten. Der Kaiser erließ nun im Einvernehmen mit den Ständen am 14. Mai ein scharfes Dekret wider den Pfälzer, das ihm die Beseitigung aller Neuerungen auftrug. Dieses Mandat wurde dem Pfälzer durch den Vizekanzler Zasius vorgelesen, aber der redegewandte Kurfürst verstand es, mit seiner Verteidigungsrede auf die Anwesenden Eindruck zu machen. Er durfte sich in der Tat, wie Zasius erfuhr, seiner »unerschrockenen Tapferkeit«, die er vor dem Kaiser bewiesen, rühmen und die Behauptung wagen, »daß der lebendige Geist Gottes aus ime geret habe«.
Der fromme Friedrich war aber weniger durch seinen christlichen Heroismus, als vielmehr durch die »zweideutige« Haltung des sächsischen Kurfürsten August gerettet worden. Als der Kaiser wenige Tage darauf an die protestantischen Stände die Gewissensfrage stellte, ob sie den Pfälzer als einen Glaubensgenossen, als einen Anhänger der Augsburger Konfession anerkennen könnten, konnte im entscheidenden Augenblick diese schwerwiegende Frage nicht beantwortet werden, weil der angesehenste Fürst im Lager der Protestanten, auf dessen Zustimmung Maximilian in erster Linie gerechnet haben mag, den Reichstag bereits verlassen hatte. Die sächsischen Gesandten aber erklärten jetzt, keinen Auftrag von ihrem kurfürstlichen Herrn erhalten zu haben. Auf einen schon im Vormonat angeregten Ausweg zurückgreifend, machten sie den Vorschlag, des Pfälzers eigentümliche Stellung zum Abendmahl auf einer eigens zu diesem Zwecke zu berufenden Theologenkonferenz zu besprechen. Der vom Monarchen erwartete Ausschluß des Kurfürsten vom Religionsfrieden war so ins Wasser gefallen.
Maximilian schäumte auf. Dem bayerischen Schwager Albrecht V. klagt er am 21. Mai in einem vertraulichen Schreiben, daß ihm des Kurfürsten Rat Doktor Lindemann, welchen der »Teifel hergebracht« hätte, »das ganze Schpil verderbt« habe. Auch August gegenüber beschwerte sich Maximilian drei Tage darauf in einem Handschreiben über das Vorgehen Lindemanns, den er verächtlich einen »Buben in der Haut« nennt, über die protestantischen Stände, die »den Fux nit baißen« wollten, so daß er fürchte, man werde sich »ain Schlang, wie man sagt, in Buesen ziglen«. Indes war es der Kurfürst selber, der den Ausschluß Friedrichs hintertrieben hatte, weshalb er auch Lindemann für dessen »angewandten Fleiß« in der pfälzischen Sache zu loben sich bewogen fand.
Maximilian ließ in harten Worten seinen Zorn auf die Gesandten der protestantischen Fürsten aus. »In summa,« so schreibt er am 24. Mai Herzog Albrecht von Bayern, »es kan sich aner auf dise wanklmietige und unbeschtandige Lait mit nichte verlassen, ja es solt aner ungern fil noch wenig mit inen zu schaffen hawn. Awer es ist gleich recht, das sich dise Sach zuegetragen, dan ich daraus gelernet haw, was Beschtandikat ich mich bai inen versehen khan. Deus det illis mentem meliorem, und ich wolt umb ier confession nit ain Ruebenschnitz gewn, dan dergeschtalt wiert es bald ain Zwinglianismus durchaus werden et maxima confusio. Awer sie saind verblent; transeat cum ceteris erroribus, wie wol es zu grow ist.«
Und er sagte auch den Protestanten selber, wie uns der Nuntius Commendone berichtet, tüchtig seine Meinung. »Niemals hätte ich gedacht,« äußerte er sich erregt, »daß Ihr so charakterlos, so wankelmütig, so arglistig sein könnt; beständig führt Ihr das wahre Wort Gottes im Munde gemäß der Augsburger Konfession, und diese habt Ihr ebensooft nach Eurem Gutdünken umgestellet, so daß es eher eine Konfusion geworden ist, die Euch, wie ich glaube, als Mantel dient, unter dem Ihr alle Sekten und Greuel verbergt. Diese Konfession hat Ähnlichkeit mit einem weiten und durchlöcherten Sack, in den Ihr alle Irrtümer hineinstoßt, die aber darin keinen Halt finden, weil sie durch die Löcher herabfallen; Eure Konfession, der ich mich nie ganz angeschlossen habe, beginnt mir zum großen Ekel zu werden. Wenn irgendeine Neigung zu ihr in mir gewesen wäre, würde sie bereits erloschen sein.«
Schon gab sich Commendone angesichts einer derart gereizten Stimmung des Kaisers dem frohen Glauben hin, es sei damit »der Anfang zu großen Dingen gemacht« worden. Man war überhaupt im katholischen Lager mit des Kaisers Aufführung, die selbstverständlich ängstlich verfolgt wurde, ganz zufrieden. Namentlich der Nuntius Biglia, der jedes Wort Maximilians für bare Münze hielt und seinen Eifer für die katholische Sache nicht genug rühmen konnte, erwies sich dem schlauen Habsburger gegenüber als ein stets dankbarer Zuhörer, wie er denn in seinem Optimismus auch glaubte, den sächsischen Kurfürsten dem »Reich Gottes« wiedergewinnen zu können. Der venezianische Gesandte Micheli dürfte Maximilian richtiger beurteilt haben, wenn er in seinem Schlußberichte meinte, man müsse beim Kaiser sehr wohl zwischen dem »intrinseco« und dem »estrinseco« unterscheiden. Äußerlich gebe er keinen Anlaß zu klagen, er lebe gleich den übrigen Katholiken, besuche die Messe, die Vesper und Predigt, ehre den geistlichen Stand und erweise dem Nuntius allen Respekt. Aber wie es in seinem Innern aussehe – das wisse Gott allein.
Dem Kurfürsten August gegenüber, der während des Reichstages ihn wieder an seine früheren Vertröstungen erinnerte, erklärte der Kaiser: Gott allein wisse, was ihn bisher verhindert habe. Von der Messe, dies möge er ihm glauben, halte er nichts, doch müsse er aus wichtigen Ursachen dabei stehenbleiben. Die Andacht aber wäre also, daß die Päpstlichen ihn für lutherisch, die Lutheraner ihn für papistisch hielten, und wäre er daran »am allerübelsten«. Der Kaiser war nicht einmal mit den Jesuiten, denen er doch gewiß nicht gut gesinnt war, während des Reichstages unfreundlich, wie denn überhaupt hier im gesellschaftlichen Verkehr zwischen den beiden Parteien kein gehässiger Ton herrschte. Der pfälzische Kurfürst verabschiedete sich, als er Augsburg verließ, in geradezu demonstrativ herzlicher Weise von dem päpstlichen Legaten, und der sächsische Kurfürst reiste nach München, um den Herzog Albrecht zu besuchen.
An dem Standpunkte der konfessionellen Parteien änderte sich freilich nichts – nach wie vor standen sie sich unversöhnlich in Kampfesstellung gegenüber. Kaiser Maximilian gab in seiner Schlußresolution vom 25. Mai über die von den beiden Lagern eingebrachten Eingaben der Hoffnung Ausdruck, man werde bei künftigen Religionsverhandlungen »alle Hitz und Hefftigkeit und sonderlich allerhand geschärffte Anziehungen und Worte«, über die sich die Stände der alten Religion in ihrer Gegenschrift beschwerten, beiseite lassen und sich derjenigen »Bescheidenheit und Glimpflichkeit befleißen«, wie dies der Religionsfriede vorschreibe; denn dadurch würden unnötige Weitläufigkeiten und Bitternisse vermieden und desto leichter »die gewünschte heylwertige gemeine Vergleichung dieses hochschädlichen Zwiespalts« gefördert werden. Der Kaiser werde, so heißt es nun weiter, diese hochwichtige Sache einer »gemeinen christlichen Concordia« im Auge behalten und bitte auch die Stände, ihm noch vor Ausgang des Jahres die Mittel und Wege dazu anzuzeigen, damit er sich »mit fernerm gemeinem der Stände Rat und Zutun« desto leichter resolvieren könne. Man sieht: der aus der kaiserlichen Proposition getilgte Ausgleichsgedanke tritt am Schlusse des Reichstages wieder hervor – ein Beweis, daß Maximilian seine Lieblingsidee nur zurückgestellt, aber nicht aufgegeben hatte.

Kurfürst August von Sachsen
Der Kaiser mußte, als er nach heftigen Auseinandersetzungen endlich den Reichstag verabschieden konnte, wiederum erkennen, daß er es mit seiner vermittelnden Haltung keiner der Parteien recht gemacht hatte. Sein bayerischer Schwager Albrecht ließ es sich nicht nehmen, am 26. Mai in einem vertraulichen Schreiben in den Kaiser zu dringen, doch endlich »einmal die Augen Ires Gemuets und Herzens aufzutun« und sich also zu erklären, »damit wir doch nach langem herzlichen Begern ainmal wissen mögen mit gutem Grünt, was wir doch an Eurer Majestät als unsern Herrn und Oberhaubt in causa religionis haben«. Der Kaiser gab als Antwort seiner Verwunderung darüber Ausdruck, daß sich der Herzog und andere »so hoch ergern«, da er doch alles getan habe, was er tun konnte. »Aber in Religionssachen«, so fügte er bedeutungsvoll hinzu, »muß man den Pogn dermaßen spannen, das er nit brech«.
Alles in allem konnten die Katholiken wirklich mit dem Ausgange der Ausgburger Tagung von 1566, »des ersten großen Aktes der Reichsregierung« Kaiser Maximilians II., zufrieden sein. Für die römische Kurie war es zwar eine arge Enttäuschung, daß sich gerade die katholischen Fürsten auf die Anerkennung des Religionsfriedens festgelegt und ihn damit gewissermaßen bestätigt hatten; aber Commendone, der vom Papst angewiesen worden war, in diesem Falle den Reichstag zu verlassen, sah ein, daß unter den gegebenen Verhältnissen nichts anderes zu machen war. Andererseits war nicht zu verkennen, daß der Legat und seine Helfershelfer viel mehr erreicht und noch mehr vorbereitet hatten, das schon in der nächsten Zeit Früchte bringen sollte. Es war ihm nämlich von der Kurie auch aufgetragen worden, von den in Augsburg versammelten Katholiken ein Bekenntnis zu den Trienter Beschlüssen zu erwirken. Daß dies viel, sehr viel verlangt war, dies wußte man wohl in Rom am besten: gab es doch eine ganze Menge ungeweihter geistlicher Fürsten, die sich, wie der Erzbischof von Köln, Graf Friedrich von Wied, geweigert hatten, sich zum Gehorsam gegen Rom eidlich zu verpflichten. Selbst der Herzog Albrecht von Bayern, sozusagen der Führer der katholischen Partei im Reiche, scheute sich nicht, in Rom für seinen zwölfjährigen Sohn Ernst das Freisinger Bistum zu verlangen – so sehr war auch bei diesem Vorkämpfer der Gegenreformation der Standpunkt, daß die hohen geistlichen Ämter zur Versorgung der jüngeren Fürstensöhne dienten, in Fleisch und Blut übergegangen.
Schon im nächsten Jahre sollte der Erzbischof Wied, dieses Sorgenkind des apostolischen Stuhles, von seinem Amte zurücktreten. Auf dem Augsburger Reichstage war, wie Kardinal Commendone bald bemerken mußte, nichts gegen ihn auszurichten, da der Kaiser in dem Vorgehen gegen Wied eine »Neuerung« erblickte.
Auch Maximilian schied trotz seiner Niederlage, die ihm in seinem Vorgehen gegen den kalvinistischen Pfälzer das konservative Luthertum bereitet hatte, nicht unbefriedigt. Die »eilende« Türkenhilfe war ihm am 30. April vom Reichstag in der ansehnlichen Höhe von vierundzwanzig »Römermonaten« (ungefähr 1 700 000 Gulden) bewilligt worden – und das war unter den vielen schwerwiegenden Fragen, die auf diesem denkwürdigen Reichstage sich anmeldeten, doch die dringendste. Denn schon hatte der Krieg gegen den Erbfeind begonnen.
Anfangs Februar, noch ehe der Reichstag eröffnet werden konnte, waren dem Kaiser in Augsburg Nachrichten seines Botschafters Albert von Wyß aus Konstantinopel, vom Neujahr datiert, zugekommen, die von großen Kriegsrüstungen des Sultans Suleiman sprachen.
Der Kaiser hatte bei Ausbruch der Feindseligkeiten mit dem Siebenbürger Fürsten, im Oktober 1564, Michael Cernovich nach Konstantinopel gesendet, um dem Sultan das zurückgehaltene Ehrengeschenk zu überreichen und denselben von einer Unterstützung Zapolyas abzuhalten. Das gleiche geschah dann im Juni 1565, als die Kaiserlichen gegen den Siebenbürger Fürsten die Offensive ergriffen. Zum Unglück war, als Cernovich im Dezember seinen Versuch wiederholte, der dem Frieden geneigte Großwesir Ali Pascha gestorben und an seine Stelle der hochmütige Mohammed Sokolli getreten, der von vornherein eine durchaus feindliche Haltung einnahm. Dem Gesandten, der ihn in einer dreistündigen Konferenz für die Beibehaltung der Waffenruhe zu gewinnen strebte, wurde brüsk erklärt, daß die Würfel bereits gefallen seien. Dem Fürsten Zäpolya hatte der Sultan schon am 21. Oktober ermunternd geschrieben: »Wir haben beschlossen, im künftigen Frühjahre selbst zu kommen, und werden Dir eine solche Hilfe gewähren, daß unsere Dir versprochene Gnade klarer als die Sonne durch den ganzen Erdkreis hinleuchte und die Erinnerung daran währe bis ans Ende der Welt und bis zum letzten Gerichte.« Und jetzt, in einem Schreiben vom 26. Dezember, kündigte er ihm an, daß er sich in wenigen Tagen in Bewegung setzen werde, und dann sollten die Deutschen für all das, was sie getan, büßen – »vertraue unserer Gnade«.
Das klang nicht gut, und am Abend des 24. März 1566, gerade einen Tag nach der Eröffnung des Reichstages, kam die Hiobsbotschaft aus Konstantinopel, daß der Sultan tatsächlich in eigener Person ausziehe und auch des Tatarenkönigs ältester Sohn mit vierzigtausend Mann der besten Streitkräfte mitkomme. »Das seind fürwahr beschwerliche Sachen,« schreibt am 25. März der Vizekanzler Zasius dem bayerischen Herzog unter dem Siegel größter Verschwiegenheit, »hett man Schwendi vormarschieren lassen, so hett man jetzo ganz Siebenbürgen zum Vortl, und folgt doch leider desjenig, dessen man sich daher befahet hat.«
Der Vizekanzler hatte recht, wenn er auf das böse Kapitel der »Versäumten Gelegenheiten«, zu welchem der Kaiser selber dann in vertraulichen Äußerungen reichlichen Stoff bieten sollte, hinwies. »Hätte man« damals, als Lazarus von Schwendi im siegreichen Vordringen war, Siebenbürgen und die wichtigsten Pässe und Festungen gut besetzt, so wäre Maximilian jetzt, da ihm der Vormarsch des türkischen Riesenheeres gemeldet wurde, zweifellos in einer ganz anderen Lage gewesen – vielleicht wäre der Zug überhaupt unterblieben. Allein ein kühner Offensivgeist lag nicht im Wesen der kaiserlichen Kriegführung, und die Gerechtigkeit erfordert es, die ganz besonderen Schwierigkeiten hervorzuheben, die Maximilian in Ungarn entgegenstanden. Die berühmte Erkenntnis des österreichischen Feldherrn Grafen Montecuccoli, daß zum Kriegführen Geld, Geld und wieder Geld gehöre, war schon hundert Jahre früher Kaiser Maximilian II., der es einmal ausdrücklich als »Nerv« des Krieges bezeichnete, vollkommen geläufig. Aber er hatte es nicht oder bekam es immer zu spät.
Unausgesetzt fordert der Feldoberst Schwendi vom Kaiser Geld, und Erzherzog Karl, dem die unangenehme Aufgabe, in der Zeit der Abwesenheit seines Bruders die Zurüstungen zu leiten, zugefallen war, richtete nach Augsburg einen dringenden Hilferuf nach dem andern, während Maximilian wiederum ungeduldig die Vorschläge über die Mobilisierung der Streitkräfte erwartete. Der Kaiser tat, was er tun konnte: er wendet sich nach allen Seiten hin um Unterstützung; die Stände der Erbländer, die Reichsstände werden angegangen, dann die kapitalkräftigen Länder Italiens, wie Florenz, Genua, Savoyen, Lucca und Parma, und der Papst. Er ersucht seinen spanischen Vetter, er möge den Türken gleichzeitig zur See angreifen, er beschäftigt sich auch ernsthaft mit dem Gedanken, die Perser auf die Türken zu hetzen, durch Albert Laski, den Palatin von Sieradien, einen Einfall in die Moldau vollziehen zu lassen. Aber während er sich in so kühn ausgreifenden Plänen bewegt, muß er zu seinem Leidwesen erkennen, wie die nächstliegenden Stützen versagen.
Sein Bruder Ferdinand von Tirol, um sein »Guetbedunken« angegangen, versorgt ihn, statt mit Geld, mit billigen Ratschlägen, die letzten Endes darauf hinausliefen, daß der Kaiser doch viel besser täte, den offenen Bruch mit den Türken zu vermeiden. »Dann, nachdem der Türk«, schreibt er am 21. Februar seinem Bruder in kluger Erkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse, die sich hier allerdings wie blutiger Hohn ausnimmt, »nun allbereit ain guete Weil in solcher Rüstung und sonders Zweifl dasjenige, was er wider Ungern und die niederösterreichischen Lande fürzunehmen vorhabens, mit müglichster Eil und zeitlichen im Summer thuen mochte, aber hergegen, bis Eure Majestät und Lieb die Reichs- und andere Hülfen erlangen, und sich allerdings zu ainer statlichen notwendigen und beharrlichen Gegenwehr und Widerstand gerüst und gefast machen werden mügen, ist allerlei Ungelegenheit nach, die Eurer Majestät und Lieb am pesten gnedigist bewüst, nit wenig zu besorgen, das soliches beschwerlich und langsam genueg, auch etwo, das Gott mit Gnaden verhueten welle, nit mit geringen Schaden und Gefar zuegehen mochte.« Und wie zur besseren Illustration der im Gutachten geschilderten trüben Aussichten für den Feldzug bewilligte der Tiroler Landtag statt der vom Kaiser verlangten 180 000 Gulden nur 60 000, die Vorderösterreicher und Vorarlberger aber gar nichts.
Überall aber benützten die Stände des Kaisers Bedrängnis dazu, um mit ihren Beschwerden, nicht zuletzt natürlich mit der Bitte um Gewährung des freien Bekenntnisses der Augsburger Konfession, herauszurücken. Die ungarischen Stände, die in erster Linie, wie man meinen sollte, sich hätten bewogen fühlen müssen, rasch und ausgiebig in ihre Tasche zu greifen, überreichten dem Erzherzog Karl, wie Bischof Forgacs berichtet, ein fast hundert Folien starkes Buch, das ihre Gravamina enthielt. Erst nach langem Feilschen einigte man sich dahin, daß statt der geforderten sechs Dukaten nur zwei auf ein Bauerngut gelegt werden sollten.
Kaiser Maximilian hatte in letzter Stunde noch einen Versuch gemacht, die Türkengefahr zu bannen. Sofort nach seiner Ankunft in Augsburg, im Januar, gab er Befehl, daß der ungarische Kammerrat Georg Hosszútúti, mit reichlichen Geldgeschenken für die Wesire versehen, nach Konstantinopel entsendet werde. Seine Abfertigung verspätete sich aber, weil das Kriegszahlmeisteramt, wie Karl am 30. Januar meldete, »gar entplößt« war und auch die Hofkammer nicht die erforderlichen Geldmittel auftreiben konnte. Als der Gesandte dann endlich, am 20. April, bei der Pforte anlangte, wurde er ins Gefängnis geworfen, nachdem man ihm alle chiffrierten Briefschaften weggenommen hatte. Wenige Tage darauf, am 29. April, reiste der Sultan trotz seines hohen Alters – er zählte 75 Jahre – und seines schweren Gichtleidens von Konstantinopel ab, um sich persönlich ins Feld zu begeben. Niemand durfte ihm von Frieden reden; er war entschlossen, vor allem jene Festungen zu erobern, die, wie Gyula, Sziget und Erlau, den türkischen Besitz im Rücken bedrohten, und er wollte von seinem Vorsatz auch dann nicht abstehen, wenn man ihm so viel Geld gebe, als tausend Rosse zu tragen vermöchten.
Als der Juni zu Ende ging, hatte man in Wien bereits Kenntnis vom Anmarsche des Sultans. Das Heer, das ihm vorauszog, wurde mit 100 000, sein Gefolge mit 40 000 Reitern und 12 000 Janitscharen angegeben. Man mußte damit rechnen, daß Suleiman noch vor halbem Juli in Griechisch-Weißenburg und vor Ausgang des Monats in Ofen stehen werde. Die Kundschafter wußten, wie Zasius dem bayerischen Herzog am 25. Juni berichtete, vom Sultan zu melden, er reite so schön geschmückt und frisch daher, als wäre er erst dreißig Jahre alt.
Mittlerweile hatten auch die Kaiserlichen umfassende Vorbereitungen zum Empfange getroffen. Von nah und fern waren fürstliche Persönlichkeiten und Kriegsvölker eingetroffen. Denn es war Maximilians Auffassung durchgedrungen, daß der Feldzug gegen die Türken eine gemeinsame Sache der Christenheit sei. Vom Herzog Cosimo von Florenz kamen zehn Fähnlein Fußsoldaten in der Stärke von 3000 Mann, vom Herzog Emanuel Philibert von Savoyen 200 Fußknechte und ebenso viele Reiter und vom Herzog Alfonso von Ferrara 1000 Reiter, die er persönlich befehligte. Aus Frankreich war der junge Herzog von Guise mit einer Reiterschar erschienen. Dazu kamen die deutschen Truppen aus dem Reich und die Zuzüge aus den Erbländern und aus Ungarn. Alles in allem standen dem Kaiser an Streitkräften zu Roß und Fuß – die Besatzungen nicht mitgerechnet – 86 300 Mann zu Gebote.
Niemals war ein derart zahlreiches Heer gegen den Erbfeind aufgeboten worden, wie es diesmal dem Kaiser zur Verfügung stand, und auch die Geldmittel waren, wenn auch meist verspätet, in reichlichem Maß eingetroffen. Trotzdem befand sich Maximilian, als er von Augsburg nach Wien geeilt war, in keiner sehr zuversichtlichen Stimmung. Auf die Segenswünsche seines bayerischen Schwagers antwortete er am 24. Juni mit sichtlichem Ärger: »Wolt Gott, wir hetten die 9 Wochen zu Augschpurg im Anfang nit so ubel versaumbt, man wierts noch taglich sehen, was man daran versaumbt hatt.« Alles ging ihm zu langsam vorwärts. »Des beschtelt Kriegsfolk«, klagte er ihm am 10. Juli, »zeucht gar langsam an; sonst mechte man wol was schtatlichs verrichten. Gott was, das es an mainen Traiwn nit erwinden tuet. Ich kan nit mer, derwail die Obristen und Ritmaster nit Glauwn haltn. Geschieht mit Schadn.«
Kaiser Maximilian war von Anfang an entschlossen, an dem Feldzuge persönlich teilzunehmen. Auch Erzherzog Ferdinand rückte mit seiner »Hoffahne« von etlichen hundert Reitern an der Seite seines Bruders ins Feld, während Karl mit 10 000 Mann von Innerösterreich aus operierte. Im letzten Moment verzögerte sich der Aufbruch wieder, weil der Kaiser von seinem Podagraleiden heimgesucht wurde. Endlich, am 12. August, um die neunte Stunde vor Mittag, erfolgte der Ausmarsch aus der kaiserlichen Residenz. »Es war ein gar trefflicher, herrlicher, schöner, langer Auszug«, so schreibt zwei Tage nachher der kaiserliche Rat Hegenmüller dem bayerischen Herzog, »hat zwei ganze Stunden gewährt.« In langsamem Vormarsche – mittlerweile hatten die kriegerischen Aktionen längst begonnen – kam man über Schwechat, Fischament, Petronell und Altenburg, woselbst überall Lager gehalten wurde, nach Wieselburg, das bereits, wie Hegenmüller am 18. August dem Bayernherzog meldet, von den Italienern derart gründlich »geplündert« worden war, daß die Kaiserlichen »weder Vieh noch Leut, weder Stiel noch Benk, ja nit ainen Nagel in der Wand gefunden«. Der Kaiser hatte jetzt, wie man weiter erfährt, ein »so großes Volk, daß der Anzug gestern morgens früh vor 5 Uhr in diesem Lager angefangen und bis abends 6 Uhr ununterbrochen gedauert hat«.
Weniger vielversprechend sah die Kehrseite dieses großen Aufgebotes aus. »An Proviant, Wein und Brot …«, schreibt Hegenmüller sorgenerfüllt, »ist ein solcher Mangel, daß er selbst heut anders nichts dann lauter Haber fuettern müssen. Wenn das nicht anders wird, ist zu besorgen, daß ein großer Unwille unter dem Volk einreißen werde.« Rat Hegenmüller wußte dem um das Seelenheil des Kaisers stets besorgten Herzog auch eine kleine Episode aus dem Wieselburger Feldlager zu melden, die teils erfreulich, teils weniger angenehm zu vernehmen war. Maximilian hatte Befehl gegeben, daß sein Hofgeistlicher Cithard predige. Als dieser ihm nachkommen wollte, stellte sich heraus, daß kein Chorrock mitgenommen worden war – die »Kappellendruchen« war beim Aufbruch in Wien vergessen worden. Was nun tun? Der Vizekanzler Zasius meinte: »Dann solle er lieber gar nicht predigen.« Aber Maximilian befahl, zu Erzherzog Ferdinand zu schicken, »da werd man gewiß einen finden«. Und da bei dem strenggläubigen Prinzen auch wirklich ein Chorrock aufgetrieben wurde, konnte Cithard eine »gute costliche« Predigt halten.
Am 22. August war die kaiserliche Hauptarmee nach dem Städtchen Raab, an der Donau gelegen, gekommen, und hier blieb man stehen, untätig stehen. Schon vorher war die Frage aufgeworfen worden, ob man die in der Nähe lagernden Türken angreifen sollte – sie wurde verneint, weil man sich scheute, die Kräfte zu zersplittern. Und aus dem gleichen Grunde wurde jetzt die Versuchung, gegen Gran oder Weißenburg vorzustoßen, zurückgewiesen; man wollte die kaiserliche Streitmacht zusammenhalten, um dem Anprall des türkischen Hauptheeres besser widerstehen zu können. Vorerst sollte herausbekommen werden, was der Feind eigentlich vorhabe, ob er nach Sziget, das bereits belagert wurde, ziehen oder sich auf die in Raab stehenden Kaiserlichen stürzen werde. Auch Schwendi, der gegen den Siebenbürger Fürsten operierte, wurde deshalb keine Verstärkung gesandt. »Uns in so fil Tail zu tailen ist nit sicher«, schreibt Maximilian am 24. August Herzog Albrecht, indem er ihm wie zur Beruhigung versichert, er werde, nachdem man, »mit Glück« hier in Raab angekommen, »nix unterlassen furzunemen, des mier muglich sain wierdet, damit Euer Lieb und meniklich sehen sollen, das nix unterlassen sol werden, so an (= ohne) Gefar und Verletzung der Reputation beschehen kan, wie man dan schan (= schon) in Beratschlagung ist und darinnen etzliche wenig Tag hie liegen mueß, also das ich hof, es solle alle Bewilligung nit ubl angelegt werden.«
Dies klingt schon wie eine Rechtfertigung. In der Tat scheint im kaiserlichen Heer angesichts der großen Stärke, über die man verfügte, eine kampflustige Stimmung geherrscht zu haben. Ferdinands Sekretär Ulrich Hohenhauser schreibt am 22. August der Innsbrucker Regierung aus Raab: »Es wäre immer schad, daß ein solch gewaltig wolgerüst stark Volk lang auf der Fueterung ligen und nicht irer Begird und sondern Verlangen nach sollten gegen den Feind gebraucht werden. Gott geb Gnad, daß man sie wol anführ, damit was ausgericht werd, sinst war es großer Schad.« Auch Rat Hegenmüller, der sich als einen »alten Kriegsmann« bekannte, wußte nicht, worauf man eigentlich warte. Kaiser Maximilian sollte, so meint er am 24. August in einem Schreiben an Herzog Albrecht, die »Wör (= Wehre) nit faiern lassen, sondern fluchs fortrücken.« Und am 9. September berichtet er Albrecht wieder: »Jedermann verwundert sich«, warum man bei einer derartig günstigen Gelegenheit zu einem erfolgreichen Schlag »solange still liege«. Nach Aussage türkischer Gefangener sei das große Heer der Türken in Wirklichkeit gar nicht so groß; es sei »viel junges Gesind« darunter, das einen »großen Schrecken« vor den Kaiserlichen habe.
Rat Hegenmüller weiß jedoch dem Herzog auch etwas Angenehmes aus dem kaiserlichen Feldlager in Raab zu berichten. »Alle Morgen«, so besagt seine Relation vom 24. August, »wird von den Hoftrompetern das Ave Maria geblasen, worauf jederman auf die Knie fällt, und ist Maximilian der erste und andächtigste. Alle Feiertage läßt Maximilian predigen und eine Messe lesen.« Aber selbst diese kirchlich musterhafte Aufführung des Kaisers konnte nicht hindern, daß auch der spanische Gesandte Chantonnay, der sich gewiß über Maximilians kirchlichen Eifer über die Massen gefreut haben mag, den Kaiser als obersten Kriegsherrn heftig tadelte. In einem längeren Bericht vom 2. September versichert er Philipp II., Maximilian habe so viele Krieger, daß er vor den Türken, selbst wenn sie zweimal so stark wären, keine Angst zu haben brauche; denn man erkenne immer mehr, daß es Gesindel und zum größten Teil unbewaffnet sei. Wenn man jetzt, solange das Heer gesund und guten Mutes sei, nichts tue, werde man später, sobald Krankheiten, die sich bereits zeigten, einreißen würden, auch beim besten Willen des Kaisers nicht mehr vorwärtskommen. Es fehle an erfahrenen Leuten, und auch der Kaiser wie der Erzherzog Ferdinand könnten diesen Mangel nicht ersetzen. Von keinem, außer von den drei Oberkommandierenden, habe er jemals in seinem Leben etwas gehört. Wie anders war das doch, so schließt der Spanier seinen Bericht, im Lager Kaiser Karls V.
Der Gesandte hatte hier den wundesten Punkt getroffen: das Fehlen kriegstüchtiger Führer. Maximilian wußte dies freilich selber am besten. Auf den freundschaftlichen Rat seines bayerischen Schwagers, sich mit »guten und verständigen« Leuten zu versehen, antwortete er am 24. August seufzend, daß er »ja alle menschliche Mitl fürneme«, um solche zu bekommen, »awer in der Warhait saind sie gar beschwerlich zu bekumen und in sonderhat solliche Lait, die diesen Faint kenten«.
Alle diese Klagen änderten indes nichts an der leidigen Tatsache, daß der obersten Heeresleitung jeder Offensivgeist vollständig abging: ihre Gedanken scheinen sich schon damals, wie es in der späteren Rechtfertigungsschrift als Erklärung angegeben wurde, mehr nach rückwärts, auf den Schutz der Stadt Wien, konzentriert zu haben. War dies der Fall, dann erklärt sich allerdings die Scheu, das den Donaustrom beherrschende Raab zu verlassen.
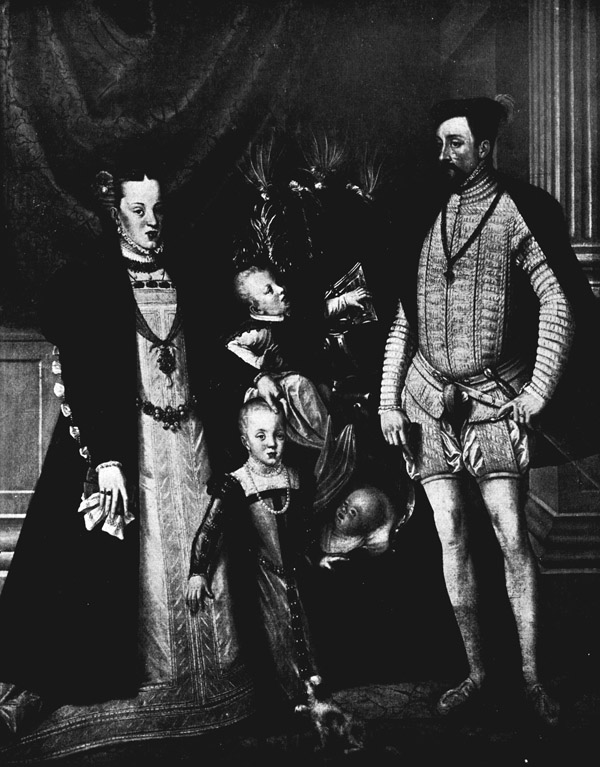
Maximilian II. und Familie
Während man nun hier untätig wartete und der Kriegsrat, der in sich zerspalten war, in allen möglichen Plänen sich erging, wurde das von dem Grafen Nikolaus Zriny verteidigte Sziget heftig von den Türken berannt. Sultan Suleiman hatte sich tatsächlich, wie schon vor Monaten gemeldet worden war, gerade diese Festung zum Ziele seines Angriffes gesetzt und dort sein Lager aufgeschlagen. Um dem schwerbedrängten Grafen zu Hilfe zu kommen, entschloß man sich nach langen Beratungen, einen Vorstoß nach Gran zu unternehmen, um auf diese Weise die Türken von Sziget abzuziehen. Am 24. August brach denn auch eine Heeresabteilung von Raab auf; sie kehrte jedoch bald wieder zurück, weil im Kriegsrate wieder die andere Partei, welche die Belagerung Grans für unnütz und gefährlich hielt, die Oberhand erhalten hatte.
So erfüllte sich denn das Schicksal Szigets. Am 9. September fiel die Festung, die nur mehr einen Trümmerhaufen darstellte, in die Hände der Türken, die seit 1. August unausgesetzt gestürmt hatten. Als auch der letzte Rest, das Schloß, durch eine Mine in Brand geraten war und die Türken sich zum entscheidenden Sturme rüsteten, da stellte sich Zriny festlich geschmückt an die Spitze der todesmutigen Belagerten, öffnete das Tor und stürzte sich auf die Janitscharen. Von mehreren Kugeln getroffen, geriet der Held in die Hand der Feinde, die ihn zum Großwesir brachten. Mohammed ließ ihm das Haupt abschlagen, schickte es aber seinem Bruder, dem Pascha von Ofen, der es wieder dem Grafen Salm, dem Kommandanten des kaiserlichen Feldlagers, übersandte.
Der Sultan selbst erlebte den Fall Szigets nicht mehr – er war fünf Tage vorher, am 4. September, verschieden. Sein Tod aber wurde längere Zeit verheimlicht, und es beweist, wie schlecht der Kundschafterdienst im kaiserlichen Heer ausgebildet war, daß man von diesem so wichtigen Ereignis noch Mitte Oktober keine genaue Kenntnis besaß. Noch am 1. Oktober meldete Rat Hegenmüller Herzog Albrecht, daß der Sultan vorhabe, von Sziget aus mit aller Macht auf die kaiserliche Hauptarmee vorzudringen. Erst am Ende dieses Monats, am 28., erfuhr der Kaiser durch den venezianischen Gesandten Contarini, der von seiner Signoria die Nachricht vom Tode Suleimans erhalten hatte, den Sachverhalt. Maximilian hatte nämlich dem päpstlichen Nuntius Biglia gegenüber den Wunsch geäußert, etwas Sicheres über den Sultan zu erfahren, was Biglia Contarini mitteilte, der nun eiligst – es war nachts – zum Kaiser ging. Man hatte also, wie der spanische Gesandte mit dem Ausdruck höchster Befremdung feststellte, zwei Monate gebraucht, um Klarheit zu gewinnen. Sogar in Innsbruck wußte man den Tod schon drei Tage früher.
Jetzt erfuhr man auch Näheres über die Art, wie es den Wesiren gelungen war, den Tod Suleimans so lange zu verheimlichen. Sie hatten einen alten Mann, der dem verstorbenen Sultan ähnlich sah, in sein Bett gelegt und für ihn alle Befehle ausgegeben.
Angesichts des kläglichen Resultats des Feldzugs – auch die wichtige Festung Gyula war gefallen – fühlte sich der Kaiser bemüßigt, einigen der angesehensten Fürsten des Reiches gegenüber, das so schwere Geldopfer für den Türkenfeldzug gebracht hatte, die Untätigkeit seines Hauptheeres zu rechtfertigen. Er für seine Person, so schreibt er am 29. September Herzog Albrecht, sei fest entschlossen gewesen, Gran zu belagern, habe auch diesen Plan durch jene Räte, die er für die besten gehalten, stattlich beratschlagen lassen. Aber sie hätten ihm alle widerraten. Er habe dann einen Vorstoß auf Stuhlweißenburg – er erfolgte am 24. September – unternommen, obwohl man auch dagegen im Kriegsrate heftig protestiert hätte, und derselbe sei auch »ohne Frucht« abgegangen. Bei dem früher unternommenen Zuge nach Gran hätten die drei ausgeschickten Regimenter von wegen des Sturmsoldes und anderer Forderungen gemeutert, so daß man sieben Wochen mit ihnen nichts habe anfangen können, und auf dem Vormarsche nach Stuhlweißenburg sei es ohne alle »genuegsame« Ursache unter den deutschen Reitern zu einer Meuterei gekommen. Nachdem er sie endlich mit Mühe und Not fortgebracht habe, hätten sie sich gestern geweigert, die Tagwache zu beziehen – »und soll aner bai disen Laitn toi und unsinnig werden«. Bei den Musterungen werde nur der dritte Teil wirklich gestellt, der Rest bleibe auf dem Papier. Von den fünfzehnhundert Pferden, die Graf Günter von Schwarzburg gemustert habe, seien nicht tausend zu sehen. »Also gets auch mit den andern zue und des das beschwarlichist ist: wan ainer vermaint, er haw achthalwtausend Pfert, so saind ier nit vier, und mag Euer Lieb in hogsten Vertrauen nit verhaltn, das ich auf dise Schtund mit allem Folk, so ich bai mier haw, aufs maist über 25 tausend Man nit haw. Da kinnen Euer Lieb laichtlich awnemen, was aner gegen aner solchen Macht mit so wenig und unbilligen und betriegerischen Folk guets richten solle.«
Der Kaiser versichert seinem Schwager, daß er sich bei diesem »zerrissenen« Wesen »schier toll« arbeite, und dies bestätigte auch der Vizekanzler Zasius, als er dem Herzog einige Wochen früher die Bewegungen des kaiserlichen Heeres beschrieben hatte. »In dem Ziehen disponieren Ir Majestät und die fürstliche Durchlaucht alle Sachen selbst aigenpersönlich, machen selbst die Schlachtordnung aigner Person, von Reuter und Knechten, faiern im Veld kain Augenblick und bescheint sich im Werk, das Ir Majestät und fürstliche Durchlaucht dis Handwerks so wol erfahren seien als etwa ein anderer, so jetzo bei Irer Majestät und Durchlaucht im Veld, wer und in was Bevelch der auch seie.«
Allein trotz dieser »merklichen großen Arbeit«, über die sich, wie Zasius meint, »meniklich verwundert«, war schließlich das eingetroffen, was der spanische Gesandte gleich anfangs prophezeit hatte, daß nämlich der Kaiser später, wenn er etwas unternehmen wolle, zu wenig Leute haben werde, und diese traurige Tatsache bezeugt nun Maximilian selber, wenn er seinem bayerischen Schwager gewissermaßen die Schlußrechnung des unglücklichen Unternehmens präsentiert: »In summa, da man mer Folk gehabt, hatt mans nit fort kinnen bringen, iezt ist es so wenig, das man fiersichtiklich handlen mues.« Mit einem Seitenhieb auf jene alles besser wissenden Salonstrategen des Hinterlandes, die »gut reden haben« und »umb dise Gelegenhait nit wissen«, versichert er dem Herzog, der Zug nach Gran sei nach dem Fall von Sziget und Gyula nicht mehr möglich gewesen, weil sie schon zu schwach waren. Warum man aber gewartet hatte, bis die zwei Festungen gefallen waren, darüber schwieg sich der Kaiser aus.
Nun, da der Herbst ins Land gezogen kam, brachen im kaiserlichen Feldlager die vom spanischen Gesandten besorgten Krankheiten aus. Das Fußvolk, so berichtete Zasius am 16. Oktober Herzog Albrecht, stirbt »purtzlenweis«, und »alle Tage« verlassen viele Soldaten, »sonderlich bei der Nacht«, das Lager, das nun »sehr schütter geworden ist«. Am 15. Oktober machte sich auch Erzherzog Ferdinand mit seinem Kriegsvolk aus dem Staub. In seinem Tagebuch vermerkt der Kaiser nur kurz: »Den 15. Octobris ist mein Herr Brueder Ferdinand von mier aus dem Feld gezogen.« Dem Herzog Albrecht aber drückte er des längeren seinen großen Ärger darüber aus. »So kan ich Euer Lieb auch mit betriebtn Gemiet nit verhaltn,« schreibt er am 18. Oktober, »das main Herr Brueder Ferdinand den vergangnen Erchtag aus dem Feld awzogen, unangesehen allen Ausfierungen und Ermanens, so ich Sainer Lieb gethon haw, sainen Ern und anders halwn. Ja, da hatt nix geholfen. In summa, ich glauw gewiß, er sai verzaubert, dan ime etzlich Brieflen von der losen Brekin – das bedeutet so viel wie »Hündin« und gemeint ist Ferdinands Gemahlin, die Philippine Welser – kumen saind; bald dernach hatt er weder Tag noch Nacht kan Ruee gehabt, sonder melankolisiert und gar in ain Fiewer geraten, glaichwol, wie ich hör, ist es besser worden. Also gets, mier ist auch das daraus gefolgt, das die Übrigen aus den Erblanden, so sie das gesehen, auch hinwek ziehen, und da ist kain Halt mer. Ich wolt, das die Brekin in einen Sakh schtekt und was nit wo ware. Gott verzeihs mier, thue ich Unrecht, und haw lauter Sorg, man haw die Marhern und Beham aufrierisch gemacht, damit man besser Ursach haw, hinwek zu ziehen; dan sie auf ainmal sich entschlossen hawen lenger nit zu belaiwn, so sie doch derfor kan ainige Meldung gethan hawen, und glaich darauf haw ich Sain Lieb auch nit haltn kunnen.«
Am 21. Oktober hatte man im Kriegsrat einstimmig, wie der Kaiser in seinem Tagebuch vermerkt, den Rückzug beschlossen. Acht Tage darauf war er, nachdem ihn noch auf dem Weg sein altes Leiden, das Herzklopfen, heimgesucht hatte, wieder in Wien. In welcher Stimmung – dies läßt sich aus der Bemerkung erraten, die Hegenmüller in seinem Bericht an den bayerischen Herzog vom 26. Oktober, da man sich gerade auf dem Rückmarsche befand, fallen ließ: »Meniklich schämt und beschwärt sich, also unausgerichteter Ding heimzuziehen.« Im Kaiser war, wie dem venezianischen Gesandten auffiel, eine große Veränderung vorgegangen. In seinem Gesicht konnte man die Bestürzung lesen. Während er früher nach den Mahlzeiten mit vielen in der herzlichsten Weise verkehrte, hielt ihm nunmehr der Gram den Mund verschlossen. Giovanni Micheli behauptete später, Maximilian habe seit dem Türkenkriege von 1566 den hohen Gedankenflug, der ihn vordem ausgezeichnet, eingebüßt. In Wien setzte es scharfe Bemerkungen, daß man so viel Geld unnütz geopfert hätte.
Der Vizekanzler Zasius sah in seiner aufgeregten Phantasie schon die Türken vor Wien. »Den Feind«, so berichtet er am Allerseelentag dem bayerischen Herzog ganz trübselig, »haben wir circum circa auf allen Orten an der Seiten, nicht weiß ich, was Gott noch mit uns wirken will, aber ein ubles Ansehen hat es leider.« Man hatte nun die unangenehme Aufgabe, das Kriegsvolk abzudanken und zu bezahlen, und wußte nicht, woher das Geld nehmen. Auch Zasius fand, daß man seinem kaiserlichen Herrn die Seelenqualen schon von außen stark anmerke. »Gott bessere es,« setzte er nochmals feierlich hinzu, »denn es steht fürwahr mißlich.« Der Vizekanzler schloß seinen Bericht mit dem wenig erfreulichen Ausblick: »Das wird den Winter hinaus eine holdsälige feintliche Nachbarschaft ausgeben … und wo nit anders den Dingen geholfen wird, so hab auf Wien ich wenig Hoffnung.«
Es war nur ein Glück, daß auch die Türken ihren Offensivgeist, für den Augenblick wenigstens, nahezu vollständig eingebüßt hatten. Der neue Sultan Selim II., der Sohn des verstorbenen Suleiman, sehnte sich in seinem unkriegerischen Gemüte nach dem Frieden und ließ bald darauf Unterhandlungen einleiten, auf die man in Wien sehr gern einging – nicht zuletzt aus dem Grunde, daß auch die deutschen Reichsfürsten mehr als deutlich zur Einstellung aller Feindseligkeiten mahnten. Im Juni 1567 schickte Kaiser Maximilian den Erlauer Bischof Verantius und seinen Rat Christoph von Teuffenbach nach Konstantinopel, um, vereint mit dem ständigen Residenten an der Pforte, Albert von Wyß, über den Frieden zu verhandeln, der dann endlich, am 17. Februar 1568, in Adrianopel – wieder auf acht Jahre – zustande kommen sollte. Er bestimmte im wesentlichen, daß der gegenwärtige Besitzstand aufrechterhalten und auch das jährliche »Ehrengeschenk« von dreißigtausend Dukaten fortbezahlt werde.
Des Kaisers harrten bei seiner Rückkehr nach Wien noch andere Aufgaben – es galt einen der gefährlichsten inneren Feinde des Reiches unschädlich zu machen.
Auf dem Augsburger Reichstage von 1566 hatte sich Kaiser Maximilian auch mit einer der schlimmsten und verwickeltsten Angelegenheiten zu beschäftigen – mit der Ächtung des Landfriedensbrechers Wilhelm von Grumbach, dessen »Händel« die Ruhe des Reiches seit Jahren in der empfindlichsten Weise störten. Dieser verwegene Abenteurer war ein geistiger Erbe des fränkischen Ritters Franz von Sickingen, ein Genosse jenes schrecklichen Markgrafen Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, der im Bunde mit Kaiser Karl V. gegen die deutschen Fürsten gekämpft und die schwersten Mordbrennereien verübt hatte. In seiner Person verkörperte sich der Kampf des sinkenden Rittertums gegen die emporgestiegene Macht des Landesfürstentums.
Wilhelm von Grumbach hatte gleich seinem Lehrmeister und Waffengefährten Alcibiades den »Pfaffenkrieg« auf seine Fahne geschrieben und lag in grimmiger Fehde mit dem Würzburger Bischof Melchior von Zobel wegen der Güter, die er sich gewaltsam angeeignet hatte und die ihm dann im Passauer Vertrag wieder entzogen worden waren. Im April 1558 wurde der Bischof von Grumbach überfallen und ermordet. Nach dieser Untat suchte er Schutz am Hofe des französischen Königs Heinrich, kehrte indes wieder zurück und fand, als Markgraf Alcibiades gestorben war, einen fürstlichen Beschützer in der Person des Herzogs Johann Friedrich von Sachsen – damit aber bekam die Grumbachische Bewegung eine neue Wendung.
Dieser Herzog war ein Sohn des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich, der im Kampfe gegen Kaiser Karl V. einen Teil seiner Länder und die Kurwürde zugunsten seines Vetters Moritz von der albertinischen Linie eingebüßt hatte. Die Aussicht, das Verlorene zurückzugewinnen, mußte für den Ernestiner etwas Verlockendes besitzen, und der Ritter Grumbach verstand es, den Ehrgeiz und Rachedurst des Herzogs nach dieser Richtung hin zu entfachen. Ein junger Bauer aus Sundhausen, »Tausendschön« genannt, der im Rufe eines Hellsehers stand, diente dazu, durch seine »Engel«, die ihm in aschgrauen Gewändern mit schwarzen Hüten und weißen Stäben erschienen und ihm »wunderbare Sachen« anzeigten, den leichtgläubigen Fürsten zu betören. In einem Kristallglase konnte dieser den verlorenen Kurhut sehen, ja noch mehr – die Kaiserkrone. Im Dezember 1562 verkündete Grumbach dem gespannt aufhorchenden Herzog: Die Engel hätten ihm gesagt, daß der Kaiser, »der nicht auf dem rechten Glauben sei, auch sein Volk von Gottes Wort abführe«, durch einen Knaben Grumbachs erschossen werden müsse. Auch die katholischen Herzoge Albrecht von Bayern und Heinrich von Braunschweig würden ihre Strafe empfangen, »weil sie ebenfalls nicht die geringsten Verfolger von Gottes Wort seien, auf welche die Pfaffen mit ihrem gottlosen Haufen ihr Herz und Vertrauen setzten«. Und nicht zuletzt sollte auch mit dem Kurfürsten August von Sachsen eine solche »Änderung« eintreten – in einem halben Jahre werde der Herzog wiederum im Besitze des ihm entzogenen Kurlandes sein. Der Bischof Friedrich von Würzburg aber werde schon binnen drei Wochen erschossen sein und das Bistum einen weltlichen Besitzer erhalten.
Der von den Engeln anempfohlene »ritterliche löbliche Zug« gegen das Stift Würzburg wurde in der Tat ins Werk gesetzt. Anfang Oktober 1563 brachen Wilhelm Grumbach und seine Genossen Wilhelm von Stein und Ernst von Mandelsloë mit einer ansehnlichen Streitmacht gegen Würzburg auf, um sich in den Wiederbesitz der dem fränkischen Ritter abgenommenen Beute zu setzen. Die Stadt wurde überfallen, eingenommen und das Kapitel gezwungen, auf alle Forderungen Grumbachs einzugehen. Der Bischof ratifizierte den vom Domkapitel erzwungenen Vertrag, aber Kaiser Ferdinand glaubte nun nicht länger diesen »Praktiken« zusehen zu dürfen. Schon hatten sich auch im Norden des Reiches beunruhigende Ereignisse abgespielt, die man mit dem Grumbacher Handel in Verbindung brachte. Erich von Braunschweig-Kalenberg war in das Hochstift Münster eingebrochen, und die Verbindungen, die er anknüpfte, schienen auch die Niederlande zu bedrohen. Eine allgemeine Erhebung der seit langem gärenden Reichsritterschaft, ein neuer »Sickinger Edelmannskrieg« stand in Deutschland zu befürchten. So verhängte denn der Kaiser über den Ritter Grumbach die Reichsacht. Der Geächtete aber fand Aufnahme und Schutz bei seinem Gönner Johann Friedrich, der sich ungeachtet aller Mahnungen des Kaisers und der befreundeten Fürsten nach dem befestigten Gotha zurückzog, um hier die glückliche Erfüllung der Prophezeiungen Grumbachs und seiner Geisterseher abzuwarten.
So standen die Dinge, als Kaiser Ferdinand starb. Die Frage war nun, wie sich der neue Monarch zur Exekution gegen den landkundigen »Ächter« stellen werde. Auch in dieser Frage hatte Maximilian ursprünglich einen anderen Standpunkt eingenommen als sein Vater, um sich schließlich derart zu dessen Auffassung zu bekennen, daß Ferdinand angst und bange wurde und sich sogar bemüßigt fühlte, den Eifer des Thronfolgers zu dämpfen. »Het die kaiserliche Majestät in disen Sachen«, so schreibt am 22. März 1564 Rat Zasius dem Bayernherzog Albrecht, »der kuniglichen Majestät gevolgt, so war dis und anders lengst beschehen. Vor und ehe das Achtexequaturmandat publiciert worden, hat Ir kunigliche Majestät sich etwas kueler bei diser Sachen vernehmen lassen und die kaiserliche Majestät vil hitziger und schörpfer; hernach aber, als die Publication angeregts Mandats ausgegangen, da haben Ir kunigliche Majestät sich in allen iren Ratschlägen und Handlungen um ain guts vehementiorem bewisen als die kaiserliche M?., haben auch mit Schreiben und Reden nur scharpf und heftig sich der Sachen angenomen, nit allain bai der kaiserlichen M?., sonder auch gegen vile Cur- und Fürsten und sonderlich den Curfürsten von Saxen treffenlich animiert, dasjenig zu treiben, wie es im Werk ervolget.«
Der Kurfürst August von Sachsen wird sich freilich nicht allzusehr dagegen gesträubt haben; – denn er als Nachfolger seines Bruders Moritz war es ja, gegen den sich die Umsturzpläne Grumbachs in erster Linie richteten. Und neben dem lutherischen August ergriffen katholische Fürsten die Partei des Würzburger Bischofs, nicht zuletzt Herzog Albrecht V. von Bayern, der nicht müde ward, den neuen Kaiser dringend zu ermahnen, im Interesse seiner Hoheit und Autorität wie der »Reputation und Achtung« des heiligen Reiches die »arglistigen, bösen Praktiken« der Ächter niederzuschlagen und die friedliebenden Stände zu schützen. Allein auch der Bayernherzog, das Haupt des Landsberger Bundes, konnte sich nicht gegen die vom Kaiser ins Treffen geführten Bedenken – sie klangen grotesk genug – verschließen: Die Vollstreckung der Acht sollte erst dann in Angriff genommen werden, wenn sie auch wirklich vollstreckt werden könne, das heißt also, wenn man des Erfolges auch sicher sei. Denn für Herzog Johann Friedrich hatte beim Kaiser eine ganze Reihe namhafter Reichsfürsten vermittelnd eingegriffen, so sein Schwiegervater Kurfürst Friedrich von der Pfalz und der Kurfürst Joachim II. von Brandenburg, der Herzog Wilhelm von Jülich-Cleve, selbst ein geistlicher Stand, der Kurfürst Daniel von Mainz. Und zu diesen »Interzedierenden«, die eine »Aussöhnung« Grumbachs mit Würzburg beantragten, kam noch die ganze schwere Menge von Reichsständen, die, wie Maximilian seinem bayerischen Schwager klagte, den Standpunkt vertraten, daß die ganze Sache sie »nichts angehe«.
Allein die verdächtigen Kriegsgewerbe in Frankreich und Schweden wie im Reiche nahmen von Tag zu Tag zu. Man sprach von einem großen schwedisch-lothringisch-sächsischen Bündnis, und während alle diese Anschläge mit Sorge verfolgt wurden, setzte der Herzog den Mahnungen des Kaisers ein trotziges Nein entgegen. Maximilian möge, so erwiderte er dreist, den »falschen, bösen Mäulern« keinen Glauben schenken. So führte denn seine beispiellose Halsstarrigkeit schließlich dazu, daß der Kaiser auf dem Reichstag in Augsburg – am 13. Mai 1566 – wider Wilhelm Grumbach und seinen Anhang von Reichs wegen die Acht erneuerte. In einem besonderen Mandat vom Vortage wurde dem »Receptator« Johann Friedrich die Gefangennahme der Ächter, ebenfalls bei Strafe der Acht, auferlegt. Und schon wurden auch wegen der militärischen Durchführung der Acht Maßregeln getroffen.

Herzog Albrecht V. von Bayern
Noch einmal aber sollte der Herzog, bevor man zum Äußersten griff, zur Unterwerfung unter die Reichsgewalt ermahnt werden. Doch auch dieses neuerliche Eingreifen des Reiches hatte keinen Erfolg. Johann Friedrich wähnte den Kaiser allzusehr in seine Türkensorgen verstrickt, als daß er an den Ernst der Situation geglaubt hätte, und in der Tat war er nicht so sehr im Unrecht. Maximilian mahnte nach Schluß des Reichstages, als er bereits in Wien mit der letzten Zurüstung zum Türkenkriege beschäftigt war, den Kurfürsten August zur Geduld. Wenn man Mittel finden würde, schreibt er ihm am 2. Juli, mit Ehren aus der Sache herauszukommen, wäre es wohl gut; man solle wenigstens Zeit gewinnen und versuchen, etliche der vornehmsten Helfer, wie Mandelsloë, abspenstig zu machen. »Das ist war,« fügt er vielsagend hinzu, »wan man mit den Türken nitt zu tuen hette und alan diser Sachen auswartn mochte, so war der Sachen wol Rat zu finden. Awer also omnibus turbatis mues man bai Wailen aus der Not ain Tugent machen und nach Gelegenhat das Sicherist an die Hand nemen.«
Kaum war der Kaiser von dem verunglückten Feldzuge gegen die Türken nach Wien zurückgekehrt, fing auch schon sein sächsischer Freund ihn mit Hochdruck zu bearbeiten an, auf daß endlich einmal die Achtexekution vorgenommen werde. Und tatsächlich entschloß sich Maximilian noch im Monat November zu deren Durchführung. »Das man in Namen Gottes die Exekution an die Hand neme«, schreibt er in sein Tagebuch und fügt erklärend bei: »Und ist zu besorgen, da man iezt nit exsequiert, quod nunquam fiet.« Dann aber stand es, wie ihm der Vizekanzler vorgestellt hatte, um sein Ansehen im Reiche schlimm – »wenn man siehet, wie die kaiserlichen Befehle mit Füßen getreten werden können, zugeschweigen dieweil on das von jüngster Expedition ungleich geredet wird«. Es war auch zu besorgen, daß der Kurfürst August die Exekution »auf eigenes Risiko« zu des Kaisers »Schimpf und Spott« in die Hand nehmen werde, »aus der Persuasion, die dann bei vielen andern hohen und niedern Ständen Platz greifen würde, daß man tun dürfe, was man wolle, ohne gestraft zu werden«.
Am 12. Dezember wurde durch ein offenes Mandat dem Kurfürsten die Achtvollstreckung gegen die Ächter und ihre »Receptatoren« aufgetragen. August, der schon früher zum Befehlshaber der aus vier Kreisen gebildeten Exekutionstruppen ausersehen worden war, traf alsbald »in höchster Geheim« alle dazu erforderlichen Anstalten und setzte sich mit etwa 1300 Reitern und 700 Knechten in Bewegung, um in das Land des sächsischen Herzogs einzufallen. Am 23. Dezember erschien ein Herold vor Gotha und überbrachte dem Geächteten das Exekutionsmandat mit dem kaiserlichen Absagebrief. Als Antwort zeigte ihm der Herzog die Geschütze, die auf der Burg aufgestellt waren, um die Feinde wissen zu lassen, »wie er gestaffiret sei«. Seine Sorglosigkeit bekundet allein die Tatsache, daß er erst zwei Tage vorher mit der Sammlung seines Aufgebotes begonnen hatte. War er wirklich der Meinung, ihn würden die Niederländer, der König von Frankreich und die französischen Hugenotten unterstützen, so sollte er arg enttäuscht werden.
Allein trotzdem ließ die Einnahme der Festung bedenklich lange auf sich warten. »Der Kurfürst von Sachsen«, so vertraute der Kaiser seinem Tagebuch an, »versieht sich, das Land innerhalb 14 Tagen einzunehmen und mit Gotha auch bald ein Ende zu machen.« Die Kontingente der Kreise trafen nur »langsam« und spärlich »mit wenig Geschützen« ein, und der Kurfürst mußte aus eigenen Mitteln für eine ausreichende Streitmacht sorgen, die schließlich in der respektablen Gesamtstärke von 10 000 Fußsoldaten und 6000 Reitern vor Gotha stand. Er selber fand sich am 22. Januar im Lager ein, um »das kaiserliche Justizienwerk zu einem glückseligen, sighaften, guten Ende zu bringen«. Aber das »Bubennest« war viel stärker und leistete einen weit zäheren Widerstand, als die Belagerer gedacht hatten. Etwas kleinlaut meldet zwei Tage darauf der Kurfürst dem Kaiser: Er habe das Schloß Grimmenstein und die Stadt Gotha so fest und dermaßen versehen und verwahrt gefunden, daß es nicht ratsam erscheine, »einen blinden vergeblichen Sturm« mit so wenig Knechten zu unternehmen; »denn wenn diese einmal im Sturm abgetrieben, so sind sie, wie Eure M?. leicht zu ermessen hat, nicht so bald wieder dazu zu bringen und den Belagerten wächst der Mut.«
Den Belagerern kam schließlich eine Meuterei zu Hilfe, die in Gotha gegen Grumbach ausgebrochen war. Anfang April kamen aus der eingeschlossenen Stadt Abgesandte mit Trommlern und Trompetern und überbrachten den im Lager befindlichen kaiserlichen Kommissären zwei Schreiben, eines vom Herzog und eines von der Ritter- und Bürgerschaft, worin um einen vierzehntägigen Anstand gebeten wurde. Grumbach und Stein sowie der Kanzler Brück saßen bereits gefangen auf dem Rathaus. Am 13. April erfolgte die Kapitulation und Übergabe der Stadt und Festung an den Kurfürsten, der nun mit seinen Truppen einziehen konnte. Wilhelm Grumbach wurde »mit beiden Fäusten und Füßen« dermaßen eingeschmiedet, daß er sich nicht entleiben konnte, wie er denn seit Monaten Gift bei sich getragen hatte. Den Herzog Johann Friedrich führte man gefangen nach Dresden ab.
Die Nachricht vom Falle Gothas langte am 15. April zur Nachtzeit in Wien an, und Doktor Zasius lief selber in die Burg, um dem Kaiser davon Mitteilung zu machen, der darauf ein feierliches Tedeum anordnete. Man ersieht schon aus dieser Verfügung, welch große Bedeutung man am Kaiserhofe dem »Gothaischen« Handel beilegte, und die folgende Untersuchung sollte sie erst recht zur Anschauung bringen.
Schon am Vortage hatte das gerichtliche Verhör mit den gefangenen Ächtern »in greulicher Tortur« begonnen. »Es war«, so heißt es, »ein unmenschliches Ergötzen«, daß der Kurfürst August und der Herzog Johann Wilhelm, ein Bruder des geächteten Herzogs, hinter einem seidenen Vorhang der »peinlichen Befragung« beiwohnten. Nach kurzem Prozeß wurden Grumbach, Brück und fünf andere Personen, darunter Hans Beyer und der Engelseher Hans Tausendschön, zum Tode verurteilt. Die Strafe für den Hauptschuldigen Ritter Grumbach wurde aus des Kurfürsten »angeborener Güte« dahin gemildert, daß er nur lebendig gevierteilt wurde. Brück wurde ohne Erwähnung der kurfürstlichen Gnade zu derselben Strafe verurteilt. Wilhelm von Stein sollte vor dem Vierteilen enthauptet, Hans Beyer und der Engelseher gehängt werden. Am 18. April fand zu Gotha in Anwesenheit des Kurfürsten August und einer »grausam großen Welt Volkes von Fürsten, Grafen, Edelleuten, Kriegsvolk, Bürger und Bauern« auf einer am Marktplatz errichteten Bühne die Hinrichtung statt. Der Kurfürst ließ im Hochgefühle seines Sieges eine Denkmünze mit der stolzen Inschrift prägen: »Tandem triumphat bona causa.«
Die Prozeßakten und die bei der Besitznahme Gothas vorgefundenen Schriften, die herzogliche »Kanzlei«, wurden nach Wien gesandt, und der Kaiser konnte jetzt, da er die Anschläge der Ächter in ihrem vollen Umfange kennengelernt hatte, mit Genugtuung sagen, daß es hoch an der Zeit war, den gefährlichen »Anschlägen und Konspirationen« einen Riegel vorzuschieben, weil sonst, wie ihm die kaiserlichen Kommissäre gleich nach dem Verhör der Ächter gemeldet hatten, ganz Deutschland »umgekehrt« worden wäre. Die in Gotha vorgefundene Kaiserkrone bewies zur Genüge, daß die Verschwörung Grumbachs nicht nur auf Würzburg und Kursachsen, sondern auch gegen das Haus Habsburg zielte. Besonders gefährlich erschien dem Kaiser die aus den beschlagnahmten Schriften erwiesene Verbindung mit den aufständischen Niederländern.
»Es ist dise Grumbachische und Niederlendische Handlung«, schreibt der Kaiser unter dem frischen Eindruck der Kenntnisnahme der Akten in sein Tagebuch vom Juni, »alles an ainander gehangen und ist Gott dem Herrn wol zu dankhen, das es disen Weg also erraicht hat.« Mit dem venezianischen Gesandten Micheli sprach Maximilian eine volle Stunde über die Bedeutung der Einnahme Gothas. »Durch sie sind«, so erklärte er ihm, »große Umsturzpläne vereitelt und enthüllt worden, welche von den Geächteten mit deutschen Fürsten und mit den Niederländern zur Vernichtung des Hauses Habsburg geschmiedet worden waren.« Man habe es auf den Entsatz Gothas, auf die Befreiung der Niederlande und deren Vereinigung mit dem Reich, auf gänzliche Abschaffung der geistlichen Herrschaft, die Wahl eines anderen Kaisers und eine Reform der Reichsregierung abgesehen gehabt. Es habe nur an dem zur Ausführung nötigen Gelde gefehlt, da England und Schweden solches versagten. Auch dem spanischen König teilte er das große Ereignis mit: »Dan hetten sie uns baide«, schreibt er am 18. Juli Dietrichstein, »vertilgen können, so wär es beschehen, aber Gott hat es durch die Exekution wunderlich verhütet.«
Der gefangene Herzog Johann Friedrich büßte mit der Freiheit auch seine Länder ein, die zunächst an seinen Bruder Johann Wilhelm, erst später an die Söhne des Verurteilten kamen. Er wurde nach Österreich gebracht und zu Wiener Neustadt in Gewahrsam gehalten. In einem von dort am 22. Juli an den Kaiser gerichteten Schreiben bat er unter Einbekenntnis seiner »gröblichen« Handlung um Gnade, und um diese Zeit traf auch am kaiserlichen Hoflager zu Preßburg eine stattliche Gesandtschaft von deutschen Fürsten ein, darunter die Kurfürsten von Mainz und Pfalz, um für Johann Friedrich Fürbitte einzulegen und das von dessen Gemahlin Elisabeth dem Kaiser überreichte Gnadengesuch zu unterstützen. Doch hatte dieses Einschreiten der Reichsfürsten keinen Erfolg. Erst nach fünf Jahren erhielt seine treue Gattin die Erlaubnis, zum Herzog zu ziehen, und nach weiteren elf Jahren durfte dieser Ausfahrten unternehmen. Er hätte übrigens seine Freiheit erlangen können, wenn er, wie ihm vom Kaiser und vom Kurfürsten nahegelegt wurde, bereit gewesen wäre, auf die Regierung völlig zu verzichten und die mit seinen Söhnen getroffenen Vereinbarungen anzuerkennen. So ist er denn bis an sein Lebensende – er starb erst im Jahre 1595 – im Gefängnis geblieben. Allgemein wurde die Härte, mit der man gegen die Ächter und nicht zuletzt gegen den Herzog vorgegangen war, dem Kurfürsten August zur Last gelegt.
»Der Gothaische Handel« hat die öffentliche Meinung in Deutschland gewaltig aufgeregt. In zahlreichen Flugschriften wurde für und wider den gefangenen Herzog und den hingerichteten Ritter Grumbach Partei ergriffen. Die überwiegende Mehrzahl feierte Johann Friedrich als Opfer der »Pfaffen« und seinen Schützling als »theuren Helden«. Unter den gegen Kursachsen und den Kaiser gerichteten »Schmähschriften« nimmt die noch im Jahre 1567 zu Frankfurt gedruckte »Nachtigall«, die im achtzehnten Jahrhundert durch Lessing ans Licht gezogen werden sollte, den ersten Platz ein. Da man den Verfasser dieses »Schmähbüchleins« nicht erwischen konnte, wurde der Drucker, ein armer Geselle, gefangengesetzt. Der Kurfürst August verlangte sogar dessen Hinrichtung – so stark war die Furcht vor »neuen Empörungen«.
In der »Nachtigall«, die zur Versöhnung der Fürsten und des Kaisers und zum Zusammenhalten gegen Papst und Türken aufforderte, fehlte es nicht an zahlreichen Anspielungen gegen Maximilian und dessen religiöse Schwenkung. Da heißt es:
»Da du empfingest die gülden Kron,
Hastu das Evangelion
Zu schützen vielen zugesagt.
Denk, ob es denn auch Gott so behagt,
Wenn izt die Hur von Babylon
Gefördert wird durch deine Kron.«
Und warnend, auf das Schicksal seines kaiserlichen Oheims anspielend, wird weiter gesagt:
»Der Höchste sitzt in seinem Thron
Und hat für lengst gezelet schon
Die Tag und Stund des Szepters Dein,
Die Zeit, di ist hie kurz und klein.«
Die Grumbachische Verschwörung war glücklich niedergeschlagen worden – aber auf den Kaiser, der ebenso wie Kurfürst August in der ständigen Furcht vor neuen Empörungen und Kriegsgewerben lebte, übte sie eine tiefgehende, folgenschwere Wirkung aus: er hatte einen Abscheu vor jeder Bewegung, vor jeder Art von Rebellion bekommen. Beide, der Kaiser wie der Kurfürst, sind durchaus konservativ geworden, stehen in der Folge in einer innigen Schicksalsgemeinschaft fest zusammen zum Schutz der Reichsverfassung und des Friedens, im Gegensatz zum Pfälzer Kurfürsten Friedrich, dem entschlossenen Vertreter einer aktiven protestantischen Politik.
Diese vorsichtige, zaghafte Haltung Maximilians sollte sich gerade in dem Moment zeigen, als im Westen des Reiches eine Bewegung ausgebrochen war, die er vom dynastischen Standpunkt aus zu fördern alle Ursache gehabt hätte und die bald das ganze Reich in ihren Bann ziehen sollte – der Aufstand der Niederlande. Doch vorher soll von Maximilians dynastischer Politik die Rede sein.
Das Wort Kaiser Ferdinands, die Töchter müßten von den Fürsten dankbarer begrüßt werden als die Söhne, weil diese die Staaten zerteilten, jene aber Verschwägerungen und Freundschaften brächten, war für seinen ältesten Sohn sicherlich nicht umsonst gesprochen. Es darf als das Geleitwort für seine ausgedehnte Heiratspolitik gelten. Zum Glück verfügte er über eine genügende Zahl von Schwestern und Töchtern, um durch wertvolle Familienverbindungen seiner Hausmacht Stützen geben zu können.
Auch mit den zwei jüngeren Brüdern Maximilians hatte Ferdinand, ehe er zu der unglücklichen Teilung der Erblande schritt, weitausgreifende Pläne verfolgt, die dann vom Ältesten getreulich übernommen und weitergesponnen werden sollten. Wiederholt begegnet uns der Name des Erzherzogs Ferdinand. Allein gerade dieser Lieblingssohn des Kaisers, der auch als der eigentliche Urheber der »Länderauszeigung« bezeichnet werden darf, machte dem um die Größe seines Hauses unentwegt besorgten Vater einen Strich durch die Rechnung. Ohne ihn zu fragen, ließ sich der Erzherzog im Jahre 1557, als er in Augsburg weilte, mit der schönen, um zwei Jahre älteren Philippine Welser aus dem berühmten Patriziergeschlecht durch den Hofkaplan Cavallerii heimlich trauen. Als der Vater später davon erfuhr, geriet er in einen heftigen Zorn, der sich erst nach und nach legte, aber die Ehe mußte auf seine Anordnung hin geheim bleiben, und das Geheimnis wurde auch tatsächlich jahrelang gewahrt. Leicht fiel dies dem jungen Ehepaare nun freilich nicht und es mußte oft zu den merkwürdigsten, schier unmöglichen Mitteln greifen. So oft im Hause des Erzherzogs ein Kind zur Welt kam, nahm Tante Katharina von Roxan den neuen Ankömmling und legte ihn irgendwohin vor das Schloß, wo er dann von einem Diener gefunden und als angebliches Findelkind zur weiteren Erziehung aufgenommen wurde. Die Kinder – von vieren überlebten nur zwei die Eltern – durften das Prädikat »von Österreich« führen, waren aber nicht erbberechtigt.
Der Zweitälteste Ferdinand schied also bald von jeder Kombination aus – um so mehr konzentrierten sich alle Zukunftshoffnungen auf den Jüngsten, Erzherzog Karl. Gleich nach dem Tode der Königin Maria, der Gemahlin Philipps II., und der Thronbesteigung Elisabeths tritt der kaum neunzehnjährige Prinz, der sich durch ein gefälliges Äußeres und liebenswürdige Umgangsformen auszeichnete, als Brautwerber der um sechs Jahre älteren Königin auf, allerdings mit einer ganzen Reihe anderer fürstlicher Persönlichkeiten. Denn die junge Beherrscherin des Inselreiches durfte sich rühmen, die »begehrteste Partie der Christenheit« zu sein. Die mächtigsten Könige bewarben sich um ihre Hand und die »jungfräuliche« Königin verstand es meisterhaft, mehrere Eisen gleichzeitig im Feuer zu halten, einen Freier gegen den andern auszuspielen und aus diesem Wettbewerbe für das englische Reich Kapital zu schlagen. Als Frau wie als Königin mag es ihr geschmeichelt haben, durch ihre Liebesintrigen die diplomatische Welt jahrelang in Spannung zu setzen.
Es war sehr bezeichnend, was der spanische Gesandte Graf Feria in London seinem König, der auf die ketzerische Elisabeth nicht gut zu sprechen war, über die »Tochter des Satans« zu berichten wußte. »Ich könnte Eurer M?. nicht sagen, was diese Frau mit sich vorhat, und die sie am besten kennen, wissen es auch nicht.« Aus ihrer Abneigung gegen die Ehe machte sie niemals ein Hehl. Die Gesandten des Königs Karl IX. von Frankreich, der sich auch um sie bemühte, bekamen eine ganze Blütenlese von ehefeindlichen Aussprüchen zu hören. Zu Foix sagte sie, wenn sie ans Heiraten denke, so sei es ihr, als ob man ihr das Herz aus dem Leibe reiße. Einem andern, La Mothe, gestand sie, der Zwang der Kerkerhaft, die sie im Tower – sie war von ihrer katholischen Schwester Maria als Staatsgefangene behandelt worden – auszustehen hatte, sei geringer gewesen als der, dem sie sich nun mit ihrem Entschluß, zu heiraten, unterzogen habe. Allein, wenn sie auch dieser Entschluß schwer ankam, so wollte sie doch, wie sie gleichfalls freimütig einzubekennen pflegte, ihre innerste Neigung vor dem oftmals dringend ausgesprochenen Wunsche des englischen Volkes zurückstellen. Dieses Verlangen der Engländer, ihre Königin verheiratet zu sehen, war allerdings eine Tatsache und so bekannt, daß Elisabeth immer wieder Freier fand. Der letzte Botschafter König Philipps II., Graf Mendoza, konnte das geflügelte Wort prägen: »Die Königin verlobe sich jedes Jahr, heirate nie.«
Mit Recht ist betont worden, daß die Heiratsverhandlungen die große Königin als die »Falschheit selbst« erscheinen ließen. Deutlich tritt dieser Charakterzug, der aber dem ganzen, im Zeichen Machiavellis stehenden Zeitalter anhaftet, in jenen Verhandlungen zutage, die nahezu zehn Jahre zwischen den Kabinetten von London und von Wien geführt wurden, um ihre Vermählung mit Erzherzog Karl zustande zu bringen.
Es war die Königin Elisabeth selbst, die durch ihren Gesandten Sir Thomas Challoner die erste Anregung dazu gab und in vielversprechender Weise erklären ließ, lieber des Erzherzogs »Hosen und Wamms« annehmen zu wollen als König Philipp II. Der hatte nämlich, vor die Wahl gestellt, den infolge des Todes seiner englischen Gemahlin verlorengegangenen Einfluß Spaniens durch einen Krieg oder durch eine Ehe sicherzustellen, den letzteren Weg gewählt und war als Freier seiner Schwägerin aufgetreten. Kaiser Ferdinand, der die Absicht seines spanischen Neffen nicht durchkreuzen wollte, verhielt sich zunächst abwartend. Erst als Philipp, im Februar 1559, eine nicht mißzuverstehende Absage erhalten hatte, trat der Wiener Hof dem Vermählungsplane näher. Er entschloß sich, den Edelmann Kaspar von Breuner nach London zu senden, um in vorsichtiger Weise die Absichten der Königin und die Stimmung ihres Hofes auszukundschaften.
Der kaiserliche Gesandte langte im Mai in London an und bekam auf sein erstes Anklopfen von der Königin einen wenig aussichtsvollen Bescheid. »Bisher habe ich«, erklärte sie offen, »das ehelose Leben so angenehm befunden und mich so sehr daran gewöhnt, daß ich viel lieber wollte im Kloster leben oder den Tod erleiden, als wider meinen Willen eine Ehe eingehen.« Breuner stutzte; es fiel ihm auf, daß der Kaiser anfänglich auch den älteren Bruder Erzherzog Ferdinand in Aussicht genommen hatte. Möglicherweise hegte also Elisabeth die Besorgnis, man wolle ihr an Stelle des jüngeren Habsburgerprinzen, der damals im Rufe stand, gleich Maximilian der neuen Lehre nicht unfreundlich gesinnt zu sein, in Ferdinand einen strengen Katholiken, als der er bereits galt, zum Gemahl geben, der dann in England die Rolle seines abgewiesenen Vetters Philipp II. von Spanien gespielt hätte. So versicherte denn Breuner der Königin, daß ausschließlich von Karl die Rede sei, worauf Elisabeth förmlich aufatmend bemerkte: »Ich habe mich getäuscht!« Jetzt wurde die Königin wohl etwas wärmer und zugänglicher, aber sie stellte doch das Verlangen, den Erzherzog früher kennenzulernen, bevor man weiter verhandle. »Lieber will ich«, meinte sie, »Nonne werden, als mich mit einem Manne vermählen, den ich nie gesehen. Den Malern traue ich nicht und bin entschlossen, nur einen tüchtigen Mann zu heiraten, den ich vorher gesehen und gesprochen.« Ihr schwebte dabei, wie sie nach Jahren einem Amtsnachfolger Breuners erklären sollte, als warnendes Beispiel ihr Schwager Philipp vor Augen, der nach seiner ersten Begegnung mit Königin Maria den Malern »geflucht« hatte.

Erzherzog Ferdinand von Tirol
Besser gestaltete sich die Situation, als im Juli infolge des Ablebens Heinrichs II. Elisabeths Nebenbuhlerin Maria Stuart auf den französischen Königsthron kam und die Gefahr, daß die Königin von Schottland mit Hilfe Frankreichs Ansprüche auf die Krone Englands erheben könnte, in bedrohliche Nähe gerückt schien. »Ich fürchte,« so äußerte sie sich jetzt resigniert, »daß ich mein Gemüt verändern und werde heiraten müssen.« Besonders aber Elisabeths nächste Umgebung ließ es an Aufmunterungen aller Art nicht fehlen. Lady Sidney, die Schwester des Grafen Leicester, des ersten Günstlings der Königin, gab dem Gesandten den wohlgemeinten Rat, um deren Antworten sich nicht viel zu kümmern, sondern flott weiter zu verhandeln; denn »in England sei es üblich, daß sich die Frauen bis zum letzten Moment nicht entschließen könnten«. Der Gesandte ließ also geduldig alle Ausbrüche der rasch wechselnden Stimmungen Elisabeths über sich ergehen. Bald hörte er aus ihrem Munde, daß sie überhaupt nicht heiraten werde; bald spielte sie die Gekränkte und stellte die Sache so hin, als ob der Kaiser nicht ernstlich verhandeln wolle. »Lieber will ich hundertmal sterben, als selbst den Erzherzog begehren; das ziemt einer jungfräulichen Königin nicht.« Ein anderes Mal wieder schien sie sich vollständig in den Gedanken, die Gemahlin des Erzherzogs zu werden, eingelebt zu haben; sie ließ über ihrem Bette Karls Bild aufhängen und Erkundigungen über dessen Alter, Natur, »Fettigkeit« und Liebesabenteuer einziehen. Aber immer kam sie auf ihre Forderung zurück, den Erzherzog erst zu sehen, bevor man weiter rede.
Breuner sowohl wie Graf Helfenstein, der jenem an den englischen Hof nachgeschickt wurde, unterstützten Elisabeths Verlangen in ihren Berichten, indem sie dabei durchblicken ließen, daß die Anwesenheit Erzherzog Karls alle Schwierigkeiten mit einem Schlage beseitigen würde; allein Kaiser Ferdinand traute der Engländerin nicht. Er bestand darauf, daß alle Heiratsbedingungen bereinigt sein müßten, bevor der Prinz nach London käme – eine Vorsicht, die, wie sich später herausstellen sollte, nur zu berechtigt war –, und so schied Helfenstein im Mai 1560 vom englischen Hofe, ohne etwas ausgerichtet zu haben.
Der Plan einer englisch-österreichischen Vermählung schien abgetan zu sein; am Wiener Hofe begann man sich für die Heirat des Erzherzogs mit Maria Stuart zu interessieren. Diese war nach dem Tode ihres französischen Gemahls Franz II. – die Ehe hatte nur ein Jahr gewährt – im August 1561 in ihre schottische Heimat zurückgekehrt. Auch ihr, der damals neunzehnjährigen bildhübschen Witwe, fehlte es nicht an Bewerbern. Da waren, um nur einige zu nennen, Friedrich II. von Dänemark und dessen Gegner Erich von Schweden, Herzog Alfonso II. von Ferrara und der Herzog von Nemours, ohne daß man sagen könnte, daß einer davon besondere Aussichten gehabt hätte. Aber schon im Jahre 1560, als sich Maria Stuart noch in Frankreich aufhielt, tauchte in Rom der Plan auf, den Kaisersohn mit ihr zu vermählen. Die Schottenkönigin, eine Urenkelin des Tudor Heinrich VII., besaß ja auch Ansprüche auf die englische Königskrone, und so winkte die Aussicht, die ganze britische Halbinsel in das katholische Weltsystem zu spannen.
Die Sache schien jedenfalls von größter Bedeutung. Alle Katholiken, so schreibt am 18. April 1562 Nikolaus von Pollweiler dem Kaiser, möchten die Heirat mit Erzherzog Karl gerne gefördert sehen; denn sie hoffen, dadurch würden die beiden Königreiche England und Schottland wiederum zum katholischen Glauben gebracht werden. Die Neugläubigen dagegen widersetzten sich aus diesem Grunde »mit allem Vermögen« dem schottischen Eheprojekt, und der Herzog Christoph von Württemberg neben anderen hätte deshalb der englischen Königin geraten, sie möge die kaiserliche Majestät »dahin persuadieren, daß dieselb den engelländischen Heyrat wiederumb zu tractieren an die Hand nehme«, und dies in der Absicht, der Schottenkönigin, wenn sie davon erfahre, den Handel zu verleiden.
Pollweiler war vom Kaiser nach Nancy geschickt worden, um die mächtigen Herzöge von Guise, die Oheime Maria Stuarts, denen ein großer Einfluß auf sie nachgesagt wurde, für den Eheplan zu gewinnen. Allein die Antwort, die der Gesandte erhielt, lautete nicht sehr befriedigend. Die Königin allein, so wurde ihm erklärt, habe über ihre Hand zu verfügen; der Grund für diesen ausweichenden Bescheid war der, daß die Guisen damals einen anderen Heiratskandidaten im Auge hatten – Don Carlos.
Der Sohn Philipps II. von Spanien bot für die Verwirklichung der großen Idee, England für den katholischen Glauben zurückzugewinnen, einen ungleich mächtigeren Rückhalt als der Wiener Hof, und die Verbindung mit dem Erben des spanischen Weltreiches war auch der Wunsch Maria Stuarts. Der Erzherzog war ihr politisch zu unbedeutend. Er sei, erklärte sie, »fremd ihrem Land, arm und entfernt daheim, der jüngste unter den Brüdern, ihrem Volk nicht genehm und ohne Mittel und Kräfte, ihr zu den Rechten auf der Insel zu verhelfen«. Wollte sie schon mit ihren Untertanen – sie meinte die Kalviner – eines Gemahls wegen in Zwist geraten, dann sollte es jemand sein, der jene zu zügeln imstande wäre; aber dazu habe der Österreicher nicht die Gewalt. In Frankreich war ihr überdies eine Abneigung gegen alles deutsche Wesen eingepflanzt worden.
So entschloß sie sich denn, durch Mittelspersonen auf König Philipp dahin einzuwirken, daß er zur Heirat mit Don Carlos seine Zustimmung gebe, und der Erfolg war auch der, daß durch den spanischen Gesandten in London insgeheim Verhandlungen eingeleitet wurden. Es kümmerte den König nicht, daß er damit die Pläne des Wiener Hofes, über die ihn dieser unterrichtet hatte, durchkreuzte – es war nicht das erstemal, daß sich die deutschen und die spanischen Habsburger auf ihren politischen Bahnen feindlich begegneten. Er kenne, schrieb Philipp am 15. Juni 1563 seinem Gesandten, Marias geringe Neigung zur Ehe mit dem Erzherzog, während dem Kaiser, der nur mit dem Kardinal von Lothringen verhandelt habe, ihre wahre Absicht verborgen bliebe.
Karl von Guise, Kardinal von Lothringen, hatte nämlich mittlerweile den Gedanken eines Ehebündnisses mit Don Carlos aufgegeben und das mit Erzherzog Karl gefördert. Damals, als er für den Infanten eintrat, war der mächtige Führer der französischen Katholiken mit samt seinem Bruder Herzog Franz von der Königin-Mutter Katharina von Medici, die durch das Edikt von St. Germain im Januar 1562 mit den Hugenotten Frieden gemacht hatte, kaltgestellt worden. Er durfte somit jenen Plan verfolgen, der in seiner Auswirkung für Frankreich geradezu katastrophal werden konnte, sobald es dem rivalisierenden Spanien gelungen wäre, durch die neue Stellung in Schottland und England seine Macht in so ungeheurem Maße zu erweitern. Als aber schon im nächsten Jahre mit dem von Seite der Guisen veranstalteten Blutbad von Vassy der Bruch mit den Hugenotten erfolgte und der Kardinal seinen Einfluß am Pariser Hofe zurückerlangt hatte, arbeitete er nun mit dem gleichen Eifer, mit dem er sich ehedem für Don Carlos eingesetzt hatte, zugunsten des deutschen Prinzen. Im Februar 1563 besuchte er Kaiser Ferdinand in Innsbruck. Neben den brennenden Konzilsfragen wurde hier auch über die Ehe seiner Nichte gesprochen, und der Kardinal trat dabei mit einer solchen Sicherheit auf, wußte dem Kaiser so viel Schönes über den innigen Wunsch seiner Familie, Maria Stuart mit dem Wiener Hofe verbunden zu sehen, zu erzählen, daß Ferdinand unter dem frischen Eindrucke dieser Unterredung schrieb: »Er achte für gewiß, daß die Heirat mit Gottes Hilfe geschlossen werde.«
Allein der Kardinal hatte seine verlockenden Anträge ohne Wissen und Zustimmung der Schottenkönigin gemacht, und als er dann nachträglich seinen Kämmerer Du Croc an den Hof von Edinburg schickte, um sich das Jawort zu holen, erhielt er eine Antwort, die ihn, wie der spanische Gesandte am Kaiserhofe berichtete, völlig »perplex« machte. Denn seine Nichte erklärte ihm in gewundenen Worten, sie müsse erst die Stände des Landes befragen und zu diesem Zwecke genau wissen, wie der Kaiser seinen Sohn auszustatten beabsichtige und auch ob er sich für die Zustimmung der Könige von Spanien und von Frankreich verbürgen könne. Doch der Kardinal gab seine Sache noch nicht verloren. Der Bescheid Maria Stuarts wurde dem Kaiser übermittelt, durch den ihm nun am 2. August 1563 in aller Form kundgetan wurde, daß er seinem Sohne die Herzogtümer Steiermark, Kärnten, Krain und die Grafschaft Görz und außerdem noch jährlich hunderttausend Gulden zu geben gedenke.
Maria Stuart aber wollte von der Heirat mit dem Erzherzog absolut nichts wissen. Auch nicht, als in einer Sitzung des spanischen Staatsrates vom 18. November 1563 – von ihr soll noch später die Rede sein – die Eheverbindung mit Schottland wegen der »eigentümlichen Disposition« des Infanten abgelehnt wurde. Maria war von dieser Nachricht, wie der englische Geschäftsträger Randolph seinem Minister Cecil meldete, tief erschüttert und hatte zwei Monate hindurch Anfälle von Melancholie. Aber sie gab sich noch immer der Hoffnung hin, der spanische König werde seinen Entschluß ändern. Und der Kardinal, der doch genau davon unterrichtet war, daß seine Nichte vom Erzherzog nichts hören wolle, schrieb noch im selben Monat November aus Trient dem Kaiser, er erwarte stündlich die Vollmacht aus Schottland, wo die Königin und ihre Untertanen der Heirat mit dem Erzherzog vortrefflich gesinnt und geneigt seien. Der alte Kaiser glaubte diese »dreiste« Lüge und schlug dem Kardinal eine Zusammenkunft im nächsten Mai vor, »bis wohin wohl«, wie er meinte, »die entscheidende Erklärung der Königin eingelangt, die Angelegenheit nach beider Absicht geordnet sein werde«. Diese Entscheidung kam natürlich nicht, und Maria heiratete später einen schottischen Adligen, den hübschen Henry Darnley; aber Ferdinand scheint bis an sein Lebensende an das Gelingen dieses großen Planes geglaubt zu haben.
Maximilian knüpfte nun, kaum daß er den Thron seines Vaters bestiegen hatte, wieder mit der englischen Königin an. Auch in der Zwischenzeit hatten die Verhandlungen mit dem Londoner Hofe nicht gänzlich geruht. Der Kaiser erhielt aus der nächsten Umgebung Elisabeths ermunternde Winke, und so entschloß er sich denn, die Gelegenheit, da er die englischen Ordensinsignien des verstorbenen Kaisers durch einen Gesandten zurückstellen ließ, dazu zu benützen, um die Aussichten für seinen Bruder zu ergründen. Mit dieser heiklen Mission betraute er den Präsidenten der Hofkammer Adam von Swetkowycz, wie der »unaussprechliche« Gesandte in Wirklichkeit hieß, dessen Name in den zeitgenössischen Berichten die merkwürdigsten Veränderungen sich gefallen lassen mußte, wie Smerkowitz, Smerkowich, Schmerckerwitz, Smekewitz, Smechevitz, Smestrewitz, Schmeckowitz und Sinequewitz. Swetkowycz erhielt auch den Auftrag, sich über den sittlichen Lebenswandel der »jungfräulichen« Königin, über den verschiedenes gemunkelt wurde, zu informieren. Breuner hatte zwar seinerzeit in ihren Beziehungen zum Grafen Leicester nichts Bedenkliches gefunden. »Es sei eine Lieb,« berichtete er dem verstorbenen Kaiser, »wie sie etwa bisweilen zwischen zwei Jungfrauen oder Junggesellen« bestehe. Es scheint aber, daß man am Kaiserhofe doch nicht so ganz darüber beruhigt war.
Der kaiserliche Gesandte traf Anfang Mai am englischen Königshofe ein und fand, als er gegen Ende dieses Monats von Elisabeth empfangen wurde, nicht gerade die beste Aufnahme. Sie drehte den Spieß um und machte dem Wiener Hofe den Vorwurf, daß die Eheverhandlungen nicht mit dem nötigen Ernst betrieben worden seien. Ursprünglich sei von Erzherzog Ferdinand die Rede gewesen und später habe man ihr seinen jüngeren Bruder Karl genannt, der sich dann mit ihrer Base Maria Stuart in Verhandlungen eingelassen hätte. Weil nun Karl so lange Zeit vollständig geschwiegen, sei sie in der Meinung, »er habe sie nicht lieb«, mit einem anderen Fürsten – sie nannte keinen Namen, aber der Gesandte konnte erraten, daß es der französische König war – in Unterhandlung getreten und müsse nun erst dessen Angebot abwarten, bevor sie die Werbung des Erzherzogs in Erwägung ziehen könne. Auf des Gesandten Frage, ob jener Fürst König Karl IX. sei, dessen Antwort mit Rücksicht auf seine Jugend noch Jahre ausstehen könne, antwortete sie unverfroren, daß sie bloß ein Jahr zu warten gewillt sei.
Swetkowycz wollte daraufhin seinen Abschied nehmen. Allein die Königin »schwor« ihm, sie sei noch keineswegs gebunden und ihr Bescheid nicht als Absage zu betrachten; und während er noch überlegte, was er tun solle, wurde ihm von den ersten Räten und Hofleuten zugesetzt, die Sache nicht verlorenzugeben. Graf Sussex versicherte dem Gesandten, daß das ganze Land die eheliche Verbindung mit dem Hause Habsburg freudig begrüßen würde. Der König von Frankreich hätte schon wegen seines jugendlichen Alters gar keine Aussichten; denn jetzt sei er noch zu jung, um einen Erben erwarten zu lassen, und später, wenn er zu Jahren gekommen, würde er vielleicht die alternde Königin verlassen, um in seinem Stammland »auf französisch mit schönen Maidlein« zu leben, und nach Elisabeths Tode England durch einen Vizekönig verwalten lassen. Die Königin werde es sich sehr überlegen, das Haus Österreich sich zum Feinde zu machen, und den Erzherzog, den das Land »so hoch begehre«, gewiß auch ihrerseits »gar lieb« aufnehmen.
Der Gesandte entschloß sich auf allgemeines Zureden hin zu bleiben, und als er nach einer Weile wieder zur Königin ging, empfing sie ihn gleich mit der Erklärung, sie willige aus Liebe zum Land in die Heirat mit dem Erzherzog. Als Swetkowycz meinte, sie werde dies gewiß nicht bereuen, denn die »Herren von Österreich« hätten sich stets als gute Ehemänner erwiesen, erwiderte Elisabeth, sie habe von der großen Liebe des verstorbenen Kaisers zu seiner Gemahlin Anna gehört und erwarte das gleiche von dessen jüngstem Sohne. Sie erkundigte sich dann angelegentlich nach dem Aussehen des Erzherzogs und sagte, indem sie auf eine ihrer Hofdamen hinwies, ganz traurig zum Gesandten, sie werde sich nun von dieser, die von Jugend an stets in ihrer Kammer geschlafen, trennen müssen. Wegen der Mitbewerbung des französischen Königs erhielt Swetkowycz die beruhigendsten Versicherungen. Dieser könnte infolge des großen Altersunterschiedes wie seines Äußeren dem Erzherzog nicht gefährlich werden. Elisabeth erzählte ihm gelegentlich, daß auch ihr »einfältiger Narr« dem Österreicher vor jenem »Buben« den Vorzug gegeben habe, und als der Gesandte darauf das Sprichwort erwähnte: »Kinder und Narren sprechen die Wahrheit«, lächelte sie bedeutungsvoll.
Swetkowycz hatte allerdings noch das Bedenken, ob die Königin überhaupt einen auswärtigen Fürsten zum Gemahl nehmen werde und nicht vielmehr den Grafen Leicester. Aber auch in diesem heiklen und entscheidenden Punkte wurde er von seinem Gewährsmann, dem Grafen Sussex, vollkommen beruhigt. Leicester selber, sagte er, unterstütze angelegentlichst das österreichische Vermählungsprojekt. Über die »jungfräuliche Ehre und Ehrbarkeit« der Königin erfuhr Swetkowycz nichts Nachteiliges. Ähnlich wie Breuner berichtete auch er dem Kaiser, daß »sie mit Leicester so verkehre wie Bruder und Schwester«.
Nachdem so der kaiserliche Gesandte die Überzeugung gewonnen hatte, daß die Werbung Erzherzog Karls von der Königin und der Bevölkerung nicht ungünstig würde aufgenommen werden, machte er ganz offiziell, mit Vorwissen Elisabeths und ihres Kabinetts, dem Kaiser Maximilian den Vorschlag, Karl nach England kommen zu lassen, und zwar »incognito«, in der Weise, daß zwei Gesandte herreisten, von welchen der eine der Erzherzog selber wäre. Wolle er aber das größere Risiko auf sich nehmen, dann möge er allein bei Hofe erscheinen. Der Gesandte verfehlte nicht, dem Erzherzog einige Winke für seinen Besuch in England zu geben. Er möge sich recht »fein und zierlich« kleiden, auch sich »parfümieren«, denn darauf lege die Königin großen Wert. Auch wäre es gut, wenn er sich als ein flotter Reiter präsentiere. Er riet dem Erzherzog weiter, der Königin ansehnliche Geschenke, wie ein halbes Dutzend türkischer Zelter, zu schicken und den »liebhabenden Galan« auch dadurch zu spielen, daß er ihr ein »liebes Buhlbrieferl«, eigenhändig und »in wälscher Sprache«, schreibe. Denn das Fehlen eines solchen, fügte der Gesandte hinzu, habe ihm seine Mission ungemein erschwert. Swetkowycz überschickte mit seinem ausführlichen Bericht – er ist vom 4. Juni datiert – auch die Heiratsartikel, die ihm auf Befehl der Königin am vorletzten Mai eingehändigt worden waren.
Kaiser Maximilian war von dem Erfolge seines Gesandten nicht sehr erbaut. Er fand die ganze Angelegenheit in hohem Grade »bedenklich und zweifelhaft«. Über einen Punkt war man sich am Wiener Hofe von allem Anfang an im klaren: der Erzherzog mußte mit Rücksicht auf das Ansehen und die Stellung des Hauses Österreich erst die nötigen Garantien haben, daß seine Werbung auch wirklich angenommen würde, bevor er die von ihm verlangte Reise nach London antrat. Aus diesem Grunde bestand der Kaiser darauf, daß zunächst wenigstens über die Ehebedingungen ein volles Einverständnis erzielt werde, um der Gefahr zu entgehen, daß der Erzherzog bloß deshalb unverrichteter Dinge werde heimziehen müssen, weil man sich über den Heiratsvertrag nicht einigen konnte.
Eine solche Vorsicht war um so gebotener, als die vom englischen Kabinett zusammengestellten Eheartikel von vornherein einiges Befremden erregten und weiterer Aufklärung bedurften. So hatte man vom Erzherzog verlangt, er solle die Kosten für sich und seinen Hofstaat aus eigenen Mitteln, nicht aus den Einkünften des englischen Königreiches bestreiten. Über die staatsrechtliche Stellung des künftigen Prinzgemahls war gar nichts gesagt, und doch hätte man am Kaiserhofe gern gewußt, ob Karl Titel und Würde eines Königs erhalten würde; denn man fand es mit dem Ansehen des Erzhauses unvereinbar, wenn er bloß eine »Statue oder Schatten« dargestellt hätte. Auch darüber hatte man sich englischerseits ausgeschwiegen, was zu geschehen habe, wenn Elisabeth ohne Leibeserben früher stürbe als ihr Gemahl. Man bezeichnete es als unhonorig, daß in diesem Falle Karl mit der Gattin auch das Reich einbüßen sollte. Vor allem aber war es der erste Punkt, der einer Erläuterung bedurfte. Derselbe lautete: »Erstlich sollen des Königreiches Gesetze und Gebräuche erhalten und weder in Religionssachen noch in den Reichsordnungen irgendwelche Veränderungen vorgenommen werden.« Dies klang für den ersten Moment sehr harmlos; aber gerade hier lag der Keim eines grundsätzlichen Gegensatzes, über den man vielleicht nicht hinwegkommen konnte, weil er der ganzen Zeit und ihren Kämpfen das Gepräge gab – den Religionsunterschied. Nach den englischen Landesgesetzen war die Ausübung des katholischen Kults verboten. Sollte der Prinzgemahl auf sie verzichten? Diese und andere Fragen mußten erst in befriedigender Weise beantwortet sein, bevor Maximilian seine Zustimmung zur Reise Erzherzog Karls an den englischen Königshof zu geben bereit war, und dann sollte er nicht heimlich, sondern offiziell hinfahren.
Die kaiserliche Resolution, die am 18. Juli nach London kam, erregte am Hofe der Königin großes Mißfallen. Ihr war die Möglichkeit genommen, durch den Zauber ihrer Persönlichkeit die religiösen Bedenken des kaiserlichen Prinzen zum Schweigen zu bringen und ihn, der noch vor Jahren, wie es hieß, der neuen Lehre keineswegs schroff gegenübergestanden, gänzlich für sie zu gewinnen; sie war auch um den Triumph gekommen, einen Prinzen des Erzhauses persönlich abweisen zu können. Als Swetkowycz nach dem Eintreffen des kaiserlichen Kuriers seine erste Audienz erhalten hatte, erkannte er alsbald, daß die Verhandlungen an einem toten Punkt angelangt waren. »Unmöglich können«, erklärte Elisabeth mit Nachdruck, »zwei Personen mit zweierlei Religionen in einem Hause friedlich und göttlich wohnen.« Sie hatte, wie sie Swetkowycz offen gestand, seinerzeit, als Breuner mit ihr den Religionspunkt besprach, den Eindruck gewonnen, der jugendliche Prinz – er war damals im Jahre 1559 neunzehn Jahre alt – werde sich bekehren lassen. Mitte August nahm Swetkowycz seinen Abschied – »Gott lob«, wie er seinem vor der Abreise erstatteten Bericht an den Kaiser hinzufügte.

Königin Elisabeth von England
Erzherzog Karl, der seine religiösen Anschauungen mittlerweile nach der strengen Richtung gewandelt hatte, war indes nicht gesonnen, auf die öffentliche Ausübung der katholischen Religion zu verzichten. Im äußersten Falle hätte er sich damit abgefunden, den Gottesdienst für sich und seinen Hofstaat privat, in einer »geschlossenen Kammer«, zu empfangen. Die Verhandlungen schleppten sich noch zwei volle Jahre weiter. Als anfangs August 1567 Graf Sussex mit einem großen Gefolge von fünfunddreißig Personen nach Wien gekommen war, um dem Kaiser im Auftrage der englischen Königin den Hosenbandorden zu überreichen, verweilte er nicht weniger als sechs Monate am Wiener Hofe, und es schien eine Zeitlang, als ob man sich in den strittigen Punkten und vor allem in dem »wichtigsten«, der Religionsfrage, nähern wollte. Der Kaiser schlug Elisabeth einen »Mittelweg« in der Form vor, daß der Erzherzog unverwehrt für sich und den Hofstaat, mit Ausschluß der englischen Katholiken, den katholischen Gottesdienst hätte ausüben dürfen. Doch die Königin lehnte in ihrem Schreiben vom 10. Dezember 1567 den Vorschlag unter Hinweis auf die »Ruhe ihres Gewissens« und die Erhaltung des »Friedens« im Königreich ab, worauf Graf Sussex am 18. Januar 1568 glatt den Bescheid erhielt, daß der Erzherzog nicht nach England reisen werde.
Am Kaiserhofe mag man über den negativen Verlauf der Heiratshandlung nicht übermäßig überrascht und betroffen gewesen sein; denn man hatte hier die Aussichten von allem Anfang an nicht sehr hoch eingeschätzt. Wiederholt äußerte sich der Kaiser in vertraulichen Briefen, daß es der »unbeständigen« Königin nur um den »Schein« zu tun sei und sie absichtlich so »unbillige« Bedingungen stelle, um die Verhandlungen, die nur zur Beschwichtigung ihrer Untertanen dienten, zum Scheitern zu bringen. Der erste Minister des Kaisers, der Vizekanzler Zasius, drückte sich etwas schärfer aus. An des Erzherzogs Stelle, meinte er am 16. August 1567 in einem Schreiben an den Bayernherzog Albrecht, würde er sich mit der »teuffelischen Engelleserin« nicht einlassen, und wenn sie gleich »noch zehn Königreiche« hätte.
Bei dieser Stimmung in Wien war es ganz überflüssig, wenn Herzog Albrecht seinem kaiserlichen Schwager die Mahnung zukommen ließ, vor den »verriebenen seltsamen Leuten« gut auf der Hut zu sein, damit der »gute, fromme junge Herr nicht auf ein Eis geführt« werde. Am Kaiserhofe verspürte man nicht die geringste Lust mehr, den englischen Vermählungsplan weiterzuspinnen.
Erzherzog Karl führte dann sechs Jahre später, im August 1571, die Prinzessin Maria, die Tochter des bayerischen Herzogs Albrecht, heim. Sie sollte ihm den späteren Kaiser Ferdinand II., mit dessen Namen die gewaltsame Durchführung der katholischen Gegenreformation verknüpft erscheint, schenken. Wie ganz anders würde sich die Entwicklung in Deutschland und in Österreich vollzogen haben, wenn der »fremden Einflüssen nicht abgeneigte« Erzherzog die protestantische Elisabeth geheiratet hätte!
Dem englischen und dem schottischen Heiratsprojekt des Wiener Hofes war also kein Erfolg beschieden – vielleicht hatte er bei den weiblichen Mitgliedern des Kaiserhauses größeres Glück …
Bei der großen Familienzusammenkunft der Habsburger, die im Sommer 1556 zu Brüssel stattgefunden, war, wie schon erwähnt, auch eine Heiratsverbindung der zwei ältesten Töchter Maximilians, Anna und Elisabeth, besprochen worden: die ältere, Anna, sollte mit Don Carlos, und die jüngere, Elisabeth, mit Karl von Orléans vermählt werden. Die Heiratsabrede stand im Zeichen des Waffenstillstandes von Vaucelles. Als sich dann aber die politischen Beziehungen zwischen Frankreich und Spanien wieder trübten, bemühte man sich in Madrid, die Hand der Erzherzogin Elisabeth für den jungen König Sebastian von Portugal, den Sohn der Prinzessin Johanna, einer Schwester Philipps II., zu gewinnen.
Umgekehrt suchte der französische Königshof mit allen Mitteln eine engere Verbindung des Wiener Hofes mit Spanien zu hintertreiben. Wiederholt ließ die Königin-Mutter Katharina von Medici durch ihre Gesandten ein Ehebündnis ihres Sohnes Karl, der mittlerweile König geworden war, mit einer der beiden ältesten Kaisertöchter anregen. Als dann der Kardinal von Lothringen im Februar 1563 mit Kaiser Ferdinand in Innsbruck zusammenkam, um sich mit ihm über die Konzilsfrage zu besprechen, hatte er ein ganzes Bündel von Heiratsprojekten mitgebracht. Neben der hier schon erwähnten Heirat Erzherzog Karls mit Maria Stuart schlug er wieder eine eheliche Verbindung des Königs mit einer der Töchter Maximilians vor, und zwar womöglich mit der ältesten, Anna, dann eine solche Erzherzog Rudolfs mit Margarete von Valois, der Schwester Karls IX.
Indes, schon war es Philipp II. gelungen, den Kaiserhof stärker an Spanien zu binden. Maximilian hatte sich entschlossen, der Einladung des Königs folgend, seine beiden ältesten Söhne Rudolf und Ernst nach Madrid zu senden. Der König wollte auch, daß Elisabeth mitkomme, um ebenfalls in Spanien erzogen zu werden; doch dies lehnte sein deutscher Vetter ab, da er nicht gewillt war, die Brücken zum Pariser Hofe gänzlich abzubrechen. Immer hoffte er noch mit Hilfe einer engeren Verbindung mit Frankreich zwei alte dringende Wünsche befriedigt zu sehen. Einmal sollte durch Vermittlung des allerchristlichsten Königs der türkische Erbfeind zur Ruhe gebracht und dann die Rückgabe der dem Reiche entzogenen Bistümer Metz, Toul und Verdun erfolgen.
Für den Kaiser ergab sich unter solchen Umständen, da er von beiden Teilen, von Spanien wie von Frankreich, eifrig umworben wurde, politisch eine überaus günstige Situation, die er im entscheidenden Moment auszunützen imstande war. Sein Gesandter Adam von Dietrichstein zeigte für diese geradezu ideale Stellung, da die rivalisierenden Mächte um die Gunst des Kaisers buhlten, aber auch für die Gefahren einer solchen Politik der Neutralität, bei der man zwischen zwei Stühle zu sitzen kommen konnte, das richtige Verständnis. »Beide Könige«, so schreibt er am 26. Dezember 1565 Maximilian aus Madrid, »trachten Eure Mt. auf ihre Seite zu bringen und lassen sich dunken, welcher es vollenden werde, der hab sein Sachen zum besten versichert. Ob nun Eure Mt. lieber die Neutralitet bei beiden erhalten oder ainen aus inen derselbigen obligieren will, stet zu Eurer Kays. Mt. gnädigstem Bedenken. Neutralitas ut plurimum male tuta et semper partibus suspecta est, werden zu beiden Tailen Eure Mt. dest weniger obligiert sein. Entgegen da Eure Mt. sich an ainem hengen und den anderen ausschließen, so haben sie schon von stund an an dem andern ain gewissen Feint. Des aber wol zu erwägen, ob soliche Freundschafft Euer Mt. mer Nutzen alls des anderen Feindschaft schaden möge, und ob es besser, an baiden ungewisse Freundt, alls ainen zu gewissen Feint zu haben. Eure Mt. seint hietz die Praut, darumben beide Khunig werben.«
Aber der spanische Brautwerber trat immer stürmischer und heftiger am Kaiserhofe auf. Sooft Philipps Gesandter Thomas Perrenot von Chantonnay, der im Herbst 1564 mit dem strikten Auftrag nach Wien gekommen war, auf jede Weise das Zustandekommen der französischen Heirat zu verhindern, von einer Werbung König Karls hörte, setzte er sofort Maximilian das Messer an die Brust, indem er ihn an die Verpflichtung erinnerte, im habsburgischen Gesamtinteresse »brüderlich« zusammenzustehen, was soviel hieß wie: daß sein königlicher Herr, falls man in Wien dem französischen Wunsche nachkommen sollte, dem Kaiser recht unangenehm werden könnte. Und er hatte Erfolg.
Im Mai 1566, da wieder einmal im Namen des Franzosenkönigs der Gesandte Bischof Bôchetel von Rennes Maximilian zum Abschluß der Heirat drängte, erfolgte von Seite des Kaisers, der damals auf dem Reichstag in Augsburg weilte, eine nicht mißzuverstehende Absage. Maximilian entschuldigte sich zunächst, daß er den Bischof so lange auf eine Resolution habe warten lassen, doch hätte er mit Rücksicht auf sein »verwandtschaftliches und brüderliches« Verhältnis zum spanischen König und das gemeinsame Interesse vorerst dessen Meinung einholen müssen. Im Einverständnis mit Philipp erkläre er nun, daß er bereit sei, auf den Heiratsantrag Karls einzugehen, doch müsse er seine Zustimmung an drei Bedingungen knüpfen: vor allem wären die widerrechtlich besetzten Bistümer Metz, Toul und Verdun herauszugeben. Sodann hätte der König sofort »bona fide ac sine simulatione, expresse« seine Freundschaft mit dem Sultan zu »renunzieren« und sich gegen ihn mit dem Kaiser zu verbünden. Und endlich behalte sich Maximilian vor, daß er sich im Falle eines Konfliktes zwischen Frankreich und Spanien nicht als zur Neutralität verpflichtet betrachte, weil er gebunden sei, Philipp II. »in Freud und Leid« beizustehen.
Der französische Gesandte zeigte sich über die Antwort des Kaisers, die nach einem Aufschub von fast drei Jahren erfolgt sei, höchst »unangenehm überrascht« und verweigerte ihre Annahme. Die Restitution der Bistümer Metz, Toul und Verdun, erklärte er gereizt, habe mit der Heirat nichts zu tun. Er schloß mit der Drohung, daß sich sein königlicher Herr »anderswohin« verheiraten werde. So endete Frankreichs Liebeswerben mit einem schrillen Mißton, und daran änderte auch nichts, daß Kaiser Maximilian in einem sehr liebenswürdig gehaltenen Schreiben – es trägt das Datum vom 21. Mai – der Königin die Tatsache, daß ihr Gesandter seine Resolution zurückgewiesen habe, mitteilte und der Hoffnung Ausdruck gab, die Ehehandlung ihres Sohnes werde eine Fortsetzung finden.
In Paris schäumte man auf. Der Kaiser hatte sich, nicht einmal verblümt, für Spanien entschieden – das war der Eindruck, den seine Antwort an den Bischof von Rennes dort erweckte. Der französische Gesandte am spanischen Königshofe durfte in seinem Berichte vom 22. Juli die ironische Bemerkung machen: Die Heiratssache stehe auf dem alten Flecke; der Kaiser werde das tun, was der spanische König wolle, aber seine Resolution zeige große »Perplexité«, wie sie eben jemand habe, der »zwei Sehnen auf seinen Bogen gespannt zu haben glaubte«.
Gern hatte Kaiser Maximilian freilich nicht die Entscheidung gefällt; denn er mußte nun mit der Feindschaft der Franzosen rechnen, ohne völlig sicher zu sein, daß er an Spanien eine volle Stütze finden werde. Deutlich klingt ein solcher Zweifel an, wenn er dem spanischen Gesandten gelegentlich der Bekanntgabe seiner Resolution die Erwartung aussprach, König Philipp II. werde ihn wohl nicht im Stiche lassen. Er weigert sich auch, die von seinem Vetter verlangte offene Erklärung, daß er die Erzherzogin Elisabeth dem König Sebastian zur Frau geben wolle, dem spanischen Gesandten auszufolgen, um Frankreich nicht völlig vor den Kopf zu stoßen. Und schon gar nicht in der verzagten Stimmung, die ihn nach dem unglücklichen Ausgang des Türkenfeldzuges befallen hatte. Die Grumbach-Gothaische Verschwörung, die mit ihren Fäden auch nach Frankreich reichte, hatte seine Besorgnis verstärkt. Man sprach auch ganz ernstlich von König Karls Plan einer ehelichen Verbindung mit der Tochter des sächsischen Kurfürsten und seiner Absicht, sich zum römischen König wählen zu lassen.
Kein Wunder denn, daß Maximilian, der sich zudem in Spaniens werktätiger Hilfe immer aufs neue enttäuscht sah, auch nach dem Abbruch der Heiratshandlung bemüht war, die Fäden mit dem Pariser Hofe weiterzuspinnen, und an Mittlern fehlte es ihm da nicht. Dazu gehörten in erster Linie der Herzog Alfonso von Ferrara und der Kardinal Zaccaria Delfino. In Madrid war man von diesen Machenschaften genau unterrichtet und daher fest entschlossen, die portugiesische Heirat endlich einmal ins Reine zu bringen. Aber der Gesandte Luis de Vanegas, der im Juli 1567 nach Wien kam und Maximilian zusetzte, Philipps Lieblingsplan zu verwirklichen, hatte kein Glück. Der Kaiser hielt ihm die Unmöglichkeit vor, die jüngere Tochter vor der älteren, der Erzherzogin Anna, zu vermählen. Gleichzeitig weist er seinen Madrider Botschafter Dietrichstein an, bei Philipp »mit dem höchsten, da es immer möglich«, darauf zu dringen, daß er in die französische Heirat willige, »dan es dergestalt meines Erachtens ain trefflich, hochs und nutzlichs Werk war«. Der König werde sie zwar, so fügt er kleinlaut hinzu, wiederum verweigern, aber dann möchte er wissen, welcher Hilfe er sich von jenem zu versehen habe, »dan sonst würde mit mier zu kurz gehandlet und würde das Schpiel über mich allain ausgehen«.
Der Kaiser hatte gerade zur Zeit, da er diesen Appell an Dietrichstein richtete, alle Ursache, über die Frage, was er eigentlich mit seinem »brüderlichen« Verhältnis zu Spanien gewonnen habe, ernstlich nachzudenken. Die finanzielle Beihilfe für den Türkenkrieg war lange nicht in dem vom Kaiser erwarteten Maße erfolgt: Margarete von Parma erklärte, die auf die Niederlande entfallende Kontribution nicht zahlen zu können. Sollte sich Maximilian je Hoffnung darüber gemacht haben, daß wirklich einer seiner Söhne in Spanien zur Herrschaft käme, so mußte er jetzt aus jeder Madrider Depesche hören, daß die Königin einem freudigen Ereignis entgegensehe, und er fängt an, die Rückkehr seiner Söhne zu betreiben. Angenehm klang es auch sicher nicht in seinen Ohren, wenn jetzt, da der König im Hochgefühl seiner kommenden Vaterfreuden schwelgte, wieder Gerüchte auftauchten, er wolle sich zum römischen König wählen lassen.
Indes, am meisten mußte es Maximilian verdrießen, ja empören, wenn er an die andere Heiratsangelegenheit, die ihm wirklich am Herzen lag, die eheliche Verbindung seiner Lieblingstochter Anna mit dem Infanten Don Carlos, dachte. Die Art, wie der König hier seinen Vetter jahrelang an der Nase herumführte, erinnert etwas an das Vorgehen der »teufflischen« Engländerin Elisabeth in der Heiratssache des Erzherzogs Karl, war jedenfalls eine der stärksten Belastungsproben für die Geduld des Kaisers, der sich durch so viele Rücksichten an das spanische Königshaus gebunden fühlte.
Bald sieben Jahre waren verstrichen, seitdem Kaiser Ferdinand zum ersten Male die Ausführung der seinerzeit auf dem Brüsseler Familientag von 1557 beschlossenen Heirat mit dem Infanten angemahnt hatte. Im Dezember 1560 vertraute er dem spanischen Botschafter Don Claudio Fernandez de Quiñones, Grafen von Luna, die große Neuigkeit an, daß sich der französische König Karl IX. um die Hand einer Erzherzogin bewerbe, mit der nur Anna gemeint sein konnte. Ein deutlicher Wink also, daß es an der Zeit sei, das Ehebündnis, das von Kaiser Karl V. selber zu dem Zweck angeregt worden war, die Verbindung zwischen den beiden Linien des Hauses Österreich inniger zu gestalten, endlich abzuschließen. Graf Luna entwarf von der für Don Carlos bestimmten Prinzessin ein überaus günstiges Bild. Sie sei wohl erst vierzehn Jahre alt, berichtete er am 10. Januar 1562 nach Madrid, sehe aber wie sechzehn aus, sei eine hübsche und stattliche Erscheinung und besitze die besten Charaktereigenschaften, Klugheit und Ruhe – kurz, man könne sich keine passendere Lebensgefährtin für Don Carlos denken.
Die Werbung war also gemacht. Allein König Philipp bekundete nicht die mindeste Eile und gebrauchte, sooft von ihr die Rede war, die merkwürdigsten Ausflüchte. Sein Sohn sei krank, so ließ er im März und August 1561 dem kaiserlichen Botschafter Martin de Guzman sagen, auch noch sehr jung; man möge daher die Verhandlung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben; biete sich inzwischen eine für beide Häuser günstigere Aussicht, so werde er den Kaiser davon in Kenntnis setzen.
Diese Antwort des Königs mußte den Wiener Hof etwas sonderbar berühren. Die Berufung auf die Jugend war nämlich mit Rücksicht darauf, daß der Infant damals sechzehn Jahre zählte, also in einem Alter stand, in welchem sein Vater Philipp bereits verheiratet war, sicherlich nicht sehr ernst zu nehmen, zumal da man mit der Hochzeit selbst noch zuwarten konnte. Der Kaiser wollte ja nur fürs erste wissen, wie er daran sei. Und das gleiche war bei dem Hinweis auf die Krankheit der Fall. Das Quartanfieber, die sogenannte »Quartana«, war ein Leiden, das so zu den Alltäglichkeiten des spanischen Lebens gehörte, daß man es als etwas ganz Selbstverständliches, Unvermeidliches hinnahm. Auch Maximilian hatte, wie wir wissen, dieses Fieber gehabt, noch ehe er Spaniens Boden recht betreten, und litt noch lange daran. Gewiß, es gab schlimmere Fälle, wie denn auch die Krankheit des Infanten einen langwierigen Verlauf zu nehmen schien. Doch in Alcalá de Henares, wo sich Don Carlos mit seinen beiden Jugendgespielen Don Juan d'Austria und Alexander Farnese, den später berühmten Kriegsmännern, seit Ende Oktober 1561 aufhielt, war er vom Fieber befreit worden. Um die Mitte Februar des nächsten Jahres konnte der französische Gesandte Bischof Aubespine seinem Hofe melden, daß sich der Infant auf dem Wege zur Genesung befinde, und am 12. März nahm er schon an einem vom König veranstalteten Feste im Pardo teil.
Am Kaiserhofe, der offenbar über des Infanten Gesundheitszustand auf dem laufenden erhalten war, wurden denn auch sofort wieder die Fühler ausgestreckt. Sicherlich geschah es nicht ohne tiefe Absicht, daß Kaiser Ferdinand den spanischen Botschafter, nachdem er die Vorteile dieser Eheverbindung für das Haus Habsburg gehörig herausgestrichen hatte, auf die glückliche Harmonie im Alter der Verlobten – die Erzherzogin war um vier Jahre jünger als Don Carlos – aufmerksam machte.
Man hatte nämlich von verschiedenen Seiten in Erfahrung gebracht, daß in Madrid die Absicht bestehe, Don Carlos mit der um zehn Jahre älteren Prinzessin Johanna, Philipps Schwester, die einstens seine Erziehung geleitet hatte, zu vermählen. Es wurde sogar schon davon gesprochen, daß Verhandlungen mit der römischen Kurie eingeleitet seien, um die für diese Verwandtenehe erforderliche Dispens einzuholen. Tante Johanna, noch immer eine schöne Frau, spielte übrigens auch späterhin, bei den verschiedenen einander jagenden Eheprojekten, eine nicht unbedeutende Rolle. So hört man, im Juni 1567, ihren Namen in Verbindung mit dem französischen König Karl IX.; doch schlug Katharina von Medici dieses Angebot mit der Bemerkung aus, daß ihr Sohn »eine Frau und nicht eine zweite Mutter« wünsche. Das Gerede von der Heiratsabsicht der Prinzessin Johanna war also von vornherein durchaus glaubwürdig, und man vernahm bald auch einen der Beweggründe dieser etwas ungewöhnlichen Ehekombination. Der allzu infantile Prinz, so wurde gesagt, brauche eine Frau, die geeignet sei, ihm in der Regierung zur Seite zu stehen, so daß er in ihrer Gesellschaft in Spanien oder anderswo, etwa in Flandern, mit Erfolg auftreten könne.
An die »Krankheit« des Infanten glaubte man aber am Kaiserhofe nicht, und Graf Luna mußte selber zugeben, daß Don Carlos von seinem Fieber wiederhergestellt sei. Nur sei dieser, meinte er, infolge der langen Krankheit völlig heruntergekommen. Gegen dieses Argument ließ sich natürlich nichts einwenden, und so sagte denn auch der Kaiser einlenkend: Es sei allerdings besser, noch eine Weile zu warten, sonst gehe es Don Carlos wie dem Kronprinzen von Portugal, dem kürzlich verstorbenen Gemahl der Prinzessin Johanna, der sich durch seine vorzeitig eingegangene Ehe zugrunde gerichtet hatte. Er habe die Eheangelegenheit der Erzherzogin Anna, so fügte er zur Erklärung bei, bloß aus dem Grunde auf die Bahn gebracht, weil er hörte, daß der Prinz mit seiner Tante verheiratet werden solle. Und da könne er nicht umhin, seine Bedenken gegen diesen Plan des Königs auszusprechen; denn solche Ehen gingen in den meisten Fällen ungünstig aus. Die Heirat mit Johanna würde für die Regierung des Landes wie für das persönliche Glück des Prinzen und die Ruhe des Vaters von üblen, schwer wieder gutzumachenden Folgen sein. Die Prinzessin sei für den Infanten viel zu bejahrt, denn wenn er ins Mannesalter eintrete, fange sie bereits zu altern an. Außerdem könne er für eine derart Nahverwandte lediglich den Respekt, den man einer Mutter – also auch hier dieses ominöse Wort – entgegenbringe, empfinden. Wohl sei die Prinzessin Johanna sehr hübsch, doch auch die Erzherzogin würde Anklang finden. Im übrigen werde sicherlich der König »in seiner Klugheit« selber das Beste zu tun wissen. Mit diesem eindringlichen Appell an Philipps einsichtsvolles Vaterherz schloß Kaiser Ferdinand sein Gespräch, nachdem er noch ausdrücklich zu verstehen gegeben hatte, daß es ihm nicht einfalle, seine Enkelin dem Madrider Hofe aufzudrängen, er sich auch noch eine andere Heirat, die dem Infanten und dem gemeinsamen Interesse besser entspreche, wohl gefallen lasse.

Maria Stuart
Graf Luna hatte übrigens, als der Kaiser bei ihm wegen der Ehe anklopfte, keinerlei Weisungen aus Madrid. Man erwartete daher mit Spannung die Antwort, die der kaiserliche Gesandte Martin Guzman vom König selber erhalten werde. Sie erfolgte endlich, nach längerem Warten, in den ersten Tagen des März und war wiederum derart gehalten, daß man ihrer nicht froh werden konnte. Man hatte diesmal auf eine bündige, kategorische Resolution gedrängt und eine Antwort erhalten, die eigentlich keine war. Gott sei Zeuge, so erklärte in des Königs Auftrag Herzog Alba dem Gesandten, daß er in seinem Leben nichts sehnlicher herbeiwünsche, als seinen Sohn mit der Erzherzogin Anna vermählt zu sehen, nicht bloß, weil sie die Tochter derart ansehnlicher Eltern sei, die er so sehr liebe, sondern auch weil er für den Kaiser die größte Verehrung und die Liebe eines Sohnes hege. Allein die Indisposition des Prinzen sei noch im gleichen Zustande wie früher: die langwierige Krankheit habe ihn dermaßen geschwächt und angegriffen, daß er in seiner Entwicklung zurückgeblieben, wie dies alles Guzman bestätigen könne. Dem König sei es daher leider unmöglich, in der Heiratssache der Erzherzogin Anna die gewünschte Entscheidung zu treffen. Maximilian möge ihm diesen »Aufschub«, der im Interesse aller gelegen sei, nicht übel auslegen. Zu seiner Zeit werde man im gegenseitigen Einvernehmen dasjenige tun, was für beide Teile das beste sei.
Soweit die königliche Resolution vom 6. März 1562, die trotz ihres Aufwandes an hochtrabenden Redensarten und Beteuerungen der Liebe, wie man wohl gefühlt haben mag, unmöglich befriedigen konnte. Guzman erhielt daher neben der offiziellen Erklärung noch eine vertrauliche, die sich über des Prinzen »Indisposition« näher ausließ. Nicht bloß der Gesundheitsmangel des Don Carlos, so flüsterte ihm der Herzog ins Ohr, gebe zu Bedenken Anlaß, sondern auch die in seiner Person gelegenen Mängel, »ebensowohl im Urteil und Wesen wie im Verständnis«, das weit hinter dem zurückgeblieben sei, was man von einem Jüngling in seinem Alter verlangen könne. König Philipp habe daher, nachdem er das Vertrauen in die Befähigung seines Sohnes verloren, die Einladung an seine deutschen Neffen ergehen lassen. Inzwischen werde man ja sehen, ob sich der Zustand des Infanten bessere.
Guzman teilte diese beiden Erklärungen des Königs, die offizielle wie die vertrauliche, seinem kaiserlichen Herrn mit und fügte seinerseits die Versicherung bei, daß das, was ihm Herzog Alba über Don Carlos gesagt habe, »nicht fingiert, sondern – wirklich wahr« und dieser körperlich derart beschaffen sei, daß er, soweit die Gesundheit in Frage käme, auch in zwei oder drei Jahren nicht zum Ehemann geeignet sein werde. Wäre der Prinz, so setzte er bedeutungsvoll hinzu, anders geartet, so würde der König sicherlich nicht die Reise seiner Neffen so betrieben haben. Die Anwesenheit derselben am spanischen Königshofe werde von allen, die das Wohl Philipps und des Staates im Auge hätten, lebhaft herbeigesehnt, und es empfehle sich daher, die Entsendung möglichst zu beschleunigen. Der König schrieb dann am 11. März persönlich dem Kaiser, daß das Quartanfieber, das eine Zeitlang schon verschwunden gewesen, wiedergekehrt und der Infant »unglaublich« schwach sei.
Am Tage vorher hatte Philipp an seinen Wiener Gesandten die Weisung ausgegeben, dem Kaiser in der bestimmtesten Form zu versichern, daß er an eine Ehe mit Johanna niemals auch nur »gedacht« habe. Freilich sollte durch diese Erklärung keineswegs der Weg für die Verbindung mit Anna freigegeben sein. Denn die Instruktion schloß mit den eigentümlichen Worten: »Zum Wohle meiner Angelegenheiten und der Christenheit ist es aus verschiedenen Gründen notwendig, den Prinzen frei zu erhalten und seinetwegen in keine Verpflichtung sich einzulassen bis zu dem Zeitpunkte, da die Verehelichung wird vor sich gehen können.« Wiederum grinst uns die Sphinx entgegen – zum Wohle des Staates und der Christenheit soll der Prinz bis auf weiteres ledig bleiben! Was hatte das zu bedeuten? Sicherlich hing diese Weisung für Luna mit der vertraulichen Mitteilung vom »Schwachsinn« des Infanten, die dem kaiserlichen Gesandten gegeben worden war, aufs engste zusammen.
Am Kaiserhofe scheint man indes auch jetzt nicht ernstlich an die vom König gerügten »Mängel« geglaubt zu haben – wenigstens beeilte sich König Maximilian durchaus nicht mit der Entsendung seiner beiden ältesten Söhne. Allein wenige Wochen nach der mysteriösen Erklärung an Guzman trat ein Ereignis ein, das allerdings geeignet war, die körperliche wie geistige Entwicklung des spanischen Thronfolgers zu gefährden, ein Ereignis, das tatsächlich vielfach als Ausgangspunkt der Don Carlos zugeschriebenen Geistesstörung angesehen wurde.
Der Prinz, der in der milden Luft von Alcalá und in der angenehmen Atmosphäre von Zerstreuung im Kreise seiner Jugendgefährten auf dem besten Wege war, seine volle Gesundheit zu erlangen, erlitt am 19. April einen schweren Unglücksfall. Als er, wie erzählt wird, zu einem Stelldichein mit der Tochter des Schloßwarts in den Garten eilen wollte, fiel er auf der finsteren, schadhaften Treppe, deren Ausgang von dem gestrengen Obersthofmeister versperrt worden war, so unglücklich nieder, daß er sich eine schwere Verletzung des linken Hinterhauptes zuzog. Es trat Wundfieber und Rotlauf ein, die Ärzte umstanden ratlos das Lager des Kranken. Am Abend des 8. Mai erklärten die Ärzte, daß er nur noch wenige Stunden zu leben habe, und in der Nacht verließ der König, während ein heftiger Sturm tobte, Alcalá, nachdem er Weisungen für die Leichenfeierlichkeiten zurückgelassen hatte.
Als aber die Gefahr für das Leben des Infanten am höchsten gestiegen war, entschloß sich am folgenden Tag der Chirurg Doktor Vesalius dazu, als äußerstes Rettungsmittel eine Trepanation des Schädels in der Weise vorzunehmen, daß er ein Stück in Form eines Dreiecks und in der Größe eines Schillings entfernte, um dem Eiter einen Abfluß zu schaffen. Am 13. Mai konnte der Prinz als gerettet angesehen werden, aber seine vollständige Genesung nahm noch mehrere Wochen in Anspruch. Erst am 14. Juni, also nach einem Schmerzenslager von drei Monaten, verließ Don Carlos sein Bett, worauf er eine Messe hörte und das Abendmahl empfing. Zwei Tage später kam Philipp nach Alcalá zurück und schloß den Sohn gerührt in seine Arme. Im nächsten Monat übersiedelte Don Carlos nach Madrid.
Wiederum sollte den spanischen Königshof ein Eheprojekt beschäftigen, in dessen Vordergrund der Infant stand – das mit der Schottenkönigin Maria Stuart. Don Carlos hatte sich noch während seines Aufenthaltes in Alcalá, wie der französische Gesandte Aubespine am 3. Januar 1561 nach Paris berichtete, sehr lebhaft für diesen Plan interessiert. Dem Sohne seines Obersthofmeisters Don Garcia de Toledo vertraute er an, er habe sein Augenmerk auf die Königin von Schottland gerichtet, erstens um dessen Größe willen, dann um die Mittel zu erhalten, in den Niederlanden mehr zu sein als der Statthalter seines Vaters, der noch jung sei, und von dem er noch auf lange Zeit hinaus große Staaten nicht zu erwarten habe; endlich weil ihm Maria Stuart von Personen, die sie selbst gesehen, als schön und als eine weise und gute Katholikin wie als Herrin ihrer Rechte geschildert worden sei.
Diese vertrauliche Äußerung, die dem französischen Gesandten zu Ohren kam, ist für die Wünsche und Ziele des Infanten höchst bezeichnend. Man ersieht einmal daraus, daß sein Ehrgeiz nicht nur Schottland, sondern auch die Niederlande umspannte. Und dann ergibt sich auch für die religiöse Einstellung des Don Carlos ein ganz merkwürdiger Schluß. Daß die Schottenkönigin, die nach ihrer Rückkehr in die Heimat den kalvinistischen Untertanen Zugeständnisse machte, vom Infanten als eine »weise« und »gute« Katholikin bezeichnet wurde, mußte in Philipp, wenn er davon gehört hat, und er wird davon ebensogut wie der französische Gesandte gehört haben, ein gelindes Grauen verursacht haben. Denn ein Herrscher, der wiederholt erklärt hatte, lieber alle seine Reiche zu verlieren als Glaubensfreiheit gewähren zu wollen, lieber hunderttausendmal zu sterben als von seinem starren, katholischen System abzugehen, konnte in Maria nicht eine »gute« Katholikin, sondern nur eine »Ketzerin« erblicken, und wenn nun sein eigener Sohn dieser ihrer Haltung Bewunderung zollte, so war dies eben irrsinnig, »vernunftlos«, wie der König es nannte. Dann aber finden auch die mystischen Worte: »Zum Wohle der Christenheit« könne an eine Heirat nicht gedacht werden, ihre Erklärung.
Das schottische Eheprojekt wurde vom König, der es eine Zeitlang betrieben hatte, am 18. November 1563 abgelehnt. In der Begründung des staatsrätlichen Beschlusses tritt uns wieder die »Disposition« des Prinzen entgegen. Philipp II. erwartete sich von der Verbindung mit Maria Stuart nicht die erwünschten Früchte, er sah in Don Carlos nicht den richtigen Mann, um den weltumspannenden Gedanken Kaiser Karls V., die Einbeziehung Englands in das katholische Machtsystem, durchzuführen. Die Verhandlungen mit der Königin wurden zwar noch weitergesponnen, aber wohl nur zum Schein. »Die Persönlichkeit des Infanten und so manche daran sich knüpfende Frage«, schreibt am 6. August Philipp seinem Minister Granvelle, »drängen mir die Überzeugung auf, daß die Zurückführung Schottlands und Englands unter den Gehorsam des römischen Stuhles auf dem Wege einer Vermählung desselben mit der schottischen Königin nicht zu erreichen ist«.
Schon sprach man auch in der Öffentlichkeit von der ungünstigen Entwicklung des spanischen Thronfolgers. Don Carlos, so berichtet am 19. Januar 1563 der venezianische Gesandte Paolo Tiepolo, finde weder am Studium noch an körperlichen Übungen, überhaupt an keinen »ehrsamen« Dingen Gefallen, sondern nur an »Übeltun«. Er liebe niemanden, hasse dagegen viele. Er lasse sich gern beschenken, während er selber nichts hergebe. Trotz seiner siebzehn Jahre verstehe er blutwenig von der Welt, und wiewohl die Spanier in ihrer Vergrößerungssucht seine Fragen, die er an alle mit ihm in Berührung kommenden Personen zu stellen pflege, herausstrichen, verrieten sie doch, wie andere sagen, nur geringe Erfahrung. Der Prinz sei von »melancholischer Gemütsbeschaffenheit«, und das scheine, so fügte er mit Beziehung hinzu, eine »Erbschaft seines Großvaters und seiner Urgroßmutter« – gemeint sind Karl und Johanna – zu sein.
War dies noch der Prinz, auf den die Spanier, wie ein anderer Venezianer, Federigo Badoer, drei Jahre vorher geschrieben hatte, so große Hoffnungen setzten, von dem sie erwarteten, er werde ein zweiter Karl werden und wunderbare Leistungen im Kriege verrichten, und der derart »witzige« Aussprüche tue, daß sein Lehrer sie, in einem Hefte gesammelt, dem kaiserlichen Großvater zugeschickt habe? In der Tat hatte ihn der spanische Dichter Juan Martin Cordero im Jahre 1558 als einen in den Wissenschaften und in dem Waffenhandwerk tüchtig geschulten Prinzen, der allen, die mit ihm zu tun hatten, große Bewunderung einflößte, geschildert und gesagt, er werde einstens Karl und seinen Vater Philipp weit übertreffen. Selbst im Auslande hatte man mit Begeisterung von Don Carlos gesprochen. So erklärte Melanchthon in seinen Vorlesungen an der Universität Wittenberg: »Von dem Enkel Kaiser Karls V. höre ich so wunderbare Dinge erzählen, daß ich überzeugt bin, es wird etwas Großes aus ihm; die Konstellation seiner Geburt war so ausgezeichnet, als sie nur sein konnte; wer weiß, was Gott mit Karl VI. vorhat! Vielleicht wird er die Macht der Türken zum Schwanken bringen oder etwas Ähnliches ins Werk setzen.«
Was war also mit dem Prinzen los? Wie erklärt sich dieser radikale Wandel im Urteil über den Thronfolger? Auch Tiepolo, der ihn in einem so ungünstigen Licht erscheinen läßt, macht die bedeutungsvolle Bemerkung, daß das Urteil über Don Carlos geteilt sei. Und überdies beruft er sich auf das Urteil anderer, also scheint er ihn kaum persönlich gekannt zu haben, weil er das sicherlich in seinem Bericht erwähnt hätte.
Über diese schwerwiegende Frage Gewißheit sich zu verschaffen, das war die Aufgabe, die dem als Diplomaten erprobten Dietrichstein, der die zwei ältesten Söhne Maximilians nach Spanien brachte, gestellt war. Denn am Kaiserhofe hielt man unverrückt an der Absicht fest, die Ehe mit Don Carlos abzuschließen, und König Philipp hatte insofern selber eine Handhabe dazu gegeben, als in dem ablehnenden Bescheid an die Schottenkönigin der Wille ausgesprochen war, ihn mit der Erzherzogin Anna zu verloben. Und Dietrichstein durfte als die Persönlichkeit gelten, der auch Philipp volles Vertrauen schenken konnte. »Er ist katholisch, scharfsinnig, sehr sachkundig, sehr ehrenhaft, vermählt mit Donna Margareta von Cardona und dem Dienst Eurer Mt. sehr zugetan«, so hatte ihn der spanische Gesandte am Kaiserhofe Graf Luna seinem König geschildert.
Dietrichstein landete im März 1564 in Barcelona, und schon bald darauf, in Valencia, wo man längeren Aufenthalt nahm, brachte er Philipp II. seine Werbung vor. Der Kaiser, so führte er aus, wundere sich sehr, daß er in der Heiratssache des Don Carlos noch immer keine Entscheidung in Händen habe, obwohl er den König von der »heftigen« Werbung Frankreichs um die Hand der Erzherzogin Anna unterrichtet hätte. Philipp möge daher rund, »ohne Scheu« heraussagen, welche Heirat er vorziehe, die mit seinem Sohn oder die mit König Karl von Frankreich, damit man sich danach richten könne und nicht am Ende die Gelegenheit versäume.
Der König, derart vor eine klare Entscheidung gestellt, rechtfertigte sein langes Schweigen wiederum auf eine höchst sonderbare Art. Zu jener Zeit, da Guzman ihn um eine Resolution gebeten, so erklärte er Dietrichstein, sei er derart mit Geschäften überbürdet gewesen, daß er sich, um besser nachdenken zu können, einen »Bedacht« nahm – nicht daß derselbe, wie er begütigend hinzusetzte, »vonnöten« gewesen sei, da ja Anna solche Eltern und so »große Qualitäten« besitze, wie man sie sich nicht besser wünschen könne. Er habe sich nun entschlossen, einen Gesandten mit der »endlichen« Resolution an den Kaiserhof abzufertigen. Der werde »demnächst« hierher kommen und dann »von Stund an« nach Wien abreisen. Kaiser Ferdinand und König Maximilian würden hoffentlich ob dieser »kleinen Zeit« keinen Verdruß empfinden.
Der kaiserliche Gesandte, der nicht wenig überrascht gewesen sein mag, statt der »endlichen« Resolution neue Ausflüchte zu vernehmen, erwiderte prompt, daß dem Kaiserhofe, der schon so lange gewartet habe, auch ein noch so kleiner Verzug beschwerlich fallen werde, um so mehr, wenn dieser Aufschub aller Voraussicht nach ein überaus langer sei; sollte doch der vom König ausersehene Gesandte erst hierher kommen. Er ließ Philipp nicht undeutlich durchblicken, daß es weit einfacher sei, wenn er ihm selber, der doch ausdrücklich dazu den Auftrag erhalten habe, die angekündigte Resolution erteile, ganz abgesehen von der schweren Bloßstellung, die für ihn persönlich der vom König gewählte Weg bedeute. Doch umsonst. Der Gesandte werde, so wurde Dietrichstein geantwortet, wirklich bald da sein, und wenn nicht, wolle er auf andere Mittel bedacht sein.
Dietrichstein erfuhr auch bald, wer für diese Gesandtschaft in Aussicht genommen sei – es war der Bruder des Kardinals Granvelle, Thomas Perrenot von Chantonnay, und diese Wahl mußte den kaiserlichen Gesandten aufs neue überraschen. Der Gesandte, der überdies, da der bisherige Wiener Botschafter Graf Luna gestorben war, mit der ständigen Vertretung Spaniens betraut werden sollte, war es ja gewesen, der seinerzeit den König Maximilian, als er aus dem Feldlager Kaiser Karls flüchten wollte, eingeholt und zurückgebracht hatte. Eine angenehme Erinnerung also war es nicht, die der neue Botschafter in Maximilian weckte, und zudem galt Chantonnay als ein kirchlicher Heißsporn, der eben erst aus Frankreich in Unfrieden geschieden war. Warum aber der König wiederum einen monatelangen Aufschub der Heiratsangelegenheit in die Wege geleitet hatte, darüber konnte sich Dietrichstein nun den Kopf zerbrechen. War vielleicht doch die Prinzessin Johanna schuld? Zwar hatte Philipp ausdrücklich versichert, er habe niemals auch nur an sie gedacht – aber das hinderte ja nicht, daß er jetzt daran denke, und überdies wird es Dietrichstein nicht unbekannt gewesen sein, daß es der König, den der venezianische Gesandte Vendramino als den »Vater der Lüge« bezeichnete, mit der Wahrheit nicht allzu genau nahm. In der Tat erfuhr der Gesandte, daß die Prinzessin, die noch immer den Infanten begehrte, von König Philipp eine Zusage oder wenigstens eine »Vertröstung« erhalten habe.
Allein, wie nun Dietrichstein nach allen Seiten hin seine Fühler ausstreckte, hörte er auch etwas, das den ehedem von Guzman gemeldeten Grund, die »eigentümliche Beschaffenheit« des Infanten, zu bestätigen schien. Don Luis Mendez de Haro, ein in des Königs besonderer Gunst stehender Höfling, dem er sein Leid geklagt hatte, daß man ihm in einer Sache, die ein einfaches Ja oder Nein erfordere, beständig hinhalte, flüsterte ihm geheimnisvoll ins Ohr: Er möge sich doch, bevor er weiter anhalte, den Infanten – einmal ansehen. Dietrichstein wußte jetzt nicht, wie er das wieder »verstehen« sollte. Wollte man seiner auf eine feine Art los werden, damit die von einer »ansehnlichen« Partei am Königshofe gewünschte Heirat mit der Prinzessin Johanna »ohne Offension« vollzogen werden könne, oder hatte es doch mit dem seinem Amtsvorgänger angedeuteten Mangel seine Richtigkeit?
Mit solchen widerstreitenden Gedanken im Kopfe setzte er sich hin, um dem auf eine baldige Nachricht harrenden Wiener Hofe wenigstens über das, was er auf Anfragen über Don Carlos erfahren hatte, Mitteilung zu machen. Diese seine erste Relation – sie trägt das Datum vom 19. April 1664 – war leider, wie Dietrichstein gestehen mußte, »schlecht genug«, doch setzte er die tröstende Bemerkung bei, es sei »nicht alles wahr, was man sage«.
Don Carlos soll, so berichtete der Gesandte zunächst über dessen äußere Erscheinung, ein ganz hübsches Gesicht haben, aber von blasser Farbe, hat die eine Schulter höher als die andere, den rechten Fuß kürzer als den linken und stottere. Sodann auf die geistigen Eigenschaften übergehend, erzählt er folgendes: In vielen Dingen erzeige er einen »guten Verstand«, hingegen »in anderen sei er noch so kindisch als ein Kind von sieben Jahren, redt gern und fragt um alle Ding, aber mit keinem judicio oder in nullum finem, mehr aus Gewohnheit als sonsten«. So habe er bisher keinerlei Neigung zu etwas Gutem gezeigt, auch für nichts Lust und Interesse bekundet außer zum Essen, und also esse er so »geitzig« (= gierig), daß nicht davon zu sagen, und wenn er erst gegessen, so äße er von neuem wieder. Und solches Überessen sei, so vermeine man, die Ursache seiner Schwachheit, und »männiglich« trage deshalb Sorge, er werde nicht lange leben. Was er sich in den Kopf setze, das müsse geschehen, und »doch sei die Vernunft nicht also, daß er zu unterscheiden wüßte, was recht oder unrecht sei, ihm schädlich oder nützlich, mal acondicionado, al possible unsauber«. Bislang habe man gar keine Neigung zu »Weibern« gemerkt, so daß viele annähmen, er sei »impotens«. Andere freilich meinten wieder, »er wolle, daß die, welche er zu seinem Weib nehme, ihn als Jungfrau finde«. Viele sagten auch, daß er deshalb »so gar pudico und mal acondicionado« – so keusch und übel gesinnt – sei, weil er »gar ein groß Gemüt und daneben sehe, wie sein Vater so gar seiner nicht achte und er so gar nix vermag«. Das habe ihn »halb verzweifelt« gemacht. Es sei auch viel bei seiner Erziehung versäumt worden, denn seine »naturalia« seien gut, »so sei er auch, wie er kleiner, nit also gewesen«.
Dietrichstein fügte seiner Beschreibung, die er gern »besser« gegeben hätte, die vielsagende Bemerkung bei: »Solches alles schreibe ich Eurer Mt., wie ichs gehört; was ich sehen und mich werde bedunken lassen, schreibe ich hernach und möge sich Eure Mt. wohl verlassen, daß ich nichts derselben verhalten will.«

Philipp II. von Spanien
In einem zweiten Berichte, den er drei Tage darauf verfaßte, teilt er weiter mit, daß die von der Tante Johanna drohende Gefahr, wie er nun erfahren habe, »noch gar nicht erloschen« sei, wenn sie sich auch auf die Gekränkte hinausspiele und so tue, als ob sie »nit viel danach frage«. Der König habe sich in diesem Punkte schon »zu weit eingelassen« und es falle auf, daß der Herzog Alba und dessen Gemahlin viel mit der Prinzessin »prakticierten«.
Alles kam nun darauf an, was der neue Botschafter auf Grund eigener Beobachtung am spanischen Königshofe erkunden sollte, um endlich einmal – die Wahrheit über Don Carlos zu bringen.
Adam von Dietrichstein, der gehofft haben mag, in der königlichen Residenz etwas Genaueres über den Infanten zu erfahren, sah sich bald schwer getäuscht. Wiederum hörte er so »seltsam« von ihm reden, daß er nicht wagte, es dem Kaiserhofe zu berichten oder es gar als »gewiß zu affirmieren«. »Ein jeder redet davon,« so meldet er am 29. Juni 1564 nach Wien, »wie er es gern sähe und dazu affectioniert ist.« Nur eins konnte er als sicher angeben, daß nämlich die Anhänger des österreichischen Heiratsplanes am Madrider Hofe »gar wenig« seien, während von der Prinzessin »alle« abhingen. Johannas Parteigänger schlügen die Ehe mit Don Carlos vor »unter dem Schein«, daß der Prinz eine Frau benötige, die zu regieren verstehe und das, »was ihm mangelt, durch ihren Verstand ersetzte«. Sie machten auch diese Mängel »größer, denn sie an ihm selbst«, und »sprengten sie in die Öffentlichkeit«.
Es ist doch auffallend, meint Dietrichstein, daß man vor dieser Heiratshandlung von des Prinzen »Mängeln« wenig hörte. Aber sie wollten durch derlei Machenschaften ihren Anhang stärken, und tatsächlich hätten sie erreicht, daß auf dem jüngsten Landtag ein Ausschuß der Cortes dem König die Bitte unterbreitete, seinen Sohn mit der Prinzessin vermählen zu wollen. Sogar für »impotent« werde der Infant ausgegeben und die sonderbare Behauptung aufgestellt, nur aus einer Ehe mit ihr seien Kinder zu erwarten – »Ab anderst eine Sukzession von ihm zu erhoffen, so sei die bei ihr zu erhoffen.« Don Carlos jedoch wolle von dieser Heirat »weder singen noch sagen hören«. Die Cortes habe er energisch zurechtgewiesen, indem er ihnen erklärte, ihr Verlangen nach einem Erben sei berechtigt, aber ihm eine bestimmte Heirat aufzuzwingen, eine »große Torheit«.
Dietrichstein gibt weiter der Vermutung Ausdruck, daß der König die Heirat mit Anna absichtlich in die Länge ziehe, um der Prinzessin zu zeigen, es habe nicht an seinem guten Willen gefehlt. Wohl habe man eine »Weile« die Ehe mit Johanna für eine beschlossene Sache angesehen und am ganzen Hofe davon geredet. Man wollte bemerkt haben, daß sie viel fröhlicher und »geputzter« erschiene und der Minister Ruy Gomez auffallend viel mit ihr und dem König verhandle, und schon sei auch davon gesprochen worden, daß der König von Portugal zur Hochzeit kommen und Johanna sofort nach der Trauung in die Niederlande reisen werde, um dort die Regierung zu übernehmen. Allein – seit einiger Zeit halte man die Heirat mit Anna für gewiß. Der Prinz habe erklärt, in Kürze sich verehelichen zu wollen, und sich dabei »gar kontent« gezeigt. Und als ein weiteres Anzeichen dafür gelte es, daß der König kürzlich, am 17. Juni, mit seiner Schwester zwei Stunden lang in den Gemächern der Königin verhandelt habe, während diese die meiste Zeit zum Fenster hinausschaute, und da soll er Johanna seinen Entschluß mitgeteilt haben, Don Carlos mit Anna zu vermählen, ihn in die Niederlande mitzunehmen, um dort Hochzeit zu halten und ihm die Regierung zu übertragen. Für die Dauer der Abwesenheit des Königs, so hörte man weiter, soll seine Gemahlin die Regentschaft führen, doch nur dem Namen nach, in Wirklichkeit alles mit Rat und Vorwissen ihrer Schwägerin Johanna handeln.
Freilich – das alles hörte Dietrichstein nur reden. Der König selber hatte ihm gegenüber nicht die geringste Andeutung gemacht, daß er in die Heirat mit Anna einwillige, sondern sich in ein tiefes Schweigen gehüllt. Und wiederum vernahm Dietrichstein über den Infanten derart Übles, daß er oft nahe daran war zu glauben, man wolle ihn nötigen, von seiner Werbung »abzustehen«, mit der es übrigens, wie man sage, noch Zeit habe, da beide Teile so jung wären. Kurz, der kaiserliche Diplomat kannte sich nicht aus, aber mittlerweile hatte er den Infanten Don Carlos persönlich gesehen und gesprochen und er säumte nicht, seine Eindrücke zu schildern, das Bild, das er in Valencia nach dem Hörensagen entworfen, nun auf Grund seiner eigenen Wahrnehmung zu ergänzen.
Die äußere Erscheinung vermochte er auch jetzt nicht viel anders zu beschreiben als damals: von Angesicht ziemlich wohlgestaltet, keine bösen Züge, braunes Haar, mittelgroßer Kopf, keine besonders hohe Stirn, graue Augen, normale Nase, »erhebte« Lippen, langes Kinn, blasse Gesichtsfarbe, »schlägt nicht aus dem österreichischen Geschlecht«, schmale Achseln, die eine etwas höher als die andere, eingebogene Brust, unter den Schultern, in der Magengegend, ein »Buckerle«, den linken Fuß »um ein gutes Stück« länger als der rechte, die ganze rechte Seite minder gebrauchsfähig als die linke, starke Schenkel, aber übel proportioniert, gar eine kleine und subtile Stimme, »die Rede kommt ihm anfangs etwas schwer an, daß ers muß herausdrucken, pronunziert das r und l übel«, aber er spricht doch so, daß man ihn verstehe.
Nun kommt Dietrichstein auf des Prinzen »Condition« zu sprechen. Hier mußte er sich mit Rücksicht darauf, daß er mit ihm noch wenig »traktiert« hatte, auf die Wiedergabe von Gehörtem beschränken. Gegen die beiden neu angekommenen Erzherzöge benehme er sich stets »freundlich«, aber sonst gelte er als »übelgesinnt«. Hierzu müsse aber gesagt werden, daß »viele« darob gar nicht verwundert seien, denn »man habe dem Prinzen bisher wohl Ursache dazu gegeben«, abgesehen davon, daß er stets schwach und kränklich gewesen. Was die Erziehung in der Jugend versäumte, habe man später nachholen, »remedieren« wollen und ihn nun so gehalten, wie man ihn höchstens früher hätte halten sollen. Jetzt aber wehre sich der Prinz, der gar ein »groß und hoch Gemüt« besitze, gegen diese Art, ihn wie einen kleinen Jungen zu behandeln. Alle Diener, die er besessen, seien ihm »wider seinen Willen« zugeteilt worden. Sein Vater habe ihn »zu nichts gebraucht«, was den ehrgeizigen Prinzen »nicht wenig schmerze«. Freilich – des Königs Standpunkt, den Infanten von den Regierungsgeschäften fernzuhalten, sei auch wieder zu verstehen; »denn er hat einen schnellen und heftigen Zorn, läßt sich den Zorn gar übergehen; was er ums Herz, das sagt er frei und unverhohlen, es treffe, wen es wolle, und da er einen Unwillen gegen jemanden gefaßt, läßt er den nicht leicht fallen, verharrt feindlich (= fest) auf seiner Meinung und, was er sich vornimmt, das soll seinem Willen nach auch so geschehen, dessen denn ihrer viele erschrocken, da er etwa den Verstand nicht zum rechten brauchen wolle«.
Doch gerade diese Tatsache des »Verstandesmangels« bestreitet Dietrichstein ganz entschieden, und hier konnte er auf Grund eigener Beobachtung sprechen. »Aber seine Fragen sind«, so stellt er fest, »gar nicht ungereimt gewesen, wie man wohl sagt, daß er dies tun soll, sondern alles Fragen, die ihm meines Erachtens gar wohl gebührt und zu tun angestanden. So hab er ein trefflich Gedächtnis für alles, was er gehört und gesehen und, wie man sagt, in vielen nur gar zu scharf.« Das gebe den Leuten Ursache, von ihm zu sagen, daß er in seinen Reden so frei und unachtsam sei. Sicherlich hätte vieles, was als »Fehler der Natur« erscheine, durch die Erziehung behoben werden können.
Dietrichstein geht sodann auf die in seinem früheren Berichte berührten Exzesse in des Infanten Lebensweise ein. Was dessen übermäßiges Essen betreffe, habe man ihn jetzt »zur Diät« gebracht, und so nehme er nie mehr als eine Speise, nämlich einen ganzen gesottenen Kapaun, klein geschnitten, mit einer Brühe vom Saft eines Hammelschlögels übergossen, zu sich, trinke auch nur einmal, und Wasser, der Wein sei ihm zuwider. Im Punkte des »Buhlens« habe er bisher keine »Probe« getan und so könne im Grunde niemand seine »Impotenz« behaupten. Seine hohe Stimme – hier ist offenbar an die Kastratenstimme gedacht – würde vielleicht für sie sprechen.
Aber Dietrichstein weiß den von ihm berichteten Mängeln auch einige gute Charaktereigenschaften des Infanten gegenüberzustellen. Er sei ein »großer Liebhaber der Gerechtigkeit und der Wahrheit«, liebe »tapfere, redliche, tugendhafte, ehrliche und ansehnliche« Leute, und wer ihm wohl und fleißig diene, den schätze und fördere er. Und der Gesandte konnte noch die erfreuliche Botschaft tun, daß der König gegen Don Carlos »etwas besser, denn bisher geschehen«, sich erzeige und den Entschluß gefaßt habe, ihn künftig im Staatsrate zu verwenden, wo er denn auch bereits am 16. Juni zum erstenmal erschienen sei. »In summa,« so schließt er vielsagend seinen langen Bericht, »es ist nicht weniger: er ist ein presthafter, schwacher Herr, aber herwider eines mächtigen Königs Sohn.« Daß Don Carlos kein Adonis war, darüber machte er dem Vater der Erzherzogin gegenüber kein Hehl. Als er wenige Tage darauf das eben fertiggestellte »Konterfei« des Infanten – es ist wohl mit dem in der Gemäldegalerie des Wiener Kunsthistorischen Museums befindlichen Bilde des spanischen Hofmalers Sanchez Coello identisch – Maximilian zusandte, unterläßt er es nicht, einige künstlerische Freiheiten festzustellen, wie daß sein Gesicht in Wirklichkeit schmäler, dessen Farbe etwas blässer und die Augen nicht so offen, der linke Fuß »um ein gutes« länger sei und – er meinte den Höcker – »deckt der Rock auch viel«.
Soweit Dietrichsteins Bericht. Aus ihm geht klar hervor, daß der gewiegte, welterfahrene Diplomat die Quelle aller »seltsamen«, über Don Carlos verbreiteten Reden in der Partei der Prinzessin Johanna sah, die mit allen Mitteln bestrebt war, das österreichische Heiratsprojekt zu Fall zu bringen. Er liefert weiter den wertvollen Beweis, daß der Gesandte von einem »Verstandesmangel«, von einem »Schwachsinn« nichts bemerkte. Wohl aber stellte er eine schwere Gereiztheit fest, für die er aber auch die Ursache erfuhr, und zwar eine sehr begründete Ursache – den Mangel an einer ausreichenden Beschäftigung.
Also – der typische Fall eines Thronfolgerkonfliktes. Aber schon konnte Dietrichstein mit Befriedigung eine »Besserung« des Verhältnisses zwischen Vater und Sohn feststellen, und so war auch die Hoffnung berechtigt, daß sich die Zornesausbrüche des zurückgesetzten Sohnes legen würden. Die Tatsache, daß sich Vater und Sohn nicht vertrugen, daß sie sich geradezu »haßten«, erscheint auch von anderen Gesandten bestätigt. Warum aber der König des Thronfolgers Heirat immer wieder hinausschob, darüber konnte Dietrichstein nichts Näheres erfahren. Er mußte am 3. Februar 1565 dem mittlerweile Kaiser gewordenen Maximilian das trübselige Geständnis machen, daß er »je länger je weniger« sich auskenne, daß er vor einem – »Mysterium« stehe.
War vielleicht doch an dem Gerücht der »Impotenz« etwas Wahres? Der diensteifrige Diplomat versuchte alsbald sich über diesen heiklen Punkt Klarheit zu verschaffen. Er setzte sich mit dem Leibarzt des Prinzen Doktor Olivarez in Verbindung, der es schließlich wissen mußte – doch der wußte nichts. Wenn der Infant, erklärte der Arzt, keinen Verkehr mit Frauen pflege, so sei dies auf das unglückliche Liebesabenteuer in Alcalá zurückzuführen, das er als eine Strafe Gottes aufgefaßt habe. Mit dieser Erklärung konnte sich der Gesandte einigermaßen zufriedengeben. Völlig beruhigt war er aber erst, als er vernahm, daß Don Carlos, der geschworen hatte, rein in die Ehe zu treten, mit der Tochter eines Gerichtsdieners Beziehungen angeknüpft hatte, die nicht ohne Folgen blieben.
Die Nachricht war etwas verfrüht. Doch im Frühling 1567 bestand der Infant die »Probe«, von der immer die Rede war, mit gutem Erfolg – allerdings erst nach einer Kur, für die den Ärzten und den Apothekern ein schweres Geld gezahlt wurde. Dietrichstein beeilte sich, dieses freudige Ereignis nach Wien zu berichten. Der Infant war selber bei dem Gesandten seines zukünftigen Schwiegervaters, um ihm mit sichtbarer Genugtuung mitzuteilen, »wie er die jüngist Prob mit fünf Malen getan hab«, und die Bitte zu stellen, dieses Resultat dem Kaiser bekanntzugeben. An dem ganzen Hofe wurde davon geredet, und bald erfuhr man auch, daß er der »Madame« ein eigenes Haus gekauft habe, worin sie mit ihrer Mutter wohnte.
Und nun schien auch, nach jahrelangem Warten, die Heiratsangelegenheit ins Rollen kommen zu wollen. Der König hatte sich auch nach der Absendung des Porträts, die man für ein gutes Zeichen hielt, in tiefes Schweigen gehüllt. Das Wort hatte ja jetzt der zum Wiener Botschafter ausersehene Herr von Chantonnay, der Mitte September 1564 aus Spanien abreiste und mit starker Verspätung, Ende März des nächsten Jahres, am Kaiserhofe anlangte. Auch er aber brachte dann nicht die ersehnte Entscheidung mit, sondern wieder die alten, abgeleierten Vertröstungen auf eine ferne Zukunft. Der König müsse, so erklärte der Botschafter, mit Schmerz feststellen, daß die schlechte »Disposition« seines Sohnes nicht gestatte, ihn zu verheiraten. Obwohl Don Carlos nunmehr neunzehn Jahre zähle, habe es Gott gewollt, daß er in seiner Entwicklung hinter allen anderen jungen Leuten zurückgeblieben sei. Man könne bei geeigneten Personen Erkundigungen darüber einziehen, um sich zu vergewissern, daß es dem König nicht um eine leere »Ausrede«, etwa um die Angelegenheit in die Länge zu ziehen, sondern um ein wahrhaftes Hindernis handle. Unter solchen Umständen hieße es also Geduld haben und mit dem Abschluß der Verhandlungen warten, bis die Heirat wirklich stattfinden könne. Denn falls sie früher stattfände, würde das daraus entstehende Übel beide Familien treffen.
Wie erstaunt mag man am Kaiserhofe gewesen sein, als Chantonnay seinen Auftrag – er war vom 14. September 1564 datiert – vorgebracht hatte. Denn von Dietrichstein war Maximilian durch eine spätere Depesche vom 31. Dezember benachrichtigt worden, daß der Prinz wohlauf sei und »täglich stärker und gesünder« werde. Man kannte dort auch aus derselben zuverlässigen Quelle, daß Don Carlos zur Erzherzogin Anna eine »große Affektion« gefaßt habe und nichts »höher« ersehne als den Abschluß der Ehe. Und diese ans Leidenschaftliche grenzende Zuneigung war derart bekannt, daß auch der französische Botschafter darüber nach Paris berichtete. Auf einer ländlichen Fahrt, so erzählt er, fragte die Königin Elisabeth den schweigsam ihr gegenübersitzenden Stiefsohn, wo er denn mit seinen Gedanken weile. Er antwortete: »Weiter als zweihundert Meilen.« Und als nun Elisabeth wissen wollte, wo denn das sei, erwiderte er träumerisch: »Ich denke an meine Cousine.« Stets trug er das Bild der Erzherzogin bei sich, wie sich denn auch in seinem Nachlaß ein solches, von kostbaren Perlen und Edelsteinen umrahmt, finden sollte.
Kaiser Maximilian konnte nicht umhin, dem spanischen Botschafter gegenüber sein Befremden über die neue Erklärung, die wieder keine Entscheidung sei, zum Ausdruck zu bringen. Man könne nicht, meinte er gereizt, einer so »unsicheren« Sache wegen die günstige Gelegenheit einer Verbindung mit dem französischen Königshofe in den Wind schlagen. Dietrichstein wurde am 26. März 1565 angewiesen, bei Philipp kräftige Vorstellungen zu erheben und ihm zu sagen, daß man sich nicht länger hinziehen lassen wolle; denn es habe fast den Anschein, daß der König mit ihm sein »Gespött« treibe. Die Erzherzogin Anna werde auf diese Weise noch »zwischen zwei Stühlen« zu sitzen kommen, das er aber nicht dulden könne, »denn sie sei ihm das liebste Kind«. Und der kaiserliche Botschafter verfehlte auch nicht, als er sich dieses Auftrages entledigte, auf die Tatsache hinzuweisen, daß sich des Prinzen Gesundheitszustand wesentlich gebessert habe, also gar kein Grund vorhanden sei, die Entscheidung noch weiter hinauszuschieben. Auch Chantonnay fühlte sich verpflichtet, seinem königlichen Herrn mitzuteilen, daß man in Wien mit jedem Tage weniger an des Prinzen Kränklichkeit glaube, und Philipp muß der Bericht seines Gesandten unangenehm in den Ohren geklungen haben, denn er schrieb eigenhändig auf dem Rücken der Depesche: »Esta no vea nadie« – das soll niemand sehen.
Das energische Auftreten des Wiener Hofes blieb nicht ohne Wirkung. Noch ehe das Jahr 1565 zu Ende ging, am Weihnachtstage, konnte der Kaiser seinem Gesandten in Madrid die frohe Mitteilung machen, daß nun tatsächlich alles »richtig« sei und Philipp »endlich« seine Zustimmung erteilt habe. Doch Dietrichstein war noch immer nicht beruhigt und hatte allen Grund dazu. Wieder fing man an, offen davon zu reden, daß Don Carlos von der Thronfolge ausgeschlossen werde. Herzog Alba selber eröffnete dem Gesandten im Auftrag des Königs vertraulich, daß Erzherzog Rudolf im Falle, daß die Königin Elisabeth – sie war gesegneten Leibes – einer Prinzessin das Leben schenken sollte, für diese in Aussicht genommen sei, »obzwar er«, wie er nachdrücklich hinzusetzte, »ohne das sein Erbe sei«. Und bei Hofe erzählte man es sich ganz laut, daß der nächste Prinz der Thronfolger sein solle. Sicherlich hörte dies auch Don Carlos; um so mehr mußte er in dieser gefährlichen Situation trachten, durch eine Verbindung mit dem Kaiserhofe einen Rückhalt zu gewinnen.
Endlich, im August 1566, hörte man von Vorbereitungen für die Reise des Königs in die Niederlande: Philipp wollte in Innsbruck mit Maximilian zusammenkommen und in Brüssel die Hochzeit feiern. Der Kaiser erklärte freudig bewegt, nur der Tod könnte ihn von seiner Fahrt nach Flandern abhalten, und sollte er krank sein, würde er sich hintragen lassen. Im nächsten Frühjahr hieß es dann, ein neuer Gesandter in der Person des königlichen Hofmarschalls Don Luis Vanegas de Figueroa werde an den Kaiserhof gehen, um Zeitpunkt und Ort der Hochzeit festzusetzen, damit Maximilian nicht den Verdacht schöpfe, man wolle ihn mit schönen Worten abspeisen. Vanegas kam auch und brachte einen kostbaren Ring im Werte von dreißigtausend Dukaten, den Don Carlos für die Erzherzogin bestimmt hatte. Aber seine Sendung galt in erster Linie dem Zweck, Maximilians zweite Tochter Elisabeth mit dem zehnjährigen König Sebastian von Portugal zu verloben. In der Angelegenheit des Don Carlos bezog er sich nur auf das, was König Philipp seinem Vetter »so klar« geschrieben hätte – aber das war eben nicht klar.
Nun riß dem Kaiser die Geduld. Sein Botschafter wurde wiederholt, am 18. Juli und am 10. November, von ihm in erregten Worten angewiesen, dem König sein höchstes Erstaunen und Befremden über dessen fortgesetzte Verschleppungstaktik auszudrücken. Seine Tochter Anna »werde auch nit jünger«, und wenn es so fortgehe, werde sie noch – er gebrauchte wieder den Ausdruck – »zwischen zwei Stühlen« zu sitzen kommen. Der Gesandte Vanegas hatte Maximilian im Auftrag des Königs vertraulich mitgeteilt, es stelle sich je länger desto mehr heraus, daß Don Carlos »nicht potent« sei. Doch merkwürdigerweise strafte Vanegas selber, wie der Kaiser Dietrichstein schreibt, seinen König Lügen, indem er ihm versicherte, der Prinz sei »Mann genug«, und das hatte ja auch die von Dietrichstein gemeldete »Probe« erwiesen. Chantonnay sandte wahre Alarmbotschaften über die in Wien herrschende gereizte Stimmung. Die Erzherzogin habe, meldet er am 16. Oktober 1566, vor Ärger und Gram einen ganzen Tag nichts gegessen. Der König entschloß sich nun, seinem kaiserlichen Vetter die Zusage zu geben, auf einer persönlichen Zusammenkunft im nächsten Frühjahr, woran auch Don Carlos teilnehmen sollte, alles ordnen zu wollen.
Niemand mag glücklicher gewesen sein als Don Carlos. Die Verzögerung der Heirat mit Anna war ja, wie Dietrichstein dem Kaiser wiederholt gemeldet hatte, die eigentliche Ursache seines »seltsamen« Wesens. Mit fieberhafter Spannung verfolgte er die Zurüstungen seines Vaters zur Reise, die endlich im März 1567 amtlich angekündigt wurde; sie sollte Ende Mai angetreten werden. Indes der Mai verging, ohne daß man etwas von ihr hörte. Erst im Juni nahmen die Gerüchte von der königlichen Expedition greifbare Gestalt an. Philipp trug Don Carlos und den beiden Erzherzögen auf, sich für die Reise, die auf dem Seewege vor sich gehen sollte, gefaßt zu machen. Im nächsten Monat wurden auch tatsächlich Schiffe zusammengezogen, Lebensmittelmagazine längs der Westküste Spaniens errichtet, und der erste Admiral, Pedro Melendez, wurde eigens aus Florida geholt, um das Königsschiff zu befehligen. Soweit war man schon, daß der König seine beiden Neffen fragte, was sie zur Seefahrt anziehen würden, und Don Carlos wurde aufgefordert, seine Reisevorbereitungen zu beschleunigen. Anfangs August wollte der König in Coruña, wo schon die Quartiere bestellt waren, die Anker lichten. Indes, der Monat August kam und Philipp saß noch fest in Madrid. Sein Minister Ruy Gomez belehrte den französischen Gesandten Fourquevaux, der sich angelegentlich nach dem Schicksal des Reiseplanes erkundigt hatte, daß eine Überfahrt im September ein »lebensgefährliches« Unternehmen sei. Dem Papst, der ebenfalls das größte Interesse an des Königs Anwesenheit in den Niederlanden an den Tag legte, ließ er zur Rechtfertigung seines Zögerns sagen, daß er infolge der verspäteten Abreise des Herzogs Alba, der ihm vorauszugehen hatte, gezwungen sei, seine Fahrt zu verschieben. Doch im künftigen Frühjahr sollte sie ganz bestimmt vor sich gehen. Der Präsident des Staatsrats, Kardinal Espinosa, erklärte dem päpstlichen Nuntius feierlich: »Entweder wird der König nicht mehr am Leben sein oder im März nach den Niederlanden gehen, es wäre denn, die Welt stürze ein.«

Isabella, dritte Gemahlin Philipps II. von Spanien
Aber war es dem König überhaupt ernst mit der Reise? Am Hofe des Königs fehlte es in der ganzen Zeit der Vorbereitungen zu ihr nicht an bösen Zungen, die steif und fest behaupteten, Philipp werde überhaupt nicht fortfahren, sondern er mache nur so, als ob er wollte. Der König war über dieses Gerede, das ihm zu Ohren kam, höchlichst entrüstet. »Diejenigen, welche an meine Reise nicht glauben,« schreibt er verärgert dem Kardinal Granvelle, »werden bald das Gegenteil von dem sehen, was sie mit solcher Böswilligkeit verbreiten.« Zu diesen »böswilligen« Zweiflern gehörte auch der kaiserliche Gesandte. Obgleich viele zweifeln, schreibt am 2. August 1567 Dietrichstein dem Kaiser, daß die Reise des nahen Herbstes wegen noch in diesem Jahr stattfinden werde, will der König doch, »daß man es glaube«. Ja, er glaubte auch nicht daran, daß die Reise im kommenden Frühjahr stattfinden werde, trotz der bündigsten Erklärungen des königlichen Kabinetts und trotz der Nachricht, daß der König die Matrosen gegen Zahlung von zehntausend Dukaten verpflichtet habe, im März sich zur Abfahrt bereitzuhalten. Dietrichstein sprach sogar den Verdacht aus, Philipp habe es mit seinen ostentativ in Szene gesetzten Reisevorbereitungen nur darauf abgesehen, vom Papst und von den Cortes eine finanzielle Unterstützung der Expedition des Herzogs Alba zu erlangen.
Und nicht zuletzt zweifelte auch an des Königs Reise sein – eigener Sohn. Er heftete, so wird erzählt, ein Buch Papier zusammen und gab ihm die Aufschrift: »Die großen Reisen des Königs Don Felipe.« Inwendig stand auf den Blättern zu lesen: »Die Reise von Madrid nach dem Pardo – einem nahegelegenen Lustschloß –, von Pardo nach dem Escorial, vom Escorial nach Aranjuez, von Aranjuez nach Toledo, von Toledo nach Valladolid usw. wieder nach Madrid.« Auch von diesem witzigen Streich des Infanten, in dem sich dessen schwere Enttäuschung spiegelte, soll der König erfahren haben und darüber recht aufgebracht gewesen sein.
Don Carlos aber dachte in seiner Seelennot daran, den Gedanken, den er im Laufe der Jahre oft, mehr spielend, erwogen haben mag, nun wirklich zur Ausführung zu bringen, um seinem nachgerade unerträglich gewordenen Zustand, seinen Leiden und Bedrückungen, ein Ende zu machen. Schon lange hatte er die Vorgänge in den Niederlanden mit gespanntestem Interesse verfolgt. Dort war seit Jahren eine gewaltige Bewegung im Zuge, die von welthistorischer Bedeutung werden sollte – denn der Aufstand der Niederlande bildete die Todeswunde für das spanische Weltreich, und er setzte auch ganz Deutschland in Brand.