
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Die Welt erlebt nicht leicht wieder eine solche Erscheinung« – so kennzeichnet Goethe das werdefrohe Deutschland um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts. Alles ist in kräftiger Vorwärtsbewegung, ein Frühlingssturm durchbraust das gesamte deutsche Leben, an allem Ererbten und Überlebten gewaltig rüttelnd. Die Männer, die im Mittelpunkt der Geistesbewegung stehen, hegen alle das stolze Gefühl, Teilnehmer an einem »außergewöhnlichen Arbeitstage der Geschichte« zu sein. Ein mächtiger Zug nationalen Selbstbewußtseins regt sich: die deutsche Vergangenheit wird durchforscht, um sich an den Großtaten der Vorfahren zu berauschen und zu zeigen, daß man den Römern ebenbürtig sei.
Allein es war ein Sonnenaufgang, dem keine Sonne folgte. Der geistigen und religiösen Renaissance entsprach keine politische Wiedergeburt. In staatlicher Hinsicht befand sich das deutsche Volk in langsamem, stetem Niedergange. Schon 1433 hatte Nikolaus von Cues ahnungsvoll geschrieben: »Eine tödliche Krankheit hat das deutsche Reich befallen; wird ihm nicht schleunig ein Gegengift gegeben, so wird der Tod unausweichlich eintreten. Man wird das Reich in Deutschland suchen und nicht mehr finden, und in der Folge werden die Fremden unsere Wohnsitze nehmen und unter sich teilen, und so werden wir einer anderen Nation unterworfen werden.«
Im Westen Europas waren nationale Einheitsstaaten erstanden – Frankreich, England und Spanien. Starke Monarchen, wie die »drei Magier« Ludwig XI., der Tudor Heinrich VII. und Ferdinand der Katholische, hatten mit fester Hand die staatlichen Grundlagen für eine gedeihliche Entwicklung im Innern und eine kraftvolle Machtpolitik nach außen geschaffen. Nur in Deutschland herrschte noch der ganze Jammer der Zerrissenheit und Kleinstaaterei, die Ohnmacht der Reichsgewalt, und somit fehlte gerade jenes Element, das imstande gewesen wäre, die nach einer Neuordnung ringenden Kräfte im sozialen und wirtschaftlichen, im politischen und religiösen Leben zu zügeln.
Denn die Kehrseite der geistigen Bewegtheit und Regsamkeit war eine tiefgehende Gärung, die alle Schichten des Volkes durchdrang und gewaltige Kämpfe und Stürme ahnen ließ. Die herrliche Blüte von Kunst und Wissenschaft, die einen Hutten zum Ausruf stimmte: »Es ist eine Lust zu leben!«, stellte einen sonnenbeschienenen Berggipfel dar, der sich über Abgründe und Schatten heraushebt.
»Die Einheit des Reiches war ein bloßer Name, sein Zustand die in Permanenz erklärte Anarchie, sein Schicksal ewige Gefährdung, immer neue Verluste an allen Grenzen.« Das deutsche Volk fühlte richtig heraus, daß es durch den Mangel einer starken Zentralgewalt gegen die mächtig emporstrebenden Nationalstaaten des Westens politisch und wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten war. Allein seine Hoffnung auf den großen Kaiser, der eine gründliche Reform des Reiches und der Kirche durchführen werde, dieser fromme Glaube, der in der Sage vom Kaiser Friedrich und in verschiedenen Flugschriften zu ergreifendem Ausdruck gelangte, erfüllte sich nicht. Weder Sigismund noch Friedrich III. stellten diesen Erneuerer, diesen »Reformator« Deutschlands dar.
Aber auch Kaiser Maximilian I. brachte nicht die ersehnte Neuordnung, obwohl er sie bringen wollte. Sein Gedanke einer Reichsreform, die auf eine Stärkung der kaiserlichen Macht abzielte, stieß auf den zähen, entschlossenen Widerstand der Reichsfürsten, die ebenfalls eine Reform, nur nach der entgegengesetzten Richtung, auf oligarchischer, auf aristokratisch-ständischer Grundlage, im Auge hatten. Es war ein langer, erbitterter Kampf, der auf dem Rücken des deutschen Volkes ausgefochten wurde und beide Teile mit wachsendem Groll erfüllte. Goethe hat wohl die Gefühle des Kaisers richtig erfaßt, wenn er in seinem »Goetz von Berlichingen« Maximilian sagen läßt: »Ich bin unmutig, Weislingen, und wenn ich auf mein vergangenes Leben zurücksehe, möchte ich verzagt werden; so viel halbe, so viel verunglückte Unternehmungen! und alles, weil kein Fürst so klein ist, dem nicht mehr an seinen Grillen gelegen wäre als an meinen Gedanken.« Selbst der Mainzer Kurfürst Berthold, der Führer der ständischen Reformpartei, tadelte diese Grillen, den mangelnden Ernst, die Gleichgültigkeit der Fürsten, und er besorgte, daß einstmals, wenn es nicht besser würde, ein »Fremder« komme, »der uns alle mit der eisernen Rute regieren werde«.
Indes, auch die Stände kann nicht die ganze Schuld an dem Scheitern des Reformwerkes und der kühn ausgreifenden Machtpolitik Maximilians treffen. Es lag doch im Wesen des Kaisers etwas, das zur Vorsicht mahnte. Franz Grillparzer hat sich über ihn so scharf als möglich geäußert: »Sicher hat, seinen Vater Friedrich III. ausgenommen, kein Kaiser als solcher eine so erbärmliche Rolle gespielt, als Maximilian I.« So hart, befremdend hart dies Urteil klingt, so ist es doch von der Geschichtschreibung, soweit der wirkliche Erfolg seiner deutschen Politik in Betracht kommt, vollauf bestätigt worden, und daran kann auch die schöne »Ehrenrettung«, die zuletzt Kurt Käser versucht hatte, nichts ändern.
Persönlich war Kaiser Maximilian I. wohl eine der ehrenwertesten und anziehendsten Gestalten. »Alle guten Gaben der Natur waren ihm in hohem Grade zuteil geworden,« sagt Ranke, »eine Persönlichkeit überhaupt, welche Bewunderung und Hingabe erweckte, welche dem Volke zu reden gab.« In der Schlacht fand man ihn immer voran, immer mitten im Getümmel. In seiner unzählige Male erprobten Tapferkeit sah die deutsche Nation ein Spiegelbild ihrer eigenen Art. Mit Stolz verfolgte sie die Leistungen der deutschen Landsknechte, dieser ureigenen Schöpfung Maximilians, die sich auf allen Schlachtfeldern Europas wacker herumstritten. Und wie bezaubernd liebenswürdig und leutselig konnte doch der Habsburger sein! Von dem Glanz der höchsten Würde war er selber am wenigsten geblendet. »Lieber Gesell,« so sagte er zu einem ihn bewundernden Poeten, »du kennst wohl mich und andere Fürsten nicht recht.« Aber diese Bewunderung der Dichter war ihm ein Lebenselement. Seine literarischen und künstlerischen Bestrebungen, für die er stets eine offene Hand hatte, dienten nicht zuletzt der Größe seines Hauses und seiner Machtpolitik. Mit dem verklärenden Schimmer der Volkstümlichkeit umstrahlt, erscheint der »letzte Ritter« im Faust des alternden Goethe.
Aber die historischen Taten waren es nicht, die Maximilians Gedächtnis im Volke lebendig erhielten. Die bunte Bewegtheit, die das ganze Zeitalter der Renaissance kennzeichnet, kam auch in der Fülle von politischen Ideen zum Ausdruck, die den Kaiser von einem Unternehmen zum andern trieben und seinen Handlungen, wie Ricarda Huch wohl zu schroff bemerkt, den Stempel »der oft bis zum Vernunftlosen und Kindischen gehenden Leichtfertigkeit« aufprägte. In der Politik des ebenso geistvollen wie phantastischen Herrschers steckte »etwas von der Aufregung seiner Jagdvergnügungen«, seine Kriegszüge erschienen mehr oder weniger als ritterliche Abenteuer großen Stils, wie er denn selbst Krieg, Turnier und Jagd in einen Topf wirft. »Und hab den Sommer«, so schreibt er 1478, »mit gueter Lust vertrieben, als mit Kriegen, Püchsenschießen, Veldtzuegen, Harnischfürn, auch darneben Tanzen und gestochen, gerennt und gejagt.«
Wie wenig der phantasievolle Kaiser mit den gegebenen Möglichkeiten zu rechnen verstand, das zeigt in wahrhaft grotesker Weise seine Schuldenwirtschaft, die nicht gerade geeignet war, den Glanz der Kaisergewalt zu erhöhen. Seine allzu große Freigebigkeit hat schon Machiavelli, der Theoretiker der »Staatsräson«, als einen schweren Mangel Maximilians, der sonst der beste Fürst sei, bezeichnet. Bei dieser seiner Eigenart würde er auch nicht das Auslangen finden, wenn die Bäume statt der Blätter lauter Dukaten trügen. Es ist bekannt, daß der Schöpfer des »Goldenen Dachls« in Innsbruck seine eigene Frau, jene Bianca Maria, die ihm aus Mailand ein starkes Heiratsgut zugebracht hatte, bereits nach zwei Jahren – verpfändete, so daß sie regelrecht ausgelöst werden mußte. Die »ewigen Geldnöte« aber waren wieder der Grund, daß der Herrscher, der ganz von den Gedanken des römischen Imperatorenrechts erfüllt schien, gerade das Element im Staatsleben, das er bekämpfen wollte, die Stände, stützte und stärkte, indem er sich an sie immer wieder um Hilfe wandte und ihnen damit auch das Recht gab, seine politischen Unternehmungen zu kritisieren.
Der Standpunkt der ständischen Reformpartei war kurz der: der »Expansion«, die Maximilian anstrebte, muß die »Konzentration«, die innerliche Festigung des Reiches, vorausgehen. »Wann aber auswendiger Krieg«, so heißt es in der Regimentsordnung von 1500, »gantz unvermöglich und unverfenglich, wo nicht vorhin redlich, gut Regiment, Gericht, Recht und Handhabung wäre, auf denen als Grundfesten alle Reich und Gewalt ruhen.« Der Kaiser aber wollte zuerst die Expansion: der sogenannte »Primat« der Außenpolitik ist von niemandem schärfer betont worden als von Maximilian I. Wollte er nun wirklich die deutsche Frage gleich Bismarck mit »Blut und Eisen« lösen, an der Spitze einer siegreichen Armee in Deutschland eine starke Monarchie aufrichten, dann kann man es nur zu sehr verständlich finden, daß die Reichsstände sich weigerten, zu ihrer Selbstvernichtung die Hand zu bieten, ihm die dazu erforderlichen Geldmittel zu bewilligen. Für die weltweite, abenteuernde Politik des kaiserlichen Romantikers besaßen sie keinerlei Verständnis – und sicherlich hatten sie nicht ganz so unrecht.
Weniger wäre mehr gewesen. Bei einiger Selbstbeschränkung hätte er der Begründer eines starken nationalen Staates, hätte die Einigung unter Österreich – noch waren die habsburgischen Erblande rein deutsch – erzielt werden können. In der »Atmosphäre des heraufziehenden Absolutismus« wäre ihm die Aufrichtung eines monarchischen Einheitsstaates nicht schwer gefallen, gar wenn er sich mit jenen tieferen, in Gärung befindlichen Volkselementen, von denen der Ruf nach einer Reform des Reiches, nach einem kraftvollen Herrscher erhoben wurde, verbunden hätte. Der Mangel an nationaler Geschlossenheit Deutschlands und der habsburgischen Länder hat aber auch die Ausbildung eines nationalen Kirchentums, durch welche die verhängnisvolle Kirchenspaltung hätte vermieden werden können, unmöglich gemacht. Alle diese großen Gelegenheiten wurden versäumt.

Kaiser Ferdinand I.
Ein »Mehrer des Reiches« ist Maximilian I. nur für seine Hausmacht geworden: die Bildung eines Großösterreich ist so recht sein Werk zu nennen. Seine Heirat mit Maria von Burgund schuf ihm in Westeuropa eine hervorragende Stellung, und die Ehe seines Sohnes Philipp des Schönen mit Johanna, der Tochter der katholischen Könige, führte zu der schicksalsschweren Verbindung mit der spanischen Weltmonarchie. Und durch die auf dem Wiener Kongreß von 1515 verabredete Doppelhochzeit mit den Jagellonen wurde auch der Anfall von Böhmen und Ungarn vorbereitet. Allein auch dieser unzweifelhafte Triumph der habsburgischen Heiratspolitik ward etwas teuer erkauft. Der »aggressive« Charakter Maximilians, der seinem Enkel Karl einschärfte, daß »ein römischer Kaiser von Rechts wegen ein Herr der ganzen Welt ist«, rief das national gefestigte, von allen Seiten eingeschnürte Frankreich auf den Kampfplatz. Das unangenehme Anhängsel der ungarischen Erbschaft aber bildete die unmittelbare Nachbarschaft der Türken.
Der Zweifrontenkrieg mit den Osmanen und Franzosen war die nächste Folge der dynastischen Politik Maximilians. Er hatte von einem großen Kreuzzuge gegen den Erbfeind der Christenheit geträumt, aber das Ende war, daß die habsburgischen Erblande dem Ansturme der Türken ungeschützt offenstanden. Und nicht die geringste Folge der ungehemmten Eroberungspolitik war eine schwer zerrüttete Finanzwirtschaft. Noch 1530 durfte sein Nachfolger zur Begründung einer größeren Geldforderung im niederösterreichischen Landtag die Erklärung abgeben: »und dann des Unvermögen und Erschöpfung unser Camerguts, welches wir im Anfang und Eingang unser Regierung, von wegen der trefflichen Krieg, die weylandt Kaiser Maximilian hochloblicher Gedächtnuß gegen den Venedigern und andern lange Zeit gefürt hat, hochbeswert und verpfend gefunden.«
Das Finanzübel aber brachte den Kaiser auch um den Erfolg seiner staatlichen Reformtätigkeit. Der »letzte Ritter« war bekanntlich zugleich der erste Vertreter des modernen Beamtenstaates, und seine Behördenorganisation, die in ihrer Art geradezu vorbildlich war, erschien wohl geeignet, der durch ihn vergrößerten Hausmacht auch die innere Festigung zu geben. Aber nun kommt die Kehrseite: Von dem neu eingerichteten Reichshofrat drückte sich ein Hofrat nach dem andern vom Amte, weil er kein Geld bekam, und die Klagen über die Bestechlichkeit der Beamten bekunden, daß die Stände in den neuen Behörden keineswegs jenes »gute« Regiment erblickten, um das sie dem Kaiser gegenüber vorstellig wurden. Die Geldkalamitäten Maximilians hatten auch in den Erblanden das Selbstbewußtsein der Stände, die sich durch das Beamtenregiment in ihrer Existenz schwerstens bedroht sahen, aufs neue gehoben.
Als Maximilian I. am 12. Januar 1519 im oberösterreichischen Wels – die Innsbrucker hatten dem todkranken Kaiser den Eintritt in die Stadt verweigert – sein tatenreiches Leben beschloß, stand alles in Frage. Nicht einmal die Nachfolge in den Hauslanden war geregelt. Erben waren seine beiden Enkel Karl und Ferdinand, die zur Zeit seines Todes in der Ferne weilten, der eine in Spanien, der andere in den Niederlanden. Mit ihnen tritt das Schicksal des deutschen Volkes in den Bannkreis der spanisch-burgundischen Herrscherfamilie.
Erscheint das Zeitalter der Renaissance überhaupt reich an interessanten Gestalten und Geschicken, so gilt dies ganz besonders von den Abkömmlingen dieses Hauses: es sind fast durchweg stahlharte, willensstarke und kluge Naturen, ganz vom Geiste des Machiavellismus erfüllt, rücksichtslos zur Macht drängend und meist tragisch endend. Da ist gleich der leichtlebige Vater der beiden Prinzen, Philipp der Schöne, der seine Gemahlin, die hochgebildete Johanna, durch seine Untreue zur Raserei bringen sollte. Nach dem Tode ihrer Mutter Isabella der Katholischen erscheint Philipp mit seiner Gemahlin, der Thronerbin, in Spanien, und nun entspinnt sich ein heftiger Kampf mit seinem Schwiegervater Ferdinand von Aragonien, der die Herrschaft über Kastilien an sich reißen wollte. Und als Philipp im September 1506 unerwartet rasch in die Gruft sank, trat der König gegen seine eigene Tochter auf.
Johanna wird im Schlosse von Tordesillas gefänglich verwahrt. Von ihrer Wohnung aus konnte sie das Grab ihres geliebten Gatten erblicken. Hat man das, wie behauptet wurde, absichtlich getan, um ihren Liebesgram wachzuhalten und die für regierungsunfähig erklärte Königin vollends dem Wahnsinn entgegenzutreiben? Daß die Unglückliche in ihrem Gefängnis nicht allzu zart und schonungsvoll behandelt wurde, geht aus dem höchst merkwürdigen Schreiben des Kerkermeisters hervor, worin sich dieser von Karl, ihrem Sohne, Verhaltungsmaßregeln erbittet. »Wenn Eure Majestät«, so heißt es da, »befiehlt, daß man gegen sie die Folter anwende, so würde man Gott einen Dienst erweisen und gleichzeitig der Königin selbst etwas Gutes tun.« Was meinte wohl der Mann, über dessen »Tyrannei« Johannas Tochter Katharina zu klagen fand? Man darf wohl annehmen, daß ihr religiöses Verhalten nicht korrekt erschien, wie sie denn seinerzeit von ihrer strengkatholischen Mutter ermahnt werden mußte. Es wird schwerhalten, jene Behauptung, Johanna sei das Opfer des »fanatischen Bekehrungseifers« und der rücksichtlosen Herrschsucht ihrer Familie gewesen, zu widerlegen. Die Kastilianer hatten sie stets als ihre rechtmäßige Herrin anerkannt.
Nach dem Hinscheiden Ferdinands von Aragonien, der noch einmal geheiratet und einen Sohn – das Kind starb freilich alsbald – bekommen hatte, schien sich der widerliche Streit um das spanische Erbe bei den beiden Enkeln wiederholen zu wollen. Früh verwaist, nicht von der zärtlichen Fürsorge der Eltern betreut, wuchsen die Knaben heran. Karl in den Niederlanden, Ferdinand am spanischen Hofe. An einem Novembertag des Jahres 1517 erscheint Karl in Spanien, um von dem Lande Besitz zu ergreifen. Zum ersten Male in ihrem Leben sehen sich die beiden Brüder und stehen sich als Rivalen gegenüber. Ferdinand, der am 10. März 1503 in Alcalá de Henarez, der Stadt, wo später Cervantes geboren ward, zur Welt gekommen und von den Spaniern als ihr »König« angesehen worden war, wird aus seiner Heimat hinausgedrängt und zieht in das Land, von wo Karl hergereist war.
Ferdinand wird uns als ein hübscher Knabe mit blondem Haar und großen schönen Augen geschildert. Er war nach allgemeiner Meinung freundlicher und lebhafter als sein Bruder; aber den in der Familie tief eingewurzelten Ehrgeiz hatten sie beide. Was sollte nun aus ihm werden? Sein Großvater Maximilian hatte über seine Zukunft wiederholt Pläne geäußert, und es lag ganz in der Natur des gedankenreichen, beweglichen Kaisers, daß auch sie rasch wechselten. Einmal will er ihn zum König von Neapel, ein andermal wieder zum Beherrscher Österreichs machen – aber immer mußte der ältere Bruder seine Zustimmung geben.
So war die Situation, als Kaiser Maximilian starb. Die beiden Brüder müssen sich ihr Erbe buchstäblich erst erkämpfen, und sie bekunden bei dieser ihrer ersten Kraftprobe eine ganz erstaunlich glückliche und feste Hand.
In den österreichischen Erblanden hatte sich ein gefährlicher Sturm erhoben, der sich gegen das vom verstorbenen Kaiser geschaffene Beamtentum, die Bureaukratie, wie man sie später nennen sollte, richtete. Die Stände, schon lange erbittert über die neuen Zentralämter, über den Vorstoß des landesfürstlichen Absolutismus, der ihre Freiheiten mit dem Untergang bedrohte, nötigten das von Maximilian eingesetzte Regiment dazu, sich nach Wiener Neustadt zurückzuziehen, und übernahmen selber die Regierung. Doch schickten sie Gesandte zu beiden Brüdern, um ihr Vorgehen zu rechtfertigen und zu bitten, daß wenigstens einer der neuen Landesherrn nach Österreich kommen möge. Daß nun Karl der ständischen Abordnung eröffnen ließ, sie hätten für jetzt und die nächste Zeit wichtigere Dinge zu tun, als ihre Erbländer aufzusuchen, wirkte gerade auch nicht beruhigend auf diese. Zum Glück für die Brüder brachen innerhalb der Ständeschaft Gegensätze aus, die zu einer vollständigen Isolierung der radikalen Gruppe, der Niederösterreicher und Wiener, führen sollten.
Karl war in der Tat mit überaus wichtigen Angelegenheiten beschäftigt. Um die durch Maximilians Tod erledigte Kaiserkrone entspann sich ein erbittertes Ringen mit dem Franzosenkönig Franz I., der mit Bestechungsgeldern nicht geizte, aber es gelang Karl, seinen Gegner aus dem Felde zu schlagen, – und am 28. Juni 1519 wurde er einstimmig zum römischen König gewählt.
Der Staatsrechtslehrer Samuel Pufendorf hat diese Kaiserwahl den verhängnisvollen Wendepunkt in der deutschen Geschichte genannt. Mit Karl bestieg das Mittelalter und der Gedanke des Weltimperiums den Thron, und dies just in einem Augenblick, da es galt, zu einer der schwierigsten und bedeutungsvollsten Fragen Stellung zu nehmen – der Tat des Augustinermönchs Martin Luther, der am 31. Oktober 1517 seine berühmt gewordenen fünfundneunzig Thesen an die Schloßkirche von Wittenberg angeschlagen und damit einen gewaltigen Brand entfacht hatte.
Der verstorbene Kaiser scheint eine Ahnung von der großen Bedeutung dieser aus der tiefsten Seele des deutschen Volkes entsprungenen Bewegung gehabt zu haben, soll er doch gesagt haben: Man möge den Mönch fleißig bewahren; denn man wisse nicht, zu was man ihn brauchen könne. Maximilian, der stets mit dem Gedanken einer Kirchenreform beschäftigt und der Idee einer deutschen Nationalkirche nähergetreten war, der einmal die Frage aufgeworfen hatte, »ob nicht jeder Monotheist in seiner Religion selig werden könne?«, wäre wohl imstande gewesen, der Reformation eine heilbringende Richtung zu geben. Aber war dies auch von dem undeutschen Karl V. zu erwarten?
An Mahnungen, die Situation für Deutschland auszunützen, hat es wahrhaftig nicht gefehlt. »Tag und Nacht will ich Dir dienen ohne Lohn,« so rief ihm Ulrich von Hutten begeistert zu, »manchen stolzen Helden will ich Dir aufwecken. Du sollst der Hauptmann sein, um die römische Zwingherrschaft zu zerbrechen und Deutschlands Recht und Freiheit wiederherzustellen.« Und der Reformator selber sprach in seiner Kampfschrift »An den christlichen Adel deutscher Nation« erwartungsvoll von dem jungen, edlen Blut, »das ihnen Gott zum Haupte gegeben und damit viel Herzen zu großer guter Hoffnung erweckt habe.«
Allein Karl V. überhörte diesen Weckruf, der ihm aus der Führerschichte des deutschen Volkes entgegenschallte. Der Herrscher, der sich rühmte, daß in seinem Reiche die Sonne nicht untergehe, war für das Wohl und Wehe Deutschlands unempfänglich. Der Geist, der ihn beseelte, war der Spaniens mit seiner Inquisition und seinen Glaubensgerichten, wie ihn die Jahrhunderte währenden Kämpfe gegen Andersgläubige großgezogen hatten. In Worms, auf seinem denkwürdigen ersten Reichstag, wo er mit dem deutschen Mönch zusammentraf, hat er über den »Ketzer« den Stab gebrochen. Das Wormser Edikt vom 8. Mai 1521, das Martin Luther und seine Religion in Acht und Bann tat, war der »Absagebrief Karls V. an die deutsche Nation«. Nicht mit Unrecht hat ihn Napoleon einen Narren geheißen, weil er den großen Augenblick versäumt habe, um an der Spitze der Nation die deutschen Fürsten und die päpstliche Allmacht zu stürzen, Deutschland zu einem Einheitsstaat und damit zur ersten Macht der Erde zu erheben. In der Tat war es die »großartigste« Gelegenheit, die sich in der deutschen Geschichte jemals geboten hat, mit einmütiger Unterstützung der Nation zu einer einheitlichen und mächtigen Gestaltung des Vaterlandes zu gelangen. Oft mag Karl später Anwandlungen von Reue gehabt haben, als er gegen eine Welt von Feinden im Kampfe stand, als ihm die ganz einzig geartete Koalition – die deutschen Ketzer, der »allerchristlichste« König, der Heilige Vater in Rom und die Türken – hart und immer härter zusetzte.
Allein fürs erste ging alles für Karl glücklich vonstatten. Auch in Spanien hatte sich gegen den »Fremden« ein furchtbarer Aufstand erhoben, aber in der Schlacht von Villalar – im April 1521 – wurden die »Comuneros« niedergeworfen, damit freilich auch die Kraft des Bürgertums, die Wurzel des Volkswohlstandes, tödlich getroffen. Und zur selben Zeit bezwang sein Bruder Ferdinand, dem er in einem Geheimvertrag die Herrschaft über die österreichischen Länder überlassen hatte, die Ständerevolution. Ohne Wien, den Hauptherd der Aufruhrbewegung, zu berühren, war der Erzherzog von den Niederlanden aus nach Wiener Neustadt geeilt, um hier, ganz nach den Vorschriften Machiavellis, ein Exempel zu statuieren. Im August 1522 fielen auf dem Marktplatz die Häupter der zwei Adligen Eitzing und Pucheim, dann des Stadtrichters Siebenbürger und fünf anderer Bürger.
Das Wiener Neustädter Blutgericht, das in der Erinnerung noch lange fortleben sollte, war nun freilich nicht geeignet, dem neuen Landesherrn die Herzen der Österreicher, die an ein patriarchalisches Verhältnis zum Herrscherhause gewöhnt waren, zu gewinnen. Sicherlich war er überzeugt davon, daß er wirklich »Gnade für Recht« habe ergehen lassen, indem er nur die Rädelsführer, nicht auch die Irregeleiteten, hatte hinrichten lassen, und man braucht nicht anzunehmen, daß er schon aus übler Erfahrung sprach, wenn er drei Monate später sich bemüßigt fühlte, seinem älteren Bruder die Mahnung zu erteilen, den Aufständischen in Spanien gegenüber zugleich mit der Gerechtigkeit auch Mitleid und Milde walten zu lassen, damit man wohl gefürchtet, aber auch geliebt werde. Der Liebe der Österreicher stand auch im Wege, daß sie nicht Spanisch und er nicht Deutsch verstanden.
Indes ging Ferdinand unbeirrt seinen Weg weiter. Die ständischen und städtischen Freiheiten werden in spanische Stiefel geschnürt, Polizeiordnungen erlassen, durch welche das ganze bürgerliche Leben, auch – und nicht zuletzt – der sittliche Wandel, geregelt erscheint. Strenge Mandate ergehen gegen die Ausbreitung der neuen Lehre und bald flammen auch in Wien, seiner Residenzstadt, Scheiterhaufen auf. Freilich lenkt hier der Erzherzog, der auch ebenso klug als energisch war, bald ein, als er sah, daß er, um den Geboten Folge zu leisten, nahezu die gesamte Bevölkerung Österreichs dem Henker hätte überliefern müssen. Er unternahm es daher, das Übel an der Wurzel zu fassen, die oft und oft gerügten Schäden an der alten Kirche zu heilen, und hier gab es wahrhaftig genug zu tun. Wie schlecht es um diese bestellt war, dafür liefert der Wiener Bischof Revellis ein merkwürdiges Zeugnis, indem er sich weigerte, einen Wiedertäufer in den im Bischofshofe gelegenen Kerker aufzunehmen – mit der Begründung, er habe schon sehr oft »Pfarrer, Kuraten und andere schlechte Menschen« eingesperrt, die durch einen Häretiker noch mehr verdorben würden. Und nicht minder trostlos sah es in den Klöstern aus. Der Prior der Karmeliter saß wegen Ehebruchs im Universitätskerker und eine Nonne von St. Klara war niedergekommen, ohne daß der Bischof eine Strafe verhängen konnte, da dieses Kloster nicht seiner Gerichtsbarkeit, sondern Rom unterstand. Mit fester Hand hat Ferdinand auch hier reformierend eingegriffen. Auf allen Gebieten, so kann man sagen, verstand er es, Ordnung zu schaffen; er hat so recht den modernen Beamten- und Wohlfahrtsstaat in Österreich begründet.
Und es währte nicht lange, so strebte der also innerlich gefestigte Hausstaat auch über seine räumlichen Grenzen gewaltig hinaus. Ferdinand hatte der auf dem Wiener Kongreß von 1515 geschlossenen Heiratsabrede gemäß am 11. Dezember 1520 mit Anna, der Schwester König Ludwigs von Böhmen und Ungarn, sich vermählt, der seinerseits die Infantin Maria, eine Schwester Ferdinands, heimführte. Da trat nun das welthistorisch bedeutungsvolle Ereignis ein: Ludwig, der letzte Jagellone, findet in der großen Türkenschlacht bei Mohács – am 29. August 1526 – nebst vielen Großen seines Reiches den Tod. So waren die beiden Kronen erledigt, und Ferdinand säumte nicht, seine Ansprüche anzumelden. Aber nur in Böhmen gelingt es ihm, die Krone zu erlangen; in Ungarn dagegen wählt ein Teil der Großen einen einheimischen Adligen, Johann Zápolya, zum König.
Ferdinand muß sich also die Herrschaft über Ungarn erst erkämpfen. Ende Juli rückt er gegen Zápolya ins Feld. Schwer mag ihm der Abschied von seiner geliebten Gattin gefallen sein, denn Anna, die ihm bereits eine Tochter – es war Elisabeth – geboren hatte, erwartete in der nächsten Zeit ihre Niederkunft. Auf dem Wege nach der Krönungsstadt Ofen, die im Besitze seines Gegners sich befand, ereilte ihn die Nachricht von der Geburt seines ersten Sohnes.
Der erwartete Thronfolger kam am 1. August 1527 »gegen der Nacht« zur Welt und erhielt bei der vier Tage später vollzogenen Taufe nach seinem Urgroßvater den Namen Maximilian.
Es ist leider nichts darüber bekannt, wie im Augenblick seiner Geburt die Konstellation der Gestirne, die nach der Sitte jener Zeit genauestens beobachtet wurde, beschaffen war. Politisch genommen stand sie im Zeichen des Kampfes, der ersten Machterfolge des Hauses Habsburg, aber auch des entschiedenen Gegenstrebens. Der Franzosenkönig Franz I. wird in der Schlacht von Pavia, am 24. Februar 1525, entscheidend geschlagen, gerät in des Kaisers Gefangenschaft und entsagt im Madrider Frieden vom Januar 1526 allen Ansprüchen auf Italien und Burgund. Und im Jahre darauf wird auch der Papst auf das empfindlichste gedemütigt. Im Mai 1527 dringen kaiserliche Soldaten in die ewige Stadt ein, plündern und brandschatzen sie in vandalischer Weise, Klemens VII. wird verhöhnt und gefangengenommen, die fast durchweg lutherischen Landsknechte treiben mit den Insignien des Papstes und den kostbaren Reliquien ihren Spott und rufen angesichts des Heiligen Vaters Martin Luther zum Papst aus. Der Söldnerhauptmann Sebastian Schärtlin von Burtenbach schildert die Szene, da seine Landsknechte in die Engelsburg eingedrungen waren und in den Kreis der erschreckten Kardinäle traten, kurz und vielsagend: »war ein großer Jammer unter ihnen, wurden wir alle reich«.
Der »Sacco di Roma« von 1527, dem Geburtsjahr Maximilians, ist zu einem welthistorisch bedeutungsvollen Markstein in der Geschichte der Gegenreformation geworden. Die Verwüstung der päpstlichen Hauptstadt wurde als Strafgericht Gottes über das sündhafte, im heidnischen Schönheitskult der Renaissance versunkene Italien aufgefaßt. Kaum zehn Jahre darauf wird unter Paul IV. nach spanischem Muster die Inquisition eingeführt – »über die zertretenen Keime des Evangeliums und über die abblühende Kultur der Hochrenaissance legt sich mit schwerer, rauher Hand die katholische Restauration«. Unter dem Eindruck dieser verdüsterten Seelenstimmung malt Michelangelo sein »furchtbares« Jüngstes Gericht, diese »Verherrlichung unerbittlicher Gerechtigkeit«, und einer der frivolsten Humanisten Pietro Aretino, konnte sich an den nackten Leibern stoßen, die dann auch sorgfältig übermalt werden mußten.
So bereitete sich in Rom der Rückschlag gegen die neue Lehre vor, die in Deutschland just damals im besten Vordringen war und gerade die führenden Kreise im Staat wie in der Gesellschaft derartig durchdrang, daß Ferdinand, die Unmöglichkeit erkennend, mit einem Schlage hier Wandel zu schaffen, sich veranlaßt sah, mit dem Ketzertum zu paktieren. Immer mehr sollte sich der Habsburger, der mit seinen spanischen Gewaltmethoden und Schreckmitteln die Herrschaft begonnen, zu einem rechten deutschen Fürsten milderer Denkungsart entwickeln. Dies um so mehr, als sich die ungarische Frage, die Ferdinand kurz vor der Geburt Maximilians angeschnitten hatte, immer ungünstiger gestaltete und zur Bedachtnahme auf die Wünsche der erbländischen Stände mahnte. Zeit seines Lebens sollte Ferdinands Sohn über diesen Konflikt nicht hinauskommen.
Doch zunächst wandelte der junge Maximilian unter einem guten Stern: es war ihm das Glück beschieden, unter der Obhut zärtlicher, fürsorgender Eltern heranzuwachsen. Über die Mutter wissen wir nicht viel mehr, als was der venezianische Gesandte im Jahre 1547, bald nach ihrem Tode, berichtet, und wenn man will, so war es viel; es hört sich wie eine Umschreibung des Dichterwortes an: »Ihr schöner Lebenslauf war Liebe.« »Die Königin Anna«, so schreibt er, »war in Wahrheit von überaus großer Schönheit der Seele und des Körpers und liebte so sehr den König und dieser sie, daß sie durch sechsundzwanzig Jahre, welche sie miteinander lebten, das Muster einer wahrhaften Ehe waren; sie gebar dem König fünfzehnmal mit Erfolg, von welchen zwölf Kinder leben, drei Söhne und neun Töchter, alle im ganzen schön …«

Kaiserin Anna, Gemahlin Ferdinands I.
Neun Töchter! Dies war ein politisch sehr wertvolles Kapital. »Die Töchter«, so belehrte Ferdinand einmal seinen Sohn, »müssen von den Fürsten dankbarer begrüßt werden als die Söhne; denn diese zerreißen die Staaten, jene aber schaffen Verschwägerungen und Freundschaften.« Doch auch sonst, vom rein menschlichen Standpunkt, mag die zahlreiche Kinderschar für die Eltern ein wahrer Segen gewesen sein; denn die Söhne wie die Töchter werden uns allgemein als gutgeraten geschildert. Der Kardinallegat Aleander, der im Jahre 1538 die Familie Ferdinands sah, glaubte einen Engelchor vor sich zu haben: so schön, so bescheiden, so gut erzogen in Wissen und Glauben erschienen sie ihm. Der venezianische Gesandte Giustiniani bezeichnet zwei Jahre später Maximilian als »groß, schön und ernst« und fand seinen nächstältesten Bruder Ferdinand noch schöner und freundlicher. Aber allen fiel bei jenem die »große Lebhaftigkeit« seines Geistes auf. An geistigen Fähigkeiten scheint Maximilian alle seine Geschwister überragt zu haben.
Die Prinzen und Prinzessinnen dürften auch nicht gerade verwöhnt worden sein. In einer Weisung Annas an die Erzieher ihrer Töchter heißt es sehr resolut: »Gebet ihnen ein schwarze Partecken (= Stück Brot) oder vier und lassends aufschroten, und wenn sie dürstet, so gebet ihnen ein sauren Wein oder dünn Bier; wollen sie es nit trinken, so bringet ihnen den Wasserkrug, alsdann wird ihnen besser.« Daß aber im Verkehr der Eltern mit ihren Kindern ein gemütlicher Ton herrschte, bezeigt der Kosename »Äffchen«, mit welchem die Erzherzogin Anna, der dritte Sprößling, belegt wurde. Den Söhnen gegenüber hielt Vater Ferdinand – dies war noch ganz spanische Art – auf Einhaltung gewisser Förmlichkeiten, um das Gefühl der Ehrfurcht und Obedienz zu wecken: in seiner Gegenwart hatten sie unbedeckten Hauptes, mit dem Barett in der Hand, zu stehen, und sich erst dann, wenn ein Wink es ihnen gestattete, zu setzen.
Die ersten Knabenjahre verlebte Maximilian im Kreise seiner Geschwister im schönen Innsbruck, der Lieblingsstätte seines kaiserlichen Urgroßvaters, und an diesen langjährigen Aufenthalt in der Hauptstadt Tirols erinnert auch die eigentümliche Ausdrucksweise, der er sich in seinen Briefen – er schrieb »Schprache« statt Sprache – bediente. Die Erziehung war die damals bei Prinzen übliche: Unterricht und Spiel waren genau geregelt; man las Klassiker und huldigte besonders dem Brettspiel. Als Lehrer begegnen uns die beiden hochangesehenen Professoren der Wiener Universität Kaspar Ursinus Velius und Georg Tannstetter. Im Unterricht spielte die Kenntnis der Sprachen eine hervorragende Rolle. Maximilian beherrschte nicht weniger als sieben Sprachen, nebst der deutschen die französische, spanische, italienische, tschechische, ungarische und lateinische. Als nach seinem Tode, so berichtet ein venezianischer Gesandter, die Ärzte das Gehirn untersuchten, fanden sie dasselbe trocken und warm und meinten diese Erscheinung auf »die große Zahl der Sprachen, die er verstand, die Kenntnis so vieler Dinge sowie die Klugheit und Geschicklichkeit, die man an ihm bewunderte«, zurückführen zu müssen.
Man darf annehmen, daß auch, und nicht zuletzt, auf die religiöse Erziehung die größte Sorgfalt verwendet wurde, und vielleicht hatte Ferdinand vornehmlich aus diesem Grunde die stärkende Tiroler Luft gewählt, um seine Kinder vor der Gefahr der Ansteckung durch die »Seuche« des Protestantismus besser bewahren zu können. Allein gerade in diesem Punkte scheint etwas nicht in Ordnung gewesen zu sein. In das Dunkel, das die Jugend auch der Höchstgeborenen zu verhüllen pflegt, dringt plötzlich wie ein greller Blitz die Nachricht von einer ganz merkwürdigen Szene am Hofe Ferdinands.
Wir hören – der Nuntius Fabio Mignanelli und der Kardinallegat Girolamo Aleander berichten es übereinstimmend nach Rom – von einer Beratung, die König Ferdinand im Oktober 1538 zu Linz in Gegenwart seiner beiden Söhne Maximilian und Ferdinand, seiner ältesten Tochter Elisabeth und des Bischofs von Trient über die Wiederbesetzung mehrerer Hofämter abgehalten hatte. Diese Beratung war, so vernehmen wir weiter, lang und schwierig, weil es an Leuten fehlte, die im Punkte des Glaubens als sicher gelten durften. Aber endlich wurde die Ernennung der neuen Minister und Erzieher vollzogen, und nun hielt der König an sie und die anderen Hofbeamten eine Ansprache, die sich seltsam genug ausnimmt. Sollte sich jemand unterstehen, erklärte er drohend, mit seinen Kindern etwas von der neuen Lehre zu reden und sie von dem wahren Weg abzulenken versuchen, dann würde er ohne Ansehen der Person und des Standes den Schuldigen köpfen lassen; die Söhne aber wolle er, falls sie ihm einen solchen Versuch nicht sofort anzeigten, körperlich züchtigen. Erschrocken vernahmen die Anwesenden die zornvollen Worte des Königs.
Was war der Grund für diesen auffallenden Vorgang? Sicherlich hing er mit einem anderen Vorfall zusammen, der sich kurz vorher abgespielt hatte – der Entlassung Wolfgang Schiefers, eines der Erzieher der Prinzen. Schiefer, ein Elsässer, war seinerzeit ein Schüler und Tischgenosse Martin Luthers gewesen, und diese Verbindung mit Wittenberg trat auch jetzt in die Erscheinung. Der gemaßregelte Lehrer wurde von Luther und Melanchthon dem Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen als Erzieher für dessen Söhne empfohlen, und in dem Empfehlungsschreiben heißt es, daß Schiefer, »so vor fünfzehn Jahren zwei Jahre lang zu Wittenberg studiert und König Ferdinands Sohne Praeceptor gewest, aber des Evangelii halber Verfolgung erlitten«, zu dem Schulmeisteramt wohl tauge.
Man darf wohl annehmen, daß König Ferdinand von dem protestantischen Vorleben und der Gesinnung Schiefers keine Ahnung hatte, aber bei einer größeren Sorgfalt in der Auswahl des Erziehers wäre der Skandal, daß Schiefer tatsächlich in die Seele des jungen Thronfolgers »den Samen der neuen Lehre pflanzen« konnte, nicht so leicht möglich gewesen. So ist es denn zu erklären, daß später Papst Paul IV. gegen den König den Vorwurf erhob, er habe Maximilian unter lutherischer Aufsicht erziehen lassen.
Allerdings – eine solche Auswahl mag unter den damaligen Verhältnissen, da die Lehrmeinungen der katholischen Kirche noch vielfach schwankten und Anhänger des Evangeliums sich mit vollster Überzeugung als »katholisch« bezeichneten, nicht immer leicht gewesen sein. Nicht zuletzt war der König doch auch auf den Rat seiner Minister angewiesen, die nicht alle in religiöser Hinsicht zuverlässig waren. Gar so übertrieben war es sicherlich nicht, wenn der Erzbischof von Lund vier Jahre vorher gegen Kaiser Karl V. sich beklagt hatte, daß es am Hofe Ferdinands nur wenige gebe, »welche nicht nach dem Luthertum rochen«. Man wird es aber jetzt verstehen, daß die Beratung in Linz, die sich um den Nachfolger Schiefers drehte, so lang und schwierig war und die Vorsichtsmaßregeln, so weit dies möglich war, verschärft wurden. In der Weisung für den Erzieher des dritten Sohnes Karl heißt es: »Er soll den Prinzen zum gesunden, tauglichen, freundlichen und vor allem christlich-frommen Menschen heranbilden, deshalb auf gutes Beispiel in der Um- und Untergebung desselben strenge sehen, durchaus niemanden ohne sein Wissen, weder bei Tag noch bei Nacht, zu ihm lassen …«
Allein was nützten alle noch so strengen Gebote und Maßnahmen zur Fernhaltung der ketzerischen Einflüsse, wenn die Politik des Kaisers wie des Wiener Hofes selber mit den Ketzern sich verbündete – wohl oder übel sich verbünden mußte! Die Macht des deutschen Protestantismus befand sich seit dem Wormser Edikt, das ihn mit Acht und Bann belegte, in beständigem Aufstieg: gerade mit den dreißiger Jahren beginnt die eigentliche Glanzzeit der neuen Lehre. Nachdem im Jahre 1534 das Herzogtum Württemberg für das Evangelium gewonnen worden war, wandten sich ihm fünf Jahre später die Beherrscher zweier der größten Territorien des Reiches zu, die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg. Im Jahre 1542 wird auch in Braunschweig die Reformation eingeführt, und schon beginnt sie in die geistlichen Länder, wie das Kurfürstentum Köln, erfolgreich einzudringen.
Solchen reißenden Fortschritten gegenüber waren die Habsburger vollkommen machtlos; denn die Türken und die Franzosen nahmen ihre ganze Kraft in Anspruch. Insbesondere die Lage in Ungarn gestaltete sich derart bedrohlich, daß man nicht nur nicht daran denken konnte, die protestantischen Fürsten zu bekämpfen, sondern bemüht sein mußte, ihre Hilfe zu gewinnen. Nach dem großen Türkensturm von 1529 war nahezu das ganze Land der heiligen Stephanskrone in den Besitz des Fürsten Zápolya gekommen. Es gelang aber Ferdinand in der Folge, sich mit seinem Rivalen zu verständigen. In einem Geheimvertrag, der am 24. Februar 1538 zu Großwardein geschlossen wurde, kam man dahin überein, daß Zápolya wohl den Teil Ungarns, den er zur Zeit in der Hand hatte, als selbständiges Königtum behalten, nach seinem Tode aber sein ganzes Land an Ferdinand fallen sollte.
Als aber ein paar Jahre darauf, am 21. Juli 1540, Zápolya starb und ihm sein minderjähriger Sohn Johann Siegmund folgte, brachen die Türken in Ungarn ein und besetzten Ofen – Ungarn wurde eine türkische Provinz. Die Gefahr einer Überflutung nicht nur der habsburgischen Länder, sondern auch Deutschlands war wiederum nähergerückt, und der Gesandte Ferdinands durfte, als er hilfesuchend bei den Reichsfürsten vorsprach, zur Begründung seines Begehrens geltend machen, daß es sich darum handle, »Deutschland selbst in Ungarn zu retten«. In der Tat raffte sich der Speirer Reichstag von 1542 zu einer Türkenhilfe auf, aber der Feldzug des Reichsheeres unter Führung des Kurfürsten Joachim von Brandenburg, der »durch gänzliche Abwesenheit aller kriegerischer Tugenden glänzte«, verlief recht kläglich. Es kam wirklich so, daß die Armee, die am 10. Juli von Wien aufbrach und langsam auf Pest vorrückte, »nur dem Kriegsruf der Deutschen, nicht aber den Türken gefährlich wurde«. Es fehlte, wie König Ferdinand wehmütig bemerkte, »an dem Gehirn für gute Führung, nicht an Leuten und Sachen«.
Auf dem nächsten Reichstag, der sich im Januar 1543 zu Nürnberg versammelte, erschien König Ferdinand in Begleitung Maximilians, um neuerdings die Unterstützung der Reichsstände für den Türkenkrieg in Anspruch zu nehmen. Die protestantischen Fürsten erklärten brüsk, vor Erfüllung ihrer religiös-politischen Wünsche jede Hilfe ablehnen zu müssen. Die katholischen Stände aber weigerten sich, auf diese Bedingung einzugehen, und ihnen schlossen sich die Gesandten des evangelisch gesinnten Herzogs Moritz von Sachsen an. Das Ergebnis war, daß König Ferdinand keine Reichshilfe bewilligt erhielt.
Für den damals sechzehnjährigen Thronfolger, der zum ersten Male einem Reichstag beiwohnte, bildete der negative Ausgang der Verhandlungen sicherlich einen politischen Anschauungsunterricht von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Er hatte auch Gelegenheit zu sehen, wie der Albertiner Moritz, der eine durchaus neutrale Stellung zwischen dem Bunde der Schmalkaldner und dem Kaiser eingenommen hatte, von beiden Teilen eifrigst umworben wurde.
Von Nürnberg reisten Vater und Sohn nach Prag, wo Maximilian die Bekanntschaft mit jenem Fürsten machte, der später einer seiner besten Freunde aus dem lutherischen Lager werden sollte – August von Sachsen, dem Bruder des Herzogs Moritz. Der Kaiser hatte es darauf angelegt, die hochbegabten Albertiner, die mit dem Kurfürsten von der ernestinischen Linie in Fehde standen, von dem Schmalkaldner Bund abzuziehen und für den Kampf gegen die Türken, Franzosen und nicht zuletzt die deutschen Protestanten zu gewinnen. Herzog Moritz, der bereits an dem letzten Türkenfeldzug teilgenommen und ob seiner Kühnheit um ein Haar den Reitertod gefunden hätte, wurde von Ferdinand, sobald er Kunde erhalten hatte, daß die Türken von Ofen donauaufwärts zögen, »flehend« gebeten, ihm Truppen zu schicken.
So waren es denn Kaiser Karl V. und sein Bruder selber, die den Thronfolger in nahe Berührung mit Protestanten brachten – eine Tatsache, die aus dem Grunde unterstrichen zu werden verdient, weil Maximilian später dieser Umgang mit Ketzern schwer verübelt werden sollte.
Schon das nächste Jahr gab dem Thronfolger Gelegenheit, seine politische Schulung zu vervollkommnen. König Ferdinand hatte sich entschlossen, ihn und den zweitältesten Sohn Ferdinand an den Kaiserhof zu führen. Hier sollte Maximilian vier Jahre verleben und Zeuge von welthistorischen Ereignissen werden, die, schon lange vorbereitet, über die deutschen »Ketzer« und »Rebellen« hereinbrachen.
Am 11. März 1544 zog der König mit den zwei Erzherzögen in der alten Kaiserstadt Speyer ein, wohin die Reichsstände zusammenberufen worden waren. Diese Tagung, die im Zeichen des neuen Waffenganges gegen Frankreich stand, bedeutete wohl den Höhepunkt der Machterfolge des Protestantismus: Kaiser Karl V. sagte den Lutheranern die Berufung eines freien Konzils, beziehungsweise die Regelung der religiösen Frage auf einem Reichstag zu. Dafür bekam er eine stattliche Hilfe bewilligt, und er konnte in einem glänzend durchgeführten Feldzug, an welchem Maximilian und die beiden Albertiner Moritz und August teilnahmen, die Franzosen niederringen.
Im Frieden von Créspy, der am 16. September unterschrieben wurde, verpflichtete sich König Franz, den Kaiser gegen die Türken zu unterstützen, schnitt aber im übrigen derart gut ab, daß man sich auf kaiserlicher Seite baß darüber wunderte. Der französische König, wurde spitz gesagt, hätte solche Bedingungen stellen können, wenn er ebenso nahe bei Madrid gewesen wäre, wie Karl bei Paris. Allein der Kaiser wußte recht gut, warum er seinen Gegner derart schonte: er war entschlossen, endlich einmal die deutsche Ketzerei auszurotten, und brauchte die Sicherheit, daß der französische König den Schmalkaldnern nicht beispringen werde, die denn auch gegeben wurde. Der Friede wurde durch eine Heiratsabrede gekrönt: Herzog Karl von Orléans, der zweite Sohn des Königs, sollte mit der Hand Marias, der Tochter des Kaisers, die Niederlande oder als Gemahl einer Tochter König Ferdinands Mailand erhalten.
Nach einem längeren Aufenthalt in Brüssel, wo es wie in Créspy zahlreiche Festlichkeiten gab und Maximilian auch dem merkwürdigen, selbst für die damalige Zeit befremdenden Einzug der Herzogin von Étampes, der Maitresse des französischen Königs, an der Seite seiner rechtmäßigen Gemahlin, beiwohnte, ging es nach Worms. Hier wurde über die schwerwiegende Frage der kirchlichen Einigung, freilich ohne Erfolg, verhandelt; denn die Katholiken wollten sie auf dem eben eröffneten Konzil von Trient zur Entscheidung bringen, während die Protestanten auf der Einberufung eines Nationalkonzils beharrten. Im Juli 1545 verabschiedete sich Maximilian vom Kaiser, um sich zunächst mit seinem Vater nach Böhmen zu begeben.
Ein Jahr später findet sich Maximilian wiederum am Hofe seines kaiserlichen Oheims in Regensburg ein. Im Juni 1546 war der Kronprinz mit seiner Mutter und mehreren Geschwistern in die alte Reichsstadt gekommen. Wichtige Familienereignisse standen bevor. Am 4. Juli beging man die Hochzeit der Erzherzogin Anna, die Ferdinand am 7. Juli 1528 als drittes Kind geboren war, mit Albrecht, dem einzigen Sohne Herzog Wilhelms IV. von Bayern, und bei den sich ihr anschließenden Festlichkeiten erhielt Maximilian vom Kaiser den Orden vom goldenen Vlies. Zwei Wochen darauf fand in gleich feierlicher Weise die Trauung Marias, die am 15. Mai 1531 zur Welt gekommen war, mit dem Herzog Wilhelm von Jülich-Cleve statt, außerdem wurden Eheverbindungen der Erzherzoginnen Magdalena und Katharina mit Emanuel Philibert von Savoyen und mit Franz Gonzaga von Mantua verabredet. Am 20. Juli verabschiedete sich das Königspaar von Karl. Bei der Trennung Maximilians von seinen Eltern und Geschwistern ging es »nicht ohne Tränen« ab – seine Mutter sollte er nicht wiedersehen.
Kaiser Karl V. stand unmittelbar vor Ausbruch des Schmalkaldner Krieges, der bisher immer verschoben und in der letzten Zeit in aller Heimlichkeit vorbereitet worden war. Schon in Worms hatten die Spanier in der Umgebung des Kaisers ganz unverhüllt von der kommenden Abrechnung mit den deutschen Ketzern gesprochen. Noch hütete sich Karl, ihr den Anstrich eines Religionskrieges zu geben und die Maske vor der Zeit fallen zu lassen, wie ja denn auf dem Wormser Reichstag die Frage des kirchlichen Ausgleichs behandelt wurde. Noch vor seiner Abreise nach Regensburg, wohin er die Reichsstände berufen hatte, ließ er das Gerücht verbreiten, er denke an einen Zug nach Algier. Auf eine Anfrage der Protestanten, was er mit seinen Rüstungen bezwecke, wurde ihnen die Antwort zuteil: Karl wolle nichts anderes als Einigkeit und Frieden im Reiche herstellen; gegen die Ungehorsamen aber müsse er nach dem Recht und kraft seiner Autorität verfahren. Und die Tatsache, daß so viele Protestanten im Lager des Kaisers bereitstanden, gegen die Schmalkaldner zu Felde zu ziehen, gab der offiziellen Angabe einen Schein von Berechtigung, wie es auch in einem Volksliede hieß:
»Drumb ist es nur ein bloßer Schein,
Damit die Sach muß gfärbet sein.«
In der Tat war es dem Kaiser gelungen, den Herzog Moritz von Sachsen, nach dem er schon seit Jahren seine Netze ausgeworfen hatte, einzufangen, indem er ihm die Schutzherrschaft über die Stifter Magdeburg und Halberstadt und überdies noch Kur und Land seines Vetters Johann Friedrich in Aussicht stellte. Und ebenso wurden Erich von Braunschweig, Hans von Küstrin und der Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Bayreuth gewonnen.
Zu spät erkannten die Schmalkaldner den Ernst der Lage. Es gab für sie jetzt kein anderes Mittel als, wie sich ein Augsburger ausdrückte, »schändlich von Gott und aller Ehrbarkeit zu weichen oder zu fechten«. Sie wählten das letztere, aber wiederum trat dabei die politische Schwäche des deutschen Protestantismus in unheilvoller Weise zutage. Nachdem sie infolge des Haderns ihrer Führer die beste Zeit verloren hatten, zögerten sie auch jetzt, die für sie günstige Situation, da der Kaiser fast wehrlos in Regensburg saß, auszunützen und vor der Ankunft seiner Truppen aus den Niederlanden und Italien einen entscheidenden Schlag zu führen. Wer annehmen wollte, daß die beiden Parteien, die sich seit einem halben Menschenalter in Kampfesstellung gegenüberstanden, auf das Signal zum Losbruch des Religionskrieges wie wütend übereinander herfielen, wird über die schleppende Art, in der er geführt wurde, einigermaßen erstaunt sein. Es war wirklich, wie man höhnte, »ein Krieg, darüber allen Menschen die Weile lang wird«.
Der Erzherzog Maximilian wurde mit dem Kommando über eine Reiterabteilung und der Führung des Reichsbanners betraut. Bei der Beschießung der Stadt Ingolstadt, die am 31. August begann und vier Tage währte, flog eine sechsunddreißigpfündige Kugel durch sein Zelt. Mit sichtlicher Genugtuung sandte der Prinz diese Kriegstrophäe seiner Schwester Anna nach München.
Indes, das lange Lagerleben, die reichliche Muße, welche die Kriegsaktionen gestatteten, scheinen bei dem nun neunzehnjährigen Erzherzog nicht die günstigsten Wirkungen erzielt zu haben. Vater Ferdinand sieht sich veranlaßt, in einer längeren Epistel – sie ist vom 13. und 14. Februar 1547 aus Leitmeritz datiert – Maximilian seines leichtsinnigen Lebens wegen eine tüchtige Strafpredigt zu halten, wobei er sich auf frühere Ermahnungen berufen konnte.
Zunächst warnt der König seinen Sohn, der sich, wie er hörte, dem übermäßigen Genuß starker Weine ergebe, vor den Folgen der Trunkenheit. Auch vor geschlechtlichen Ausschreitungen möge er sich in acht nehmen; aber wenn er sich schon in diesem Punkte nicht zurückhalten könne, dann solle er wenigstens »vorsichtig« zu Werke gehen, jeden »Skandal« meiden, es auch nicht mit Verheirateten treiben und keine Gewalt anwenden.
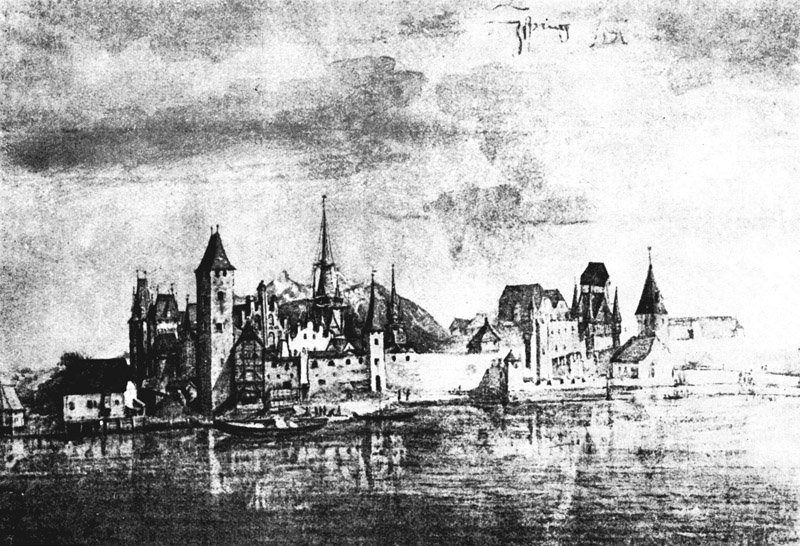
Innsbruck
Das religiöse Verhalten Maximilians und seines Bruders Ferdinand muß ebenfalls dem König Sorge bereitet haben; denn er hält es für nötig, sie zum Beharren in der alten katholischen Kirche zu ermahnen. In dieser herrsche die größere Eintracht, während die Protestanten zerspalten, unbotmäßig, keine Autorität weder des Papstes oder der Konzilien noch des Kaisers mehr zu dulden geneigt seien. Die Katholiken hätten einen festen Grund auf festem Felsen, ihre Gegner aber auf Sand gebaut. Keiner der Neuerer führe ein gutes Leben, gebe ein gutes Vorbild, sondern alle seien sie mit den schlimmsten Lastern behaftet. »Daher, teuerste Söhne,« beschwört er sie, »haltet Euch fern von ihren Ketzereien und Irrlehren, und bleibt bei der katholischen Kirche und trennt Euch von ihr in keiner Weise.«
Schwer fiel es dem Vater auf die Seele, daß er bei seinem ältesten Sohne solche Anzeichen von Unbotmäßigkeit bemerkte. Er sei »störrig«, klagt er, höre nicht auf die Ratschläge der für ihn bestellten Dienstpersonen, leihe vielmehr leichtfertigen Menschen sein Ohr. »Mit diesen, deinem Bären und der Musik bist du ausschließlich in Anspruch genommen«, während er die »gewichtigen, guten und ehrenhaften Männer«, die von dem Kaiserhofe oder anderswo kommen, unfreundlich aufnehme, wenig und selten mit ihnen spreche. Er möge sich ja nicht einbilden, alles besser zu wissen als der welterfahrene Kaiser, sonst bewahrheite sich an ihm das italienische Sprichwort: »Wer ein Esel ist und ein Hirsch zu sein glaubt, der hüte sich, über einen Graben zu springen.«
Diesen Klagen und Mahnungen des Vaters lagen einige ganz bestimmte Fälle von Disziplinwidrigkeiten zugrunde, die sich der Thronfolger während des Feldzuges hatte zuschulden kommen lassen. Von Landshut aus, wo die kaiserliche Armee halt machte, um Verstärkungen heranzuziehen, tat er, ohne lange zu fragen, einen Abstecher nach München, um seine Schwester Anna zu besuchen, und sprach hier derart dem Weine zu, daß er betrunken wurde. Aber es kam auch vor, daß er sich den Befehlen des Kaisers direkt widersetzte. Einmal erhielt er von diesem den Auftrag, mit seiner Mannschaft an einen bestimmten Ort zu eilen. Maximilian weigerte sich jedoch lange Zeit, ihm Folge zu leisten. Er wisse genau, was er zu tun habe, erklärte er trotzig. Ein andermal sollte er bis auf weiteren Befehl an einer Stelle stehenbleiben und Umschau halten. Der Kaiser, der seinen Neffen schon kannte, schickte zur Vorsicht dessen Kämmerer Thomas Perrenot von Chantonnay nach, um seinen Herrn vor einem etwaigen Verlassen des Postens zurückzuhalten. Aber trotzdem gehorchte Maximilian nicht.
Indes, es sollte noch ärger kommen. Der Erzherzog stand mit seiner Abteilung in Ulm. Dort hatte ihn, am 2. Februar 1547, die Nachricht von der Geburt einer neuen Schwester – es war Johanna, die am 27. Januar in Prag zur Welt kam – erreicht. Bald darauf aber war die schmerzliche Kunde vom Tod seiner Mutter eingetroffen. In der Nacht vom 5. zum 6. Februar verläßt Maximilian heimlich sein Quartier, von einem Knappen begleitet, indem er vorgab, ein vom Kaiser an seinen königlichen Bruder entsendeter Kurier zu sein. Sein Kämmerer Chantonnay bemerkte indes noch rechtzeitig, um drei Uhr in der Früh, den Abgang des Erzherzogs, ritt ihm nach, holte ihn schon bei der zweiten Poststation ein und brachte ihn noch vor Anbruch des Tages zurück. Chantonnay wird dem Erzherzog dadurch nicht sympathischer geworden sein. Nach der Erzählung des venezianischen Gesandten hatte Maximilian gegen den diensteifrigen Kämmerer sogar den Degen gezückt.
Was den Erzherzog zur Flucht – sie spielt im Leben der Kronprinzen eine ganz typische Rolle – bewogen hatte, ist nicht bekannt. Hat der Tod seiner teuren Mutter, das leidenschaftliche Verlangen, sie noch einmal zu sehen, die Sehnsucht nach seiner Heimat, verstärkt durch den Unwillen über die spanische Umgebung, den Anstoß zu dem abenteuerlichen Schritt gegeben? Es mag auch sein, daß er sich in Österreich, wo ein Feldzug gegen die böhmischen Utraquisten im Gange war, für nützlicher erachtete, wobei, wie der venezianische Gesandte Mocenigo berichtet, die Eifersucht gegen seinen Bruder Ferdinand mitspielte. »Ich stehe«, soll er gesagt haben, »in einer Armee unter dem Herzog Alba, und mein Bruder, der jünger ist als ich, wird General im väterlichen Heere.«
Soweit alle diese Ausschreitungen des Erzherzogs durch die Öde des Lagerlebens, den Mangel an größeren Aufgaben, die seinem Ehrgeiz ein dankbares Feld gegeben hätten, verschuldet gewesen sein mögen, sollte bald ein gründlicher Umschwung eintreten. Im Frühjahr 1547 spitzte sich alles zu einem großen Schlag gegen das Heer der Schmalkaldner zu, und am 24. April – es war der Ostersonntag – sollte denn auch bei Mühlberg an der Elbe die Entscheidung fallen.
Der alternde Kaiser, schwer von der Gicht geplagt, unfähig, ohne fremde Unterstützung sich zu bewegen, ließ sich in Anbetracht des großen Augenblicks den Harnisch anlegen und aufs Schlachtroß setzen. So, in goldener Rüstung mit der roten Feldbinde, den Speer in der Faust über die Walstatt sprengend, hat ihn Tizians Meisterhand verewigt. Der starre, regungslose Ausdruck im Gesichte Karls V., der auch in dieser Schicksalsstunde außer einer gewissen Feierlichkeit keine innere Bewegung verrät, erscheint dem Leben nachgebildet. Denn dieses Undurchdringliche seines Antlitzes fiel allen Beobachtern auf. »Er hat«, berichtete der englische Diplomat Ascham, »ein Gesicht, so ungewohnt, irgendeine Bewegung des Herzens zu verraten, wie ich kein zweites in meinem Leben gesehen habe. In seinem bleichen Antlitz läßt kein Wechsel der Farbe ahnen, ob ihn eine Meldung erfreut oder verletzt. Selbst aus den Augen kann man nur wenig von dem erraten, was in seinem verschlossenen Innern vorgeht. So oft ich ihn sah, mußte ich der Worte Salomos gedenken: ›Der Himmel ist hoch und die Erde tief, aber der Könige Herz ist unergründlich.‹ Da ist nichts an ihm, was spricht, außer der Zunge.«
Maximilian wohnte, ebenso wie sein Vater und sein Bruder Ferdinand, der denkwürdigen Schlacht bei, und der Kaiser ließ es sich nicht nehmen, den beiden Prinzen das Glück, daß sie in jungen Jahren einen solchen Schicksalstag erleben durften, vor Augen zu rücken. »Ihr seid Jünglinge«, so redete er sie am Abend an, »und habt euch bereits in einer Schlacht befunden; ich bin ein alter Mann von fünfzig Jahren und war noch in keiner andern als dieser.« Der Erzherzog sah wohl auch die eindrucksvolle Szene, da der Feldherr Herzog Alba den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen, der im Kampfgewühl verwundet und nach tapferer Gegenwehr gefangengenommen worden war, in schwarzer Rüstung, das vom Helm befreite Gesicht mit Blut überströmt, auf seinem Streithengst dem kaiserlichen Lager zuführte. Der Kurfürst, der absteigen und Karl die Hand reichen wollte, dann nach höflicher Anrede um Gnade bat, wurde mit den harten Worten abgefertigt, er werde nach Verdienst behandelt werden, worauf Johann Friedrich seinen Hut wieder aufsetzte und stolz erklärte: »Machet mit mir, was ihr wollt, ich bin in eurer Gewalt.« Diese würdevolle Haltung des Fürsten im Unglück machte auch auf die Feinde einen tiefen Eindruck.
Bei der Gefangennahme des sächsischen Kurfürsten fiel seine lutherische Bibel, ein Prachtwerk in schwarzem Samt, in die Hände der Kaiserlichen – sie sollte später in den Besitz Maximilians kommen, der sie, wie uns sein Prediger versichert, zum Gegenstand eifrigen Studiums machte.
Von Mühlberg rückte Karl vor Wittenberg, und hier im Lager, am 10. Mai, erfolgte die Kapitulation, die dem gefangenen Johann Friedrich den Verzicht auf die Kurwürde und seine Lande auferlegte. Nach der Einnahme der Stadt erschien Sibylle, die Gemahlin des Kurfürsten, um den Kaiser um Gnade zu bitten, und Maximilian legte im Vereine mit dem brandenburgischen Kurfürsten, der den Sieg des Kaisers mit einem Dankgottesdienst – er, der Protestant! – gefeiert hatte, Fürbitte ein. Der Erzherzog wohnte auch der Versammlung bei, in welcher dem Herzog Moritz die ihm versprochene Kurwürde in feierlicher Weise übertragen wurde. Er hörte da die merkwürdige Erklärung des neuen Kurfürsten, daß er sich bei seinem ganzen Vorgehen nicht von eigennützigen Beweggründen habe leiten lassen, sondern nur dem Kaiser gehorsam gewesen sei.
Kaiser Karl zog nun nach Halle, um auch das andere Haupt des Schmalkaldner Bundes, den Landgrafen Philipp von Hessen, in seine Gewalt zu bekommen. Hier ereignete sich ein an und für sich ziemlich bedeutungsloser Vorfall, der aber zeigt, wie hoch im eigenen Lager die Erbitterung der Deutschen gegen die Spanier gestiegen war. Aus einer ganz geringfügigen Ursache – ein spanischer Soldat hatte einem deutschen eine Handvoll Silber entrissen – kam es zu einem Aufruhr, der in eine förmliche Schlacht zwischen den beiden Völkern ausmündete. Maximilian, der im Auftrag des Kaisers die Deutschen beruhigen wollte, hätte dabei um ein Haar sein Leben eingebüßt.
Bald nach dieser für die Stimmung in Deutschland so bezeichnenden Episode geriet auch der Landgraf in die Gewalt des Kaisers. Die Art und Weise freilich, wie dem Kaiser dies glückte, war nicht geeignet, die ohnehin schon arge Verbitterung gegen die Spanier zu beheben. Philipp von Hessen hatte sich dem Kaiser unterworfen, weil er wähnte, er sei vor dem Schicksal der gefänglichen Verwahrung gesichert. Er tat also einen Fußfall vor dem Kaiser und wurde darauf gefangen abgeführt. Gewiß, es war von Seiten Karls formell kein Wortbruch, allein er wußte recht gut, daß die Unterhändler, die Kurfürsten Joachim von Brandenburg und Moritz von Sachsen, ihn mißverstanden hatten. Der Kaiser wollte dem Landgrafen nur Sicherheit vor Lebensstrafe und ewigem Gefängnis zugestehen, aber von dem Wort »ewig« hatte man Philipp nichts gesagt, so daß er gerne in die Kapitulation willigte, die ihm sein Land beließ. Zweifellos waren die beiden Vermittler von den geriebenen Spaniern übertölpelt worden, aber im deutschen Volke, das die näheren Umstände nicht kannte und das Spiel mit den Worten »ewiges« und »einiges« Gefängnis nicht verstand, erweckte dieser Akt der Hinterlist einen gewaltigen Haß.
So schmachteten die beiden Häupter des Schmalkaldnerbundes im Gefängnis, der deutsche Protestantismus war kläglich zusammengebrochen, und der Kaiser ging nun daran, seinen Sieg über die Rebellen weidlich auszunützen. Auf dem »geharnischten« Reichstag in Augsburg, der am 1. September 1547 eröffnet wurde, sollte die kaiserliche »Reformation« verkündet werden. Maximilian war auch hier dazu ausersehen, den weltbewegenden Ereignissen handelnd beiwohnen zu können, indem er als Präsident die denkwürdige Reichsversammlung leitete.
Hier in Augsburg sah der protestantische Graf Wolrad von Waldeck, der auf Seite der Schmalkaldner gekämpft und sich deshalb zu rechtfertigen hatte, den nunmehr zwanzigjährigen Thronfolger und entwarf von ihm ein überaus anziehendes Bild. »Maximilian«, so schreibt er in seinem Tagebuch, »ist ein Jüngling von nicht unedler Gestalt und guter Statur und beweist im Reden eine Bildung, wie sie dem Fürsten ansteht. Gegen den wahren Glauben und gegen Deutschland soll er nicht schlecht gesinnt sein. Möge der, welcher die Herzen der Könige in seiner Hand hält, ihn die trefflichen Gaben, die ihm die Natur in reichem Maße gab, zu Gottes Ruhm, zur Wohlfahrt seiner Untertanen und zum Heil seiner Seele verwenden, und ihn nicht auf Ohrenbläser und Schranzen hören lassen.«
Um dieselbe Zeit schildert ihn auch der venezianische Gesandte Bernardo Navagero als einen zu den besten Hoffnungen berechtigenden Prinzen. Er sei groß, hager, schön und gesund, gleiche mehr dem Kaiser als dem Vater, insoferne er nicht viel rede und Gravität zeige. Sein Sinn stehe, wie es scheine, nach großen Dingen, und woferne er erzogen wäre von kraftvollen Männern, die ihm beständig von Kriegen erzählt und in der Geschichte unterwiesen hätten, glaube er, daß man alles Große von ihm erwarten könnte. Aber der König habe Sorge getragen, daß er mit Männern umgehe, die ihn gute Sitte lehrten und vor Sünde und Unordnungen bewahrten, »so daß mir scheint, daß mehr die Erziehung als die Natur gefehlt hat«. Maximilian reite gut, sei auch im Turnier wie in der Handhabung von Gewehr und Geschütz wohl bewandert. Er hat vielen Trieb zu befehligen, so schloß der Bericht, und läßt sich schwer lenken, so daß der König Mißfallen daran hat.
So tritt uns das Bild eines sympathischen Prinzen entgegen, der trotz seiner Erziehung, die mehr auf eine korrekte kirchliche Haltung zielte, den entschiedenen Willen zu selbständigem Handeln besitzt und Großes zu leisten verspricht. Die Protestanten zählen Maximilian, der auch für den gefangenen Landgrafen als Fürsprecher auftrat, bereits zu ihren Gönnern, und der Sohn des Spaniers Ferdinand gilt als ein durchaus deutscher Fürst.
Indes, schon war von Kaiser Karl Sorge dafür getroffen worden, daß der Prinz, auf den sich die Zukunftshoffnungen des deutschen Volkes lenkten, vom Schauplatz seiner mit vielem Erfolg begonnenen Tätigkeit entfernt und zu einem Spanier werde. Auf dem Höhepunkt seiner Machterfolge tritt Karl V. mit dem großen Plan hervor, seinem Sohne Philipp die Nachfolge in Deutschland zu sichern – die Spaltung der habsburgischen Weltmacht in zwei Linien, eine deutsche und eine spanische, sollte verhindert werden.
In der Tat – der Gedanke war kühn! Aber es war auch vorauszusehen, daß er dem entschiedenen Widerspruch seines Bruders und seines Neffen begegnen werde. Dieses spanische »Sukzessionsprojekt« bildete denn auch den Kernpunkt der kaiserlichen Politik in den nächsten Jahren und zugleich die Erklärung für die antispanische Gesinnung des Thronfolgers, der sich so um die erträumte Kaiserwürde betrogen sah. Denn auch die Aussicht, nach seines Vetters Tode in Deutschland zur Herrschaft zu gelangen, wog nicht allzuviel, da Philipp nur um wenige Monate älter war.
Die bittere Pille der spanischen Sukzession sollte den deutschen Habsburgern dadurch versüßt werden, daß der Kaiser in Augsburg die Verheiratung seiner Tochter Maria mit Maximilian zusagte. Am 24. April 1548 wurde der Ehevertrag abgeschlossen und am 4. Juni ratifiziert, aber sehr vorteilhaft für den jungen Bräutigam war er gewiß nicht. Der Erzherzog mußte das bedrückende Gefühl haben, daß es sich bei ihm – entgegen den sonstigen Gepflogenheiten an Fürstenhöfen – weniger um eine reine Liebesheirat handle. Die Mitgift war nicht allzu reichlich bemessen, und das Wenige sollte dann nicht einmal richtig ausbezahlt werden, so daß man sich in Wien genötigt sah, auf den Kaiser den schärfsten Druck auszuüben, um die durch den Pakt zugesicherten Geldbeträge zu erhalten.
Aber auch nach einer anderen Richtung hin brachte die Eheverbindung eine schwere Enttäuschung. Maximilian hätte erwarten dürfen, aus der reichen Ländermasse der kaiserlichen Universalmonarchie ein Land zu erhalten, in erster Linie natürlich die Niederlande, die ja zum Reiche gehörten. Der Kaiser dachte auch in der Tat daran, ihm und Maria dort wenigstens die Statthalterschaft anzuvertrauen, »weil die Niederlande gewohnt sind, von keinem andern als von einem Abkömmling unseres Stammhauses beherrscht zu werden«. Aber auch davon kam er ab und beauftragte Maximilian nur, für die Dauer der Abwesenheit seines Vetters Philipp in Spanien die Regentschaft zu führen. Die Regierung über die Niederlande wurde Philipp vorbehalten. Kaiser Karl V. drang nur darauf, daß sein Schwiegersohn durch die Erhebung zum König von Böhmen, die ihn nichts kostete, eine erhöhte Stellung bekomme.
So wiederholte sich bei dem Sohne Ferdinands das seltsame Schauspiel, das dieser als Jüngling zu seinem Schmerz erlebt hatte – er muß mit einem andern den Platz tauschen. Hatte der damalige Infant, der in Spanien aufgewachsen war, vor dem Niederländer Karl das Feld räumen müssen, so mußte jetzt Maximilian, der deutsche Prinz, nach Spanien, damit Philipp, der Spanier, in Deutschland festen Fuß fassen konnte.
»Aber wehe! Er tritt eine gefährliche Reise an, wie es heißt, gegen seinen Willen«, so schrieb Graf Wolrad von Waldeck besorgt in sein Tagebuch. Gefährlich sicherlich, auch für den Werdegang des Erzherzogs und für das Schicksal des deutschen Volkes. Konnte nicht der zwanzigjährige, innerlich wohl kaum gefestigte Prinz den fremden Einflüssen unterliegen; konnte er nicht als ein halber oder gar als ein vollendeter Spanier zurückkehren? Schon jetzt sorgte der Kaiser dafür, daß der neue Hofstaat, der für Maximilian eingerichtet wurde, einen ausgiebig spanischen Charakter trug. Wiederum waltete als Obersthofmeister Don Pedro Lasso di Castilia. Bis ins kleinste wurde die Etikette, die einzuhalten war, vorgeschrieben.
Auch die venezianischen Gesandten am Kaiserhofe bekamen den Eindruck, daß Maximilian nur »ungern« seine Brautfahrt antrat. Die Abreise verzögerte sich indes, und nicht zuletzt dadurch, daß der Heilige Vater aus alter Feindschaft gegen die Habsburger die Erteilung der Dispens zur Eheschließung lange hinausschob. Der Erzherzog benutzte die Zeit des Stilliegens dazu, daß er schon jetzt dem Sukzessionsplan seines Oheims entgegenarbeitete. Ganz im geheimen trat er, wie die venezianischen Gesandten zu berichten wußten, mit Moritz von Sachsen, dem neuen Kurfürsten, in Verbindung. Schwor ihm dieser, keinen andern König als Maximilian zu wählen, so gab ihm der Erzherzog die Zusage, er werde als Träger der römischen Königskrone an dem derzeit in Deutschland herrschenden religiösen Zustand nicht rütteln lassen. Und daß diese Meldung der Venezianer auf Wahrheit beruht, geht aus den späteren Verhandlungen des Kurfürsten mit Maximilian hervor, in denen sich auf »unser beiderseits gehaptes Unterreden« bezogen wird.
Am 10. Juni 1548 verabschiedete sich Maximilian von Kaiser Karl und von Vater Ferdinand, um die beschwerliche Reise anzutreten. Sie ging zunächst über München, wo einige Tage Aufenthalt genommen wurde, nach Innsbruck, der wohlvertrauten Stätte seiner Kindheit. Daß die Gedanken des Erzherzogs noch nicht ganz bei seiner spanischen Braut weilten, bekundet die etwas indiskrete Aufzeichnung eines gewissenhaften Rechnungsbeamten, wonach Maximilian in Mittenwald »ettlich Weiber gefangen« und mit einem Taler beschenkt habe. Von der Innstadt, wo er seine Geschwister sah, ging es immer südwärts über Brixen, Bozen und Trient nach Mantua, wo er den Herzog Franz Gonzaga, seinen zukünftigen Schwager, besuchte. Sodann führte die Fahrt über Mailand, die Apenninen, die auf dem La-Bocchetta-Paß überschritten wurden, nach Genua, wo er am 20. Juli eintraf. Hier fand seine Vermählung mit Maria »per procurationem« statt.
Am 25. Juli segelten die zur Überfahrt bestimmten Schiffe unter Führung des Admirals Andreas Doria von Genua ab. Die Seereise gestaltete sich sehr bewegt, so daß er mit einiger Verspätung und nicht mit den besten Eindrücken Anfang August in Barcelona landete. »Als wir«, so berichtete er am 19. September dem Mainzer Kurfürsten, »zu Genua auf die Armada gesessen und auf Barzalona zuschiffen wöllen, hat uns ein ganz widerwärtiger Wind, durch welchen das Meer heftig wütend worden, angetroffen, daraus gefolgt, daß uns (dieser Zeit zu unserm besondern großen Unglück) das Fieber quartana angestoßen.«
In leidendem Zustand kam Maximilian am 13. September nach Valladolid, der spanischen Residenz, wo noch am selben Tag die Hochzeit mit Maria gefeiert wurde. Er durfte das »neidige Glück« anklagen, das ihm seine Gesundheit gerade zu einer Zeit vorenthielt, da er ihrer, wie er humorvoll sich ausdrückt, »am passten (am besten) bedürftig« gewesen wäre. Die Prinzessin muß ihm von Anfang an gefallen haben. Seiner Tante Maria von Ungarn schrieb er am 19. September: er habe sie »ganz frisch, gesund und nach seinem höchsten Wohlgefallen« gefunden. Aber in der Umgebung des Kaisers, der durch die vertraulichen Berichte des Lizentiaten Gamiz und den Haushofmeister Pedro Lasso über alle Geschehnisse unterrichtet wurde, munkelte man, daß Maximilian zu seiner jungen Frau keine besondere Zuneigung habe. Der Kaiser behauptete sogar, die Ehe sei noch gar nicht vollzogen. Möglich, daß die körperliche Verstimmung – Maximilian hatte im Herbst wiederum ein schweres Fieber zu bestehen – auf das Verhältnis zu Maria ungünstig einwirkte.

Kaiser Karl V.
Aber seit Beginn des Jahres 1549 war man am Kaiserhofe vollkommen beruhigt. Mit großem Interesse vernahm Karl die Zeichen der wachsenden Zärtlichkeit der Gatten; kaum, daß sie sich auch nur für kurze Zeit trennen wollten. Als das Frühjahr anbrach, hatte man am Kaiserhofe die Gewißheit, daß die Erzherzogin sich in gesegneten Umständen befinde. Karl beglückwünschte am 9. Juli den Schwiegersohn in einem Schreiben, in welchem der Weltbeherrscher recht menschliche Töne anschlägt. Er wundere sich nicht, sagte er ihm da, daß die Prinzessin die gemeldeten Üblichkeiten habe, »das sei immer so und besonders das erste Mal«. Maximilian solle seine Frau möglichst schonen.
Am 2. November kam das erste Kind zur Welt, eine Tochter, die in der Taufe nach Maximilians Mutter den Namen Anna erhielt, und nun geht es genau wie in seinem Elternhause: »Alle Jahre womöglich ist Kindtaufe.« Schließlich schenkte ihm die Gemahlin fünfzehn Kinder, von denen zehn den Vater überleben sollten. Maria war nicht gerade als schön zu bezeichnen, aber klug und bescheiden, und sie scheint es verstanden zu haben, ihrem Gemahl eine treue Gefährtin zu sein, ohne sich jemals in die Politik zu mischen. Die ernst und melancholisch veranlagte Frau ist zeit ihres Lebens Spanierin geblieben. Der deutschen Sprache scheint sie auch nach Jahren nicht ganz mächtig gewesen zu sein; denn Maximilian schreibt am 12. Juli 1566 – also achtzehn Jahre nach der Hochzeit – dem sächsischen Kurfürsten August: Eben da er den Brief schließen wollte, sei sein »böses Weib« gekommen, die ihn gebeten habe, sie bei seiner Gemahlin zu entschuldigen, daß sie ihr noch nicht geschrieben, »dan sie ainmal die Schprach nit kunn«. Aber Maximilian, der sonst allem Spanischen feind war, hing an ihr bis an sein Lebensende mit zärtlicher Liebe. Er, der seinem sittenstrengen Vater einstmals seines Umgangs mit Frauen wegen Sorge bereitet hatte, erwies sich stets als der beste Ehemann. Sicherlich wäre der geringste Seitensprung von Marias spanischer Umgebung, die ihren Gemahl beständig, auf Schritt und Tritt, überwachte, Karl und Philipp gemeldet worden; denn auf das ungetrübt herzliche Verhältnis der Gatten baute sich ein Gutteil der Hoffnung auf, Maximilian bei der alten Kirche zu erhalten.
Selbstverständlich wurde auch Maximilians kirchlich-religiöses Verhalten vom ersten Augenblick an, da er spanischen Boden betrat, strengstens beobachtet. Allein da war fürs erste nichts Nachteiliges zu berichten. Viermal in der Woche hörte er die Predigt, die Osterfasten hielt er genau ein. Nur zeigte er sich schon, wie Gamiz am 7. Januar 1550 dem Kaiser meldete, wenig erbaut über die »Zudringlichkeit« der spanischen Geistlichen, die man nur mit Mühe abschütteln könne. Auch sonst konnte er an dem spanischen Wesen keinen Gefallen finden. Die Regierungsgeschäfte, die er nach der am 1. Oktober des Vorjahres erfolgten Abreise des Infanten Philipp zu führen hatte, bereiteten ihm nur geringe Freude.
Die Gedanken des Erzherzogs weilten stets in Deutschland. Aus seinen Briefen an die fernen Freunde spricht die heiße Sehnsucht nach seinem »geliebten Vaterland«. Wie gern hätte er, so schreibt er dem Kurfürsten Moritz, an den Jagden, die dieser zu Ehren seines Vaters und seines Bruders Ferdinand veranstaltete, teilgenommen. »Dieweil es aber nicht hat anders sein mugen, so wellen wir uns gleich, als weren wir bei allem Gejaid und frölichem Leben gewesen – das uns dann in disen Landen wol etwas seltsam ist –, bedanken und sein lassen, bis so lang sich etwo unsere Abledigung aus dieser Nation schicken wird … Und so wir also in unser Vaterland kommen, in welches wir für all andere Ding herzlich Verlangen haben, und daß es der Allmechtige pald schicken welle, teglich bitten, verhoffen wir mer dan ainmal Euer Lieb zu besuchen.« Wiederholt bittet er, ihn mit Zeitungen aus Deutschland zu versehen.
Welche Qualen mag ihm der Gedanke bereitet haben, daß jetzt, während er in Spanien sich langweilte, sein spanischer Rivale in Deutschland alle Hebel in Bewegung setzte, um sich dort die Herzen zu erobern, wie er denn selbst den deutschen Trinksitten sich anzupassen suchte und sich sogar einmal betrank. Freilich, trotz der verzweifeltsten Anstrengungen, hatten alle seine Liebeswerbungen keinen Erfolg: je näher man den steifen, wortkargen und unnahbaren Infanten kennenlernte, desto unbeliebter wurde er. Der sprichwörtliche Hochmut der Spanier, die auf Deutschland wie auf ein erobertes Land herabsahen, trennte die beiden Völker immer mehr. Alles das blieb Maximilian wohl nicht unbekannt, aber er kannte auch die Zähigkeit seines kaiserlichen Oheims und konnte sich lebhaft vorstellen, daß Karl nichts unversucht lassen werde, um seinen Lieblingsgedanken, Philipp die Nachfolge im Reiche zu verschaffen, zu verwirklichen. Er fühlte zudem, daß sein Aufenthalt in Spanien nur geeignet war, ihm die Herzen der Deutschen zu entfremden.
Schon waren solche Besorgnisse, Maximilian könnte sich allzusehr zum Spanier entwickeln, laut geworden, zwar nicht in Deutschland selbst, aber im Lande der Wenzelskrone, wo man ernstlich fürchtete, der Thronfolger könnte in Spanien sein Böhmisch vergessen. In dem Glückwunschschreiben, das der Oberstburggraf Wolf der Ältere von Kreyg namens der Stände an den »König« – er war dazu im Februar 1549 erhoben worden – anläßlich der Geburt Annas richtete, war auch der Wunsch ausgesprochen, »er möge sich mittlerzeit der behmischen Sprach nit gar begeben und vergessen«, auf daß er »sich derselben gegen den Stennden und Unterthonen zu gebrauchen« hätte.
Der junge König bestürmte den Kaiser wie seinen Vater mit der Bitte, ihm die Rückkehr in seine Heimat zu gestatten. Gab er Ferdinand zu bedenken, daß ihm das Studium der spanischen Sitten und Gewohnheiten nichts nützen, sondern nur schaden werde, so schützte er Karl vor, daß er das spanische Klima nicht vertrage. Der Kaiser suchte ihn zu beruhigen, arbeitete aber mittlerweile mit Hochdruck darauf hin, sein großes Werk der Sukzession unter Dach zu bringen. Im Mai 1550 trafen die beiden Brüder wieder in Augsburg zusammen. Kaiser Karl hält ihm die stärksten Köder hin: Philipp, der nach der Geburt des Infanten Don Carlos Witwer geworden war, sollte mit Ferdinands Tochter Margarete vermählt werden, der König überdies einen Landzuwachs und eine Reichshilfe für Ungarn erhalten.
Allein Ferdinand, der nur zu gut seinen Bruder kennt, will nicht anbeißen. Er drängt in Karl, daß Maximilian heimberufen werde. Karl erwidert, Spanien könne nicht ohne einen Regenten sein, worauf Ferdinand gereizt bemerkt, diesem Übelstande sei am besten dadurch abzuhelfen, daß Philipp in sein Stammland zurückkehre. Karl ruft in seiner Bedrängnis die kluge Schwester Maria zu Hilfe, die aus den Niederlanden herbeieilt. Eben damals stirbt Karls langjähriger Berater Nikolaus Perrenot von Granvelle, dem ein großartiges Leichenbegängnis bereitet wurde. Allein alle Trauergäste zusammen, berichtet boshaft der französische Gesandte Karl von Marillac, vergossen nicht so viele Tränen, als die Deutschen Humpen Weins austranken vor Freude über das Hinscheiden des Mannes, den man allgemein für den bösen Geist des Kaisers hielt. König Ferdinand selber, so berichtet er weiter, sei über dessen Tod erfreut, weil er in dem verstorbenen Minister den Hauptvertreter des Sukzessionsplanes erblickte. Ferdinand, nicht minder zähe wie sein kaiserlicher Bruder, lehnt es entschieden ab, ohne Einwilligung seines Sohnes einen bindenden Beschluß zu fassen. Karl muß nachgeben. Noch im September ergeht an König Maximilian die Weisung, so rasch wie möglich nach Augsburg zu kommen und seine Gemahlin, die zum zweiten Male ihrer Niederkunft entgegensah, einstweilen in Spanien zu belassen.
Der junge König ließ sich dies nicht zweimal sagen und reiste alsbald, am 30. Oktober, von Valladolid ab, um sich auf demselben Wege, den er vor mehr als zwei Jahren gekommen, nach Deutschland zurückzubegeben. Überall wird er freundlich begrüßt. Am 10. Dezember trifft er endlich in Augsburg ein, und nun beginnen innerhalb der Familie die schwerwiegenden Verhandlungen, denen man in den Kreisen der deutschen Fürsten mit begreiflicher Spannung entgegensah. Der Kardinal Otto Truchseß von Waldburg, Bischof von Augsburg, hatte schon im November, wie der venezianische Gesandte berichtet, die Äußerung fallen lassen, Deutschland habe den »spanischen Übermut« völlig satt. Weder Ferdinand noch sein Sohn würden je der Wahl Philipps zustimmen. Er schloß mit der Versicherung, daß in Deutschland unter dem Regiment des Spaniers niemals Ruhe herrschen werde. »Ich kenne«, sprach der Kardinal warnend, »die Seele dieses Volkes, das sich nicht so leicht beschwichtigen lassen wird; man will in Deutschland keine so große Macht.« Indes, was kümmerte diese üble Stimmung den Kaiser! Der kurpfälzische Kommissär Andreas Masius sprach seine Überzeugung dahin aus, daß Karls Wille durchdringen werde. Es sollten beide, Masius wie Truchseß, in der Folge recht behalten.
Zu Neujahr 1551 kam wieder, von ihrem kaiserlichen Bruder herbeigerufen, die Königin Maria nach Augsburg – ein Zeichen dafür, daß das Ringen der beiden Habsburger seinem Höhepunkt entgegenging. Wochenlang wurde oft am Tage fünf bis sieben Stunden verhandelt, wurde mit einer Erbitterung gestritten, daß Karl, wie er sich ausdrückte, vor Ärger zu »krepieren« vermeinte und einmal aus der gleichen Ursache einen Fieberanfall bekam. Es war so weit gekommen, daß er Maximilian gar nicht sehen wollte.
Da die Besprechungen streng geheim geführt wurden, war es nur natürlich, daß in der Öffentlichkeit über sie allerlei Mutmaßungen laut wurden. Bald sprach man davon, daß ein Doppelkaisertum Karl und Ferdinand in Aussicht genommen worden, denen Philipp und Maximilian als Koadjutatoren zur Seite stehen sollten. Man wollte auch wissen, daß Papst Julius III. bereit sei, für Philipp einzutreten, obwohl dieser als zukünftiger Herr von Neapel seiner Herrschaft gefährlich werden konnte. Denn durch die Wahl Philipps, so wurde weiter gesagt, und das klingt recht merkwürdig – sollte die katholische Religion geschützt werden.
Merkwürdig deshalb, weil aus solchem Gerede zu ersehen ist, daß man den Sohn Ferdinands für religiös nicht mehr ganz zuverlässig hielt und annahm, auch der Papst wisse bereits darum. War diese Behauptung richtig, dann hätte dem kaiserlichen Sukzessionsplan auch eine religiöse Seite zugrunde gelegen, wäre auch die besondere Heftigkeit zu verstehen gewesen, mit welcher Kaiser Karl seinen Gedanken verfolgte. Auch von Heiratsabreden wurde wieder viel gesprochen: Philipp sollte tatsächlich, wie es schon oft geheißen, die Hand der Erzherzogin Margarete erhalten und Erzherzog Ferdinand mit Maria von Portugal, einer Nichte Karls V. verlobt werden. Sicheres wußte man natürlich nicht, so sehr man sich auch auf eine sogenannte »beste Quelle« berufen zu können glaubte. Und soweit der Erzherzog in Frage kam, hätte sich derselbe für eine noch so ehrenvolle und glänzende Eheverbindung schönstens bedankt, denn er schmachtete zu jener Zeit bereits in den Banden der Augsburger Patriziertochter Philippine Welser.
Seit Februar aber sprach man ziemlich allgemein davon, daß Maximilian in der Sukzessionsfrage den Rückzug angetreten habe. Um die Mitte dieses Monats wollte man bereits von dem Abschluß eines Vertrages wissen. Das war nun freilich alles verfrüht: es gab noch manch heftige Auseinandersetzung, aber man war tatsächlich auf dem besten Wege zu einem Abkommen nach dem Wunsche des Kaisers. In dem Geheimvertrag, der am 9. März 1551 zustande kam, verpflichtete sich König Ferdinand, nach dem Tode seines Bruders mit allen Mitteln für die Wahl Philipps einzutreten, und gleichzeitig sollte – vorausgesetzt, daß sie dadurch nicht irgendwie gefährdet werde – auch die Wahl Maximilians als Nachfolger Philipps bei den Kurfürsten angeregt werden. Und Philipp versicherte wiederum, daß er, sobald er Kaiser geworden, Maximilians Wahl zum römischen König fördern und ihm dann die Reichsregierung in der Weise überlassen wolle, wie es zwischen Karl und Ferdinand gehandhabt wurde. Ferdinand nahm es weiter auf sich, seinen Neffen Philipp zum Reichsvikar in Italien zu ernennen. Maximilian endlich sollte eine ausdrückliche Erklärung abgeben, daß er der Nachfolge seines Vetters nicht nur keine Schwierigkeiten bereiten, sondern sie vielmehr nach Kräften unterstützen wolle, und er kam auch tatsächlich diesem Verlangen nach. In Gegenwart des Königs und der Tante Maria gab er die gewünschte Erklärung in spanischer Sprache zu Protokoll. Zwei Tage nach dem Abschluß der langwierigen, dornenvollen Unterhandlungen, am 11. März, reiste der Kaiser hochbefriedigt ab.
Indes war in der heiklen Angelegenheit auch jetzt noch nicht das letzte Wort gesprochen. Niemand scheint dies besser gewußt zu haben als der König Maximilian, der trotz seiner Jugend – er zählte jetzt dreiundzwanzig Jahre – die Schliche und Künste der machiavellischen Staatskunst schon meisterhaft beherrschte. Mit Recht meinte der venezianische Gesandte Tiepolo 1557 von dem jungen König: Der gute Verstand, den Maximilian von Haus aus besitzt, ist durch den Umgang mit dem Kaiser und den Spaniern noch lebhafter geworden, indem er von ihnen Verschlagenheit und Schlauheit trefflich gelernt hat.
Warum hätte er sich auch nicht einem Pakt widersetzen sollen, der nach allen ihm wohlbekannten Anzeichen in dem Moment, da er geschlossen wurde, ohnehin bloßen Papierwert besaß! Eine Herrschaft Philipps in Deutschland nach den Erfahrungen, die man mit den Spaniern seit der unseligen Kaiserwahl von 1519 gemacht hatte, erschien unmöglich. »Kein Walch (= Wälscher) soll uns regieren, darzu kein Spaniol«, so hieß es überall. Eben in Augsburg, da man über die Sukzession verhandelte, war im Auftrag des Kurfürsten Moritz von Sachsen der Rat Christoph von Carlowitz erschienen, der das vor seiner Abreise nach Spanien gegebene Versprechen zu erneuern und ihn der treuen und beständigen Freundschaft seines Herrn zu versichern hatte. Und in der Reichsversammlung sprach man sich allgemein gegen Philipp aus. »In Summa,« berichteten die Gesandten Kurbrandenburgs, »man geht mit den Deutschen um, als wären wir allbereits eigen.« Niemals, so erklärten die Kurfürsten von Mainz und Trier dem päpstlichen Nuntius, würden sie in die Wahl Philipps willigen. Bei einem Trinkgelage, so wurde erzählt, schwor man sich förmlich zu, den Spanier nicht zu wählen; wer sich dazu hergebe, sei ein Verräter.
Maximilian tat auch alsbald so, als ob ihn der ganze Geheimvertrag recht wenig angehe. Daß er bei der feierlichen Belehnung Philipps mit den Niederlanden, die zwei Tage vorher, am 7. März, erfolgte, sich fernhielt, war nur ein Symptom der großen Spannung, die zwischen den beiden Vettern bestand und sich auch darin äußerte, daß dieselben die ganze lange Zeit, die sie in Augsburg waren, nichts miteinander redeten. Als nun Philipp an Ferdinand und Maximilian mit dem Ansinnen herantrat, ihren Zusicherungen gemäß bei den Kurfürsten seine Wahl anregen zu wollen, machten sie die größten Schwierigkeiten, und auch als der Kaiser selber sich an seinen Bruder wandte, erreichte er nichts, nur daß die Worte, wie die kluge Schwester Maria meinte, etwas »süßer« klangen. Die Wahlherren des Heiligen Reiches aber bezeigten ebenfalls keine Lust, die Verbindung mit Spanien, dessen Macht sie drückte, zu festigen und zu verewigen. Sie fühlten da wie die muntere Herzogin von Rochlitz, die sich dem Kurfürsten Moritz gegenüber etwas derb, aber bezeichnend geäußert hatte: »Das Haus von Österreich hat große Augen und Maul; was es nur siehet, das will es haben und fressen.« Und andererseits hingen sie, wie später Maximilians Rat und Feldoberst Schwendi bemerkte, an Ferdinands Sohn, »und dies aus der Ursache, weil man von Jugend auf ein gutes, deutsches, aufrichtiges Herz bei Eurer Majestät gespiret«.
Für Maximilian war es schon sehr viel gewonnen, daß nun der Kaiser – zehn Tage nach dem Abschluß des Geheimvertrages – seinen Sohn nach Spanien zurückkehren hieß. Der junge König erhielt die Erlaubnis, seine Familie abzuholen und mit dem Infanten bis nach Barcelona zu reisen, von wo er dann mit denselben Schiffen zurückfahren konnte. So reisten denn die beiden feindlichen Vettern, jeder für sich, nach Genua, wo sie gemeinsam die Schiffe bestiegen, die sie im Juli nach Spanien brachten. Die Rückfahrt, die Maximilian mit seiner Gattin und seinen zwei Kindern Mitte August antrat, gestaltete sich recht gefährlich. Abgesehen von den Seeräubern, mit denen beständig gerechnet werden mußte, bestand die Gefahr, von den Türken, deren Flotte ins Mittelmeer gestoßen war, und den mit ihnen verbündeten Franzosen angefallen zu werden. Und in der Tat wurden von letzteren ein paar Schiffe mit reicher Beute – darunter spanische Pferde – gekapert.
Gewiß hat dieses unliebsame Erlebnis dazu beigetragen, daß sich der König, als er am 13. November in Genua gelandet war, in der bittersten Weise über Spanien und die Politik des Kaisers ausließ, durch welche eine allgemeine Unsicherheit in Europa verursacht und die so wünschenswerte Vereinigung aller christlichen Fürsten verhindert werde. Dem venezianischen Gesandten Giovanni Micheli, der ihn im Namen der Dogenrepublik begrüßt hatte, konnte er nicht genug von der Rücksichtslosigkeit Karls gegen den Wiener Hof erzählen. Alle Erfolge des Kaisers, äußerte er sich in großer Erregung, verdanke er mehr seinem Glück als seinem Können. Niemals werde er, Maximilian, dem Sukzessionsplan zustimmen, auch wenn ihm der Kaiser eines seiner Länder als Entschädigung anbiete; denn die Ehre sei höher zu achten als aller Besitz. Übrigens stünde es mit Kaiser Karl trotz seiner Triumphe schlecht, es drohe ihm der Ausbruch einer Revolution, namentlich in Flandern, wo sein Sohn Philipp, der weder für den Krieg noch für die Regierung befähigt sei, nur an Späßen und Vergnügungen Gefallen finde, mit seinen gleich feigen und übermütigen Spaniern wenig Erfolg aufzuweisen habe. Er sei froh, dem Lande heil entronnen zu sein, in welchem niemand, der nicht dort geboren und auferzogen wäre, leben könne. Man glaube wohl, daß er, der eine Spanierin und eine Tochter des Kaisers heimführte, ein Spanier sei, aber man kenne ihn noch nicht und verkenne auch seine Frau, die niemals zu seiner »Erniedrigung« die Hand bieten werde.
Dies klang wie ein Programm des heimkehrenden Prinzen, wie eine Ankündigung der kommenden Katastrophe. Offenbar war es ihm darum zu tun, daß man in Deutschland seine wahre Haltung gegenüber dem spanischen Sukzessionsplan erfuhr. Es muß aber auch seiner innersten Überzeugung nach um die Sache des Kaisers schon schlimm bestellt gewesen sein, weil er sich sonst doch gehütet hätte, derart zum Fenster hinauszusprechen.
Als Maximilian auf der Heimreise im Dezember 1551 nach Trient kam, tagte dort das Konzil, um das, was in der ersten Session und in Bologna nicht geglückt war, zu vollenden. Der König wurde mit seiner Gemahlin feierlich eingeholt, nachdem sich vorher der übliche Streit um das dabei einzuhaltende Zeremoniell und nicht zuletzt um den leidigen Vorrang abgespielt hatte. Im Hause des Kardinals Madruzzo war für ihn Quartier gemacht. Dem hohen Gast zu Ehren gab es »allerlei Kurzweil an Tanzen, Schießen und Freudenfeuern«. Er ward aber auch Zeuge der unerquicklichen Streitigkeiten unter den Teilnehmern der Kirchenversammlung. Dem Wunsche des Kaisers folgend, hatten sich hier auch Vertreter der protestantischen Fürsten eingefunden; sie merkten indes gar bald, daß das neue Konzil das alte sei und nicht die geringste Aussicht bestehe, mit ihren Forderungen durchzudringen. So wandten sie sich denn mit ihren Klagen – auch bezeichnend genug – an Maximilian, der ihnen versprach, sich beim Kaiser dafür einsetzen zu wollen, daß er die ihnen gegebenen Zusagen halte. Er verwendete sich auch beim Papst für des Kurfürsten Joachim von Brandenburg zweiten Sohn Friedrich, der von dem protestantisch gesinnten Kapitel zum Erzbischof von Magdeburg und zum Bischof von Halberstadt gewählt worden war, damit er die Bestätigung erhalte.

Kinderbildnis Maximilians II. und seiner Brüder Ferdinand und Johann
So erweist sich hier der junge König als ein Freund und Sachwalter der Protestanten, während er in kirchlicher Hinsicht, wie es uns von zuverlässigster, von spanischer Seite, bezeugt erscheint, sich vollkommen korrekt benimmt und den Konzilsvätern mit aller Devotion begegnet. Es hat also auch dieses Eintreten für die protestantischen Interessen gar nichts mit seiner religiösen Überzeugung zu tun. Maximilian wußte eben, wie der englische Gesandte Richard Morysine um diese Zeit berichtet, sehr wohl, daß es keinen besseren Weg gebe, ihn groß zu machen, als ein gutes Verhältnis zum Protestantismus.
Am Silvesterabend traf Maximilian in Innsbruck ein. Hier erwartete ihn schon ungeduldig Kaiser Karl. Noch einmal sucht er in persönlicher Aussprache den Schwiegersohn für seinen Sukzessionsplan zu gewinnen – freilich ohne Erfolg. Maximilian konnte sich aber bei dieser Gelegenheit von der tiefen Unzufriedenheit überzeugen, die gegen das spanische Regiment, namentlich gegen den Minister Granvelle, in weiten Kreisen herrschte.
Zu Beginn des neuen Jahres 1552 verbrachte der junge König in Gesellschaft seines Schwagers Albrecht von Bayern, der ihn schon in der Tiroler Hauptstadt aufgesucht hatte, einige Tage in Wasserburg am Inn. Der Aufenthalt in diesem oberbayerischen Städtchen sollte für Maximilian zeit seines Lebens von schlimmster Bedeutung sein. Denn da war es, daß ihn eine schwere Krankheit niederwarf, die in Herzkrämpfen und Ohnmachtsanfällen, Podagra und Magenschmerzen sich äußerte und in der Folge nicht mehr von ihm wich. Maximilian behauptete allen Ernstes, es sei ihm in Trient von Seite der deutschen Katholiken ein Gift verabreicht worden. Er beschuldigte auch einen Mann ganz besonders: den Kardinal Christoph Madruzzo, seinen Gastgeber in der Konzilstadt. Um sich beim Infanten Philipp beliebt zu machen, habe sich der Kardinal zu dieser schwarzen Tat verleiten lassen. Und König Ferdinand schenkte dieser Angabe Glauben, denn er schickte ihm Arzneien, die gegen Gift zu wirken geeignet erschienen. Man sieht, wie sehr sich durch den langen Kampf zwischen den beiden Linien der habsburgischen Familie die Gemüter verbittert hatten, daß man einen derart fürchterlichen Verdacht laut werden lassen konnte.
Der schwere Bruderzwist im Hause Habsburg hat ohne Zweifel die große Katastrophe vorbereiten helfen, die sich nun über dem Haupte Kaiser Karls V. entladen sollte – die deutsche Fürstenrevolution.
Die Abrechnung mit dem Kaiser kam nicht wie aus der Pistole geschossen. Schon seit langem herrschte in allen Schichten des deutschen Volkes eine schwere Verstimmung gegen sein spanisches Regiment. Nicht zuletzt war es die Religionsordnung, die Karl V. nach der Bezwingung der Schmalkaldner, auf der Höhe seiner Machterfolge, den Deutschen aufgezwungen hatte. Das sogenannte »Augsburger Interim«, in welchem den Protestanten wohl einige Zugeständnisse, wie die Priesterehe und der Genuß des heiligen Abendmahles unter beiderlei Gestalt, gemacht, aber sonst die katholischen Dogmen und Gebräuche beibehalten worden waren, hatte große Erbitterung erregt. In einer Flut von Flugschriften und Liedern wurde das »teuflische Interim«, die Augsburger »Sphinx«, »das schöne heuchelische und gladstreichende Ketzlein« verhöhnt. Man sah es als einen an den Protestanten verübten Gewaltakt an:
»Herr Gott von Himel, steh uns bei
Und straf des Kaisers Tyrannei
Und Steuer seinem Toben! …«
»Ein Mann Carlus der fünfft genannt,« heißt es in einer Dichtung, »habe endlich nach zwanzigjähriger Schwangerschaft ein grausames Tier geboren.« Mit besonderer Vorliebe wird die Greuelgestalt dieses antichristlichen Ungetüms ausgemalt, etwa als ein dreiköpfiger Drache mit Schlangenschwanz, Skorpionsstachel, Adler- und Krötenfuß – »dieser Wurm heißt auf Latein Interim«. Evangelische Prediger schürten diese Erregung, die sich dann bald auch gegen die katholische Kirche richtete. »Es stinkt kein Dreck«, ließ sich der radikale Wortführer Flacius Illyricus derb vernehmen, »so übel in unsern Nasen als das Papsttum, welches der allergarstigste Teufelsdreck ist, vor Gott und seinen heiligen Engeln stinket.«
Aber zu der religiösen Gärung kam eine tiefgehende politische Opposition, die vor den katholischen Ständen des Reiches nicht halt machte. Allgemein sah man in der schimpflichen Behandlung der vormaligen Häupter des Schmalkaldner Bundes eine Demütigung des Fürstentums selber. Niemand aber fühlte sich tiefer verletzt als der stolze, hochfahrende Kurfürst Moritz, der Schwiegersohn des gemaßregelten Landgrafen Philipp. In aller Eile bereitete der Fürst, der die Sache der Schmalkaldner verraten hatte, den großen Schlag gegen den Kaiser vor, und der gelehrige Schüler desselben wußte es so geschickt anzustellen, daß Karl die längste Zeit von dem heranziehenden Sturm nichts merkte.
Am 15. Januar 1552 schloß Moritz, der schon von einem »Königreich« Sachsen träumte, auf Schloß Cambray mit dem Franzosenkönig Heinrich II. den für die ganze Zukunft Deutschlands verhängnisvollen Vertrag, der als Preis für die französische Hilfe die Abtretung der lothringischen Städte Metz, Toul und Verdun verfügte. Und dafür, daß dem allerchristlichsten König deutsche Reichsgebiete – allerdings mit Vorbehalt der Reichsrechte – überlassen wurden, ließ er sich noch als »Rächer der deutschen Freiheit«, als ein »Freund und treuer Vater« feiern, der berufen erschien, die Absichten des Kaisers, die Deutschen in eine »ewige viehische Servitut« zu zwingen, vereiteln zu helfen.
Wenige Wochen später, im März, warf der sächsische Kurfürst, der noch zu Beginn des Jahres mit dem Kaiser verhandelt und sich um eine Zusammenkunft in Innsbruck bemüht hatte, die Maske ab. Mit dem Heere, das er gegen das geächtete Magdeburg auf die Beine gebracht hatte, rückte er rasch durch die Ehrenberger Klause nach der Tiroler Hauptstadt vor, wo der »überlistete Kaiser«, wie es in einem Gedicht hieß, »in Schlaf und Traum versunken«, an der Gicht daniederlag. Die Absicht des Kurfürsten, Karl in seine Gewalt zu bekommen, »den Fuchs in der Höhle aufzusuchen«, mißglückte allerdings. Es gelang dem Kaiser in eiligster Flucht sich nach Villach in Kärnten zu retten; aber es war für den Beherrscher des Weltreiches schmerzlich genug, am Abend seines tatenreichen Lebens mit Schmach und Schande sich bedeckt zu sehen. Und in der Verbitterung, welche die Seele des Monarchen erfüllte, bezichtigte er den Bruder und den Neffen des Einverständnisses mit den deutschen Fürsten.
Für ein solches Zusammengehen liegen nun keinerlei Beweise vor. Der junge König hat in einem Schreiben an den Kaiser den Verdacht, mit dem Kurfürsten Moritz unter einer Decke gesteckt zu haben, für seine Person nachdrücklichst zurückgewiesen; aber diese Verwahrung wäre an und für sich noch kein vollgültiges Zeugnis. Doch das ist richtig: die Ziele der Verschwörer und die Wünsche Maximilians liefen in einer Richtung, und aus dieser Schicksalsgemeinschaft, aus dieser inneren Verbundenheit hat denn auch der Thronfolger kein Hehl gemacht.
Dem Rat Ulrich Mordeisen, der bei einer Zusammenkunft in Linz zu Ostern im Auftrage des sächsischen Kurfürsten die Erwartung aussprach, der König werde die Stiftung von Ruhe und Frieden in der Christenheit nach Kräften fördern, erwiderte er: Er habe gehört, »daß von ezlichen die deutsche Freiheit zu rekuperieren angezogen wurde; nun wollten Ihre Königliche Würde auch nicht gerne, daß derselben Freiheit zuwider etwas sollte furgenommen werden; denn es hätten Ihr Herr Vater und das Haus Österreich auch nicht die geringsten Freiheiten – die wollten sie ihnen auch nicht gerne entziehen und schmälern lassen, und befahrten sich Ihre Königliche Würde, daß diejenigen, so sich unterstünden, dieselbe jetzt zu vindizieren, selbst nicht gar guet mit den Deutschen meinten«. Drei Jahre später äußerte sich Maximilian gelegentlich, daß es ihm recht gewesen wäre, wenn man den Kaiser gefangen hätte.
König Ferdinand hatte schon vor der Flucht Kaiser Karls auf dessen Wunsch hin die Vermittlung in die Hand genommen. Dem Herzog Johann Friedrich von Sachsen schenkte er in Innsbruck die Freiheit und reichte ihm zur Versöhnung die Hand. Am 1. Juni begannen in Passau die Verhandlungen mit den Verschworenen, die schließlich zu dem ersehnten Religionsfrieden führten. Der Passauer Vertrag bedeutete den vollen Sieg der »deutschen Libertät«, des fürstlichen Partikularismus und des Evangeliums, das sich seine Gleichberechtigung erstritten hatte.
Aber nun galt es des Kaisers Zustimmung zu erwirken, und die war nicht leicht zu erreichen. »Wenn es nur um die Schande wäre,« schrieb Karl seinem Bruder, »so würde ich um des Friedens willen leicht darüber wegkommen; ich habe mich niemals gesträubt, Beleidigungen, die mir persönlich zugefügt wurden, der gemeinen Wohlfahrt wegen zu vergeben. Aber das Schlimme ist hier, daß zur Schande, die man ja hinunterschlucken könnte, eine Belastung meines Gewissens hinzutritt, die ich nicht auf mich zu nehmen vermag.« Nur nach einigen nicht unerheblichen Änderungen – so war der Gedanke eines »ewigen« Religionsfriedens ausgeschieden – konnte Karl zur Unterzeichnung des Passauer Vertrages bewogen werden. Auf dem nächsten Reichstag sollte die Frage dann endgültig bereinigt werden.
Allein der Kaiser, der wieder seine alte Spannkraft gewonnen hatte, war nicht gesonnen, die durch die Fürstenrevolution geschaffene Lage als einen bleibenden Zustand anzuerkennen. Er bricht nach dem Westen auf, um den Franzosen die Stadt Metz zu entreißen, und er scheut sich nicht, mit einem der gefährlichsten Abenteurer und Unruhestifter sich zu verbinden, jenem Markgrafen Albrecht Alcibiades, den ein Rat König Ferdinands scharf, aber treffend als ein »ungeheures, unsinniges, wildes Tier« bezeichnet hatte, der den Krieg um des Krieges willen wollte und über Deutschland Schrecken und Verwüstung brachte. Nichts war in der Tat geeigneter, »Karls Namen und Ansehen bei der Nation am gründlichsten zu ruinieren«, als dieses sonderbare Waffenbündnis. Eigenhändig übergab Karl diesem »Unmenschen« die rote Feldbinde. »Not kennt kein Gebot«, so schreibt er seiner Schwester Maria. Im Reiche aber verhöhnte man den besudelten doppelköpfigen Adler mit grimmigen Spottversen.
Doch das von dem französischen Feldherrn Franz von Guise verteidigte Metz leistete zähesten Widerstand. Karl, der mit bewunderungswürdiger Ausdauer die Unbilden des Krieges ertragen hatte, sieht sich endlich gezwungen, die Belagerung aufzuheben. Müde und gebrochen zieht er sich in die Niederlande zurück, schon mit dem Gedanken beschäftigt, die dornenvolle Last der Regierung niederzulegen. Allein an den zwei Grundideen, in denen seine Lebensarbeit gipfelte, Rückführung der deutschen Ketzer zur alten Kirche und Einfügung Deutschlands in die spanische Universalmonarchie, hält er noch unentwegt fest.
So geht der Kampf weiter. Der Kurfürst Moritz trägt sich mit dem Gedanken, die Niederlande den Spaniern zu entreißen, jenes Land, auf das Maximilian seit jeher ein Auge geworfen, und das wiederum auf ihn seine Hoffnungen richtete. »Die Deutschen wünschen sich ihn zum Kaiser, die Flamländer zum Grafen«, so meldete der englische Gesandte am Kaiserhof, und dieses Urteil wird uns von dem brandenburgischen Rat Christoph von der Straßen vollauf bestätigt. »Die Niederlande«, meldet der Gesandte im April 1553 aus Brüssel, »dringen hart darauf, daß Ihre Majestät einen regierenden Herrn neben sich ordne, schreiet jedermann uf Maximilian.« Und der venezianische Gesandte Damula hörte von einem Bündnis, das in der Absicht geschlossen worden, nach Karls Tode die Niederlande an die deutsche Linie des Hauses Österreich zu bringen.
Allein der tatkräftige, kühne Kurfürst findet im Kampfe gegen Karls Verbündeten Albrecht Alcibiades sein vorzeitiges Ende. In der Schlacht von Sievershausen, am 9. Juli 1553, die für Moritz siegreich ausfiel, wird der erst zweiunddreißigjährige Held von einer Kugel tödlich getroffen und stirbt zwei qualvolle Tage später. Maximilian betrauert den Verlust seines Freundes mit den schönen Worten: »In summa, er ist ehrlich und ums Vaterland willen gestorben, aber gut war, daß man den unsinnigen Markgrafen nit ließ aufkommen, da es böser als je wurde.« Und auch im Volke fühlte man, daß Deutschland in dem Dahingeschiedenen eine bedeutende Kraft verloren hatte.
»Mit schwarz tu dich bekleiden
O teutsche Nation,
Rew, klag und hab groß Leiden,
Itz ist dein Held davon.«
Maximilian arbeitete auch in der Folge eifrig an der Befriedung des durch die Erhebung gegen Karl zu tiefst aufgewühlten Reiches mit. Es hatten sich zu diesem Zweck eigene Fürstenvereinigungen gebildet. In dem Heidelberger Bund, in welchem protestantische und katholische Fürsten einträchtig zusammenwirkten, spielt der junge König bald eine derartige Rolle, daß seinem Vater angst und bange wird. Ferdinand will ihn von einer allzu aktiven Politik ferne halten und schützt Rücksichten auf den Kaiser vor. Er erlaubt ihm daher nicht, dem Bundestag beizuwohnen. Doch Maximilian braust auf gegen seinen Vater, der ihm vorgeworfen, er habe einen »hitzigen Kopf«, und denke »weder hinter sich noch für sich«. In dem Wortwechsel, der sich darüber entspinnt, meint der Sohn, es sei unter den gegenwärtigen Verhältnissen doch gleich, da sie beide nun einmal für verdächtig gehalten würden – ein Argument, das Ferdinand nicht gelten lassen will. Man solle verhüten, so viel man verhüten könne, erwidert er.
Schweren Herzens bittet Maximilian in einem Schreiben vom 1. September Herzog Albrecht von Bayern, sein Fernbleiben zu entschuldigen. »Aber nichtsdestoweniger«, so fügt er bedeutungsvoll hinzu, »will ich gut deutsch bleiben und sterben, das soll mir kein Mensch wehren, es seien gleich die anderen wie sie wollen; und Euer Lieb und dem gemeinen deutschen Vaterland zu dienen, will ich jederzeit ganz willig befunden werden bis in meine Grube und so lange eine Hand an mir ist, wen es auch treffe.« Und drei Tage darauf legt er demselben Herzog gegenüber das Bekenntnis ab: »Ich wolt, daß die Spanier warn, ich was (= weiß) nit wo und das sie unser miesig giengen.«
Immer und immer wieder wirft Maximilian dem Vater seine schwächliche Haltung gegenüber dem Kaiser vor. »Gott gew,« so schreibt er am 11. Dezember Herzog Albrecht, »daß Seine M? sich ainmal tapfer gegen der Kayserlichen M? erzag und nit so klanmietig, wie bisher beschehen ist. Mich wundert nuer, daß Seine M? so blint ist oder nit merken wil, wie untreulich und unbruederlich die Kayserliche M? mit ime umbget. Got welle es zum besten schicken, sunst besorg ich lauter, es werde nichts guets daraus.« Und der junge König hatte nicht so unrecht.
Noch ehe das Jahr 1553 um war, sollte es sich wiederum zeigen, daß Kaiser Karl auch jetzt, nach seiner Demütigung, überall wo er konnte, seinen deutschen Verwandten feindlich in den Weg trat. Der Tod des jungen Königs Eduard VI. im Juli hatte dessen ältere Schwester, die katholische Maria, auf den englischen Thron gebracht. Allsogleich sendet Ferdinand seinen Oberstkämmerer Martin de Guzman nach London, um für Erzherzog Ferdinand die Hand der neuen Königin zu begehren. Aber der Kaiser wollte es anders: die ältliche Herrscherin wird für seinen eigenen Sohn bestimmt, um das schon fast für den Katholizismus verlorene England der alten Kirche zu unterwerfen und in das spanisch-habsburgische Weltreich einzuspannen. Ferdinands Rat Doktor Zasius sprach dem jungen König sicherlich aus der Seele, wenn er von dem Abschluß der englischen Ehe das Wiederaufleben des kaiserlichen Sukzessionsplanes besorgte. Werde Philipps Handel in England perfekt werden, schrieb er am 4. November Maximilian, »da würde es erst recht angeen und sich die löbliche teutsche österreichische Linie von der Kuniglichen M? an usque in omnem posteritatem wol furzusehen haben …«, daß man ihr nicht Maulkorb und Zügel anlege. Und als dann Philipp mit Maria im Juli 1554 Hochzeit hielt, konnte sich sein deutscher Vetter nicht enthalten, gegen das »spanische Regiment« in England loszuziehen.
Doch die Tage des Weltherrschers waren gezählt. Es war die Tragik Karls, auch diesen letzten Trumpf, die englische Heirat, zusammenbrechen zu sehen. Die Schwangerschaft Marias, die man für eine vollendete Tatsache gehalten hatte, erwies sich als unrichtig und Karl erhielt statt der bereits vorbereiteten Freudenbotschaft die Nachricht vom Hinscheiden seiner unglücklichen Mutter, der »wahnsinnigen« Johanna, die am Karfreitag des Jahres 1555 im Gefängnis von Tordesillas ausgelitten hatte. Schwer getroffen, nicht zuletzt auch gedrängt von seiner eigenen Umgebung, die ihn merken ließ, daß er ausgespielt habe, entschloß er sich dazu, die Regierung seinem Sohne Philipp zu überlassen. In seiner zögernden Art tat er auch dies nur schrittweise; zuerst, im Oktober, trat er Philipp, der aus England gekommen war, in einer feierlichen Versammlung der Generalstände die Niederlande ab, und dann, im Januar des nächsten Jahres, überließ er diesem auch die Herrschaft Spaniens.
Die Ordnung der deutschen Reichsangelegenheiten hatte Karl schon früher seinem Bruder anvertraut. Der Reichstag, der seinerzeit in Passau verabredet und dann, hauptsächlich des markgräfischen Krieges wegen, viermal vergebens angesetzt worden war, konnte erst am 5. Februar 1555 – ausgeschrieben war er für den 13. November 1554 – vom König in Augsburg eröffnet werden. Hier ist nun nach langwierigen Verhandlungen der denkwürdige Religionsfriede zustande gekommen. Man weiß, daß er eigentlich kein Friede war, sondern nur ein Waffenstillstand im Kampf der beiden konfessionellen Parteien, eine »temporäre Auskunft, ein Werk der Not und der Gewalt«, wie Schiller sagt. Der von den Zeitgenossen als ein köstliches Kleinod, ein demantener Pfeiler, eine Zierde und Herrlichkeit des Reiches gepriesene Augsburger Religionsfriede, der wohl ausdrücklich als »beständig und beharrlich« erklärt wurde, brachte nicht die Aussöhnung der Konfessionen, die »christliche Religionsvergleichung«, von der man immer gesprochen, nicht die nationale Kirche, wie sie damals in England und Frankreich entstanden war. Durch Unklarheiten in der Formulierung suchte man sich um die großen, schroff und unversöhnlich einander gegenüberstehenden Gegensätze herumzudrücken. Die Katholiken hatten es durchgesetzt, daß dem Übergreifen der neuen Lehre auf die geistlichen Fürstentümer ein Riegel vorgeschoben wurde: das sog. »Reservatum ecclesiasticum«, der »geistliche Vorbehalt«. Er bestimmte, daß ein zum Protestantismus übertretender Prälat mit seiner kirchlichen Würde auch die weltliche Herrschaft abzugeben habe. Gegen diese Abmachung, die auch in den Reichstagsabschied kam, legten die Protestanten Verwahrung ein, so wie umgekehrt die Katholiken die sog. »Ferdinandeische Deklaration«, durch welche die freie Religionsübung evangelischer Untertanen in den geistlichen Ländern geschützt wurde, nicht anerkannten.
Alles lag jetzt an der Ausführung dieser Bestimmungen und an der inneren Kraft, über welche die beiden Religionsparteien verfügten. Aber immerhin hatten die Protestanten mehr erreicht, als sie sich das noch vor wenigen Jahren hätten erträumen können. Und mehr jedenfalls, als daß es der Kaiser hätte über sich gewinnen können, die Beschlüsse dieses denkwürdigen Reichstages mit seinem Namen zu decken. Denn soviel war klar: durch die Anerkennung der Gleichberechtigung des Protestantismus, die hier endgültig erfolgte, war die politisch-religiöse Gedankenwelt des Mittelalters, die kirchliche und weltliche Einheit der gesamten Christenheit, zerbrochen, war die Autorität der Kaisermacht unterhöhlt worden. Der Augsburger Religionsfriede besiegelte das Übergewicht der fürstlichen Oligarchie über die Reichszentralgewalt. Das den Fürsten hier eingeräumte Recht, über den Glauben ihrer Untertanen zu verfügen, bedeutete eine ungeheuere Verstärkung der Macht des Landesherrn in moralischer Hinsicht; für die materielle Fundierung ihrer neuen Stellung sorgten die Güter und Stiftungen der alten Kirche, die sie sich in den vorausgegangenen Stürmen der Reformation angeeignet hatten und deren rechtmäßiger Besitz nunmehr anerkannt wurde.

Die Wiener Hofburg aus dem Jahre 1563
Karl V. überließ die Verantwortung für den Augsburger Religionsfrieden, der deutlich den Sieg der Fürstenerhebung gegen den übermütig gewordenen Kaiser zum Ausdruck brachte, seinem Bruder Ferdinand, der allerdings schwer daran zu tragen haben sollte.
König Maximilian hatte an den schicksalsschweren Verhandlungen des Augsburger Reichstages nicht teilgenommen, er leitete in der Abwesenheit des Vaters die Regierungsgeschäfte. Sein Wunsch, »auch derbei« sein zu dürfen, wurde von Seiten des Vaters nicht erfüllt, und Maximilian mußte sich damit begnügen, durch seine Vertrauensmänner über den Gang der Beratungen auf dem laufenden erhalten zu werden. Warum der alte König seinen Sohn, dem es einstmals vergönnt gewesen, an allen größeren Staatsaktionen teilzunehmen, von der für die künftigen Schicksale Deutschlands so entscheidenden Reichsversammlung ferngehalten hat, ist nicht bekannt. Wollte ihn Ferdinand vor weiterer Berührung mit den deutschen Protestanten bewahren? Gewiß ist nur, daß er damals, als der Reichstag zusammentrat, alle Ursache hatte, mit der religiösen Haltung seines Sohnes unzufrieden zu sein.
Schon seit langem hatte – wir wissen es schon – Maximilians religiöse Entwicklung dem Vater schwere Sorge bereitet. Nach den ernsten Vorstellungen, die Ferdinand im Februar 1547 an den im kaiserlichen Hauptquartier weilenden Thronfolger richtete, fand er sich mehrmals gedrängt, diese zu erneuern, so als er im Februar 1554 die »Auszeigung« der Länder, die Verteilung des habsburgischen Besitzes unter seine Söhne, vornahm, und wieder gerade während des Augsburger Reichstages in einem Kodizill zu seinem Testament vom 10. August 1555.
Da wendet er sich zunächst summarisch an alle seine drei Söhne, um dann bald seinen ältesten gründlich ins Gebet zu nehmen. »Ich betrachte«, so heißt es da, »das Wesen der Welt, und wie die Ketzereien und neuen Sekten sehr überhand nehmen, und daß Ihr nicht werdet unangefochten bleiben, darein verführt zu werden. Und hauptsächlich hab ich auf Euch, Maximilian, mehr Sorg als auf Euer ander keinen, denn ich hab allerlei gesehen und gemerkt, das mir einen Argwohn bringt, als wolltest Du Maximilian von unsrer Religion fallen und zu der neuen Sekte übergehen. Gott wolle, daß das nicht sei und daß ich Dir darin Unrecht tue; denn Gott weiß, daß mir auf Erden kein größeres Leid noch Bekümmernis vorfallen könnte, als daß Ihr, Maximilian, mein ältester Sohn, der am meisten zu regieren haben wird, von der Religion abfielet. Es wäre mir das auch von Euch andern ein großes Leid und Betrübnis, so groß, daß ich viel lieber Euch tot sehen wollte, als daß Ihr in die neuen Sekten und Religion fallen solltet, und ich bitte daher Gott ganz treulich täglich, daß er Euch davor behüte, und ehe er Euch darein fallen lassen sollte, Euch, dieweil Ihr, wie ich hoffe, gute Christen seid, von dieser Welt abfordern möge.«
In der Tat konnte der königliche Vater schon »allerlei« gesehen und gemerkt haben, denn um diese Zeit war es bereits eine offenkundige Tatsache, daß Maximilian der neuen Richtung angehörte. Die Frage, wann und wie sich dieser Wandel beim Prinzen vollzogen habe, sie läßt sich nicht aktenmäßig beantworten. Gewiß hat er sich nicht plötzlich ereignet, war der Boden für die Aufnahme der Saat schon von langer Hand gründlich bearbeitet worden. Die beständigen Reibereien und Konflikte mit dem Kaiser und dem Infanten Philipp haben wohl in erster Linie dazu beigetragen, Maximilian ins andere Lager zu treiben, und dies um so mehr, als er ja eigentlich immer, soweit unsere Kenntnis reicht, mehr ein »laxer« Katholik gewesen ist. Gerade im Sommer 1555 hatte er wieder einen Zusammenstoß mit der spanischen Umgebung seiner Gemahlin gehabt, in welcher er nicht ohne Grund »Spione und Aufpasser seiner Handlungen und seiner Worte« zu sehen gewohnt war. Ruhte einmal der Kampf um die Nachfolge im Reich, dann gab es wieder die unerquicklichen, sich beständig wiederholenden Reizungen finanzieller Natur, weil die beim Abschluß der Heirat mit Maria vereinbarten Zahlungen unterblieben. Da zu jener Zeit Politik und Religion innigst miteinander vermengt waren, muß unter solchen Umständen dem Kaiser selber ein guter Teil der Schuld an der unbefriedigenden Entwicklung des Thronfolgers zugeschrieben werden.
Und nicht zuletzt hat auch Ferdinand in Verfolgung seiner dynastischen Ziele oft Wege eingeschlagen, die vom streng kirchlichen Standpunkt gewiß nicht unbedenklich erscheinen und dem König den Vorwurf der – »Sorglosigkeit« eintragen sollten. Er fand nichts dabei, wenn er seine Tochter Maria mit dem protestantenfreundlichen Herzog Wilhelm von Jülich vermählte oder eine Verbindung seiner Tochter Leonore mit dem lutherischen Prinzen Friedrich von Dänemark in Erwägung zog. Mußte die beständige Berührung mit dem Protestantismus nicht in dem jungen Maximilian die Überzeugung erwecken, daß das Bekenntnis der neuen Sekte nichts Ungeheuerliches sei?
Eine solche »Sorglosigkeit« war es, daß Ferdinand einen derart zum Protestantismus hinneigenden Mann, wie es der Niederländer Kaspar von Nidbruck gewesen, in hervorragender diplomatischer Stellung verwendete. Nidbruck stand lange Zeit mit dem lutherischen Theologen Matthias Flacius Illyricus in Verbindung und förderte dessen literarische Arbeiten, den »Katalog der Wahrheitszeugen« und das große kirchengeschichtliche Werk der »Magdeburger Centurien«. Durch Empfehlungen von Seiten des jungen Königs wußte sich der Gesandte alte wertvolle Handschriften und Bücher zu verschaffen, die sodann den »Centuriatoren« zur Benutzung überlassen wurden. Es kann wohl kein Zweifel darüber bestehen, daß Maximilian um diese Tätigkeit seines Lieblingsgesandten gewußt hat und auf diese Weise jene »lutherische« Bibliothek zustande gekommen ist, die in den später vom Papst Paul IV. gegen den Wiener Hof erhobenen Vorwürfen eine Rolle spielte.
Und als eine solche Sorglosigkeit darf nicht zuletzt die Berufung Johann Sebastian Pfausers an den Wiener Hof gedeutet werden – denn dieser Prediger war es, der Maximilian, soviel man sieht, wenn nicht zum Lutheraner gemacht, so doch seine evangelische Gesinnung stark beeinflußt hat. Wie wäre dieser aus einer steirischen Familie stammende, aus Konstanz gebürtige Priester in die Dienste des jungen Königs gelangt, wenn ihn nicht Ferdinand, von seinem Ruf als eines ausgezeichneten Predigers angelockt, eingeladen hätte, nach Wien zu kommen! Die Tatsache allein, daß er Frau und Kind besaß, hätte ihn verdächtig erscheinen lassen müssen. Es ist auch schwer zu glauben, daß Pfauser, der etwa im Herbst 1554 Maximilians Hofprediger wurde – Ferdinand wähnte, er sei von Nidbruck verführt worden –, in so kurzer Zeit zu einem vollwertigen Vertreter des Evangeliums geworden sei. Als der böhmische Priester Johann Blahoslaw im März 1555 in Wien weilte und Pfauser in der dichtgefüllten Augustinerkirche predigen hörte, bekam er sofort den Eindruck, daß er ein Lutheraner sei, wie denn auch der Gottesdienst einen ausgesprochenen lutherischen Anstrich hatte.
»Am Sonntag – es war der 10. März – früh«, so berichtet Blahoslaw, »ging ich in die Predigt und fand da eine große Menschenmenge; von allen Seiten eilte man herbei, trug Stühle und andere Sitze. Dies dauerte über eine Stunde, bis es ganz voll wurde. Endlich kam auch Maximilian aus dem Schlosse in die Kirche durch einen Gang in seinen Chor, dann kam alsbald der Prediger. Er intonierte ein kurzes lutherisches Lied; nach dem Gesange wurde gebetet, dann sprach er aus dem Gedächtnisse die Perikope aus Matth. 15 her vom Kananäischen Weib … Dieser Prediger erschien mir durchwegs als ein evangelischer; denn er predigte ganz in lutherischer Weise, doch ohne dies zu erwähnen; er setzte bloß einfach die Wahrheit auseinander und belegte sie mit vielen Schriftstellen … Vor der Predigt geschah in der Kirche nichts; die Leute harrten bloß zwei bis drei Stunden, bis es eine solche Menschenmenge gab, daß einige Mädchen im Gedränge zu schreien begannen. Nicht einmal der königliche Trabant konnte einer Dame auf ihren Stuhl verhelfen, wenngleich er mit Schlägen drohte … Nach der Predigt ward wieder lutherisch gebetet, dann ging Maximilian und alles Volk gleich weg, viele trugen Stühle mit, von denen manche im Gedränge zerbrochen wurden. In der Predigt gab es verschiedenes Volk: Deutsche, viele Ungarn, viele Hofdiener und Trabanten, Gelehrte, Bürger und Dienstleute. Niemand tadelte den Prediger, vielmehr lobten ihn fast alle, und obzwar der Prediger niemanden nannte, so grollen sie doch alle den Mönchen.«
Was sich also da am hellichten Tage in der Hofkirche abspielte, mußte König Ferdinand als ein Skandal erscheinen, und es änderte daran wenig, daß Pfauser steif und fest behauptete, keiner religiösen Parteirichtung anzugehören, sondern einfach die Wahrheit vorzutragen. Zu Blahoslaw bemerkte er erklärend: Er lobe weder die Lehre der Lutheraner öffentlich, noch tadle er öffentlich das Papsttum, »denn ich ging stets den Mittelweg, kehrte mich weder an die eine, noch an die andere Partei; denn bei beiden sehe ich vieles, was nicht taugt. Gebe uns doch Gott den Geist der Eintracht! In wahrer Eintracht aber fühle ich mich mit allen Frommen der wahren Kirche. Und obzwar ich nach keiner Seite hin mich neige, so weiß ich doch in meinem Herzen, was ich erkannt habe, und davon will ich nicht ablassen, auch nicht einen Finger breit.«
Aus dieser Mittelstellung, die Pfauser einzunehmen behauptete und die für Maximilian zeit seines Lebens bestimmend sein sollte, erklärt sich seine scharfe Einstellung gegen den spanisch-römischen Kampforden der Jesuiten, die er als Heuchler, Schelme und entsetzliche Blutmenschen bezeichnete. Den Katholizismus des ersten deutschen Jesuiten Canisius, der bei Ferdinand das Amt eines Hofpredigers bekleidete, nannte er eine »Summe des abenteuerlichsten Papistentums, doch schön mit Schminke übertüncht, wie dies eben Brauch der römischen Hure sei, ihre Sachen zu verschönern«. Doch hinderte Pfauser seine Mittelstellung nicht, ausgesprochen lutherischen Anschauungen zu huldigen, so wenn er gegenüber der Autorität der Konzilien und Kirchenväter sich auf die Heilige Schrift berief. Von der Anrufung der Heiligen und anderen »Mißbräuchen« wollte er auch nichts wissen.
Maximilians religiöse Gesinnung war jedenfalls schon zu Ende des Jahres 1554, vor der Abreise Ferdinands nach Augsburg, am Wiener Hof bekannt. In Gegenwart des Vaters warf der königliche Vizekanzler Doktor Jakob Jonas dem jungen König, wie dieser dem Gesandten des sächsischen Kurfürsten erzählte, seine Hinneigung zu Pfauser und zum Luthertum vor. Er gehe mit faulen Eiern um, erklärte Jonas, täte nichts, »dan vor die lutherischen Buben beten (= sich verwenden). Maximilian erwiderte: Er bitte für einen ehrlichen Diener des Hauses Österreich. Darauf dann wieder Jonas: Es wäre gleichwohl ein lutherischer Bube und er, der König, wäre auch lutherisch. Das Geplänkel schloß damit, daß ihn Maximilian einen »alten Papisten« nannte. Und als dann Ferdinand in Augsburg weilte, wandte sich Canisius mit Klagen an ihn, die zur Folge hatten, daß der König – es war um die Wende des Monats März – seinem Sohne »einen gar geschwinden, bösen und ernstlichen Brief« zugehen ließ, derart strenge, wie er noch nie einen von seinem Vater erhalten hatte.
Sebastian Pfauser war um die Zeit, da sich Blahoslaw in Wien aufhielt, der Vertrauensmann des jungen Königs, der in der Abwesenheit Ferdinands ganz im Geiste seines Hofpredigers vorging. Der böhmische Priester schilderte Maximilian als den »offenen Hauptfeind« der Jesuiten, auf die er so »bitter böse« sei, daß er keinen von ihnen sehen und sprechen wolle, ja daß man ihrer in seiner Gegenwart nicht einmal Erwähnung tun dürfe. Der junge König verbot die Veröffentlichung eines Ablaßschreibens, das er wenig respektvoll als »Zauberpossen« bezeichnete. Den Katechismus des Canisius, der, mit einem Geleitwort Ferdinands versehen, in Druck erscheinen und in Österreich eingeführt werden sollte, hielt er zurück. Die Messe der »Papisten« mied er. Luthers deutsche Bibel – es war die Prachtausgabe, die dem in der Schlacht bei Mühlberg gefangengenommenen Kurfürsten Johann Friedrich gehört hatte – bildete seine Lektüre.
Doch hatte Maximilian mit dem Papsttum noch nicht gänzlich gebrochen. An die Thronbesteigung des Papstes Marcellus II., der dem im März 1555 verstorbenen Julius III. folgte, mögen er und seine Gesinnungsgenossen die Hoffnung geknüpft haben, es könne durch Abstellung der kirchlichen Mißbräuche ein Bruch vermieden werden. Als aber der neue Papst schon nach wenigen Wochen starb, konnte sich der König nicht enthalten, den Verlust dieses Oberhauptes der Christenheit zu beklagen, »derweil er wohl«, wie er am 30. Mai seinem bayerischen Schwager Albrecht schrieb, »leiden hätte mögen, daß man zu einer Vergleichung hätte griffen«, die den Pfaffen nicht nach ihrem Sinn gewesen wäre, und er fügte den bösen Verdacht hinzu, daß man ihm ein »walhisch Menesterl«, ein wälsches Supperl, habe zu essen gegeben.
Maximilians Stellung am Wiener Hofe war unter solchen Umständen, da er sich mit seinem Vater – dies war der Eindruck, den Blahoslaw gewonnen – zerworfen hatte, nicht die behaglichste. In vertraulichen Briefen an befreundete Fürsten klagt er über die Verfolgungen, die er auszustehen habe. Gegen Damian von Sebottendorff, den Gesandten des Kurfürsten August von Sachsen, der seinem Bruder Moritz in der Regierung gefolgt war, schüttete er in bewegten Worten sein Herz aus. »Er habe eine Kette am Halse,« bemerkte Maximilian seufzend, »nicht allein am Halse, sondern auch an den Füßen. Man traue ihm gar nichts, wäre wie ein Mönch im Kloster, hätte auch niemand Treuen um sich, hätte Leute bei sich, die er lieber wollte, daß sie weit von ihm wären, müßte es dulden bis zu seiner Zeit, hätte einen breiten Rücken, könne es wohl tragen. Die kaiserliche Majestät wäre ihm spinnefeind; könnten Sie ihn im Löffel ertränken, so täten Sie es.« Mit Bitterkeit gedachte er dann seiner »Leibesschwachheit«, die ihn seit seiner Rückkehr aus Spanien nicht loslasse, und er wisse wohl, »wo es herkomme, und was ihm darin gekocht worden«. Schließlich versicherte er dem Gesandten, daß er August nicht weniger zugetan sein wolle als seinem verstorbenen Bruder; käme einmal die Gelegenheit, dem Kurfürsten »seine Freundschaft mit der Tat zu beweisen und ihm mit Lieb, Haar und Gut« in etwas zu dienen, »so sollte es ihm eine Freude sein, es wäre auch wider wen es wolle, niemand ausgenommen«.
Auch am Kaiserhofe war man um Maximilian besorgt geworden. Karl V. beauftragte daher in den ersten Augusttagen Don Juan de Ayala, der als Gesandter nach Polen ging, seinen Weg über Wien zu nehmen und über den jungen König Erkundigungen einzuziehen. Der Gesandte traf unterwegs in Augsburg mit dem päpstlichen Nuntius Lippomano, Bischof von Verona, zusammen, der sich, von ihm befragt, sehr »reserviert« dahin äußerte: Er halte ihn für einen katholischen Fürsten, die Lutheraner hingegen rechneten ihn zu den Ihren. Ayala erzählte nun, was er selber über Maximilian gehört habe. Sein Obersthofmeister – es war Christoph Freiherr von Eitzing – sowie die Vornehmsten seines Hofes wären Lutheraner und besuchten nicht die Messe. Der Thronfolger selber stehe mit protestantischen Fürsten in Korrespondenz. Leider ist der Bericht, den Ayala über seine persönlichen Wahrnehmungen am Wiener Hofe machte, nicht bekannt. Aber ein anderer Spanier, Luis de Vanegas, der bald darauf dort weilte, erhielt von der Königin Maria die Tatsache, daß der Obersthofmeister Eitzing der Haupturheber des antispanischen und ketzerischen Treibens sei, bestätigt. Und das gleiche meinte wohl der königliche Rat Doktor Zasius, wenn er sich später einmal äußerte: »O Eyzing, Eyzing, was hast du gepflanzet!«
Indes versuchte es Ferdinand, als er im Oktober von Augsburg heimgekehrt war, noch einmal mit Güte. Pfauser, der im Juni 1555 Wien hatte verlassen müssen, aber dann mit des Königs Erlaubnis wieder zurückgekommen war, wurde auf seine Rechtgläubigkeit hin sorgfältig geprüft. Der Vater dachte wohl, daß Maximilian selber von Pfauser, wenn dieser als Ketzer überführt sei, sich abwenden werde. Ferdinand wohnte mit dem Kronprinzen seinen Predigten bei und äußerte sich dann im ganzen beifällig über ihn. Doch fand er in seiner persönlichen Aussprache mit Pfauser einiges daran auszusetzen. Er habe zu wenig von den guten Werken, meinte der König, zu viel vom Glauben gesprochen und alle Heilmittel in Christus gelegt, ohne die Sakramente, die guten Werke und die Fürbitte der Heiligen zu erwähnen. Pfauser müsse sich daher, wenn er hier als Prediger weiter verwendet werden wolle, in diesen Punkten ändern und am nächsten Tage – es war der Allerheiligentag – seine früher geäußerten Anschauungen ergänzen. Pfauser erwiderte, er könne nicht die Wahrheit nach dem Wunsche eines Menschen umformen, und berief sich auf die Heilige Schrift. Maximilian aber suchte seinem Prediger zu Hilfe zu kommen und erklärte auch für seine Person, nichts auf die Fürbitte der Heiligen zu geben; wer dies tue, handle gegen die Heilige Schrift und treibe Götzendienst. Ferdinand »erbitterte sich furchtbar« ob dieser Rede, seine »ganze Haltung änderte sich«.
Tags darauf predigte Pfauser vor den beiden Königen in seiner alten Weise, nur lebhafter denn je. Der hartnäckige Prediger wurde nun zwar nicht entlassen, aber sichtlich kaltgestellt und ein neuer Seelenhirt in der Person des Bischofs Urban von Gurk herangezogen, der es aber trotz seiner vermittelnden Haltung nicht verstand, die Gunst des Kronprinzen zu gewinnen. Diese blieb zu Ferdinands Leidwesen Pfauser erhalten, gegen den sich jetzt ein verstärkter Druck geltend machte. Nach einem heftigen Auftritt übergab ihm Ferdinand elf Fragen, die er im Verein mit Canisius aufgesetzt hatte, zur Beantwortung. Pfausers Erklärung, die recht scharf ausgefallen war, nahm der König zu sich, ohne sich mehr darauf zu äußern – sie war ihm, wie er sagte, »zu gelehrt«. Allein diese elf Artikel veranlaßten Maximilian und seinen Schützling zu weiterem Nachdenken. Sie beschlossen, sie einem »tüchtigen und gelehrten Manne« zur Beurteilung zu unterbreiten, und die Wahl fiel auf den mit Nidbruck befreundeten Melanchthon.
Der große Wittenberger Theologe erwiderte im März 1556 auf etwa zwanzig engbeschriebenen Bogen. Die Antwort klang fast mit lutherischer Schärfe in das Urteil aus: »Papst, Bischof, Pfaffen, Mönche sind Mörder, da sie christliche Menschen, die sich ihrer falschen Lehre widersetzen, dem Tod überantworten. Und weil Gotteslästerer und Mörder nicht Glieder der wahren Kirche Christi sein können, so sind diese Päpste, Bischöfe, Pfaffen und Mönche nicht Glieder der katholischen Kirche Christi, sondern Feinde Christi und der wahren Kirche, bei denen die Regel Geltung zu behalten hat: Wer ein ander Evangelium predigt, der soll verflucht sein … Alle Menschen aber sind schuldig, zu lernen, was und wo die rechte Kirche ist, und sich zu ihr zu halten … In dieser wahren Kirche sind wir durch Gottes Gnaden und bitten Gott, er wolle uns gnädiglich in dieser Versammlung erhalten, von der er spricht: Meine Schafe hören meine Stimme. Amen.«
Maximilian und Pfauser stellten mit Befriedigung fest, daß sich ihre dem König übergebene Antwort mit den Ansichten Melanchthons deckte. Sie rechneten sich fortan zu Anhängern des Wittenbergers – und sie konnten in diesem Sinne sich Mitglieder der katholischen, nämlich der wahren Kirche nennen.
Von den verschiedensten Seiten wird der Thronfolger als Freund der »evangelischen Wahrheit« um seine Unterstützung angegangen. Die böhmischen Brüder, eine Sekte, aus der die späteren Herrenhuter hervorgehen sollten, ließen ihm durch Blahoslaw ihre Bekenntnisschrift überreichen, mit der Bitte, sich für sie bei König Ferdinand zu verwenden. Zwei Monate später, im Januar 1556, trat in Wien ein Ausschußlandtag der fünf niederösterreichischen Lande – Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Görz – zusammen. Ferdinand verlangte von ihnen die Bewilligung einer Türkenhilfe, aber sie wollten, daß früher die Religionsfrage gelöst werde. In der Petition, die Ferdinand überreicht wurde, baten sie, allen »öffentlichen, greulichen, in der alten Kirche eingerissenen Aberglauben«, alle dem Worte Gottes widerstreitenden Mißbräuche abzuschaffen und dafür das wahre, reine Wort Gottes ohne menschlichen Zusatz und ohne Scheu predigen, die Sakramente nach der Ordnung Christi verwalten, das heißt in erster Linie das Abendmahl in beiderlei Gestalt reichen zu lassen. Dem König sagten sie offen heraus, daß sie lieber jede Gefahr auf sich nehmen und sich sogar vor dem Tode nicht fürchten wollten, ehe sie sich der römischen Tyrannei unterwürfen. Auch an Maximilian wandten sie sich, um seine Fürsprache zu erwirken. Der junge König sagte ihnen seine Unterstützung zu, ermahnte sie aber – hier zeigte sich der Dynast –, zuerst an die Geldbewilligung zu denken.
Immer offener tritt nun Maximilians oppositionelle Haltung gegenüber der alten Kirche zutage. Er steht mit dem Theologen Pietro Paolo Vergerio, der seines Glaubens wegen aus Italien hatte flüchten müssen, in Verbindung und liest seine Schriften. Er überträgt den Unterricht seiner Kinder dem Professor der Wiener Universität, Georg Muschler, der in religiöser Hinsicht mehr als verdächtig erschien. Ihre Erziehung den Jesuiten, wie es der Vater gewünscht hatte, zu überlassen, hatte er sich geweigert. Kein Wunder denn, daß Canisius in einem Gutachten die Mittel zur Änderung der Gesinnung des Kronprinzen ins Auge faßte und daher wieder an Pfausers Entfernung dachte.
In diese Zeit fallen auch die Anfänge seiner intimen Korrespondenz mit dem Kurfürsten August von Sachsen. Sie wird fast durchwegs eigenhändig geführt, und daß sie da manches mitteilen, was das Licht der Öffentlichkeit scheute, dies beweist die Verwendung von Chiffren und der Gebrauch einer eigenen Geheimschrift mittels chemischer Tinte, für die der sächsische Freund die folgende Anweisung erhält: »Hiermit überschickh ich Euer Lieb ain Zetl; do Sie es lesen wollen, so nemen Sie ain Schtickle von ainem Badschbamen (= Badeschwamm) als groß als ain Taler, netzen denselben wol in ainem Melissawasser und überschtraichen bemelte Zetel damit wol ain 3 oder fiermal; do Sie es aber alsdann nich wol lesen khunten, so mögen Sie ain Liecht in ainer finstern Khamer anzinten und bemelte Zetel wolgenetzter gegen bemelten Liecht halten, so verhofe ich Euer Lieb sollen sie lesen khunen, so aber nit, so wollen michs Euer Lieb berichten, so will ichs in der Zifer schraiben, so ich mit Euer Lieb in Brauch bin.«
Ein Schreiben Maximilians – es ist vom 2. April 1556 datiert – deutet durch die eigentümliche Ortsangabe »Wien in der Verfolgung« auf die Fortdauer der gespannten Beziehungen zum königlichen Vater hin. Der Kurfürst schreibt zurück, daß er mit ihm ein »herzliches Mitleiden« trage und ihn zum höchsten bitte, er wolle »sich dieses alles nichts irren oder abwendig machen lassen, sondern jemal bei der erkannten und bekannten Wahrheit und der Augsburgischen Confession, darauf sich Seine kunigliche Würden referiren, beständiglich belassen«.
Auch mit anderen protestantischen Fürsten unterhielt er einen vertraulichen Briefwechsel, der sich bald immer reger und herzlicher gestalten sollte, denn er brauchte sie auch aus politischen Gründen: große Veränderungen kündigten sich vom Kaiserhofe her an, zu welchen es Stellung zu nehmen galt.
Kaiser Karl V. hatte wiederholt den Wunsch geäußert, vor seiner Abreise nach Spanien noch einmal die Angehörigen seiner Familie zu sehen. Auch an Maximilian erging die Aufforderung, mit seiner Gemahlin nach Brüssel zu kommen. Die Reise wurde viermal verschoben. Endlich, Ende Mai 1556, brach Maximilian mit Maria, die wiederum gesegneten Leibes war, und einem großen Gefolge von Wien auf. Der junge König hatte auch wieder, um seiner Fahrt einen pomphaften Anstrich zu geben, allerlei exotische Tiere, wie Dromedare, Affen und Papageien, mitgenommen. Aber das Seltsamste war doch wohl, daß ihn sein Hofprediger Pfauser begleitete – ein evangelischer Prediger am Hoflager Karls V.! Auf der Fahrt trifft er mit Herzog Albrecht von Bayern zusammen, der es nicht unterläßt, ihm über seine religiöse Haltung Vorstellungen zu machen; aber auch mit seinem protestantischen Freunde Christoph von Württemberg und mit dem berüchtigten Markgrafen Albrecht Alcibiades, mit welchem er ein »sonderlich geheim Gespräch« hatte.
Mit starker Verspätung, am 17. Juli, reitet Maximilian, von seinem Vetter Philipp feierlichst eingeholt, in Brüssel ein, wo die Pest gewütet hatte, weshalb die Stadt erst gründlich ausgeräuchert werden mußte. Der Kaiser begrüßte seinen Schwiegersohn und seine Tochter in herzlicher Weise, und nun begannen wieder die Beratungen über die zukünftige Gestaltung des spanischen Weltreiches und Deutschlands. Karl erscheint endlich bereit, dem jungen König die Niederlande zu übergeben – freilich nicht ganz umsonst, wie sich bald herausstellen sollte. Der Kaiser, welcher im allgemeinen, wie der Kardinal Madruzzo boshaft bemerkte, »nicht so gern gab als nahm«, steuerte mit den verschiedenen Tauschprojekten, die er zur Verhandlung zog, doch wieder auf seinen alten Lieblingsplan zurück, dem Infanten die Nachfolge in Deutschland zu verschaffen. Da aber Maximilian für einen solchen Verzicht auf die römische Königskrone nicht zu haben war, so verliefen die verheißungsvollen Besprechungen im Sande – »parturiunt montes, nascetur ridiculus mus«, bemerkte spöttisch der Thronfolger. Auch bei der Regelung der finanziellen Ansprüche Maximilians und seiner Gemahlin, die hier zur Verhandlung kamen, entsprach das Ende keineswegs den ursprünglichen Vorschlägen. Aus der Grafschaft Burgund mit einer garantierten Jahresrente von hunderttausend Kronen, die er erhalten sollte, waren dann sechzigtausend Kronen, die ihm aus den Einkünften des Königreiches Neapel zuzuweisen wären, geworden.
Nicht zuletzt wurden die üblichen Heiratsabreden getroffen. Sie bezogen sich diesmal auch auf die Kinder des jungen Königs, von welchen die älteste Tochter Anna kaum sieben Jahre zählte. Sie sollte zur Sicherung des guten Einvernehmens der beiden Linien des Hauses Österreich mit dem Sohne Philipps, dem elfjährigen Don Carlos, verbunden werden. Für die jüngere, die zwei Jahre alte Elisabeth, wurde des französischen Königs Sohn Karl in Aussicht genommen. Auch wurde über eine Heirat Erzherzog Ferdinands mit der englischen Elisabeth gesprochen. Am Abend des 5. August nahm Maximilian, der wieder, wie er sagte, »des hiesigen Wesens schon genug« hatte, Abschied vom Kaiser, um am folgenden Tage von Brüssel abzureisen.
Karl verließ drei Tage später die Hauptstadt. Noch ehe der Monat um war, am 27. August, vollzog sich in Gent das wichtige Ereignis, auf das sein Bruder schon lange gewartet haben mag. Karl V. dankte nun auch als Kaiser ab und erteilte Wilhelm von Oranien, dem nachmaligen Todfeind seines Sohnes Philipp und Führer des niederländischen Freiheitskampfes, den Auftrag, von diesem seinem letzten Willensakt den Kurfürsten offizielle Mitteilung zu machen. Am 17. September trat er dann seine letzte Seereise an, um sich nach Spanien in das von ihm als Ruhesitz erwählte Hieronymitenkloster San Yuste zu begeben. »Die Welt war des Mittelalters satt und er war der Welt müde.«
Für König Maximilian eröffneten sich nach des Kaisers Rücktritt ganz neue Ziele und Wege. Das war es wohl, was er meinte, wenn er zum venezianischen Gesandten am Kaiserhofe sagte, daß »große Dinge« im Werke seien – es galt nun zu den religiösen und politischen Fragen, welche die Welt bewegten, in entschiedenerer Weise Stellung zu nehmen als bisher.
König Ferdinand teilte im November 1556 den Reichsfürsten den Verzicht Karls V. auf die deutsche Kaiserkrone amtlich mit. Er hegte die Absicht, auf einem Reichstag, der demnächst in Regensburg sich versammeln sollte, die Frage der Nachfolge zu regeln. Für Maximilian ergab sich nun die Möglichkeit, sich zum römischen König wählen zu lassen. Er säumt auch nicht, bei seinen neuen Freunden aus dem protestantischen Lager vorsichtig anzuklopfen. Dem Kurfürsten August ließ er durch seinen Gesandten Andreas Ungnad die Notwendigkeit vorstellen, daß die Protestanten für ihn einträten; denn die Geistlichen und Bischöfe, die »Bauchpfaffen«, würden nicht viel nach ihm fragen, wüßten sie doch, daß er »gut evangelisch ist worden«. Aber die anderen Fürsten, fügte er vielversprechend hinzu, würden gut dabei fahren, in erster Linie August, dem er als Preis für seine Stimme die Erwerbung des Vogtlandes in Aussicht stellte.
Doch hatte diese erste Fühlungnahme keinen greifbaren Erfolg. Die Sache eile nicht – das war die Antwort, die er von den verschiedensten Seiten erhielt. Dagegen wurden ihm bereits einige Kandidaten genannt, wie der Kurfürst August und Albrecht von Bayern. Gern wäre Maximilian zum Regensburger Tag gekommen, wie es denn nicht an Aufforderungen dazu fehlte. »Wenn ich also gut pfäffisch wäre, als vielleicht andere,« schrieb er am 15. Januar 1557 dem Herzog Christoph gereizt, »so hätte mir Ihre Majestät wohl hinauf erlaubt«, denn die Geschäfte, die er in Wien zu verrichten habe, könne sein Bruder Ferdinand gerade so gut besorgen. Freilich, besonders erquicklich war das Schauspiel nicht, das sich auf dieser Reichsversammlung dem Auge eines Beobachters bot, der selber dermaleinst auf den Kaiserthron zu gelangen hoffte – ein Schauspiel, das sich dann mit einer fast typischen Regelmäßigkeit wiederholen sollte.
König Ferdinand hatte unter die Beratungsgegenstände des Reichstages in erster Linie die Bewilligung einer Türkenhilfe und den kirchlichen Ausgleich, den ja der Augsburger Religionsfriede noch immer in Aussicht gestellt hatte, aufgenommen. Aber wie man sich nun an die Verhandlung machte, trat alsbald der Gegensatz zwischen den beiden Religionsparteien, den Katholiken und den Protestanten, sowie der Riß innerhalb der protestantischen Partei selber, das Auseinanderfallen in zwei um Kursachsen und Kurpfalz gescharte Gruppen, scharf zutage. Die aktivistische Partei der Protestanten unter Führung des Pfälzer Kurfürsten brachte die böse Frage der »Freistellung« auf die Bahn und meinte damit – denn der Begriff wurde in sehr verschiedenem Sinne aufgefaßt – nicht mehr und nicht weniger als die Aufhebung des Geistlichen Vorbehaltes, die Freistellung der Religion für die geistlichen Stände. Diesem Verlangen widersetzte sich neben den Katholiken, für welche die Freistellung naturgemäß den Kriegsfall bedeutete, auch die konservative Partei der Lutheraner mit dem sächsischen Kurfürsten an der Spitze. Sie stemmte sich auch der Ansicht des Pfälzers entgegen, daß man die Bewilligung der Türkenhilfe erst nach Bereinigung des Religionspunktes in Verhandlung ziehen solle. Die der Ostgrenze des Reiches nahe wohnenden Stände hatten ja von Haus aus für die Türkengefahr ein ganz anderes Verständnis, als jene, die weit vom Schusse, wie die Pfälzer, sich befanden und dazu kam bei dem Kurfürsten Friedrich dem Frommen der kalvinistische Gesichtspunkt, daß die Sache Gottes allen andren Pflichten vorangehen müsse. Die Aktivisten drangen angesichts des Zusammengehens der Konservativen mit den Katholiken nicht durch, aber eines erreichten sie doch, und dies war es, was dem Regensburger Reichstag von 1557 seine bestimmte Signatur und Bedeutung geben sollte: es hatte sich hier eine protestantische Partei gebildet, die doch in bestimmten Fragen zusammenhielt, während auf katholischer Seite auch nicht entfernt eine Einigkeit herrschte.
Diese größere Stärke der Protestanten bestand freilich nur nach außen hin. Wie es in Wirklichkeit damit bestellt war, dies zeigte sich sogleich, als man sich im September in Worms zu der in Regensburg vereinbarten Religionskonferenz zusammensetzte. Dieses »freundliche Gespräch«, das die »Vergleichung der spaltigen Religion« herbeiführen sollte, endete bald recht unfreundlich damit, daß die Theologen des sächsischen Herzogs Johann Friedrich, die der radikalen Lehre des Istrianers Flacius angehörten, unter Protest die Versammlung verließen, zum Gaudium der Katholiken, die sich weigerten, mit dem Rumpf noch weiter zu verhandeln. Mit Hohn erklärten sie, nicht zu wissen, ob die zurückgebliebenen Protestanten oder ihre abgezogenen Brüder die rechten »Augsburger Religionsverwandten«, die wahren Vertreter der Augsburger Konfession, darstellten.
Der Hohn war nicht unberechtigt, und wenn Melanchthon, der an dem Religionsgespräche teilnahm, erwiderte, sie alle seien in dem Augsburger Bekenntnis einig, so entsprach diese Feststellung mehr einem Wunsche als den Tatsachen. Die Denkfreiheit hatte, wie man weiß, den Protestantismus, aber nicht umgekehrt der Protestantismus die Denkfreiheit geschaffen. So war denn im Lager der Lutheraner ein wilder Meinungsstreit entstanden, der sich namentlich um die Lehre von der Notwendigkeit der guten Werke und um die schweizerische Abendmahlsdoktrin drehte. Die orthodoxen Flacianer, die das Luthertum in seiner reinen Gestalt zu vertreten meinten und in der Streitsucht ihren Meister Martin überbieten zu müssen glaubten, verstiegen sich in dem Kampfe bis zu der »tollen« Behauptung, daß gute Werke zur Seligkeit – schädlich seien. »Wie wird sich die Nachwelt«, meinte Melanchthon sehr mit Recht, »wundern, daß es ein so rasendes Jahrhundert gegeben hat!« Und in der Abendmahlslehre hielten die Anhänger des leidenschaftlichen Istrianers an der Anschauung fest, daß Christus körperlich gegenwärtig sei und sein Leib auch wirklich »mit, in und unter« dem Brote empfangen werde, während Zwingli und Calvin dem Abendmahl nur eine symbolische Bedeutung beilegten.
Alle Versuche, in den Streit vermittelnd einzugreifen, reizten die unduldsamen Eiferer nur zu schärferer Abwehr, und so kam es denn auch in Worms zu dem großen Krach, der den Anhängern der alten Kirche – aus ihrer Mitte war auch Canisius erschienen – Wasser auf ihre Mühle bedeutete. Ihnen war es natürlich mit dem ganzen Religionsgespräch, wie der bayerische Rat Wiguleus Hundt seinem Herrn verriet, »gar nit ernst«, sondern lediglich darum zu tun, »daß es nur ein Spiegelfechten ad protrahendum negotium et nihil agendum« sei. So waren sie also keineswegs darüber böse, daß die Wormser Tagung durch ihre Gegner selbst »zerstoßen« wurde, während den gemäßigten Bekennern der neuen Lehre das »wohlangestellte und hofflich angefangene, aber jämmerlich gehinderte und schimpflich geendete Colloquium« schwer auf der Seele brannte. »Ihr Krieg ist unser Friede«, so frohlockte man in Rom.
Maximilian war über den Ausgang des Wormser Gespräches recht wenig erbaut; er hätte es, wie er seinem Freunde Christoph klagte, gerne gesehen, daß dort »was Fruchtbares« wäre ausgerichtet worden. Ohnedies befand er sich damals in einer überaus gedrückten Seelenstimmung. Am 26. September 1557 war auf einer Gesandtschaftsreise in Brüssel »sein treuester und geheimster« Rat Nidbruck gestorben – »einige sagen,« bemerkt Blahoslaw, »er sei vergiftet worden, und dies ist nicht unwahrscheinlich«. Der Thronfolger vergoß, als er die traurige Kunde erhielt, Tränen; er wollte es nicht begreifen, »daß Gott so ausgezeichnete und fromme Männer von dieser Welt berufe, die doch seiner Kirche so nützlich werden könnten«.
Schon während König Ferdinand in Regensburg weilte, war in Wien gegen Maximilian wieder ein Feldzug eröffnet worden. Der Kronprinz klagt dem Herzog Christoph über die »römischen Pfaffen«, die seinem Vater »so hart in den Ohren« lägen. Canisius hatte in einem »Brandbrief«, worin er sogar von Umsturzplänen des Thronfolgers sprach und für dessen Zukunft das Schlimmste voraussagte, die Verstimmung Ferdinands verschärft. Der König wollte nun, als er im Mai nach Wien zurückgekehrt war, Pfauser, der noch immer, abwechselnd mit Bischof Urban, seinen Dienst als Prediger versah, überhaupt nicht mehr predigen lassen. Maximilian ließ, als er von der gegen ihn erfolgten Denunziation Kenntnis erhalten hatte, Canisius rufen. Es kam zu einer erregten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Kronprinz dem Pater drohend erklärte: »Wisse, daß, so Gott will, die Zeit kommen wird, wo ich dir alles in Erinnerung bringen werde; nun lasse ich dich meines Vaters wegen in Ruhe.«
Nicht lange darauf kam es auch zu einem Zusammenstoß mit dem Vater. Am 17. Juni wurde das Fronleichnamsfest gefeiert, an welchem sich, wie gewöhnlich, der Hof beteiligte. Maximilian aber weigerte sich, mitzugehen. Man hatte eigens den Beginn des Umganges bis zu Ende der Predigt Pfausers hinausgeschoben, weil der Thronfolger erklärt hatte, er müsse sie hören. Maximilian aber befahl Pfauser, drei volle Stunden zu predigen, so daß es mittlerweile Essenszeit wurde, worauf er sich »hurtig« aus der Predigt zum Speisen begab. Der junge König reiste alsdann nach Preßburg zu seinem Vater. Hier fand am Johannistage die Oktave des Fronleichnamsfestes statt. Maximilian erklärte dem Vater, er könne nicht gehen, denn er sei krank. Ferdinand erwiderte: So reite. Doch Maximilian entschuldigte sich wiederum mit seiner Indisposition. Der Vater glaubt nicht recht daran, und es kommt zu einem längeren Wortwechsel. Ferdinand: So gehe nur wenigstens drei bis vier Schritte mit. Maximilian: Ich kann durchaus nicht. Ferdinand: Warum könntest Du nicht? Maximilian: Weil ich nicht will. Ferdinand: Warum willst du nicht? Maximilian: Deshalb, weil ich nicht gegen mein Gewissen handeln kann, denn aus diesen Zeremonien kann ich keine Verehrung Gottes herausfinden. Da begann der Vater »wehmütig und zugleich wie wütend« darüber zu klagen, daß sich der Prinz nicht so benehme, wie es einem Sohne gebühre, und er ihm nur Trauer und Schande verursache. Das Ende der Szene war, daß auch Ferdinand nicht mitging.
Merkwürdig ist die Haltung Maximilians den böhmischen Brüdern gegenüber, die sich durch ihren Priester Blahoslaw an ihn gewendet hatten, um bei Ferdinand die Befreiung ihres gefangengehaltenen Seniors Augusta zu erwirken. Der Thronfolger verwendete sich nur mit halbem Herzen für die Bittsteller, deren Richtung ihm nicht behagte, weil er sie für Sektierer hielt, und ihm war es gerade damals um die Einigung der Protestanten zu tun.
Er steht jetzt im vertrautesten Verkehr mit jenem evangelischen Fürsten, der – eine rühmliche Ausnahme – mit Schmerz den Zwiespalt der Theologen verfolgte, mit Herzog Christoph von Württemberg. Ihm hatte er am 20. Dezember, nach dem Scheitern des Wormser Religionsgespräches, in einem Schreiben, wo er sich als »propter veritatem suspectus« bezeichnet, seine schmerzlichen Gefühle mitgeteilt. Ihm läßt er am 23. Februar 1558 durch seinen protestantisch gesinnten Rat Nikolaus von Warnsdorf zu Haußdorf, der nach Nidbrucks Tod sein vertrautester Rat ist, um die Sendung von Schriften Luthers, Melanchthons oder »anderer Theologen der wahren Religion« bitten und bedankt sich dann, als er solche erhalten hatte, für dies »gar angenehme Geschenk«. Und ihm drückt er auf die Nachricht von dem glücklichen Abschluß des Frankfurter Religionsgespräches, wo man sich über die wichtigsten Streitpunkte geeinigt und erklärt hatte, alle Differenzen »in Vergeß zu stellen«, seine lebhafte Freude aus. »Dann einmal kein besser Weg vorhanden,« schreibt er am 22. Juni, »denn allein die Vergleichung der Religion. Will auch derhalben Euer Lieb dienstlich ermahnt haben, damit Sie wollen darauf bedacht sein und keinen Fleiß sparen; dann durch diesen Weg der Vergleichung sticht man dem Papst den Hals gar ab, darum nicht wenig daran gelegen.«
Der Herzog antwortet mit dem Gelöbnis, er werde sich die Verbreitung des Wortes Gottes, die Förderung der Einigkeit seiner Kirche und die Niederwerfung der Tyrannei des Antichristen, wo er nur immer könne, »mit allem Fleiß und Treuen« angelegen sein lassen. Und Maximilian bittet ihn am 29. Juli neuerdings »auf das höchste«, darauf zu sehen, »damit so vielerlei Opinionen nicht geduldet werden, sondern daß man sich samtlich einer vergleiche und darob bleibe und halte, dann sonst gibt man dem Feind das Schwert in die Hand; wann man sich aber vergliche, so möchte man alsdann desto baß sehen, wie man den Sachen täte. Und bitte Euer Lieb, Sie wolle solches von mir nicht anders als treuer Meinung verstehen, dann mir einmal bei solcher Spaltung die Weile lang ist, und möchte mit der Zeit nichts Gutes daraus werden, sondern unsere Feinde gestärkt und wir geschwächt, wiewohl ich zu Gott meinem Herrn verhoffe, er werde es dazu nicht kommen lassen, sondern uns alle bei seinem Wort erhalten; aber wir müssen das Unserige auch dazu tun.«

Maximilian II. als Jüngling
Nur auf einen starken, innerlich gefestigten Protestantismus konnte der Thronfolger sich stützen und seine Zukunft aufbauen. Gerade jetzt benötigt er einen kräftigen Rückhalt; denn seine Gegner setzten alle Hebel in Bewegung, um Maximilian in den Schoß der alten alleinseligmachenden Kirche zurückzuführen.
König Ferdinand war am 14. März 1558 als »erwählter römischer König« in der Bartholomäuskirche zu Frankfurt in feierlicher Weise zum Kaiser proklamiert worden. Diese Erhebung führte alsbald zu einer heftigen Auseinandersetzung mit dem geistlichen Oberhaupt der Christenheit. Paul IV., ein Neapolitaner aus dem Hause Caraffa, der damals auf dem Heiligen Stuhle saß, hatte, unduldsam und fanatisch wie er war, Ferdinand den Abschluß des Religionsfriedens schwer verübelt. »Wenn Ferdinand«, so äußerte er sich damals, »schon Kaiser wäre, so müßte er abgesetzt werden.« Nun, da er wirklich zum Oberhaupt des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation aufgestiegen war, verweigerte der Papst seine Anerkennung. Die Kaiserkrone hätte Karl, so verlangte er, in seine Hände legen müssen.
In seinen heftigen Anklagen gegen den Wiener Hof, die der kaiserliche Gesandte Guzman zu hören bekam, spielte die »ketzerische« Erziehung Maximilians eine ganz besondere Rolle. Er verglich diesen wenig schmeichelhaft mit den Söhnen Elis, nicht ohne an das Strafgericht Gottes über das Haus des schwachen Hohenpriesters zu erinnern. Immer kam er in seinen Vorwürfen auf die »üble Häresie« des Thronfolgers zu sprechen, der ganz und gar Lutheraner sei, eine lutherische Bibliothek besitze, einen lutherischen Prediger sich halte, mit den lutherischen Fürsten gemeinsame Sache mache, und den Ferdinand enterben oder an die römische Kurie schicken müsse, »wo er vor Seiner Heiligkeit unter Tränen Buße tun möge nach der Vorschrift des Papstes«. Der päpstliche Nuntius verließ Wien, ohne sich vom jungen König zu verabschieden.
Maximilian frohlockte. »Aber ist Ihrer Majestät recht geschehen, Gott wolle, daß es etwas wirke«, so schrieb er seinem Freunde Christoph von Württemberg, der darauf seine Meinung kurz und bündig dahin äußerte, es sei am besten, wenn der Kaiser sich nicht weiter um den Papst kümmere und ihn »zu Rom mit seinem Geschwärm sitzen« lasse.
Allein dem Kaiser gab Guzmans Bericht doch zu denken. Er mußte sich schließlich sagen, daß kaum je ein Papst, auch wenn er nicht gegen die Habsburger, und besonders gegen den Wiener Hof, so übelwollend wie Paul IV. sei, für die Nachfolge eines Protestanten zu haben sein werde, und um deren Sicherung in seinem Hause war es ihm selbstverständlich zu tun. Maximilian mußte also – so viel war klar – vom Protestantismus sich abkehren.
Kaiser Ferdinand ließ sich zunächst durch seinen Rat Dr. Georg Siegmund Seld über die Beschwerden des Heiligen Vaters ein Gutachten erstatten. Seld, das Urbild eines »Beschwichtigungshofrates«, suchte den kaiserlichen Vater von zu weit gehenden Schritten abzuhalten. Es gehe zwar das Gerede, meinte er da, daß Maximilian seine Religion geändert habe, allein er glaube dies nicht. »Ob aber vielleicht Ihre kunigliche Würde ein Mißfallen ob den öffentlichen unwidersprechlichen Mißbräuchen, so gleichwohl des wenigern Teils in der Lehr, sondern meisten Teils in dem Leben der Geistlichen eingerissen hat, das wäre Ihrer kuniglichen Würde nicht allein nicht zu verargen, sondern Sie wird auch in selbem Fall bei vielen gutherzigen, frommen Leuten hoch und niedern Standes einen großen Beifall haben.« Und ähnlich sprachen sich auch die vier Wiener Doktoren aus, deren Meinung er eingeholt hatte. Von einer Hinneigung zur Ketzerei, sagten sie, sei bei Maximilian nichts zu bemerken, außer man wollte sich daran stoßen, daß er gerne das Wort Gottes höre, was ja doch der Weg der Wahrheit und des Lebens sei.
So harmlos freilich sah Ferdinand die religiöse Haltung seines Sohnes nicht an, und er wurde in seiner pessimistischen Auffassung von anderen bestärkt, nicht zuletzt von Spanien, wo sich die politische Lage für den neuen König Philipp II. in einer Weise günstig gestaltet hatte, daß die Stimme des verwandten Hofes schwerlich überhört werden konnte.
Der Nachfolger Karls V. war bald nach seiner Thronbesteigung in einen heftigen Kampf mit Frankreich und dem Papst Paul IV. verwickelt worden. König Heinrich II. hatte im Vertrauen auf die spanienfeindliche Stimmung in Deutschland und am Wiener Hofe seinen Gesandten Caius de Virail beauftragt, den Thronfolger aufzusuchen, um den Zuzug deutscher Truppen nach Italien zur Unterstützung Philipps zu verhindern. Maximilian, der, schon mit Rücksicht auf die Türken, die Verbündeten König Heinrichs, seit Jahren mit einer Verbindung Frankreichs geliebäugelt hatte, lehnte, dem Druck seines Vaters nachgebend, den Empfang Virails ab. Aber besonders erfreut war er doch nicht, als die Spanier unter ihrem Feldherrn Emanuel Philibert von Savoyen am 10. August 1557 bei St. Quentin einen großen Sieg erfochten hatten. Mit süßsaurer Miene machte er dem Landgrafen Philipp von Hessen, der ihm seine Sorge vor den spanischen Anschlägen anvertraut hatte, Mitteilung von der »glücklichen und hoffentlich hochersprießlichen Expedition und Ausrichtung« seines Vetters. Wie hoch König Philipp II. den Sieg der spanischen Waffen einschätzte, dies zeigt sein Beschluß, zum Dank für den Heiligen des Schlachttages St. Laurentius mit ungeheuren Kosten das Riesenkloster Eskurial, zugleich Lustschloß und Totengruft, zu erbauen. Und ehe noch ein Jahr um war, erfocht Graf Egmont am 13. Juli 1558 über die Franzosen den glänzenden Sieg bei Gravelingen.
Philipps Triumpf bekam sein deutscher Vetter alsbald zu fühlen. Der König hatte von dem Magister Gallo, einem namhaften Kanzelredner aus Salamanca, der in seinem Auftrag im März 1556 nach Deutschland gegangen war, über Maximilians religiöse Gesinnung ein höchst ungünstiges Bild erhalten. Er erbat sich daher von seinem Vater, der aus der Stille des Klosters San Yuste mit unverändertem Interesse die Welthändel verfolgte, Weisungen darüber, was die Familie gegen den deutschen Vetter tun solle. Man scheint sogar schon eine Scheidung von seiner Gemahlin in Erwägung gezogen zu haben. Eben damals, im Spätsommer 1558, war man in Madrid einer Ketzerverschwörung auf die Spur gekommen, die sich bis in die höchsten Kreise des Hofes und der Gesellschaft erstreckte. Philipp, über diese Vorgänge aufs höchste erschreckt, verließ eiligst die Niederlande und kehrte nach Spanien zurück. Für die Stimmung, wie sie in Rom gegen Maximilian herrschte, ist es jedenfalls bezeichnend, daß man gegen ihn auch den Vorwurf erhob, er habe bei der Ketzerbewegung im Lande der katholischen Könige seine Hand im Spiele gehabt.
So galt es also zu handeln. Ehe aber der Gesandte Philipps, der Erzbischof Carranza von Toledo, nach San Yuste kam, um sich vom Kaiser die endgültige Beschlußfassung zu holen, lag dieser bereits im Sterben. Man kann sich keinen tragischeren Ausklang eines Herrscherlebens denken: mit schweren Sorgen über die religiöse Gesinnung in seiner eigenen Familie schied der unglückliche Monarch am 21. September aus seinem sturmbewegten, ereignisreichen Leben.
Wenige Monate vorher, am 18. Februar, war Karls Schwester Eleonore, die Witwe des Franzosenkönigs Franz I., gestorben. Maximilian blieb zum großen Schmerz des Vaters den Leichenfeierlichkeiten fern, weil er alle »papistischen« Zeremonien scheute. Am 17. Oktober folgte den beiden Geschwistern Maria von Ungarn. Der von seiner Gemahlin für die Tante angeordneten Seelenmesse entzog sich der Kronprinz durch seine Abreise nach Preßburg.
Kaiser Ferdinand, durch das Hinscheiden seiner Geschwister ohnehin schon traurig gestimmt, erlebte auf dem am 3. März 1559 eröffneten Reichstag in Augsburg den Schmerz, daß ihm von den protestantischen Reichsständen nahegelegt wurde, zugunsten seines Sohnes auf die Kaiserwürde zu verzichten. Sie waren über die Ablehnung ihrer religiösen Wünsche ebenso verstimmt wie der Kaiser, der sie vergeblich für seine Idee, die Frage der christlichen Religionsvergleichung auf einem allgemeinen Konzil zu bereinigen, bearbeitet hatte. Unwillig verließen Stände und Kaiser den Reichstag, der erst Mitte August geschlossen wurde. Maximilian war den Verhandlungen wieder nicht zugezogen worden; »denn man besorgte,« so schrieb er an Hans von Küstrin bitter, »daß wir sie zu noch mehreren und größeren Ketzern machen möchten«.
Nach Wien zurückgekehrt, schlägt Kaiser Ferdinand seinem Sohne gegenüber einen schärferen Ton an. Fast täglich verhandelt er mit ihm. Sebastian Pfauser hatte man inzwischen aus den sorgsam belauschten Predigten nicht weniger als achtunddreißig Ketzereien nachgewiesen. Und auch von Seiten König Philipps setzt wiederum ein scharfer Druck ein. Im Juli war der Franziskanermönch Francisco de Cordova nach Wien gekommen, um bei der Königin Maria die Stelle eines Beichtvaters zu übernehmen. Er sollte sich aber auch, so lautete sein Auftrag, ganz besonders Maximilians Seelenheil angelegen sein lassen.
Der Pater Cordova erreichte wenigstens, daß ihn der junge König anhörte und sich mit ihm besprach. Seine Bemühungen wurden von dem spanischen Gesandten Don Claudio Fernandez de Quinones, Grafen von Luna, aufs wirksamste unterstützt. Der Diplomat setzte gleich mit dem stärksten Druck ein: er drang in die Königin Maria, sich von ihrem Gemahl scheiden zu lassen; aber da sollte er sich doch verrechnen. Die Maximilian herzlich ergebene Königin, die soeben zum neunten Male Mutter geworden war, erklärte rasch gefaßt, »daß sie keine Ursache des Scheidens hätte, weil ihr Herr ihr in der Religion nicht Maß vorgeschrieben«.
Indes, es gab noch ein anderes Mittel, um auf den Abtrünnigen zu wirken. Während der Kaiser bereits das Schreckgespenst seiner Enterbung zugunsten des zweiten Bruders Ferdinand aufmarschieren läßt, droht Luna, sein königlicher Herr werde den Kronprinzen, falls er im protestantischen Glauben verharre, als offenen Feind behandeln, wogegen ihm, wenn er sich ändere, alle möglichen guten Dienste erwiesen werden sollten, und er konnte dabei auf die seinerzeit in Brüssel noch von Kaiser Karl angeregte Heirat der Erzherzogin Anna mit dem Infanten Don Carlos anspielen.
Maximilian aber blieb fest: er zeigt etwas von dem »Daniel«, von dem »tapferen Löwen«, als den ihn Pfauser hingestellt hatte. Seinen Schützling, der im November – es war zum zweiten Male – seines Amtes enthoben worden war, rief er um die Jahreswende wieder zurück und ließ ihn predigen. Trotzig erklärte der junge König, er wolle nicht länger unter der Zuchtrute des Kaisers stehen und verlange die ihm bisher vorenthaltene Regierung Böhmens oder eines anderen seiner Würde entsprechenden Landes. Er drang dann in seinen Bruder Ferdinand, seine Statthalterschaft niederzulegen, welche Zumutung der Erzherzog aber sehr energisch zurückwies. Im Namen seines Vaters erklärte er, ihn an dem Eintritt nach Böhmen gewaltsam hindern zu wollen. Verärgert reiste der Thronfolger nach Wiener Neustadt ab und kehrte erst auf Zureden des Grafen Luna nach Wien zurück, ohne daß sich aber in den Beziehungen zwischen Vater und Sohn etwas geändert hätte. Im Gegenteil, die Zwietracht war, wie der venezianische Gesandte Soranzo am 10. Januar 1560 vom Kaiserhof meldete, »ärger denn je«.
So standen die Dinge, als in Rom sich eine entscheidende Wendung vollzog, die den Kaiser bestimmte, die »Bekehrung« seines Sohnes mit erhöhtem Eifer in Angriff zu nehmen. Am 18. August 1550 war der zelotische, dem Wiener Hofe feindlich gesinnte Papst Paul IV. verschieden. In Rom kam es zu Ausbrüchen der Volkswut gegen den verhaßten kirchlichen Eiferer, und die stürmischen Kundgebungen bildeten für die Kardinäle, die zur Wahl eines neuen Papstes zusammentraten, einen deutlichen Wink. Nach einem erbitterten Kampf zwischen der französischen und der spanischen Partei ging aus dem Konklave am 26. Dezember der weit milder und versöhnlicher gestimmte Kardinal Medici hervor.
Papst Pius IV., wie er sich nannte, erklärte sich in der brennenden Frage des Konzils bereit, den Wünschen des Kaisers entgegenzukommen. Maximilian wird von seinem Vater veranlaßt, an das neue Oberhaupt der Christenheit ein Begrüßungsschreiben zu richten, und Pius antwortet sehr freundlich, indem er dem Wunsche – er klingt fast wie Ironie – Ausdruck gab, der König werde ihn in seinem Bestreben, die wankende Kirche wieder zu befestigen, tatkräftig unterstützen. Der Kaiser ließ durch einen besonderen Gesandten, den Grafen Scipio d'Arco, Pius versichern, daß sein Sohn gut katholisch erzogen und verheiratet sei und nur in seinem Verhältnis zu Pfauser, der sich erst allmählich als Ketzer entpuppt, Anstoß erregt habe. Doch sei dieser Prediger bereits unschädlich gemacht und werde demnächst entlassen werden.
In der Tat hatte Maximilian, durch die Drohung seines Vaters, er werde Pfauser »in den tiefsten Brunnen werfen lassen«, erschreckt, in dessen Entfernung eingewilligt – schweren Herzens. Was in der Seele des Thronfolgers vorging, das spiegelt sich in dem vertraulichen Schreiben, das er am 2. Februar 1560 an den Markgrafen Hans von Küstrin richtete. »Ich khan Euer Lieb … nit verhalten,« so heißt es da, »das es nit an (= ohne) ist, sonder das ich von der kays. Mt. zum allerhogsten verfolgt wierde. Glaichwol erzagen sich I. Mt. vor den Laiten gantz gnadigist gegen mier. Und ist lader dahin khumen, das mier I. Mt. mainen Predicanten mit Gewalt nemen, dann sie mit großen Zorn zu mier gesagt, ich sol gedenkhen und solle ine weckthuen: wo awer nit, so welle I. Mt. nach ime graifen und gegen ime verfahren, wie ain sollicher khetzerischer buew verdient haw; und wiewol ich alle Wege und Mitl versuecht hawe, ow ich den gueten Man bai mier hette erhalten khunen, so hat es awer gar kain schtat bei I. Mt. hawen wollen, also wo ich anderst nit will, das er main Predicant in Gefare khum, so mues ich ine wek thuen, dann I. Mt. gar obduratus ist et contra oportet non est remedium, lader, also das ich warlich in großer Betriewnus und Gefarlikat maines Lewens bin; doch wan ich gedenk, das es umb Christi willen geschicht, so erkhikt sich main Hertz, dan ich wol was, das es muß verfolgt sain auf dieser Welt, und das wier, die so Christum bekhenen, das Kraitz tragen miessen. Awer sie machen, waß sie wollen, so werden sie mier Christum und sain Wort weder mit Schwert noch Faier aus meinem Hertzen nit raisen. Was auch gewislich, das mich Gott der Herr derbei erhalten wierd, ow ich schon darum verfolgt wier; lait wenig davon, hawen sie es Gott den Herrn schwer gethan, es wiert uns auch geschehen, dan der Knecht ist nit besser als der Maister.«
»Ich schte ietzt«, so fährt der König bedeutungsvoll fort, »in Handlung umb ainen andern Predicanten: wiert man mier den selwen auch nit lassen wellen, so wierde ich verursacht werden, auf andere Weg zu gedenkhen; dan man den Khrug so oft zum Brunnen tragen thuet, bis das er zu der Leste brechen mues. Doch bitt ich taglich Gott den Herrn umb Gedult und Beschtandikait, dan ich wol was, das sie mier höflich nach mainem Lewen trachten, dan sie vermanen, wan nuer ich wekh were, so war alle ier Sach richtig. Ich bitt, Euer Lieb welle mier main unnuetz Geschwetz nit verargen, dan ich main Owligen niemant was zu klagen als Gott, Euer Lieb und anderen gueten Kristen. Ich was, wan Euer Lieb sehen solt, wie man mit mier umbgehet, sie wurden ain treulichs Mitlaiden mit mier hawen, awer Gott sai gelobt, das es nuer umb sainent willen geschicht. Es ist auch dahin geraten, das sie, so sie almal wol auf mainer Saiten erzagt hawen, die geschtellen sich ietzt gegen mier als khant sie mich nit propter metum fariseorum, Gott verzaih inen sollichs. Und insunderhat des Khunigs von Ispania Potschaft ist der, der das Redle am allermaisten bai der kays. Mt. traiwen thuet. Euer Lieb khunen nit glauben, wie sie mit mier umbgehen; ja sie hawen sich auch unterschtanden mainen lieben Gemahl wider mich aufzuhetzen, awer sie ist so erber und frum, das sie sich nichts hatt lassen bewegen, sondern sich erzagt, wie ier geburt hat. Das melde ich alles darumen, damit Euer Lieb sehen sold, in quantis adversitatibus ietzunden ich schtekhen; ich trau awer Gott, Euer Lieb und andern mainen gueten Freunden, das sie mich im Fal der Not nit verlassen werden.«
Der Vater versäumte nicht, dem widerhaarigen Thronfolger auch das Lockmittel der spanischen Erbschaft vor Augen zu halten. »Maximiliane,« so sprach er zu ihm, »Du kannst ein großer, gewaltiger Herr werden, wenn Du von dieser Lehre abständest: ganz Hispanien entginge Dir nicht; denn da dasselbe zuvor auf vielen Personen gestanden und doch auf Österreich gekommen; jetzt stünde es aber nur auf zwei Personen, zudem so wäre des Philippi Sohn ein junger schwacher Knabe. So er aber von dieser Religion nicht ablasse, so dürfe er nicht gedenken, daß es ihm begegnen werde, daß Hispanien an ihn komme.« Und Maximilian antwortete darauf: »Gnädigster Kaiser, es ist nicht um das Zeitliche allhier zu tun, sondern vielmehr das Ewige zu bedenken und nicht in die Schanze zu schlagen um zeitlicher Ehre, Pracht und Herrlichkeit willen.« Den Leib könne der Kaiser ihm nehmen, »aber nicht die Seele; er könne wider Gewissen nicht handeln, da wäre er mit seinem Leib und wäre an ihm wenig verloren«. Das Evangelium lasse sich allen Verfolgungen zum Trotz nicht aufhalten – so sei es in Frankreich, in den Niederlanden und selbst in Spanien. Und als die Rede auf die österreichischen Lande kam, die »alle wohl dieser unserer Lehre gewogen« seien, da sagte der Kaiser, doch mit einem Lächeln, als scherzte er: »Maximiliane, du machst mir alle meine Untertanen zu Ketzern.«
Der Kaiser war sichtlich bemüht, seinem Sohne goldene Brücken zu bauen. Er kaufte ihm die Herrschaft Pardubitz in Böhmen mit einem Einkommen von fünfundzwanzigtausend Gulden. Und nicht zuletzt wandte er sich am 6. März in einem Schreiben an den Heiligen Vater, worin er ihn eindringlich bat, Maximilian bis zum kommenden Palmsonntag die Bewilligung, unter beiderlei Gestalt zu kommunizieren, erteilen zu wollen, »damit nicht dieser unser Sohn an der Hilfe und dem Trost Eurer Heiligkeit und des Heiligen Stuhles verzweifle und sich ganz den unserer katholischen und orthodoxen Religion widerstreitenden Dogmen und Sekten anschließe«. Ferdinand konnte sich darauf berufen, daß auch den Hussiten eine solche Konzession gemacht wurde.
Indes, zu einem derart weitgehenden Zugeständnis konnte sich der Papst doch nicht entschließen. Er wollte zunächst erst den Erfolg der Mission abwarten, mit welcher der neue, für den Kaiserhof bestimmte Nuntius betraut worden war.
Rasch war unter dem Pontifikate Pius' IV. die Aussöhnung mit dem Kaiserhofe hergestellt. Graf Scipio d'Arco, den Ferdinand nach Rom geschickt hatte, wurde vom neuen Papst freundlich aufgenommen. Er leistete dem Heiligen Vater nicht nur die »observantia et reverentia«, sondern auch – und damit überschritt der Gesandte die ihm erteilte Vollmacht – die »oboedientia«. Nun konnte Pius IV. die von seinem unduldsamen Vorgänger abgebrochenen diplomatischen Beziehungen wiederum aufnehmen, und so reiste denn der zum Nuntius ausersehene Bischof Stanislaus Hosius von Ermland mit wichtigen Aufträgen an den Kaiserhof.
Der Bischof traf am 21. April 1560 mit einiger Verspätung in Wien ein, vom Kaiser schon mit größter Ungeduld erwartet. Kurz vorher war Pfauser zum dritten Male entlassen worden – diesmal endgültig. Der König schrieb am 12. März seinem Prediger, der bei dem protestantisch gesinnten Abt von Lilienfeld Aufnahme gefunden, zum Trost: Er möge bedenken, »daß wir, so wir Christum bekennen, müssen verfolgt sein und das Kreuz leiden; kein Mensch wird ihn selbst verführen.« Seine Hoffnung, an Stelle Pfausers einen anderen evangelischen Prediger zu erhalten, erfüllte sich nicht. Der Kaiser stellte ihn kurz vor die bittere Wahl: »Unterwerfung oder Enterbung.«
In dieser Gewissensnot, entschlossen, dem väterlichen Diktat sich nicht zu beugen, sondern Widerstand zu leisten, wollte er sich Klarheit verschaffen, ob er – mit diesem Gedanken mag er ja öfter schon gespielt haben – auf den Beistand seiner evangelischen Freunde zählen könne. Am 2. April sandte er seinen Rat Warnsdorf an die Kurfürsten von Sachsen, Brandenburg und Pfalz sowie an einige andere protestantische Fürsten, wie den Herzog Christoph von Württemberg, den Landgrafen Philipp von Hessen und den Markgrafen Hans von Küstrin. Er hatte ihnen zunächst »vertraulich« mitzuteilen, wie er durch seines Vaters Drängen »in hohe Beschweren versetzt sei, von wegen Abschaffung des Hofprädikanten und der Lehre, so in der Augsburgischen Konfession begriffen, welche Maximilian für die wahre, christliche Religion erkenne, auch in solcher Bekenntnis vermittelst göttlicher Gnade sein End zu schließen, ja Kreuz und Verfolgung darüber zu leiden endlich bedacht sei«. Alsdann sollte er um Rat darüber bitten, wie er sich zu verhalten habe, »wenn er zur bapstischen Messe und anderen dergleichen Mißbreuchen, darob er viele Jahre anhero (ungeacht, daß er der Zeit nachhengen müssen) Abscheuen und Mißfallen getragen, gezwungen würde«. Und endlich sollte er fragen, »was für Hilf er sich von den betreffenden Fürsten zu versehen hätte, so er auf bapstisch oder ander Ursach persecutirt würde«.
Bevor Niclas von Warnsdorf auf seine Werbung Antwort erhielt, war Bischof Hosius in Wien eingetroffen. Als er zwei Tage nach seiner Ankunft, am 23. April, die erste Audienz beim Kaiser hatte, kam alsbald das Gespräch auf den Thronfolger. Unter Tränen schilderte ihm Ferdinand das Leid, das ihm sein Sohn bereite, der auf alle seine Bemühungen, ihn auf den rechten Weg zu leiten, stets die Antwort bereit habe, man müsse um das Heil der Seele, nicht um irdische Reiche besorgt sein. Nun fragte der Kaiser, ob der Bischof die Ermächtigung, das Abendmahl sub utraque zu nehmen, mitgebracht habe. Als Hosius diese Frage verneinte, erklärte der Kaiser betroffen: »Das darf ich meinem Sohne nicht sagen, sonst begeht er eine Torheit.«
Am nächsten Tag erschien Hosius wieder beim Kaiser. Dieser erzählte ihm, Maximilian habe ihn sofort gefragt, ob vom Papst die Bewilligung des Laienkelches für ihn gekommen sei, und als er das verneinte, habe der König trotzig erklärt: »Mein Entschluß ist gefaßt, es ist genug, daß ich hier bis zur Ankunft des Nuntius gewartet habe.« Und Ferdinand ließ den Bischof nicht darüber im Zweifel, daß Maximilians »Entschluß« oder, wie sein Vater sich ausdrückte, die »Torheit« nichts anderes sei, als der öffentliche Übertritt zur Augsburger Konfession. Doch ist Hosius zum Unterschied vom Kaiser, der damit rechnete, daß sein Sohn die Torheit wirklich begehen werde, voller Zuversicht. Es handle sich nur, meinte er trostvoll, um die richtige Belehrung des irregeleiteten Prinzen, und die wolle er ihm eben geben.
Am 27. April hatte Hosius endlich Gelegenheit, längere Zeit hindurch mit dem König selber zu sprechen. Dieser behandelte ihn, wie ihm sofort angenehm auffiel, »mit vollendeter Höflichkeit«. Mit der größten Ruhe ließ Maximilian die anzügliche Bemerkung des Nuntius, er habe vom Papst, der zum Seelenarzt der ganzen Christenheit von Gott bestellt sei, den Auftrag erhalten, des Königs »Krankheit« zu heilen, über sich ergehen. Allein fürs erste bekundete der Thronfolger nicht das geringste Verlangen, die Seelenkur des Bischofs in Anspruch zu nehmen. Er reiste zur Herstellung seiner körperlichen Gesundheit in ein nahegelegenes Bad, und als sich Hosius erbot, ihn dort zu besuchen, um weitere Zwiesprache mit ihm zu pflegen, winkte er höflich, aber deutlich ab. Die Unterkunft sei dort, meinte er, sehr schlecht und infolge einer Überschwemmung die Straße kaum fahrbar. Der Bischof wollte aber trotzdem den Kranken im Bade besuchen – da erfuhr er, daß der König mit dem Gedanken sich trage, nach Böhmen zu reisen, um dem Nuntius auszuweichen; nun gab er seine Absicht auf.
Als König Maximilian vom Bade nach Wien zurückgekehrt war, wollte der Nuntius seine Bekehrungsarbeit aufnehmen, fand aber kein williges Ohr. Viermal in einem Zeitraum von vier Tagen suchte er bei ihm um Audienz an, und erhielt jedesmal die ausweichende Antwort, der König werde ihn bei passender Gelegenheit rufen lassen. Da Hosius überdies vom Kaiser gewarnt wurde, allzu ungestüm vorzugehen, stellte er schweren Herzens seine Versuche ein. Dagegen glückte es ihm, den verhaßten Pfauser endgültig aus dem Lande zu treiben. Er hatte herausbekommen, daß der angeblich erkrankte Prediger in Lilienfeld »gesund und wohlauf herumspaziere«. Nach einer heftigen Szene zwischen Vater und Sohn mußte ihn Maximilian, der wohl noch immer gehofft haben mag, seinen Liebling halten zu können, Ende Juni ziehen lassen. Mit warmen Empfehlungsschreiben des Königs versehen, sollte Pfauser in Lauingen an der Donau eine Stelle als Pastor und Superintendent finden.
Maximilian war indes keineswegs zugänglicher geworden. Wohl gestattete er, unter dem Druck seines Vaters, dem Nuntius eine Unterredung, aber diese Aussprache, die am 8. Juni stattfand, führte nicht zum gewünschten Ergebnis. Bischof Hosius hatte den König gefragt, warum er denn eigentlich auf Gewährung des Kelches bestehe. Maximilian berief sich auf sein Gewissen, und als ihm der römische Abgesandte darauf erwiderte, daß das Heil der Seele nicht im Kelche, sondern in der Gemeinschaft mit der Kirche und dem Papst beruhe, machte das auf den König nicht den geringsten Eindruck. Dieser blieb dabei, daß der Kelch unbedingt bewilligt werden müsse, wenn Österreich zur Ruhe kommen solle; denn zwei Drittel der Bevölkerung verlangten nach ihm. Des Bischofs Mission war »vollständig gescheitert«.
Maximilian nahm an dem Fronleichnamsfest, das wenige Tage darauf, am 13. Juni, in Gegenwart seines bayerischen Schwagers Albrecht abgehalten wurde, nicht teil. Er hielt sich auch von den Predigten des neuen Hofpredigers Matthias Cithard fern, obwohl ihn Kaiser Ferdinand zu deren Besuch aufgefordert hatte. Aber er ließ sich am 11. August herbei, den Bischof Hosius, der um Audienz angesucht hatte, zu empfangen. Der Nuntius war mittlerweile von den verschiedensten Seiten gemahnt worden, mit Maximilian sehr behutsam und sanft umzugehen.
Zuerst wollte der König, als Hosius von den Reformen, die der Kaiser damals in Rom angeregt hatte, von Laienkelch und Priesterehe, zu reden anfing und sie bekämpfte, das Gespräch auf ein anderes Feld lenken, auf die Bewegungen der türkischen Flotte, aber dann kam man doch auf die Priesterehe zurück, um schließlich über die Glaubensstreitigkeiten unter den Protestanten zu sprechen. Der König fand die Verschiedenheit der Glaubensbekenntnisse und die Streitsucht der Prediger sehr bedauerlich. Und schließlich, als sich der Bischof verabschieden wollte, hielt ihn Maximilian noch zurück. Hosius war entzückt und ebenso der Kaiser, als ihm der Bischof über die große Veränderung in des Königs Haltung berichtet hatte. Beide mögen diese günstige Wandlung ihrer geänderten Taktik zugeschrieben haben, allein der Grund war ein anderer.
Um die Wende des Monats Juli war Warnsdorf endlich von seiner Reise zu den protestantischen Fürsten zurückgekehrt. Die Antworten, die er mitbrachte, mußten auf den König geradezu vernichtend wirken, seine Hoffnungen von Grund aus zerstören. Alle strotzten von leeren Versicherungen der freundschaftlichen Teilnahme, von billigen Ratschlägen – aber das große befreiende Wort, das der Thronfolger diese ganzen vier Monate des Harrens erwartet hatte, daß man ihn im Kampfe gegen seinen Vater unterstützen werde, fand keiner. Es waren »Ermahnungen statt Zusagen, herzliche Trostworte statt bestimmter Versprechen, Gemeinplätze statt tatkräftigen Zuspruchs«. Der Kurfürst August, auf dessen Hilfe der König besonders gehofft haben mag, erklärte sich zu Fürbitten bei Ferdinand bereit, riet aber ausdrücklich ab, »gegen den Vater etwas Tätliches vorzunehmen«. Nur der Pfälzer Friedrich der Fromme, also gerade der Fürst, mit dem Maximilian am wenigsten gut stand, erklärte sich bereit, ihm Aufnahme und Schutz zu gewähren, wies aber sofort darauf hin, daß dann natürlich an eine Nachfolge im Reich nicht zu denken sei. »Ein großer Moment fand«, so wurde mit Recht gesagt, »ein kleines Geschlecht vor.«
Diese jämmerliche Haltung der protestantischen Fürsten hat in dem Kaisersohne eine tiefgehende Wirkung hervorgebracht. Nicht, daß er sich gewandelt hätte – von einer »Bekehrung« kann in der Tat keine Rede sein –, aber er hatte zu seinem tiefen Schmerz erkannt, daß die protestantischen Fürsten, so wacker bibelfest sie auch gewesen sein mögen, lediglich von egoistischen politischen Rücksichten sich leiten ließen. Von nun an schied auch Maximilian sorgfältig Religion und Politik. »Er hatte für seine eigene Person sich die Glaubensfreiheit erstritten, aber darüber hinauszugehen, sich offen zur Augsburger Konfession zu bekennen, den Kaiser, den Papst, Spanien, die katholischen Kreise in Deutschland sich zu unerbittlichen Feinden zu machen, erschien ihm nun als die größte Torheit … Damit war bei Maximilian der Wendepunkt eingetreten.«
Der König wußte nach außen hin den Eindruck hervorzurufen, daß eine »Bekehrung« eingetreten sei, und Bischof Hosius schwelgte in den nächsten Monaten in dem Hochgefühl, daß seine geschickte Diplomatie diesen erfreulichen Umschwung herbeigeführt habe – freilich mehr nach außen hin. Innerlich wußte er wohl am besten, daß zu einer wirklichen »Heilung« des Kranken, zu einer »Bekehrung« noch viel, sehr viel fehlte. Allein die Hauptsache war, daß sich der König jetzt sichtlich bemühte, mit dem Vertreter der römischen Kurie in freundschaftlichem Tone zu verkehren. Hier und da entschlüpfte ihm freilich die eine oder andere Äußerung, die den Bischof wie ein kalter Wasserstrahl berühren mußte. So wenn er in einer Aussprache, die er am 4. November mit Hosius hatte, sich vernehmen ließ, er sei öfter gefragt worden, warum er sich nicht offen erkläre, ob er Papist oder Lutheraner sei, und darauf antwortete, er sei weder Papist noch evangelisch, sondern ein Christ.
Erscheint uns diese Äußerung Maximilians: »Nicht päpstlich, nicht evangelisch, ein Christ«, für seine innerste Überzeugung gewiß überaus bezeichnend, so ist dies nicht minder bei einer anderen Bemerkung der Fall, die er am 27. November in einem Gespräch mit Cithard machte. Der neue Hofprediger hatte sich zur Aufforderung aufgeschwungen, Maximilian möge sich offen als Katholik bekennen und diejenigen, die dem Volk über ihn eine falsche Meinung beibrächten, Lügen strafen, worauf der König erwiderte: »In der ganzen Welt wird verbreitet, daß ich ein Freund der Sekten bin, aber mir geschieht großes Unrecht. Denn ich habe keinen anderen Glauben als den katholischen, wenn ich auch manchmal gegen Mißbräuche rede.« Es ist sicher, daß Maximilian hierunter etwas ganz anderes verstand als der katholische Priester. Wenn Cithard mit den Sekten selbstverständlich auch die Augsburger Konfession meinte, so konnte der König sich mit so vielen Anhängern dieses Bekenntnisses, die sich als zur »wahren katholischen Kirche« gehörig rechneten, als einen Katholiken – zum Unterschied von der römisch-katholischen Kirche – bezeichnen.
In seinem Herzen blieb Maximilian der alte. Auch in den Beziehungen zu den protestantischen Fürsten änderte sich nach außen hin nichts – sie rechneten ihn nach wie vor zu den ihren. Mit lebhaftestem Interesse sieht er der Tagung von Naumburg entgegen, die für den 20. Januar 1561 ausgeschrieben worden war, um die Spaltungen innerhalb des Protestantismus zu beseitigen. Seinem Freunde Christoph von Württemberg schreibt er fünf Tage vorher: Er wünsche von Herzen, daß dort endlich die dogmatische Einigung zustande käme, »würde auch dadurch unsern Widersachern nicht ein kleiner Abbruch beschehen, wie Euer Lieb leichtlich abzunehmen hat; denn ihr meistes Triumphieren ist allein in dem, daß sie sagen, daß wir zwischen einander in Religion und sonst nicht einig seien, welches durch das Mittel verhütet würde, welches der liebe Gott gnädiglich verleihen wolle«.
Aus dem Worte »Wir« zu schließen, zählte sich also Maximilian noch immer zu den Bekennern des Evangeliums, und der Ausdruck »Widersacher« zeigt wohl mehr als deutlich, daß er sich innerlich noch keineswegs mit der päpstlichen Partei abgefunden hatte. Die zwei Legaten, die Papst Pius IV. nach Deutschland gesandt hatte, um die protestantischen Fürsten zur Beschickung des Trienter Konzils einzuladen, Commendone und Delfino, nennt er »diese Gesellen«, »geschwinde Vögel«, vor welchen sich wohl vorzusehen, welchen »in der Wahrheit nicht zu trauen ist«. Er spricht offen seine Meinung dahin aus, daß er die Aussichten für das Konzil – »conciliabulum«, einen Handelsplatz, spottete er – nicht sonderlich hoch einschätze. »So halte ich wenig davon,« schreibt er am 8. März dem Herzog Christoph, »daß was daraus werden sollte.«
Und in der Tat hatten die beiden Nuntien in Naumburg keinen Erfolg. Die an die protestantischen Fürsten gerichteten Schreiben des Papstes, welche die gewinnende Aufschrift trugen: »Dem geliebten Sohne«, wurden den Legaten uneröffnet mit der Begründung zurückgestellt, daß der Papst nicht der geistliche Vater der Protestanten sei, und der Besuch der Kirchenversammlung wurde rundweg abgelehnt. Als der Bischof Hosius mit Maximilian über diese unfreundliche Aufnahme der päpstlichen Abgesandten sprach, tat dieser ganz entrüstet; er erklärte sie für eine »verabscheuungswürdige Barbarei«. Schwerer wird den König die Nachricht getroffen haben, daß der Naumburger Tagung die Verständigung nicht gelang. Diese Glaubensstreitigkeiten, welche die innere Schwäche des Protestantismus nach außen hin bekundeten, haben gewiß viel dazu beigetragen, daß der Thronfolger enttäuscht von der neuen Lehre immer mehr abrückte. Aber er ist auch niemals ein »Papist« geworden, wenngleich er in der Folge an der Messe und anderen Zeremonien teilnehmen sollte – die Erlangung einer Königskrone war ihm eben, wie später von dem französischen König Heinrich IV. gesagt wurde, »eine Messe wert«, ihr Besuch galt ihm lediglich als eine Staatsaktion, die sein Gewissen nicht im geringsten belastete.
Und auf die Krönung zum König waren die Gedanken Maximilians ebenso wie die seines Vaters in dieser ganzen Zeit der Bedrängnis gerichtet. Zuerst sollte er in Ungarn und in Böhmen, dann im Reich die Krone erhalten. Aber es tauchte sofort eine Schwierigkeit auf, die wiederum zeigt, daß der Thronfolger alles eher als »bekehrt« war. Am 15. Mai 1561 sollte er in Preßburg feierlich die Stephanskrone in Empfang nehmen. Er weigert sich jedoch ganz entschieden, bei der kirchlichen Feier, die der Krönung voranging, das Abendmahl unter einer Gestalt zu nehmen und, wie es das ungarische Zeremoniell weiter vorschrieb, bei seinem Eide die Heiligen anzurufen. Die Verhandlungen mit den ungarischen Ständen, die übrigens darauf bestanden, daß Maximilian nicht kraft des Erbrechtes gekrönt werden sollte, mußten zurückgestellt werden.
Ähnliche Schwierigkeiten bestanden auch bei der Wahl zum römischen König, die zur Enttäuschung des Thronfolgers drei Jahre vorher, als Ferdinand zum Kaiser erhoben wurde, gar nicht in Erwägung gezogen worden war. Auch hier mußte bei der Krönung das Abendmahl in der hergebrachten Weise unter einer Gestalt verabreicht werden. Und außerdem galt es, die üblichen Bedenken der Kurfürsten zu überwinden. Die Sache war ja deshalb so überaus schwierig, weil bei einem entschiedenen Heraustreten des Thronfolgers zugunsten des Protestantismus die geistlichen Kurfürsten verstimmt gewesen wären, umgekehrt bei einem offenen Frontwechsel Maximilians zugunsten der alten Kirche ihn wiederum die Protestanten glatt preisgegeben hätten. Gerade damals wurde laut von der Kandidatur des lutherischen Dänenkönigs gesprochen.
So entschloß sich denn Maximilian, wenigstens das eine Hindernis, das jeder Krönung im Wege stand, aus der Welt zu schaffen. In ebenso tiefem Geheimnis, mit welchem vorhin die Sendung Warnsdorfs an die protestantischen Fürsten erfolgte, sandte er jetzt den Oberststallmeister der Königin Maria, Adam Freiherr von Dietrichstein, mit einem Schreiben des Kaisers – es ist vom 14. Oktober 1561 datiert – nach Rom. Der Gesandte hatte fürs erste die Ergebenheit Maximilians gegen den apostolischen Stuhl zum Ausdruck zu bringen, aber dann auch – und nicht zuletzt – um die Gewährung des Laienkelches für seine Person zu bitten.
Papst Pius befand sich, als Dietrichstein die gewiß ungewöhnliche Werbung vorgebracht hatte, in keiner geringen Verlegenheit. Einerseits scheute er sich, den eben halbwegs gewonnenen Habsburger wieder zurückzustoßen, andererseits wollte er dem gerade in Trient tagenden Konzile nicht vorgreifen. Schließlich fand er einen Ausweg, der geeignet schien, die Bitte des Kaisersohnes zu erfüllen und sein päpstliches Gewissen zu salvieren. In einem geheimen Schreiben wird der Kaiser zunächst aufgefordert, die Versuche zur Umstimmung seines Sohnes fortzusetzen. Für den Fall aber, daß sich Maximilian nicht bekehren lasse, wird Ferdinand bevollmächtigt, seinem Sohne das heilige Abendmahl unter beiderlei Gestalt zu erlauben. Doch sollte er dies so geheim wie möglich tun und vorher einem katholischen Priester die Erklärung abgeben, daß die Kommunion unter einer Gestalt ebenso vollgültig sei wie die unter beiden Gestalten.
Trotz aller Verklausulierung hatte der Heilige Vater dem Wiener Hofe ein weitgehendes Zugeständnis gemacht, und Kaiser Ferdinand konnte nun auf dem Wege zur ungarischen Königskrönung und zur Wahl zum römischen König weiter fortschreiten. Vorher aber wollte er für seine Person über die religiöse Haltung seines Sohnes völlig beruhigt sein. Er verlangte deshalb von diesem eine förmliche Erklärung, bei der katholischen Kirche bleiben zu wollen. Zu Prag, im Februar 1562, leistete Maximilian in Gegenwart seiner Brüder Ferdinand und Karl und der Geheimen Räte in die Hand seines kaiserlichen Vaters den feierlichen Eid, daß er in der katholischen Kirche leben und sterben wolle.
Der Friede mit dem Vater und der katholischen Kirche war gemacht. Schon vorher hatte er den Bischof Urban von Gurk zu seinem Hofprediger angenommen. Nun ging alles glatt und rasch vonstatten. Nachdem er im September zu Prag die Wenzelskrone empfangen hatte, wurde er zwei Monate später, am 24. November, in Frankfurt einstimmig – auch der Pfälzer hatte seine ursprünglichen Bedenken zurückgestellt – zum römischen König gewählt. Sofort nach diesem glücklich vollzogenen Akt sandte er seinen Kämmerer Don Juan Manrique nach Rom mit einem Schreiben, worin er die Wahl dem Papst zur Kenntnis brachte und wiederum das Versprechen gab, bei der katholischen Kirche bleiben zu wollen.
Sechs Tage darauf, am 30. November, wurde Maximilian in der Bartholomäuskirche, der altgewohnten Wahlstätte, feierlich gekrönt, »und der Jubel des Volkes bestätigte es: der beliebteste Fürst im deutschen Reich war auf den Thron erhoben« – es war »mehr als ein flüchtiger Rausch festlicher Freude«.
Der neue König leistete in herkömmlicher Weise den Schwur, die katholische Kirche und ihre Diener zu beschützen und der römischen Kurie die schuldige Unterwürfigkeit, Treue und Ehrfurcht zu erweisen. Nur das Abendmahl fiel weg. Maximilian hatte tags zuvor dem Kurfürsten von Mainz das päpstliche Breve, das ihn davon dispensierte, vorgewiesen. Katholischerseits empfand man über das vom König geleistete Gelöbnis der Treue eine lebhafte Genugtuung, umgekehrt hatten die Kurfürsten von Sachsen und von der Pfalz einen Protest erhoben, der aber dann, weil der Brandenburger seine Mitwirkung verweigerte, unterbleiben sollte. Maximilian benahm sich überhaupt, wie der päpstliche Nuntius nach Rom berichtete, »wie ein Heiliger und sprach über seine Stellung zur römischen Kurie mit einer solchen Fülle prächtiger Worte und erhabener Gedanken, daß die protestantischen Fürsten niedergeschmettert waren«. In Wirklichkeit waren aber auch die Anhänger der neuen Lehre im ganzen vollkommen befriedigt; einigen wenigstens, wie aus späteren Äußerungen hervorgeht, hatte Maximilian neuerlich versichert, daß er ihr treu bleibe.
Im Grunde war es ja nur natürlich, daß der neue König bei seiner eigenartigen Stellung zwischen den beiden Konfessionsparteien es keiner ganz recht machte. Scharfen Beobachtern, an denen es Maximilian auch diesmal nicht fehlte, wollten bemerkt haben, daß er beim Hochamt, als der Priester die Monstranz erhob, nur mit gebeugtem Haupte zur Erde blickte.
Die kluge Mittelstellung, die der König vor seiner Wahl angenommen hatte, bekundete sich auch auf seiner Rückreise von Frankfurt. Er besuchte den Pfälzer Kurfürsten in Heidelberg, führte mit ihm, wie der fromme Friedrich bekannte, ein »ganz christliches, treuherziges« Gespräch über »unsere wahre ungezweifelte Religion«, kehrte dann bei seinem württembergischen Freund Christoph in Stuttgart ein, traf auch in Günzburg mit seinem ehemaligen Prediger Pfauser zusammen und reiste hierauf – um auch nach der anderen Seite zu befriedigen – nach Augsburg, wo er, herzlich begrüßt, den heiligen Abend im Kreise Herzog Albrechts verbrachte, der ihm wieder zu Gemüte führte, daß es »sich nicht also wie bisher würde lavieren lassen«.
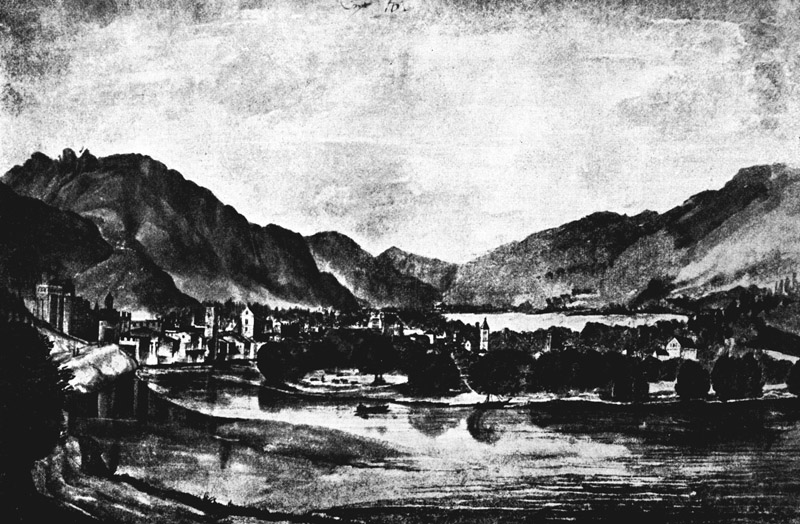
Trient
Am 16. März 1563 kehrte König Maximilian nach Wien zurück. Er wurde vom Bürgermeister und vom Stadtrat beim Rotenturmtore erwartet, von dem berühmten Historiographen Wolfgang Lazius in einer wohlgesetzten Festrede begrüßt, durch die blumengeschmückten Straßen in die Burg geleitet, und auch hier zeigte sich die große Beliebtheit des jungen Königs in demonstrativer Weise.
Die Krönung mit der Stefanskrone konnte erst am 8. September des nächsten Jahres in Preßburg stattfinden. Ihr waren langwierige Verhandlungen vorausgegangen, weil die ungarischen Stände darauf bestanden, daß Maximilians Königtum auf die Wahl sich gründe. Man half sich schließlich mit einer Form, welche die stachelige Frage offenließ. Inzwischen hatte auch jene Angelegenheit, die den Wiener Hof die ganzen Jahre hindurch beschäftigt hatte, die Frage der kirchlichen Reform, eine ganz eigenartige Lösung gefunden.
Kaiser Ferdinand vertrat gleich seinem verstorbenen Bruder Karl den Standpunkt, daß man nur durch Einführung von kirchlichen Reformen dem Protestantismus den Boden entziehen und die Rückkehr seiner Anhänger zur alten Kirche herbeiführen könne. Aber bisher hatte die Kirchenversammlung, die im Jahre 1545 vom Papst Paul III. nach Trient berufen worden, dieser Erwartung des Kaiserhofes in keiner Weise entsprochen. Von allem Anfang an bekundete sie das lebhafte Bestreben, die Reformfrage gegenüber der Formulierung der Glaubenssätze zurückzustellen.
Durch diese wenig entgegenkommende Haltung der Konzilväter war auch die Möglichkeit, die Protestanten zur Beschickung der Kirchenversammlung zu veranlassen, nahezu gänzlich geschwunden. Doch der Kaiser gab die Hoffnung, die Anhänger der neuen Lehre doch noch auf diesem Wege gewinnen zu können, keineswegs auf. Gerade in Österreich hatte der Protestantismus unter dem Adel und der Bürgerschaft reißende Fortschritte gemacht. Auch im Klerus war ein großer Abfall zu verzeichnen: teils aus eigenem Antrieb, teils gezwungen gingen die Pfarrer Ehen ein und reichten dem Volke bei der Kommunion den Kelch. Ihre theologische Unwissenheit und ihre Sittenverderbnis erregten allgemeines Ärgernis. Diese Mißstände, vor denen auch die treuesten Söhne der Papstkirche – und gerade die – nicht ihre Augen verschließen konnten, schrien geradezu nach einer gründlichen Reform, die füglich nur von einem allgemeinen Konzil zu erwarten stand.
Der Kaiser hatte gleich nach der Thronbesteigung des Papstes Pius IV. zu Ende des Jahres 1559 die Gelegenheit, daß Graf Arco ihm seine Glückwünsche überbrachte, zur Bitte benutzt, auf ein allgemeines Konzil bedacht zu sein. Denn wenn irgendein Träger der Tiara dazu ausersehen schien, die sehnsüchtigst erwartete Reform zu bringen, so war es Pius. Er hatte seinerzeit als Kardinal derart vielversprechende Äußerungen getan, daß er im Konklave von seinen Amtsgenossen entrüstet gefragt wurde, ob er wirklich gesagt habe, daß »wär guet, das man einen Pabst erwelet, der der Tayzen (= Deutschen) Gemiet erkennet und der sich nit sprayzen sol, die Communion sub utraque zu bewilligen, auch das die Priester elich Weiber nemen mechten«. Überdies war er durch eine mit den Kardinälen vereinbarte Wahlkapitulation gebunden, mit allem Fleiß dahin zu wirken, daß endlich einmal die Kirchenreform vorgenommen würde. Durch ein allgemeines Konzil und andere zulässige Mittel sollten die Ketzerei und die Mißbräuche, die sich seit langem in die Christenheit eingeschlichen hatten, ausgerottet werden.
Schon war in Frankreich für den 10. September 1560 ein Nationalkonzil ausgeschrieben worden, so daß man in Rom alle Ursache hatte, nun eiligst dem ersten Schritt zur Loslösung vom Heiligen Stuhle vorzubeugen. So willigte er denn, im November, in die Berufung einer Kirchenversammlung ein, die zu Ostern des nächsten Jahres in der alten Konzilstadt Trient zusammentreten sollte. Schon hatte sein längeres Zögern am Wiener Hofe die Besorgnis ausgelöst, daß es mit dem Eifer für das Konzil nicht weit her sei: »Man geht jetzt«, schrieb Maximilian am 18. November an Pfauser, »mit dem Konzil um, daß man nit weiß, wo man darin stecket. Aber ich halt meines Teils wenig davon oder schier gar nichts. Gleichwohl wird man in Kürz wissen, wo es aus will.«
Die Verspätung hatte ihre guten Gründe. In dem Augenblicke, da man sich zur Einberufung des Konzils entschloß, tauchte auch eine ganze Reihe von Schwierigkeiten auf. Die wichtigste Frage war die, ob dasselbe als eine Fortsetzung des alten oder als ein neues anzusehen sei. War das erstere der Fall, dann war es auch entschieden, daß die protestantischen Fürsten es nicht als ein allgemeines anerkennen würden. Der Papst wich dieser heiklen Frage aus. In der Ausschreibungsbulle vom 29. November wurde nicht ausdrücklich von einer Fortsetzung des Konzils gesprochen, aber auch nicht mit Bestimmtheit gesagt, daß es das alte sei. Das dort gebrauchte Wort »indicimus« konnte dahin ausgelegt werden, daß man sich für die Berufung einer neuen Kirchenversammlung entschieden habe. Klar war also die Textierung nicht, und so hatte der kaiserliche Gesandte Graf Arco recht, wenn er schon vierzehn Tage vorher dem Kaiser meldete, die Kurie werde sich durch zweideutige Worte – »verba ambigua« – um den Kern der Frage: »Kontinuation« oder »Indiktion« – einfach herumdrücken.
Die protestantischen Fürsten zeigten eine sehr feine Nase, wenn sie die Beschickung des Konzils rundweg ablehnten und die Einladung dazu als eine Anmaßung ansahen. War dies für den Kaiser die erste Enttäuschung, so sollte sich die zweite in dem Moment einstellen, da an das Konzil die Frage der Reformen herantrat. Der Kaiser hatte zu diesem Zweck ein umfassendes, wohldurchdachtes Programm ausarbeiten lassen. Als die Hauptforderung erschienen hier wieder Laienkelch und Priesterehe. Gerade im Jahre 1561 hatte eine in sechsunddreißig Klöstern Österreichs vorgenommene Visitation das erschreckende Ergebnis zutage gebracht, daß neben 182 Ordensleuten sich 135 Frauen und 223 Kinder vorfanden. Da mußte also vorgebeugt werden, aber man wußte in Wien auch, daß die Gewährung der Priesterehe auf die größten Schwierigkeiten stoßen werde, weshalb alle möglichen Gründe aufgeführt wurden, die für sie sprachen.
»Je mehr die Geistlichen«, so heißt es in der kaiserlichen Denkschrift mit feinen Spitzen, »zeitliche Güter im Überfluß besitzen, um so weniger seien sie mit einem Gelübde oder Gebot der Keuschheit zu belasten, oder aber ihr Stand müsse zur Armut der ersten Kirche zurückgeführt werden. Wenn alle Kleriker durch das Gebot der Keuschheit verpflichtet werden sollten, dürften nur solche, die vorgerückten Alters sind, in den heiligen Stand aufgenommen werden, von denen ehestens zu erhoffen ist, daß sie die Ehelosigkeit recht und unverletzt halten werden.« Wenn aber doch Jüngere zu den Weihen zugelassen werden müßten, sei zu erwägen, ob man nicht besser täte, ihnen dem Rat des Apostels Paulus gemäß die Ehe zu gestatten. Im Juni 1562 wurde den Konzilvätern das umfangreiche »Reformationslibell« des Kaisers vorgelegt, in welchem die sittliche Entartung der Kirche und besonders der Hierarchie als die vornehmste Ursache der Erfolge des Protestantismus bezeichnet und nochmals in dringlichster Weise um Abhilfe aller Mißstände gebeten wird.
Mit bewunderungswürdiger Zähigkeit und Energie hat sich Kaiser Ferdinand bemüht, sein Reformprogramm in Trient zur Ausführung zu bringen. Schon leidend, ging er persönlich nach Innsbruck, um den Verhandlungen des Konzils näher zu sein. Allein in der Kirchenversammlung, in welcher die von der römischen Kurie abhängigen italienischen Prälaten die Mehrheit bildeten, stießen die kaiserlichen Vorschläge auf die alten Widerstände, und auch Pius IV. zeigte schon aus finanziellen Gründen das lebhafte Bestreben, das Konzil so bald als möglich loszuwerden. Eine Zeitlang schien es, als ob man dort wirklich ernster auf die Reformfrage eingehen wollte, als sich nämlich die französischen Prälaten mit den Forderungen des Kaisers vereinigten und der Kardinal von Lothringen, der mächtige Führer der französischen Katholiken, zu persönlicher Aussprache an das Innsbrucker Hoflager reiste. Aber schließlich gelang es der Kurie, die ihr gefährliche Bewegung zur Reformation des »Hauptes« abzubiegen. Die von Rom aus angekündigte »Reform der weltlichen Fürsten« und ihrer »angemaßten« kirchlichen Rechte und Güter kühlte den Reformeifer des Wiener Hofes ganz beträchtlich ab, und außerdem war ihm versprochen worden, daß nach Schluß des Konzils der Papst Laienkelch und Priesterehe in der von Ferdinand gewünschten Weise bewilligen würde. Auf die Beendigung der Kirchenversammlung drang vor allem König Maximilian.
Von allem Anfang an hatte der Thronfolger die Aussichten für das Trienter Konzil sehr ungünstig beurteilt. Dem Kurfürsten August von Sachsen gegenüber gab er sich als »ungläubiger Thomas« aus. Als er die Nachricht vom Schluß des Konzils erhalten hatte, äußerte er sich am 19. Dezember 1563 zum venezianischen Gesandten wenig anerkennend: »Was mich betrifft, so habe ich dieses Konzil niemals dieses Namens würdig erachtet, sondern es erschien mir viel eher als eine Versammlung von Menschen voller Leidenschaften und besonderen Interessen.« Mit aller Entschiedenheit bekannte er sich zum Gedanken eines Nationalkonzils.
Wiederholt hatte der Thronfolger seinen Vater gebeten, nach Wien zurückzukehren und den niederösterreichischen Ständen, die mit Ungestüm auf die Gewährung ihrer religiösen Wünsche drängten, entgegenzukommen, da man ja doch auf das Konzil keine Hoffnungen mehr setzen könne. »In jeder Hinsicht«, schrieb er am 24. Mai dem in Innsbruck weilenden Vater, »halte ich es jetzt für nötig, daß Eure Majestät ungesäumt daran denken möge, wie sie hierin väterlich für ihr Volk sorgen und helfen können. Denn meinem Urteil nach geht es nicht mehr an, daß Eure Majestät das Volk noch länger mit der Hoffnung auf das Konzil hinhalten zu können glaubt, da die Leute doch lieber als auf das Konzil auf das Versprechen Eurer Majestät bauen wollen. Deshalb, gnädigster Kaiser, Herr und Vater, wiederhole ich jetzt zum drittenmal meine Mahnung und dringende Bitte, in dieser Angelegenheit nicht ganz vom Konzil abhängig zu sein, sondern lieber in väterlicher Gnade und christlichem Sinn zu bedenken, was für ein Ende die Dinge wohl nehmen werden, wenn nicht diesem bejammernswerten Leiden der christlichen Religion, besonders in Niederösterreich, eine rasche und heilsame Medizin gereicht wird.« Aus eigener Machtvollkommenheit, unabhängig von Rom, sollte die kirchliche Reform in Deutschland wie in den habsburgischen Erblanden durchgeführt und vor allem Laienkelch und Priesterehe gewährt werden.
Diese zwei wichtigsten Forderungen sollten ja nun, wie der Papst in Aussicht gestellt hatte, nach Schluß des Konzils bewilligt werden. Aber was Ferdinand ganz besonders für diesen einnahm, war die Frage der Zustimmung des Heiligen Stuhles zur römischen Königswahl Maximilians. Pius IV. hatte in einer Weisung an seinen Wiener Nuntius Delfino vom 27. Juni durchblicken lassen, daß die Approbation Maximilians nicht für sich allein, sondern in Verbindung mit den Konzilangelegenheiten zu erledigen sei. Das hieß also, aus dem kurialen Latein in ein gemeinverständliches Deutsch übersetzt: Die Approbation war erst nach Beendigung der Trienter Tagung zu erlangen, und diese Aussicht wirkte auf den Kaiser wahrhaft befreiend.
Die Frage der päpstlichen »Approbation« war nämlich auf dem besten Wege, sich zu einer wahren Seeschlange zu gestalten. Als Don Juan Manrique, der Gesandte des Königs, im Verein mit dem Grafen Arco, dem kaiserlichen Botschafter in Rom, die Anerkennung der in Frankfurt vollzogenen Wahl begehrte, stieß er auf die größten Schwierigkeiten. Vor allem vermißte man in dem sonst »liebreichen« Schreiben des neuen Königs das Versprechen der »Oboedientia«, die sein Vater geleistet habe. Auch sollte Maximilian die bindende Versicherung abgeben, in der römisch-katholischen Religion leben und sterben zu wollen, und man legte gerade auf das Wort »römisch-katholisch« Wert. Unverrichteter Dinge trat Manrique am Silvestertage des Jahres 1562 seine Rückreise an. Zum Unterschied von seinem Vater, der alsbald sorgsam in den Archiven nachforschen ließ, wie die Anerkennungsfrage von seinen Vorfahren behandelt wurde, bekundete Maximilian nicht die geringste Beunruhigung. Er für seine Person würde, wenn es nicht anders ging, auch auf die Bestätigung ganz verzichtet haben. Allein dies konnte er nicht, schon mit Rücksicht auf seinen spanischen Vetter, der durch den Gesandten Guzman das größte Interesse für den Stand der Angelegenheit an den Tag legte.
Maximilian ließ nun neue Vorschläge – unter anderm wollte er nur bei Gott und nicht bei Petrus schwören und sich nicht zum Schutz der »römischen«, sondern der »katholischen« Kirche verpflichten – ausarbeiten. Aber als sie der kaiserliche Gesandte – im März 1563 – dem Heiligen Vater überreichte, erhob dieser neue Einwände. Gerade damals hatte man in Rom wieder weniger günstige Nachrichten über des Königs religiöse Haltung bekommen. Vielleicht war Pius zu Ohren gekommen, daß sich Maximilian geweigert hatte, der Einweihung der neuen Stiftskirche in Innsbruck um der dabei beobachteten »päpstlichen« Zeremonien willen beizuwohnen.
Im Mai beschäftigte sich mit der schwierigen Approbationsfrage eine vom Papst eingesetzte Kommission, die mehrere Sitzungen abhielt, ohne zu einem Ergebnis gelangen zu können. Pius entschloß sich darauf, den geriebenen Bischof Zaccaria Delfino mit dem Abschluß der verwickelten Angelegenheit zu betrauen. Der in den Geschäften wohlbewanderte Rat Dr. Zasius konnte nicht umhin, über die Schwierigkeit dieser »scharfen und schlüpfrigen Handlung« zu klagen, bei der es drei stark verschiedene Parteien gebe, die des Papstes, die des Kaisers und die des Thronfolgers, »welche alle drei in dieser lausigen Handlung noch ziemlich ungleich einziehen«. Delfino mußte sich, als er auf das Verhalten des kaiserlichen Gesandten Arco hinwies, der für Kaiser Ferdinand die »Obödienz« geleistet hatte, von Zasius sagen lassen, daß der Diplomat das Opfer einer »Treulosigkeit« gewesen, daß er »überlistet« worden sei. Aber schließlich fand Delfino das Zaubermittel, welches der stacheligen Frage ein Ende bereiten sollte – Ferdinands Zustimmung zum Schluß des Konzils.
In der Tat wickelte sich jetzt die Angelegenheit ungemein prompt zur Zufriedenheit beider Parteien ab. Maximilian schickte am 24. Dezember den Grafen Georg von Helfenstein mit einer neuen Instruktion nach Rom. Der Text der Erklärung des Königs, die er nach seiner Ankunft Anfang Februar dem Papst unterbreitete, war vorsichtig genug gehalten. Maximilian, so heißt es da, bitte den Papst um das, was die Päpste bisher nach einer Königswahl »getan« hätten, und sei hinwieder bereit, alles das zu leisten, was man nachweisen könne, daß es seine Vorfahren, namentlich Maximilian I., Karl V. und Ferdinand, geleistet hätten; vom Wohlwollen des Papstes Pius überzeugt, werde er ein dienstwilliger Sohn des apostolischen Stuhles bleiben. Helfenstein fügte noch die Versicherung bei, sein königlicher Herr werde sich der römischen Kurie gegenüber immer so verhalten, wie es einem guten, unbescholtenen und christlichen Fürsten zieme. Von »Obödienz« war nicht die Rede.
In dem geheimen Konsistorium vom 5. Februar wurde der Text der Konfirmationsbulle beschlossen, die dann, in feierlicher Form ausgefertigt, dem Gesandten eingehändigt werden sollte. Doch Graf Helfenstein wies sie zurück, mit der Begründung, daß eine solche bisher niemals übergeben worden sei. Mit einem Mißton endete so das erbitterte Ringen um das Bestätigungsrecht des Papstes, der letzte Nachhall eines noch weit größeren Kampfes, den einst die beiden Häupter der Christenheit miteinander geführt hatten.
Für Maximilian – und für seine Nachfolger – war es von großer prinzipieller Bedeutung, daß hier die Kurie nachgegeben hatte. Schließlich konnte sie es als einen Gewinn buchen, daß durch die Wahl Maximilians, wie Pius IV. selber hervorhob, die deutsche Krone der katholischen Kirche erhalten blieb. Und wie glänzend stand doch diese Kirche da, als das Trienter Konzil am 4. Dezember 1563 nach so vielen Wechselfällen seine denkwürdige Tagung beschloß!
Wohl hatte die Kirchenversammlung die noch immer in weiten Kreisen erhoffte Herstellung des Friedens und der Eintracht in der Christenheit nicht gebracht – statt die Anhänger der neuen Lehre für die alte Kirche wiederzugewinnen, war der Zwiespalt der beiden Konfessionen, der Bruch mit dem Gegner vollendet. »Man mußte sich mit dem Gedanken vertraut machen, daß die Einheit der christlichen Völkerfamilie, die kostbarste Erbschaft des Mittelalters, für immer auseinandergerissen sei und eine neue Zeit beginne.« Aber auf der anderen Seite brachte sie »die so lang vermißte Klärung der religiösen Lage. Was katholisch sei, was nicht, konnte fürder nicht mehr zweifelhaft sein; die religiöse Verschwommenheit, die bei den Katholiken so viele Köpfe verwirrt, so viel Tatkraft gelähmt hatte, nahm ein Ende«. An Stelle schwankender Überlieferungen wurden feste Lehrsätze und Dogmen aufgerichtet und damit dem Sektengeist und Neuerungsdrang ein unerschütterliches Bollwerk entgegengestellt.
So bedeutete in der Tat das Trienter Konzil einen »Grenz- und Markstein, an dem sich die Geister scheiden mußten, begründete es eine neue Epoche in der Geschichte der katholischen Kirche«. Das bei den Deutschen in dem kühnen Auftreten des Augustinermönches Martin Luther erwachte Gewissen hatte auch die altkirchlichen Kreise aufgerüttelt, die »Reinheit des Evangeliums«, welche seine Anhänger forderten, bildete auch für das Konzil den Ausgangspunkt seiner Beratungen und Beschlüsse. In der Frage der kirchlichen Reform wurden wichtige Beschlüsse gefaßt. Durch Seminare sollte für eine bessere wissenschaftlich-religiöse Bildung der Geistlichkeit gesorgt werden, auch wurden Bestimmungen zur Handhabung einer strengeren Kirchenzucht getroffen und vor allem die Bischöfe auf die ihnen als Oberhirten obliegenden Pflichten verwiesen, wie denn die so oft beklagte Häufung von Pfründen in einer Hand verboten wurde.
So hatte sich die alte totgesagte Kirche in Trient sittlich und geistig verjüngt, hatte hier die Kräfte gesammelt, die zur katholischen Gegenreformation führten. Und trotzdem wären vielleicht die Beschlüsse des Trienter Konzils mehr oder weniger toter Buchstabe geblieben, hätte nicht die römische Kurie jene Gehilfin gefunden, die es sich zur Lebensaufgabe machte, die Konzildekrete in die Tat umzusetzen – die Gesellschaft Jesu, von dem spanischen Ritter Ignaz von Loyola begründet, von der Kreuzzugsstimmung erfüllt, die das spanische Volk seit Jahrhunderten im harten, erbitterten Kampf gegen Andersgläubige geleitet hatte.
Während nun die wiedererstarkte katholische Kirche zum Schlag ausholte, um das in den letzten Jahrzehnten Verlorengegangene wieder zurückzugewinnen, herrschte im andern Lager Zwietracht und Uneinigkeit. Diese innere Schwäche des Protestantismus war in erster Linie schuld daran, daß der Thronfolger Maximilian sich von ihm abwandte und mit den katholischen Mächten seinen Frieden schloß; schon hatte der König auch die Zukunft des deutschen Reiches aus der Hand gegeben.
In dem heftigen Ringen, das im Sommer 1560 um die Seele des Thronfolgers entbrannt war, hatte der Kaiser als Lockmittel auch die Aussicht auf die spanische Erbschaft verwendet. Es währte nicht lange, und die Versuchung trat wieder an Maximilian heran. Diesmal aber war es König Philipp II. selber, der seinen deutschen Vetter ködern wollte. Im August des folgenden Jahres ergeht an Maximilian die offizielle Einladung, seine beiden ältesten Söhne Rudolf und Ernst an den spanischen Hof zu schicken, damit sie dort erzogen würden. Maximilian gibt – in der Tat ein »verhängnisvoller« Entschluß! – seine Einwilligung dazu, aber er zögert mit der Ausführung. Da läßt Philipp durch Herzog Alba den kaiserlichen Gesandten Guzman vertraulich wissen, daß es mit Rücksicht auf die »eigentümliche Beschaffenheit« seines einzigen Sohnes, des Infanten Don Carlos, gut wäre, wenn die Neffen möglichst bald nach Madrid kämen.
König Maximilian wird wohl nicht eine Sekunde gezweifelt haben, daß es dem spanischen König, wenn er auf die Ausreise der beiden Prinzen drängte, lediglich darum zu tun war, die Neffen möglichst bald den »giftigen« Einflüssen des Wiener Hofes, die bereits den königlichen Vater verdorben hatten, entrückt zu sehen und sie im spanisch-römischen Geist strengster Gläubigkeit erziehen zu lassen. Er hat denn auch so lange als möglich die Abreise seiner Söhne hinausgezogen; erst nach Jahren fügt er sich dem unausgesetzten Druck. Am 8. November 1563 traten die beiden Prinzen in Begleitung des Gesandten Adam von Dietrichstein, der auch zu ihrem Obersthofmeister ausersehen war, von Wiener Neustadt aus die Reise nach Spanien an. Sie erfolgte auf demselben Wege, den einst ihr Vater widerwillig gezogen war, um wohl mit einer spanischen Gattin, aber sonst als ein erklärter Feind des Spaniertums, nicht zuletzt der spanischen, mit viel Heuchelei untermischten Gläubigkeit heimzukehren. Konnte dieselbe Wandlung nicht auch bei seinen Söhnen eintreten?
Im März 1564 trafen Rudolf und Ernst in Barcelona ein, von König Philipp freundlichst begrüßt. Und diese Herzlichkeit war sicherlich echt, denn er sah in ihnen ein wertvolles Unterpfand für die religiöse Haltung seines deutschen Vetters und Schwagers, die ihm nach wie vor die schwersten Sorgen bereitete. Aus diesem Grunde wollte sie Philipp nicht so bald wieder ziehen lassen, so sehr auch ihr Vater auf die Rückkehr drängte, und dieser fing sehr bald an, ihre Heimreise zu betreiben, sei es, daß ihn sein Entschluß überhaupt reute oder daß er ein längeres Verweilen am spanischen Königshofe wegen der schädlichen Einflüsse vermeiden wollte. Aus dynastischen Gründen hatte sich Maximilian, als er nach schwerer Bedrängnis seinen Frieden mit dem Vater machte, dem Wunsche Philipps II. gefügt, aber die spanische Erbschaft war sicherlich nicht das treibende Moment seiner »Bekehrung« – der entscheidende Wendepunkt war vielmehr die schwere Enttäuschung über die Antwort der protestantischen Fürsten auf seinen Hilferuf.
Das – wenigstens äußerlich – gute Verhältnis zum spanischen Hofe gehörte ebenso zu den dynastischen Inventarstücken, die er nach der Aussöhnung mit Kaiser Ferdinand übernommen hatte, wie die korrekten Beziehungen zur römischen Kurie. Innerlich hat der Thronfolger an seinem Verhalten gegenüber der neuen Lehre nichts geändert. Dies zeigte er in seiner Stellungnahme zum Trienter Konzil, das er nicht für ein allgemeines, sondern für ein römisches hielt und dessen Absage an die Neugläubigen ihn nicht hinderte, den Gedanken »einer christlichen Vergleichung« weiterzuverfolgen. Unabhängig von Rom, auf einem Nationalkonzil, sollte die Versöhnung der beiden Konfessionen erfolgen.
Nach wie vor steht der junge König mit den protestantischen Fürsten in regster Verbindung. Ihren Unionsbestrebungen bringt er ein derartiges Interesse entgegen, daß ihn Herzog Christoph von Württemberg sogar aufforderte, sie selber in die Hand zu nehmen. Dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, der mittlerweile sich offen zum Kalvinismus bekannt, und ihm den Heidelberger Katechismus zugesandt hatte, macht er Vorstellungen, die wieder seine Sorge für die Aufrechterhaltung der Einigkeit unter den Protestanten bekunden. Er warnt ihn, der »Zwinglischen Opinion«, besonders in den Artikeln der Taufe und des Abendmahles, weiter nachzuhängen. Die dort enthaltenen Glaubenssätze, meint er, stimmten nicht mit der »Augsburger Religion« und nicht mit der »alten Religion« überein und stünden somit auch nicht unter dem Schutz des Religionsfriedens. Noch immer bekennt er sich als Anhänger der Augsburger Konfession, verfolgt er mit sichtlichem Schmerz die Entzweiung im Lager des deutschen Protestantismus und steht hier im Grunde völlig auf dem Boden des von seinem Vater in Augsburg geschlossenen Religionsfriedens.
Maximilian handelte auch durchaus im Geist der kaiserlichen Tradition, wenn er sich für die unverzügliche Gewährung der dringendsten Reformen wie Laienkelch und Priesterehe, die ja bereits im Augsburger Interim zugesagt erschienen, mit aller Entschiedenheit verwendete. Der kaiserliche Vater hoffte nach Schluß des Konzils diese beiden Konzessionen in Rom durchsetzen zu können. Nach langwierigen Verhandlungen gestattete indes der Papst bloß den Laienkelch und diesen unter Bedingungen, die den Wert seines Zugeständnisses wesentlich beeinträchtigen mußten. In dem an die Kirchenfürsten gerichteten Breve vom 16. April 1564 heißt es sehr unbestimmt, daß der Papst mit Rücksicht auf das Dekret des Trienter Konzils, auf die vom Kaiser Ferdinand vorgebrachte Bitte und um der Gefahr, daß der Abfall von der katholischen Kirche zunehme, vorzubeugen, es jedem Bischof anheimstelle, in seiner Diözese die Austeilung der Kommunion unter beiderlei Gestalt zu gestatten.
Zur selben Zeit trat in Wien eine Theologenkommission zusammen, um sich mit der Frage des kirchlichen Ausgleiches zu befassen. Man habe den Kaiser, so heißt es in der kaiserlichen Proposition, dahin berichtet, daß man sich bei den früheren Unionsverhandlungen »etlicher und nicht der geringsten« Artikel »ziemlichermaßen« verglichen und die übrigen noch unverglichenen »nicht so gar einer großen Anzahl« sein sollen. Viele fromme, christliche, gelehrte Leute seien der Meinung, daß das Ziel schon zu erreichen wäre, wenn man etliche allgemein bekannte Mißbräuche abstelle und um des Friedens willen einiges, was mehr juris positivi denn divini wäre, zugestehe oder dulde, endlich einige »subtile und scharfe Disputationes«, welche doch im Grunde ohnedies dem gemeinen Mann ganz unverständlich und vielleicht meistenteils zur Erlangung der Seligkeit unnötig seien, einstweilen zurückstelle.
Nachdem diese Theologenkommission, in welcher zunächst der eifrig katholische Propst Eisengrein das Wort führte, Mitte Mai verabschiedet worden war, wurden noch im selben Monat von einigen der bekanntesten katholischen Reformtheologen, Georg Witzel, Georg Cassander und Leonhard Villinus, Gutachten abgefordert, um sodann auf Grund der verschiedenen Elaborate durch einen landesfürstlichen Machtspruch den so lange erwarteten Ausgleich zwischen Protestantismus und Katholizismus zu bewerkstelligen. Allein Kaiser Ferdinand sollte nicht mehr in die Lage kommen, dieses Schlußwort zu sprechen. Schon seit längerer Zeit leidend, hatte er im Gefühl, er werde es »wohl nicht mehr lange treiben«, am 21. April seinem Sohne die Regentschaft übertragen und ihm vor allem die Erhaltung der katholischen Religion, die Wahrung der Gerechtigkeit und – die Befriedigung seiner Gläubiger ans Herz gelegt.
Maximilian, der seinem Vater einst so großen Kummer bereitet hatte, benahm sich in der schweren Zeit der Todeskrankheit Ferdinands als ein guter Sohn. Er ließ ihm, wie Rat Zasius am 12. Mai dem Landgrafen Philipp schreibt, »täglich zu gelegenen Stunden süße Kammermusicen halten und visitieren auch sonst Seine kaiserliche Majestät zum öfteren des Morgens, sobald sie aufsteen, also Abends und sonst im Tag, so oft si von Rat aufsteen, ehe si sich zu Irer kuniglichen Majestät Malzeit verfügen, und ist zu spüren, das die kaiserliche Majestät ob solchen Irer kuniglichen Majestät unsäglichen Fleiß, Ehrung und Beweisung aller söhnlichen Offitien ain treffenlich groß Gefallen empfahen«.
Ansonsten war die Pflege, wie der Vizekanzler Dr. Seld am 22. April Herzog Albrecht von Bayern schreibt, »nicht besonders gut«, wozu er entschuldigend bemerkt, daß die »Mannespersonen in solchen Sachen nicht viel können«. Der Kaiser – auch Seld erwähnt, daß ihn die Musik am meisten unterhalte – sitze oft stundenlang mutterseelenallein. Die fromme Königin, Maximilians Gattin, täte wohl ihresteils gern das Beste, »es ist aber, wie Eure fürstliche Gnaden wissen, ain gutte und eingezogne, melancolisch Frau, die ir Tag mit solchen Sachen wenig umbgangen«. Im Mai kamen Erzherzog Ferdinand und die Herzogin Anna zum Besuch ihres hoffnungslos daniederliegenden Vaters, der eben ins zweiundsechzigste Lebensjahr eingetreten war, nach Wien, reisten indes bald wieder ab, so daß neben Maximilian nur der jüngste Sohn Karl in der Sterbestunde anwesend war.
Am 25. Juli trat im Befinden des Kaisers die entscheidende Verschlimmerung ein. Als Maximilian – wir folgen hier der Schilderung, die Rat Zasius dem bayerischen Herzog gab – nach der Sitzung des Geheimen Rates vor dem Nachtmahl seinen Vater besuchte, fand er ihn »vast blöd und dermaßen so schwach«, daß »auch Ihrer Majestät Rede seer übel vernemblich gewest«. Er nahm noch mit Müh und Not zwei Eier in der Suppe, das zweite nur auf Maximilians besonderes Zureden. Hierauf – es war 6 Uhr – ging der König in sein Zimmer hinunter, um zu nachtmahlen und die Werbung eines Gesandten anzuhören. Ehe er damit fertig geworden, wurde er rasch ins Sterbezimmer geholt, wo der Beichtvater Cithard Ferdinand »ganz tröstlich und christlich zusprach«, und den Kaiser, wie ihm dieser »schon vor etlichen Monaten befohlen«, ohne Titel, bloß mit »Ferdinand« anredete. »Ferdinande, mein Bruder,« so sprach er, »streit' wie ein frommer Ritter Christi, sei deinem Herrn bis in den Tod getreu.« So hatte es der Kaiser haben wollen, »dieweil mit dem Tode alle Majestät ein End' nehme«. Er starb ohne Todeskampf, ohne einen »einzigen Rucker oder Bewegung ainiches Glids«, war »gleich wie ein Liechtl in ainer Amppel erloschen«.
Die Todeskrankheit war Lungenschwindsucht, und die übliche Öffnung der Leiche bestätigte es – »die pur lautter phtysis und Abdörrsucht«, wie Zasius schreibt. Der Körper des Toten war, wie Maximilian dem spanischen König schreibt, »dermaßen verzert, das si – die Majestät – nix als Haut und Ban an ier gehabt hatt.« Die Ärzte scheinen den Charakter der Krankheit zu spät erkannt zu haben, so wenigstens behauptet Zasius, der die Ansicht ausspricht, daß Ferdinand zu retten gewesen wäre. Namentlich grollte er dem Dr. Bartholomäus Carrichter, »Doktor Bachus« genannt, der Ferdinand zuletzt behandelt hatte. Dieser »Kräutteldoktor«, den die anderen Ärzte, wie Maximilian bemerkte, »nit ansehen können, so faind saind sie ime«, hatte nämlich versprochen, den Kranken durch seine Arzneien so weit herzustellen, daß er in vierzehn Tagen das Bett verlassen und in einem Vierteljahr auf die Jagd werde reiten können. »Also ist des heillosen, znichtigen Bachi Cur leider zu Ende geloffen«, schreibt Zasius, während Maximilian anerkannte, daß er seines Vaters Ende »ain Wail« aufgehalten habe, und »wäre gewiß ain Wunder gewest, so er Ir Majestät aufgebracht hette«.
Mit Kaiser Ferdinand I. war ein Herrscherleben zu Ende gegangen, welches »durch schwierige Verhältnisse und gewaltige Umwälzungen mühsam und ehrenhaft hindurchgegangen war, als dessen Erbschaft bedeutende Erfolge, aber noch viel schwerere Aufgaben zurückblieben«. Er hat im Reich wie in den Erblanden Großes geschaffen, und auch seine konfessionellen Gegner konnten ihm nicht die Anerkennung versagen, daß der in Spanien geborene und erzogene Habsburger, der sich immer mehr und mehr zum deutschen Fürsten umgewandelt hat, ein durchaus wohlwollender, rechtlicher Charakter war, der sich allgemeiner Achtung erfreute.
Die Glocken, die das Hinscheiden des alten Kaisers verkündeten, läuteten auch die Thronbesteigung des neuen Herrschers ein. Es war nach seiner ganzen Vergangenheit nicht anders zu erwarten, als daß sich an seinen Regierungsantritt Hoffnungen wie Besorgnisse knüpften. Gleich die Beileidsbezeigungen und Glückwünsche, die anläßlich des Thronwechsels nach Wien kamen, boten dazu gute Gelegenheit. So richtet der bayerische Herzog Albrecht, nachdem er seiner Zuversicht Ausdruck gegeben, Maximilian werde seinen Schmerz zu »temperieren« wissen, an den Schwager die wohlgemeinte Mahnung, zu Eingang seiner Regierung im Punkte der Religion sich gut zu halten. Umgekehrt fordert ihn der pfälzische Kurfürst Friedrich auf, sich »die Bekanntnus, die Pflanzung und Fortsetzung der wahren christlichen und alleinseligmachenden Religion« angelegen sein zu lassen und vor dem Papst und seinem Anhang keine Furcht zu zeigen.
Der neue Kaiser, der eben in sein siebenunddreißigstes Lebensjahr trat, vermied es, in seinem Rat irgendwelche einschneidende Veränderungen vorzunehmen. Er wollte schon dadurch nach außen hin zeigen, daß er gesonnen sei, in den von seinem Vater vorgezeichneten Richtlinien weiterzuregieren. Die leitenden Männer blieben die beiden Vizekanzler Dr. Johann Ulrich Zasius und Johann Baptist Weber – der erstere hatte die deutsche Kanzlei, der letztere die lateinische zu besorgen. Beide waren Katholiken, gehörten indes, wie fast alle Räte des verstorbenen Monarchen, der Reformpartei an. Von Weber behaupteten die Anhänger der streng katholischen Partei, daß er »den Mantel nach dem Wind kehre«. Und das gleiche konnte füglich auch von seinem geistig höher stehenden Amtsgenossen Dr. Zasius, einem Sohne des berühmten Rechtsgelehrten Ulrich Zasius, gelten. Er zeigte sich als eine außerordentlich geschäftskundige Arbeitskraft, verstand es aber auch in den Pausen, die ihm seine Kanzleitätigkeit gestattete, den Freuden des Lebens tüchtig und ausgiebig zuzusprechen. Seine vertraulichen Berichte, die er nicht nur seinem besonderen Gönner Herzog Albrecht von Bayern, sondern auch dem lutherischen Kurfürsten August von Sachsen ziemlich regelmäßig zugehen ließ, bekunden eine gute Dosis von Humor und Spottlust. Da macht er sich einmal über das neue Fastengebot des Graner Erzbischofs lustig, der seinen Seelsorgekindern den Genuß des Sauerkrautes ebenso streng wie den des Fleisches untersagt habe und zwar aus der »tiefgeistlichen vernünftigen Fürsorge«, daß sich nicht am Ende jemand vergesse und ein Stück geräucherten Specks unter dem Sauerkraut zu verstecken versucht fühle, welche »neue Rigorosität«, wie er spitz hinzufügt, »offenbar schon die Wirkung des letzten Konzils sei«.
Gleich seinem neuen kaiserlichen Herrn haßte Zasius die Jesuiten aus dem Grunde seiner Seele. Gegen Herzog Albrecht, bei dem seine katholische Gesinnung verdächtigt worden war, rechtfertigt er sich dahin, daß er eben nicht »die Laster der römischen Kurie adorieren wolle«, und darin sei er mit vielen frommen, katholischen Männern einer Meinung. Freilich gebe es Leute mit »vierspitzigen Baretten«, fährt er mit einem scharfen Ausfall auf die Mitglieder der Gesellschaft Jesu fort, die, wenn der Papst und alle Kardinäle »auf Köpfen gingen und alle Tag tausend Morde täten«, auch dies »recht hübsch und katholisch« finden und alle andern, die nicht heucheln könnten und das übel getan hießen, für Häretiker erklären würden. Er aber wolle nicht weiter davon reden, um nicht in Zorn zu geraten.
Nicht minder schlecht ist Zasius auf Spanien zu sprechen. In einem Schreiben an den Kurfürsten August gibt er der Besorgnis Ausdruck, des Kaisers Fürsprache zugunsten der Niederländer werde nicht viel helfen, »weil dieses belzebubisch spanisch Ungeziefer das Hefft schon ergriffen und in irem hochmütigen, hoffertigen Sinn der ganzen Welt stark genug zu sein sich gedenken«. Ein andermal spricht er von den Spaniern als von einem »pluetdürstigen Ungeziefer«. Aus dem gleichen Grunde kommen auch die Kalviner bei ihm nicht gut weg, denn ihre Pläne und Unternehmungen seien, wie er Albrecht schreibt, »ad sanguinem et caedem«, auf Blut und Mord gerichtet.
Zasius seufzt auch gelegentlich über die »Viechsarbeit«, die auf ihm laste und »allein« von ihm bewältigt werden müsse, da sein Kollege – Weber – von den Geschäften nichts verstehe. Allein in einem Punkte waren die beiden vollkommen gleich, geradezu kongenial – sie nahmen von überall her Geschenke an. So bezog Zasius just wegen seiner bekannt antispanischen Gesinnung von dem sonst sehr knauserigen König Philipp II. ausgiebige Geldunterstützungen, damit er nicht allzusehr dem Madrider Hofe entgegenarbeite. Während nun Zasius anscheinend die Einnahmen rasch in Ausgaben umsetzte, ward Weber ein steinreicher Mann; er konnte schließlich die zwei großen Herrschaften Bisamberg und Retz in Niederösterreich ankaufen. Und auch darin waren sie sich gleich, daß Maximilian zu Beginn seiner Regierung sowohl den einen wie den andern für das Kanzleramt »gar nit qualifiziert« erachtete, obwohl sie sonst, wie er milde hinzufügte, »gute Leute« seien.
Von Mitgliedern des Geheimen Rates kamen noch der Vorsitzende Johann Trautson Freiherr von Sprechenstein und der Obersthofmeister Leonhard von Harrach in Betracht, beide Katholiken, allerdings derart gemäßigter Richtung, daß sie von der päpstlichen Partei als »lau« bezeichnet wurden. Später sollte der Feldoberst Lazarus von Schwendi, der in religiöser Hinsicht weiter nach links gerichtet erscheint, bei Maximilian eine besondere Vertrauensstellung einnehmen. So hatte also Zasius im ganzen vollkommen recht, wenn er in seinem gleich nach Ferdinands Ableben an den sächsischen Kurfürsten erstatteten Bericht die Ansicht vertrat, daß Maximilian im Rat keine Veränderungen vornehmen wolle.
Der Tod des Vaters legte dem neuen Kaiser zunächst die Verpflichtung auf, für die Leichenfeier die erforderlichen Anstalten zu treffen, die verschiedenen Höfe offiziell davon in Kenntnis zu setzen. Den näherstehenden Fürsten, wie dem bayerischen Schwager Albrecht und dem spanischen König, schrieb Maximilian eigenhändig, auch manchem vertrauten Rat. Gott habe seinen Vater, so zeigt er dem Madrider Gesandten Dietrichstein an, »aus diesem Jammertal« gefordert; er habe »an ihm in Wahrheit viel verloren«, und »jetzt zu tun genueg sain wierd«. Aber die Trauerbotschaften, die man aussandte, wie die Kondolenzgesandtschaften, die unter tiefen Verbeugungen in wohlgesetzter Rede, mit umflorter Stimme das »hochbekümmerte und betrübte Gemüt« ihrer hohen Auftraggeber zum Ausdruck zu bringen hatten, verschlangen noch überdies ein ganz enormes Geld, weil die fremden Gesandten nicht nur verpflegt werden mußten, sondern außerdem noch Geschenke erhielten. Und dies in einem Moment, da man es für weit bessere Zwecke hätte verwenden können.
Über die Hinterlassenschaft des Kaisers, die sogenannte »Fahrnis«, wurde von den Gesandten am Wiener Hofe allerlei getuschelt, ohne daß man natürlich deren Mitteilungen auf ihre Wahrheit erproben könnte. Der päpstliche Nuntius Delfino hörte von einer »einflußreichen Person«, daß in einer Kassette mehr als fünfhunderttausend Dukaten enthalten seien. Aber eine »Zeitung« aus Wien vom 25. September meldete, der Schatz sei »leer« und das Angebot des Herzogs Cosimo von Florenz, Maximilian eine Million in Gold zu leihen, werde voraussichtlich angenommen werden. Der Vizekanzler Zasius spricht nur von »sehr vielen und stattlichen Kleinotern«, die Ferdinand hinterlassen habe. Sicher ist, daß Maximilian selber bis über die Ohren verschuldet war und auch Kaiser Ferdinand recht beträchtliche Rückstände hinterlassen hatte. Die aus den Feldzügen gegen die Türken erwachsenen Außenstände, die an das Kriegsvolk und an die Armeelieferanten zu bezahlen waren, betrugen allein dritthalb Millionen Gulden, in die sich die drei Brüder teilen mußten.
Die Erbteilung gestaltete sich überhaupt äußerst schwierig. Dies um so mehr, als Maximilian mit seinem Bruder Ferdinand keineswegs gut stand. Dieses Mißverhältnis äußert sich schon in dem fast vollständigen Fehlen eigenhändiger Schreiben. Nicht einmal jetzt, anläßlich des Todes ihres Vaters, vermochte sich Erzherzog Ferdinand zu einem Handschreiben an den kaiserlichen Bruder aufzuraffen, nur daß er diesmal das Bedürfnis empfand, sich deshalb zu entschuldigen. Er konnte nämlich, wie es in seinem Schreiben vom 27. Juli heißt, »aus Hertzenleid und Unmuet« nicht mit eigener Hand auf Maximilians Todesanzeige antworten. Er war es auch, der bei der »brüderlichen Vergleichung«, die ihr Vater angeordnet hatte, die größten Schwierigkeiten machte, so daß Maximilian, nachdem die von den drei Brüdern deputierten Räte, die ihre Aufgabe darin zu sehen glaubten, für ihre Herren so viel als möglich herauszuschlagen, sich nicht einigen konnten, den Vorschlag machte, die Sache persönlich in Linz zu ordnen. Dort ist denn auch am Dreikönigstag des Jahres 1566 »in engbrüderlichem Vertrauen« die Einigung zustande gekommen.
Nicht uninteressant ist, daß einmal gelegentlich dieser unbrüderlichen Auseinandersetzung der Brüder die Tiroler Finanzbehörde, die »Kammer«, das ganze Prinzip der Erbteilung als für den Bestand des Hauses Österreich höchst bedenklich erklärte. Dazu war es nun freilich zu spät; aber merkwürdig war es in der Tat, daß der Herrscher, der unentwegt auf die Größe seines Hauses bedacht war, die österreichischen Erblande in drei Teile zerschlug und so ihre Kraft nach außen hin lähmte. Maximilian erhielt außer den Königreichen Böhmen und Ungarn nur Österreich unter und ob der Enns, Ferdinand, des Kaisers Lieblingssohn, Tirol und die Vorlande, und der jüngste und geistig unbedeutendste, Karl, bekam die sogenannten innerösterreichischen Lande, das heißt also Steiermark, Kärnten, Krain, Görz, Triest und Istrien. Wohl war von Ferdinand bestimmt worden, die Brüder sollten sich gegenseitig derart unterstützen, daß es aussehe, als ob die Länder ungeteilt wären, aber das war eben nur ein frommer Wunsch – die Stoßkraft der Ostmark war durch die Erbteilung geschwächt worden, und das just in einem Augenblick, da der türkische Erbfeind der Christenheit wieder stärker an ihre Tore zu klopfen begann.
Unter den vielen ungelösten Aufgaben, die Kaiser Ferdinand seinem ältesten Sohne, dem »Vorgeher« der anderen, hinterließ, gehörten nicht zuletzt der Krieg gegen die Türken, der sich eben vorbereitete, die Ordnung der religiösen Angelegenheiten, die man trotz Trienter Konzil erwartete, und die Wahrung der inneren Sicherheit des Reiches, die durch den Ritter Grumbach ernstlich gefährdet erschien.