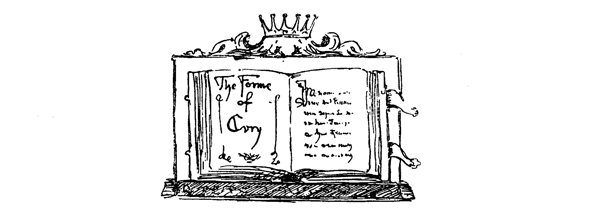|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Den Ureinwohnern des Britenreiches beschränkte der Mangel an Öl und Butter, ihre abergläubische Abneigung gegen Hasen, Gänse und Hühner sowie gegen Fische das Menü auf Hammel- und Rindfleisch, Milch und Kornfrüchte. Die Gastereien, die Hengist einst für König Vortigern anordnete, dürften nicht viel Üppiges geboten haben. Erst mit der Ankunft des leckermäuligen und trinkfrohen Dänen – wollte man doch sogar das englische Wort »gormandize« nicht von der französischen »gourmandise«, sondern vom Dänenkönig Gormund ableiten! – begannen bessere Zeiten, so daß Erasmus in seiner Chronik schon die »reichlichen und üppigen Tafeln« seiner Periode erwähnt. Wilhelm der Eroberer war nicht nur länderhungrig, sondern auch ein großer Feinschmecker, wie alle Normannen. Als ihm einst sein Lieblingsdiener – er hieß Fitz-Osberne – einen halbgaren Braten vorsetzte, hätte er ihn auf ein Haar mit der erwartungsvoll zum Mahle gehobenen Faust erschlagen. Der »dapifer« oder Haushofmeister, der »larderius« oder Speisenbewahrer wurden den normannischen Großen zugerechnet; es befanden sich sogar hohe Geistliche unter ihnen. Die Stellung der Küchenbeamten ist immer charakteristisch für die Speisenkultur eines Landes.
Die blutigen politischen Wirrnisse zu den Zeiten der Plantagenets scheinen vor der Schwelle des kulinarischen Heiligtums halt gemacht zu haben, denn aus der Zeit nach dem siegreich niedergeschlagenen Bauernaufstand unter Wat Tyler stammt das älteste bekannte englische Kochbuch.
Der Küchenmeister Richards II. sammelte etwa gegen 1390 eine Reihe von erprobten Rezepten, die den Sammeltitel: »The Forme of Cury« tragen. Das Manuskript hat interessante Schicksale durchgemacht. Wie aus einer lateinischen Nachschrift hervorgeht, hat ein Lord Stafford es 1586 der Königin Elisabeth überreicht. Später befand es sich im Besitz des Earl of Oxford, von dem es der berühmte Bibliophile James West erstand. Bei des letzteren Tode ging es in den Besitz des hochgelahrten Herrn Gustavus Brander über, der es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts seinem Freunde Pegge zur Herausgabe anvertraute. 1780 ist denn auch bei Nichols in London ein Nachdruck des kostbaren Manuskripts mit Einleitung und Randnoten von Herrn Pegge erschienen – und bald wieder vergessen worden. Ein Faksimile aus dem Original zeigt eine nicht einmal schwer zu lesende Handschrift gotischen Charakters von seltener Schönheit.
Diese »Rolle« altenglischer Kochkunst enthält des Interessanten mancherlei. Da gibt es Tiere, wie Reiher, Kranich, Seehund u. a., die wir nicht mehr essen; Gewürze und Kräuter, die höchstens noch in der Apotheke ein verstaubtes Dasein führen; eigenartige Saucen und fremde Näschereien. Da gibt es aber auch Rezepte, die in den Kochbüchern anderer Sprachen um die gleiche Zeit ganz genau so vorkommen und einen geheimnisvollen Zusammenhang aller mittelalterlichen Kochlöffel verraten. Z. B. »Tredura«, ein Fleisch- und Brotragout mit Safran, das ich in einem von Ludovico Frati herausgegebenen italienischen Kochbuch aus dem 14. Jahrhundert wiederfand. Ebenso kehrt das »Blancmanger«, bald »bramagere« oder »Blamensier« genannt, eine Süßspeise auf der Basis der Mandelmilch, der jedoch auch Fleischschaum zugesetzt wurde, von der Nürnberger »Küchenmaysterey« bis zu Antonin Carême wieder, und König Richard von England bekam zu seiner Weihnachtsgans eine Kräutertunke »Sawse madame«, die zur gleichen Zeit der Herr Obermundkoch Tirel dit Taillevent Karl V. von Frankreich zum Kapaunen servierte, und die er in seinem »Viandier« sorgsam aufgeschrieben hat.
Die »Forme of Cury« enthält zumeist Suppen, Breie und Ragouts, denn es war damals nicht Sitte, ganze Stücken Fleisch und Fisch zu servieren, noch durften die Gerichte allzu heiß aufgetragen werden, denn man aß mit den Fingern, so zierlich es eben ging. Ich habe in einem andern alten Kochbuch das Rezept zu einem Teig gefunden, der in Fladen neben den Gast gelegt wurde und sowohl zum Abwischen der Finger an Stelle einer Serviette, wie auch zum Formen eines ad hoc-Löffels diente, wie dies heute noch in China die Sitte ist. Erst später kamen, nach Vorbild der Küchenkellen, Eßlöffel auf, die auch als Gastgeschenk dienten und die Vorläufer unserer Patenlöffel geworden sind. Das Tranchieren bei der Tafel war ebenso unbekannt wie Messer und Gabel. Zum erstenmal wird der Bratenvorschneider – es war ein Lord Wylloughby – bei einem Gastmahl des Erzbischofs Néville m 15. Jahrhundert erwähnt, und 1508 druckte Wynken de Worde ein »Book of Kervinge«, das alle Einzelheiten der neuen Tranchierkunst festlegte. Von Gabeln weiß aber auch er noch nichts.
Zur Zeit Richard II. war in England der Käse wenig bekannt und die Butter selten. Olivenöl und Speck mußten letztere ersetzen. Starkgebrautes Ale war sowohl als Getränk wie als Speisenzusatz in Aufnahme gekommen, Rot- und Weißwein löschten den Durst und sogar deutscher Rheinwein fand seinen Weg in Alt-Englands Humpen. Als Süßwein wurde »vyne greke« verschenkt.
Gerade wie in Deutschland war auch in Albion der bunte Tand der vergoldeten, befiederten, maskierten Schaugerichte beliebt. Alkermessaft, Safran, Blumendecocte dienten zum Färben. Im übrigen finden wir auch hier die zwecklose Häufung von Würzen in einem Gericht, wie sie seit den Zeiten des Apicius die müden Zungen reizen sollten. Nelken, Pfeffer, Muskat, Paradieskerne, Korinthen, Zinnamom, Zimt, Galyngal (eine Cypruswurzel, die pulverisiert zu Galantinen verwendet wurde), Ingwer und allerlei fertig beim Gewürzkrämer zu erstehende Zusammensetzungen, wie »powder-douce«, »powder-forte«, »spykenard de spayn« fehlen nie. Mit dem aus Indien importierten Zucker wird viel Luxus getrieben, auch an Stellen, wo wir auf ihn verzichten würden.
Aber der Küchenmeister Richard II. verheißt nicht nur Recipes »für den genäschigsten aller christlichen Könige und die Meister der Arznei und Philosophie« an seinem Hofe, sondern gedenkt auch gütig der gemeinen Sterblichen. Er leitet den Reigen seiner Suppen mit einem Mus aus gedörrten, sauber gewaschenen Bohnen ein, zu dem derbe Stücken Speck gehörten. Feiner war schon ein Fleisch-stew, in das Borasch, Minze, Ochsenzunge, Petersilie, Atriplex, Eppich, Veilchen, Saftkraut und Fenchel gehackt wurden. Selbst Pilze, die damals noch den lateinischen Namen »funges« trugen, bekommen ihre Safrandouche, und Wildragouts ihre Streu von Zinnamom und Korinthen. Mehr sagen unserm Geschmack schon gewisse Quittenschnitte zu; die Früchte werden allerdings in Schmalz gesotten, dann aber mit Honig, rohem Eigelb und etwas Mandelmilch – natürlich auch mit powderfort und dem geliebten Safran – vermischt. Das mochte ganz gut schmecken, besser jedenfalls als Nieren mit Rosinen und gebratenen Zwiebeln, denen freilich eine scharfgewürzte Rotweinsauce erst die rechte Weihe verlieh. Die einst verpönten Hasen waren mit der steigenden Gaumenkultur recht beliebt geworden, besonders als Pasteten, die man zierlich in Teigwaffeln oder Ovalen anrichtete. Hühnchen, Schweinefilet, Kapaunen, Fasanen, Schwäne, auch Pfauen und Truthähne – mit oder ohne Federn aufgetragen – bilden die feinsten Gerichte, aber alles zerhackt, zerquirlt, zerkocht, zerstampft, in unkenntliche Gallerte verwandelt und mit einer abweichenden Sauce übergossen. Der »ganz neue« irdene Kochtopf spielte eine große Rolle; in seinem feuerfesten Rund behielten die Kräuter ihr Aroma, wurden Täubchen weich, Käsegebäcke knusprig, Pasteten saftreich. In der noch herdlosen Zeit vertrat der irdene, direkt in die Glut zu schiebende Topf, Bratofen und Papintopf, Weckapparat und Pfanne.
Und was hatten die Speisen für schöne Namen!
»Douce-Ame« bestand aus Milch, lieblichen Kräutern und passierten Kapaunenbrüsten, wobei es fraglich bleibt, ob mit dem Namen die sanften Seelen der Hahnenjünglinge gemeint waren. »Egurdouce« war eine pikantere Mischung. »Marmence« kann niemand mehr so recht übersetzen; es hängt – nach Chaucer – mit Schweinebauch zusammen, besteht jedoch aus dem dunkeln Fleisch der Fasanen mit gewürztem Wein, Pinienkernen, Ingwer und Nelken.
Im Salat kamen mehr Küchenkräuter vor, als heute ein Professor der Botanik kennt: Schnittlauch, Perlzwiebeln, große Zwiebeln, Borasch, Minze, Porree, Fenchel, Kresse, Raute, Rosmarin und noch ein halbes Dutzend andere. Von frischen Gemüsen waren Fenchel, Spinat und Bohnen die beliebtesten. Die zahlreichen Süßspeisen bestehen stets aus Mandeln, Korinthen, Eiweiß, Granatäpfeln, Reis und Honig als Grundelementen. Schlagsahne, wie in Alt-Italien, fand ich nirgends genannt. Die verschiedenfachen Eierspeisen liebte man – wohl eine Folge der vorgeschriebenen »mageren« Küchen an Freitagen – mit Fischen zu vermischen. Außer der oben erwähnten Sawse Madame, war eine Verde Sawse aus dem üblichen Grünzeug, Wein, Brot, Essig und Safran in Mode; endlich die »Sawse Noyre for Malard«, die man aber nicht als »Sauce noire pour malades« ansprechen darf. Denn dieser Sud aus in Blut und Essig gekochtem Brot mit Ingwer und Pfeffer war nicht etwa für Kranke bestimmt, sondern wurde zu einem gebratenen Erpel gereicht.
An einem schönen Septembertag des Jahres 1387 gab der Herzog von Lancaster im Palais Durham seinem Souverän ein Bankett, denn der »genäschige König« aß auch außer dem Hause gern gut. Zu einem Mahl, dessen Geber sich respektierte, gehörten dazumal drei »Gänge«, deren jeder ein vollständiges Diner umfaßte und sozusagen ein vereinigter Zoologischer Garten in der Pfanne war. Fasanen, Reiher, Schwäne, Tauben, Küken, Lerchen, Rebhühner, Spanferkel, Wildschweinsköpfe, Rehe, Pasteten und Galantinen wechselten endlos ab. Über den Gesundheitszustand der Geladenen am nächsten Tage berichtet der Chronist nichts.
Nicht viel anders liest sich die Speisenfolge des Prunkessens, das der Krönung Heinrich IV. zu Ehren nach Richards Sturz in Westminsterhall stattfand. Der dritte Gang enthielt – bei der soliden Grundlage durch die zwanzig Gerichte der ersten beiden Gänge konnte man das wagen, ohne die Gäste verhungern zu sehen – die Leckereien: »Blaundsorye«, eine gebundene Suppe in der Art der Blancmangers, Quitten- und Kaninchenpasteten, Singvögel, Äpfel- und andere Torten, Süßigkeiten und »Pottys of lylye« – wir würden »gemischtes Allerlei« sagen.
Auch legte man damals viel Wert auf die »Sotelde«, d. h. die Schaugerichte, die den Abschluß jedes Ganges bildeten. In ihnen steckte ein gutes Stück zeitgenössischer Geschichte. Aus Zucker, Pasten, Gélées bestehend, beflittert und bunt bemalt, stellten sie bald Wahlsprüche, bald Anspielungen auf Ereignisse dar oder wollten auch nur Tafeldekorationen bieten. Bei der Krönung der Gemahlin Heinrich V. bildete die »Sotelde« ein gepanzerter Ritter mit einem Tiger vor einem Spiegel, bei der Krönung Heinrich VI. ein königliches Wappenschild von Leoparden gehalten. Aber auch das gebratene Fleisch war wie ein Schild in rot-weiße Felder geteilt und mit goldenen Ovalen und Boraschblüten verziert, und zum Schluß wurde eine ganze Heiligenfamilie aus Gélée, Marzipan und sonstigen Näschereien aufgestellt.
Ein anderes Bankettmenü – ein Lord de la Grey ist der Gastgeber – muß wohl für einen »mageren Tag« bestimmt gewesen sein. Es besteht zumeist aus Fischen: gebackenen Heringen, großen Salzfischen, Lachs, Ellern in verschiedener Form, Rochen, Stör, Delphin, Lampreten, Schleien u. a. m. Der Bischof von Bath und Wells, John Stafford, hingegen legte wieder besonderen Nachdruck auf die Schaugerichte: ein Rechtsgelehrter, ein Adler und der heilige Andreas in Dragant schließen bei ihm die obligaten drei Gänge ab.
Man sieht, wie sich die englische Küche zusehends verfeinert. Bedeutend komplizierter als die »Forme of Cury« ist ein anderes Kochbuch aus den Jahren 1430-40. Es heißt »Two fifteenth-century Cookery-books« und ist erst 1888 von Mr. Thomas Austin in London veröffentlicht worden. Hatte man früher in Gewürzen geschwelgt, so wird nun förmlich darin verschwendet. Besonders der »Verjus«, ein französischer Traubenessig, kommt neu hinzu. Neben den Hachées erscheinen gebratene Rebhühner. Aber auch Walfisch, Delphin, Seehund, Möwen werden verzehrt. Der Pudding kommt auf. Gefüllte Kapaunen- oder Schwanenhälse gelten als besondere Delikatessen. Nichts, vom im Ganzen gesalzenen Ochsen bis zum kleinsten Singvogel, entging den hungrigen Kiefern. Und auch der König englischer Puddingkunst wird geboren: der weihnachtlich flammende Plumpudding, »Viande ardente« genannt.
Während sich bisher die meisten Gerichte nur durch etwas mehr oder weniger Flüssigkeit unterschieden, wurden nunmehr schon die Potages von den Bruets streng getrennt. Immer stärker herrschen französische Ausdrücke in der Weltküchensprache vor. Zugleich tauchen leichte graziöse Gerichte auf, von Erdbeeren und Kirschen – allerdings auch scharf gewürzt und mit Wein bereitet – und allerhand Blumenkonfitüren. Vanille kannte man noch nicht, und so wurden denn Veilchen, Zentifolien und Heckenrosen in Reismehl und Mandelmilch mit Honig und Zucker eingemacht. Ich fand sogar eine leibhaftige »Kaltschale« aus Mandelmilch und Wein. Die Crustaden bräunen sich lieblich, die Geflügel avancieren vom Napf zum Spieß, die Galantinen bestehen nicht mehr aus heterogenen Einzelheiten. Aber noch gibt es zwei Gebiete, auf denen logische Anarchie herrscht: die »Cawdels« oder Füllungen und die Tunken. Mandeln schmeckten gut; Küchengrün tats auch. Man warf wahllos beides zusammen und schüttete an Würzen hinein, was sich vorfand. Gans und Ferkel, Hammelkopf und Seezunge, Gemüse und Puddings wurden rücksichtslos damit gestopft. Mal paßte es, mal nicht. Die Tunken aber muten an, wie die Werke eines modernen Malers. Da werden Brotstücke mit Essig und Wein getränkt, durchgesiebt und mit Zimtpulver, Ingwer, Zucker, Gewürznelken und Safran gemischt (Sauce gamelyne) – oder Milch und Mehl mit Knoblauch, Pfeffer und Salz (sermstele) – oder Milch und Schwanenblut mit Gewürzen vermengt. Wieder andere Kräutersaucen würden unserem Geschmack schon eher zusagen, wenn nicht plötzlich auf unverständliche Weise Essig zur Butter, Rosinen zum Knoblauch, Zimt zur Kapaunenleber kämen, und wenn nicht ein Reis-Fischgericht mit Mandeln und Hummern mit Zucker zu bestreuen Vorschrift gewesen wäre.
Der »Forme of Cury« ist ein interessantes Heftchen beigegeben, das Ausgabebücher aus der Zeit Heinrichs VIII. reproduziert. Ein Sir John Nevil verheiratete seine Tochter; er notierte sich nicht nur die Ellen Damast und Hochzeitsbänder, den Ehering und die Hutkoffer, die Gürtel und die Mailänder Ärmel aus weißem Atlas, sondern auch die Auslagen für das Festessen, aus denen wir wiederum entnehmen können, was es gab. Drei Oxhofte Wein, zwei Ochsen, zwei Wildschweine, zwei Schwäne, neun Kraniche, sechzehn Reiher, sechzig Taubenpaare, Wildgeflügel, Kapaune, Schweine, Kälber, Lämmer, Widder, allein vier Dutzend Kücken: welche Hekatombe von Viehzeug für ein einziges Mahl! Die Reihe der Würzen, der Datteln, Biskuits, Konfitüren, Portugiesentorten usw. ist endlos. Bei der Hochzeit der zweiten Tochter entwarf Sir John das Menü selbst: da sollte es Schwanen, Mastkapaunen, Pasteten mit ganzen Kaninchen geben, eine Hirschkuh, Lebkuchen, Äpfel mit Käse, Zucker und Sago. Wir erfahren auch, wie sich dort der fromme Sir die Fastentage mit Lachs und Aal, Steinbutt und Stör, mit Lampreten und Butten nahrhaft ausgestaltete.
Um diese Zeit hub ein großes solides Schlemmen in Merry Old England an und Sir John Falstaff kann als sein symbolischer Vertreter gelten. Das Ale bekam einen unzertrennlichen Kumpan im Porter; kalter Sekt – der aber nicht mit unserem Schaumwein identisch, sondern Süßwein war – half dem heißen Magen die »pickled goods« ertragen.
Von allen Eingriffen, die Cromwell und seine Puritaner in englische Nationalfreuden getan, haben sich seine enthaltsamen Eßgesetze am wenigsten lange gehalten. Das feuchte Klima verlangte nach einem guten Tropfen und der gute Tropfen nach einem guten Bissen. Noch heute sind englische Festmähler viel umfangreicher und an ausgetiftelten Gerichten reicher als kontinentale, Rußland ausgenommen. Die großen englischen Fleischstücke vom Hammel, vom Ochsen, vom Schwein haben Weltruf erworben.
Erst der immer siegreicher vordringende Sport hat durch erzwungene Mäßigkeit im Essen die Vorliebe für starke Würzen zurückdrängen können, so daß die englische Kost des heutigen Tages uns fast zu salzlos erscheint.