
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Systeme des indischen Mittelalters, denen wir uns jetzt zuwenden, haben größtenteils zur selben Zeit -- vermutungsweise in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten -- ihre erste literarische Fixierung in der Form von größeren Aphorismenkomplexen gefunden. Diese Aphorismen, Sūtra genannt, sind als der erste Abschluß der Entwicklung der betreffenden Schule anzusehen; ihre Verfasser, von denen wir nichts als die Namen kennen, sind hervorragende Schulhäupter, welche, die Lehren der eigenen Schule gegen die anderen Schulen erfolgreich verteidigend, den Stoff in Sūtras fixierten, die in ihrer Kürze nur den notwendigsten Gedächtnisstoff bringen sollten, der dann durch mündliche Erklärungen vom Lehrer zu erläutern war, nachdem der Schüler die Sūtras auswendig gelernt hatte.
Solche Sūtras stehen am Anfang der Geschichte der beiden Systeme Nyāya und Vaiśeṣika, die schon in diesem Stadium eine gewisse Fühlung miteinander zeigen, indem sie sich in vieler Hinsicht ergänzen. Die Nyāyasūtras werden dem Akṣapāda zugeschrieben, der gewöhnlich nach seinem Geschlecht mit dem Namen »Gotama« bezeichnet wird. Zu den Sūtras besitzen wir einen alten Kommentar, dessen Verfasser gewöhnlich mit seinem Sippennamen »Vātsyāyana« (sein Personenname ist Pakṣilasvāmin) genannt wird und um 400 n. Chr. gelebt haben dürfte [R132]. Da dieser Kommentator Vorgänger gehabt zu haben scheint und den Sūtraverfasser Gotama als einen Weisen der Vorzeit betrachtet, so darf man ihn für ein bis zwei Jahrhunderte jünger halten als den von ihm erklärten Sūtratext. Für die Schulentwicklung, die dieser Text voraussetzt, und für die Gestaltung des Sūtratextes selbst, dem Gotama vielleicht nur die endgültige Form gab, wird man wiederum zwei Jahrhunderte ansetzen dürfen. Mehr als solche auf Schätzung beruhende Vermutungen lassen sich heute hinsichtlich des Alters der Nyāyasūtras nicht geben, zumal auch die in den Sūtras enthaltene Bekämpfung der Lehren der späteren Buddhisten (vgl. Kap. 9) bei der Unsicherheit darüber, wann der buddhistische Negativismus bzw. Idealismus feste Formen angenommen hat, die Datierung der Sūtras nicht sicherer zu gestalten vermag. Ebensowenig Klarheit besteht über die Zeit der Vaiśeṣikasūtras, welche dem Kaṇāda aus dem Kāśyapageschlecht zugeschrieben werden. Nach allgemeiner Annahme gehören sie in dieselbe Periode wie die Nyāyasūtras; ihre uns vorliegende Fassung scheint noch etwas älter zu sein als die letzterer.
Die Vaiśeṣikasūtras des Kaṇāda einerseits sowie die Nyāyasūtras des Gotama mit dem Kommentar (Bhāṣya) des Vātsyāyana andererseits stellen die älteste literarisch bezeugte Phase unserer beiden Systeme dar. Ihre Wesensverschiedenheit von den im ersten Teil betrachteten und in ihrer systematischen Form in den folgenden Kapiteln noch zu betrachtenden Systemen des Sāṃkhya, Yoga, Buddhismus und Vedānta liegt vor allem darin, daß sie nicht wie jene von Haus aus religiös-metaphysisch eingestellt sind. Das Vaiśeṣika sucht alles Erkennbare in den drei Kategorien der Substanz, Qualität und Bewegung zu fassen und die Beziehungen unter den drei weiteren Kategorien der Allgemeinheit, Besonderheit ( viśeṣa) und Inhärenz zu begreifen. Die Substanzen, deren es neun aufzählt: Erde, Wasser, Feuer, Luft, Aether, Zeit, Raum, Seele ( ātman) und Innenorgan ( manas), gehen in ihrer Gesamtheit auf kein einheitliches Prinzip zurück, wie es die Prakṛti des Sāṃkhya oder das Brahman des Vedānta bildet. Die ersten vier bestehen aus kleinsten unsichtbaren Teilen, den ewigen Atomen, die, unendlich an Zahl, alles Materielle letzten Grundes ausmachen, die übrigen fünf sind ewige Entitäten. Man darf daher wohl als ursprüngliche Quelle des Vaiśeṣika eine materialistische Richtung annehmen [R133], die sich jedoch den verbreitetsten transzendenten Lehren, wie der von der unsterblichen Seele, der Fortwirkung der Werke über das gegenwärtige Leben hinaus u. a. m., nicht verschloß. In den uns vorliegenden Sūtras freilich ist auch das orthodox-brahmanische Element eingehend berücksichtigt, so die Autorität des Veda, die durch religiöses Verdienst ( dharma) zu erlangende Erlösung als eigentlicher Zweck der Vaiśeṣikalehre (1, 1), sowie ritualistische und die Lebensordnung vom religiösen Standpunkt behandelnde Vorschriften (6, 1 und 2). Aber all das kann doch nicht die Tendenz des Ganzen verändern, die auf eine sachlich-realistische Ordnung des Weltbildes abzielt. Das zeigt schon der Name »Vaiśeṣika«, der, von der Kategorie der Besonderheit ( viśeṣa) abgeleitet, darauf deutet, daß man das Wesen der Dinge durch Aufzeigung ihrer Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten zu erfassen strebte, nicht aber durch Zurückführung auf ein transzendentes Prinzip [R134].
Das in diesem ältesten Vaiśeṣikadokument festgelegte Weltbild ist in allem Wesentlichen auch das der Nyāyasūtras, deren Hauptgesichtspunkt jedoch der dialektische ist. Seit sehr alten Zeiten hat die öffentliche Disputation in Indien eine große Rolle gespielt, so daß es wundernehmen kann, daß auf die seit langem geübte Praxis erst so spät die Theorie gefolgt ist [R135]. Der älteste Nyāya, den Vātsyāyana als »die Untersuchung eines Gegenstandes durch Erkenntnismittel« [R136] definiert und dessen höchste Form er in der fünfgliederigen Demonstration des logischen Schlusses findet, wird am leichtesten in seinem Wesen erkannt werden, wenn man seine sechzehn Kategorien überblickt. Während die erste Kategorie ( pramāṇa) die vier rechten Erkenntnisarten oder Mittel zur richtigen Erkenntnis [R137] (sinnliche Wahrnehmung, logische Schlußfolgerung, Analogieschluß und sprachliche Ueberlieferung) umfaßt, bringt die zweite unter dem Titel » Objekt richtiger Erkenntnis« ( prameya) alles, womit sich das Vaiśeṣika befaßt, nämlich Seele, Leib, die fünf Sinnesvermögen, die fünf Elemente und ihre Qualitäten, Erkenntnis, Manas, Aktivität, Fehler (nämlich Leidenschaften usw.), Seelenwanderung, Frucht der Werke, Leid und Erlösung. Die übrigen vierzehn Kategorien sind entweder logischen oder rein dialektischen Charakters, wobei die Logik nicht wie später nur um ihrer selbst willen, sondern mit besonderer Rücksicht auf ihre praktische Verwendbarkeit im Redekampfe betrachtet wird. Zuerst wird da der Zweifel ( saṃśaya) genannt, der aller Argumentation zugrunde liegt; ferner das Motiv ( prayojana), das darin besteht, daß man eine Sache zu haben oder zu vermeiden wünscht, der Beleg ( dṛṣṭānta), d. h. etwas, worüber alle einig sind; die Lehre oder der Lehrsatz ( siddhānta), welcher Sonderbesitz einer Schule oder Gemeinbesitz aller Schulen usw. sein kann; die fünf Glieder ( avayava), in denen die Schlußfolgerung demonstriert wird, die sowohl im Sūtra als bei Vātsyāyana noch ziemlich primitiv ist und erst in der folgenden Phase des Systems das rechte Verständnis erfährt, um dann durch die Jahrhunderte den Mittelpunkt alles Interesses zu bilden; der Absurditätsbeweis ( tarka) der Gegenbehauptung, welcher die eigene Ansicht sichert; die Gewißheit ( nirṇaya), welche aus der gründlichen Erwägung entgegengesetzter Standpunkte entsteht; ferner die drei Kategorien bildenden drei Arten der Diskussion: die auf die Feststellung der Sache allein gerichtete ( vāda), die nur auf den Triumph des einen Redners über den anderen abzielende ( jalpa) und die nur mit Schikanen zur Ruinierung des Gegners geführte ( vitaṇḍā). Es folgt dann die auch in der späteren Logik eine wichtige Rolle spielende Kategorie der Scheingründe ( hetvābhāsa), deren fünf von Vātsyāyana eingehend erklärte Arten sich nicht restlos mit den Formen der späteren Theorie decken. Den Beschluß machen neben der Verdrehung ( chala) die wertlosen Einwände ( jāti) und die schwachen Punkte ( nigrahasthāna), deren zahlreiche Unterabteilungen wegen ihres dialektischen Interesses den Gegenstand eines besonderen Kapitels bilden.
Mit dieser andeutenden Charakterisierung der beiden Sūtrasammlungen müssen wir uns hier begnügen, da eine vollständige Inhaltsangabe des beschränkten Raumes wegen nicht möglich ist. Diese notgedrungene Unterlassung wirkt deshalb nicht so schwer, weil die nachfolgende Darstellung des vollendeten Systems den wesentlichen Inhalt des alten Vaiśeṣika, wenn auch in etwas fortgebildeter Form, deutlich machen wird, während ebenda vom Nyāya das erkenntnistheoretisch und logisch Wichtigste gezeigt werden soll.
Auch die auf die älteste Phase folgenden Entwicklungsstufen, die sich über viele Jahrhunderte ausdehnen, können hier nur gestreift werden. Der wichtigste Punkt liegt hier in der Fortbildung des Vaiśeṣika durch Praśastapāda, der als der erste wirklich systematische Autor des Vaiśeṣika betrachtet werden muß, denn ihm ist die Einordnung des gesamten Materials unter die sechs Kategorien gelungen, während die Vaiśeṣikasūtras des Kaṇāda trotz der Konzeption der Kategorien den Eindruck noch nicht abschließend bewältigter Gedankenmassen machen. So ist hier -- ein im indischen Mittelalter nicht gewöhnlicher Vorgang -- die Fortbildung des Systems nicht durch einen Kommentar zu den Sūtras erfolgt, sondern durch ein Werk, das nur lose an die Sūtras anknüpft, um das System ganz selbständig aufzubauen; daher lautet der Name auch nicht »Kommentar zu den Sūtras«, sondern »Kommentar zu den sechs Kategorien Substanz usw.« (Dravyādiṣaṭpadārthabhāṣya). Daß ein solcher Autor das System auch mannigfach ausgestaltet hat, versteht sich von selbst. Von besonderem Interesse ist der große Fortschritt, den er durch die Vertiefung des Schlußverständnisses nicht nur gegenüber den beiden Sūtrasammlungen, sondern auch gegenüber Vātsyāyana gemacht hat. Dieser Fortschritt besteht, kurz gesagt, darin, daß man in der alten Phase des Systems die Schlußfolgerung auf einer erschöpfenden Aufzählung der tatsächlichen Beziehungen zwischen Grund und Folge zu basieren suchte, während Praśastapāda statt dessen die allgemeine Regel des ständigen Zusammengehens ( sāhacarya) von Grund und Folge einführte. Hätte Vātsyāyana diese prinzipielle Neuerung gekannt, so hätte er wohl kaum umhin gekonnt, sie zu berücksichtigen [R138]. Da das nicht der Fall ist, darf man annehmen, daß Praśastapāda später als Vātsyāyana gelebt hat.
Ob aber Praśastapāda selbst der Entdecker dieses neuen Gedankens war, ist eine andere Frage. In bestechender Weise ist dafür argumentiert worden [R139], daß der große buddhistische Philosoph Dignāga (vielleicht 5. Jahrhundert) der Entdecker und Praśastapāda nur der Entlehner sei. Solange Dignāgas Werke, deren Sanskritoriginale verloren gegangen und nur in tibetischer Uebersetzung erhalten sind [R140], nicht herausgegeben und gründlich durchforscht sind, kann Sicheres hier nicht gesagt werden, da Parallelentwicklung bei brahmanischen und buddhistischen Denkern möglich bleibt. Im Entlehnungsfalle müßte Praśastapāda natürlich später als Dignāga sein. Jedenfalls hat Dignāga, der in verschiedener Hinsicht bedeutende Fortschritte in der Logik gegenüber der ersten Phase unserer Systeme aufweist, den Vātsyāyana angegriffen; darauf hat der Uddyotakara (Beiname: der Erklärer) aus dem Bharadvājageschlecht (etwa im 6. Jahrhundert) [R141] in seinem Nyāyavārtika, in welchem er Vātsyāyana erklären und rechtfertigen wollte, geantwortet, wogegen wiederum der berühmte Vertreter der buddhistischen Erkenntnistheorie im 7. Jahrhundert, Dharmakīrti (vgl. Kap. 9) geschrieben hat. Mitte des neunten Jahrhunderts hat dann Vācaspatimiśra eine große Erklärungsschrift zu Uddyotakaras Werk verfaßt. Vācaspatimiśra ist einer der scharfsinnigsten und sicher der vielseitigste aller indischen Kommentatoren, da er mit erstaunlicher Anpassungsfähigkeit fast zu jedem brahmanischen System ein vorzügliches erklärendes Werk produziert hat; in diesem Buche werden wir ihm noch als Interpreten des Sāṃkhya und des Yoga begegnen. Im 10. Jahrhundert lebte Udayana, berühmt vor allem durch sein Werk über die Gottesbeweise [R142] und Verfasser weiterer wichtigen Schriften, in denen Nyāya und Vaiśeṣika schon ganz verschmolzen erscheinen. In seiner Zeit wurde auch von Śrīdhara ein neuer Kommentar zum Werke des Praśastapāda verfaßt. Noch einmal im 12. Jahrhundert tritt ein Denker ersten Ranges hervor: Gangeśa mit seinem Werke »Tattvacintāmaṇi«, in welchem der in Jahrhunderte langen geistigen Kämpfen mit den Buddhisten aufs feinste geschliffene Nyāya seine höchste Vollendung erreichte. Die Kommentare zu Gangeśas Werk führten zwar die Lehre im ganzen nicht mehr weiter, entwickelten aber in der Ausgestaltung des einzelnen einen Scharfsinn, dessen Resultate wegen ihrer außerordentlichen Schwierigkeit noch nicht zu der Würdigung durch die moderne Forschung gekommen sind, die sie vom Standpunkt der technischen Logik verdienen dürften [R143].
Die an Umfang gewaltige und an Schwierigkeiten überreiche Literatur des Nyāya und Vaiśeṣika rief seit dem 11. Jahrhundert die Komposition von Werken hervor, welche das für den Anfänger Wichtigste zusammenzufassen sich zur Aufgabe machten. Wir nennen hier nur Keśavamiśra mit seiner Tarkābhāṣā im 13. Jahrhundert, Annambhaṭṭa (Anfang des 17. Jahrhunderts) mit seinem einfachen Tarkasaṃgraha, dem der Verfasser selbst in dem Kommentar (Dīpikā) eine Andeutung der schweren Probleme hinzufügte, und Viśvanātha (17. Jahrhundert), dessen Memorialverse, Kārikāvalī oder Bhāṣāpariccheda genannt, von einer kurzen und daher nicht immer leicht verständlichen Darstellung der schwierigen Probleme (Siddhāntamuktāvalī) begleitet sind.
Auf diese zusammenfassenden Lehrbücher, besonders auf das Werk Viśvanāthas, stützt sich die folgende Skizze des vollendeten Nyāya-Vaiśeṣikasystems.
Das vollendete System [R144] hat die Kategorien des Vaiśeṣikasystems angenommen, um mit deren Hilfe alles zu umfassen, was unter die Wechselbegriffe der Benennbarkeit und Erkennbarkeit fällt. Die Rolle, die damit der Benennbarkeit zufällt, zeigt schon, daß die Konzeption des Kategorienbegriffs von der Betrachtung der sprachlichen Verhältnisse ausgegangen ist. Das wird bestätigt durch das Sanskritwort, welches durch »Kategorie« wiedergegeben werden soll: padārtha, wörtlich Gegenstand oder Sinn eines Wortes. Die Zahl der schließlich anerkannten Kategorien ist sieben: Substanz ( dravya), Qualität ( guṇa), Bewegung ( karman), Allgemeinbegriff ( sāmānya), Besonderheit ( viśeṣa), Inhärenz ( samavāya) und Nichtsein oder Negation ( abhāva). Die ersten sechs wurden schon von den Vaiśeṣikasūtras anerkannt, aber nur die ersten drei sind ihnen objektive Realitäten, während die beiden folgenden nur als Anschauungsweisen ( buddhyapekṣa) angesehen wurden und Inhärenz als die Beziehung von Ursache und Wirkung galt. Das Nichtsein endlich ist erst viel später zur Dignität einer Kategorie aufgerückt. Einen Reflex dieser Verhältnisse erkennen wir noch in der Einteilung der sieben Kategorien im vollendeten System: Substanz, Qualität und Bewegung fallen unter den gemeinsamen Oberbegriff »Existenz« ( sattā); die ersten sechs werden unter dem Begriff »Sein« ( bhāva) der siebenten Kategorie, dem »Nichtsein« ( abhāva), gegenübergestellt. Daß sich die Vaiśeṣikakategorien gegenüber den Kategorien des Nyāya im vollendeten System durchgesetzt haben, liegt in der Natur der Sache, denn die sechzehn Kategorien, mit denen uns das erste Buch der Nyāyasūtras bekannt macht, verdienen den Namen Kategorien eigentlich nicht, sie sind größtenteils mehr Kapitelüberschriften eines Lehrbuchs der Logik und Dialektik.
Wir wenden uns nun der Besprechung der einzelnen Kategorien zu, indem wir im wesentlichen der indischen Anordnung folgen, um damit gleichzeitig dem Leser ein Bild der eigentümlichen Darstellungsart zu vermitteln. Daß dabei Begriffe, die erst später erklärt werden, gebraucht werden müssen, wird kaum Schwierigkeiten bereiten.
Die Definition des Substanzbegriffes bietet bekanntlich so außerordentliche Schwierigkeiten, daß man die Stellungnahme einer indischen Schule, die ihn als undefinierbar erklärte, um ihn nicht aufgeben zu müssen, sehr begreiflich finden wird. Unser System hat sich dadurch nicht abschrecken lassen, sondern auf dreifache Weise versucht, die Aufgabe zu lösen. Erstens heißt es formal, daß Substanz das ist, was unter den Begriff der Substanzialität fällt. Sachlich führt die zweite Definition weiter: »Substanz ist Grundlage für Qualitäten.« Diese Definition ist zwar nicht ganz einwandfrei, denn nach unserm System ist ein Ding im Augenblick seines Entstehens qualitätlos, aber abgesehen von diesem Einzelpunkte, der überdies bei ewigen Substanzen nicht in Betracht kommt, leistet sie gute Dienste. Die dritte Form endlich erfüllt alle Bedingungen: »Substanz ist die inhärente Ursache ihres Produkts«, wobei man nicht nur an Materielles (z. B. an den irdenen Krug als Produkt des Lehms) sondern auch an Spirituelles (z. B. Erkenntnis als Produkt der Seele) zu denken hat.
Aus dem Gesagten folgt schon, daß die zweite Kategorie »Qualität« ihrem Wesen nach untrennbar mit der Kategorie »Substanz« verbunden ist, d. h. die Qualitäten inhärieren den Substanzen; und zwar inhärieren sie teils nur bestimmten Substanzen (in diesem Falle heißen sie »Spezialqualitäten«, viśeṣaguṇa), teils können sie mehreren oder allen Substanzen zukommen (Allgemeinqualitäten). Ihre Gesamtzahl beträgt im vollendeten System 24, während die Vaiśeṣikasūtras nur 17 annehmen.
Auch die dritte Kategorie »Bewegung« ( karman, wörtlich Tätigkeit) steht in engster Beziehung zu den Substanzen, denen sie freilich nicht in dem Maße wie die Qualitäten wesentlich ist, da sie der Substanz nur gelegentlich und vorübergehend inhäriert. Für einige Allgemeinqualitäten (Verbindung, Trennung, Geschwindigkeit) kann Bewegung Ursache sein.
Es werden neun Substanzen angenommen: 1. Erde, 2. Wasser, 3. Feuer, 4. Luft, 5. Aether, 6. Zeit, 7. Raum, 8. Seele, 9. Manas. Die ersten fünf werden auch Elemente ( bhūta) genannt. Die ersten vier gehören in gewissem Sinne zusammen, da für sie die sogleich zu erörternde Atomtheorie gilt. Jedes dieser vier Elemente ist Träger einer spezifischen Qualität: das Element Erde besitzt Geruch nebst Anschmiegsamkeit und natürlicher Flüssigkeit, das Feuer (das auch das Licht umfaßt) Farbe, die Luft Fühlbarkeit. Erde (z. B. als Butter) und Feuer (z. B. als Gold) besitzen künstliche Flüssigkeit, d. h. sie können durch Einwirkung von Hitze flüssig werden. Die ersten vier Elemente erscheinen in drei verschiedenen Formen, nämlich als Körper, Sinnesvermögen und Objekt. Hinsichtlich des Erdelements handelt es sich dabei um die Körper aller lebenden Wesen einschließlich der Pflanzen, um das Sinnesvermögen des Riechens, das in der Nase lokalisiert ist, und um das Objektsein der ganzen anorganischen Natur, soweit sie auf das Erdelement zurückgeführt wird. Entsprechend werden die Erscheinungsformen von Wasser, Feuer und Luft erörtert; die Körper, die aus diesen Elementen bestehen, existieren in den fabelhaften Welten des Wassergottes, Feuergottes und Windgottes.
Die genannten vier Elemente liegen nun in Atomform allem Zusammengesetzten zugrunde. Die Erdatome, die Feueratome und die Luftatome sind ewig, d. h. ohne Entstehen und Vergehen, aber ihre Aggregate sind vergänglich. Hierin liegt schon, daß die Atomlehre unseres Systems auf die Analyse des Zusammengesetzten zurückgeht. Um nicht dem logischen Fehler des regressus in infinitum ( anavasthā) zu verfallen, muß man einen Haltepunkt annehmen, über den hinaus nicht mehr zerlegt wird. Denn bei Fortsetzung der Zerlegung ins Unendliche würde zwischen dem größten Berge und dem kleinsten Senfkorn kein Unterschied mehr sein, da sich bei beiden die gleiche Unendlichkeit der Teile ergeben würde. Der somit notwendige Haltepunkt ist das absolut Kleine, das Atom, paramāṇu, wörtlich das Winzigste. Der Begriff wird im Vaiśeṣika- und Nyāyasūtra bereits als bekannt vorausgesetzt und ist uns schon bei den Jinisten begegnet. Eine gewisse Entwicklung seit jenen Zeiten läßt sich erkennen [R145], auf die einzugehen wir uns hier versagen, um nur den Standpunkt des vollendeten Systems kurz zu skizzieren.
Hiernach werden die sichtbaren Dinge nicht direkt aus den ewigen unsichtbaren Atomen, denen übrigens gewisse Qualitäten eignen, aufgebaut, sondern die unteilbaren Atome bilden zuerst Doppelatome ( dvyaṇuka), die auch noch unsichtbar klein sind, und erst aus der Kombination dreier Doppelatome entstehen die kleinsten sichtbaren Teilchen, deren Symbol die Stäubchen im Sonnenstrahl sind. Zur Begründung dieses komplizierten Aufbaus weisen unsere Texte darauf hin, daß Kleinheit und Größe, welche, technisch gesprochen, die Qualität »Ausdehnung« bilden, im Falle der Atome nicht grad-, sondern artverschieden sind, daß also die sonst in unserem System geltende Regel »die Qualitäten des Produkts sind aus den Qualitäten der Ursache abzuleiten« eine Ausnahme erleidet. Daher würde Hinzufügung von Winzigem zu Winzigem nur die Winzigkeit steigern, weshalb die Zahl eintreten muß, um den Abgrund, der zwischen »winzig« ( aṇu) und »groß« ( mahat) klafft, zu überwinden. Zahl aber bedarf eines Intellekts, in dem sie vorgestellt wird, und da es sich hier um die Wahrnehmung aller Atome handelt, was Allwissenheit erfordert, so kommt nur der Intellekt Gottes in Frage. Die Einschiebung der Doppelatome, welche für die angedeutete Theorie nicht unbedingt erforderlich sind, scheint sich historisch daraus zu erklären, daß man entsprechend der Zweiteilung der großen Dinge in ewige (z. B. Aether) und vergängliche auch die kleinen in ewige, d. h. Atome, und nicht ewige, d. h. auflösbare Doppelatome, einzuteilen für wünschenswert hielt. Die Atomtheorie ist auch von Wichtigkeit für die Lehre von dem ewigen Zyklus der Weltauflösungen und Weltrekonstruktionen, die unser System in Uebereinstimmung mit fast allen anderen Schulen lehrt. Der Wille Gottes und die unsichtbare Macht der Tatwirkungen der einzelnen Seelen bewirken sowohl zu gewissen Zeiten die Auflösung alles Aggregierten in seine ewigen Atome wie zu anderen Zeiten den Neuaufbau des Ganzen durch erneute Vereinigung der Atome.
Während also die ersten vier Substanzen: Erde, Wasser, Feuer, Luft in ihrer Atomform ewig, in ihrer Aggregatform vergänglich sind, sind die folgenden fünf: Aether, Zeit, Raum, Seele, Manas immer ewig. Mit Ausnahme des Manas, dem Atomkleinheit zugeschrieben wird, sind sie von unendlicher Größe ( paramamahat) oder allverbreitet. Aether, Zeit und Raum sind außerdem einheitlich, während der Seelen nebst dem zu jeder gehörigen Manas unendlich viele sind [R146]. Andererseits hat der Aether auch Gemeinsames mit den ersten vier Substanzen, indem er wie sie als Element ( bhūta) angesehen wird, weil nämlich seine Spezialqualität, der Ton, mittels eines äußeren Sinnes (Gehör) wahrgenommen wird, wie der Geruch bei der Erde durch das Riechvermögen und entsprechend der Geschmack bei Wasser, die Farbe bei Feuer, die Berührung bei Luft. Selbst sinnlich wahrnehmbar ist der Aether freilich nicht; daher muß er aus seiner Spezialqualität, die er mit keiner anderen Substanz teilt, erschlossen werden. Der Beweis für seine Existenz liegt darin, daß der Ton, der als Qualität eines Substrates bedarf, keiner anderen Substanz angehören kann, wie die Texte ausführlich darlegen.
Aus dem Aether ist das feinmaterielle Vermögen ( indriya) für die Wahrnehmung des Tons gebildet wie aus den Atomen der Erde usw. die Vermögen für die Wahrnehmung des Geruchs usw. Da er aber im Gegensatz zu den vier ersten Substanzen einheitlich ist, so bildet der die Ohrhöhlung erfüllende Aether, mit dem man hört, nur einen Teil des ganzen allverbreiteten Aethers. Daher kann der Hörsinn nicht wie z. B. der Geruchsinn zu seinem Objekt hingehen, sondern der Ton muß sich durch den Aether zu dem im Ohre abgegrenzten Aetherteil hinbegeben, und zwar geschieht dies auf folgende Weise. Der durch das Schlagen einer Trommel oder das Zerbrechen eines Bambus erzeugte Ton geht nicht direkt zum Ohre, denn die Qualität Ton hat nur momentanen Bestand. Die Lehre der späteren Buddhisten von der Momentanheit alles Gegebenen (vgl. Kap. 9) spielt in unserem System nur für gewisse Qualitäten und für Bewegung eine Rolle. Jeder Ton hat nur drei Momente: einen Moment des Entstehens, einen des Bestehens und einen des Vergehens. Im letzten Moment erzeugt der vorhergehende Ton seinen Fortsetzer, so daß also nicht der ursprüngliche Ton, sondern nur einer seiner Nachkommen das Ohr erreicht. Die Fortpflanzung der Tonreihe vom Ursprungsort wird entweder als in einer Richtung gehend aufgefaßt und mit den Meereswellen verglichen oder als nach allen Seiten gleichzeitig auseinandergehend wie die Blätter einer aufbrechenden Blüte. Neben den unartikulierten Tönen der Trommel usw. gehören auch die artikulierten Laute der Sprache zur Qualität Ton; ihre Erörterung soll uns später bei der Sprachphilosophie beschäftigen.
Ueber Zeit und Raum hat unser System wenig Wichtiges zu sagen. Sie gelten als ewig einheitliche Realitäten, die allen unseren zeitlichen und räumlichen Ausdrücken und Begriffen zugrunde liegen. Die Einteilung der an sich einheitlichen Zeit wird durch die Sonnenbewegung bewirkt.
Wir wenden uns zur achten Substanz, der Seele ( ātman), unter welchem Begriff in den meisten Texten des vollendeten Systems sowohl die Menschenseele als auch Gott gefaßt wird.
Die menschliche Seele ist nach verschiedenen Texten unseres Systems bald durch innere Wahrnehmung direkt erfaßbar, bald nicht direkt wahrnehmbar, sondern nur erschließbar. Sofern sie erschlossen oder durch Schlußfolgerung demonstriert wird, was auch bei Annahme direkter Wahrnehmbarkeit gegenüber solchen Schulen notwendig ist, welche entweder die Seele leugnen oder sie unrichtig auffassen, kommen wesentlich zwei Wege in Betracht. Erstens: Wie ein materielles Werkzeug, z. B. eine Axt, zur Wirksamkeit einen Handhaber voraussetzt, so erfordern auch die Sinnesorgane zu ihrer Wirksamkeit einen Agens, und das ist die Seele. In demselben Sinne wird das alte Gleichnis vom Wagen verwendet: der Leib als Wagen mit den Sinnen als den ziehenden Rossen fordert einen Lenker. Zweitens geht man von speziellen Qualitäten aus, die eines Substrates bedürfen, das durch keine der acht andern Substanzen, also nur durch die Seele gebildet werden kann.
Daß es unendlich viele Seelen geben muß und nicht etwa nur eine, beweist die Verschiedenheit der Erfahrung und des Wollens bei den einzelnen Menschen. Die Ewigkeit der Seelen folgt aus der Anfanglosigkeit der Seelenwanderung, welche z. B. durch die unbewußt zweckmäßige und daher auf frühere Erfahrung zurückweisende Handlung des nach der Mutterbrust greifenden Säuglings evident ist. Indem ferner bewiesen wird, daß die Seele weder atomklein sein kann, wie z. B. Rāmānuja und Madhva in ihren viṣṇuitischen Vedāntassystemen lehren, noch von mittlerem Umfang entsprechend dem Körper, den sie gerade erfüllt, wie die Jinisten meinen, ergibt sich ihre unendliche Größe (Allgegenwart), die aber nicht, wie man vielleicht einwenden könnte, Allwissenheit zur Folge hat, da jede Seele nur mit Hilfe des ihr zugeordneten einzelnen Manas erkennen kann.
Den vielen menschlichen Seelen, deren Erkenntnis beschränkt, vorübergehend und relativ ist, steht im vollendeten System die göttliche Seele in ewiger absoluter Allwissenheit gegenüber. In den Nyāyasūtras wird die Gottesidee noch nicht gelehrt, aber auch nicht bekämpft, weswegen Jacobi [R147] ansprechend vermutet, daß der Gottesglaube dem Empfinden des einzelnen anheimgestellt war; ebenfalls fehlt die Lehre von Gott höchstwahrscheinlich in den Vaiśeṣikasūtras. Erst im Laufe der Entwicklung der Systeme tritt sie deutlich hervor, um seit Udayanas Hauptwerk (10. Jahrhundert), das den Beweisen für das Dasein Gottes gewidmet ist, einen Kardinalpunkt unseres Systems zu bilden. Freilich ist die Rolle Gottes durch die Natur des Systems selbst sehr beschränkt. Die Atome sind ewig, können also nicht von Gott geschaffen werden, sondern erhalten von seinem Willen nur den Antrieb zur Vereinigung bzw. Trennung bei Weltaufbau bzw. Weltvernichtung, und das Schicksal der ja ebenfalls ewigen Menschenseelen regelt sich automatisch durch die unsichtbare Macht der guten und schlechten Werke, so daß Gott hier höchstens der intelligente Aufseher dieses mechanisch ablaufenden Prozesses sein kann. Die wahre Bedeutung Gottes aber liegt für die Anhänger des Nyāya-Vaiśeṣika als Śivaverehrer auf religiösem Gebiet, also außerhalb des eigentlichen Systems, und kann daher hier nicht weiter verfolgt werden.
Die menschliche Seele hat acht spezielle Qualitäten: Erkenntnis, Lust und Leid, Begierde und Abneigung, Wollen, die unsichtbare Macht der Werke und Eindruck. Der Zusammenhang dieser Qualitäten ist seit der Sūtrazeit klar empfunden worden. Das Motiv alles menschlichen Handelns ist, Lust zu erlangen und Leid zu vermeiden, und dies setzt Erkenntnis voraus. Hat man erkannt, daß etwas Lust oder Lust verschaffend bzw. Leid oder Leid verschaffend ist, dann entsteht Begierde danach bzw. Abneigung dagegen, und demgemäß gestaltet sich das Wollen, welches die Handlung auslöst. Ist diese moralisch gut oder rituell verdienstlich bzw. schlecht oder schuldhaft, so empfängt die Seele einen Eindruck, aus dem kraft der unsichtbaren Macht ( adṛṣṭa) der Werkwirkung gute bzw. schlechte Folgen nach dem Tode entstehen. Aber auch die beste Werkwirkung führt höchstens zu himmlischer Lust, die auch nicht ewig ist. Aus der ununterbrochenen Kette der Wiedergeburten löst nur die rechte philosophische Erkenntnis, welche, Begierde und Abneigung aufhebend und damit die Erzeugung neuer unsichtbarer Macht verhindernd, zu dauernder Freiheit vom Leiden führt. Diese seit den Sūtras feststehenden Gedanken treten in den systematischen Darstellungen immer mehr hinter dem rein wissenschaftlichen Teil des Systems zurück.
Wir kommen zur neunten Substanz, dem Manas oder Innenorgan. Jeder Seele ist ein Manas zugeordnet, welches sie auf ihrer Wanderung von Geburt zu Geburt begleitet und ihren Verkehr mit der Außenwelt dadurch ermöglicht, daß es zwischen ihr und den Sinnesvermögen, welche die Außenwelt erfassen, die Vermittlerrolle spielt. Bei innerer Wahrnehmung wirkt das Manas nicht vermittelnd, sondern selbst als Organ. Seine Atomkleinheit ergibt sich daraus, daß es nicht mit mehreren, sondern nur mit einem Sinne in einem Augenblick verbunden sein kann. Die scheinbare Gleichzeitigkeit mehrerer Wahrnehmungen beruht auf der Geschwindigkeit, mit der das Manas von einem Sinn zum andern überzugehen vermag. Die hier erwähnte Qualität »Geschwindigkeit« kommt auch noch den ersten vier Substanzen zu.
Damit haben wir die neun Substanzen nebst den meisten Qualitäten kennen gelernt. Der Vollständigkeit wegen seien hier noch sämtliche vierundzwanzig Qualitäten aufgezählt: 1. Farbe, 2. Geschmack, 3. Geruch, 4. Fühlbarkeit, 5. Zahl, 6. Ausdehnung, 7. Unabhängigkeit, 8. Verbindung, 9. Trennung, 10. Ferne, 11. Nähe, 12. Erkenntnis, 13. Lust, 14. Schmerz oder Leid, 15. Begierde oder Wunsch, 16. Abneigung, 17. Energie oder Wollen, 18. Schwere, 19. Flüssigkeit, 20. Anschmiegsamkeit, 21. Disposition, 22. Verdienst, 23. Schuld, 24. Laut.
Unter den noch nicht besprochenen verdienen noch Zahl, Verbindung und Trennung eine kurze Betrachtung. Zahl gehört zur Gruppe der allgemeinen Qualitäten, die allen Substanzen eignen. Bei der Zahl ist zu unterscheiden zwischen der Einheit, die eine objektive Realität ist, und der Mehrheit, die nach der vorwiegenden Ansicht der Texte (Vaiśeṣikarichtung) Produkt unseres Denkens ist. Einheit ist ewige Qualität bei unzusammengesetzten Substanzen (z. B. beim Aether), vergängliche Qualität bei Aggregaten. Mehrheit dagegen ist als ein Produziertes niemals ewig. Sie baut sich aus Einheiten auf: zwei Gegenstände z. B. nehmen wir zuerst mittelst unterscheidender Erkenntnis ( apekṣābuddhi) einzeln wahr, um daraus die Zweiheitsvorstellung zu bilden. Alle Zahlenbegriffe über eins sind also Produkte unseres Denkens, welche aus Einheiten gebildet sind wie alle materiellen Dinge aus Atomen; und wie erst die Verdreifachung des Doppelatoms eine wahrnehmbare Größe ergibt, so wird auch erst die Dreiheit als Vielheit betrachtet. In diesem Zusammenhang sei an die schon erwähnte Bedeutung des göttlichen Denkens für die Atomaggregierungen bei der Weltentstehung erinnert.
Verbindung ist der Kontakt zweier Dinge, welche vorher getrennt waren. Zwischen zwei allverbreiteten Substanzen kann also die Qualität »Verbindung« nicht bestehen, da ihnen Bewegung nicht zukommen kann. Dieser Gedanke wird z. B. zur Begründung der Atomkleinheit des Manas verwendet; wäre es von unbegrenzter Ausdehnung wie die Seele, so könnte es keine Bewegung und daher keinen Kontakt mit ihr haben. Da Verbindung immer erzeugt sein muß, kann sie nie ewig sein. In der technischen Sprache unseres Systems wird »Verbindung« ( saṃyoga) als Qualität scharf von der Kategorie »Inhärenz« ( samavāya) und dem durch keine Definition belasteten Ausdruck »Beziehung« ( sambandha) unterschieden. Trennung ist nicht einfach die Abwesenheit von Verbindung, sondern die Zerstörung einer vorhandenen Verbindung. Genau genommen müßte man »Getrenntheit« sagen, denn es handelt sich nicht um einen Akt (dieser geht als Ursache voran und fällt unter die Kategorie »Bewegung«), sondern um die Wirkung eines solchen.
Die neun Substanzen sowie die vierundzwanzig Qualitäten werden unter den mannigfaltigsten Gesichtspunkten zu Gruppen vereinigt. Bei den Substanzen kommt neben der Einteilung nach den Qualitäten, die ihnen inhärieren, vor allem in Betracht, ob sie beschränkten Umfangs sind ( mūrta) wie die Atome und ihre Aggregate oder unbeschränkten Umfangs ( sarvagata, vibhu) wie z. B. der Aether, die Seele u. a. Bei den Qualitäten spielt natürlich die Einteilung nach ihren substanziellen Trägern eine Rolle, ferner ob sie nur einzelnen Substanzen oder mehreren oder allen zukommen können, ob sie sinnlich wahrnehmbar sind u. a. m. Diese Gruppierungen sind für die Technik des Systems wichtig, dürfen uns aber hier nicht länger beschäftigen, zumal sie leicht aus meiner Uebersetzung der Siddhāntamuktāvalī zu entnehmen sind.
Wir fahren in der Betrachtung der Kategorien fort. Die vierte ist der Allgemeinbegriff ( sāmānya), der methodisch für unser System von größter Bedeutung ist. Technisch wird der Allgemeinbegriff definiert als » ewig und mehr als einem Dinge inhärent«. Es sei gestattet, an dieser einfachen Definition ( lakṣaṇa) die Methode des Definierens, welche unser System aufs schärfste ausgebildet hat, ganz kurz zu zeigen. Würde »ewig« nicht gesagt, so träfe die Definition auch z. B. auf die Zahlen über zwei zu, wäre also zu weit ( ativyāpti), denn die Zahlen über zwei inhärieren zwar mehr als einem Ding, sind aber nicht ewig. Der zweite Teil der Definition enthält eine doppelte Vorsichtsmaßregel. »Mehr als einem inhärent« muß gesagt werden, um die unendliche Ausdehnung des Aethers auszuschließen. Nach der Regel, daß Qualitäten ewiger Dinge ewig sind, ist die Qualität unendliche Ausdehnung, die dem ewigen Aether inhäriert, ewig; sie ist aber nur einem inhärent, nämlich dem Aether. »Inhärent« muß gesagt werden, um das absolute Nichtsein auszuschließen, welches ewig ist und mehr als einem zukommt, aber nicht in Inhärenzbeziehung. Diese Definition ist also dagegen geschützt, zuviel zu umfassen, während in anderen Fällen auch der Gefahr, zu wenig zu umfassen ( avyāpti), vorgebeugt wird. Durch diese genaue Methode des Definierens hat unser System vielfach vorbildlich gewirkt, ist freilich auch in gewissen Perioden seiner Geschichte der Gefahr nicht entgangen, über der formalen Verfeinerung das Sachliche aus dem Auge zu verlieren. Aus der Definition des Allgemeinbegriffs als ewig ergibt sich, daß man ihn als eine absolute Realität im vollendeten System ansieht, was in den Vaiśeṣikasūtras noch nicht der Fall war. Man geht sogar so weit, den Allgemeinbegriff als sinnlich wahrnehmbar zu erklären: mit der Wahrnehmung des Topfes ist mir auch das dem Topf inhärierende Topfsein sinnlich gegeben.
Mit dieser realistischen Auffassung hängt auch die Hervorhebung der Klassenbegriffe aus den Allgemeinbegriffen zusammen. Nicht jede begriffliche Zusammenfassung ist gleichzeitig Klassenbegriff ( jāti). Letzterer erfordert einen natürlichen, logisch unanfechtbaren, in sich geschlossenen Kreis. Wenn z. B. zwei Allgemeinbegriffe sich überschneiden, kann keiner von beiden ein Klassenbegriff sein; daher sind die Begriffe »Beschränktsein« und »Elementsein« keine Klassenbegriffe, denn das Manas ist beschränkt (atomklein), aber nicht Element, der Aether ist ein Element, aber nicht beschränkt, während Erde, Feuer Wasser, Luft sowohl beschränkt als Elemente sind [R148]. In der folgenden Figur, die dies veranschaulichen soll, bedeutet der linke Kreis die Sphäre des Begriffs »Elementsein«, der rechte die des Begriffs »Beschränktsein«.
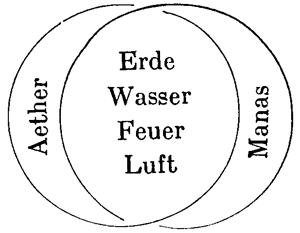
Die natürliche Ergänzung des Begriffs der Allgemeinheit ist der Begriff der Besonderheit ( viśeṣa), welche als fünfte Kategorie gezählt wird. Die Besonderheit eines Dinges gegenüber einem anderen kann bei allem Zusammengesetzten durch die Verschiedenheit der Teile konstatiert werden. Kommt man aber zu den Atomen, welche ja keine Teile haben, so bedarf es eines besonderen Begriffs, um sie voneinander zu unterscheiden. Das ist der Begriff der Besonderheit, welche den Atomen und den anderen ewigen einfachen Substanzen eignet. Fragt man, wie sich nun aber die Besonderheit eines Atoms von, der Besonderheit eines andern unterscheide, so antwortet unser System, daß Besonderheit die Fähigkeit, sich zu unterscheiden, selbst besitze, weil man sonst einem regressus in infinitum ( anavasthā) verfallen würde, da die erste Besonderheit durch eine zweite, diese durch eine dritte usf. unterschieden werden müßte. Daß somit eine besondere Kategorie viśeṣa eigentlich unnötig wird, indem man die Fähigkeit, sich von anderem zu unterscheiden, einfach den Atomen zuschreiben könnte, hat die späteren Logiker unsers Systems teilweise zur Ablehnung der Kategorie Besonderheit veranlaßt. Trotzdem der Name Vaiśeṣika von viśeṣa abgeleitet ist, spielt der Begriff der Besonderheit in den Sūtras des Kaṇāda keine Rolle, erst Praśastapāda hat ihn ausgearbeitet.
Die Wichtigkeit der nun folgenden Kategorie » Inhärenz« ( samavāya) ist schon dadurch deutlich geworden, daß der Begriff im Vorangehenden von der Definition der Substanz an öfter gebraucht werden mußte. Inhärenz wird definiert als eine Beziehung zwischen getrennt nicht denkbaren Dingen ( ayutasiddha). Dieses Verhältnis kennt unser System in fünf Fällen, nämlich zwischen einem substanziellen Ganzen und seinen substanziellen Teilen, zwischen Qualität und Qualitätsträger, d. h. Substanz, zwischen der Bewegung und der sich bewegenden Substanz, zwischen dem Klassenbegriff und den unter ihn fallenden Einzeldingen und zwischen der Besonderheit und den ewigen Substanzen. Inhärenz ist einheitlich, d. h. die Beziehung ist überall, wo sie auftritt, dieselbe, und sie ist ewig, d. h. sie kann nicht erzeugt sein, da sie der Kausalbeziehung zugrunde liegt, wie wir sehen werden. Hinsichtlich der Frage, ob Inhärenz der sinnlichen Wahrnehmung zugänglich oder nur erschließbar sei, ist unsere Schule in zwei Lager gespalten. Die einen halten sie für sinnlich wahrnehmbar und nehmen eine besondere Art des Wahrnehmungsprozesses dafür an; die anderen weisen darauf hin, daß auch sinnlich Nichtwahrnehmbares, wie z. B. der Aether, in seinem Verhältnis zum Laut für Inhärenz in Betracht komme, und begründen darauf die Notwendigkeit, sie zu erschließen. Ausgegangen ist die Konzeption des Inhärenzbegriffs von dem Verhältnis zwischen der materiellen Ursache und ihrem Produkt, wie die Vaiśeṣikasūtras (7, 2, 26) zeigen. Wenn auch die weitere Ausarbeitung des Kausalitätsproblems den Ursachebegriff über das Inhärenzverhältnis hinaus erweitert hat, so daß er nicht mehr unter den Fällen der Inhärenz einfach mitaufgezählt werden konnte, wie wir eben gesehen haben, so ist die Inhärenz doch der Eckpfeiler der Kausalitätstheorie geblieben und hat gerade deshalb von anderen Schulen, besonders vom Sāṃkhya und Vedānta, schärfste Ablehnung erfahren. Während nämlich diese Schulen auf Grund ihrer Gesamteinstellung das Verhältnis von materieller Ursache und Produkt als Identität auffassen mußten, hat unser System von seinem realistischen Standpunkt das Produkt als etwas Neues gegenüber der materiellen Ursache verstanden, technisch gesprochen den asat-kārya-vāda gelehrt, d. h. daß das Produkt (noch) nicht (in der Ursache) existiere, aber ihr nach seiner Entstehung inhäriere. Daher ist hier der rechte Punkt, die Kausalitätslehre unseres Systems darzustellen, denn die Kausalität ist in unseren Texten keine Kategorie und hat somit keine feste Stelle im System.
Unser System hat bei der Untersuchung der Kausalität in erster Linie die Substanz im Auge, das Material, aus dem ein neues Substanzielles gebildet wird oder an dem eine Qualität oder Bewegung erscheinen kann. Das Tuch z. B. ist aus Fäden gebildet, ohne Fäden wäre es nicht denkbar, so werden die Fäden als die inhärente Ursache des Tuches angesehen. Nun besteht aber Inhärenz nicht nur zwischen Teil und Ganzem, sondern auch zwischen Substanz und Qualität und zwischen Substanz und Bewegung. Daher ist das Tuch inhärente Ursache ( samavāyi-kāraṇa) seiner Qualitäten und seiner Bewegungen.
In zweiter Linie steht die Kausalität der Qualitäten (und entsprechend der Bewegungen). Die Qualität »Verbindung« der Fäden ist in anderem Sinne Ursache für das Tuch als es die materiellen Fäden sind. Die Qualität »Verbindung« inhäriert nämlich den Fäden und die Fäden sind die inhärente Ursache des Tuches, -- so ist die Verbindung der Fäden nicht-inhärente Ursache für das Tuch. Oder das Verhältnis ist indirekt: den farbigen Fäden inhäriert die Qualität »Farbe«, die Fäden sind inhärente Ursache des Tuchs, die Qualität Farbe inhäriert dem Tuch, -- so ist die Farbe der Fäden nicht-inhärente Ursache ( asamavāyi-kāraṇa) der Farbe des Tuches.
In dritter Linie steht die wirkende Ursache ( nimitta-kāraṇa), worunter alles begriffen wird, was nicht unter die zwei ersten Arten der Ursache paßt. Hier erst wird der Agens, in unserem Beispiel der Weber, berücksichtigt, ein Beweis dafür, daß die Betrachtung der Kausalität nicht vom psychologischen, sondern vom physikalischen Gesichtspunkt ausgegangen ist. Neben dem Agens als besonderer wirkender Ursache werden hier noch acht allgemeine aufgestellt: Gott, sein Wissen, Wollen und Handeln, das vorherige Nichtsein, Raum, Zeit und die unsichtbare Macht der guten und bösen Werke. Eine besondere Rolle spielt noch die instrumentale Ursache ( karaṇa), welche durch ihre Tätigkeit oder Operation ( vyāpāra) direkt die Wirkung hervorbringt. Beim Holzspalten z. B. ist die Axt die instrumentale Ursache, die Verbindung von Axt und Holz die Operation, das Spalten die Wirkung.
Allgemein wird der Begriff der Ursache definiert als das, was dem Resultat notwendig vorausgeht, unter Ausschluß alles dessen, was mit der eigentlichen Ursache irgendwie verknüpft ist, ohne direkt zum Resultat beizutragen, wie z. B. hinsichtlich des Produkts Topf der Stock, mit dem die Töpferscheibe gedreht wird, der Vater des Töpfers, der Esel, der den Lehm herbeiträgt, u. a. m. ( anyathāsiddha). Aus der Forderung, daß die Ursache dem Resultat vorausgehen muß, folgt, daß eine Substanz, z. B. ein Tuch, im ersten Augenblick ihres Entstehens ohne Qualität und Bewegung sein muß, da das Tuch ja, wie wir sahen, inhärente Ursache seiner Qualitäten und Bewegungen ist.
Zum vollständigen Verständnis dieser Kausalitätstheorie muß aber noch die eigentümliche Auffassung des Nichtseins ( abhāva) berücksichtigt werden, welches unser System zwar noch nicht in den Sūtras, aber später ganz einstimmig als siebente Kategorie betrachtet. In dieser Tatsache kommt der Begriffsrealismus des Nyāya-Vaiśeṣika, den wir schon anläßlich des Klassenbegriffs kennen gelernt haben, besonders deutlich zum Ausdruck. Indem man den Boden der Hütte überblickt und die Abwesenheit eines Topfes auf ihm konstatiert, hat man die Vorstellung des Nichtseins des Topfes, welche, obwohl negativen Inhalts, als Vorstellung ein Positives ist. Das zeigt die Sprache, die zu sagen gestattet: Auf diesem Boden ist Nichtsein des Topfes ( bhūtale ghaṭābhāvah). Das Nichtsein wird hier dem Boden attribuiert, es ist gleichsam eine Eigenschaft des Bodens. Zweierlei kann nun negiert werden: entweder der Zusammenhang ( saṃsarga) eines Objekts d. h. des positiven Korrelates ( pratiyogin) der Negation mit der Grundlage oder die Identität eines Objekts mit einem anderen. Im zweiten Falle spricht man dann von gegenseitigem Nichtsein ( anyonyābhāva), z. B. der Topf ist kein Tuch. Im ersten Falle, wenn der Zusammenhang mit der Grundlage negiert wird, ergeben sich drei verschiedene Arten des Nichtseins. Erstens das vorherige Nichtsein ( prāgabhāva). Man erinnere sich, daß die Fäden inhärente Ursache des Tuches waren. Solange sie noch verknüpft sind, bilden sie noch kein Tuch, d. h. solange kann das Nichtsein des Zusammenhanges zwischen dem Produkt (Tuch) und seiner inhärenten Ursache festgestellt werden. Dieses Nichtsein hat aber ein Ende, wenn das Produkt entstanden ist. In diesem Sinne wird Produkt definiert als »das positive Korrelat des vorherigen Nichtseins«. So ist vorheriges Nichtsein anfanglos, aber endlich. Damit ist gleichzeitig die schon berührte Lehre, daß das Produkt vor seiner Entstehung nicht vorhanden ist ( asatkāryavāda), klargestellt. Sie hängt mit dem Begriffsrealismus unseres Systems zusammen, denn wenn man auch das Material des Tuches hat, so ist doch der Begriff Tuch erst nach Umgestaltung des Materials da und vorher nicht. Dem vorherigen Nichtsein, welches dem Begriff der Vergangenheit entspricht, tritt als Repräsentant der Zukunft das Zerstörungsnichtsein ( dhvaṃsābhāva) gegenüber. Nehmen wir wieder das Beispiel der Fäden und des Tuches, so schwindet das Tuch, wenn die Verknüpfung der Fäden gelöst ist, der Zusammenhang des Produkts mit seiner Ursache hat aufgehört. So hat das Zerstörungsnichtsein einen Anfang (Auflösung der Fäden), aber kein Ende. Die Existenz jedes nicht-ewigen Dinges ist also eingerahmt von seinem vorherigen Nichtsein und seinem Zerstörungsnichtsein, wie schon die alte buddhistische Scholastik Entstehen, Bestehen und Vergehen bei den Dingen unterschieden hatte. Die spätere buddhistische Philosophie hat daraus die Lehre von der Momentanheit alles Gegebenen entwickelt (vgl. Kap. 9). In unserem System ist diese Lehre auf gewisse Spezialqualitäten beschränkt. Wir haben sie beim »Laut« kennen gelernt, und ebenso gilt sie für die seelischen Qualitäten Erkenntnis usw. Die dritte Art endlich ist das absolute Nichtsein ( atyantābhāva), das, auf alle drei Zeiten bezüglich, weder Anfang noch Ende hat und in seiner einfachsten Form durch das Nichtsein des Geruchs im Aether illustriert ist. Weitere beim absoluten Nichtsein mögliche Subtilitäten mögen hier unerwähnt bleiben. Nur noch auf eine Folge der realistischen Auffassung der Negation sei hingewiesen. Die späteren Logiker haben die Konsequenz aus dem Kategoriecharakter des Nichtseins gezogen, indem sie lehrten: Da Nichtsein selbständig ist, kann die Negation des Nichtseins nicht gleich dem positiven Korrelat sein, eine Negation kann nie gleich einer Position sein, daher ist die Negation der Negation ebenso selbständig wie die einfache Negation, aber die Negation der Negation der Negation ist gleich der ersten Negation.
Wir haben nunmehr die sämtlichen Kategorien erörtert und einen Ueberblick über alle Realitäten gewonnen, die im Nyāya-Vaiśeṣika zu einem Weltbild vereinigt sind. Es bleibt noch übrig, von der Erkenntnistheorie zu reden, durch welche unser System, unterstützt durch die Arbeiten der späteren Buddhisten, für die ganze indische Philosophie normgebend geworden ist. Unsere Darstellung, die leider auch dieses wichtige Thema nur in kürzester Form behandeln kann, folgt am besten den Erkenntnismitteln ( pramāṇa), von denen im vollendeten System und schon im ältesten Nyāya vier angenommen werden: Wahrnehmung, Schlußfolgerung, Analogieschluß und sprachliche Erkenntnis. Das älteste Vaiśeṣika nahm nur die beiden ersten an, indem es das dritte und vierte als Sonderfälle der Schlußfolgerung auffaßte. Der Analogieschluß ist aber auch im vollendeten System nur aus Traditionsgründen mitgeschleppt worden und braucht uns wegen seiner Unerheblichkeit nicht zu beschäftigen, so daß wir hier unsere Aufmerksamkeit auf Wahrnehmung, Schlußfolgerung und sprachliche Erkenntnis konzentrieren.
Die gewöhnliche Wahrnehmung ( laukika pratyakṣa) geht entweder mit Hilfe der äußeren Sinne des Sehens, Riechens, Schmeckens, Tastens und Hörens auf die Außenobjekte oder mit Hilfe des inneren Sinnes ( manas) auf die Innenobjekte, d. h. auf die seelischen Qualitäten Erkenntnis, Wille, Lust, Schmerz, Begierde und Abneigung, sowie auf die Seele selbst (letzteres nur in der Nyāyarichtung unseres Systems). Das Manas hat also bei dem Wahrnehmungsprozeß eine doppelte Rolle: entweder vermittelt es zwischen den in den Sinnesorganen lokalisierten äußeren Sinnesvermögen und der Seele, wodurch das sinnliche Datum ein geistiges wird, oder es funktioniert bei der Innenwahrnehmung selbst als Sinnesvermögen. Bei der Wahrnehmung äußerer Objekte gehen die Sinnesvermögen des Sehens, Riechens, Schmeckens und Tastens in einer nicht näher erörterten Weise zum Objekt hin, während beim Hören, wie schon oben erwähnt, der Ton zum Ohre geht. Die Erfassung eines Außenobjekts wird in der vollendeten Form unseres Systems in zwei Stadien zerlegt, die als undifferenzierte und differenzierte Erkenntnis ( nirvikalpaka bzw. savikalpaka jñāna) bezeichnet werden [R149]. Zuerst wird nur ein unbestimmter Eindruck vermittelt: »das ist etwas«. Dann tritt die Wahrnehmung des Charakteristischen dazu, d. h. des Klassenbegriffs, der Qualitäten usw., und wir haben die bestimmte Wahrnehmung des Gegenstandes, welcher z. B. durch den Klassenbegriff Topfsein, durch die Qualität schwarze Farbe usw. als ein schwarzer Topf erfaßt wird. Erst jetzt kann die Frage nach der Richtigkeit ( pramā) dieser Wahrnehmung [R150] aufgeworfen werden. Ihre Richtigkeit ist nämlich daran feststellbar, daß die nun in uns erzeugte Erkenntnis mit den gleichen Charakteristiken ( prakāra) ausgestattet ist wie der Gegenstand selbst, wodurch sich der Realismus unseres Systems deutlich zeigt. Solch richtige Wahrnehmungserkenntnis beruht auf einem Vorzug ( guṇa), nämlich in dem Kontakt des Sinnesvermögens mit dem Gegenstand. Dieser Kontakt ist beim Sehen einer Substanz, z. B. eines Topfes, die Qualität »Verbindung«, beim Sehen seiner Farbe (die als Qualität dem Topf inhäriert) ist der Kontakt eine Kombination von Verbindung und Inhärenz usw. Tritt aber an die Stelle des Vorzugs ein Fehler ( doṣa), so entsteht falsche Erkenntnis. Dieser Fehler kann organisch sein, so daß ich die weiße Muschel gelb sehe, also meine Muschelerkenntnis durch Gelbheit qualifiziert ist, während das Objekt »Weißsein« als Charakteristikum besitzt, oder der Fehler kann in zu großer Entfernung u. ä. liegen. Irrtümliche Wahrnehmung stellt sich also als eine Auffassung des Objekts dar, welche anders ist als die wirkliche Sachlage ( anyathākhyāti), ein Punkt, über den die verschiedenen Systeme vielfach variieren. Zu den äußeren Objekten, welche direkt apperzipiert werden können, gehören auch, wie schon erwähnt, die Inhärenz und das Nichtsein, Inhärenz freilich nur in der Nyāyarichtung unseres Systems, während die Vaiśeṣikarichtung ihre Wahrnehmbarkeit leugnet. Die von der Wahrnehmung der anderen Objekte abweichende Natur der Erfassung von Inhärenz und Nichtsein zeigt sich daran, daß hier der Kontakt zwischen Sinn und Objekt ein eigentümlicher ist. Bei der Wahrnehmung der Negation (und mutatis mutandis bei der Inhärenz) ist das Auge mit der Grundlage »verbunden«, welche durch die Negation »qualifiziert« ist, z. B. mit dem durch die Abwesenheit des Topfes qualifizierten Erdboden, wobei freilich »Geeignetheit zur Wahrnehmung«, d. h. die Ueberlegung, »wenn der Topf da wäre, würde er bemerkt werden« erforderlich ist; die auch sonst zum Sehakt erforderliche Helligkeit ist also Bedingung für das Bemerken des Nichtseins.
Neben dieser sinnlichen Wahrnehmung, die unser System »gewöhnlich« nennt, stellt sich eine andere Art, die »nicht-gewöhnliche« Wahrnehmung. Sie befaßt kurz gesagt erstens zwei Arten der Assoziation ( pratyāsatti, wörtlich: Verknüpfung). Wir haben gesehen, daß die Wahrnehmung eines Topfes die Wahrnehmung des Allgemeinbegriffs Topfsein einschließt. Durch den Begriff Topfsein sind mir andrerseits in gewissem Sinne alle Töpfe gegeben, d. h. ich habe die nicht-gewöhnliche Wahrnehmungserkenntnis aller Töpfe vermöge des Allgemeinbegriffs ( sāmānyalakṣaṇā pratyāsatti). Zweitens genügt der bloße Anblick von Sandelholz bei einer Entfernung, die normale Geruchswahrnehmung ausschließt, um mir den Geruch desselben so lebendig zu machen, daß ich ihn als wahrgenommen empfinde. Dies wird die nicht-gewöhnliche Wahrnehmung des Geruchs vermöge des Besitzes seiner Erkenntnis genannt ( jñānalakṣaṇā pratyāsattii). Eine dritte Art endlich beruht auf der übernatürlichen Wahrnehmungskraft der Yogins, für die dank ihrer akkumulierten Verdienste alles unmittelbar schaubar ist. Von einer Anpassung unseres Systems an ihm eigentlich fremde Ideen ist dabei nicht die Rede, der Realismus des Nyāya-Vaiśeṣika ist ja kein Materialismus.
Auf der Wahrnehmung als Voraussetzung baut sich das zweite Erkenntnismittel auf: die Schlußfolgerung ( anumāna). Im Sinne des vollendeten Systems ist der Prozeß des Schließens an dem üblichen Schulbeispiel folgendermaßen zu verdeutlichen: Ich sehe in der Ferne einen Berg und auf dem Berge eine Rauchsäule. Durch den Anblick dieses Rauches aber ist mir vermöge der beiden eben erwähnten Assoziationsarten der nicht-gewöhnlichen Wahrnehmung sowohl aller Rauch als auch das Zusammengehen von Rauch und Feuer gegeben, d. h. ich erinnere mich des öfters (z. B. in der Küche) beobachteten Zusammengehens von Rauch und Feuer. Ich schließe nun, daß auch der Rauch auf dem Berge dort Feuer voraussetzt und komme zu dem Ergebnis ( anumiti), daß auf dem Berge Feuer ist, oder daß der Berg Feuer hat. Es handelt sich also um drei Dinge: der Berg ist das Subjekt ( pakṣa); das Feuer ist das Festzustellende ( sādhya) oder die logische Folge; der Rauch ist das Merkmal ( linga), sofern er das Feuer charakterisiert, oder das Feststellungsmittel ( sādhana), durch welches das Feuer erwiesen wird, oder der logische Grund ( hetu) des Feuers als Folge. Diese später gesicherte Terminologie ist in der Frühzeit unserer Systeme noch nicht ganz fest.
Im Mittelpunkt der Schlußoperation steht nun naturgemäß die Beziehung von Grund und Folge und die Anwendung dieser Beziehung auf das Subjekt, d. h. technisch gesprochen die »Betrachtung« ( parāmarśa): »Rauch, welcher immer von Feuer umfaßt ist, ist ein Attribut des Berges.« Hier sind zwei verschiedene Erkenntnisse verschmolzen, nämlich die Wahrnehmung des Rauches auf dem Berge und die Umfassung des Rauches durch das Feuer. Diese Idee der Umfassung ( vyāpti) ist das Zentrum des ganzen Verfahrens. Man hat die Idee auch durch »ständige Begleitung«, »Konkomitanz« u. dgl. wiedergegeben; ich halte »Umfassung« für eine besonders geeignete Uebersetzung, da es sich um Größenverhältnisse von Begriffen handelt: der Begriff Rauch wird von dem Begriff Feuer umfaßt, d. h. die Sphäre des Rauchbegriffs ist die kleinere, oder der Begriff Feuer umfaßt den Rauch, d. h. die Sphäre des Feuerbegriffs ist die größere. Daher lautet die Umfassung in unserem Falle: »Wo Rauch ist, da ist auch Feuer.« Den Schluß auf eine so prinzipielle Regel zu bringen, ist in der Frühzeit unserer Systeme noch nicht gelungen. Da begnügte man sich, aus der Analogie mit einem Beispiel zu schließen oder die verschiedenen möglichen Fälle der Beziehung zwischen Grund und Folge anzuführen. Erst in der »Umfassung« gelangte man zu einer allgemein gültigen Regel.
Aber wie war ihre Allgemeingültigkeit zu sichern? In erster Linie muß man feststellen, daß die Regel positiv und negativ belegbar ist. In unserem Beispiel ist der positive Beleg die Küche, in der man nur Rauch beobachtet, wenn Feuer da ist, und der negative der Teich, auf dem kein Feuer möglich und daher niemals Rauch zu beobachten ist. Solche Beobachtungen, häufig gemacht, sichern die Allgemeingültigkeit der Regel: Wo Rauch ist, da Feuer -- wo kein Feuer, da kein Rauch. (Neben solchen Schlüssen, die sich auf positive und negative Umfassung stützen ( anvayavyatirekin), gibt es noch besondere, rein positive ( kevalānvayin) bzw. rein negative ( kevalavyatirekin), deren negative, bzw. positive Umfassung mangels Belegen nicht demonstrierbar ist) [R151]. Erregen diese Beobachtungen irgendwelche Bedenken, so gibt es zwei weitere Sicherungen. Einmal muß es gelingen, die Unsinnigkeit der entgegengesetzten Umfassung, »wo Rauch ist, da ist kein Feuer« festzustellen. Dies geschieht in unserem Falle leicht durch die Feststellung des Kausalitätsverhältnisses zwischen Rauch und Feuer: Rauch ohne Feuer wäre ein Produkt ohne Ursache. Weiterhin ist die Umfassung auf ihre Bedingungslosigkeit zu prüfen, da die indische Logik bedingte Schlüsse nicht anerkennt. Die Umfassung z. B. »wo Feuer ist, da ist Rauch«, ist falsch, da nach dem Schulbeispiel eine glühende Eisenkugel Feuer hat, aber keinen Rauch. Unsere Umfassung ist also nicht allgemeingültig, sondern nur unter der Bedingung bestimmten Feuers, z. B. eines mit feuchtem Brennholz erzeugten. Eine solche Bedingung ( upādhi) würde also die genannte Umfassung einschränken und daher den Schluß »der Berg hat Rauch, weil er Feuer hat« ungültig machen. Ist aber die Umfassung richtig gefunden, so wird sie dem Grunde als Qualifikation hinzugefügt und von dem so qualifizierten Grunde wird dann ausgesagt, daß er Attribut des Subjekts ist ( vyāptiviśiṣṭa-pakṣadharmatā), -- das ist die »Betrachtung« ( parāmarśa), die mit Recht als das Wesentliche beim Schließen von den Indern betrachtet wird.
Das Subjekt des Schlusses spielt also in der indischen Auffassung eine wichtige Rolle, denn es ist ja die gemeinsame Grundlage von Grund und Folge. Es muß daher immer vorgestellt werden; ist es nicht ausdrücklich genannt, wie es in praxi öfter geschieht, so ist ein bestimmter Ort oder Zeitpunkt als Subjekt anzusetzen. Subjekt eines Schlusses wird eine Sache dadurch, daß eines ihrer Attribute (der Grund) bekannt und ein anderes (die Folge) noch nicht als solches erkannt ist. Dies ist der Fall in dem bisher geschilderten Schlußprozeß, den die Inder den »Schluß für sich selbst« ( svārthanumāna) nennen. Will man aber den selbstvollzogenen Schluß einem anderen demonstrieren, so handelt es sich um den »Schluß für einen anderen« ( parārthanumāna). In diesem Falle ist zwar die dem Subjekt zu attribuierende Folge dem Sprecher schon bekannt, er wünscht sie aber zu demonstrieren, und auch dieser Wunsch ( siṣādhayiṣā) kann eine Sache zum Schlußsubjekt stempeln.
Für solche Demonstration haben schon die Nyāyasūtras ein fünfgliederiges Schema ( nyāya) aufgestellt, da zu ihrer Zeit das Interesse am Schluß nicht auf die Psychologie seines Ablaufs, sondern auf seinen praktischen Gebrauch als Beweis im Kampfe der Diskussion gerichtet war. Zuerst wird die Behauptung ( pratijñā) vorgetragen: »Der Berg hat Feuer«, d. h. die Folge wird dem Subjekt zugesprochen. Zweitens wird der Grund ( hetu) angegeben: »denn er hat Rauch«, d. h. das syllogistische Merkmal wird ebenfalls dem Subjekt attribuiert. Drittens wird das Beispiel ( udāharaṇa) angeführt, welches in der Frühzeit vor allem den Beleg bringt und die Umfassung nur gelegentlich miterwähnt, das aber seine feste Form seit Praśastapāda [R152] zeigt: »Wo Rauch ist, da ist Feuer, wie in der Küche.« Viertens folgt die Anwendung ( upanaya), welche das umfaßte Merkmal dem Subjekt zuspricht: »und ebenso (d. h. von Feuer umfaßten Rauch habend) ist dieser (d. h. Berg)«. Fünftens folgt die Schlußfolgerung ( nigamana), die in neuer Beleuchtung die Behauptung wiederholt: »darum ist er ebenso« (d. h. hat Feuer). In der Buchpraxis werden gewöhnlich nur die beiden ersten Glieder genannt. Die fünf Glieder zusammen bilden im Nyāyasūtra eine der dort aufgezählten sechzehn Kategorien, und unter diesen finden sich auch die verschiedenen Mittel, die fünfgliederige Demonstration anzugreifen.
Von diesen hat sich nur eine Kategorie im vollendeten System allgemeine Anerkennung erringen können, nämlich die Scheingründe ( hetvābhāsa), die auf Grund ihres logischen Interesses ein besonderes Kapitel in den späteren Lehrbüchern zu bilden pflegen. Alle Fehlermöglichkeiten eines Schlusses werden nämlich auf die Fehlerhaftigkeit des Grundes zurückgeführt, und ein fehlerhafter Grund ist nur ein scheinbarer Grund, kein wirklicher. Ein richtiger Grund ( saddhetu) muß Attribut der Sache sein, nur noch in Beispielen vorkommen, dagegen von den Gegenbeispielen vollständig ausgeschlossen sein, nicht direkt durch die Tatsachen widerlegt werden und keinen Gegengrund zulassen. Verstößt ein Grund gegen eine dieser Bedingungen, so ist er ein Scheingrund und hindert den richtigen Ablauf des anfangs geschilderten Prozesses, indem er die Umfassung, die Betrachtung oder das Ergebnis unmöglich macht. Auf die Darstellung der fünf Klassen von Scheingründen mit ihren Unterabteilungen müssen wir hier des beschränkten Raumes wegen verzichten, was um so leichter möglich ist, als dem Leser in Jacobis »Indischer Logik« eine sehr klare und kurze Belehrung zur Verfügung steht.
Neben der Wahrnehmung und der Schlußfolgerung vermittelt auch die Sprache ( śabda) richtige Erkenntnis. Früh hat sich die Aufmerksamkeit der Inder auf das Wesen des sprachlichen Ausdrucks gelenkt, denn die göttliche Offenbarung des Veda besteht ja in Worten. Die Gebote und Verbote und die Sacherklärungen der rituellen Schriften, sowie die Aussprüche der Upaniṣaden sind autoritativ, weil sie -- wie das alte Vaiśeṣikasūtra sagt -- übermenschlichen Ursprungs sind, weil sie gemäß dem Gottesglauben des fortgeschrittenen Systems von Gott stammen, der über jeden Irrtum erhaben ist. Wo diese göttliche Autorität fehlt, tritt wie z. B. bei der Bhagavadgītā und den Sūras des Kaṇāda und Gotama die Glaubwürdigkeit ihrer Verfasser als heiliger Männer ( ṛṣi) für die Erlangung des richtigen Wissens durch die Erfassung dieser sprachlichen Ueberlieferungen ein. Im täglichen Leben endlich ist es die eventuell nachzuprüfende Zuverlässigkeit des Sprechers, auf Grund deren wir seine Worte als direkte Mittel für richtige Erkenntnis ansehen dürfen. Weil in all dem ein Schluß von der Glaubwürdigkeit des Sprechers auf die rechtes Wissen erzeugende Kraft seiner Worte liegt, hat das alte Vaiśeṣika die Sprache formell nicht als ein besonderes Erkenntnismittel anerkennen wollen, sondern sie als unter die Schlußfolgerung fallend angesehen, was natürlich einen reichlichen Gebrauch der Berufung auf Worte der Offenbarung in den Vaiśeṣikasūtras keineswegs gehindert hat. Dem vollendeten System aber gilt wie schon dem ältesten Nyāya die sprachliche Mitteilung als besonderes Erkenntnismittel.
Ein Wort ( pada), d. h. ein Lautkomplex, besitzt nun die eigentümliche Kraft ( śakti), die Erinnerung an den Gegenstand, den es bezeichnet, hervorzurufen: »Nennkraft ist die Beziehung zwischen Wort und Gegenstand« [R153]. Freilich sind in unserem System die Laute ( śabda) vergänglich, jeder Laut hat, wie schon erörtert, nur drei Momente, aber die geistigen Eindrücke, welche die einzelnen hinterlassen, bleiben erhalten, so daß man beim Hören des letzten Lautes die ganze Lautreihe des Wortes besitzt und damit die Nennkraft des Wortes [R154]. Diese Beziehung zwischen Wort und Gegenstand ist von Gott festgesetzt. Ist sie einem bekannt, so ruft der bestimmte Lautkomplex vermöge seiner Nennkraft den Gegenstand in unser Bewußtsein; ist sie nicht bekannt, so muß sie aus Grammatik, Vergleich, Wörterbuch, Ausspruch eines Zuverlässigen, Gebrauch, Satzergänzung, Erklärung oder der Nähe eines bekannten Wortes gelernt werden. Die Nennkraft der Wörter geht entweder aus der Nennkraft ihrer Teile hervor, was bei der durchsichtigen Struktur des Sanskrit und der meist leichten Zurückführbarkeit auf die zugrunde liegende Verbalwurzel sehr häufig der Fall ist, oder sie ruht auf dem nicht weiter analysierbaren Wortganzen, d. h. ist nicht etymologisch erklärbar, oder sie liegt in der Kombination der beiden Möglichkeiten. Neben der natürlichen Bedeutung findet auch die übertragene ( lakṣaṇā) eingehende Berücksichtigung, die in einem besonderen Zweige der wissenschaftlichen Literatur, in der Poetik ( alaṃkāra), besonders ausgearbeitet worden ist. Einen wichtigen Streitpunkt der Schulen bildet die Frage, ob die natürliche Nennkraft eines Wortes das Einzelding oder den Klassenbegriff bezeichne. Sie wird von den späteren Lehrbüchern unseres Systems dahin beantwortet, daß die Nennkraft beides bezeichne, technisch ausgedrückt: das durch den Klassenbegriff bestimmte Einzelding.
Die sprachliche Mitteilung, welche Erkenntnis vermittelt, besteht aber nicht aus einzelnen Wörtern, sondern aus Sätzen ( vākya). Damit ein Satz oder Ausspruch einen Sinn ergebe, muß er gewisse Bedingungen erfüllen: die einzelnen Wörter müssen in richtiger Ordnung stehen ( saṃnidhi), sie müssen miteinander dem Sinne nach vereinbar sein ( yogyatā) und sie müssen die notwendige Abhängigkeit ( ākānkṣā) aufweisen, d. h. regelrecht miteinander konstruierbar sein. Aber auch das genügt nicht immer, um den sprachlichen Ausdruck zum Mittel für richtige Erkenntnis zu machen. Oft ist auch die Absicht ( tātparya) des Sprechers zu wissen nötig, und diese ergibt sich aus dem Anlaß. »Der Ton ist schlecht« hat verschiedenen Sinn, je nachdem es zu einem Sänger oder zu einem Töpfer gesagt wird.
Anhangsweise soll hier noch ein System behandelt werden, welches, in verschiedener Hinsicht für das indische Geistesleben von Bedeutung, mit Philosophie von Haus aus nichts zu tun hat und erst verhältnismäßig spät dazu gekommen ist, zu den zentralen philosophischen Systemen Stellung zu nehmen. Es handelt sich um die » Erörterung« ( mīmāṃsā) derjenigen Teile der heiligen vedischen Texte, die sich auf das Ritual beziehen, d. h. um die Interpretation der zu singenden, zu rezitierenden oder zu murmelnden Mantras (Lieder, Verse, Sprüche) und der mit diesen zusammengehörigen Brāhmaṇas (Opfervorschriften und Deutungen), mit dem Zwecke, die rituelle Praxis einwandfrei gemäß den autoritativen Geboten des Veda ausüben zu können. Eine Wissenschaft dieser Art muß angesichts der Kompliziertheit der Riten und der Schwierigkeit der alten Texte früh notwendig geworden sein, Bestrebungen in dieser Richtung zeigen sich mehrere Jahrhunderte vor Christus in der Literatur. Die endgültige Kodifikation in der Form von Sūtras wird dem Jaimini, von dem wir sonst nichts wissen, zugeschrieben; sie darf vermutungsweise in die ersten Jahrhunderte n. Chr. gesetzt werden. Ihre gewöhnlichste Bezeichnung ist Karma-mīmāṃsā-sūtras oder Pūrva-mīmāṃsā-sūtras. Diese Namen deuten den behandelten Gegenstand an: der erste bedeutet die Erörterung desjenigen Teils des Veda, der sich auf die rituellen Werke ( karman) bezieht; der andere bedeutet »frühere Erörterung« auf Grund der Tatsache, daß auf die Saṃhitās und Brāhmaṇas mit ihrer Werklehre in den Upaniṣaden, wie wir gesehen haben, eine Erkenntnislehre folgt. Der »früheren Erörterung« entspricht die »spätere Erörterung« ( uttaramīmāṃsā), in der die Brahmanerkenntnis der Upaniṣaden behandelt ist, d. h. die Brahmasūtras des Bādarāyaṇa (vgl. Kap. 10). Wenn nun auch die beiden Sūtrasammlungen mancherlei Beziehungen zueinander aufweisen -- die Namen der Autoren z. B. werden wechselseitig zitiert --, so liegen doch ihre Ziele ebensoweit auseinander wie die der Brāhmaṇatexte einerseits und der Upaniṣaden andererseits. Nur sofern Werkteil und Erkenntnisteil des Veda als Teile des einen Veda aufgefaßt werden, also nur im Sinne der orthodoxen Systematik, sind Brahmasūtras und Mīmāṃsāsūtras (so nennt man das dem Jaimini zugeschriebene Werk gewöhnlich) korrelativ. Ihrer tatsächlichen Einstellung nach aber gehört die Mīmāṃsā vielmehr mit dem Vaiśeṣika und Nyāya zusammen. Wie diese Systeme in ihrer Frühzeit nicht auf Erlösung abzielten, sondern die Erfassung alles Erkennbaren unter Kategorien, die Kenntnis der Dialektik und Logik als ihren wahren Zweck verfolgten, wie sie ursprünglich kein Interesse an einem absoluten Gott hatten, gerade so verhält sich die älteste Mīmāṃsā. Sie strebt keine Erlösung an, und sie leugnet die Notwendigkeit des Gottesbegriffs. Ihr Ziel ist die Erforschung der religiösen Pflicht ( dharma), wie es das erste Sūtra ausspricht. Der Inhalt dieser Pflicht ist bestimmt durch die rituellen Gebote ( codanā) des Veda. Diese Gebote sind autoritativ durch sich selbst, sie bedürfen nicht etwa des Beweises durch Wahrnehmung oder Schlußfolgerung, denn die Worte des Veda und ihre Bedeutungen sind ewig und stammen nicht etwa von irgendwem, wie in scharfer Polemik gegen alle möglichen sorgfältig verzeichneten Einwendungen festgestellt wird. Die rechte Ausführung der im Veda vorgeschriebenen Handlungen erzeugt eine Kraft, ein vorher nicht Dagewesenes ( apūrva), das in dieser Welt oder im Himmel erfreuliche Frucht bringt [R155]. Hinsichtlich ihrer Ethik (die religiöse Pflicht besteht im Rituellen), und ihrer Metaphysik (himmlische Lust als Ziel) stehen die Mīmāṃsāsūtras auf dem primitiven Standpunkt der Brāhmaṇatexte, deren Gesinnung eben weiten Kreisen gemäß ist. Nicht primitiv aber, sondern scharfsinnig, ja raffiniert ist ihre Methode. In der Art, wie die Mīmāṃsakas ein Problem zerlegen und erörtern, wetteifern sie mit dem Nyāya in Klarheit und Folgerichtigkeit. Ihre Interpretation der Textstellen ist als die Begründung der Auslegungskunst anzusehen und hat naturgemäß schon früh für andere Gebiete, so für das juristische, Bedeutung gewonnen. Ihre äußerst kurze und oft sehr dunkle Prägung -- darin gleichen sie besonders den Brahmasūtras -- macht die Mīmāṃsāsūtras freilich ohne Kommentar unverständlich. Wieweit die mündliche Erklärung von vorneherein andere Gegenstände als die Interpretation der Ritualtexte heranzog, können wir natürlich nicht wissen, aber schon der älteste uns vorliegende Kommentar des Śabarasvāmin (vielleicht 5. Jahrhundert) behandelt auch Weltanschauliches und zitiert einen Vorgänger, der schon mit den späteren buddhistischen Philosophenschulen die Kontroverse aufnahm [R156]. Aber die Stellungnahme der Mīmāṃsā zu allen wichtigen Problemen der Philosophie, die in den Systemen erörtert zu werden pflegen, gehört einer späteren Phase unseres Systems an und ist durch die beiden Namen Prabhākara und Kumārila bezeichnet, die, wenn auch auf einer breiten gemeinsamen Basis stehend, im einzelnen mannigfach divergieren und daher als Gründer (oder Hauptvertreter) zweier Mīmāṃsārichtungen anzusehen sind. Prabhākara mit dem Beinamen »Guru« (der Lehrer) kommentierte im siebenten Jahrhundert das Werk Śabarasvāmins, Kumārila mit dem Beinamen »Bhaṭṭa« tat dasselbe wahrscheinlich im Anfang des achten. An die Werke dieser beiden führenden Autoren knüpft sich eine reiche philosophische Literatur, die hier nicht weiter beschrieben werden kann.
In der durch die beiden genannten Lehrer und ihre Schulen charakterisierten neuen Phase nimmt die Mīmāṃsā endgültig den Charakter eines philosophischen Systems ( darśana) an. Als solches muß sie auch den ihr von Haus aus fremden Gedanken der Erlösung aufnehmen, was freilich nur durch einen Kompromiß mit ihrer utilitarischen Einstellung möglich ist. Der nach Erlösung Strebende (sagt Kumārila [R157]) soll keine wunschhaften und verbotenen Opfer mehr vollziehen, sondern nur die regelmäßigen und die an bestimmte Tage gebundenen, aber auch diese nur zur Tilgung von Schuld, nicht um einer positiven Frucht willen, denn die Frucht tritt nur für denjenigen Opferer ein, der nicht nach ihr begehrt. Wir haben hier also denselben ethischen Kompromiß, dem wir schon in der Bhagavadgitä begegneten: Dort war die Pflicht ( dharma) des Kriegers zum Kampfe mit dem Verneinungsideal zu vereinigen, hier die praktische Ritualpflicht ( dharma). Mit Recht zitiert daher der Kommentar [R158] Verse der Gītā zu unserer Stelle. Charakteristisch für die Abneigung der Mīmāṃsā gegen metaphysische Spekulationen ist der scharf negative Charakter, den ihre Definition der Erlösung und des Erlösten aufweist. Kumārila äußert sich dahin und ebenso Prabhākaras Schüler Śālikanātha: »Erlösung ist das absolute Aufhören der Verkörperung auf Grund restloser Vernichtung von Verdienst ( dharma) und Schuld ( adharma). Verdienst und Schuld bewirken die Wanderung der Seele von Leib zu Leib. Wenn nach ihrer völligen Aufhebung die Seele ihre Verbindung mit den körperlichen Sinnesvermögen gelöst und die Fessel des Wanderungsleidens vollständig abgeschüttelt hat, so heißt sie erlöst.« Die Erlösung als Wonne oder dgl. im Sinne des Vedānta zu beschreiben wird ausdrücklich (in Uebereinstimmung mit dem Nyāya-Kommentator Vātsyāyana) abgelehnt. Die ganze Erlösungsidee aber -- und damit kehrt das System zu seiner altüberlieferten Praxis zurück -- ist nur für die, welche sie erfaßt haben, von Bedeutung. Die am Werke hängen, soll man nicht unsicher machen, denn wer sich ganz auf die Werke verläßt, erlangt unendliches Heil im Himmel.
Hinsichtlich Gott und Seele hat unser System seinen alten Standpunkt bewahrt und gegen alle anderen verteidigt. Ein schaffender oder auch nur lenkender Gott wird abgelehnt. Die Seelen sind ewig, allgegenwärtig und viele.
Hinsichtlich des Außenweltproblems teilt die Mīmāṃsā den Realitätsglauben des Nyāya-Vaiśeṣika vollständig und hat ihn wie den Seelenglauben aufs schärfste gegen den Negativismus und Idealismus der Buddhisten (vgl. Kap. 9) verteidigt, so daß die Sage dem Kumārila die gewaltsame Austreibung der Buddhisten aus Indien zuschreibt, worin der historische Kern stecken wird, daß zur Zeit des Kumārila der orthodoxe Brahmanismus seine alte Vorherrschaft über weite Kreise, die dem Buddhismus zugefallen waren, wiedergewann.
Auch in der Einführung der Kategorien sehen wir unser System dem Vorgehen des Nyāya-Vaiśeṣika folgen. Von den sieben dort angenommenen Kategorien (Substanz, Qualität, Bewegung, Allgemeinheit, Besonderheit, Inhärenz und Nichtsein) hat die Kumārilaschule unter Ablehnung von Besonderheit und Inhärenz fünf für vollwertig erklärt, während die Prabhākaraschule Substanz, Qualität, Bewegung, Allgemeinheit und Inhärenz aus den vorhandenen auswählte und von sich aus noch Fähigkeit ( śakti), Aehnlichkeit ( sādṛśya) und Zahl ( saṃkhyā) hinzufügte, so daß sich acht Kategorien ergeben. Unter Śakti wird hierbei die Fähigkeit einer Substanz, Qualität, Bewegung oder Allgemeinheit verstanden, Ursache für eine bestimmte Wirkung zu werden. Die philosophisch nicht unergiebigen Erörterungen zur Verteidigung der angenommenen Kategorien und besonders zur Widerlegung der abgelehnten, können hier aus Raummangel nicht skizziert werden.
Wir müssen uns aber noch der speziellen Erkenntnistheorie der Mīmāṃsā zuwenden, die sowohl wegen ihres besonderen Standpunktes hinsichtlich der Wahrheit der Erkenntnis als auch wegen der Zahl und Art der dazu führenden Wege von Interesse ist. Dem Grundgedanken des Systems, der absoluten Autorität des ewigen Vedawortes entsprechend, steht unter allen Erkenntnismitteln die sprachliche Mitteilung an erster Stelle. Die Laute werden im Gegensatz zu den übrigen Systemen schon in den Mīmāṃsāsūtras für ewig erklärt, das Aussprechen eines Lautes ist in Wahrheit nur ein Offenbarmachen des immer vorhandenen. Auch die Verbindung eines Lautkomplexes mit seiner Bedeutung wird schon in den Sūtras »natürlich« ( autpattika) genannt [R159]. Ausdrücklich lehnt Prabhākara es ab, die Bedeutung auf menschliche Konvention oder göttliche Festsetzung zurückzuführen. Das einzelne Wort gewinnt aber nach ihm seine Bedeutung erst in Zusammenhang des Satzes ( anvitābhidhāna), während Kumārila die Selbständigkeit der Wörter bei der Zusammenstellung zum Satze lehrt ( abhihitānvaya). Beide Schulen aber stimmen mit dem Sūtraverfasser darin überein, daß die Bedeutung der Wörter immer auf den Allgemeinbegriff gehe und erst nachträglich ein Individuum bezeichne. Diese Theorie, die eng mit der Lehre von der Ewigkeit der Wortes zusammenhängt, hat zu ausführlichen Diskussionen mit dem Nyāya-Vaiśeṣika einerseits wie mit den Buddhisten andererseits geführt [R160]. Diese sprachphilosophischen Probleme, von denen hier nur einige angedeutet werden konnten, nehmen das Interesse der Mīmāṃsā in hohem Grade in Anspruch, weil allein das autoritative Wort des Veda Auskunft geben kann über den Inhalt der religiösen Pflicht ( dharma), auf deren rechte Erfüllung alle Bemühung der Mīmāṃsā gerichtet ist.
Außer der sprachlichen Mitteilung erkennt unser System auch die drei anderen Erkenntnismittel des Nyāya-Vaiśeṣika an: Wahrnehmung, logische Schlußfolgerung und Analogieschluß, natürlich mit mancherlei abweichenden Schattierungen im einzelnen, deren Besprechung hier nicht stattfinden kann.
Zu den genannten vier Erkenntnismitteln fügt unsere Schule als fünftes noch die selbstverständliche Annahme ( arihāpatti). Beispiel: Devadatta lebt, ist aber in seinem Hause nicht zu sehen, -- also ist er außerhalb des Hauses; oder: Devadatta ist fett, ohne am Tage Speise zu sich zu nehmen, -- also ißt er bei Nacht. Während die selbstverständliche Annahme von beiden Richtungen (wenn auch mit einer gewissen Divergenz hinsichtlich des springenden Punktes) als Erkenntnismittel anerkannt ist, wird das sechste Erkenntnismittel, das Nichtbemerken ( abhāva, anupalabdhi) nur von Kumārila angenommen, dagegen von Prabhākara abgelehnt. Kumārila erklärt, daß die Feststellung: »an dieser Stelle ist kein Topf« nicht als Wahrnehmung gelten kann, da Wahrnehmung Kontakt von Sinnesvermögen und Gegenstand (Abwesenheit des Topfes) fordere. Da auch die anderen Erkenntnismittel hier nicht anwendbar sind, das Bewußtwerden der Topfabwesenheit aber eine richtige Erkenntnis ist, so liegt ein besonderes Erkenntnismittel vor: das Nichtbemerken. Prabhākara dagegen sieht mit dem Nyāya-Vaiśeṣika hier nur eine gewöhnliche Wahrnehmung des Ortes, qualifiziert durch die Ueberlegung, daß ein Topf, wenn er da wäre, bemerkt würde [R161].
Alle die genannten Erkenntnismittel ergeben Erkenntnis. Wie steht es nun mit der Richtigkeit dieser Erkenntnis? Im Nyāya-Vaiśeṣika beruht die Richtigkeit auf dem normalen Ablauf des Erkenntnisprozesses, die Falschheit auf einem Mangel in diesem Ablauf, beide hängen also von anderen Faktoren ab. Im Gegensatz dazu behauptet die Mīmāṃsā, daß alle Erkenntnis durch sich selbst Autorität besitze ( svataiprāmāṇya), d. h. jede Erkenntnis ist an sich richtig, bedarf also zu ihrer Rechtfertigung keines andern Faktors. Dagegen muß die Falschheit einer Erkenntnis durch einen andern Faktor, nämlich durch eine entgegenstehende Feststellung konstatiert werden. In diesem Sinne sprechen die Mīmāṃsā-Anhänger bei Irrtümern (z. B. wenn man Perlmutter für Silber hält, wenn man die weiße Muschel infolge einer organischen Krankheit gelb sieht oder den Strick auf dem Wege in der Dämmerung für eine Schlange hält) nicht von »falscher Auffassung« ( anyathākhyāti), sondern von »Nichtauffassung« ( akhyāti). Die Schlange, die ich in der Dämmerung zu sehen glaube, ist für mich eine Tatsache und ich schrecke vor ihr zurück, -- einen Strick sehe ich nicht. In dieser Lehre von der Evidenz jeder selbständigen Erkenntnis (Erinnerung ist als von Früherem abhängig hier nicht einbegriffen) liegt eine wichtige Erfassung der psychologischen Schwierigkeit, welche das Verhältnis von Erkennen und Wirklichkeit bietet. Der ganze hiermit zusammenhängende Problemkomplex muß einer besonderen ausführlichen Erörterung, die der Verfasser für die Zukunft plant, vorbehalten bleiben, da im Rahmen dieses Buches nicht mehr als eine Andeutung Platz finden konnte. Das Problem der Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit der Richtigkeit bzw. Falschheit einer Erkenntnis hat die indischen Systeme mannigfach beschäftigt, wie der folgende im Sarva-darśana-saṃgraha aufbewahrte Memorialvers zeigt: »Richtigkeit und Falschheit gelten der Sāṃkhyaschule als selbst-evident, der Nyāyaschule als durch anderes zu erweisen; die Buddhisten erklären Falschheit für selbst-evident und Richtigkeit als durch anderes zu erweisen, für die Vedaerklärer (d. h. für die Mimāṃsā) aber besitzt Richtigkeit ihre Autorität in sich selbst und Falschheit ist durch anderes zu erweisen« [R162].