
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
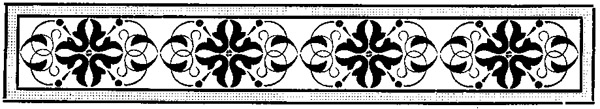
 Sie fühlen vielleicht mit mir den inneren Widerstreit, der in dem Titel unseres heutigen Stoffes zu liegen scheint; Sie fühlen, daß da zwei Begriffe ineinander gekettet sind, die sich ihrem Wesen nach eigentlich ausschließen.
Sie fühlen vielleicht mit mir den inneren Widerstreit, der in dem Titel unseres heutigen Stoffes zu liegen scheint; Sie fühlen, daß da zwei Begriffe ineinander gekettet sind, die sich ihrem Wesen nach eigentlich ausschließen.
»Auf dem Lande« – wem wird es bei diesem Gedanken nicht leicht und wohlig ums Herz, aber es ist nicht Tannengrün und Waldluft allein, was uns diese Stimmung giebt, sondern es ist ein Gefühl der Entlastung, das uns überkömmt. Man wähnt sich und die andern frei da draußen von dem Lärm feindlicher Gegensätze, und das erst macht den Sonnenzauber der Landluft zum Seelenzauber, das ist es, was so viele große thatenreiche Männer am Schlusse ihrer Laufbahn wieder zurückzieht in den Bannkreis ländlichen Lebens und ländlicher Arbeit. Auf dem Lande – bedeutet den Frieden.
Und wenn wir nun das andere Wort betrachten, das den Kern unseres heutigen Stoffes bildet, dann fühlen wir unwillkürlich ein gewisses Sträuben, denn es knistert durch dies Wort, wie elektrischer Funken. Wir fühlen uns hineingestürzt in das Gedränge gährender Geister und wogender Massen – der Zeitgeist bedeutet den Kampf.
Und zögernd fragen wir uns – ist es denn wirklich wahr, daß auch schon draußen im Bereiche stiller Beschaulichkeit und ländlicher Einfachheit jene unsichtbare, zersetzende Macht wirkt, die ein hundertjähriges Gefüge lockern und einer neuen Welt die Wege ebnen will – regt sich in der That auch auf dem Lande der Zeitgeist?
Noch vor zwanzig Jahren hätte man vielleicht vergeblich darnach gesucht, heutzutage würde man es vergeblich leugnen. Ja, auch auf dem Lande macht sich jene riesige innere Umgestaltung fühlbar, in der wir den Zeitgeist erblicken, wenn er auch natürlich nicht jene vulkanischen Äußerungen zeigt, die das Leben der großen Städte erschüttern. Es ist nur wie ein grollendes Echo, wie ein Wellenschlag, der sich abgeschwächt auf die Peripherie überträgt, aber leugnen kann ihn keiner, der mit scharfen Augen in unser Volksleben hineinblickt.
Ich aber habe mir nun die Aufgabe gesetzt, Sie etwas näher und tiefer einzuführen in diesen geheimnisvollen Prozeß des Werdens, in diese geistige Umwandlung der alten in die neue Zeit. Ich möchte Ihnen zeigen, welche Elemente und Faktoren es vor allem sind, die als die treibende Kraft und als die Hebel dieses Umschwunges in Betracht kommen, welche Charakterzüge des Volkes zumeist dadurch berührt und geändert werden, und welche Grundlinien des bäuerlichen Lebens sich hinwiederum als ein Damm der Verneuerung entgegenstellen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man heutzutage auf dem Lande über die großen Fragen des Lebens denkt und wie sich dieses Denken dann bethätigt in Handel und Wandel, in Moral und Intelligenz, in Arbeit und Genuß.
Wenn ich dabei ganz allgemein »vom Lande« rede, so mag sich diese generelle Bezeichnung damit rechtfertigen, daß eben die ländlichen, d. h. die bäuerlichen Verhältnisse doch allenthalben unter denselben Grundbedingungen stehen, ob wir nun nach Norden oder nach Süden schauen. Im einzelnen aber ist es wieder Baiern und speziell das bairische Oberland, dessen Zustände ich Ihrer Betrachtung unterbreiten möchte. Und es eignet sich auch in der That das bairische Hochland zu dieser Betrachtung in vorzüglicher Weise, weil es einerseits durch seinen Bergcharakter die alten Ideen und Lebensformen besonders lange und intensiv erhielt, und weil es dann durch den plötzlichen immensen Fremdenverkehr dem Einfluß der modernen Zeit unendlich mehr geöffnet wurde, als das Flachland.
Und wie wirkt nun auf dies Volk der Berge jene rastlos schaffende und zerstörende Macht, die wir den Zeitgeist nennen? – Aber wir müssen zuerst uns fragen: Was ist der Zeitgeist? Das Wort hat einen dämonischen, gewaltthätigen, unsympathischen Klang – wer möchte dies leugnen? – Es hat ihn deshalb, weil sein Wesen ewig wandelbar, weil seine Anforderungen immer ungenügsam, weil sein Dasein unvertilgbar ist. Weil wir uns niemals sagen können, daß irgend eine Erklärung diesen Begriff ganz erschöpft, daß irgend eine Befriedigung ihn dauernd verstummen macht. Daher kommt jene eigentümliche Unruhe, mit der auch die schärfsten Denker diesem Worte stets gegenüber standen, das sich rastlos wandelt vor dem grübelnden Verstande. Wenn wir vom »Geiste unserer Zeit« sprechen, so haben wir dabei vor allem das positive Gefühl der Errungenschaften, welche die Gegenwart uns gebracht hat oder erstrebt, aber sowie wir vom »Zeitgeist« reden, beherrscht uns unwillkürlich eine negative Empfindung; wir fühlen das zerstörende Moment heraus, das minenartig in diesem Worte lagert, wir fühlen die aggressive Spitze des Werdenden gegen das Bestehende. Das Wort ist vielleicht das modernste, das wir im Munde führen, und dennoch ist es so alt als die Erde; sein Stachel war es, der die Sklaven Roms um Spartakus versammelte und die deutschen Bauern um den Bundschuh; seine Marksteine sind 1789 und 1848; wie eine Hydra schlingt es sich durch die Geschichte der Staaten. Und vergeblich haben Genie und Macht sich gemüht, es zu überwinden.
Das einzige Ziel aber, das der »Zeitgeist« in unseren Tagen sich gesetzt – ich glaube, es ist die schrankenlose Freigebung, die unersättliche Bethätigung der individuellen Persönlichkeit. Das Ich macht sich überall geltend auf Kosten des Ganzen, und das Recht auf Kosten der Pflicht, selbst bei den niedrigsten Existenzen hat dieser Gedanke eine wuchernde Kraft gewonnen und fast völlig ist jenes lindernde Moment verloren gegangen, das die Weisheit geistig beschränkterer Zeiten war – die Resignation. Schon frühe hat die Rechtsordnung es als einen Teil ihrer ethischen Aufgabe betrachtet, die Befreiung des Individuums auf gesetzlichem Wege anzubahnen, sie gab den Menschen frei, indem sie Hörigkeit und Leibeigenschaft beseitigte; sie hat von seiner Arbeitskraft und seinem wirtschaftlichen Leben allmählich jedes Hemmnis fremder Privilegien hinweggeräumt, sie gab ihm die Gründung einer Familie fast bedingungslos anheim, ja sie hat das Individuum selbst auf dem letzten und höchsten Gebiete, auf dem politischen, emanzipiert, indem sie dem Proletarier das allgemeine Stimmrecht gab.
Wer diese Riesenarbeit überblickt, welche die Legislative in den letzten Jahrzehnten vollbracht, um die individuelle Persönlichkeit des einzelnen nach allen Seiten hin zu erlösen, der kommt fast auf den Gedanken, es habe der Staat in ahnungsvoller Sorge den begehrlichen Zeitgeist gleichsam entwaffnen wollen, indem er den Ansprüchen desselben in vornhinein gesetzliche Befriedigung verlieh. Aber alles, was man gegeben, war zu wenig und zu viel, – zu viel für das geringe Pflichtgefühl, wie es den heutigen Massen innewohnt, zu wenig für die unersättlichen Ansprüche derselben! Denn die Mehrzahl begnügt sich nicht mit der Gleichheit Aller vor dem Gesetze, sondern sie will eben die Gleichartigkeit oder doch den Ausgleich der wirklichen Lebensverhältnisse, die soziale, die wirtschaftliche, die moralische Nivellierung; sie erblickt auch im wohlerworbenen Rechte des Nächsten nur ein drückendes Vorrecht und dieser Gedanke ist es, der unablässig den Zeitgeist zum Kampfe befeuert. Dieser Kampf ist natürlich unermeßlich geschärft und zündender in den Arbeiterschichten der großen Städte, aber wirksam ist er auch bereits in der bäuerlichen Bevölkerung, auf dem platten Lande, wenn er auch dort zunächst noch mehr das Absterben der alten Traditionen, als den Sieg neuer Ideen bedeutet.
Sie alle wissen es aus eigener Erfahrung, wie tief sich die Lebensverhältnisse auch auf dem Lande seit den letzten 10 Jahren geändert haben. Sie kennen wenigstens die Thatsache, wenn Ihnen auch die Einzelheiten, die inneren Momente dieses Umgestaltungsprozesses ferner liegen; Sie können mit Händen greifen, wie der Fremdenverkehr und die Eisenbahnen täglich neue Begriffe hinaustragen, wie die allgemeine Wehrpflicht, die Vervollkommnung der Schule, die Verbreitung der Tagesblätter u. s. w. wirkt. Es wäre einseitig, die wirklichen Verbesserungen, welche die Neuzeit damit schuf, zu verkennen. Eine Fülle gemeinnütziger Einrichtungen, die man vordem nicht kannte, entstand, mancher Zug wahrer Humanität begegnet uns. Der materielle Wohlstand und der Durchschnitt geistiger Bildung ist gleichmäßig gewachsen, und wieviel ist schon allein das Bewußtsein wert, daß der Bauernstand nun keine abgeschlossene oder richtiger ausgeschlossene Kaste mehr im öffentlichen Leben bildet!
Das alles sind bedeutsame Errungenschaften, die das ländliche Dasein der Neuzeit verdankt, aber zur vollen Gültigkeit, zur durchgebildeten Wirklichkeit sind sie freilich noch keineswegs gediehen. Wir stehen auf einer Übergangsstufe und bei jedem Übergang sind die Schatten fühlbarer als das Licht; der Nutzen zeigt sich erst später, die Unzuträglichkeiten zeigen sich sogleich. In doppeltem Maße aber gilt dies bei dem Bevölkerungselement der niederen Schichten, das sich schwerer accomodiert, weil es minder elastisch ist, das den Ausgleich zwischen früherer Gebundenheit und plötzlicher Freiheit unmöglich sofort zu finden weiß. Es fällt rasch heraus aus der bisherigen Rolle und wächst nur langsam hinein in seine veränderte Stellung, es löst sich ab vom bisherigen Brauch und hat doch noch keine andere sichere Tradition für die Zukunft: mit einem Wort, man ist zu klug geworden für die alte Zeit und noch nicht reif genug für die neue. Das ist der Zustand unseres heutigen Bauernlebens, das ist der Zeitgeist auf dem Lande.
Der wesentlichste Umschwung aber, den das äußere Leben unsers Bauern durch die neue Zeit erfahren hat, liegt jedenfalls darin, daß ihm das spezifisch ständische Bewußtsein mehr und mehr abhanden kommt, welches er früher im guten, wie im schlechten Sinne besaß. Ehedem war er Bauer und nichts als Bauer, aber das auch ganz, vom Wirbel bis zur Zehe; er sah und er wollte nicht heraus aus seiner enggeschlossenen Sphäre, sein ganzer Zusammenhang mit der Weltgeschichte war die Schranne. Trotzig hielt er jedem anderen Stande seinen eigenen – den Nährstand – entgegen und durch sein Gespräch, wenn er sich überhaupt aufs Vergleichen einließ, klang stets der stolze Refrain, den man bisweilen noch in alten Bauernhäusern auf gemalten Tafeln findet:
Ich lasse den lieben Herrgott walten
Ich muß euch doch allesamt erhalten.
Heutzutage ist der Bauer ein Bürger – so paradox dies Wort auch klingen mag, oder doch ein Staatsbürger, der unablässig mit allen möglichen öffentlichen Dingen befaßt wird; seine ganze Persönlichkeit ist auf ein anderes Niveau gestellt. Bedenken Sie doch, daß es der bäuerliche Bürgermeister ist, der als Standesbeamter die junge Fürstin traut, wenn dieselbe auf dem Stammsitz ihrer Ahnen Hochzeit hält, daß Bauern zu jener Richterbank berufen waren, welche den Grafen Chorinsky verurteilten, daß der Bauer im offiziellen Coupé I. Klasse nach Berlin fährt, um dort dem Reichstag sein »Nein« zu bringen. Solche Umstände muß man erwägen, um zu begreifen, wie tief sich seine persönliche Stellung seit einem Jahrzehnt gewandelt hat und wie der lokale Wirkungskreis derselben endgiltig durchbrochen ist. Auch früher hatte ja der Bauer unleugbar einen starken Trieb zur persönlichen Geltendmachung, zur Repräsentation; es ist kein Märchen, daß man in Niederbaiern bei festlichen Zusammenkünften die Wagenräder mit Champagner wusch, selbst die Pferde, die den »Kammerwagen« seiner Tochter zogen, erhielten z. B. im Rosenheimer Bezirke vor jedem Wirtshaus zwei Maß Bier in den Barren, – aber ein Zug war doch allen diesen Äußerungen des Bauernstolzes gemeinsam – der Bauer blieb damit in seiner heimischen, bäuerlichen Sphäre. Ja es war gerade das ein Teil seines Stolzes, daß er von dem nichts wissen wollte, wodurch die übrigen Leute sich geltend machten. Er war sich selbst genug und lebte mit der äußeren Welt in einem permanenten negativen Kompetenzkonflikt, indem er Hunderte von Dingen mit dem inapellablen Bescheide abwies: »Dös geht mi' nix an.« Jetzt ist dies umgekehrt geworden, sein Stolz besteht heute nicht mehr darin, daß ihn die Dinge nichts angehen, sondern vielmehr darin, daß er »auch dabei« ist; es ist Mode in seine Passionen hineingekommen. Er muß sein »Laufroß« vor dem Einspänner haben, anstatt der dicken gutmütigen Bauernstute, womit sein Vater fuhr; er wettet wie andere Freunde des Sport und ambitioniert es entschieden, daß er z. B. bei landwirtschaftlichen Festen oder dergleichen Gelegenheiten als Sachverständiger oder Preisrichter erscheint. Noch vor Jahrzehnten kam der Bauer höchstens einmal im Leben in die Stadt und dann war es mit dem Reisen so ziemlich vorbei bis zur Reise in die Ewigkeit; jetzt können Sie jeden Tag ganze Reihen im Münchener Vergnügungslokale finden; der Marktschreier druckt auf seine Plakate »für die Herren Landleute« und sogar im standesamtlichen Register heißt es »Ökonom« statt »Bauer«. So beginnt selbst der Name zu wanken und eine Thatsache von tiefster kulturgeschichtlicher Bedeutung tritt uns aus diesen Wandlungen, wie wir sie eben dargestellt, entgegen: Die räumliche Abgeschlossenheit, in welcher der Bauer früher lebte, ist für immer zerbrochen, seine Persönlichkeit ist hinausgewachsen über die Schranken seines Besitzstandes, mit welchen sie vordem unzertrennbar verknüpft war, – und damit sind auch die Besitzverhältnisse selbst wankend geworden. Ihre einstige Bürgschaft war ja eben jener trutzige Stolz eines abgeschlossenen Charakters, der sich um keinen Preis loslösen oder wegheben wollte von der ererbten Scholle; ihre heutige Lockerung wurzelt eben darin, daß dieser Charakter gelockert ward unter dem rastlosen Drange persönlicher Geltendmachung. Er selber geht der Versuchung nicht nach, aber sie kommt zu ihm und spiegelt ihm hundertmal den Gedanken vor, ob er sich nicht eigentlich noch viel stattlicher ausnähme, wenn er mit den 80,000 Mark, die sein Hof etwa wert ist, den Rentier spielte? Denn Nichtsthun bleibt nach bäuerlichen Begriffen doch immer noch das vornehmste von allem.
Zahllose Spekulanten, die allerwärts auf der Lauer liegen, greifen diesen Gedanken auf und so werden jene hunderte von uralten Gehöften oder »Heimaten«, wie sie der Volksmund tiefsinnig nennt, alljährlich zertrümmert; es ist nicht der Unverstand der einen und nicht die Habsucht der andern allein – es ist der Zeitgeist, der sie verschleudert. Die Persönlichkeit des Bauers ward mobilisiert aus ihrer hundertjährigen abgeschlossenen Ruhe, aber mit seiner Persönlichkeit ist auch seine Habe mobil geworden aus ihrer alten Unantastbarkeit. Das ist der erste und tiefste Schatten, der auf dem Lande den Wahlspruch unserer fortgeschrittenen Zeit begleitet: »Es werde Licht.«
Allein auch da, wo keine leichtfertige Veräußerung erfolgt, wo der Bauer nicht ans Verkaufen denkt, sondern selber noch wirklich arbeiten will, ist schon diese Arbeit an sich unendlich anders geworden, als vordem. Der ganze landwirtschaftliche Betrieb hat neue Ziele; denn während unser Bauer sonst den Ertrag von Ackerbau und Viehzucht nur zum eigenen Bedarf verwertete oder den Überschuß höchstens an Ort und Stelle abgab, ist jetzt alles Handelsobjekt geworden, er spekuliert und ist mit Eifer darauf bedacht, wo möglich auch die Verarbeitung des Rohproduktes in der Hand zu behalten. Es ist ein konformer Zug – wie in seine Persönlichkeit eine Art von bürgerlicher Repräsentation hineinkam, so hat auch seine Arbeit eine Art von industriellen und kommerziellen Zusatz erhalten, welcher derselben das spezifisch bäuerliche Gepräge nimmt. Rein wirtschaftlich betrachtet wäre dies ja wohl ein Fortschritt, wenn nur auch der Bauer stets die richtigen Hände dafür hätte, aber in der Regel ist leider das Gegenteil der Fall; denn kein Stand ist so wenig zur Vielseitigkeit veranlagt und erzogen – und doch spürt keiner von allen soviel Neigung zum Probieren. So zeigt uns auch hier der Geist dieser neuen Zeit sein doppeltes Walten, er steigert auf der einen Seite den Betrieb und die Thätigkeit der bäuerlichen Wirtschaft aufs höchste und giebt ihr zahllose Impulse, aber mit einer Art von heimtückischer Verblendung lockt er wieder zugleich den einzelnen hinaus über die Grenzen seiner Kraft.
Nicht nur durch die Passion, zu verkaufen, die wir oben geschildert haben, sondern auch durch diese Art des Betriebes, durch diesen Hang industrieller Vernutzung ist der ländliche Besitzstand bereits vielfach gefährdet, weil der Bauer zu viel beginnt und sich als Geschäftsmann gebahren möchte, ohne ein Geschäftsmann zu sein. Vor allem hat er eine unleugbare Schwäche, er kann mit dem Bargeld nicht umgehen, entweder legt er es als Sparpfennig nutzlos in den Strumpf, oder wenn es verwendet wird, so wird es meist ebenso nutzlos verschwendet. Allein selbst da, wo der Bauer sein mobiles Vermögen zinstragend anlegen möchte, geht er gewöhnlich den verkehrtesten Weg – nicht bei den Kapitalisten der großen Städte, sondern auf dem Lande, bei unseren Knechten, Fuhrleuten und Taglöhnern müssen Sie Spanier- und Türkenlose und jene Ratenbriefe suchen – »Gottes Segen bei Cohn«. Ich habe sie nicht zu dutzenden, sondern zu hunderten dort gefunden, und es ist geradezu unglaublich, wie hilflos der Bauer der Verwertung des mobilen Kapitals noch heute gegenüber steht. Ein Lenggrieser Holzknecht, der für 100 fl. gute bairische Staatspapiere gekauft, sprach nach einiger Zeit ganz traurig zum Gutsverwalter von Hohenburg: »Jetzt hab i g'moant, i hab ebbes Guats und daß mir der Staat mei' Interessa zahlt – jetzt wart i schon 2½ Jahr und der Spitzbua is no' nit kemma«. Das Papier wurde sofort besichtigt und die Coupons der fünf Semester waren unversehrt an demselben – aber der Holzknecht wollte von weiterem Besitz nichts wissen und meinte: »Dös g'hört si' halt do' nit, daß i da erst an andern anpacken muß, er sollt halt doch selber kemma und mir mei Interessa zahlen«. Das Brachliegen des baren Geldes ist übrigens durch das Mißtrauen, das man der neuen Währung entgegenbrachte, noch bedeutend vermehrt worden. In einem Zuge, mit dem ich voriges Jahr über Holzkirchen nach München fuhr, befand sich ein interessantes Frachtstück – ein Bierfaß, dessen Inhalt aber nicht für den Magen, sondern für die bairische Münze bestimmt war. Der Bauer, dem es gehörte, hatte kurz vorher einem Vertrauensmanne mitgeteilt, daß er noch einiges alte Silbergeld besitze, weil er eben doch nicht glauben konnte, daß die »lumpigen Markln obenauf bleiben«. Nun aber werde ihm doch allmählich Angst.
»Is's viel?« frug der Vertraute teilnahmsvoll. Ja wenig nit (erwiderte der andere) 50,000 Gulden halt, lauter Zweiguldenstückl.
Natürlich giebt es auch nach der entgegengesetzten Seite bemerkenswerte Ausnahmen, es finden sich ab und zu auch Bauern, die in der That mit ingeniösem Blick ihr Kapital zur Arbeit zwingen und einen industriellen Betrieb in Flor bringen. So steht z. B. im Mangfallthal ein altes mächtiges Gehöft, zum Schmerold geheißen, das schon in Urkunden von 1017 mit demselben Hausnamen vorkommt; der Vater, ein unruhiger Kopf, war 1848 nach Amerika geflüchtet und so übernahm der Sohn, nachdem er mit 18 Jahren großjährig erklärt worden war, das elterliche Gut. Er war kein Kopfhänger, der etwa Stall und Pflugschar verabsäumt hätte, im Gegenteil, er war so tüchtig, daß er als 25jähriger Mann zum Bürgermeister seiner Gemeinde erwählt ward. Aber er besaß die beneidenswerte Gabe, Lebensfrohheit und Lebensernst zu verbinden; statt müßig zu sein in freien Stunden, las er und sein Lieblingsbuch war die – Physik von Eisenlohr. Bedenken Sie es, welche Mühe, welche Geduld, welcher Heroismus nötig ist, um mit den Vorkenntnissen eines Bauernjungen ein solches Buch durchzulesen, er aber sah dabei hinunter auf die grüne Mangfall und dachte sich, warum doch eine so prächtige Wasserkraft ganz unbenützt vorüberrauschen sollte. Dann zeichnete er selber den Plan für eine kleine Fabrik, er kam in die Stadt, um die nötigen Maschinen kennen zu lernen und zu studieren, und da es mit den heimischen Arbeitern nicht gehen wollte, so nahm er ohne weiters Italiener in seinen Dienst und lernte italienisch, um sich mit ihnen zu verständigen. Schon übers Jahr stand eine kleine, aber blühende Papierfabrik am Ufer unter dem alten Bauernhofe, der unverändert betrieben wird; der Schmeroldbauer selbst aber ist die ganze Nacht auf den Beinen, denn die Bestellungen sind so zahlreich, daß selbst des Nachts gearbeitet werden muß. All das aber sind, wie wir es bereits erwähnten, seltene Ausnahmen, hunderte gehen darüber zu Grunde, bis Einem solcher Erfolg zu teil wird.
Fassen wir das Gesagte zusammen, so hat sich das Wesen der bäuerlichen Arbeit im allgemeinen ebenso tief geändert, wie das der bäuerlichen Persönlichkeit, die Arbeit ist freier geworden in ihrem Betriebe, aber nicht in ihrer Auffassung; sie hat den Fluch verloren, der sie zu Zeiten der Hörigkeit bedrückte, aber auch den Segen, der ihr eigen war, bevor der Zeitgeist sie zur schrankenlosen Gewinnsucht entarten ließ.
Am deutlichsten aber zeigen sich diese Übelstände bei dem dienenden Teile der bäuerlichen Bevölkerung; hier ist der Rückgang, den das ehrliche, pflichttreue Arbeiten erfahren hat, wohl am empfindlichsten. Ich kenne eine alte Grabschrift aus dem Freisinger Gaue von 1650; ein Bauer ließ den Knecht, der 56 Jahre bei ihm gedient, in seinem Familienbegräbnis beisetzen und auf dem Steine steht eine Heugabel, ein Rechen und ein Schubkarren und in der Kreuzung das Diktum
»Da liegt der Herre bei seinem Knecht
So ist es recht.«
Es ist wohl die letzte Gerechtigkeit gemeint, vor welcher wir alle gleich sind, der heutige Knecht aber will schon bei Lebzeiten diese Devise verwirklichen. Die 56 Jahre freilich werden dabei für entbehrlich gehalten, es dauert, wenn es gut geht, ebenso viele Wochen; dann will man es wieder einmal anderswo »probieren«, schon um der Abwechslung willen, und vielleicht läßt sich ja auch ein neuer Vorteil erzwingen. Daß man auch seines Herren Vorteil zu wahren hat, das ist heutzutage selbst auf dem Lande fast völlig vergessen, die Dienstboten erfüllen im besten Falle knapp ihre Obliegenheit, aber sie sind nicht mehr wachsam besorgt, um dem Haushalt hier einen Nutzen zu sichern und dort eine Schädigung zu ersparen, sie fühlen sich nur in einem Vertragsverhältnis, nicht mehr in einem Verhältnis zur Familie, unter deren Dach sie wohnen. Verschwunden ist jenes Ehrgefühl, das den höchsten Stolz in die vollste Erfüllung der Pflicht setzt, man freut sich wenig des Lobes und schämt sich noch weniger des Tadels – denn der ganze Ehrgeiz ist auch hier nach außen gerichtet auf die Geltendmachung der Persönlichkeit. Wenn man die Arbeit versäumt, das macht nichts, aber den Tanzboden zu versäumen, das wäre ein Unglück. Ein junges Mädchen, das voriges Jahr auf einem Einödhofe in Tegernsee in Dienst treten sollte, wies das vorteilhafte Angebot zurück, weil die Gelegenheit zu ungünstig sei, um hier eine Liebschaft anzufangen. »Schau (sprach sie ganz offen zur Bäuerin) 's is überall z'weit hin und überall z'weit her«.
Ebenso ist es ein kleines, aber doch unendlich vielsagendes Symptom, daß man seit einiger Zeit den biederen Namen des »Hausknechts« allgemein in »Hausmeister« verwandelt hat; nur so ruft jetzt der Wirt oder Posthalter in den Stall, wenn eingespannt werden soll, und der ahnungslose Fremde, der von diesem sozialen Ereignis noch nicht unterrichtet ist, riskiert ohne Antwort zu bleiben, wenn er den neben ihm stehenden Träger der Zipfelhaube als »Hausknecht« interpelliert. Hier liegt in der That in dem Wechsel zweier Worte der Wechsel zweier Zeiten begriffen: der Knecht will Meister werden.
Wenn er es nur auch an Tüchtigkeit, an Verlässigkeit, an Pflichtgefühl geworden wäre, aber diese Entwicklung steht zur andern leider im umgekehrten Verhältnis. Das wissen übrigens auch die Leute selber ganz gut, ich besitze das Manuskript höchst origineller und anmutiger Gedichte, die eine Bauerntochter von Glashütten verfaßt hat, welche als Magd im Bade Kreuth dient. Das Thema derselben ist mit reizender Naivität gewählt – es behandelt die Schlechtigkeit der heutigen Dienstboten und ich würde Ihnen sehr gerne ein paar Pröbchen davon mitteilen, wenn dieselben nicht gar zu naturalistisch wären.
So hat denn auch auf diesem Gebiete der Zeitgeist seine zersetzende Kraft erprobt, er hat die Verhältnisse des bäuerlichen Dieners nicht nur äußerlich gefährdet, sondern innerlich gelockert, er hat Knecht und Magd abgelöst aus dem uralten häuslichen Zusammenhange, in dem sie sich ehemals sicher und trotz bescheidener Stellung oft stolz und glücklich fühlten, und hat ihnen jenen Zug von individuellem Selbstgefühl gegeben, zu dessen Befriedigung doch die individuellen Mittel fehlen. Überall will auch hier die Persönlichkeit sich geltend machen; es genügt ihr nicht, als dienendes Glied in der großen Kette zu stehen, und darum ist es auch so schwer, ja fast unmöglich, sich mit aller Rücksicht, Freigebigkeit und Güte noch ein Gefühl persönlicher Ergebenheit zu sichern. Es giebt fast keinen Dank in diesen Kreisen mehr – man fühlt sich angehängt, nicht anhänglich. Im Wappen der englischen Thronfolger steht der hundertjährige Wahlspruch »Ich dien«, der deutsche Bauernjunge hat zu viel Selbstgefühl, um dieses Wort zu ertragen.
Die Erschütterung, welche die bäuerlichen Dienstverhältnisse auf solche Weise erfahren haben, ist vielleicht der größte und schlimmste Erfolg, welchen der Zeitgeist bisher in der Landbevölkerung zuwege brachte, denn einer der ältesten und festesten Organismen ward dadurch getroffen.
Noch geringeren Widerstand boten seinem Einflusse naturgemäß von Anfang an die Handwerksverhältnisse dar, die auf dem Dorfe ja ohnedem stets stiefmütterlich vertreten waren. Die wenigen Gewerbe, welche früher dort Zulaß hatten, besaßen ein Monopol und arbeiteten schlecht; die neueren, die mit der Freigabe hinzukamen, schufen zwar einige Rivalität, aber sie erhöhten die allgemeine Leistungsfähigkeit nur wenig und blieben numerisch doch immer sehr gering. So ist der eigentliche Handwerker- und Arbeiterstand, der ja in großen Städten die soziale Bewegung trägt, auf dem Lande nur ein verschwindender Hebel für den Zeitgeist; tief geändert und zwar nicht zum besten wird freilich auch dieses Gebiet der Arbeit durch die sogenannten modernen Ideen.
Der Gewerbsmann auf dem Lande ist noch altmodisch und schwerfällig in allen Dingen mit Ausnahme der Rechnung; die geringe Konkurrenz und der Umstand, daß der Konkurrent es eben auch nicht anders macht, befähigt ihn, so ziemlich nach Belieben mit den Kunden zu verfahren. Noch mehr als in den Städten lassen sich hier halbausgelernte Leute nieder, die natürlich auch nur halbe Arbeit liefern; die Klage, daß es nichts zu thun giebt, ist auch draußen allgemein, aber was man bestellt, wird niemals rechtzeitig fertig, und die Unsolidität unserer Erwerbsverhältnisse, bei der es häufig nur darauf ankommt, Geld zu verdienen, ohne daß man sich darum kümmert, was man dafür leistet, ist auch dort schon in bedenklichem Maße entwickelt. Ungescheut werden die Nahrungsmittel gefälscht, nicht hinter dem Rücken, sondern in Gegenwart der Kunden gießt die bäuerliche Milchfrau das entsprechende Wasser in den Kübel und der Butterhändler erklärt ganz offen, daß er dies Jahr schlechtere Ware geben werde, weil das Geschenk, das man ihm mitgebracht, ungenügend ausgefallen sei. In Tegernsee ist nur dann Sauerkraut zu bekommen, wenn mehrere Personen zufällig solches wünschen, denn wegen einer einzelnen ist es zu mühsam, den schweren Stein vom Fasse zu heben; die Köchin, die nach dem Preise von Eiern frägt, erhält die Antwort: »Kaufen S' eine? Wenn S' keine kaufen, na' brauchen S' es nit z'wissen, was s' kosten, na' geht's Ihne z'erst nix an.« Einem Handwerker, der im Hause etwas auszubessern hatte, war über den Lohn hinaus ein Trinkgeld von drei Mark versprochen worden, damit er die Sache auch gewiß recht machen möge, er aber erwiderte: »Was, nur drei Mark? – um dös kann ich's nit recht machen!« Welcher Abgrund thut sich auf hinter dieser offenherzigen Antwort, welches Streiflicht fällt damit auf unseren ländlichen Gewerbsbetrieb! Das populärste aller Gewerbe aber ist draußen leider das Wirtshaus und die brennendste Frage für die ganze ländliche Gewerbspolitik liegt gerade in der unverhältnismäßigen Vermehrung dieses Zweiges, in dem förmlich alle schlimmen Neigungen zusammentreffen. Der Hang bequem und ohne wirkliche Arbeit Geld zu machen, verlockt eine Menge kräftiger junger Leute, eine Wirtschaft zu begründen, und der neue Gründer, der nun in Hemdärmeln unter der Thüre steht, dünkt sich dann in der Regel noch um 100 Prozent erhaben über den Bauer, der vor seinen Augen auf dem Felde ackert; die vermehrte Gelegenheit schafft natürlich auch vermehrten Besuch, nicht soviel freilich, um den Unternehmer vor dem Bankerott zu schützen, aber doch genug, um so und soviel Müssiggänger gleichfalls zum Bankerott zu bringen. Früher gab es überall nur ein einziges stattliches Gasthaus im Orte; da war der Wirt noch in der That persona publica und hielt mit eigener Hand gewaltige Hauspolizei, jetzt finden Landstreicher und halbgewachsene Bursche in Winkelkneipen willkommene Unterkunft, und wenn das Gespräch augenblicklich verstummt, sobald ein Unberufener in die Stube tritt, mag man daraus wohl folgern, was dort besprochen wird. Die vielgerühmte Sicherheit des Eigentums, die noch vor fünfzehn Jahren im bairischen Oberland jeden Verschluß entbehrlich machte, ist jedenfalls nicht das Endziel dieser Debatten.
Der Jackel steht vom Wirtstisch auf,
Dem kann dös Bier fein an!
»Jetzt,« sagt er, »muaß i's halt probiern,
Ob i no' hoamgehn kann?
Und wenn i nimmer gehn kann, woaßt
(So hat er g'sagt), woaßt was?
No ja, na' kimm i wieder z'ruck,
Na' – trink' ma no' a Maß.«
Der Posthalter jammert: i bin nit z'neiden –
Heuntz'tag, dös san scho' schlechte Zeiten!
Bringst oan a recht a G'fraaß
Recht schlechtes Essen. daher,
Ja schaug, dös frißt dir koaner mehr.
Is 's Bier verderbt, dös spannen s' g'schwind,
Bist grob, na' bleibst von anfang hint.
Bleibst du im Nachteil.
Na' sollst no' sauber sein dabei,
Dös is ja do' a Sauerei!
Ja, so a Wirt is nit zum Neiden,
Heuntz'tag, dös san scho' schlechte Zeiten:
Und 's schlechtest is no' dös – jawohl!!
Daß aa no' alles guat sein soll!
Ich habe versucht Ihnen bisher zu zeigen, wie sich der Zeitgeist auf allen großen Gebieten des ländlichen Lebens geltend macht, wie er die Persönlichkeit des Bauers umgestaltet und seiner Arbeit ein anderes Gepräge gab, wie die Besitz- und Dienstverhältnisse davon berührt wurden, wie die gewerbliche Thätigkeit darunter litt, aber ebenso deutlich und scharf zeigt sich dieser Wandel im hundertfältigen kleinen Alltagsleben. Unverkennbar tritt allenthalben das Bestreben zu Tage, es den bürgerlichen Ständen und dem städtischen Elemente nachzumachen. Noch vor 15 Jahren wußte kein Mensch im bairischen Oberland etwas von Polka oder Schottisch und jetzt hört man dieselben auf jeder Kirchweihe spielen; welcher Bauer kannte damals die Photographie und nun läßt jeder Hüterjunge sich in seinem Sonntagsstaat »portographieren«, wie der technische Ausdruck lautet; es ist natürlich nicht Kunstsinn, denn die Maler wissen gar wohl, wie mächtig sich der Bauer älterer Ordnung sträubte, wenn man ihn ja einmal ins Skizzenbuch »abschreiben« wollte; sondern es ist Mode, Selbstgefühl, es ist die Zeit. Daß dem in der That so ist, das zeigt der naive Ausspruch eines Bairischzeller Knechtes, der vor dem Bildnis einer Preiskuh kopfschüttelnd sprach: »Na na, dös is do' schandvoll, die Hoffart heutigstags, jetzt laßt sich's Viech aa noch photographieren.«
In den bäuerlichen Haushalt sind natürlich durch die erleichterten Verkehrsmittel ebenfalls eine Reihe von Geräten und Gebrauchsartikeln hineingekommen, von welchen man vordem keine Ahnung hatte; am populärsten von allen aber ist unleugbar das Petroleum geworden, das man jetzt fast in jeder Holzhauerhütte findet. Es ist dies um so merkwürdiger, wenn man die lange, mannigfache Opposition bedenkt, die sich hiegegen in städtischen Kreisen erhoben hatte.
Verhältnismäßig am wenigsten hat sich die Nahrung geändert, weit mehr ist dies mit Kleidung und Tracht der Fall; die Nahrung ist eben eine ganz interne Angelegenheit des Hauses, das Kleid aber wirkt nach außen und ist ein Stück Repräsentation. Hier zeigt sich indessen ein merkwürdiger Unterschied zwischen der Neuerungssucht der Männer und dem konservativen Geiste der Frauen; denn während die Tracht der Frauen fast unverändert dieselbe blieb, gehören Kniehosen und Wadenstrumpf schon zu den Seltenheiten. Es meinte zwar ein schalkhafter Bauer, als man beim Wirt von Gmund die Ursachen dieses Rückganges besprach, es gebe deshalb keine Wadelstrümpfe mehr, »weil s' keine Wadeln nimmer haben,« allein der wahre Grund liegt auch hier ein wenig tiefer, er liegt in dem unaufhaltsamen Drang zur Nachahmung, zur Nivellierung. Fast allenthalben herrscht jetzt das lange Beinkleid; auch die Joppe, die übrigens nicht bairischen, sondern tirolischen Ursprungs ist und die vor 60 Jahren noch kein Mensch im bairischen Hochland trug, weicht bereits vielfach dem dunklen Wamms, am sichersten aber ist der Wechsel der Mode aus dem Hute zu erkennen und der Hut bedeutet nicht selten den Kopf.
Ganz fundamentalen Einfluß hat übrigens die Zeit auch auf den Kreis der volkstümlichen Vergnügungen und Zusammenkünfte geübt. Hier wird vor allem das politische Element recht merkbar, wenn wir es so nennen wollen, das Interesse, die neugierige Teilnahme an dem, was draußen in der Welt geschieht; hier, wo er unter den Leuten und im öffentlichen Verkehr steht, fühlt sich der Bauer doppelt als einen Mann, der »auch dazu gehört.« Und hier zeigen sich auch manche förderliche und originelle Seiten.
Bei einem Kirchgang im Neuhaus stichelte ein Tiroler auf die Baiern, da erhob sich jählings ein Bursche von Ellbach und rief mit dröhnender Stimme: »Tirolerspitzbub, red nit alleweil bloß von die Boarn, du muaßt schon wissen, daß d' mit an Deutschen redtst!« Und dann hielt er ihm vor, wie er es wagen könne, über die Grenze ins Ausland zu kommen, dort Arbeit zu suchen und gleichwohl über unsere Zustände zu schmähen. »I han dös guat Herz nit, daß i dös leid', wenn a fremder Mensch in a fremds Land kimmt und sich so krauti' macht: der muaß ganz staad thoa, hast mi' verstanden?« Der Tiroler knirschte mit den Zähnen und meinte, so stolz brauchten die Baiern wohl auch nicht zu sein, die würden wohl auch gelegentlich um Arbeit ins Ausland reisen – aber wie ein Pfeil schnellte der andere empor und donnerte dem Tiroler entgegen: »Jawohl – anno 1870, wennst da nit g'schlafen hast, da san mir Boarn ins Ausland g'roast, und frag nur d'Franzosen, was mir g'arbeit ham.«
Bei einem Maskenzuge, der im vorigen März zu Reichersbeuern gehalten ward, wurde statt einer goldenen oder silbernen eine »nickelne Hochzeit« dargestellt, voll von witzigen Anspielungen auf die moderne Zeit, in einem anderen Dorfe gab man die »orientalische Frage« mit acht oder zehn Tableaux, worunter eines betitelt war »Rauferei sämtlicher Großmächte.« Für den Abend war angekündigt »Raçenball«.
Diesem kosmopolitischen Trouble, dieser Teilnahme an dem, was draußen in der Welt geschieht, fällt freilich auch immer mehr von der eigenen heimischen Sitte zum Opfer, selbst die Sprache, die am längsten feststeht, zeigt bereits die leisen Spuren dieser Umgestaltung.
Denn je mehr der Kreis der Gedanken, der Begriffe sich gegen die bürgerliche Sphäre hin erweitert, in demselben Maß wird auch die harte Ursprünglichkeit und Selbständigkeit der dialektischen Formen abgeschwächt und der allgemeinen Sprechweise genähert. Ein Beispiel mag Sie darüber belehren. Früher sagte man allgemein und ausschließlich »gehn ma auffi«, jetzt hört man hundertemale »gehn ma 'nauf«, es ist die handgreifliche Annäherung an das hochdeutsche »hinauf« und man kann schon jetzt nicht mehr behaupten, daß der Gebrauch dieser letzteren abgeschwächten Form eine dialektisch unrichtige wäre. Vor zwanzig Jahren wußte kein oberbairischer Bauer, und wenn es seinen Kopf gegolten hätte, was eine » Thatsache« ist, und jetzt führt jeder Knecht die Beteuerungsformel im Munde: »Thatsach', Thatsach'«.
So kommen mit den Worten die Gedanken herein und mit den Gedanken der Geist einer neuen Zeit.
Der eigentliche Träger der Neuzeit aber ist das Kind; die heranwachsende Generation und der Familiengeist, in welchem sie erzogen wird, diese gleichsam innerste Seite des bäuerlichen Lebens, müssen wir nun noch in Kürze betrachten und sie giebt uns wohl auch die beste Gelegenheit, zu zeigen, wie es um Moral und Religion, wie es überhaupt mit dem Begriffe der Autorität beschaffen ist. Denn für alle Autorität ist doch die Familie die erste Verkörperung und der letzte Ausgangspunkt.
Es wäre thöricht zu glauben, daß in einer Zeit, die an alles Hand legt, gerade dieses Gebiet unberührt bleiben sollte; von ihnen allen, zu denen der Zeitgeist mit schmeichelnder Stimme spricht, ist ja das Herz des Kindes am offensten, sein Auge ist am schärfsten, seine Wißbegier am wachsten. Die vegetative Ungestörtheit, in welcher das Kind auf dem Lande bisher heranwuchs, auch sie ist durchbrochen, ja sie ist geradezu unvereinbar mit den Ansprüchen, die der Staat selber heutzutage an den schlichtesten Bauernburschen stellt. Er muß ordentlich lesen und schreiben können, wenn er als Rekrut in die Kaserne oder später als Geschworener zu Gericht kommt, auch er muß lernen und zwar in guter Schule. Der Fortschritt, der in dieser Beziehung auf dem Lande seit 30 Jahren gemacht ward, ist verblüffend, die meisten kommen unleugbar mit Freuden zur Schule »All's wollen s' wissen jetzt, die Fratzen, bis zum Kaiser Karl«, sprach ein altes Mütterlein beklommen. Aber dem Lichte folgt auch hier der Schatten, der Schwerpunkt liegt auch hier wie allerorten in der Erziehung des Verstandes, nicht des Herzens, man braucht ja leider mehr Verstand als Herz im heutigen Leben. So zeigt sich selbst in der bäuerlichen Erziehung schon eine Art von einseitiger Entwicklung, das frühreife Kind war ehedem ein Monopol der Städte, jetzt ist der Begriff, wenn auch in abgeschwächter Form, selbst auf das Land gedrungen; auch dort reift und altert man schon zu schnelle. Als ich vor kurzem einem Trupp von acht- bis neunjährigen Knaben begegnete und frug, warum denn heute keine Schule sei, erwiderte der kleinste dreist: »Weil ma's ausg'macht habn«.
Man wird erwidern: hier muß das Gegengewicht eben in der Familie, in der häuslichen Erziehung liegen – wenn nur noch die Familie jene innere Macht über ihre Angehörigen besäße, die sie einst besaß. Aber von jener gewaltigen Zucht, von jener Kraft des Gehorchens und jener Selbstverleugnung der Eltern, wie man sie z. B. zur Zeit der Freiheitskriege und lange nachher noch festhielt, ist heute kaum mehr der Schatten da. »I hab fünfundzwanzig Jahr kei Wirtshaus g'sehgn und kein Tropfen Bier, aber neun Buben hab i aufzogn, wo einer braver als der ander is« – sprach ein achtzigjähriger Mann vom Hagrain zu mir – heute, beim ersten häuslichen Verdruß geht der Mann von dannen und vertrinkt seinen Groll. Nur selten wird der Arbeit der Kinder so wachsam nachgesehen, daß diese sich auch im Gewissen gemahnt fühlten; der Achtziger, mit dem ich aus der Kaiserklause nach Hause ging, blieb an der Wegscheid stehen und sprach: »B'hüt Gott, jetzt muß i noch a Stund da in den Holzschlag 'nauf, da droben arbeiten drei von meine Buabn; die möcht' i hoamsuachen dort und schaug'n, ob s' ihr Sach ordentli' machent. Vor 62 Jahr hab i selber da droben g'scheitert.«
Und ebenso ist es bei den Mädchen mit der Wachsamkeit der Mutter; oft hat mir die alte Dürnbachbäuerin erzählt, daß sie gar niemals das Gefühl gehabt, als ob ihre Mutter jemals schlafe, als ob irgend etwas ihr entgehen könne, »mir Kinder haben allweil g'moant, die is Tag und Nacht auf.« Wie schläfrig ist daneben die heutige Kinderzucht – wie eingeschlafen ist aber auch das Bewußtsein dessen, der über aller Zucht als gebietende Macht steht, das Bewußtsein Gottes, und hier hat in der That die Kirche selbst manch schweren Mißgriff begangen. Sie übersah, daß man die religiöse Polemik, wie sie in den letzten Jahren überhand nahm, auf Kosten des religiösen Gefühls betreibt und daß man die weltliche Autorität nicht angreifen kann, ohne zuletzt die eigene geistliche Autorität zu schädigen. Denn alles, was an Gehorsam, an Ergebenheit, an Autoritätsglauben gegen eine einzelne Obrigkeit hinweggestritten wird, das geht dem ganzen Menschen verloren – und in der That liegen die Dinge auf dem Lande so, daß sich die weltlichen und geistlichen Behörden bereits in gleicher Weise über den Rückgang ihres Ansehens beklagen. Der Leitnerbauer von Point las als Vorbereitung zum Tode die Schriften Ernst Renans; wie war der Mann auf das seltsame Buch gekommen? Durch eine fulminante Predigt, in der der Pfarrer wider dasselbe gelästert hatte; nun erst wollte der neugierige Alte sehen, ob es denn wirklich so arg sei, und fand, daß derselbe viel gescheiter sei, als der Pfarrer des Dorfes.
Der Beamte aber ist schon äußerlich in zu kärglicher Stellung, um zu imponieren, und gar nicht selten gilt der Büttel mehr als der Richter. »Gel' Herr Landrichter (sprach ein Bauer aus der Gegend von Wofratshausen) legen S' fei a guts Wörtel für mich beim G'richtsdiener ein, daß i dös schuldige Sach nit z'zahlen brauch.« Zwei Angeklagte, die wegen Raufhandels vorgeladen waren, stürzten sofort, als sie einander ansichtig wurden, in Gegenwart des Richters auf einander los, um ihre Prügelscene fortzusetzen; ein dritter aus der Nähe von Wasserburg schoß im Sitzungssaale ein Terzerol ab und erwiderte auf die Frage, warum er geschossen habe, ganz ruhig: »Damit daß's schnallt, damit's a bißel lusti werd.« Solche Spuren der Verwilderung, solche Mißachtung seiner Autorität erlebt der Beamte mit eigenen Augen; ist eine seiner Entschließungen unbequem, so kann man rasch das Wörtlein hören: »Wart nur, den bring i scho' in d'Zeitung.«
Das alles sind Beispiele, die uns die wirkliche Lage beredter klar machen, als alle gelehrten Reflexionen; fassen wir aber die Sache tiefer, dann müssen wir uns gestehen: nur im Leben des einzelnen giebt es Ungerechtigkeiten, die historische Entwicklung eines Volksstammes ist immer gerecht. Sie kennt keine Wirkung ohne Ursache; auch hier ernten wir nur die Früchte eigener Schuld. Seit Jahrhunderten stand der Beamte eigentlich dem Leben des Volkes fremd gegenüber, statt mitten drinnen, und der Priester war mehr bedacht, die Willfährigkeit der Leute als ihr Gemüt heranzuziehen. Jetzt erst, in den Zeiten erwachenden Selbstgefühls kommt es dem Volke zum Bewußtsein, was die alte angestammte Autorität ihm schuldig blieb, nun fängt es selbst das Schuldigbleiben an, ein Zug der Entfremdung regt sich und eine neue Macht sucht Herr zu werden über die Gemüter – der Zeitgeist.
Am Landg'richt, da steht oaner drunt,
»So – (sag'n s) bist da, Du Vagabund!«
Der Landrichter, der setzt glei' auf
Die Augenbrill'n – und macht a G'schnauf,
Schaugt fuchswild auf den alten Mo',
»Du hast ja bettelt!« fahrt er'n o'.
»›I hab nit bettelt,‹« sagt der oa,
»›Dös is nit wahr, i bin ja koa – –«
»Bist staad, Du Luder!« fahrt er'n o',
»Ja freili' bist a Bettelmo',
Was denn? – Hast auf der Woaden
Weide. grast?
Was hast
denn than, wennst nit bettelt hast?
Da braucht's koa lange Überlegung –
G'richtsschreiber, schreiben S': »In Erwägung,
Daß der besagte ...
Angeklagte ...
Gebettelt hat ...
Gebettelt hat ...
Und dieser That ...
Auch
geständig is ...«
»›I han nit bettelt, aber g'wiß!‹«
»Bist staad, Du Luder! Da schaugts her,
Jetzt möcht er aa no' laugnen, der!
G'richtsschreiber, schreib'n S': (mach koa so G'friß!)
Und dieser That auch
geständig is,
Erhält derselbe drei Tag Arrest.
Dös is für so an Kerl dös Best!
Schreib'n S' die bekannten Paragraffen,
Den Spitzbuabn woll'n ma da scho' straffen.«
»›I hab nit bettelt – g'wiß is's wahr!‹«
»Bist staad, Du Luder! – Was nit gar!
Jetzt schaugts mir nur den Kerl an,
Jetzt fangt der aa no' 's Laugnen an,
Da hört si' ja do' alles auf.
G'richtsdiener – machen S', führ'n S' ihn nauf!«
Der alte Verwalter von Kammerloh
Der sagt: mit der Geldsach da is's a so,
Z'erscht kimm i,
Höllsakradi!
Und na kimm wieder i,
Und nachher kimm nomal i,
Höllsakradi!
Und nachher kimmt lang nix – –
Und ob nachher no' oaner kimmt und b'steht,
Und etwas bekömmt.
Dös woaß i no' net.
Und nun zum Schlusse und zu der Frage: Ist die Zukunft schutzlos dieser Entwicklung preisgegeben? giebt es keine Macht, die derjenigen, die wir hier walten sahen, gewachsen wäre? Wir wollen es hoffen.
Jede Entwicklung und wäre sie noch so gewaltig, ist etwas Wandelbares, ist nur ein Durchgangspunkt, aber noch wohnen in der Menschenbrust Kräfte, die unwandelbar und unverwüstlich sind, und diese müssen hier helfen. Es giebt ewige Mächte über den Mächten der Zeit! Keine historische Epoche und hätte sie noch so wild gestürmt, hat das vernichten können, was wir Pflichtgefühl nennen, keine Revolution hat noch den Wert der Ehrlichkeit entwertet, wenn sie ihn auch zu Zeiten herabgedrückt; keine hat es zu hindern vermocht, daß nach der Schrankenlosigkeit ein Bedürfnis freiwilliger Beschränkung kam, und nach den Tagen zügelloser Erregtheit eine ernste innere Einkehr.
Dies Gesetz wird auch an unseren Tagen seine Gültigkeit bewähren; wir aber dürfen die Hände nicht müßig in den Schoß legen, denn vollziehen müssen wir es selber! Die Idylle der früheren Zustände, wenn man sie überhaupt so nennen will, ist freilich für immer dahin, die stumme Resignation ist fort, mit welcher der gemeine Mann vor Zeiten die Last seines Lebens trug, aber an ihre Stelle wird ein bewußtes klares Gefühl treten, daß man zuerst da ist, um seine Pflicht zu thun, und dann erst, um das Leben zu genießen.
Der Ursprung dessen, was man heutzutage die soziale Frage nennt, kam vom Lande, so paradox dies klingen mag; er kam daher, daß eine Unzahl von Kräften sich von der ländlichen Arbeit hinweg nach den Städten zog, wo das Angebot sich bis zur Übervölkerung und die Ansprüche der unteren Klassen sich bis zur unerträglichen Genußsucht steigerten. Unsere gefährliche Halbbildung that das übrige. Vom Lande her muß auch die Heilung kommen – dort müssen vor allem wieder gesunde Lebens- und normale Arbeitsverhältnisse geschaffen werden; die Landbevölkerung muß mehr als je das natürliche Gegengewicht wider jene Ausschreitungen bilden, womit man in den großen Städten die bürgerliche Gesellschaft erschüttert.
Dazu muß jeder an seinem Teile mithelfen, am meisten aber wird der gesunde Sinn des Volkes selber helfen, dessen letzter Kern doch gut und unverdorben ist, das kann ich Ihnen verbürgen. Er hat die jahrhundertelange Drangsal überwunden und wird auch die Drangsal dieses Jahrzehnts bestehen, er ist durch das Übermaß des Druckes nicht zerstört worden und wird wohl auch das Übermaß der Freiheit, wie er es momentan besitzt, ungefährdet ertragen.
Der Bauer hat zum Glück keinen Sinn für das Anormale, für so verschrobene Verhältnisse, wie sie gegenwärtig selbst auf der ländlichen Gesellschaft lasten, er hat ein unleugbares Bedürfnis für das Gesunde, das Natürliche.
Derjenige, der tiefer in das Leben dieses Volkes hineinblickt, wird Anzeichen genug entdecken, daß der gute Grund nur verschüttet, nicht zerstört ist. Ich sah mit eigenen Augen einen jungen Holzknecht, der vor der Thüre seines ärmlichen Hauses die schweren Nagelschuhe auszog, damit der Schlaf seines Kindes nicht gestört werde; eine alte Bauersfrau, die ein fremdes Kind mit unsäglicher Mühe und Liebe großzog und der ich darüber eine Anerkennung aussprechen wollte, erwiderte ruhig, daß sich das doch von selbst verstehe – »denn schaug'n S', was hätt' denn so a Kind, wenn's d' Lieb nit hätt'.«
Wo solche Züge möglich sind, da ist der Familiensinn nicht verloren gegangen, trotz allen Übermutes, womit Bursche und Mädchen verkehren.
Auch das wildeste Kraftgefühl kann das Rechtsgefühl nicht völlig erdrücken. Ich sah auf dem Tanzplatz in Gmund einen gefürchteten Raufbold stehen, der wehrlos die Arme vor seinem halberwachsenen Angreifer sinken ließ, mit den Worten: »Jetzt is vorbei mit meiner ganzen Kraft, i g'spür's bis in die Finger 'nein, daß i im Unrecht bin«. An einem benachbarten Tische ward gestritten über die Last des Dienens und der Soldat, der Jäger, der Fuhrmann – jeder meinte, daß es wohl keinen schlimmeren Herren gäbe, als den seinen. Da sprach ein alter Bauer gelassen: »Und der schlechteste von allen Herren is doch der eigne Herr.«
Und so sehr auch leider der positive Glaube geschwunden ist, eine Art von religiösem Zartgefühl ist doch noch übrig, das sich in entscheidender Stunde oft unbewußt regt. Ich werde nie den Eindruck vergessen, als ein müder trauriger Mensch von dem Wallfahrtsorte Birkenstein in die lärmende Wirtsstube zu Neuhaus trat und einer der übermütigsten Burschen ihm entgegenrief: »Was is's? war d'Mutter Gottes nit dahoam?« Eine lautlose Stille entstand, keiner wies mit derben Worten den Frevler zurück, sondern seine Strafe war die, daß er im allgemeinen Schweigen die tiefe Beschämung erfuhr, die ihm gebührte. Feuerrot ging der Spötter von dannen – und dann ging das Gespräch ruhig seinen Gang – wir aber fragen, in welchem städtischen Lokale wohl eine Taktlosigkeit in so taktvoller Weise gerügt worden wäre? Das eben ist der Unterschied von Stadt und Land: so ausgelassen auch der Hang zu derben Scherzen ist, so findet sich doch fast niemals dort wirkliche Frivolität. Ein andermal wohnte ich einem Gespräche bei, wo von den zahlreichen Selbstmorden die Rede war, die man früher im bairischen Hochland so gut wie gar nicht gekannt hatte; jeder gab eine andere Meinung ab, bis ein alter Bauer seine Begründung in den folgenden schweren Worten zusammenfaßte: »Sie meinen halt, sie hab'n kei' Seel'.«
Das ist der wahre und letzte Ausgangspunkt jeder besseren Zukunft, die Seele des Volkes, nicht etwa bloß im kirchlichen, auch im menschlichen und kulturgeschichtlichen Sinne, muß wieder wachgerufen und geläutert werden, und an dieser Seele des Volkes wollen wir nicht irre werden, trotz aller Fehler und Schäden, die sie heute verdunkeln.
Der Fond von Geistes- und Gemütskraft, der sich in einem gesunden Volkstum während eines Jahrtausends angesammelt, er ist in der That ein unerschöpfliches Kapital, das wohl eine starke vorübergehende Inanspruchnahme ertragen kann, ohne deshalb zum Bankerott zu führen.
Aber der Mitarbeit an diesem großen Ziele, das kann ich nur aufs dringendste wiederholen, möge sich keiner entziehen, wie eng auch sein Wirkungskreis gemessen sei, denken Sie niemals, daß es gleichgültig ist, wie sich das Volk entwickelt, denn wir alle sind das Volk!