
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
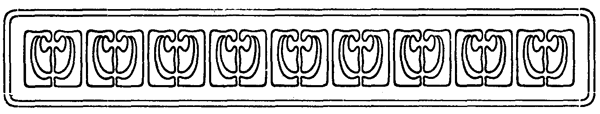
Ein weites Schloß und ein kleiner Trauerbote darin. – Von einem Erker mit bunten Scheiben, und was zwei Jugendfreundinnen zusammen sprechen. – Wer der Turmpeter und seine Familie war. – Eine Beratung hoch oben. – Warum Gottlobele laut aufschluchzt und Frau Maier den Atem verliert. – »Heruntermüssen, ach, heruntermüssen!«
Durch den mit Steingebilden aller Art verzierten Torbogen des alten Stadtschlosses in St. trat zögernd ein kleiner Knabe. Er hatte das Gesicht fest in sein Sacktuch gedrückt und schluchzte und weinte nach Kinderart.
»Was ist denn mit dir, Gottlob, und zu wem willst du?« fragte der dicke Pförtner mit dem blauen, goldbortenbesetzten Rock, dem eckigen Hut und dem Stock mit dem großen Kopf. »Du mußt später kommen, die jungen Herrschaften sind vorhin mit dem Fräulein ausgegangen, und nur die Frau Schloßhauptmann mit ihrem Besuch, der fremden Dame, ist zu Hause!«
»Zu ihr soll ich ja gerade gehen! Mutter schickt mich, weil – weil – der Vater heute nacht plötzlich gestorben ist.«
Der Knabe schluchzte tief auf, und angstvoll schauten die dickverschwollenen Augen den Pförtner an.
Dieser trat nun vollends ganz aus seiner kleinen Stube heraus, »'s ist nicht möglich, Gottlob, 's ist nicht möglich! Dein Vater ist ja gestern abend noch gesund und munter über den Schloßplatz gegangen und hat mir wie immer zugenickt. Und dann habe ich ihn deutlich durch die durchbrochenen Fenster gesehen, wie er auf seinen Turm hinaufgestiegen ist. Und heute nacht zwölf Uhr hat er doch auch noch das Silberglöckchen geläutet. Ich hab's gehört, weil ich zufällig noch wach lag.«
»Mutter sagt, das habe er noch getan, doch dann habe er im Bett einen Schlag gekriegt. Aber es ist doch in der Nacht kein böser Mensch auf den Turm gekommen, der so was hätte tun können?« redete der Kleine nun in großem Eifer, und seine auffallend dunkeln Augen blitzten ordentlich dabei.
»Da hat kein Mensch die Schuld, sondern das ewige Gesteige die vielen Treppen hinauf. Armer, braver Turm-Peter!« murmelte der Mann halb für sich, halb als Antwort für den Knaben und tätschelte diesem den Rücken. Dann zog er ein großes, rotgewürfeltes Taschentuch heraus und schneuzte sich gewaltig die Nase.
»Jetzt geh nur hinauf, Büble, zu der gnädigen Frau! Die wird auch nicht übel erschrecken, schon wegen eurer Angelika, die sie so gern hat, und dann wegen deiner Mutter. Was soll die jetzt anfangen? Und dann von wegen der jahrelangen Nähe, – der Turm und das Schloß gehören doch von jeher zusammen! Wie oft ist dein Vater am Feierabend heruntergekommen, wenn's irgend was zu bosseln gab, oder er hat die zerbrochenen Spielsachen unserer Kinder geleimt! Ich hab' zwar nie so recht verstanden, warum die gnädige Frau sich immer so gern gerade mit ihm unterhalten hat, aber sie sagte oft: ›Dem Turmpeter merkt man es an, daß er über den Menschen und näher dem Himmel wohnt.‹«
Der Pförtner hatte das letztere mehr für sich gesprochen, als er wieder in seine Stube zurückkehrte, der Knabe aber stieg langsam die schöne, teppichbelegte Treppe hinauf, indem er seine kleinen, schmalen Finger krampfhaft über den Rand des mit kunstreichen eisernen Rosetten und Arabesken verzierten Geländers laufen ließ. Dann und wann blieb er stehen; ein kleiner Fehler am Fuß schien ihn dazu zu nötigen. Das Taschentüchlein hatte er eingesteckt, er wollte nicht mehr weinen droben vor der gnädigen Frau, aber von Zeit zu Zeit kam es von tief unten herauf schluchzend über seine Lippen: »Vaterle, o mein Vaterle!«
So gelangte er in den zweiten Stock des viele Gänge enthaltenden Schlosses.
Die Frau Schloßhauptmann von Werder war keine Fremde für die Familie des so jäh aus dem Leben geschiedenen Turmwächters Peter Lindenmaier. Sie und die Ihrigen hatten von jeher gute Nachbarschaft mit den Leuten im Turm oben gehalten. Peter war, wie schon gesagt, manchmal helfend ins Schloß gekommen. Seine erste Frau, die Mutter der hübschen, blondlockigen, in der ganzen Stadt unter dem Namen Turmengele bekannten einzigen Tochter Angelika, war Kammerjungfer bei Bekannten der Frau von Werder gewesen. Die jetzige, etwas derbe, verwachsene, aber äußerst brave Frau war überall geschätzt ob ihrer Tüchtigkeit. Sie hatte viele Jahre bei Stadtpfarrer Reinhardts, die auf der andern Seite des Kirchplatzes wohnten, als Köchin gedient. Das einzige Kind aus dieser Ehe war der kleine, bald siebenjährige Gottlob, der lange Zeit infolge eines Sturzes elend und halb lahm gewesen, nun aber, seit kurzem geheilt, die Freude und der Stolz der Seinigen, besonders seines Vaters, war. In dem kränklichen, ganz in der Stille aufwachsenden Knaben hatte sich eine große Innerlichkeit entwickelt, ein Denken weit über seine Jahre hinaus, und daneben ein hervorragendes musikalisches Talent. Unten in den mächtigen, alten Kirchenräumen, wohin er schon als kleines Kind mitgenommen wurde, wenn Peter seinen Mesnerdienst versah und Mutter die geschnitzten Stühle und goldglänzenden Altäre abstäubte, hatte sein Kinderohr früh die Töne der mächtigen Orgel in sich aufgenommen. Die großen Augen weit geöffnet, die magern Händlein fest gefaltet, so konnte das kleine Kind stundenlang dabei sitzen, ohne Herrn Steiner, den Organisten, im geringsten zu stören. Es störte diesen auch nicht, wenn dann und wann die dünne, feine Kinderstimme wie probierend ganz leise und nie falsch mitsang. Auf einer kleinen, billigen Geige, die Vater im Scherze gekauft, hatte der damals erst Vierjährige zum Erstaunen aller bald richtige Töne und Melodien hervorgebracht. Daraufhin hatte Herr Steiner freudig den kleinen Jungen in die Lehre genommen. Er hatte ihm in einem Alter, wo das Büblein kaum in die ersten Höschen geschlüpft war, die nötigen Handgriffe und Noten beigebracht, und nun, besonders seit Gottlobs körperlicher Erstarkung, war ein Leben und ein Zug in sein Spiel gekommen, daß ihm schon da und dort von solchen, die's verstanden, der Name eines Wunderkindes beigelegt wurde.
Der Turmpeter und seine Frau mochten das nicht gern hören, denn sie waren schlichte, einfache Leute, und es schien ihnen wirklich etwas Unrechtes in diesem Begriff zu liegen.
»Wenn er nur einmal lernt, den Menschen das Herz zu bewegen mit schönen Gottesliedern, und dabei sein Brot ehrlich verdient, dann braucht nichts Wunderbares dabei zu sein,« sagte der Vater auf das Reden der Leute, und Gottlob war's zufrieden. Für ihn und die Seinigen gab es ja vorderhand nur den einen Begriff: Kirchenmusik und ernste Lieder.
Auch Schwester Angelika war musikalisch. Sie sang und spielte und durfte unten bei Stadtpfarrers auf dem Klavier ihrer Schulfreundin Gertrud üben.
Angelika hatte, so jung sie war, viel erlebt und erfahren, und durch ihr herziges Gesichtchen war sie in Kreise gezogen worden, in die sie nicht hineingehörte. Das damalige Turmengele war trotz seiner Liebenswürdigkeit ein oberflächliches, eitles Mädchen, mit dem der Vater, als seine Frau gestorben und er die Stadtpfarr-Nane, wie sie die Leute hießen, geheiratet, einen recht schweren Stand hatte, besonders nach der Geburt des kleinen Gottlob, den Engele als Eindringling ansah und mit Eifersucht betrachtete. Ungern und unlustig verrichtete sie die häuslichen Arbeiten, die Mutter Nane ihr zuteilte, und der Nachlässigkeit der damals Zwölfjährigen war es zuzuschreiben, daß das Brüderchen verunglückte. Statt es zu hüten, schaute sie nach den Wolken, und das Wäglein mit dem Kind rollte die oberste steile Turmtreppe hinunter. In der Reue und bei der Pflege des leidenden Kleinen erwachten Engeles gute und tiefe Eigenschaften, die dann ein paar Jahre wieder in den Hintergrund traten, als ein kinderloses englisches Ehepaar das Mädchen mit sich in seine Heimat und auf Reisen nahm. Doch bei dem eitlen, oberflächlichen, pflichtlosen Leben, das diese Menschen führten, wobei der größte Wert nur auf Engeles hübsches Aussehen gelegt wurde, überkam diese ein verzehrendes Heimweh nach Vater und Mutter, dem Brüderchen und den einfachen, aber so trauten Verhältnissen oben auf dem geliebten Turme. Eine schwere Krankheit, in die sie verfallen, reifte und vertiefte dieses Empfinden, und eine deutsche Dame, eine Johanniterin, welche als Schwester Martha sie pflegte, half ihr, ohne daß sie sich dem Ehepaar Brown gegenüber undankbar erwies, von diesem los und wieder zu den Ihrigen heim. Von da an hatte Angelika, wie sie nun meistens genannt wurde, eifrig und energisch gelernt, um das Lehrerinnenexamen zu machen.
In einem der Schloßzimmer oben saßen in dem Erker, durch dessen buntbemalte Scheiben man über grüne Baumwipfel hinüber auf den Schloßplatz und die alte Kirche sah, zwei Damen behaglich plaudernd beisammen. Die eine von ihnen, Frau von Werder, stickte an einem weißen Kinderkleid, während die andere eifrig Wollstrümpfe strickte. Letztere trug einen einfachen, grauen Anzug, und ein weißes Häubchen auf dem dunkeln, schlicht gestrichenen Haar kennzeichnete sie als Krankenpflegerin. Es war Schwester Martha von Thadden, die von ihrer alljährlichen Erholungszeit ein paar Tage in St. bei ihren alten Jugendbekannten zubrachte und damit auch ein Wiedersehen mit Angelika verband, die sie warm in ihr Herz geschlossen hatte.
Beide Damen sprachen gerade von ihr. »'s ist doch eine große Freude, daß das Mädchen sich wieder in die einfachen, bürgerlichen Verhältnisse gefunden hat, da doch ihr hübsches, lebhaftes Köpfchen von klein auf nach Feinem und Vornehmem gestanden hat,« sagte Frau von Werder und wickelte bunte Seide auf.
Schwester Martha nickte ihr freudig und zustimmend zu. »Ach gottlob, ja!« sagte sie. »Bis jetzt ist doch alles gut gegangen, besser als ich damals, wo ich Angelika zurückbrachte, zu hoffen gewagt hätte. Wohl war sie in einer Schule, in der sie früh schon das Nichtige und das Unechte an den Menschen kennen lernte, aber doch fürchtete ich für ihr phantasievolles, aufs Schöne im Leben gerichtetes Empfinden. Aber ihr heimeliges Turmstüblein mit dem Blick ins Weite, ihr ernstliches Arbeiten, ihre Singstunden und Proben zum Kirchenchor und eure Güte« – Schwester Martha streckte der Freundin die Hand hin – »haben sie bis jetzt nichts vermissen lassen. An ihrem Vater und dem kleinen Bruder hängt sie mit wirklicher Liebe. Nur der Mutter ungebildete, wenn auch tüchtige Art erträgt sie noch immer schwer. Alltagsarbeit und Haushalt ist und bleibt ihrer Natur zuwider, und ich fürchte jetzt das eine, daß, wenn wir für sie nach glücklich überstandenem Lehrerinnenexamen eine Stelle in einem feinen Hause finden, sie wieder von dem abkommt, was jede Frau in allen Verhältnissen doch können muß.«
Die zwei Damen sprachen noch weiter mit größter Liebe von Angelika Lindenmaier und von der Möglichkeit, daß Fräulein von Thadden sie vielleicht bei Freunden auf einem mecklenburgischen Gut unterbringen könnte; es seien nur noch Zeugnisse und Photographie einzusenden.
»Meine Kinder und ich werden das liebe Mädel sehr vermissen. Ich war recht zufrieden mit den Nachhilfstunden, die sie gab,« sagte eben Frau von Werder, als der Diener unter die Türe trat und meldete, draußen stehe der kleine Gottlob vom Turm oben ganz verweint, und die Köchin habe auch eben vom Markte heimgebracht, daß den Turmpeter heute nacht der Schlag gerührt habe.
»Das verhüte Gott, daß das wahr ist! Das wäre ja zu schrecklich! Der Mann in den besten Jahren!« Frau von Werder sagte es ganz entsetzt, während Schwester Martha aufgesprungen und Gottlob entgegengeeilt war. Sie zog ihn liebevoll herein.
»Was sollst du sagen, Kind? Komm her, setz dich!« Frau von Werder, ganz aufgeregt, schob dem Kleinen einen Stuhl hin, den er aber unbeachtet ließ, während Schwester Martha vor ihn hinkniete und seine Hände faßte. »Hat dir Mutter etwas an uns aufgetragen, Gottlob?« Das Kind nickte, und man sah, es kämpfte mit den Tränen.
»Was sollst du ausrichten, Gottlob? Warum hat man dich geschickt?« Fräulein von Thadden strich ihm ermutigend über die seidenweichen schwarzen Haare.
»Vater ist tot, und du sollst kommen!« Der Knabe atmete tief auf. Er vermochte trotz aller Fragen, die an ihn gestellt wurden, jetzt nichts mehr zu sagen, denn er wollte ja nicht weinen, und doch drückte es ihm fast das Herz ab.
Frau von Werder und Fräulein von Thadden wußten aber genug, um schleunigst sich zu richten und selbst nach der Sache zu sehen. Langsam stiegen sie die hohe Turmtreppe hinan, nachdem Frau von Werder Gottlob ins Kinderzimmer zu dem gleichaltrigen Werner und der zwei Jahre älteren, neunjährigen Wanda geführt und dem Kindermädchen schnell gesagt hatte, um was es sich handelte. Werner war in der Verlegenheit sofort an seinen Spielschrank geeilt und hatte die große Eisenbahn, Gottlobs Entzücken, herausgeholt, während Wanda sagte: »Nachher spiel ich dir auf dem Klavier mein neues Stückchen vor.« Sie wollte damit vor dem kleinen Geigenkünstler großtun.
Als aber die Damen in der Mitte des Turmes, da, wo über ihnen die großen Glocken hingen, aufatmend vom Steigen und von der Aufregung ein bißchen innehielten, da kam eine Kindergestalt dicht hinter ihnen drein.
»Ich will oben sein! Ich will dabei sein!«
Und »dabei« war das schmächtige Büblein, das nirgends viel Platz einnahm und sich auch im ganzen ruhig und still verhielt, in den nächsten Tagen bei allem. Es kauerte sich in die Ofenecke, als Angelika Fräulein von Thadden weinend um den Hals flog, und als Frau Nane den Frauen in ihrer kurzen Art, aber unterbrochen von Herzstößen, berichtete, wie sich alles begeben. Es saß auf dem Fenstertritt hinter dem alten Lehnsessel und wollte nichts essen, als man es aufforderte, zu Tisch zu kommen. Es versteckte sich wieder dort, tief hinten, und ballte die kleinen Fäuste und hielt sich die Ohren zu, als die Männer kamen und den Deckel auf den Sarg nagelten. Es war dabei, als man diesen in der Dämmerung an Stricken frei schwebend vom Turme hinunterließ, und es stand am nächsten Tage mit unter den Leidtragenden, aufzuckend, als der Posaunenchor am Grabe einigemal falsch ansetzte. Dann aber blickte es unverwandt nach einem Falter, der über den Blumen, die die weinende Angelika hielt, gaukelte, und der dann in die Lüfte entschwebte, weit, weit hinauf.
Und der erst Siebenjährige mit dem ernsten Gesichtchen und einem Ausdruck, der über seine Jahre ging, befand sich auch unter den andern, als ein paar Tage später Rat gehalten wurde, was nun zu beginnen sei. Stadtpfarrer Reinhardt, seine Frau und Schwester Martha waren anwesend, und man saß in der Turmstube um den alten Tisch, dessen Platte die Jahreszahl 1604 trug. Wie viele Geschlechter waren schon um ihn versammelt gewesen zu Mahlzeiten, Arbeit und Kinderspiel! Wie mancher, der hier gewohnt in diesen heimeligen Räumen, und für den gleich Peter und seiner Familie der Turm und die Behausung da oben eine wenn auch beschwerlich zu erreichende, aber doch lieb gewordene Heimat gewesen, hatte im Laufe der Zeiten den engen und doch weiten Sitz und Wirkungskreis verlassen und an andere abtreten müssen!
»Hast du dir schon irgend was gedacht, Nane, oder ins Auge gefaßt, wohin ihr ziehen wollt, und wie du dein Leben ferner gestalten kannst?« fragte Frau Reinhardt. Da Nane lange bei ihr in Diensten gestanden, sagte sie zu ihr du.
Die Witwe, die mit kummervollem Gesicht und gefalteten Händen zwischen ihren Kindern saß, schüttelte den Kopf. Es war zu plötzlich über sie gekommen! »Ich kann noch gar nicht recht denken,« sagte sie, »aber das weiß ich, daß Wilhelm, der neue Turmwächter, schon bald heraufziehen muß; er gehört an seinen Platz.« Bei Nane kam in allen Lebenslagen immer zuerst die Pflicht.
»Das ist leider so,« sagte nun der Herr Stadtpfarrer, der warmen Anteil an der früheren Dienerin und ihrem Geschick nahm. »Ich weiß, daß ihr nicht lange bleiben könnt. Wir haben uns deshalb unter der Hand schon ein bißchen nach netten, kleinen Wohnungen erkundigt, aber gerade diese sind recht selten.«
»Mehr als zwei Stuben wird's nicht reichen, und auf Nettigkeit werde ich auch nicht sehen dürfen,« erwiderte Nane gebeugt.
Angelika, die in ihrem schwarzen Anzug noch lieblicher aussah als sonst, zog es das Herz zusammen. Nur zwei Stuben! Sie würde nun keinen eigenen Raum mehr haben in Zukunft, würde heruntermüssen, ach, heruntermüssen in jeder Hinsicht! Es war ihr in den letzten Tagen neben dem Jammer um den Vater auch lastenschwer aufs Herz gefallen, ob sie denn gerade jetzt Mutter und Brüder verlassen, ob sie die Stelle so weit fort annehmen dürfe. Es wurde ihr gleich unbehaglich zu Mute sowohl beim Gedanken ans Fortgehen wie ans Bleiben.
Schwester Martha, die ihr Engele durch und durch kannte, die aber auch für ihre Freunde nicht weichlich dachte, ergriff das Wort.
»Ich glaube, daß Frau Lindenmaier sich vor allem klarmachen muß, ob sie's für richtiger hält, daß Angelika für die erste schwere Zeit bei ihr bleibt oder vielleicht auch für ganz ihre Lehrarbeit hierher verlegt. Mein liebes Engele weiß, was sie der Mutter und deren angestrengter Arbeit für sie alles verdankt!« Schwester Marthas und Angelikas Blick begegneten sich, aber letzterer war's unbeschreiblich enge und weh ums Herz. Trotz ihrer schweren Erfahrungen in der Fremde, und trotzdem sie den Wert der zweiten Mutter nach ihrer Zurückkunft immer mehr schätzen lernte und an dem kleinen Bruder mit großer Liebe hing, hatte sie sich nun doch so unaussprechlich darauf gefreut, ihr Können draußen auf einem andern Felde zu betätigen, die Welt diesmal nicht in Müßiggang und tändelnd, sondern in ernster, freudiger Arbeit kennen zu lernen. Ihr Herz pochte darum, als die Mutter sagte:
»Daß Engele die gute Stelle annimmt, die Sie ihr verschaffen wollen, darüber ist wohl kein Zweifel, Schwester Martha, und auch mein Mann, der sich noch so darüber freute, würde so sagen.« Von Engeles Herz fiel eine Zentnerlast, obgleich ihr die Tränen in die Augen traten.
»Daß wir sie vermissen werden, gerade jetzt doppelt, darf nicht mitreden. Schwer ist schwer, aber Gott wird auch da helfen!« Ein Ton wie ein unterdrücktes Schluchzen kam von der tiefen Fensternische her, in die Gottlob sich hineingedrückt hatte, aber niemand achtete im Augenblick darauf.
»Ja, Nane, Gott wird helfen, aber auch Angelika wird von draußen her helfen, daß Ihnen der Erwerb dessen, was Sie zum Leben brauchen, künftig nicht zu schwer wird,« sagte der Stadtpfarrer, und die Anwesenden blickten mit einiger Sorge auf die kleine, etwas verwachsene Frau.
»Wenn mich Gott gesund erhält, will ich mich und den Gottlob schon durchbringen. Wenn auch das Gnadengehalt, das wir von der Stadt kriegen, arg klein ist, so verdiene ich durchs Handschuhwaschen doch eine hübsche Summe, und –«
»Was ich verdiene, Mutter, das ist ja doch ganz selbstverständlich, daß ich's dir schicke,« fiel Angelika ihr mit Wärme in die Rede. Das hübsche, feine Gesicht des Mädchens strahlte vor Eifer, und alle Anwesenden sahen sie mit Wohlgefallen an.
»Versprich nicht zu viel, Engele,« mahnte lächelnd Schwester Martha, und sie und Frau Reinhardt rechneten aus, daß die künftige Erzieherin immerhin die Hälfte ihres Gehalts für Kleider, Schuhe und sonstige kleine Ausgaben selber brauchen werde.
»Wenn ich kann, nehme ich nichts von Engeles Geld,« sagte Nane. »Was sie bekommt, wird sie auch nicht im Schlaf verdienen, und der Bub und ich brauchen im ganzen recht wenig. Wenn wir jetzt nur einmal einen Unterschlupf hätten, wenn auch einen ganz bescheidenen! Aber nur nicht zu weit vom Turm und vom Stadtpfarrhaus weg, nur, wenn's sein könnte, in der Gegend, wo ich jetzt schon so lange daheim bin!«
Nane drohte bei diesen Worten ihre Fassung zu verlassen. Die beiden andern Frauen sahen sich bekümmert an, denn heute früh schon hatten sie nachgefragt und überall den Bescheid bekommen, daß die Häuser gerade auf dem Marktplatz und in der inneren Stadt in festem Besitz von alteingesessenen Handwerks- und Geschäftsleuten waren, die ihren Raum selber brauchten. Gerade als sie dies schonend mitteilen wollten, hörte man draußen auf der hölzernen Treppe schwere Schritte und vor der Tür ein Schnaufen wie von jemand, der erst zu Atem kommen will. Dann klopfte es, und eine ältere, sehr umfangreiche Frau trat, noch immer nach Luft ringend, über die Schwelle.
»Ach, die Frau Maier!« – »Was, Sie kommen selber heraufgestiegen auf den Turm?« – »Wie gut, daß Sie nach uns sehen!« – »Gottlob, rücke den Lehnstuhl an den Tisch!« so scholl es durcheinander, und die Eingetretene mußte sich setzen und sich erst ein bißchen erholen, ehe sie recht sprechen konnte. Dann aber, nach verschiedenen »Ach!« und »Oh!« und »Tausend noch einmal, wie hoch!« kam sie zum wirklichen Reden, nachdem ihr gutes, rotes, wohlwollendes Gesicht freundlich zunickend von einem zum andern geschaut hatte.
»Jetzt hab' ich einen Anlauf genommen und bin zu euch heraufgestiegen, und nun komm' ich erst recht ungeschickt, wie ich sehe, – mitten in eine Unterredung hinein!«
»Zu der Sie als alte, treue Freundin der Familie gerade so gehören wie wir,« beschwichtigte der Herr Stadtpfarrer. »Wir sprechen von dem, wie's nun werden soll. Nane muß bald Platz auf dem Turme machen, und da gilt's eine Wohnung finden –«
»Nicht zu weit weg, und doch ist nirgends in der Nähe etwas Passendes zu haben,« schaltete Frau Reinhardt ein.
»In Gottes Namen denn, muß es auch von hier scheiden heißen,« sagte Nane und senkte tief den Kopf.
Da aber erscholl plötzlich von der Fensterbank her ein geradezu jämmerliches Schluchzen und Weinen: »Unser Turm, Mutterle, unser Turm! Wenn wir so weit fortmüssen, dann kann ich ja gar, gar nie mehr heraufkommen und an den alten Plätzchen sitzen! Wilhelm hat erlaubt, daß ich's manchmal nach der Schule tue, aber da ist's ja dann nicht möglich! Und ich muß doch hören, was die Vögel da oben zwitschern, und was der Wind sagt! Und wie kann man überhaupt unten geigen, wo all der Lärm ist?«
Des Kindes Brust arbeitete ordentlich vor innerem Weh, und die Anwesenden waren tief ergriffen.
»Vielleicht reicht dir die Zeit dann am Sonntag,« tröstete die Mutter mit stockender Stimme, denn auch ihr dünkte es entsetzlich, irgendwohin in ein ganz fremdes Straßenviertel, wo man keine Menschenseele kannte, ziehen zu müssen.
Frau Maier hatte ihr großes Taschentuch entfaltet und sich damit Augen und Stirn getrocknet. Darauf zog sie mit Hilfe von Schwester Martha, die neben ihr saß, den altmodischen Schal mit den eingewirkten Palmen ab, denn es war ihr heiß in jeder Hinsicht. Dann aber nach ein paarmal Ansetzen, faßte sie einen energischen Entschluß und sagte zu Nane:
»Wenn ich was Besseres gewußt hätte, hätte ich geschwiegen, so aber, wo ich sehe, daß euer Herz auch an dem Viertel hängt, und wo ich weiß, daß eine Wohnung hier herum einfach nicht zu haben ist, denn ich tät in mein ererbtes Haus auch nicht ein jedes hineinnehmen, so möchte ich bescheidentlich anbieten, ob ihr nicht zu mir ziehen wollt. – Halt, – oho, – noch nichts gesagt, und noch nicht gefreut!« Frau Maier wehrte Angelika, die auf sie einstürmen wollte, energisch ab.
»Also drei Stuben kann ich euch abgeben, und ihr zahlt mir dafür, was ihr sonst für zwei geben würdet. – Schreit nicht gleich, daß das zu wenig ist, denn daß die Wohnung sehr schön wäre, kann ich nicht sagen. Ihr wißt, mein Häusle ist schmal, und unten hab' ich das Geschäft.« – Frau Maier handelte seit vielen Jahren mit Eiern und Nudeln, welche letztere sie und ein Dienstmädchen verfertigten. – »Wenn man älter wird, ist's gescheiter, man schränkt sich ein, dann gibt's nicht so viel zu schaffen. Will nun meine Magd, die im zweiten Stock schlief, zu mir in die drei Stuben im ersten Stock nehmen, und das Rumpelwerk, das oben stand, in der Bodenkammer unterbringen. Ein paar Möbel von meinen Eltern selig dürfen wohl bei euch stehen bleiben, Platz dazu wird's wohl geben, denn ein Teil eurer jetzigen Sachen gehört ja von Olims Zeiten her in die Turmstube!« Frau Maiers Blick streifte die hölzerne Bank, den Tisch mit den gedrehten Füßen, den Schrank gegenüber vom Ofen und den alten Lehnsessel, der unter jeder Bewegung der lebhaften, gewichtigen Frau eigentümlich knarrende, ächzende Töne hervorbrachte.
Nane war mit diesem letzten Vorschlag nochmals eine Sorge vom Herzen genommen, denn der Ankauf der nötigen Möbel machte ihr auch schwere Sorgen. Viel sagen konnte sie nicht, sie hatte überhaupt nicht die Gabe, ihre Gefühle in Worte zu kleiden. Aber die müden, verweinten Augen leuchteten ordentlich auf, und der Händedruck über den Tisch hinüber war so fest, daß Frau Maier ihre Hand rasch freimachte und in komischem Entsetzen schrie: »Au, meine alten Knochen!«
Als aber die andern alle auch ihre Freude und Erleichterung über die glückliche Lösung dieser bedrückenden Frage bezeigten, da wehrte sie rechts und links ab und sagte: »Wartet erst ab, ob's euch gefällt. Und zu danken braucht mir schon gar niemand, denn 's ist der pure Eigennutz, daß ich euch unten bei mir haben möchte! Man wird alt und möchte manchmal gerne jemand um sich haben. Und wenn mir der Gottlob hie und da mein Lieblingslied geigt: »Ueb' immer Treu und Redlichkeit,« so soll mich das freuen, mehr als das moderne Zeug, was die Wachtparade jetzt spielt, und wo man ganz wirr im Kopf wird und sich nichts dabei denken kann.«
