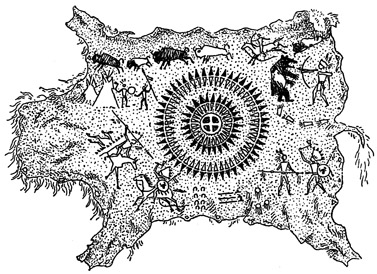|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eines Abends, Ende Januar, war in den drei Lagern große Aufregung. Ein paar Piegan, die gerade von mehrtägiger Jagd aus den nördlichen Prärien heimkehrten, hatten einen weißen Büffel gesehen. Die Kunde verbreitete sich schnell, und von allen Seiten strömten die Indianer in unseren Laden und verlangten Pulver, Patronen, Feuerstein und andere Waren. Am anderen Morgen zogen aus allen drei Indianerdörfern Scharen hinaus zur Jagd, und die Männer wetteten, welcher von den Stämmen das weiße Fell erringen würde. Selbstverständlich wettete jeder auf seinen eigenen Stamm. Bei fast allen Präriestämmen galt ein weißer Büffel als heilig, und wurde als besonderes Eigentum der Sonne angesehen. Gelang es, einen zu töten, so wurde das Fell auf das sorgsamste gegerbt, und bei der nächsten religiösen Feier der Sonne in großer Ehrfurcht dargebracht. Man breitete es in der Mitte des Zauberzeltes, über allen anderen Opferspenden, aus und ließ es dort bis es allmählich zusammenschrumpfte und zerfiel. Zogen an solch' einem Platz Kriegsbanden vorüber, so würden sie nie gewagt haben, es anzurühren, aus Furcht vor der Sonne. Der Mann, der das Glück hatte, ein solches Tier zu erlegen, stand bei der Sonne in besonderer Gunst, nicht er allein, sondern der ganze Stamm, dem er angehörte. Ein weißes Fell kam niemals in den Handel, keiner hatte es länger in seinem Besitz als bis zum nächsten, einmal im Jahr stattfindenden großen Fest der Medizinhütte. Den Medizinmännern erlaubte man, die Streifen zu nehmen, die man am Rande des Felles abgeschnitten hatte, um damit ihre heiligen Pfeifen zu umwickeln, oder um sie, bei besonders feierlichen Gelegenheiten, als Kopfbinden zu tragen.
Natürlich erkundigte ich mich überall nach weißen Büffeln. Mein Freund Berry sagte, daß er in seinem ganzen Leben nur 4 gesehen hätte. Ein uralter Piegan berichtete von sieben, die ihm zu Gesicht gekommen seien, zuletzt das Fell einer großen Kuh, das sein Stamm den Mandanen für 120 Pferde abgehandelt und gleich allen anderen dann der Sonne dargebracht hätte. Berry berichtete dann noch weiter, daß diese Albinos nicht schneeweiß, sondern gelblich aussähen. Nun, wenn irgend möglich, wollte ich dies vielbesprochene Tier auch sehen, lebendig dahinjagen sehen mit seinen dunklen Genossen, und so schloß ich mich am anderen Morgen einer Jagdgesellschaft an und ging, wie gewöhnlich, mit Sprich mit dem Büffel- und Wieselschwanz. In des Letzteren Zelt wurde der Plan besprochen, und da wir voraussichtlich eine Zeitlang fort sein würden, beschlossen wir, ein Zelt mitzunehmen, das wir aber nur für uns allein haben wollten. »Unsere Frauen wollen wir aber mitnehmen,« fügte Wieselschwanz hinzu, »vorausgesetzt, daß sie sich nicht zu viel zanken.« Dafür warf ihm seine Frau einen Moccassin an den Kopf.
Wir brachen nicht allzu früh auf. Die Tage waren kurz und nachdem wir etwa 35 Kilometer zurückgelegt hatten, schlugen wir unser Zelt in einer tiefen, breiten Schlucht auf. Um uns herum standen 15 Zelte der Unseren, alle vollgestopft mit Jägern. Am Abend kam viel Besuch, und es wurde geraucht, geschwatzt und gegessen, aber als wir schlafen wollten, hatten wir reichlich Platz, uns mit unseren Betten bequem auszubreiten.
Am anderen Morgen rückten wir zeitig aus und rasteten nicht eher, als bis wir einen Fluß, dessen Ufer mit Weidengebüsch umsäumt war, erreicht hatten. Ein herrlicher Lagerplatz! schön geschützt und reichlich Holz und Wasser. Die große Herde, in der der weiße Büffel gesichtet worden war, hatte man etwa 30 Kilometer südöstlich von unserem Lager angetroffen. Bei der Verfolgung war sie gen Westen durchgebrochen. Wir waren alle davon überzeugt, den besten Platz gewählt zu haben, um das Land nach allen Himmelsrichtungen hin abzusuchen. Die Jäger, die das Tier gesehen hatten, berichteten, daß es ziemlich groß und so schnell im Lauf sei, daß es an die Spitze der Herde gejagt wäre und sich so weit ab von ihren Pferden gehalten habe, daß sie nicht hätten erkennen können, ob es ein Bulle oder eine Kuh sei.
Wir bildeten den westlichen Teil des großen Jagdzuges. Andere Abteilungen der Piegans, Schwarzfüße und Blutindianer lagerten östlich von uns, die Hügelkette entlang. Wir waren überein gekommen, so wenig als möglich zu jagen, um die Büffel nicht zu schrecken, bevor wir den Albino gefunden hätten. Nur zwei Jagdzüge wurden unternommen, um das Notwendigste an Fleisch und Fellen zu bekommen.
Das Wetter war ungünstig. Es war bitterkalt und schneite unaufhörlich. Man konnte in der Entfernung nichts erkennen, trotzdem ritten wir täglich gen Norden und Süden, Osten und Westen und suchten. Unzählige große und kleine Herden sichteten wir, aber der weiße Büffel war nicht dabei. In unser Lager kamen oft andere Jagdgesellschaften, um mit uns zu rauchen oder zu plaudern und uns ein wenig auszuhorchen, oder wir trafen auch welche in der Prärie, sie alle wußten aber über den Gegenstand, den wir alle mit solchem Eifer suchten, nicht mehr und nicht weniger als wir selbst zu berichten: Viele, viele Büffel, aber kein weißer. Es war entsetzlich kalt. Die Antilopen drängten sich in dichten Haufen, mit vornüber gebeugten Köpfen, in den Schluchten zusammen. Am südlichen Abhang des Berges sahen wir Hirsche, Wapiti und selbst Bergschafe in derselben Gegend beieinander. Letztere gingen uns aus dem Wege, die anderen beachteten uns überhaupt nicht. Nur die Büffel, Wölfe, Präriewölfe und die kleinen Präriefüchse fühlten sich wohl. Die Büffel grasten wie gewöhnlich, die Wölfe trotteten umher oder hatten sich über das Wild, dem sie die Beinflechsen durchbissen und es so niedergebracht hatten, hergemacht und heulten und kläfften die ganzen Nächte hindurch. Ihre dicken Felle konnte die Kälte nicht durchdringen.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lange wir in dieser grimmen Kälte vergeblich nach dem Albino herumsuchten. Eines Morgens um 10 Uhr, als wir langsam westlich um den Berg herumritten, änderte sich plötzlich das Wetter. Wir fühlten ganz plötzlich auf unseren Gesichtern einen warmen Hauch, der eisige Dunstschleier verschwand und wir konnten das Felsengebirge, über dem dichte, dunkle Wolken lagerten, sehen. »Hay!« rief ein Medizinmann, »habe ich nicht in der vergangenen Nacht um warmen Wind gebetet? – Seht, da ist er. Meine mir von der Sonne verliehene Kraft ist groß.«
Als er noch so redete, tat sich der warme Wind schon auf und steigerte sich zum brausenden, heulenden Sturm. Die Eiskruste auf dem Gras verschwand, man glaubte, der Sommer sei da.
Wir befanden uns ein paar hundert Meter oberhalb der Ebene, und wohin das Auge schaute, sah man Büffel und immer wieder Büffel. Es war ein großartiger Anblick. Wie gut hatte die Natur hier für die Indianer gesorgt und ihnen so viel Herden zum Lebensunterhalt gespendet. Wäre nicht der weiße Mann mit seinem Branntwein, seinen billigen Schmuckwaren und vor allem mit seiner unersättlichen Ländergier gekommen, die Herden würden heutigen Tages noch da sein, und die Rothäute lebten noch zufrieden und glücklich dahin.
Es schien aussichtslos, unter diesen Mengen den weißen Büffel herauszufinden. Wir saßen alle ab, und ich suchte mit meinem Fernglas die Herden sorgsam ab, bis ich nichts mehr sehen konnte. Dann reichte ich das Glas meinem Nebenmann. So wanderte es von Hand zu Hand, aber keiner konnte vom Albino auch nur eine Spur entdecken. Es war herrlich, so im warmen Wind zu sitzen und sich von der Sonne bescheinen zu lassen. Die Pfeifen wurden gefüllt und angezündet, und die Unterhaltung drehte sich natürlich um den Weißen. Jeder vermutete ihn an einer anderen Stelle, in der Gegend des Missouri bis zum Saskatschewan oder am Felsengebirge, oder den Bärentatzenbergen. Während wir so plauderten, gerieten die Büffel, die südöstlich von uns grasten, plötzlich in Bewegung. Ich schaute durch mein Glas und sah, daß eine Schar von Indianern eine Herde stracks gen Westen jagte. Die Reiter waren weit hinter den Tieren, die Entfernung vergrößerte sich zusehends zwischen ihnen, aber mit zäher Ausdauer hielten die Jäger in langer Linie auf ihr Ziel zu. Ich gab Wieselschwanz mein Glas und berichtete, was ich gesehen. Alles sprang auf.
»Sicher haben sie den Weißen entdeckt,« sagte mein Freund, »denn sonst würden sie doch die Jagd aufgeben. Sie sind weit hinten, und ihre Pferde sind müde, denn sie laufen langsam. Ja, ja, sie folgen dem Weißen! ich sehe ihn, ich sehe ihn!«
Im Nu saßen wir zu Pferde und eilten, der Herde den Weg abzuschneiden. Wir ritten Trab, schoben manchmal einen kleinen Galopp ein, mußten doch die Kräfte für den letzten Lauf geschont werden. In einer knappen halben Stunde erreichten wir eine niedrige, dammartige Erhöhung, in deren Nähe die Herde vorbeikommen mußte. Wir sahen sie gerade auf uns zuhalten. So stellten wir uns hinter der Anhöhe auf und warteten. Die Indianer sattelten wie gewöhnlich ab und legten die Sättel auf einen Haufen. Wir nahmen an, daß die Büffel Witterung von uns bekommen und lange, bevor wir mit Erfolg in die Herde einbrechen konnten, seitlich abbiegen würden. Unser Führer beobachtete scharf, und nach langem Warten – wenigstens mir wurde die Zeit unsäglich lang – befahl er uns aufzusitzen. Dann gab er das Zeichen zum Abreiten, und wir sprengten über die Anhöhe. Die Herde war noch etwa 400 Meter von uns entfernt und wandte sich bei unserem Ansturm südwärts. Wie klatschten die Peitschen! Es waren kurzstielige mit rohledernen Riemen, die die Pferde aufs äußerste anfeuerten und fast toll machten. Zuerst kamen wir der Herde schnell nah, nach und nach aber erweiterte sich der Abstand. Trotzdem rasten wir weiter, denn wir konnten alle den kostbaren Preis, den Albino, an ihrer Spitze genau erkennen. Ich war fast davon überzeugt, daß ihn keiner von uns erreichen würde, trotzdem hielt ich mit den anderen aus und hieb schändlich auf mein gutes Pferd ein, das sich bis zum äußersten anstrengte. Da geschah etwas Unerwartetes. Aus einer Schlucht sprengte ein einzelner Reiter gerade in die Herde hinein, und zerstreute sie nach allen Windrichtungen. In einem Augenblick war er neben dem Weißen und jagte ihm Pfeil auf Pfeil zwischen die Rippen, so daß er schwankte und zusammenbrach. Als wir bei dem Jäger ankamen, stand er mit erhobenen Händen da, betete inbrünstig, und gelobte der Sonne Fell und Zunge zum Opfer. Das Tier war eine etwa dreijährige Büffelkuh mit gelbweißem Fell, aber normal gefärbten Augen. Ich hatte immer gedacht, daß die Augen aller Albinos rot seien. Der erfolgreiche Jäger war ein Piegan und hieß Zauberwiesel. Er war so aufgeregt und zitterte so heftig, daß er sein Messer nicht handhaben konnte, und einer der Unseren mußte für ihn das Fell abziehen und die Zunge auslösen, während er dabei stand, und immer bat, vorsichtig zu sein, und es nicht zu verletzen, denn es sei heilige Arbeit für die Sonne. Vom Fleisch nahm man nichts. Es wäre eine Entweihung gewesen, davon zu essen. Die Zunge wurde getrocknet und mit dem Fell der Sonne als Opfer dargebracht. Während das Fell abgezogen wurde, kam die Jagdgesellschaft, die wir vorher gesehen hatten, heran. Es waren Schwarzfußleute aus nördlicher Gegend, die nicht gerade sehr beglückt schienen, daß die Piegans den Sieg davongetragen hatten. Sie ritten bald wieder davon, und wir suchten, begleitet von Zauberwiesel, unser Lager auf. Letzterer war am Morgen ausgeritten, um einige verirrte Pferde wieder einzufangen, und nun war ihm solch' großes Glück unvorhergesehen in den Schoß gefallen. So endete jene merkwürdige Jagd.
Ehe die Büffel ganz verschwanden, sah ich noch einmal einen Albino, allerdings keinen ganz reinen. Berry und ich erhandelten das gefleckte Fell 1881, als die letzten, großen Herden sich zwischen dem Yellowstone und Missouri aufhielten. Es war eine etwa fünfjährige Kuh. Das Haar war an Kopf, Beinen, Schwanz und Brust schneeweiß und auf jeder Flanke hatte es einen weißen Fleck. Da das Fell, wie gewöhnlich, am Bauche des Tieres aufgeschlitzt war, zeigte es eine etwa handbreite, weiße Umrandung, die kraß gegen das schöne Dunkelbraun der Mitte abstach. Der Jäger war ein junger, den nördlichen Stämmen angehöriger Schwarzfußindianer. Wir hatten damals einen guten Handelsplatz am Missouri. Berry reiste von dort eines Tages zu einem unserer Nebenhandelsplätze, und traf unterwegs eine Jagdgesellschaft der nördlichen Schwarzfüße, gerade im Begriff, die Beute zu zerlegen. So sah er den Halbalbino noch im Fell. Er reiste an dem Tage nicht weiter, sondern begleitete den Jüngling zu seines Vaters Zelt, wo er herzlich willkommen geheißen wurde. Wenn es auf der ganzen Welt einen Mann gab, der einen Indianer so beeinflussen konnte, daß er ihm zu willen war, so war es Berry. Er bemühte sich den ganzen Nachmittag, bis tief in die Nacht hinein, das Fell zu bekommen. Das Fell gehörte aber der Sonne, und es war gegen alle Sitte und nie dagewesen, daß man es verkaufte. Das wäre eine Entweihung gewesen. Der junge Jäger zog sich geschickt aus der Angelegenheit, indem er das Fell seinem Vater schenkte und endlich, als der Alte zum letzten Mal seine Pfeife ausklopfte, ehe er zur Ruhe ging, sagte er zu Berry: »nun wohl, mein Sohn, du sollst deinen Willen haben, mein Weib soll das Fell gerben, und ich werde es dir eines Tages geben.«
Es war ein prachtvoll gegerbtes Fell, auf dessen weißer Lederseite der Alte seine Erinnerungen gemalt hatte. Zuerst die Feinde, die er erschlagen, dann die Pferde, die er erbeutet hatte. Dann kamen die Kämpfe mit den Grizzlys und seine Zaubersterne und Tiere. Außer uns waren noch andere Händler in der Gegend. Eines Tages kam der Alte mit seinem Weibe angeritten und stellte das herrliche Fell vor allen Händlern aus. Natürlich wollte jeder es haben. »Ich kann es noch nicht verkaufen,« sagte der schlaue Mann. »Später – je nun, wir wollen sehen.«
Daraufhin buhlten natürlich sämtliche Händler um des Alten Gunst. Er wurde den ganzen Winter hindurch mit Tabak, Branntwein, Tee, Zucker und anderen guten Dingen von ihnen versorgt. Zwei oder dreimal in der Woche kamen er und sein Weib, beladen mit Branntweinflaschen, zu uns, setzten sich in unser Wohnzimmer und tranken sich buchstäblich voll. Ich fand großes Vergnügen daran, sie zu beobachten und ihren Erzählungen zuzuhören, denn sie waren so glücklich, so liebevoll, so ganz zurückversetzt in die schönen Tage ihrer Jugend.
So ging es ein paar Monate hindurch bis endlich, an einem Frühlingstage, als zufällig gerade alle unsere Nebenbuhler in unserem Laden herum lungerten, das alte Paar hereinstürmte und das Fell auf den Tisch warf. Der Alte sagte zu Berry: »Da ist es, mein Sohn, ich halte mein Versprechen. Aber lege es gut weg, denn wenn ich es sehe, nehme ich es vielleicht wieder mit.«
Wir freuten uns nicht über den Kummer der anderen Händler. Jeder von ihnen war so sicher gewesen, der glückliche Besitzer dieses seltsamen Felles zu werden. Aber es waren Neulinge, die sich mit den Indianern nicht auskannten. In jenem Winter setzten wir über 4000 Büffeldecken um, mehr als alle anderen Händler zusammen. Endlich verkauften wir auch das wundersame Fell. Das Gerücht von diesem Besitz verbreitete sich in der Gegend und drang bis nach Montreal in Canada. Ein Herr, der das Land bereiste, hörte davon, trat eines Tages bei uns ein und hatte es, ehe wir wußten, wie uns geschah, gekauft. Wir wollten es nicht verkaufen und nannten ihm einen ungeheuren Preis. Zu unserem Staunen legte er zwei große Geldrollen auf den Tisch, warf das Fell über die Schulter und eilte zurück zum Dampfer. Berry und ich schauten uns an und sagten nichts.