
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
War das eine U-Boot-Fahrt mit dem Doktor Kleinermacher! Dieter konnte sich gar nicht vorstellen, daß die Matrosen auf ihren großen Schiffen mehr und Besseres von ihren Kämpfen mit Haifischen und Walfischen erzählen könnten. Wie liebevoll und tapfer war doch der Stichlingspapa, und wie merkwürdig ist das Leben einer Wasserspinne! Und solche abenteuerlichen Gestalten gibt es in jedem Tümpel unserer Heimat. Dieter machte immer große Augen, wenn er später an einem kleinen Gewässer vorüberging. Zu einem Schulkameraden sagte er einmal: »Weißt du, was sich da drinnen im Wasser abspielt? Mord und Totschlag, Krieg und Kampf, eine Spinne baut sich da drin eine Taucherglocke, und ein Fischvater paßt ganz allein auf seine hundert Kinder auf. Vor jeder Pfütze muß man den Hut abnehmen, soviel Wunder gibt es darin.«
Aber der Schulkamerad sah den Dieter ganz verwundert an und verstand ihn nicht.
Desto besser verstand ihn Traute, und die beiden Kinder wurden immer bessere Freunde. Bald wollten sie eine neue Verabredung mit dem Doktor treffen, als eine Nachricht alle Zusammenkünfte für die nächste Zeit mit dem Doktor Kleinermacher zerschlug. Dieter und Traute sollten an die See verschickt werden. Wie hätten sie sich früher über diese Nachricht gefreut! Jetzt wollten sie aber gar nicht froh werden darüber. Es gab am Meer ja allerlei zu sehen, aber so viel Wunder, wie beim Doktor Kleinermacher zu erleben waren, konnte ihnen niemand zeigen. Eine Entfernung von dem Doktor Kleinermacher bedeutete jetzt für alle Fälle Einsamkeit, Langeweile und Trostlosigkeit. Nur beim Doktor Kleinermacher gab es Erlebnisse, Abenteuer und Wunder.
Dieter und Traute beschlossen, auf ihre Eltern so lange einzureden, bis die Verschickung an die See aufgegeben wurde. Aber wie fängt man so etwas an? Auf alle Fälle darf dabei der Doktor Kleinermacher nicht verraten werden, am besten, man holt sich Rat beim Doktor selber.
So klopften sie denn eines Tages bei ihrem Wundermann an und baten um Rat. Der Doktor lächelte so verschmitzt und so heiter, daß die Kinder wußten, jetzt geht sicher alles in Ordnung. Denn der Doktor Kleinermacher wird uns helfen, überall weiß er ja einen guten Rat. Der Doktor aber sagte:
»Kinder, laßt euch ans Meer verschicken. Das paßt wunderbar in meinen Kram. Wirklich, fahrt an die See, ihr sollt es nicht bereuen.«
Was hat nur der Doktor? Wir sollen von ihm weg? Will er uns loswerden? Das kann doch gar nicht sein, wir haben uns doch immer so gut verstanden. Besser, man überlegt nicht lange und hört auf das, was der Doktor sagt. Aber komisch ist diese Trennung doch, so ganz ohne Bedauern und Traurigkeit.
Der Tag der Abreise kam heran. Dieter und Traute wurden von ihren Eltern an den Bahnhof gebracht. Es gab ein Abschiednehmen und ein Winken, die Mütter hatten noch endlose Ratschläge für ihre Kinder, und dann holte der Zug tief Atem, stieß den Dampf aus und rollte langsam aus dem Bahnhof. Die Mütter und Väter rannten noch ein Stück mit dem Zuge mit, bis zum Ende des Bahnsteiges, und dann winkten sie mit ihren Taschentüchern, immerzu, bis sie ganz klein waren.
Im Zug fingen die Kinder an zu spielen: Pfänder verlosen, Lieder raten und das Spiel von Feuer, Wasser und Kohle. Dann fingen sie wieder an zu singen, und als sie nicht mehr singen konnten, wickelten sie ihre Brotpakete aus. Traute vertauschte eine Apfelsine mit einem Apfel, und Dieter tauschte Zigarettenbilder. Ein Mädchen holte ein Stück Papier hervor und schrieb sich alle Stationen auf, die der Zug durcheilte. Traute wurde auch zum Schreiben angeregt und schrieb Ansichtspostkarten und einen Brief an ihre Mutter.
So ging die Zeit dahin. Einige Kinder waren schon eingeschlafen, als der Zug anhielt und die Schwestern riefen: »Kinder, alles aussteigen, wir sind angelangt. Das letzte Stück fahren wir mit einem Dampfer.« Da kam Leben in den Zug. Die Koffer und Pakete wurden zusammengetragen, und alles drängte dem Ausgange zu. Auf dem Bahnsteig mußten sich die Kinder anstellen, und singend ging es vom Bahnhof durch die kleine Stadt. Noch eine kleine Straßenbiegung, dann sahen die Kinder den kleinen Hafen und das weite, weite Meer. War das ein Erlebnis! Soviel Wasser auf einmal, gibt es denn so was? Bis ganz weit hinten, da wo sich Himmel und Erde berühren, reichte das große Wasser. So weit, so weit, kann denn Wasser so weit reichen? Es ist ja unheimlich, wieviel Wasser es auf der Erde gibt. Wenn das mal überläuft!
Die Kinder bestiegen ihren Dampfer, und als der abfuhr, blickten sie noch immer über die weite Fläche des Meeres. Dahinten ging die Sonne unter. Nur noch einen Finger breit standen Sonne und Wasser voneinander entfernt. Immer näher und näher kam die Sonne dem Wasser. Jetzt berührten sich Feuer und Wasser. Traute ergriff den Dieter, zog ihn am Arm und sagte: »Du, Dieter, jetzt muß das Wasser zischen.« Aber die Sonne ging unter, und das Wasser kochte nicht.
»Dumme Traute«, sagte Dieter, »weißt du denn nicht, daß die Sonne noch viel weiter weg ist als das Meer?«
Die ersten Tage verbrachten die Kinder in ihrem neuen Heim noch voller Erwartung und Neugierde. Das Meer sah jeden Tag anders aus. Mal still und durchsichtig, dann grün und dann wieder düster und grau. Am Strande konnten sie Burgen bauen, und in den Dünen umherklettern war herrlich. Auch konnten sie sich über die Kinderschwestern nicht beklagen, sie waren wirklich gut. Was aber macht Doktor Kleinermacher?
Tagelang gingen die Blicke der Kinder über das Meer. Wie geht es unserem lieben Doktor Kleinermacher? Macht er nun ganz allein Abenteuer? Denkt er noch etwas an uns? Oder sind Dieter und Traute ganz und gar abgemeldet?
Eines Tages hielt wieder ein Dampfer an. Die Fahrgäste stiegen aus, Männer und Frauen, und da – – der Doktor Kleinermacher! Hurra, unser Doktor Kleinermacher! Dieter und Traute bestürmten den alten kleinen Herrn so sehr, daß er kaum atmen konnte. Für wieviel Tage besuchst du uns? Bleibst du solange hier wie wir? Hast du auch solche Sehnsucht gehabt? Hast du das U-Boot mitgebracht? Lieber guter Doktor Kleinermacher!
Der Doktor hatte alles mitgebracht. Er wollte nicht lange bleiben, aber er wollte ein Abenteuer mit den beiden Kindern bestehen, das sich so leicht nicht wiederholen sollte. Das U-Boot hatte er auch mitgebracht. Morgen nachmittag sollten die Kinder an der letzten Düne auf ihn warten. Dahinten würde sie niemand beobachten. Dann ging der Doktor in sein Quartier.
In der Nacht konnten die beiden Kinder keinen Schlaf finden, und am nächsten Tage konnten sie vor Aufregung kaum etwas essen. Aber frisch und munter waren sie doch am verabredeten Treffpunkt. Der Doktor stand schon bereit. Wieder hatte er eine kleine Landungsbrücke gebaut. Da das Wasser am Ufer sehr flach war, hatte er sogar einen kleinen Kanal in den Sand gegraben. Auch war das U-Boot schon im Wasser am Landungssteg befestigt.
»Rasch die Wunderpulle her«, rief Dieter voller Aufregung. Lächelnd gab der Doktor jedem die Flasche zu einem Schluck. Dann schrumpften die drei zusammen, daß die Dünen wie riesige Gebirge erschienen. Aber zum Betrachten der trockenen Erde war keine Zeit und bestand keine Lust. Rasch auf den Landungssteg, beinahe wäre Dieter vor lauter Hast ins Wasser gefallen, und dann in das U-Boot hinein. Der Doktor machte die Klappe zu, ließ den Motor laufen, ging ans Steuer, und jetzt war alles seeklar.
Hinein in das Salzwasser! Sicher und ruhig fuhr das U-Boot durch die Brandung und erreichte bald tiefere Stellen. Dieter und Traute blieben am Fenster und sahen sich die Unterwasserwelt an. Der Blick war klarer und ging weiter als im trüben Wasser des Teiches nahe dem Imkerhause. Muschelschalen lagen im Wasser umher, und freche Krabben stolzierten über den Grund.
»Du kleine freche Krabbe«, drohte Traute einer Krabbe mit dem Finger. Der Doktor konnte es nicht unterlassen, schon am Anfang der Fahrt mit seinen Belehrungen loszulegen. Aber er wußte ja, die Kinder hörten ihn gerne: »Die kleinen frechen Krabben sind gar nicht so furchtbar flink und niedlich, wie der Volksmund sagt. Die Fischer sagen nämlich zu den Garnelen Krabben. Das sind jene flinken, behenden Geschöpfe dort. Überall schwimmen sie durch das Wasser. Schwimmen vorwärts und rückwärts, stoßen überall hin vor und ziehen sich sofort zurück, wenn sie bedroht werden. Wenn die großen Krebse eine Nahrung vertilgen, dann fliegen die Fleischreste umher. Die Tiere sind keine sauberen Esser. Und auf jene Fleischbrocken haben es die Garnelen abgesehen. Sie sind gewissermaßen die Reiniger des Meeres. In größere Aquarien mit Salzwasser setzt man immer gerne Garnelen, denn die halten das Becken sauber, sie verzehren das, was die großen Herren veraasen. Manchmal stehlen sie auch einem größeren Krebse die Nahrung vor dem Maule weg. Dann müssen sie sich aber schnell zurückziehen, sonst werden sie selber verzehrt. Diese kleinen Garnelen nennen die Fischer Krabben, und von den Tieren kommt der Name kleine, freche, niedliche Krabbe. Die echten Krabben, die Taschenkrebse hier, sind gar nicht so niedlich. Aber dafür können sie etwas anderes. Schaut einmal dort den Taschenkrebs, wie der läuft!«
Richtig, die Kinder sahen zu ihrem Erstaunen, wie die Krabbe nicht nach vorn, der Nase nach, sondern immer seitwärts lief. Die Krabben sind Seitwärtsgänger. Komisch, daß der Volksmund daraus nichts gemacht hat? Das wäre doch ganz nett, wenn man sagen wollte, der schlägt sich seitwärts in die Büsche wie eine Krabbe. Da macht man viel mehr Aufhebens von dem Rückwärtsgehen der großen Krebse, und dabei gehen die großen Krebse gar nicht rückwärts. Nur manchmal, wenn sie sich in ihr Versteck zurückziehen, kriechen sie in dem berühmten Krebsgang rückwärts, der gar kein natürlicher Krebsgang ist. Aber die niedlichen Garnelen schwimmen vorwärts und rückwärts, davon spricht kein Mensch.
Bei der immerwährenden Unterhaltung kreuzte das U-Boot durch das Salzmeer. Jetzt steuerte der Doktor auf einen besonderen Krebs zu, den er Einsiedlerkrebs nannte. Die Kinder sahen, wie sich der Krebs über eine Meeresschnecke hermachte. Mit seinen Scheren riß er brutal das arme Tier aus dem Gehäuse, daß die Fleischstücke flogen. Die Schnecke war schon längst tot, und noch immer säuberte der Krebs das Gehäuse und entfernte alle Überreste aus der Schale. Nun merkten die Kinder, warum der Krebs die Schnecke aus ihrem Gehäuse herausgerissen hatte. Dem Einsiedlerkrebs ist nämlich der Panzer etwas knapp. Er darf sich nicht wie andere Krebse auf seine Rüstung verlassen, denn hinten ist er ziemlich weich. Aber er steckte sein Hinterteil in die Muschelschale, und jetzt hatte er eine Rüstung, die fester war als jede andere Rüstung eines Krebses. Aber damit war der Raubritter noch nicht zufrieden. Immer sein Gehäuse nachschleppend, rannte er unruhig auf dem Meeresgrunde auf und ab. Da, jetzt endlich hatte er das gefunden, was er suchte. Schnurstracks krabbelte er auf eine Seerose zu. So nannte nämlich Dieter das Wesen, weil es so schön bunt wie eine Blume aussah und festgewachsen war wie eine Pflanze. Aber der Doktor klärte die Kinder auf, daß das Wesen zwar See-Anemone heiße, aber ein Tier sei. Jetzt war der Einsiedlerkrebs bei der See-Anemone angelangt. Vorsichtig trennte er sie mit seinen Scheren vom Untergrunde ab, hob sie empor und verpflanzte sie auf seine Schneckenschale.
Was soll denn das bedeuten? Hat der Einsiedlerkrebs ein Schönheitsbedürfnis? Will er immer Blumen um sich haben?
Aber bald sollten die Kinder merken, wie wertvoll eine See-Anemone auf dem Buckel ist. Ein größerer Krebs nahte sich dem Mieter des Schneckenhauses und wollte den Fremdling herausziehen. Das aber duldete die See-Anemone nicht. Mit ihren Nesselbatterien – die Kinder kannten die gefährliche Einrichtung schon von der Süßwasserhydra im Teiche – spritzte sie den großen Krebs so gewaltig an, daß der sich eiligst zurückzog. Die Rosen haben Dornen, und die See-Anemonen haben Brennesselspritzer, die furchtbar unangenehm wirken. Gut, der Einsiedlerkrebs braucht die See-Anemone, weil die so unbarmherzig gut spritzen kann. Warum aber beschützt die See-Anemone den Krebs? Was sind ihre Vorteile in dem Tierbündnis?
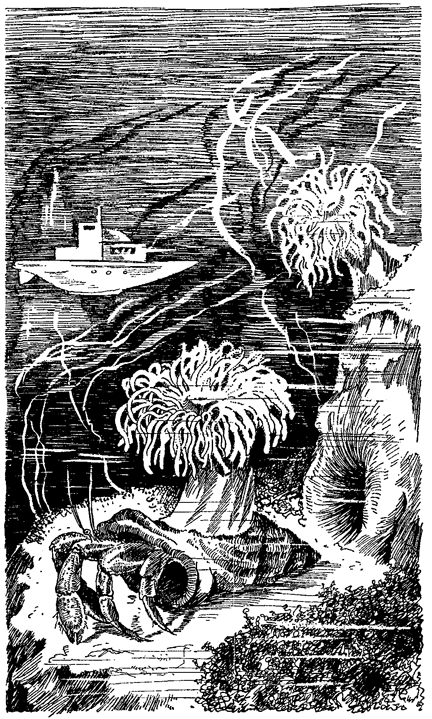
Die Kinder sollten es bald merken. Der Doktor steuerte sein U-Boot immer in der Umgebung des Einsiedlerkrebses, und jetzt konnten die drei beobachten, wie der Krebs sich über einen Wurm hermachte. Wie es so bei den Krebsen Sitte ist, sehr manierlich sind sie nicht beim Fressen. Die Fetzen fliegen umher, und die kleinen Fleischstücke wurden von den Fangarmen der See-Anemone, die wie Blütenblätter aussehen, ergriffen und in den Schlund befördert. Aha, die See-Anemone ist festgewachsen. Sie kann die Nahrung nicht aufsuchen und muß warten, bis die Nahrung zu ihr kommt. Nun trägt sie der Krebs auf der Muschelschale spazieren, von einem Ort zum andern, und wenn der Krebs frißt, dann fliegen die Fleischbrocken direkt in das Maul der See-Anemone. Der Krebs ist ein Liederjan. Aber von der Unordentlichkeit des Einsiedlerkrebses lebt die See-Anemone, und darum beschützt sie den lieben unordentlichen Kerl.
Der Doktor erzählte den Kindern, daß in anderen Meeren manche Krebse sich so sehr auf die See-Anemonen verlassen, daß sie sich erst gar keine Schneckenschalen aussuchen. Sie verzichten sogar auf ihre Scheren als Waffen. In jeder Schere tragen sie eine kleine See-Anemone vor sich her wie zwei Blumentöpfe, und davor haben die Feinde mehr Angst als vor den nackten Scheren.
Auf ihrer U-Boot-Fahrt sahen die drei viele Muscheln umherliegen. Manche lagen weit offen da, und andere waren geschlossen. Traute meinte: »Die da so verschlossen liegen, die sind wohl tot?«
Aber der Doktor sagte, es sei gerade umgekehrt. Wenn die Muschel nämlich ihre Schalen zusammenpreßt, dann muß sie ihre Muskeln anstrengen. Lange hält sie das nicht aus, einmal muß sie die Schalen wieder öffnen. Wenn die Muschel aber tot ist, dann erschlaffen die Muskeln, und alle toten Muscheln liegen mit offenen Schalen da.
Langsam steuerte der Doktor an eine halboffene Muschel heran. Kein Leben war an dem Tier zu bemerken. Das weiche Muschelfleisch regte und rührte sich nicht. Aber jetzt, deutlich bemerkte Dieter einen schwachen Pulsschlag der Muschel. Sollte er sich geirrt haben? Lange paßte er auf, aber der Pulsschlag wiederholte sich nicht. Jetzt, endlich wieder. Dieter fragte: »Liegt die Muschel hier im Sterben? Wenn ihr Herz so furchtbar langsam schlägt, dann wird es wohl bald mit ihr aus sein?«
Der Doktor erklärte: »Nein, nein, allen Muscheln schlägt das Herz so langsam. Es gibt kaum noch Tiere mit solchem trägen, langsamen Pulsschlag. Es gibt überhaupt kaum noch Tiere, die so wenig leben, so wenig Gehirn haben wie die Muscheln. Ich möchte sagen, die Muscheln sind die dümmsten Tiere. Es gibt aber noch leblosere Tiere, z. B. die Schwämme. Was sollen denn auch die Muscheln mit ihrer Klugheit? Wenn sie Wasser einziehen, dann atmen, fressen und trinken die Tiere zu gleicher Zeit. Aus dem Wasser holen sie die Luft, und von den kleinen feinen Lebewesen im Wasser ernähren sie sich. Zwar wachsen sie danach sehr langsam, aber sie wachsen. Denn die Muscheln werden sehr alt und haben Zeit zum Wachsen. Nur manchmal zeigen sie Lebenskraft. Wenn nämlich ein Feind naht, dann machen sie ihre Klappe zu, und der Räuber steht vor verschlossenen Türen. Ich muß euch noch erzählen, in den Tropen, da gibt es ganz riesige Muscheln, so groß wie eine Badewanne. Wenn die ihre Riesenschalen zumachen, dann darf kein Feind zwischen den Schalen sein, er würde zermalmt. Eine menschliche Hand zum Beispiel zwischen den Schalen wird mühelos abgeknipst.«
Dieter wollte wissen: »Woher kommen denn die Perlen in den Schalen? Wachsen die dadrin? Oder ist das auch ein Märchen?«
Der Doktor antwortete: »Die Perlen wachsen wirklich in den Schalen. Die alten Inder glaubten, wenn eine Göttin Tautropfen vom Himmel regnen lasse, dann kämen die Muscheln zur Meeresoberfläche, fingen die Tautropfen auf, ließen sie von den Sonnenstrahlen befruchten, und dann wüchsen aus den göttlichen Tautropfen die berühmten Perlen. So schön wie im Märchen ist aber die Geschichte der Perlen nicht. Kommt nämlich etwas Schmutz zwischen die Muschelschalen, dann versuchen die Muscheln, den Fremdkörper mit Perlmutt zu überwachsen. Es dauert Jahre, aber schließlich werden so aus Dreck Perlen. Häßlich, nicht wahr, die Entstehungsgeschichte der Perlen? In Japan will man heute nicht mehr so lange warten, bis zufällig Schmutz in die Muschel kommt und bis man zufällig auch gerade diese Perle findet. Man führt mit einer Pinzette in die Muschel künstlich einen Fremdkörper ein; nach Jahren öffnet man dann die Schalen wieder und findet eine Perle. Ein großer Streit: ist jene Perle nun eine künstliche oder natürliche Perle?«
Die Kinder fanden keine Zeit zu einer Erklärung. Sie entdeckten jetzt, wie ein Seestern mit seinen hundert kleinen, kurzen Füßen langsam auf die Muschelschale zukroch. Der Seestern war schön farbig, hatte aber keine Waffe. Wollte er die Muschel fressen? Das würde ihm kaum gelingen. Immer näher kam der Seestern der Muschel, jetzt war er dicht bei ihr, und schwapp, die Muschel klappte ihre Schalen zu. Prost Mahlzeit, Herr Seestern, früher aufstehen! So leicht verdient man sich nicht das weiche Muschelfleisch. Ein Glück, Herr Seestern, daß einer Ihrer Arme noch nicht zwischen den Schalen war, dann wäre er sicher abgeknipst worden.

Der Seestern kam zu spät, aber er ging nicht, der schlaue Bursche. Er wußte so gut wie der Doktor Kleinermacher, nicht für immer kann die Muschel ihre Schalen zusammenhalten, denn das erfordert Muskelkraft, und mal muß doch die Muschel erlahmen. Geduldig hielt er bei der Muschel aus. Jetzt glaubte er, daß seine Zeit gekommen sei. Mit zwei Armen saugte er sich an der unteren Schale fest, und drei Arme umklammerten die obere Schale. Dann riß er langsam, aber sicher die Schalen auseinander.
Gut, Herr Seestern, aber was nun? Dein Mund ist klein, sehr klein, und Zähne hast du auch nicht. Wie willst du denn die große Muschel verzehren? Aber der Seestern ist ein Tausendkünstler. Aus seinem kleinen Munde zwängte er seinen Magen heraus, stülpte ihn um, zwängte ihn durch den schmalen Spalt zwischen den Muschelschalen und verdaute die Muschel außerhalb seines eigenen Körpers. Dann zog der Genießer gut verdaut alles wieder ein. So ein Tausendkünstler, der Herr Seestern!
Es war kein Wunder, daß der Doktor wieder vom Seestern erzählen mußte. Wenn man dem Burschen einen Arm abschneidet, dann wächst ihm wieder ein neuer Arm nach. Aber noch mehr, aus dem abgeschnittenen Arm wächst sogar ein neuer Seestern heran. Ist das nicht merkwürdig, Kinder? Durch seinen Körper pumpt sich der Seestern immerfort Salzwasser des Meeres, das sei ebensogut wie Blut, meint er. Jedoch er hat auch echtes Blut. Auf dem tiefen Meeresgrunde wachsen entfernte Verwandte des Seesterns, die Seelilien. Ihre Nahrung besteht aus den Resten aller Art, die von oben herunterfallen. Was in den geöffneten Schlund hineinfällt, wird verzehrt. Sie kommen nicht um und verhungern nicht. Speisereste fallen genug auf den Meeresgrund.
Ein weiterer Verwandter des Seesterns ist der Seeigel. Der Landigel kann sich zusammenrollen, wenn Gefahr naht, der Seeigel aber bleibt ewig zusammengerollt, nie kann er sich aufrollen, denn sein Körper ist eine geschlossene Kugel. Und doch wird der arme Teufel gefressen. Und von wem? Von dem gefräßigen Seestern, seinem Verwandten.
Eine nette Verwandtschaft!
Mit Vergrößerungsgläsern zeigte der Doktor die kleinsten Lebewesen des Meeres von seinem U-Boote aus. Da schwammen niedliche Tiere, wie Schnecken aussehend, aber viel prächtiger und zierlicher, durch das Wasser. Ihr Panzer besteht aus Kalk und Kreide. So zahlreich sind sie, daß in früheren Zeiten die Kammern der toten Tiere in solchen Massen auf dem Meeresgrunde zusammenbackten, daß später, als der Meeresgrund emporgedrückt wurde, ganze Gebirge von jenen Tieren gebildet wurden.
Da aber schwimmen andere kleine Wesen durch das Wasser. Das Skelett dieser Kreaturen ist noch feiner, noch kunstvoller und noch schöner. Die Kinder wußten es ja, am prächtigsten und schönsten sind die allerkleinsten Lebewesen. Ihr Gitterpanzer besteht aus Kieselsäure. Auch diese Panzer lagerten sich auf dem Meeresgrunde ab. Man hat sie später gefunden, Kieselalgen nennt man jene Wesen und hat daraus – Dynamit gemacht. Das Leben ist so komisch. Unter dem Mikroskop erblickt der Mensch die schönste aller Welten, und er macht nichts Besseres daraus als ein Sprengmittel. Der Erfinder Nobel ist mit dem Dynamit schwer reich geworden.
Aber nun die Vergrößerungsgläser in die Ecke gestellt! Dort schwimmt ja ein urkomisches Wesen heran. Wie Glas ist der Körper, so durchsichtig, aber auch so weich wie Sülze. Das Tier ähnelt einer Glocke. Am Glockenrande hängen aber noch Bänder herab. Wenn nun das Tier, Qualle heißt das Geschöpf, durch das Wasser schwimmt, dann drückt es sich Wasser aus der Glocke heraus und schwimmt so durch Rückstoß vorwärts. Die Glocke zugedrückt und aufgespannt, immer im Wechsel, so schwimmt die Qualle, weich wie Sülze, durchs Wasser.
»Ein Glück«, sagte der Doktor, »daß wir in unserem U-Boot sind. Wären wir nämlich draußen, dann würde die Qualle mit ihren Nesselbatterien Salut abschießen, und wir würden elendig absaufen. Überall im Wasser sind doch diese gefährlichen Nesselbatterien, die so furchtbar wie Brennesseln wirken. Die Fischer haben schon gemerkt, wie eklig Quallen sein können, sie meinten, die Quallen teilten elektrische Schläge aus. Das ist aber gar nicht wahr. Noch merkwürdiger ist das Familienleben in der Familie Qualle. Die Kinder der Qualle nämlich schwimmen nicht so lustig umher, sondern sie lassen sich nieder, wachsen am Boden fest und sehen dann ungefähr so aus wie See-Anemonen. Erst die Kinder dieser Kinder, man nennt die Zwischeneltern Polypen, werden wieder Quallen. Die Polypen zerfallen nämlich nach einiger Zeit in lauter Scheiben, und aus jeder Scheibe entwickelt sich eine Qualle. Komisch geht es im Meere zu. Wenn man sich sehr gelehrt ausdrücken will, dann spricht man von einem Generationswechsel. Aber dadurch versteht ihr die Sache nicht besser. Oder seid ihr durch das Wort klüger geworden?
Halt, bei dieser Gelegenheit will ich euch den Mann nennen, der diesen Generationswechsel zuerst entdeckt hat. Ihr kennt nämlich den Mann. Habt ihr das köstliche Märchen vom Peter Schlemihl gelesen? Das Buch hat der Dichter Chamisso geschrieben. Dieser Dichter Chamisso war auch ein Gelehrter. Und der hat den Generationswechsel entdeckt. Na ja, man muß Wissenschaftler und Poet sein, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt.
Nun aber heim! Es ist höchste Zeit.«
Der Doktor steuerte sein U-Boot wieder dem Strande zu. Nicht einen Torpedo hatte er abgeschossen, und nicht einer Gefahr waren sie begegnet. Der Doktor war ordentlich stolz darauf, daß seine Abenteuer jetzt so gefahrlos ausliefen. Aber Dieter sehnte sich schon längst wieder nach einem handfesten Abenteuer mit einer ordentlichen Gefahr. Das regt tüchtig auf, und das Leben kostet es auch nicht, denn der Doktor ist ja dabei.
Sicher landeten die drei an ihrem zierlichen Steg, stiegen aus und warteten auf ihr Wachstum. Gerade wollte Dieter sagen, daß man sicher zu früh ausgestiegen sei. Vielleicht könnte man noch schnell einen kleinen Abstecher machen, da begann sich auch schon der Körper zu regen. Die drei wuchsen über das Zwergleben hinaus, der Doktor ging zum Wasser, beugte sich, nahm das U-Boot in seine Hand und verbarg es in seiner Tasche.
Es war schon alte Sitte geworden unter den dreien, wortlos gingen sie nach Hause. Nur zum Abschied sagte der Doktor noch: »Also morgen um dieselbe Zeit. Wieder hinter der letzten Düne.«