
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Marguerite war schlank, blond und die hochmütigste. Der Bischof hatte schon von ihr gesagt, daß das Leben für sie nicht leicht sein würde.
›Ich glaube, daß ich mich töten werde!‹ erwiderte sie jetzt. ›Herr Armand, ich bin aus guter Familie. Sie werden nicht von mir verlangen, daß ich für diese langweiligen Deutschen arbeiten soll! Lieber sterbe ich. Das Sterben sind wir Aristokraten gewohnt geworden, ich werde es mit Anstand besorgen!‹ Armand machte ein ernstes Gesicht. Er war ein älterer Mann und die Vertrauensperson des Bischofs, da konnte er sich schon ein freies Wort erlauben. ›Solange Gott es beschließt, solange muß jedermann sein Leben festhalten. Gott hat Ihnen das Leben gegeben, er wird es nehmen, wenn die Stunde gekommen ist. Jetzt ist sie noch nicht da: Sie müssen das Kreuz tragen, das Ihnen auferlegt wird!‹
Armand konnte fast schöner als der Bischof sprechen, und Marguerite senkte den Kopf. Aber sie hatte einen eigensinnigen Zug um den Mund, ich glaube, sie würde doch tun, was sie wollte. Berthe dagegen war sehr verständig.
›Gewiß, Herr Armand, wenn Sie glauben, daß ich mir mit meinen kleinen Kenntnissen mein Brot verdienen könnte, werde ich es gleich versuchen; vielleicht helfen mir auch die guten Deutschen, die ich gar nicht so langweilig finde. Ich habe von einer Wirtstochter schon Strümpfe und Schuhe zum Geschenk erhalten: bis jetzt hat mir kein Franzose, Sie ausgenommen, Herr Armand, die geringste Freundlichkeit erwiesen. Nein, ich will mich ganz gewiß nicht töten, der Tod kommt früh genug, und wir haben ihn in Frankreich genugsam kennen gelernt.‹
So sprach sie, war tapfer und wohlgemut, und Armand gab ihr die Hand.
›Sie werden sehen, Mademoiselle, daß ernsthafte Arbeit keinen Menschen schändet!‹

Dann habe ich die zwei jungen Fräulein eine ganze Weile nicht gesehen, und mein Bischof hat auch nicht von ihnen gesprochen. Wenigstens nicht in meiner Gegenwart. Und ich war doch dabei, wenn er die Besuche empfing. Es war eine ganze Reihe von Menschen, darunter auch Deutsche, die sich für den Bischof interessierten, weil er aus einer sehr berühmten und vornehmen Familie Frankreichs stammte. Es ist von manchen Dingen geredet worden: nicht immer konnte ich aufmerken, weil ich vieles nicht verstand, und wenn der Bischof nachher allein war, hat er wohl oft die Spieluhr in meinem Innern aufgezogen und ihren munteren Weisen gelauscht. Da hörte auch ich zu, und versäumte auf das zu achten, das der Bischof vor sich hin sprach. Er hielt viel von seinen Landsleuten und versuchte ihnen zu helfen, wie er nur konnte. Sie hörten ihn wohl an, versprachen alles, was er von ihnen verlangte, auch daß sie arbeiten wollten. Aber wenn er ihnen einiges Geld gegeben hatte, gingen sie weg und zeigten sich erst, wenn sie wieder ohne Mittel waren. Einmal ist auch der Bruder des ermordeten Königs, der Graf von Artois, bei meinem Bischof gewesen. Auch er wollte natürlich Geld, und der Bischof gab es ihm unter vielen Verbeugungen. Dann setzte sich der hohe Herr vor meine Platte, nahm ein Stück Papier und schrieb darauf nicht allein einen Schuldschein, sondern auch das Versprechen, sich des Bischofs und seiner Familie immer in Gnaden zu entsinnen. Dieses Papier habe ich nachher lange in meiner Geheimschieblade gehabt: es ist erst viel später daraus genommen worden, als der Bischof gestorben war und einer seiner Erben mich als Schreibtisch eine Zeitlang benutzte. Was damit geschehen ist, weiß ich nicht. Der Erbe, ein französischer Graf, hat mich dann für ein Spottgeld verkauft. Er war nur nach Norddeutschland gekommen, um nach verschiedenen Menschen zu forschen, die hier gelebt haben sollten, und von denen niemand etwas Ordentliches wußte. Er fand sie auch nicht: So wenigstens habe ich mir von dem alten Lehnstuhl des Bischofs berichten lassen, mit dem ich mich beim Auktionator wiederfand. Es ist merkwürdig; die Menschen, die sich so viel einbilden, und alles wissen wollen, sind ein kurzlebiges Geschlecht: plötzlich sind sie tot, und wir müssen unsere Eigentümer wechseln!« Der Sekretär schwieg, und der Mond lächelte ihm gutmütig zu.
»Du verstehst nicht viel von der göttlichen Weltordnung, obgleich du in so ehrwürdiger Obhut gewesen bist. Dein Bischof hätte einmal verständig mit dir reden sollen, wie er es mit den Menschen tat. Im übrigen war er ein guter Mann, und wenn er wirklich gelegentlich etwas über den Durst trank, so muß man bedenken, daß er aus einem Weinlande stammte, und aus einem Hause, wo man den Vergnügungen sehr ergeben war. Wie denn der französische Hof selbst sehr vergnügungssüchtig war, und manche Stimme der Warnung in den Wind schlug, bis es zu spät war. Die Franzosen haben sich oft ihr Grab selbst gegraben und werden es noch oft tun. Jedenfalls hat der Bischof die Fehler seiner Landsleute klar eingesehen und einigen auf den rechten Weg geholfen. Wenn es nicht viele gewesen sind, dann ist es nicht seine Schuld gewesen.«
»Warum er wohl niemals wieder nach Frankreich zurückgekehrt ist?« fragte der Sekretär, »ich hätte ihm gewünscht, daß er seine Heimat wiedergesehen hätte.«
»Er ist in seiner bescheidenen Wohnung, hier in der Stadt gestorben. Aber vor einigen Jahren hat man seine Gebeine, die in der Krypta der katholischen Kirche standen, nach Frankreich überführt. Es sind die Deutschen, die sich seiner erinnerten: die Franzosen denken nicht gern zurück, und wer tot ist, der bleibt immer tot und ist vergessen. Die Deutschen sind anders geartet; ich aber spende mein Licht den Deutschen wie den Franzosen: Gott hat beide Völker erschaffen und ich muß ihnen dienen.«
Der Mond war ernsthaft geworden: aber dann hielt er mit Sprechen inne und beschien die leeren Augen der kleinen Schäferin. Sie rührten sich ein wenig und dann war es, als hätten sie Pupillen und könnten sehen.
»Ich habe dich nicht vergessen!« sagte der Mond. »Alles zu seiner Zeit, Kleine! Das Durcheinanderreden kann ich nun einmal nicht haben. Aber ich meine, daß du mit Berthe und Marguerite hierher gekommen bist und daß du sie auf ihrem Lebenswege begleitet hast. Ist es nicht so?«
Die Schäferin zitterte ein wenig, dann begann sie mit einer sehr feinen Stimme zu sprechen.

Du irrst dich, Herr Mond. Die beiden jungen Demoisellen haben mich nicht mitgebracht: sie fanden mich in dem alten Stübchen, das sie sich mieteten. Dorthin hatte mich ein Emigrant gebracht, der mich aus den Tuilerien mitnahm und hier billig verkaufte. Marguerite weigerte sich zuerst, ans Arbeiten zu gehen, aber Berthe setzte ihren Willen durch. Sie war fröhlich trotz allen Unglückes, das sie getroffen hatte. Sie meinte, man müßte das Leben anpacken, und daher nahm sie die zwei Zimmerchen zu ebener Erde bei der Witwe Grünau und hängte einen Zettel ins Fenster, darauf zu lesen stand: Hier werden Spitzen gestopft und gewaschen, hier kann man Französisch lernen und hier gibt es jeden Sonnabend frische Kuchen, wie sie am Hofe des Märtyrerkönigs gegessen wurden.‹ Als Marguerite diesen Zettel las, fiel sie fast in Ohnmacht, und als Berthe ihr nicht einmal ein stärkendes Salz unter die Nase hielt, ging sie zwei Tage zu Bett. Dann langweilte sie sich, obgleich ich auf einem Brett über ihrem Bette stand, und schließlich erhob sie sich und begann, unter Berthes Leitung, die kleinen Kuchen zu backen, die nachher frisch und knusperig im Fenster standen und bald verkauft waren. Marguerite zeigte sich selten. Sie hatte einen kleinen Küchenraum, in dem sie buk und auch Spitzen wusch und stopfte, denn sie sah ein, daß, wenn sie nicht verhungern wollte, die Arbeit sie vom Hungertode rettete. Sie war nicht dumm, diese blonde Marguerite: ganz im Gegenteil, sie las in verschiedenen Büchern und sie sprach manchmal laut vor sich hin. Auf diese Weise habe ich viele ihrer Gedanken erfahren. Sie waren oft sehr bitter. Es ist auch nicht leicht, eine verwöhnte Haustochter zu sein und dann plötzlich auf der Landstraße zu stehen und nichts zu haben, als das eigene, oft armselige Leben. Außerdem war Marguerite schon verlobt gewesen, und zwar mit einem jungen Mann, den sie gut kannte und sehr liebte. Er hieß René von Renneton und war noch im Hause von Marguerites Eltern gewesen, ehe diese verhaftet wurden. Und er hatte ihnen feierlich versprochen, sich niemals von seiner Braut zu trennen und gut für sie zu sorgen. Damals aber konnte man wohl solche Versprechungen geben, aber sie selten halten. Marguerite mußte mit ihren Eltern ins Gefängnis wandern und seit der Zeit hörte sie nichts mehr von René. Als sie mit Armand floh, hatte sie keine Zeit zum Fragen. Nun aber dachte sie an ihn, hoffte, ihn vielleicht in Deutschland zu treffen, und als sie ihn nicht fand, mußte sie fürchten, daß auch er der grausigen Guillotine zum Opfer gefallen wäre. Wenn sie allein war, weinte sie oft, rang die Hände und flüsterte seinen Namen. Es war traurig, und wenn ich hätte weinen können, dann würde ich es getan haben. Aber wir Puppen von Porzellan haben keine Tränen, und was wir fühlen, können wir nicht zeigen. Berthe war manchmal grausam. Sie kam oft in Marguerites kleine Küche hinein gelaufen, fragte nach den Kuchen, nach den Spitzen. Brachte neue Arbeit und manchmal ein lustiges Lachen. Die Bürger der guten Stadt Altona waren oft sehr drollig. Sie kauften so viel Kuchen, daß Marguerite auch Mittwochs welche backen mußte, und einige waren unter den Herren, die Französisch zu lernen begehrten. Auch etliche würdevolle Damen erschienen mit Spitzen und mit Dormeusen und wollten sie repariert haben. So konnte Berthe der Madame Grünau bald ihre Miete bezahlen und so viel Lebensmittel kaufen, daß beide Fräulein satt wurden. Auch neue Kleider fertigten sich die Zwei an, und wenn sie dann einmal auf die Straße zur Messe gingen, dann sahen sie zierlich und frisch aus, und mancher von den französischen vornehmen Herren, der zuerst von den armen zwei Mädchen nichts hatte wissen wollen, begrüßte sie jetzt höflich, fragte nach ihrem Wohlergehen und lud sie ein, doch zu den Gesellschaften im Wirtshaus zu erscheinen, wo die Emigranten sich einmal in der Woche trafen. Beide Mädchen dankten in artigen Worten, versprachen auch zu kommen, taten es aber nicht.
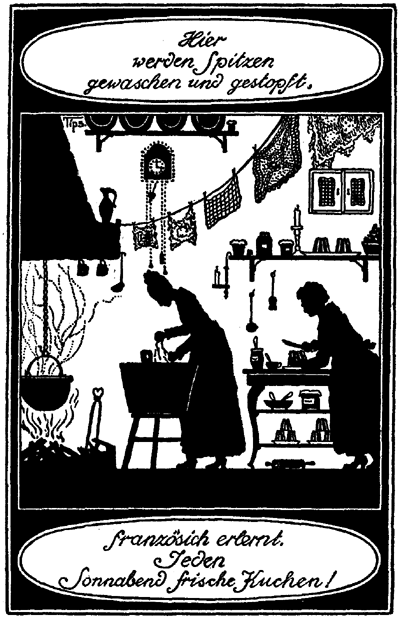
›Ich will mir nicht von den Grafen, Herzögen und Marquisen den Kopf verdrehen lassen!‹ sagte Berthe, wenn sie allein mit ihrer Kusine war. ›Sie haben sich in keiner Weise unserer angenommen, als wir hier allein und freundlos eintrafen. Sie waren alle ängstlich, wir könnten ihnen zur Last fallen. Und dann gehören wir ja auch nicht zu dem vornehmsten Adel, wie die meisten dieser Herrschaften. Unsere Väter waren hohe Beamte in einer Provinzstadt. Das bedeutet bei den Herren und Damen, die den König und die Königin kannten, gar nichts. Ihren Hochmut haben sie alle schön mitgebracht, da mögen sie ihn auch weiter behalten. Ich habe lieber mit den Deutschen zu tun, die es ehrlich meinen und die Mitleid mit uns empfinden!‹
›Hoffentlich heiratest du nicht einmal einen Deutschen!‹ sagte Marguerite, die der anderen aufmerksam zuhörte.
›Werde wohl keine Gelegenheit haben. Denn es gibt sehr hübsche Mädchen in Altona und in Hamburg. Die haben ein eigenes Heim und Eltern, und vielleicht auch eine Aussteuer – wir aber sind nichts und bedeuten nichts. Sind fremd hier und müssen ins Armenhaus, wenn wir nicht mehr arbeiten können. Also glaube ich nicht, daß ein Deutscher mich heiratet. Sollte er es aber dennoch wollen und er mir gefallen, dann würde ich nicht nein sagen!‹
Marguerite fuhr auf. ›Berthe, rede keinen Unsinn, auch du warest verlobt, hast du das vergessen?‹
Berthe lachte. ›Mein Kind, der dicke Gerichtsrat, dem mich meine Eltern bestimmten, hat mich noch keine Stunde Schlaf gekostet. Er ist damals, als der Lärm in unserer Stadt begann, gleich geflohen und wird irgendwo in Deutschland ein behagliches Leben führen. Hielte er etwas von mir, würde er sich wohl einmal nach mir umgesehen haben; nein, an diesen guten Mann fühle ich mich nicht gebunden!‹
›Er war aus guter Familie und sehr wohlhabend!‹ warf Marguerite ein.
›Ganz recht, daher meinten meine guten Eltern, daß meine Zukunft sicher wäre, wenn ich diesen Mann heiratete. Die Eltern haben sich getäuscht, niemals war meine Zukunft unsicherer, als in diesen Zeiten. Daher will ich auch nicht der Zukunft, sondern der Gegenwart leben. Weißt du, Marguerite, wir hatten im Kloster doch einen so süßen Bonbon, er war braun und mit etwas Weißem gefüllt, würdest du ihn wohl bereiten können? Heute war hier ein kleines Fräulein aus Hamburg, die für eine Gesellschaft viele Süßigkeiten, am liebsten französische, haben wollte. Ich versprach ihr, wenn sie morgen wiederkehrte, daß sie mehrere schöne Leckereien bei uns finden sollte!‹
›Ich weiß zwei Rezepte für Bonbons!‹ erwiderte Marguerite, und dann begannen beide eifrig über das Kochen und Zubereiten der Süßigkeit zu reden. Es war gut, daß Marguerite auf diese Art ihren eigenen Gedanken entrissen wurde: sie weinte zwar noch oft um ihren René, der ganz sicher von den schrecklichen Männern der Revolution aufs Schafott geschleppt worden war, aber die Arbeit machte ihr doch ein gewisses Vergnügen. Als das Hamburger Fräulein am nächsten Tage wiederkam und alle Süßigkeiten, die die Kusinen bereitet hatten, mitnahm und in blanken Silbertalern bezahlte, da lächelte Marguerite zum erstenmal und erinnerte sich eines Kochbuches, das ihre Mutter besessen hatte und aus dem sie verschiedene Gerichte auswendig kannte.