
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In deine Festtagsstille
Tret' ich anbetend ein,
In deinen Gottesfrieden,
Du heilig Kämmerlein.
Zu neuem Kampf und Siege,
Zu neuer Glaubenstreu –
Zur Sammlung und zur Segnung,
Du stille Sakristei!
Des Herren Wort zu künden,
Zog ich in Schwachheit aus.
Nun trag ich's froh in seines
Und meines Vaters Haus.
Der Gnadengruß des Meisters
Macht' mir die Seele frei,
Und löste Bann und Fessel
In stiller Sakristei.
Nun soll sein Wort erklingen,
Hell wie im höhern Chor.
Nun heb' ich Perl um Perle
Aus Gottes Schatz empor.
Nun trag ich die Kleinodien,
Die Botschaft ew'ger Treu,
Hinauf zu heil'ger Stätte,
Aus stiller Sakristei.
Wird mir die Welt zu enge
Und Leib und Seele matt,
So winken mir die Zinnen
Der hochgebauten Stadt.
Die Palmentore glänzen,
Der Zugang wird uns frei,
Der Himmel steht weit offen! –
So schließt die Sakristei.
Hoch oben im Gebirge war's. Auf den Felsen lag sengende Sonnenglut, die Luft flirrte und zitterte in dörrender Hitze, als sei das Fleckchen Erde unter ihr ein Schmiedeofen, der seine höchste Glut erreicht und ausströmt. Grau und staubig lagen die Felder, kahl und vergessen die Gärtchen vor den kleinen Hütten, keine Blume blühte, kein fröhliches Lied klang zur Arbeit, das arme Bergdorf schien ausgestorben. Als ob das hartgewöhnte Volk des Kampfes mit Frost und Hitze müde geworden, als ob der kaum angebrochene Sommer ihm eine neue, nie gekannte, ungeheuerliche Not gebracht, vor der es Halt gemacht und geflohen wäre. O, es kannte sie, die weltferne, efeuumsponnene, felsenharte Scholle, die es sein eigen nannte, kannte die rauhe, unwirtliche Schale, die den edlen Kern barg, das Kleinod, das ihm kein Gold der Welt aufwog: Heimatrecht. Um nichts in der Welt hätte es diesen Schatz hingegeben – Dursten und Darben schien ihm leichter, als das Stückchen eigenen Landes missen, ob's auch nur ein rauher, unfruchtbarer Fels war, dessen Grasnarbe kaum ein Zicklein ernährte. Aber in diesem Sommer wuchs kein Halm, alles Leben starb im Keim. Die Welt stand unter dem Zeichen der Dürre. Und drinnen in den schwülen Kammern saßen sie beieinander, ließen die arbeitsharten Hände in den Schoß sinken und fragten einander, wie lange das Wasser in dem alten Ziehbrunnen noch ausreichen werde. Eine Antwort auf diese Frage vernahm keiner der müden, verzweifelten Menschen, denn niemand hatte den Mut, sie zu geben.
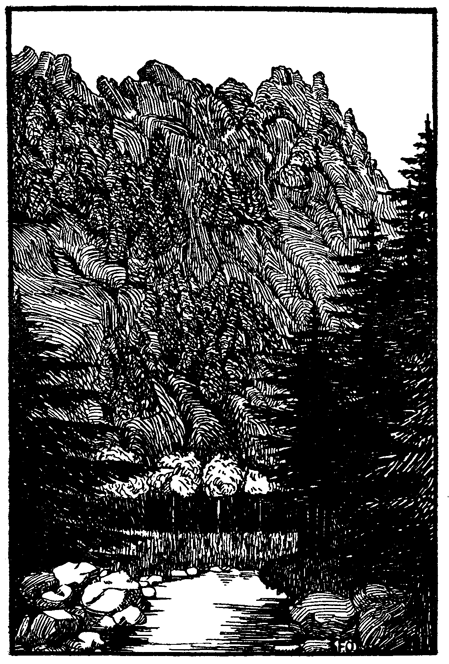
Aber sie alle wußten: wenn es nicht in den nächsten zehn Tagen regnete, Wochen und Monate hindurch – so müßten sie alle miteinander verschmachten. Manch grollender Blick irrte über den blauen, wolkenlosen Sommerhimmel, der sich in südlicher Schönheit über das kleine Bergdorf spannte, und manche Hand, die sich in guten Tagen fromm gefaltet, ballte sich beim Anblick des heimgesuchten Landes zur Faust. Wie ein Gespenst war's über die schmale Schwelle hereingetreten und hatte sich mit den Kindlein an den hölzernen Tisch gesetzt; den letzten Bissen nahm es, den letzten Becher Wassers leerte es vor den verlangenden Augen der Kleinen: das war die Dürre, die graue Frau, die kein Mitleid kennt, wenn Menschen und Tiere elendiglich verschmachten.
Ja, er hatte recht gehabt, der Pfarrer Johannes, wenn er dies Jahr ein nie dagewesenes hieß, denn ob manche Not an die Türen geklopft, eine Plage wie die heurige war's nimmer gewesen. Die ältesten Leute erinnerten sich nicht, also dem Tode ins Antlitz geschaut zu haben Tag um Tag, Woche um Woche. Armut und Entbehrung kannten sie wohl, Leid und Gebrest, Vergehen und Sterben – aber es war zu ihnen gekommen wie ein Gewappneter, fordernd und dahinraffend, nicht auf leisen Sohlen, eine endlos scheinende Qual, die heute das Letzte zertritt und morgen das Allerletzte. Mit zerbrochenem Leibe auf dem letzten Bette liegen war ein hartes Sterben – zuschauen müssen, wie Weib und Kind verhungern und verdursten – das war Todesqual!
*
Auf einer kleinen abseits gelegenen Anhöhe lag ein verwitterter Bau aus vergangenen Tagen. Ein unkundiges Auge meinte auf den ersten Blick ein Werk der Natur zu schauen, unbehauen schien der starre Fels, Efeu und Dornen wucherten über dem dunklen Grotteneingang. Wer aber näher zuschaute, gewahrte die Spuren uralter Kunst und das mühselige Schaffen des Steinmetz. Der Eingang mochte nicht verschließbar gewesen sein, Falz und Hespenhakenloch verrieten die ehemalige Pforte. Heut stand die ehrwürdige Stätte jedermann offen, nur die Waldrebe umspann das Geheimnis der Bergeinsamkeit mit ihren grünen Schleiern, und der Kreuzdorn streckte sein scharf' Geäst aus, als wollte er den Fremdling mahnen, an der Pforte des Himmels seine Schuhe auszuziehen. Blaue Glockenblumen wehten im Winde um das Felsentor, hier und da hob eine Immortelle das goldene Köpfchen – ein verirrter Falter gaukelte über dem braunen Grund, und die Luft zitterte und glühte ...
Ein müder, todmüder Schritt kam über die Felsen herauf, ein schneeweißes, gebeugtes Haupt ward sichtbar und die hohe Gestalt eines Greises. Er schob Ranken und Gezweig zur Seite und trat über die Schwelle, als sei er daheim in der stillen Felsenkammer. Aber in seinem Auge lag ein tiefer Schmerz, eine ungestillte bittere Qual, als sein Blick durch den engen Raum schweifte. Durch die Lichtöffnung der Wölbung blickte der blaue Himmel herein und die Sonnenstrahlen fielen auf die kleine Felsenkanzel und vergoldeten die dämmerige Spitzbogennische, deren steinernes Becken das Weihwasser barg. Ein Marienbild blickte milde aus rauhem Geklüft, und drüben, wo das Chörlein sich wölbte, ragte das Kreuzbild Gottes über dem Altar. Das Gewand der Madonna hatte seine Farbe verloren und das Gnadenantlitz über der heiligen Stätte seine einstige Schönheit; die Zeit und des Wetters Unbill hatten manches Unheil angerichtet. Aber trotz all ihrer Mängel und Schäden lag eine Weihe über der armen Steinkirche, als hielten Engel an der stillen Stätte Wacht, die den ersten Christen im Sachsengau als Heiligtum und Zufluchtsstätte gedient.
Eine liebliche Sage knüpfte sich an die Felsenkapelle.
Als einst die Sachsen dem Wotan ihre blutigen Opfer darbrachten, trat der heilige Bonifatius in ihre Mitte und verkündigte ihnen den wahren Gott. Dann ergriff er eine hölzerne Axt und begann mit derselben den Felsen auszuhöhlen. Und siehe, das harte Gestein schwand unter dem schwachen Werkzeug dahin wie Wachs. Die göttliche Sendung des Heidenapostels war besiegelt. Anbetend fielen die trotzigen Sachsen nieder und ließen sich taufen.
Das war die Steinkirche und ihre altehrwürdige Geschichte, und wie eine Erscheinung vergangener Zeiten stand unter dem Felsentor der Wächter und Priester des weltvergessenen Heiligtums, der Pfarrer Johannes.
Ein Leben voll Mühe und Arbeit lag hinter dem Siebzigjährigen, ein hartes, entsagungsreiches Jahr reihte sich an das andere, aber er war nicht müde geworden, den unwirtlichen Boden urbar zu machen, und sein Tun ward reich gesegnet. Mit rührender Liebe hing das arme Bergvolk an dem treuen Seelsorger, der es nicht nur von der Felsenkanzel herab zur Buße vermahnte, sondern auch draußen im Alltagsleben helfend und mitarbeitend an seiner Seite stand und Not und Glück mit ihm teilte. Und der Pfarrer Johannes war weiß geworden im Dienst der Steinkirchengemeinde. Wenn er rückwärts blickte auf das lange einsame Leben oben in den Bergen, dann dankte er Gott für alles, was er sich erkämpft und errungen, für den Frieden, der nach manchem Sturm bei ihm eingekehrt war. Er hatte vielem entsagt im Leben, manch harten, schweren Streit hatte er mit sich selbst geführt, mit jäher Leidenschaft und heißer Frauenliebe – aber er hatte gesiegt und war still emporgestiegen in die große, schweigende Bergeinsamkeit, um dem armen, weltfernen Volk die frohe Botschaft zu bringen. Jahrelanges mühseliges Schaffen galt's und dann kam der Lohn. Kein Kirchenfürst unten in Bischofssitz und Pfalz konnte willigeres Gehör finden, als der demütige Pfarrer der armen Waldgemeinde, und treuere Anhänglichkeit gab es nimmer. Jedes Kind grüßte ihn strahlenden Angesichts, und wenn er die welke Hand auf ein Flachsköpfchen legte, blickten ihn die großen blauen Augen vertrauend an und das rosige Gesichtlein schmiegte sich an seine Knie – ein Lächeln verklärte das Greisenantlitz – die Liebe des kleinen Volkes war der Dank der Männer und Frauen, denen er Glück und Lebensfreude geopfert.
*
Die Sonne ging zur Rüste, purpurn lag ihr Feuerschein über den Felsen und dem wildumrankten Geklüft der Steinkirche. Aber die Abendkühle blieb aus, kein Windhauch erfrischte das durstende Land und die ermatteten Menschen.
Wolkenlos stieg die sternklare Sommernacht über die Berge und der Vollmond bestrahlte Tal und Tannen. Der lichte Himmel in seiner ewigen Schönheit schien der verschmachtenden Erde spotten zu wollen!
Der Pfarrer stand noch immer auf der Schwelle; sein ernstes Auge blickte forschend in die strahlende Weite, dann wandte er sich seufzend ab und schritt durch das dämmernde Kirchlein einer engen Nische zu, deren Inneres der Gemeinde durch einen weit vorspringenden Fels verborgen bleiben mußte. Ein steinerner Tisch, ein in den Granit gehauenes Betpult unter dem rohgeschnitzten Kruzifixus, über dem Bibelbuch der Schimmer der ewigen Lampe – der Pfarrer Johannes trat in die Sakristei.
Und das gewaltige Auge blickte noch ernster, auf der edlen Stirn lagerten tiefe Schatten, als er sich in dem stillen, heiligen Raum vor dem Kreuz auf die Knie warf und das weiße Haupt auf die verschlungenen Hände drückte.
»Herr, nur das nicht! Nur das nicht nach jahrelangem Schaffen und Mühen! War ich ein ungetreuer Knecht, der sein Pfund im Schweißtuch vergrub? Hab ich dein Wort nicht rein verkündigt in Schwachheit und Nöten, in Frost und Hitze, ob Leib und Seele darniederlagen? Vierzig Jahre lang bin ich im Dienst der Gemeinde, gesät und geerntet hab ich, das Volk folgte meinem Wort und hing mir an – und heut', da mein Haupt schneeweiß geworden, da wenden sie sich von mir und schütteln die Köpfe in Trotz und Verzagtheit, weil der Pfarrer Johannes nicht den Regen vom Himmel herunter zu beten weiß, weil der Felsen sich nicht auf sein Wort erschließt und Wasser spendet! Bin ich ein Moses, ein Elias, der Propheten einer, die an deinem Thron stehen Tag und Nacht? – Der arme Pfarrer Johannes bin ich, nicht wert, des heiligen Bonifatius Feld zu bauen, aber du, Herr, hast mich hinaufgeführt in die große Stille, und ich habe mein Werk getan mit Freuden – bis auf diesen Tag!« Die greise Gestalt ward von Schluchzen erschüttert, die welken Hände rangen in heißem Gebet, im Eifer um ein heilig' Amt. Ein unerbittlich harter Kampf war's, ein Kampf bis aufs Blut um jahrelange Treue, um das Werk eines Menschenlebens. Und immer wieder war's die eine Frage, die den Streit von neuem entfachte, die den ringenden Mann tiefer in die Anfechtung hineintrieb: Würdig oder unwürdig? und der eigene Unwert trat ihm vor die Seele, die Kraftlosigkeit seines Gebets, der Schwachglaube des eigenen Herzens, seines Lebens Sünde. Eine Stimme aber flüsterte ihm ins Ohr: Du bist alt und grau geworden, des Geistes Feuer erlischt, du taugst nicht mehr für das schwere Amt – nimm deinen Stab und geh, bevor man dich zum alten Eisen wirft! – – Er lag am Boden. Die Wucht der Verantwortung warf den Starken nieder, Zweifel und Anfechtung stürmten auf ihn ein und vollendeten das harte Werk. Es war aus mit ihm. »Wasser, Wasser, nur einen einzigen Tag Regen für das versteinerte Land, Herr, und sie würden mich hören!« stöhnte er, das weiße Haupt verhüllend, dann kein Laut mehr, nur die schweren Atemzüge des Knienden unterbrachen die Kirchenstille.
Es war Nacht geworden in der Sakristei; der Priester Gottes kämpfte mit den Mächten der Finsternis. Draußen am Felsentor aber stand die Dürre, die Hand zum Fluch über die lechzenden Felder gestreckt.
Und morgen war Feiertag! –
*
Ein Wetter kam heraufgezogen ums Morgengold, aber die Sonne hatte gesiegt, kein Tropfen die Erde genetzt, und die Wolken schifften vorüber. Der Himmel strahlte im gewohnten Südlandsblau, die Luft zitterte und flirrte über dem ausgedörrten Acker – es war alles wie ehedem.
Von der Steinkirche herüber klang des Meßners Glöcklein, und den schmalen Bergpfad empor schritt der Pfarrer Johannes. Nicht rechts noch links blickend wanderte er den Weg, den er viel hundertmal gegangen war – so wie heut war er ihn nie gegangen.
Ein Bursch und ein Mädchen hatten miteinander auf der Dorfstraße gestanden, und den wandernden Wolken nachblickend, hatte der Mann so laut, daß der Vorüberschreitende es vernehmen mußte, gesprochen: »Das hat der Pfarr' getan! All sein Geplärr ist vom Teufel und verdirbt uns das Wetter!«
Der Greis hörte die Antwort des Mädchens nicht mehr, er sah nicht die blauen Augen, die sich in Zorn und Trauer auf den Liebsten richteten, und hörte den leichten Schritt nicht, der hinter ihm drein kam. Er wußte nur eines: die Sprache des Burschen war die Sprache des ganzen Dorfes, ob sie auch nicht laut ward.
Mit schwankenden Knien hastete er die staubige Straße entlang und sank in der Sakristei vor der Marter Gottes zusammen. Leidenschaftliches Schluchzen erschütterte den Körper des alten Mannes, er war am Ende seiner Kraft und seiner Hoffnung; was er in jahrelangem Mühen und Ringen erstritten, sank in sich zusammen wie ein Trugbild.
Was fruchtete sein Beten und Wachen? Wer vernahm seine Predigt? Ein halsstarrig Volk, das sich die Ohren verstopfte, saß unter der Kanzel der Steinkirche, ein Volk, das in der ersten großen Not, die ihm an Leib und Leben ging, abfiel von dem Herrn, seinem Gott. Jetzt wußte er, woran er war, lange genug hatte er sich getäuscht. Und sie sollten es hören, ins Angesicht sagen wollt er's ihnen, dann wollte er gehen, weit fort, hoch oben hinauf ins Gebirge, in die große, weltferne Stille, wo keine Menschenseele lebte, soweit die müden Füße ihn tragen würden. Es war genug – das Maß übervoll – vielleicht nahm der Herr seine Seele!
Er gedachte des Großen, der einst vor tausend Jahren in die Wüste unter den Wachholderbaum geflüchtet war, der mit Gott gerungen: Ich bin nicht besser denn meine Väter!
Und dann überkam's ihn, er wußte nicht wie, ein eifernder Zorn hatte ihn erfaßt und ließ ihn alle Milde, alle Nachsicht mit dem Elend des armen Bergdorfes und seiner Bewohner vergessen.
Wie Sturm und Gewitter brach's von der Kanzel über die Verzweifelten herein, ein erbarmungsloses Gericht sonder Schonen und Vergeben. Die bleichen Gesichter wurden immer härter, auf manchem Antlitz brannte der Haß. Und dann ging einer nach dem anderen hinaus. Nur ein paar Frauen und Kinder saßen noch in den Kirchstühlen, als das Amen an den Felswänden verklang. Und dann gingen auch sie; der Pfarrer Johannes stand allein in der Sakristei. Ja, nun war's da, das große Schweigen, das er heraufbeschworen. Stöhnend barg er das Antlitz in den Händen. Wie betäubt stand er vor dem Bilde des Erlösers, in seinem Hirn wogte es durcheinander: Zorn, Scham und bittere Selbstanklage.
Und mit plötzlichem, hartem Entschluß raffte der alte Mann sich auf, noch einmal irrte sein Blick durch den stillen heiligen Raum, wo er so oft Sammlung und Segnung gefunden, dann verließ er schweren Schrittes die Sakristei. Draußen in der Mittagssonne standen die Dörfler in Gruppen und besprachen, die Köpfe zusammensteckend, die Predigt. Keiner schien den Greis zu gewahren, der unfern auf schmalem Saumpfad die Richtung in das Gebirge einschlug.
Er vernahm nicht mehr den heftigen Streit, der sich zwischen den Leuten entspann, denn nicht der kleinste Teil der Gemeinde war auf des Pfarrers Seite und hieß die harten Worte eine wohlverdiente Zucht. Es sei an der Zeit, umzukehren und Buße zu tun, die Dürre sei die gerechte Strafe ihrer vielfachen Sünde. Der Pfarrer wäre zurückgekehrt, wenn er diese Reden vernommen hätte, aber er sah und hörte nichts und stürmte vorwärts, den einsamen Bergpfad hinan.
Zu den streitenden Männern war ein Mädchen getreten. Um das Haupt waren zwei schwere dunkle Zöpfe gesteckt, helles Rot lag auf den Wangen, die großen blauen Augen sprühten und blitzten im Zorn. Ihr Sonntagsstaat war ärmlich, aber sauber, knapp umschloß das schwarze Mieder den schlanken Leib, und die Brust arbeitete schwer unter dem schneeigen Linnen. Sie war an einen hochgewachsenen Burschen herangetreten und legte ihre arbeitsharte Hand auf seine Schulter.
»Du bist an allem schuld, Vollrath,« rief sie mit bebender Stimme, »deine unziemlichen Worte, die du auf der Dorfstraße gesprochen ...«
Der Bursche unterbrach sie rauh: »Ich schuld an dem Donnerwetter des Alten? Stellst mich wohl gar noch zur Red', wenn wir alle miteinander verschmachten?«
Das Mädchen war einen Schritt zurückgetreten. Dunkle Glut bedeckte den weißen Nacken und das schöne Antlitz. Sich hoch aufrichtend, hob sie den Arm wider ihn auf.
»Ja, zur Red' stell ich dich,« rief sie und die jungfräuliche Gestalt schien zu wachsen. »Zur Red' stell ich dich um deinen Unglauben, deine Gottlosigkeit, um deine Lästerreden. Meinst, der Herrgott werd' uns Regen bescheren, so lange so einer unter uns ist, der sein' heiligen Namen verspottet und verlacht? Da mag der Herr Pfarr' beten, da mag das ganze Dorf auf den Knien liegen, es wird nimmer regnen! Und wenn wir verschmachten müssen, Vollrath, so wird Gott dich und euch alle, die ihr wider ihn aufbegehrt, zur Rechenschaft ziehen!«
»Und ich sag dir's, Resel, jetzt schweigst,« schrie flammenden Auges der Mann, »und wenn du dein Zung' nicht wahrst, so –«
»Ich wahr' mein Zung' ohne dich,« rief Resel, den Kopf in den Nacken werfend. »Sollst mich auch nicht lang mehr hören! Nur eins noch mußt' wissen. Wenn du jetzt den Herrn Pfarr' nicht auf der Stelle um Verzeihung bitt'st, dann – dann geb ich dir mein Wort zurück, Vollrath! Auf so einer Lieb' ruht kein Gottessegen!«
»Ich den Pfarr' um Verzeihung bitten, nun und nie! Denk nicht, daß ich glaub', daß es dein Ernst sei, was du da red'st von deinem Wort. Aber, wenn so ein Lieb dir nimmer g'fällt, so magst gehen!«
Sein dunkles Auge ruhte forschend auf ihr mit heißer, heimlicher Frage.
Sie sah ihn mit unnennbarer Trauer an, als warte sie auf ein letztes Wort – dann wandte sie sich um und ging.
Er zuckte trotzig die Achseln und pfiff leise vor sich hin, während sein Blick ihr folgte, aber er ging ihr nicht nach.
Eine Weile stand man noch redend und streitend umher, dann gingen einige der Bessergesinnten in die Steinkirche, um mit dem Pfarrer zu unterhandeln. Den Ausgang der Sache abwartend, blieben die übrigen vor dem Grottentor.
Doch schon nach wenigen Augenblicken kehrten die Männer zurück, die gebräunten Gesichter fahl und bleich.
»Er ist fort,« klang es den Wartenden entgegen.
»Vollrath, Vollrath, wenn heut ein Unglück geschieht, so hast du's auf dem Gewissen.«
Der Bursch antwortete nicht. Das allgemeine Entsetzen lähmte ihm die Sinne. Aus dem Haufen der erregt durcheinander Redenden schlich er sich fort und schlug den Weg ins Gebirge ein. Er wußte es nur zu gut, war der Seelsorger der Steinkirchengemeinde ins Elend gegangen, so war die Resel, das Waisenkind, dem der Greis Vater und Mutter ersetzt, nicht weit davon. Aber es war ihm schwül zu Sinn. Wenn Resel von »so einer Lieb« sprach, dann standen die Dinge schlimm, und wenn den Pfarrer Johannes ein Unglück betroffen, so standen sie noch schlimmer; denn was die Resel sprach, war ihr allezeit ernst. Er kannte seinen Schatz.
*
Unaufhaltsam schritt der Pfarrer Johannes bergan in die schweigende Einsamkeit der Felsen. Eines, danach er sich gesehnt, fand er dort oben: Stille. Kein Lüftchen regte das braune Laub, kein Vogel sang in der blauen, sengenden Luft, eine Mittagsruhe waltete dort oben, wie sie dem Menschen selten wird. Hier und da wehte eine Glockenblume auf zartem Stiel, ein Käfer lief durch die knisternden Blätter, über das funkelnde Gestein huschte ein Salamander, sonst kein Laut, keine Regung. Und über das gewaltige Stück Natur ausgebreitet das Leiden, das unaufhaltsam seinen ehernen Gang ging, alles Leben im Keim tötend: die Dürre.
Der Greis stand schwer atmend still und blickte sich um. Das war das große Schweigen, die stille, heilige Bergeinsamkeit, da nur einer redete: Gott. Er strich sich wie geistesabwesend über die Stirn. Es war alles gekommen, wie er's gewollt, aber am Ziele angelangt, fehlte ihm etwas. Heißen Herzens hatte er's ersehnt, mit allen Sinnen danach verlangt, und nun versagte ihm die große, weltferne Stille das Kleinod, das sie selbst besaß: Frieden. Und darum nur war er gekommen, darum nur hatte er den Hirtenstab von sich geworfen und das Heiligtum verlassen, dessen Hüter er ein Menschenleben hindurch gewesen. –
Er raffte sich auf und wanderte weiter. Tiefer hinein in die steinerne Klause wollte er, wo's keine Weltgedanken mehr gab, kein Erinnern an Not und Glück, Liebe und Haß, an die tausend Dinge dieser Erde. Dann würde er auch einen Wachholderbaum finden und in seinem Schatten Frieden und den ersehnten letzten, langen Schlaf, um den er in heißem Gebet zu Gott gefleht. Der Herr würde ihn erhören, er vertraute fest darauf, warum sollte der Allmächtige dem schwachen, zu seinem heiligen Werke untauglichen Greise seine Bitte versagen. Immer tiefer spann er sich in seinen Schmerz ein und vergaß über demselben, daß ein Größerer einst dieselbe Bitte vergeblich gewagt, daß dem Propheten des alten Bundes auf sein lebensmüdes Gebet die vorwurfsvolle Frage geworden: »Was hast du hier zu tun, Elias?«
Immer steiler türmten sich die Felsen. Zwischen himmelhohen, senkrechten Steinwänden schritt er empor, wolkenloses Blau und strahlenden Sonnenglanz über sich, Staub und Geröll unter den Füßen, eine heiße, quallvolle Pilgerfahrt.
Aber quallvoller war die Last seiner Seele, die bangen, immer wiederkehrenden Gewissensfragen, die den alten Mann durch die Wüste begleiteten. Als sei die Hölle hinter ihm drein, als hätten sich alle Geister unter dem Himmel verschworen und kämen aus Schlucht und Klamm und Felsspalt hervor und umringten spottend den Einsamen! Wie schweifendes, wallendes Nebelgezücht umflatterte es den schreitenden Mann, die Schleiergestalten drängten sich an ihn heran, ihr Todeshauch streifte die feuchte Stirn – allen voran ein bleiches Weib von verlockender Schönheit, im wallenden Goldhaar das Diadem. Es neigte sich tief über die Schulter des Greises und flüsterte: »Hast du endlich deine Torheit eingesehen und das häßliche Felsennest verlassen, Johannes? Es ist spät geworden, aber noch ist es Zeit! Komm, wir wandern zusammen zum Jungbrunnen!« Ihr Haar umflatterte ihn, die weißen Arme streckten sich nach ihm aus. »Kennst du die Bischofsnichte nicht mehr, Johannes? Hast du's vergessen, wie wir zusammen in heimlicher Laube saßen, wenn die Mondnacht über dem Fluß strahlte, und von unserer Liebe redeten? Hast du's vergessen, Johannes? Als die Rosen blühten, bist du gegangen und hast mir kein Wörtlein zum Abschied gegönnt, sag', war das Treue? In der Bibel steht geschrieben: Die Liebe hörtet nimmer auf!«
Da stand der Greis; die Augen zornflammend, die Gestalt hochaufgerichtet riß er das Kruzifix aus dem Gewande und hielt es dem versucherischen Weibe entgegen: »Luitgard, wer ist dein Herr und Meister?«
Sie zuckte zusammen und duckte sich zur Erde, das Haupt im Schleier verbergend. Scheu flatterte das wilde Heer über die Felskuppen.
»Hinweg mit dem Gekreuzigten,« ächzte sie. »Wir haben beide nichts mit ihm zu schaffen. Mit Lucifer bin ich im Bunde, du aber warfst den Hirtenstab von dir und brachst deinen Eid! Hinweg mit ihm, Johannes! Unrein sind deine Hände und Lippen, du darfst sein Wort nimmer verkünden, und sein Kreuz ward dir zum Fluch!«
Ihre Augen flackerten wie ein Irrlicht, zerbrochen lag die schöne Gestalt am Boden.
»Johannes! Johannes!«
Aschfahl stand der Greis an die Felswand gelehnt, seine Augen waren aus ihren Höhlen getreten, krampfhaft umklammerten die fliegenden Hände das heilige Zeichen der Christenheit.
»Johannes!«
Die brechenden Augen sterbender Liebe sahen flehend zu dem Manne auf. »Hinweg mit ihm, oder ich vergehe!«
Aber unentwegt hielten die schwankenden Arme den Heiland empor. »Herr, führe mich nicht in Versuchung!« stöhnte der Pfarrer.
Und vor seiner Seele stieg ein rosenumsponnenes Bild empor, der stolze, altehrwürdige Bischofssitz zu Regensburg, und hoch in der Mauerkrone blühendem Rebengelände auf dem Bänklein, schön wie der Maitag, die junge Nichte des Kirchenfürsten.
Heißes Lieben und Kosen in mondklaren Sommernächten, von roten Lippen Kuß um Kuß, in den Armen die verlockende Gestalt – dann ein Blick aus dunklen Augen, ein Flüstern an seinem Herzen, und der Mann stieß die Grafentochter von sich, deren heiße Sinne nichts von edler deutscher Minne wußten.
Schwerem Kampf folgte schwerer Sieg. Er schüttelte den Staub von den Füßen, verließ die segens- und fluchwerte Stadt und zog gen Norden. Und das Leben flutete über ihn hinweg und riß ihn in seine Strudel. Manch tiefe Wunde schlug es dem stolzen Manne, bis er nichts mehr von ihm begehrte. Der Welt entfremdet, klomm er die Felsenstiege empor und fand in der stillen Sakristei des heiligen Bonifatius den Frieden, den er suchte. Das rauhe, hartgewöhnte Volk aber, dem er mit seiner großen, warmen Liebe diente, lohnte ihm Entsagung und Mühen mit treuer Dankbarkeit.
Und die Jahre gingen dahin. Was hinter ihm lag, trat in weite Fernen zurück, der Pfarrer Johannes, der von einem Tag zum andern mit seinen Bergbewohnern um das tägliche Brot kämpfte, hielt den Blick in die Zukunft gerichtet. Und die Zukunft war kein lachender Lenz mit blühenden Bäumen und Vogelgesang, sie war der harte kommende Tag mit seinen Sorgen und Nöten – aber über jedem jungen Tage stand der Name Gottes. So waren Glanz und Reichtum vergangener Tage bald vergessen und dünkten ihn nichtig wie ein Schemen, denn die Zeit barg für den streitbaren Mann Ewigkeitswert. Bisweilen war's wohl geschehen, daß ein holdes Antlitz in die stille Felsenklause zu dem Beter hereinblickte, doch scheu wich die Versuchung vor dem Bilde des Gekreuzigten zurück, und der Zauber zerrann. Aber in den langen Winternächten, wenn die greise Pfarrmagd die Spindel regte, hörte sie zu Zeiten in der Kammer ein Seufzen: Luitgard! Luitgard!
Und Lenz und Winter kamen und gingen. Das bange Rätsel im Herzen des jungen Pfarrers löste sich: die Liebe zu dem schönen, sündigen Weibe erlosch. An der Tür lauschte die greise Barbara in der Geisterstunde, doch sie vernahm nichts als die ruhigen Atemzüge des Schlafenden.
»Seltsam,« dachte die Alte, und der holde Frauenname, den sie zum erstenmal in dem armen Bergdorf vernommen, klang ihr im Ohr – »er wird mit einem Englein geredet haben, es war in den heiligen Nächten!«
Aber der Pfarrer dankte seinem Gott auf den Knien, daß er dieses Engleins ledig geworden, und beugte sich in Buß' und Reu' vor dem Kreuz. – –
Jahre starken, freien Schaffens kamen, und der Saat folgte die Ernte. Pfarrer und Gemeinde hielten treu zusammen in guten und bösen Tagen. So war's bis heut gewesen – und dann lag die jahrelange Arbeit in Scherben zu seinen Füßen.
An Gott und Menschen und seiner heiligen Aufgabe irre geworden, war der Pfarrer hinaufgewandert in das große Schweigen der Berge. Doch statt des Friedens war ihm der Kampf geworden, die Versuchung trat an den Einsamen heran und wies auf seinen verlassenen Posten, auf seine Flucht vor Gott und Menschen. Aber sie hatte einen Fehlgang getan. Anstatt ihn in Verzweiflung zu treiben, zeigte sie ihm seine Pflicht. Die Erscheinung der verlockenden Frauengestalt rief den Pfarrer in den Kampf seines Lebens, dem er entrinnen wollte, zurück. Die Sünde, die dem Manne im weißen Haar in der hehren Stille der Hochwaldeinsamkeit entgegentrat, schärfte ihm ungewollt den Blick für eigene Schuld und Versäumnis. Er stand still, seine Hände umklammerten das Kreuz, hoch empor hob er das heilige Zeichen, so hoch die zitternden Arme es vermochten: »Gelobt sei Jesus Christ!« Der Spuk verschwand. Über die Felskuppen wehte der Mittagszauber und zerrann.
Aus der Enge der Bergstraße trat er hinaus, wo das weite Steinfeld sich breitete. Aber wie gebannt blieb er an der altbekannten Stätte stehen. Vor ihm lag es klar und leuchtend, das ersehnte Gottesgeschenk für ein verschmachtendes, verzweifeltes Volk: Wasser. Starren Auges blickte er auf das Wunder, den stillen schimmernden Bergsee, der wie ein Edelgestein in den rauhen Fels gebettet lag. Im Harz vorkommende Naturerscheinung. Die Tränen stürzten ihm über die Wangen, er verbarg das weiße Haupt im Gewande.
Da zog's über die jungfräuliche Flut, weihevoll wie Orgelklang, ein Säuseln sanft und leis' wie der Odem eines Kindes: »Was hast du hier zu tun, Elias?«
Er sank in die Knie, die hohe Gestalt von Schluchzen erschüttert. Das eigene Ich zerbrochen, das feste mühevoll erbaute Werk in Scherben – alles Ruhms entkleidet, aller eigenen Ehr' beraubt, so lag er vor Gott: »Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch!«
Nicht den Eifer um den Herrn ließ der sichtende Geist, der mit unbarmherziger Schärfe sein Selbstgericht hielt, der ringenden Seele, nicht die jahrelange Treue, nicht Mühen noch Entsagung – nur das Kreuz, das roh gefügt unter dem Felsentor hing, das war sein, und der Mann, der in heiliger Liebe vom Marterholz niederblickte, der gehörte ihm auch in dieser tiefsten Not zu eigen.
Er hatte sein heilig Amt von sich geworfen wie ein Gewand – mit blutenden Lettern stand's in seiner Seele. Da gab's kein Bemänteln, kein Entschuldigen, keine Rechtfertigung – flüchtig war er geworden, und von Eitelkeit verblendet hatte ihm ein in Sünden lebendes Weib die Augen öffnen müssen. Einen weiten Weg war er in Dunkel und Selbstverherrlichung gewandert, sein Haar war weiß geworden, bald grub man sein Grab – in seiner Brust aber hämmerte es: dein Leben ist umsonst gelebt!
Sein Auge suchte das Antlitz des Gekreuzigten. Alles rang und stritt in ihm, doch je länger er emporblickte, um so stiller ward's in seiner Seele: »Und wenn alles umsonst ist, was ich geschafft, so laß doch dein Blut nicht umsonst vergossen sein!« kam es flehend von seinen Lippen.
Was er umklammerte, das war seiner Zeit ein toter Schatz, aber der Mann, der die Schrift kannte, wagte den Sprung und rettete sich auf den Felsen der Gottesgnade. Die Verheißung von der blutroten Sünde, die schneeweiß werden soll, fand ihre selige Erfüllung. Eine Stunde mochte vergangen sein, da richtete sich der Pfarrer Johannes auf und trat fest auf seine Füße. Er war ein anderer geworden. Die alte Kraft und Frische war zurückgekehrt, rüstig wie ein Mann in des Lebens Sommer stand der Greis unter der Marter Gottes und blickte leuchtenden Auges auf das sonnenbeglänzte, kristallhell flutende Wasser.
Wie ein Märlein lag der stille, smaragdgrüne Bergsee mitten in der Steinwelt, kein Laut zog herüber und hinüber, nur oben in schwindelnder Höhe rauschten die Tannen auf den Felskuppen ihr ewiges Lied, und der Sommerwind regte leise die Wasser. Vor wenig Monden noch hatte er von dieser Stelle aus über die öden versteinerten Strecken geblickt, heut' fand er inmitten der wüsten Einöde die liebliche Oase mit ihrer Wasserfülle. Und ein Kleines war's, das glänzende Naß hinabzuleiten in das verschmachtende Dorf und allem Jammer ein Ende zu machen! Er stand und schaute – die Augen gingen ihm über, in seiner Seele jauchzte es: Herr, wie sind deine Werke so groß!
Ein Windhauch umspielte das weiße Gelock des anbetenden Greises. Er hob das Haupt und blickte zur Sonne. Der Tag ging zur Rüste. Heute noch mußte er in die arme Heimat zurück, in seinem Herzen stand groß und heilig der Gnadenbefehl: »Steige hinab!«
Mit einem letzten hellen Blick auf den See wollte er den Heimweg antreten, als eine Hand sich auf seinen Arm legte und ein junges, von mühevollem Anstieg erglühtes Weibesantlitz zu ihm aufblickte: »Herr Pfarr', Gott sei Lob und Dank!« und das Mägdlein umklammerte laut aufschluchzend die Knie des alten Mannes.
»Resel!«
Er hob sie empor.
»Resel, jetzt brauchen wir nimmer zu verdursten. Sieh, jetzt ist's auch bei uns wahr worden: Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle! Nun wollen wir nie wieder zagen und verzweifeln, wir alle miteinander!«
Sie hob die blauen Augen zu dem lieben ehrwürdigen Antlitz empor. Es war alles vergeben und vergessen, was ihr undankbares Volk dem frommen Greise angetan, nur der Sünde wider einen Höheren gedachte er und stellte sich demütig an die Spitze der Schuldigen: »Wir alle miteinander!« Im Geiste sah sie ihn mit seiner armen Gemeinde in der Steinkirche im Beichtgebet auf den Knien liegen; die Augen wurden der Jungfrau naß, die Heimat- und Vaterliebe an diesem Herzen gefunden.
Und dann blickte auch sie auf die glänzenden Wasser und konnte das Wunder nicht fassen. Die Hände über der klopfenden Brust gefaltet, schritt sie hart an den Rand des felsigen Ufers.
»Und hier waren Stein', Herr Pfarr', nichts als Stein'! Haben die Englein einen Bronnen gegraben im Geklüft?«
»Was geschehen ist, weiß ich nicht, Kind, nur das weiß ich, daß es einen gibt, der das Schreien der Elenden erhört!« erwiderte feierlich der Greis.
Die Felsen leuchteten im roten Glanz der Abendsonne, als die Steinkirche und das tiefer liegende Dorf vor den Blicken der Heimkehrenden auftauchte.
Die Hand über die Augen gebreitet, stand der Pfarrer still. In seiner Seele arbeitete es. Das Vergangene erwachte und klopfte aufbegehrend an seine Tür.
Da schwebte ein lieber, bekannter Laut durch die Stille der Bergwelt, der Meßner läutete das Glöcklein zum Ave Maria.
Still knieten die zwei im Heidekraut, die jungfräuliche Gottesmutter anbetend. Unten im Dorf scharten sich Männer und Frauen um den Bildstock und neigten die Häupter andächtig über den Rosenkranz. Es war ein Bild tiefer Frömmigkeit und unentwegten Friedens, ohne den Prunk und die Unrast der Städte, das Gebet eines Volkes zu der Mutter des Erlösers. Nur wer nahe hinzutrat, gewahrte die Leidenschaft in den abgezehrten Gesichtern, und vernahm das heiße, ungestüme Flehen zu der Benedeieten um einen gnadenreichen Regen.
Dann ward es still im Dorf, das Ave verklang, an dem ausgetrockneten Brunnen unter der welken Dorflinde zogen die Frauen vorüber, ihren freudlosen Heimstätten zu. Über den Tälern ging der Mond auf, klar und voll in strahlender Schönheit wie an jedem Abend, und die Sterne zogen glitzernd ihre Bahn.
Und dann kam der Augenblick, an den das verschmachtete Volk zurückdachte, jahrzehntelang, der ihm die qualvollen verflossenen Stunden in einen lichten Feiertag wandelte.
Durch die mondhelle Dorfstraße tönte eine hallende Frauenstimme: »Wasser! Wasser!«
Wie eine Botschaft vom Himmel klang der Ruf, der so oft Weh und Todesangst in die Hütten getragen, wenn die Bergbäche das steinerne Bett verließen und ihre Hochflut in die ahnungslosen Täler ergossen.
»Wasser! Wasser!« Jubelnd und jauchzend schallte es von Tür zu Tür, von Hütte zu Hütte.
Mitten unter dem zitternden, fragenden Volk stand der Pfarrer Johannes. Aller Augen hingen an seinen Lippen, als predigten sie das Evangelium, und manche harte Faust, die sich vor wenigen Stunden im Trotz geballt, faßte reumütig die Hand des greisen Seelsorgers und zog sie ehrfürchtig an die Lippen.
Liebreich vergebend ruhte die Rechte des Pfarrers auf dem Haupte des Bittenden, während die Linke den mondhellen Bergpfad emporwies, in das große Schweigen, wo der Bildstock ein heiliges Antlitz in den stillen Wassern des Bergsees spiegelte.
Er hatte einen Schatz gefunden droben in der Einsamkeit; nun stand er und teilte mit vollen Händen aus. Und je mehr er austeilte, um so mehr wurden der Kleinodien. –
*
Mitternacht war vorüber. Ein Lichtlein nach dem andern verglomm in den Kammern, und die Dorfstraße lag träumend im Sternenschimmer. Nur im Pfarrhause brannte noch die tönerne Lampe.
Hinter den efeuumsponnenen Fenstern flackerte sie wie ein Irrlicht, und die zitternden Ranken des Hauslaubs warfen ihr tanzendes Schattenbild auf die getünchten Wände. Mitten im Gemach stand der Pfarrer Johannes; vor ihm auf dem Boden lag ein Mann und verbarg laut schluchzend das Antlitz in den Falten des priesterlichen Gewandes. Der verlorene Sohn war heimgekommen, zitternd und zagend, und konnt' es nicht fassen, daß der greise Hirte der Gemeinde dem Reuigen mit weit geöffneten Armen entgegenkam. In Schlucht und Klamm war er umhergeirrt und endlich spät abends ohne die Vermißten heimgekehrt. Da warf ihn die Jubelbotschaft im Dorf fast zu Boden: sie sind da – und der Wassermangel hat ein Ende! Und dann trieb's ihn zu den Füßen des Greises, den er verlästert, die Vergebung zu erflehen. Sie ward ihm nicht versagt. – –
In der Fensternische stand ein Mägdlein. Auf dem jungen Antlitz wechselte Blässe des Todes mit Purpurglut, und die dunklen Augen hafteten am Boden.
Der Bursch hatte sich von den Knien erhoben und blickte von dem Pfarrer auf die Liebste und von der Liebsten auf den Pfarrer.
Endlich trat er auf das Mädchen zu. »Resel,« bat er weich, »mein Lieb ist eine andre worden – du hast's ja g'hört!« Er stockte.
Unbeweglich stand sie vor ihm, das Köpfchen gesenkt.
»Wenn du noch meinst, auf so einer Lieb ruh' kein Gottessegen,« sagte er traurig, »so muß ich gehen!« Er wollte sich abwenden, da legte sie sanft die Hand auf seinen Arm und hob die tränenschweren Augen zu ihm auf.
»Ich mein's nimmer!« flüsterte sie mit erstickter Stimme. »Aber, gelt, Vollrath, jetzt hältst die neue Lieb' fest und läßt sie nimmer los, damit der Gottessegen bei uns bleib' alle Tag'!«
Es hielt ihn nicht länger. Er zog die blühende Gestalt an die Brust und preßte die durstigen Lippen auf den roten Mund.
Und die Resel ließ sich strahlenden Auges herzen und küssen – sie wußten es: jetzt kam das Glück! – – – – –
Am anderen Morgen in aller Herrgottsfrühe wanderte das ganze Dorf unter der Führung des Pfarrers Johannes hinauf ins Gebirge, um den wunderbaren See mit eigenen Augen zu schauen.
In stiller Andacht standen Männer und Frauen vor der leuchtenden Gottesgabe, die ihnen so unverdient in den Schoß gefallen war, und die rauhen Hände falteten sich und manch heiße Träne rann.
Und dann begann ein Schaffen und Regen, als gält' es die Rodung Deutschlands. Die ältesten Greise legten mit Hand an, die Kinder halfen ihren Eltern bei der Arbeit, keiner stand müßig – allen voran der Pfarrer Johannes. Und nicht lange währte es, da rann es in leichtem Gefäll silberhell in die Täler hinab und unter der durstenden Dorflinde klang ein Plätschern und Rauschen, das man seit Wochen und Monden nicht mehr vernommen. Das Wasser des Bergsees war hinabgeleitet worden, der Mangel hatte ein Ende.
Aber der Pfarrer mahnte zur Sparsamkeit; der Sommer sei lang, und allzulange werde der Vorrat nicht reichen, wenn nicht der ersehnte Regen eintrete. Wenige Tage nach der Entdeckung des kostbaren Fundes war der Greis hinaufgewandert, um den Wasserstand zu erkunden. Bei dem starken Verbrauch im Dorf mußte schon eine, wenn auch nur geringe Abnahme ersichtlich sein. Aber er täuschte sich. Der Wasserstand war unverändert und erleichterten Herzens schritt er talwärts. Der Gemeinde gegenüber schwieg er von seiner Entdeckung und mahnte nach wie vor, das edle Gut nicht zu vergeuden, denn noch wär' nicht aller Tage Abend.
Eine Woche war vergangen seit jenem schlimmen Sonntag, da er Amt und Heimstätte verlassen. Sengend wie an jenem Morgen ging die Sonne über der Steinkirche auf und die trockne heiße Luft flirrte über dem Sandweg, den der Greis emporklomm. Aber die Gesichter, denen er begegnete, waren verwandelt. Frohsinn und Frieden leuchteten aus den Augen und ein helles: »Grüß Gott, Herr Pfarr',« klang ihm von allen Seiten entgegen.
Ein mildes Lächeln umspielte die Lippen des alten Mannes, als er sein verlassenes Heiligtum betrat. – In seiner Seele war lichte Sonntagsfreude: nicht nur dem murrenden Volk war Vergebung geworden, auch er, der den Hirtenstab in Unmut und Verzagtheit von sich geworfen, war in Gnaden wieder angenommen worden. Nun wollte er nimmer nach Ruh und Stille trachten, sie würden von selber sein Teil werden, sobald Gottes Stunde schlug, für ihn galt nur eins: Treue halten. Und die bleierne Müdigkeit, die seit den dürren Wochen auf ihm lastete, abschüttelnd, trat er leise in die Sakristei. Die Bibel auf den Knien saß er auf dem Bänklein am steinernen Tisch und der Sommerwind stahl sich herein und schlug die pergamentenen Blätter um. Im ersten Buche der Könige beim achtzehnten Kapitel lag ein dürres Zweiglein Waldefeu; der Greis legte den Finger darauf und las. Die gewaltige Geschichte des Gottesurteils auf dem Karmel zog an seiner Seele vorüber, er sah den Propheten von seiner furchtbaren Arbeit aufstehen und hinaufsteigen auf des Berges Spitze in die große Stille. Auf den Knien sah er ihn liegen, das Antlitz im Staube, den Winden lauschend, denn »es rauschte, als wollte es regnen.«
Der Pfarrer Johannes faltete die Hände um das heilige Buch. Dies Wort, das wie eine Verheißung den kommenden Geschlechtern gegeben ward, wollte er heut' der Gemeinde zurufen, deren Äcker und Felder noch immer des Segens von oben harrten. Er wußte es, kam der Regen nicht bald, so war die Ernte des armen Volkes zerstört. Das Leben war ihnen durch die wunderbare Gabe gefristet worden, vor dem Verschmachten bewahrte sie der grüne Bergsee, doch Not und Armut mußten kommen, wenn sich nicht in Bälde der Himmel auftat. Aber er fürchtete nimmer, daß sein Wort wie ein leerer Schall zu ihm zurückkehre. Er wußte es, der reiche Herr vergaß die Seinen nicht. Droben in der großen Stille, wo der Mensch schweigen lernt, und das Höchste redet, hatte er's erfahren.
Dort oben unter dem Kreuz lag seines Lebens Last und Sünde, seine Schwachheit und sein Zweifel, und leichten Herzens war er herabgekommen, in der Seele den Heldenmut eines Gotteskindes. Nun mochte geschehen, was da wollte, die Verheißungen des Herrn fanden dennoch ihre Erfüllung.
Er merkte es nicht, daß sich drinnen im Schiff die Gemeinde sammelte. Sein Geist schweifte in weite Fernen. Mit dem heiligen Buch wanderte er hinauf in des Hochwalds Einsamkeit, wo der Ewige wohnte. Sein eigen heilig Wort wollte er ihm entgegenhalten, wollte ihn der Verheißung gemahnen, die er seinem Volke zugesagt. Und dann wollte er warten, wie Elias in der Karmelsstille gewartet hatte, bis er das Rauschen vernahm, das stille, sanfte Sausen.
Eine halbe, eine Stunde verrann. Drinnen in den Kirchenstühlen ging ein Flüstern um, fragend schaute einer zum andern. Die Sonne hatte sich hinter den Wolken verborgen, tiefe Dämmerung lagerte im Gotteshause, nur das Licht der ewigen Lampe warf seinen Purpurglanz auf den Kruzifixus und das schneeige Linnen der Altardecke.
Da klang ein leiser, linder Laut von draußen herein, als fielen einzelne Tropfen auf Busch und Baum, als klopfte es sacht auf die Fenster und ein Engel träte mit einem himmlischen Gnadengeschenk in das Heiligtum. Immer eindringlicher ward das Pochen, ein Rauschen und Plätschern ging über die Steine, ein wundersames Säuseln und Singen, als verkünde der Gottesbote der Welt ein heilig' Geheimnis – sonst kein Laut – draußen lag ein verschmachtetes Land und hielt nach langem Warten zitternd vor Wonne dem ersten linden Morgenregen still. Holde Lüfte wehten kühl zum Kirchlein herein, wo die Gemeinde regungslos mit gefalteten Händen auf den Knien lag. Jetzt stand's in ihren Herzen fest und gewiß, was der treue Seelsorger sie gelehrt, jahraus, jahrein: Der Herr verlässet die Seinen nicht! und andächtig lauschten sie dem Plätschern und Rauschen und sahen im Geiste, wie sich in ihren armen verdursteten Gärtlein Blatt und Blüte aufrichteten und gesund tranken.
Sie hatten über dem langersehnten Regen fast ihres Pfarrers vergessen. Plötzlich fiel's ihnen wieder ein, wie lange sie schon in den Kirchenstühlen gesessen, und die beiden Dorfältesten standen auf und traten leise in die Sakristei.
Da saß der Pfarrer Johannes unter dem Kreuz, das weiße Haupt zurückgelehnt, auf den Knien die aufgeschlagene Bibel, den Finger auf das achtzehnte Kapitel im ersten Buche der Könige gelegt. So saß er regungslos, ein verklärtes Lächeln auf dem lieben, ehrwürdigen Antlitz, als lausche er dem plätschernden Regen wie einer himmlischen Melodie.
In wortloser Frage standen die beiden Männer auf der Schwelle. Einer las im Auge des anderen die Antwort.
Tief erschüttert kehrten sie zu der harrenden Gemeinde zurück und teilten ihr mit, daß ihr geliebter Seelsorger abgerufen worden sei.
Totenstill war's in dem engen Raum. Dann zitterte heißes Schluchzen durch das Kirchenschiff und mischte sich in das Rauschen der fallenden Tropfen. Leise, leise wanderte der lange Zug in die stille Kammer, wo der Mann, der ihnen alles geopfert, den letzten langen Schlaf schlief.
Mit weitgeöffneten Augen und gefalteten Händen standen sie da und blickten auf das verklärte Greisenantlitz mit seinem Gottesfrieden, und manch einer schüttelte das Haupt und wollte es nicht glauben, daß der Tod die treuen Augen geschlossen. Ein junges Weib kniete bitterlich weinend zu den Füßen des Toten; es war Resel, der ein Stück ihres Herzens mit dem greisen väterlichen Freunde dahinging.
*
Die Gemeinde hatte bis auf einige Männer die Sakristei verlassen. Vollraths Mutter nahm die Braut mit heim; er selbst blieb in der Sakristei zurück. Und dann gingen auch die letzten, er war mit dem Toten allein. Als schliefe er einen langen Schlaf, saß der Pfarrer Johannes im Schatten des Kreuzes, auf den Knien das Buch der Bücher, ein Bild des Friedens. Ein Hauch der Ewigkeit durchwehte den engen Raum, und der Hüter der heiligen Schwelle regte sich nicht, als scheue er sich, die Majestät des Todes zu stören. Leise trat er ins Freie hinaus und hielt vor der Felsenkammer auf und nieder schreitend die letzte Wacht.
Der Abend brach herein. Kein Laut ging durch die Kirchenstille. Nur der Schritt des draußen auf und nieder Gehenden klang gedämpft herüber. Bisweilen stand er wohl still und lauschte, aber er ging nicht hinein. Er wußte es, drinnen in dem heiligen Kämmerlein waltete der Eine, der den Müden Kraft gibt und die Elenden vom Tode errettet; dem treuen Knecht hatte er die Arbeit aus der Hand genommen und ihn zur Ruhe gebracht und die stille Sakristei geschlossen, daß niemand den Schlummer des Greises störe. Der Mund, der allezeit nur von seinem Herrn gezeugt, hatte ausgeredet, und der Meister sein Amen dazu gesprochen.
Wie ein letzter Gruß klang das Ave Maria aus dem Dorfe durch die regenfeuchte Luft herauf. Wolkenverhangen war der Himmel, aber hie und da brach goldener Abendsonnenglanz hindurch, als stünd droben in Zion ein Fenster offen, und ein Strahl der Herrlichkeit fiele leuchtend auf die arme Erde. In starrem Schweigen lagen Schlucht und Klamm, und der Abend breitete seine violetten Lichter über die graue, einsame Bergstraße, wo der Pfarrer Johannes unter dem Kreuz um Sieg und Frieden gerungen.
Um die Felskuppen zog ein lindes Säuseln, als summte der Nachtwind dem himmlischen Kinde das Wiegenlied. Leise, leise klopfte es auf Busch und Baum, und im Waldefeu klang es wie Tropfenfall – es rauschte, als wollte es regnen.
