
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
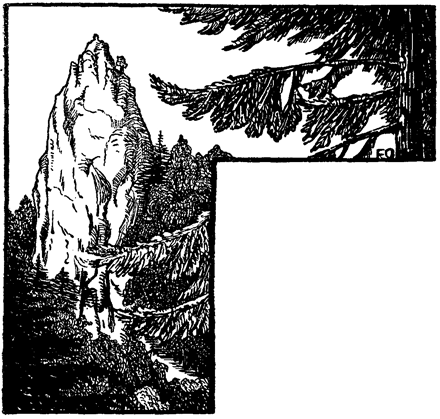
Eine Bergsage.
Feierabend war es. Vor den Türen saßen die Alten mit Pfeifchen und Kunkel Spinnrocken., spielende Kinder jagten um die alte Linde, Burschen und Mädchen standen lachend und plaudernd am Brunnen, und nur selten schwankte der morsche Eimer in die schwarze geheimnisvolle Tiefe hinab.
Es war ein Spätsommerabend ohnegleichen, wohl der letzte in diesem Jahre; daher war auch das ganze Städtlein Grund im Freien versammelt wie eine einzige, große Familie und genoß die scheidende Sommerherrlichkeit in vollen Zügen. Vom rosigen Hauch der untergegangenen Sonne überstrahlt, schauten die grünen Harzberge in die Straßen hinab, der altehrwürdige Iberg, der wie ein Korallenriff in die dämmernden Lüfte ragte, der Hübichstein, jene sagenhafte Heimstätte des Zwergenkönigs, der tief im Schachte seine Schätze hütete und bisweilen draußen in der Welt erschien, um Not und Armut zu lindern, und manch andere stolze Stätte noch, manch ragender Hügel blickte übermütig auf das »im Grunde« liegende Harzstädtlein nieder, das mit seinen bunt gemalten Fachwerkbauten ausschaute, als sei es eben aus der hölzernen Spielschachtel genommen und aufgebaut worden. Oben auf dem Hübichstein saß die Sage, ihr langes, goldenes Haar flatterte im Winde, und ihre weiße Hand wob einen duftigen Schleier, den breitete sie über das Städtlein »im Grund«, der Vollmond ging über den Bergen auf und überflutete das stille Tal mit seinem Silberglanz, tausend Sterne funkelten darüber – »wie eine Märchenstadt!« flüsterte die Bergfee, und niemand hätte die Frechheit gehabt, ihr anzudeuten, daß das Städtlein ein hölzernes Spielzeug sei.
Unten im Tal riefen die Glocken, feierlich klangen die ehernen Stimmen, den Sonntag einläutend, über die stille Stadt. Die Männer nahmen die Pelzkappen ab, die Frauen ließen die Kunkel rasten und falteten die Hände auf den Knien, manches Flachsköpfchen schmiegte sich stumm an die Mutter und folgte, die kleinen Finger ineinander legend, ihrem Beispiel. Ein Bübchen aber, das vor allen anderen ein loses Mundwerk hatte, brachte ganz laut sein Anliegen vor: »Lieber Herrgott, schieß doch dem Hübich die Falken tot!«
Erschrocken blickte die Försterfrau vom Gebet auf, mit ihrer Andacht war es aus. Sie schwieg noch, solange die übrigen beteten, aber ihre Rechte hielt das Händchen des Kleinen fest umfaßt.
»Dem Hübich die Falken?« fragte sie dann, »Bub, was redest du da Gottloses! Bist wohl nicht klug! Daß du dich nicht noch einmal unterstehst, dergleichen zu reden,« schalt sie weiter und begann ihrem Nachkömmling halblaut auseinanderzusetzen, daß der Hübich besser sei als alle Leute in Grund und in der Umgegend, und daß die Edelfalken nur die Hüter seiner Schätze wären.
Aber das Nesthäkchen riß sich los. »Der Jürgen sagt es doch auch!« rief es unwirsch und rannte in lustigen Sprüngen davon.
Die Frau seufzte. Daß der Jürgen den Herrgott nicht bat, König Hübichs Falken zu erschießen, das stand so fest bei ihr wie die Gewißheit, daß das Zwergenvolk im Hübichsteine sein Wesen trieb – der Jürgen betete überhaupt nicht, das war der Kummer der treuen Mutter. Aber durch die Rede des kleinen Wolfgang war ihr zur Gewißheit geworden, was sie lange geahnt und gefürchtet hatte, daß ihr ältester Sohn den Falken des Zwerges nachstellte, die so manchen jungen Hasen, so manches Rehkälbchen vom Felde raubten – und des Hübichs Feind sein, bedeutete nichts Gutes, das wußte Frau Margarete. Der Gnomenkönig war eines der guten Geisterlein, die der Menschheit Wohltäter sind; darum ließen auch alle Jäger die Vögel, von denen man sich erzählte, der Wicht habe sie als Wächter auf die Zinnen seiner Felsenburg gesetzt, unbehelligt, warum konnte sich nicht auch der Jürgen bescheiden? Sie seufzte. »Es wird noch einmal ein böses Ende nehmen, so ohne Gott und ohne Scheu vor irgend welcher Gewalt!«
Sie erhob sich und setzte den Rocken beiseits.
»Nun, was gibt es?« fragte Wolff Hubert, ihr Mann.
»Ich will noch einmal zu Anne-Marie gehen,« klang die Antwort, »ich habe etwas mit ihr zu reden,« und fort war sie.
Die blauen Wolken seiner Tabakpfeife in die Luft blasend, blickte er der stattlichen Gestalt seines Weibes nach, das einst das schönste Mädchen in Grund gewesen war und noch heute zu den hübschesten Frauen zählte; dann paffte er behaglich weiter.
Am Brunnen unter der Linde bei den Mädchen und Burschen war die Anne-Marie nicht, keiner hatte sie gesehen, und so wanderte Frau Margarete weiter, dem Hause des Dorfschullehrers zu, dessen liebliche Älteste seit einem Jahre die Braut ihres Sohnes war.
Sie hatte viel von dem Einflusse des stillen, frommen Kindes auf ihren Jürgen gehofft, aber noch konnte sie nichts davon bemerken, und oft kam ihr der Gedanke, ob die kleine Anne-Marie es wohl wisse, wes Geistes Kind ihr Herzallerliebster war.
Sie war am Ziele. Durch das volle Laub der Fliederbüsche fiel ein Lichtstreifen aus den weinumrankten Fenstern des kleinen Hauses. Sie sah Anne-Mariens Mutter sitzen, das schmale, ernste Antlitz über die Arbeit geneigt. Frau Margarete schritt langsam weiter; nun stand sie an der Gartenpforte. Eben wollte sie dieselbe öffnen, da klangen Stimmen durch die stille Abendluft zu ihr herüber – immer näher kamen sie, und jetzt vernahm sie dieselben dicht neben sich in der Fliederlaube, wie angewurzelt stand sie und lauschte.
»Und ich sage dir, ich erklettere den Horst, und am Sonntagmorgen ist es am besten, da stört mich keiner!«
Die Männerstimme – Frau Margarete war sie nur zu bekannt – schwieg; es war, als erwarte der Sonntagsjäger eine Antwort.
Aber alles blieb still, die Försterin drängte sich dicht an den Zaun und spähte durch die Büsche. Da sah sie die Anne-Marie sitzen, blaß wie eine weiße Rose, das goldene Haar in zwei dicken Flechten um den hübschen Kopf gewunden. Sie hatte die Rechte auf die Bank gestützt, das Haupt neigte sie tief auf die schwer atmende Brust. »Jürgen,« flüsterte sie endlich, »Jürgen, bleib, ich bitte dich, bleib! Und wenn du nicht mit mir zur Kirche willst, so tu' mir nur das eine zu liebe und steig nicht auf den Horst – morgen nicht – es ist Feiertag!«
»Feiertag!« spottete er, »wie oft hab' ich das schon hören müssen! Was geht mich der Sonntag an – draußen im Walde feiert's sich besser als in schwüler Kirchenluft! – Und jagen soll ich nicht? Anne-Marie, was fällt dir ein! – Bei der heutigen Gelegenheit muß ich's dir doch sagen, daß ich nicht allsonntäglich mit dir zur Kirche gehen kann, vielleicht 'mal um Ostern, wenn die Leute beichten, oder zur Christmette – aber – laß mich's kurz machen – ich halt' nichts davon! Und nun plag' mich nicht länger, Schatzerl, sonst mein' ich am Ende, ich hätt' um eine Betschwester gefreit! Früh morgen erjag' ich Hübichs Falken, und damit Punktum – komm, und gib mir einen Kuß und schlag ein: ›Auf die Königsfalken!‹«
Er umfaßte das Mädchen und wollte es an die Brust ziehen, aber es wich zurück und sagte, die Hände abwehrend ausgestreckt: »Nein – so nicht!«
Er faßte ihren Arm. »Anne-Marie, was fehlt dir? Bist du von Sinnen?«
Da fuhr sie auf, das sonst so sanfte Kind war zum Weibe erstarkt. Hoch aufgerichtet stand sie vor ihm, den weißen Arm erhoben.
»Nicht so!« sprach sie, und ihre Stimme klang ernst und gebietend, »rühr' mich nicht an! Erst sprich: Ist's dein Ernst, was du geredet hast, oder gab dir der Zorn deine Worte ein? Erst sag' mir's, ob du wahrhaftig Gottes Wort und Sakrament verachtest, ob dir sein Feiertag Werkeltag ist, ob du dem Heiland am Kreuze den Rücken wendest! Man hat mir's gesagt, etliche Monde nachdem wir Verspruch gehalten haben, und ich hab's nicht geglaubt, ich hab' dich nicht fragen mögen, weil ich gemeint hab', es müsse dich in tiefster Seele verwunden, so ich nicht an dich glaubte – und Jürgen, bei Gott, ich hab's nicht geglaubt, bis du da heut' vor mich hingetreten bist und hast gesagt: ›Ich halt' nichts davon!‹ Sag mir's beim allmächtigen Gott – ist das wahr?«
Der Mond war aufgegangen, sein silbernes Licht umfloß die blühende Gestalt der Jungfrau, wie flüssiges Gold schimmerten die schweren Zöpfe, das lockige Gekräusel lag wie ein Heiligenschein um das blonde Haupt. Sie hatte die Hände über der jungen Brust gefaltet. »Jürg,« sagte sie stockend, die aufquellenden Tränen zurückdrängend, »ist das wahr?«
Mit verzehrender Sehnsucht weilten seine Augen auf ihr. Sie war ihm nie schöner und begehrenswerter erschienen als in diesem Augenblicke, wo ihm ihr ganzes Sein entgegenglühte, wo ihm die tiefsten Tiefen dieses keuschen Herzens sichtbar wurden. Und eine Ahnung stieg in ihm auf, schwer, unüberwindlich – es durfte nicht sein – und doch – lügen wollte er nicht. »Ja, es ist wahr,« sprach er finster.
Eine Sekunde lang stand sie regungslos da, dann trat sie auf ihn zu: »Jürg, kehr' um!«
Es lag so viel Liebe und Herzleid zugleich in den wenigen Worten, daß er weich wurde.
»Sieh, Jürg,« fuhr sie fort und legte die Hand, die seinen Brautring trug, auf seinen Arm, »es ist nichts Sonderliches, das ich von dir will. Du sollst nur an Gott glauben und morgens und abends mit mir die Hände falten, wie's ein rechter Hausvater tut; sonst liegt ja kein Segen auf unserm Tun. Und wenn es nicht an jedem Sonntag sein kann, daß du zur Kirche kommst, so laß es doch nicht eine Ausnahme sein, daß du hingehst – und vor allem, laß am Festtag das Jagen – ich bitte dich, Jürg!«
Er sah sie mit heißem Blick an, das Bewußtsein ihrer Liebe machte ihn siegesgewiß.
»Und wenn ich es nicht tue, was dann?«
Er hatte sie umfaßt, sein Atem streifte ihre Stirn.
»Dann ist es aus mit uns,« sprach sie mit leiser Stimme.
Er ließ sie los. Einen Augenblick standen sie einander gegenüber, er trotzig und finster, sie klar und bleich wie ein Heiligenbild.
»Ist das dein letztes Wort?« stieß er endlich hervor.
»Wenn es dein letztes ist, daß du von deinem Gott nichts wissen willst, so ist es mein letztes, daß ich geh'!« sprach sie tonlos.
Da stürzte er auf sie zu und umklammerte ihren Leib. »Anne-Marie,« ächzte er.
Ein kurzes Flüstern, ein Bitten und Flehen von roten Lippen, dann war es still – der Schritt des Mannes verklang auf den Kieswegen zwischen den Blumenbeeten.
Auf der Bank unter dem Flieder saß eine gebeugte Gestalt und schluchzte zum Herzbrechen. Frau Margarete stand zögernd, zitternd am Pförtlein; es war ihr ums Herz, als müsse sie das Mädchen in die Arme schließen und ihm die Tränen von den Augen wischen, aber sie tat es nicht, sie wußte, das war ein Kampf, den der Mensch allein kämpfen muß.
Und ihn, den Sohn, warnen? Ein letztes Mal die Macht der Mutterliebe aufbieten? Noch einmal verhielt sie den Schritt, doch nein – sie kannte den zähen, unbeugsamen Trotz, den Eigensinn, der schon dem kleinen Büblein böse Stunden und die Bekanntschaft der Rute eingebracht – und am Ende mußte sie es am besten wissen, ob etwas auszurichten war.
Seufzend kehrte sie um und schritt die stille, mondbeschienene Dorfstraße entlang, dem von grünen Bäumen umschatteten Forsthause zu. Ihr Mann saß noch vor der Tür, das Büblein mit dem rührigen Mundwerk auf den Knien.
»Nun,« fragte er langsam die Kommende, »was hast du ausgerichtet?«
Er sah alt aus, meinte sie plötzlich, viel älter, als er war; es ward der stattlichen, vierzigjährigen Frau, die mit sechzehn Sommern den zwanzig Jahre älteren Mann gefreit hatte, in diesem Augenblicke klar, daß sein längst ergrautes Haar stark ins Weiße spielte, oder war es der Mondschein, der seine silbernen Lichter über alles, was lebte und webte, breitete?
Sie trat dicht an ihn heran. »Nichts,« sprach sie leise.
Er sah sein Weib forschend an, ließ den Buben zur Erde gleiten und erhob sich. »Komm,« sagte er, den Arm um ihren Nacken legend, »es wird Nacht!« Und sie gingen miteinander in das Haus.
*
Über den Tälern lagen die Morgennebel wie ein weißes, dichtes Gewebe, als hätte die Waldfee ihre Schleier über den grünen Grund gebreitet. Fern hinter den Bergen kämpfte die Nacht mit dem Tage, eine blasse Sichel stand glanzlos über den Höhen, hinter den Zacken und Spitzen aber flammte und sprühte es, Funken flogen empor, ein glühender Feuerschein leuchtete am Himmel – die Sonne ging auf.
Und allmählich stieg sie empor, klar, sieghaft, in königlicher Herrlichkeit. Die Nebel zerrannen, in langen Fetzen hing der Feenschleier an den Felsenzacken, auf Gräsern und Büschen, im goldenen Laub der Waldbäume glänzte der Tau, als hätten Engelhände Juwelen über die Erde verstreut. Wie ein Zauberschloß glitzerte der Hübichstein, Millionen von Lichtern tanzten an der grauen Felswand auf und nieder, und die weiße Waldfrau saß still am Eingange des Berges und spann und spann.
Tiefes, geheimnisvolles Schweigen lag über dem Grund, nur die Baumwipfel regten sich in leisem Spiel im Hauch des Morgenwindes.
Auf dem Waldwege, der am Fuße des Hübichsteins vorüberführte, schritt ein Jäger, Vogelschlingen und Fänge in der Hand, Jürg war's, der Sohn des Försters in Grund. Trotz und Entschlossenheit lagen auf dem braunen, mannhaften Antlitze, hoch aufatmend schritt er bergan, den Stock heftig in den steinigen Boden stoßend. Er wollte den Horst erklettern, den Edelfalken Schlingen legen und sie dann mit ihren Jungen umbringen. Die Vögel zu erschießen hatte er aufgegeben, hatte er ihnen bisher doch nichts anhaben können, und wenn er sicher wähnte, sein Schuß habe getroffen, so flogen doch stets nur Federn in die Luft, und Hübichs Falken setzten ihren Weg unbekümmert fort. Aber diesmal mußte und wollte er der Sieger sein, schon um der Anne-Marie willen. Wenn sie ihn mit seiner Beute zurückkehren sah, würde sie wieder zur Vernunft kommen, so meinte der Jürg. Ganz wohl war ihm bei dem allen nicht ums Herz, aber der Trotz hielt die aufsteigenden Gedanken nieder.
Von Grund herauf klang Glockengeläute – er stieß den Stab auf den Felsen nieder, daß die Splitter unter dem Eisen aufflogen.
Feierlich grüßten die hellen Töne den Sonntag, aus allen Dörfern hüben und drüben klang brausende Antwort, und zum vielstimmigen Chor sich einend hallte der Morgenpsalm der Glocken über die Berge.
Jeden Ton vernahm er, wie Hammerschlag traf er sein Gewissen, die Worte der Braut vermeinte er zu hören: »Wenn es dein letztes ist, daß du von deinem Gott nichts wissen willst, so ist's mein letztes, daß ich geh'!« und dazwischen klang's wie ein Mahnruf der Feiertagsglocke: »Kehr' um, kehr' um!«
Aber er kehrte nicht um, er dachte nicht daran. Ein Mann wollte er sein und kein Kind, das sich von Frauenhänden leiten läßt – ein letzter steiler Anstieg noch, und er war oben – vor sich selber hätte er Scham empfunden, wäre er so nahe vor dem Ziele umgekehrt.
Nur eins mußte noch kommen auf seinem Wege, davor er sich scheute. Am Fuße der Felskuppe, von gewaltigen Quadern überdacht, hing der Gekreuzigte. Der Jürg wäre gern einen anderen Weg gewandert, aber es gab keinen, er mußte an der Marter Gottes vorüber. Wenige Schritte noch, und das stille Heiligtum inmitten der Bergeinsamkeit ward dem Auge des Wanderers sichtbar – unwillkürlich verhielt er den Schritt. Schon vernahm er das Rauschen der Quelle, die den Stamm des Kreuzes mit ihren Wassern netzte, hochauf ragte das Zeichen der Vergebung und des Glaubens, milde neigte sich das Antlitz mit der Dornenkrone. Zu Füßen der heiligen Gestalt aber lag ein junges Weib, aufgelöst in Tränen und Schmerz, das Antlitz in den gefalteten Händen verborgen – es war Anne-Marie.
Betroffen blieb er stehen und starrte auf die Betende, er wußte es nur zu gut, warum das Mädchen dort kniete, und sein Gewissen schlug aufs neue mit mahnender Gewalt.
Und die Waldvögel sangen über ihm in den Wipfeln, als wollten sie ihn warnen, und die Wichte und Gnomen des Hübichsteins kamen hervor, wiesen zum Kreuz und flüsterten: »Kehr' um, noch ist es Zeit!« Aus dem Quell stieg, schön wie ein Maimorgen, die Nymphe; zitternd nahte sie dem Verwegenen und flehte, ihr zartes Haupt trauernd verhüllend: »Kehr' um, um deiner Liebe willen, um deiner lebendigen erlösten Seele willen,« und bittend hob sie die Hände.
Aber er wollte nicht, es war, als säße ihm der Böse im Herzen, als habe der Anblick des Heiligtums im Himmel und auf Erden seine Seele verstockt. Er schob die Nixe beiseite. Trauernd schlich sie davon, legte, sich tief vor dem Kreuze neigend, Krönlein und Schleier davor nieder und tauchte in den klaren Fluten des Bergbachs unter. Ein sanftes Murmeln, ein leiser Gesang aus weiter Ferne und ein silberner Kreis auf den grünen Wassern waren die einzigen Merkmale, daß das Königskind aus der Tiefe heraufgestiegen war, um einen Betörten zu warnen. Er aber schritt, so leise er's konnte, über das Moos, an der Marter Gottes und der verlassenen Braut vorüber, Finsternis in der Seele.
Durch die Luft ging ein seltsames Schwirren und Pfeifen, während er den letzten steilen gefahrvollen Anstieg begann. Wildes Jodeln und Jauchzen umtönte ihn, und doch sah er niemand rings umher; dazwischen verklangen leise, schmerzliche Laute, wie Kindertränen in Not und Einsamkeit geweint. Ihm graute, aber seinen Mut zusammenraffend, schritt er fürbaß, die hellen Schweißtropfen auf der Stirn. An seiner Seite starrte die Tiefe, ein schwarzer, gähnender Grund zwischen geraden Felswänden. »Wenn du da hinabstürzst ohne Kreuz und Heiland, bist du verloren in Ewigkeit!« wisperte ein dünnes Stimmlein hinter einer weißen Glockenblume, und er faßte den Bergstock fester. Höher und höher klomm er. Schon gewahrte er den Horst der Königsfalken, zwei in weißen Flaum gekleidete Junge lagen darin, die Alten waren ausgeflogen.
Da legte er rings um den Horst seine Schlingen, in denen das Elternpaar sich bei seiner Rückkehr fangen sollte.
Das Werk war getan. Mit einem Gefühl des Stolzes und Selbstbewußtseins stieg er aufwärts bis zur höchsten Kuppe. Mit einem Jauchzer kam er an, keine Menschenseele hatte vor ihm hier oben gestanden, seine Augen glänzten, das Herz schwoll ihm vor Eitelkeit. Und während sein Blick über die Weite schweifte, die sich zu seinen Füßen ausbreitete, wuchs ihm der Ehrgeiz, und die letzte Furcht vor Gott und Menschen verschwand.
Lange hatte er so gestanden. Es war Zeit, sich nach dem Raube umzusehen und den Abstieg zu beginnen.
Da erstarrte ihm plötzlich alles Blut in den Adern, ein entsetzliches Gefühl überkam ihn, als sei er mit dem Felsen verwachsen – keinen Fuß konnte er von der Stelle regen. Seine Schenkel schienen in Stein gewandelt, ein Bann lastete auf seinem ganzen Körper, jeder Versuch, sich aus seiner furchtbaren Lage zu befreien, war umsonst – der Hübich hielt seine Beute fest.
Ein irrer, wahnsinniger Schrei klang von den Lippen des unglücklichen Mannes, markerschütternd hallte er von Fels zu Fels, zum Iberg hinüber, aber keiner schien ihn zu hören, nur das Echo wiederholte spottend den Hilferuf des Gebannten.
Endlich kamen Kirchgänger, deren Weg in der Nähe vorüberführte, auf die wiederholten, dringenden Rufe bis an den Fuß des Hübichsteins. In tiefem Mitleid schauten sie zu ihm empor, der sie, die Hände ringend, beschwor, ihn zu retten, aber keiner wollte sein Leben um den Tollkühnen wagen. Endlich lief einer nach Grund hinab, um seinen Vater, den Förster, zu holen.
Inzwischen war es Mittag geworden; wieder riefen die Glocken, und ihr festlicher Klang zog grüßend von Kuppe zu Kuppe.
Und in die Seele des Mannes, der droben, mit dem Felsen verwachsen, dem Tode ins Antlitz blickend, stand, trugen die ehernen Stimmen ihre Botschaft, und Leib und Seele erbebten unter der Gewalt ihrer Anklage.
Ja – warum stand er dort oben festgewurzelt, ein Gerichteter, eine lebendige Warnung allen Spöttern und Verächtern? Hätt' er's nicht selbst gewußt, die Glocken hätten es ihm in die Seele geschrien: »Du, du bist der Mann, der die Hölle über sich selbst heraufbeschworen hat!«
Und in seinem Innern zogen die Jahre vorüber, sein verlorenes, verfehltes Leben ohne ewigen Inhalt und himmlisches Ziel. Und es war seine Schuld allein, daß es so war – das war der schärfste Stachel. Er hatte von allem gewußt, hatte alles besessen. Als kleines Büblein auf der Mutter Schoß hatte er die süße Mär von dem Kindlein in der Krippe vernommen, von dem Heiland, der uns zuliebe ans Kreuz gegangen, hatte leuchtenden Auges der Siegesbotschaft vom offenen Grabe gelauscht: »Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten?« Das war seliger Kinderglaube; die Jahre waren darüber hingezogen, fremdes Licht und fremde Weisheit hatten der jungen Seele geleuchtet, und vor allem war eine an seine Seite getreten und hatte seine Hand gefaßt mit dämonischer Gewalt, die Leidenschaft. Im grünen Jagdkleide trat sie zu ihm – das edle Weidwerk, den Beruf seines Vaters und Großvaters, hielt jedermann in Ehren – und doch sollte dasselbe einem Gliede dieses rechtschaffenen Geschlechts zur Klippe werden. Jürg Hubert dachte an nichts weiter als an Fischen und Jagen, wenn es hoch kam, freute er sich seiner schönen Braut; aber seine innerste Seele erfüllte die Jagd und mit ihr unbezwingbarer Ehrgeiz und Leidenschaft. Diese Eigenschaften regierten und knechteten ihn, sie erfüllten sein ganzes Leben, seine Zeit, sie verschlangen alles andere in seinem Herzen wie ein verzehrendes Feuer, das nichts neben sich duldet.
Bald war der Jürg soweit, daß er an jedem Sonntag, den der Herrgott werden ließ, mit der Büchse über der Schulter das Haus verließ, den Mahnungen seines frommen Vaters, den Bitten seiner treuen Mutter zum Trotz; nicht einmal Anne-Maries Tränen erweichten ihn. Und mit der Ehrfurcht vor dem Heiligsten schwand auch die Liebe zu Vater und Mutter und der Braut, ob auch ihm selbst unbewußt, dahin. Es lag ein Trotz in seinem Wesen, ein Widerspruch gegen alles, was ihm einst lieb und heilig gewesen war, und am Ende hatte er so die Herrschaft über sich selbst verloren, daß das Böse in seinem Herzen vollends die Oberherrschaft gewann, daß er nichts anderes mehr kannte als seiner Leidenschaft frönen, als fluchen und lästern. Und nun stand er dort oben, wohin sein Hochmut ihn gebracht hatte, und es war ihm ums Herz, als triebe der da droben, den er so oft verlacht, seinen Spott mit ihm. Todesangst überkam ihn; wenn er hier oben verhungerte, wenn er den Raubvögeln, den Wölfen zum Fraße ward ... Kalter Schweiß perlte von seiner Stirn – würde Gott ihn erhören, wenn er zu ihm riefe? – – Er faltete die Hände, zweifelnd, zagend, wie der verlorene Sohn. Die Sünde seines Lebens lag wie mit einem Federstrich gezeichnet vor ihm bis zu der letzten Stunde, da er am Kreuz vorübergegangen war. Und die stille, waldumrauschte Felsengrotte tauchte vor seiner Seele auf, kein Lüftchen wehte in dem einsamen Heiligtume, nur die Quelle murmelte ihr Lied im Schatten der Königsfarne, leise flehende Worte verklangen am Fuße der Marter Gottes. Die Arme weit ausgebreitet, hing der Erlöser am Kreuz, als wollte er die ganze Welt zu sich ziehen in heiliger Liebe, und ein altes Wort erwachte in der Seele des unglücklichen Mannes, ein Wort von blutroter Sünde, die schneeweiß geworden war durch das Opfer des Gekreuzigten. Ein Strahl, warm und erhellend, fiel in seine Finsternis.
Er faltete die Hände fest ineinander und betete um die Vergebung seiner Sünden, um die unverdiente, barmherzige Hilfe aus der Todesgefahr.
Da wurden unten Stimmen laut. Im Städtlein hatte sich die Kunde des Unglücks verbreitet, Scharen von Menschen umstanden den Felsen, im Vordergrunde der Förster Hubert mit seinem Weibe und der schluchzenden Anne-Marie. Mehrere rüstige Leute waren ihm mit Leitern und Stangen gefolgt, um ihm bei seiner Rettungsarbeit behilflich zu sein. Eilends gingen sie ans Werk. Aber alle Mühe und Opferwilligkeit war vergebens, der Fels war und blieb ihnen unersteigbar. Traurig gaben sie ihre Arbeit auf.
Mit wachsender Sorge hatte der junge Jäger ihren fruchtlosen Anstrengungen zugeschaut; als er aber nach kurzer Frist alle Hoffnung schwinden sah, da faßte ihn aufs neue das Grauen, die namenlose Angst vor dem entsetzlichen Ende, und die Verzweiflung legte ihm die rasende Bitte auf die Lippen: »Laß mich nicht hier oben verhungern, Vater, verenden wie ein Tier! Sei barmherzig und schieß mich herunter! Gott wird's dir nicht anrechnen!«
Der alte Förster starrte hinauf. Der Jammer da oben zerriß ihm das Herz, aber die Vaterliebe bäumte sich gegen solch Begehr, und sein Gewissen redete laut wider die Sünde im Kleide der Barmherzigkeit. Gab's nicht einen Gott im Himmel, der seine Rache in Erbarmen und Gnade zu wandeln die Macht hatte, einen Gott, der dem Verworfensten vergibt, wenn er Buße tut, der den Elendsten unter den Sündern grüßt: »Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein!«? Er schüttelte stumm das weiße Haupt zu der wahnwitzigen Bitte; angstvoll schauten die Frauen, die an seiner Seite auf den Knien lagen, zu ihm empor.
Da klang abermals der Verzweiflungsschrei seines Sohnes von der Spitze des Hübichsteins: »Um der Barmherzigkeit Gottes willen, schieß mich herunter!«
»Um der Barmherzigkeit Gottes willen!« – Seine Sinne verwirrten sich im Anschauen des Elends, das über sein Haus hereingebrochen war, im Gedanken an die kommenden Stunden und Tage, an den Hungertod, der dem Manne dort oben nahte, an den machtlosen Kampf mit Geier und Wolf – und es brauste ihm vor den Ohren: »Tu's – schieß ihn herab! Gott ist barmherzig!«
Er raffte sich auf. In dumpfem Schweigen ging er davon.
Eine Stunde mochte vergangen sein, da sah man ihn den schmalen Fußpfad heraufkommen, die Büchse über der Schulter. Ein Schrei des Entsetzens klang ihm entgegen, wie im Sturm war die Menge zerstoben. Sein Weib fiel in Krämpfen zur Erde, wie ein Marmorbild lag Anne-Marie auf den Knien. Ein paar mitleidige Leute trugen die unglückliche Mutter ins Städtlein hinab – sie waren allein.
»Vater,« sagte das Mädchen, sich aufrichtend, »ich kann's nicht zulassen, was du da tust! Laß mich noch einmal am Kreuz beten, es sind nur wenige Schritte bis dahin« – ihre Stimme brach, sie legte die Hand auf seinen Arm.
Er lehnte die Büchse an die Felswand und nickte ihr stumm die Antwort. Gleich darauf war sie unter den Waldbäumen verschwunden.
Gramversunken blickte er nieder in die goldig schimmernden Täler. Sonst war Gottes schöne Welt seine Wonne gewesen, heute war es ihm, als schlügen ihm der Hölle Flammen aus dem leuchtenden Wäldermeer entgegen – er war irre geworden an seinem Gott und seinem Christenglauben. Hätten die Felsen sich aufgetan und ihn verschlungen, er wäre es zufrieden gewesen.
Es währte lange, bis das Mädchen zurückkehrte, aber droben auf dem Hübichsteine erklangen aufs neue die herzzerreißenden Klagen, die flehenden Bitten, dem furchtbaren Dasein ein Ende zu machen.
Und der Alte ertrug es nicht länger. Er riß die Büchse empor und zielte auf das Herz seines Sohnes. Todesbereit erwartete der junge Jäger die erlösende Kugel.
Minuten verstrichen – der Schuß blieb aus. Kraftlos sanken dem Förster die Arme am Leibe nieder, seine Knie zitterten, es ward ihm schwarz vor den Augen. Dreimal raffte er sich auf und legte an – vergeblich. Und der Jürg bat und flehte: »Versuch's noch einmal, ein letztes Mal!«
Da nahm er alle Kraft zusammen und zielte scharf. Aber als er den Drücker berühren wollte, war es ihm, als griffen ihn unsichtbare Hände an, als stellte sich ihm eine fremde, geheimnisvolle Macht entgegen. Tannenzweige schlugen ihm ins Gesicht, als schritte er durchs Dickicht, und doch stand er auf freiem Plane. Ein Kichern und Wispern klang ringsum, leise wie das Zirpen eines Heimchens, wie ein Rauschen im Tann, als wären alle Geister geschäftig, als huschten Gnomen und Wichte unter den Farnen umher und erzählten einander ein Waldgeheimnis. Die schöne, zarte Quellnymphe war aus ihrem feuchten Schlosse heraufgestiegen und saß unter dem Kreuz; die kleinen Hände über den Knien gefaltet, blickte sie mit nassen Augen auf das Menschenkind, das um sein Liebstes kämpfte und betete. Aber weder der alte Förster noch das Mädchen vernahm das Flüstern im Walde; hingenommen von ihrem Schmerz kniete die Jungfrau unter der Marter Gottes, während der verzweifelte Vater am Fuße des Hübichsteins saß, tief gebeugt, das Haupt in den Händen vergraben.
Und die Dämmerung brach herein und lagerte ihre Schatten um den Vergrämten, um die reglose Gestalt des Märtyrers auf der Zinne des Zwergenschlosses. Dunkler, immer dunkler ward es, der Mond kam über den Wäldern herauf und goß seinen Silberglanz über die Täler, tausend Sterne blinkten am Himmel. Leise zog der Westwind über die Höhen, dazwischen tönte fernes Flötenspiel, als klänge ein Brautlied durch das Schweigen der Bergeinsamkeit, in tiefem Traume lagen die Täler, das letzte Licht unten im Grunde erlosch.
Da dröhnte Hufschlag durch die Nacht. Gnom und Wicht flohen erschrocken unter die Büsche oder verkrochen sich in hohlen Bäumen. Ein eisgrauer, gebeugter Mann in langem Mantel trat aus dem Dickicht, tief herab hing der weiße Bart, die grauen, gutmütigen Augen spähten am Boden umher, wo das kleine Volk geängstet umherlief. »Flieht, Kinderlein, flieht, die wilde Jagd ist unterwegs,« sagte er mit seiner tiefen Stimme, »eilt euch, ehe die Unholden nahen!« Dabei hob er ein Elfenkind am goldenen Haar empor und trug das zappelnde Geschöpfchen zur nächsten Felsspalte. »Nur keine Angst, Kleine, kennst du den getreuen Ekkehard nimmer?«
Zitternd hüllten sich die Elfen in ihre Schleier, in die Kelche der Blumen schlüpften sie, und die Blütenblätter schlossen sich über den flüchtigen Kindern der Geisterwelt – wie vom Erdboden verweht war das zarte, duftige Leben unter den taufrischen Gräsern.
Und dann kam es herangebraust mit dämonischer Gewalt, in fliegender Hast – ein bleiches Nachtgezücht, eine tagesfeindliche Schleiergestalt nach der anderen auf keuchendem Roß –, voran ein Weib mit lichtem Haar und verlockender Gestalt, schön wie ein Königskind der Sage, von zarten Gewändern umflattert – die Nebelfrau war es und das ungezählte, drängende Volk ihr Gesinde, die wilde Jagd!
Schaurig hallte der Hufschlag durch den Hochwald, ein bläulich dämmernder Schein ging den Gestalten der Nacht voran und zeichnete ihre Straße. Da plötzlich bäumten sich, wie von Furien gepeitscht, die Rosse, der sausende Flug stockte, ein gewaltsames Zittern durchrann die fluchende Schar, auf den fahlen Gesichtern lag bleiches Entsetzen: vom Mondlicht strahlend umflutet leuchtete das Kreuzbild Gottes durch die Finsternis.
Mit einem wahnsinnigen Schrei verhüllte die Nebelfrau das Haupt, ächzend folgten ihr die Schleiergestalten. In wirrem Durcheinander ging es über Stock und Stein und Wurzelwerk, bis der spukhafte Zug sich endlich sammelnd in rasender Hast weiterjagte, in fliegendem Ritt um den Hübichstein, aufwärts, zur höchsten Spitze.
Der Mond stand voll über den Bergen, da hielt die Unholdin mit ihren Scharen vor dem Manne, der auf der Felskuppe den Tod erwartete. Wie gebannt blickte er auf die weiße, königliche Frauengestalt, die, sich aus dem Ring der Nachtgeister lösend, auf ihn zu trat und dicht vor ihm stehen blieb. Und dann vernahm er die glockenhelle Stimme, lockend wie Sirenengesang: »Ich will dich lösen von deinen Banden, wenn du dich mir verschreibst mit Leib und Seele, mit Sinnen und Geist, wenn du absagst allem im Himmel und auf Erden!«
Sie streckte den schimmernden Arm aus: »Unten in der Felsengrotte hängt einer am Kreuz, das ist mein Feind, mein bitterster! Ich will dich lösen von den Banden, wenn du dem Gekreuzigsten fluchst!«
Unverwandt hatte der Jürg bei den Worten des schönen, gespenstischen Weibes in die leuchtenden Augen geblickt. Eine Sekunde lang war es ihm, als müsse er ihr antworten: »Ja, ich bin dein mit Leib und Seele!« Aber bei ihren letzten Worten fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Wäre die verlockende Gestalt einige Stunden früher zu ihm getreten, er hätte in wilder Leidenschaft die Arme ausgebreitet und wäre mit ihr zur Hölle gefahren. Aber er war ein anderer geworden, als er gestern war – ein Mann, der, von seiner Sünde zerbrochen, mit ihr gebrochen hatte. Schenkte Gott ihm das Leben, wollte er es neu beginnen. Dies Weib aber, das verführerisch vor ihm stand und ihm alle Schätze der Erde bot, versprach ihm ein Leben, das kein Leben war, hinter ihrem gleißenden Wort und dem schillernden Gut, das sie ihm bot, lauerte der ewige Tod – die Verdammnis – der furchtbare Sold der Sünde, der Verstocktheit wider den Geist Gottes.
Sie sah sein Zögern, näher und näher trat sie ihm. Ihr Atem streifte seine Stirn, ihr Goldhaar umflatterte ihn im Nachtwind, mit wogender Brust und glühenden Lippen stand sie da – »fluch ihm!« flüsterte sie.
Da fuhr ein Blitzstrahl vom Himmel nieder, taghell war der Hübichstein und die weiten Täler ringsum. Unten sah er seinen alten Vater sitzen, von Gram gebrochen, und die Anne-Marie schaute mit flehend erhobenen Händen gen Himmel. An seiner Seite aber stand die Versuchung im Kleide des Lichts, ein Weib, wie es diese Erde nicht geboren, eine Tochter der Finsternis, die heraufgestiegen war, eine lebendige, erlöste Menschenseele der Hölle zu gewinnen, und mit einem Schlage war es ihm klar: »Du stehst vor der Entscheidung, vor der Wahl zwischen Seligkeit und Verdammnis.«
Grollend hallte der Donner von Fels zu Fels, schaurig folgte ihm das Echo. Da umschlangen zwei weiche Frauenarme den Nacken des Mannes, und ein bleicher Mund berührte seine Wange.
Er fuhr empor und wollte sich aus ihren Banden lösen, aber die zarten Arme umschlossen ihn wie Stahl; es war ihm, als sei er nicht nur mit dem Felsen, sondern mit der Nebelfrau verwachsen.
Da schrie er zum Himmel in höchster Not: »Herr Gott, erbarme dich meiner!«
Von allen Felsen hallte die Antwort, als jauchzten tausend Stimmen ein Triumphlied. Im selben Augenblick aber sanken die Arme der Nebelfrau von seinen Schultern, mit einem vergiftenden Blick schaute sie ihn an, dann zerrann sie in nichts vor seinen Augen. Mit ihr verschwand das Heer der bösen Geister im Dämmer der Herbstnacht, und die weißen Nebelschleier, die in langen Fetzen um die Felszacken flatterten, waren die letzte Spur, die sie hinterlassen hatte.
Jürg Hubert atmete auf. Diese letzte Stunde war die furchtbarste, die er dort oben verbracht hatte. Aber einen Trost hatte er aus dem heißen Kampfe mitgenommen: Er hatte seinen Gott wieder und hatte in seiner Kraft die Versuchung überwunden. Er hatte gesiegt; er wußte, nun durfte er nicht nur schreien: »Führe mich nicht in Versuchung!«, sondern auch aus tiefstem Herzen die Errettung vom Tode erflehen. Er wußte es wieder fest und gewiß: Es gab einen Vater im Himmel, der um seines Sohnes willen das Seufzen aller Verlorenen hört! Und wenn seine Bitte nicht im irdischen Sinne erfüllt ward, wenn er hier oben sterben sollte – er brauchte nicht mehr den Büchsenschuß des Vaters, wußte er es doch, daß einer an seiner Seite stand, der ihn vom Tode zum Leben brachte.
Während er sich so auf sein letztes Stündlein vorbereitete, merkte er es nicht, daß es rings um ihn her lebendig wurde. Der ganze Berg wimmelte von kleinen Gestalten, die in fiebernder Geschäftigkeit mit Leitern und Grubenlichtern, mit Schlägel und Eisen aus den Felsspalten des Hübichsteins hervorkamen und emsig an die Arbeit gingen, Leiter an Leiter setzend, bis ein Abstieg hergestellt war.
Vor dem Jürg aber stand plötzlich, wie aus der Erde gewachsen, ein graues Männlein mit weißem Bart; ein goldenes Krönlein trug es über der Kapuze und ein Zepter von funkelndem Edelgestein in der kleinen Hand. Das konnte kein anderer als König Hübich sein, sagte sich der Jürg, und Furcht und Hoffen stritten in seinem Herzen. Der Kleine aber stellte sich gerade vor ihn hin und musterte ihn mit strengem Blick. Dann hob er sein Zepter und sagte: »Wie konntest du es wagen, Verwegener, am heutigen Tage ohne Scheu die Zinnen meines Schlosses zu ersteigen und meinen Falken nachzustellen? Beides, merke dir, lasse ich nicht ungestraft!«
Da bat der Jäger: »Ach, Herr König, erbarmt Euch! Seht, ich bin schwer gestraft um meine Gottlosigkeit und meinen Frevel. Aber ich hab's hier oben gelernt, was ein Mensch ohne Glauben ist, und werd's im ganzen Leben bewahren, was ich in den Stunden der Verzweiflung gelernt habe. Eure Vögel aber, das gelob ich Euch, will ich nimmermehr stören!«
»Mir scheint, du hast deine Lektion schon von einem Höheren empfangen,« sagte der Zwerg, »darum will ich diesmal Gnade für Recht ergehen lassen; aber daß du's mir nicht vergißt,« schloß er, den Finger hebend, »der Hübich gehört zu den guten Geistern, die Gott den Allmächtigen ehren, und er hält geradesogut den Feiertag heilig als ihr Menschenkinder!«
Damit winkte er seinen Zwergen, die eben die letzte Leiter befestigt, und im Nu sprangen etliche der Männlein herbei und lösten mit raschen Schlägen die Füße des Gebannten vom Felsen.
»Komm mit mir,« sprach der Wicht, noch ehe er sich über sein Glück besinnen konnte, und faßte ihn bei der Hand. Damit setzte er den Fuß auf die oberste Sprosse der Leiter, und vertrauensvoll folgte ihm der Befreite auf schmalem Abstieg. Das Herz schlug ihm laut, als er wieder über Gottes Erdboden schritt, und ein heißes Dankgebet stieg aus seiner Seele empor. Sie waren den Hübichstein etwa zur Hälfte hinabgestiegen, als der Kleine vor einer glitzernden Tür, die der Jürg noch nie im Leben gesehen hatte, Halt machte. Er meinte nicht anders, als daß der Zwergenkönig hier von ihm Abschied nehmen werde und wollte ihm für die unverdiente Hilfe danken, aber Hübich winkte ihm abwehrend mit der Hand, und die Tore der Felsenburg sprangen auf. Wie geblendet blieb der Jäger stehen. Ein Meer von Licht umfing ihn, Millionen Kerzen funkelten in dem weiten, mit königlicher Herrlichkeit aus Bergkristallen erbauten Prunksaal, in dessen Wänden sich jede Flamme hundertfach widerspiegelte. Alles glitzerte von Gold und Edelsteinen, als wären aller Welt Schätze im Palast des Gnomen aufgespeichert.
Stumm vor Staunen durchwanderte der Jürg an der Seite des Kleinen einen schimmernden Saal nach dem andern. Endlich langten sie vor einer Grotte an. Bläuliches Licht strömte aus den gewaltigen Öffnungen der Höhle, deren Wände und Pfeiler von Juwelen strotzten. Am Eingange stand ein riesenhaftes Steinbecken, darin funkelte es von Gold und Kleinodien.
Hübich wies darauf hin. »Du hast meinen Zorn kennengelernt,« sprach er zu dem Erstaunten, »nun sollst du's auch erfahren, wie ich denen lohne, die von ihrem bösen Wege umkehren! Die Schale mit ihrem Inhalt ist dein, meine Zwerge mögen sie in deines Vaters Haus tragen!«
Und noch ehe der Jäger seinem Wohltäter danken konnte, waren zwölf Männlein zur Stelle und schleppten den Schatz aus der Burg. Der Hübich aber schaute unverwandt nach der Grotte hinüber, als hätte er dort das Beste aufbewahrt. Langsam schritt er an der Seite seines Gastes unter den Felsblöcken dahin, dem Innern der Höhle zu. Rings plätscherten silberne Quellen, glänzende Tropfen fielen von der Wölbung nieder, aus den Nischen und Säulengängen klang der schwebende Reihen weißgekleideter Elfen. Am Rande der Grotte lag ein stiller, grüner See, von Alpenrosen umblüht. Ein Nachen schaukelte zwischen Lotosblumen, eine Nymphe saß am Steuer, die zarten Glieder von blauen Schleiern verhüllt, wie ein Geheimnis der Tiefe.
»Steig ein,« befahl der Wicht und setzte sich neben den Jäger auf die Bank des Schiffleins.
Langsam glitt der Nachen über die spiegelhellen Wasser dahin, der bläuliche Schein der Grotte ward blasser und blasser und kämpfte mit einem fremden Licht, die Felsentore taten sich auf, golden schimmerte der See, vom warmen Schein der Oberwelt umflossen, das Schilf rauschte, die Wasservögel zirpten, ein wolkenloser Oktoberhimmel blaute in lazurfarbener Schönheit über den Wassern, hinter den Harzbergen flammte es purpurn – die Sonne ging auf. Und drüben vom anderen Ufer winkte es mit sehnendem Blick – der Morgenwind umstrich das Haar eines blondlockigen Mädchens, ein alter Mann stand auf seinen Stab gestützt und schaute, die Hand über den Augen, auf den See hinaus.
Da klang ein hallender Jauchzer aus dem landenden Kahne – die Arme weit ausbreitend, hielt der Erlöste die Braut umfangen.
Als die Glücklichen sich einen Augenblick später umwandten, ihrem Wohltäter zu danken, waren See und Kahn, Zwerg und Nymphe verschwunden, vor ihnen aber starrten die Felsen des Hübichsteins grau und trotzig gen Himmel, und im Steinkar = Steinhöhle. hing das Kreuzbild des Herrn waldumrauscht über der Quelle. Da neigten die drei still das Haupt, und der Bursch umfaßte niederkniend den Stamm des Kreuzes. Kein Laut ging durch das einsame Heiligtum, wo die drei Menschenkinder dem Erlöser ihr Dankopfer brachten, nur die Wipfel regten sich leise und streuten ab und an ein goldenes Blatt zur Erde. Oben über das Felsendach aber spähte ein graues Männlein, eine goldene Krone trug es über der Kapuze; das hatte die kleinen Hände gefaltet, als bete es mit, und die hellen Tränen rannen über das runzelige Gesicht. – –
Als der Förster und seine Kinder den Heimweg antraten und ins Freie kamen, rauschte es plötzlich über ihnen – zwei weiße Falken zogen in raschem Fluge zum Hübichstein. Der junge Jäger warf einen langen Blick auf die beiden Vögel, dann sagte er hinaufweisend: »König Hübich ist heimgekehrt!«
Gleich darauf flatterten die Wächter des Felsenschlosses um die grauen Zinnen, und die Sage saß auf dem Berge und spann den Faden deutscher Poesie wie in alten Zeiten.
*
Jahre waren vergangen. Die Glocken jauchzten das Siegeslied der Ostern in die Bergwelt hinaus. Weiß wie der letzte Schnee auf der Kuppe des Hübichsteins standen Altar und Kanzel im lichten Festschmuck heiliger Zeiten, und die Sonne grüßte mit goldenem Strahl junge Saaten und veilchenblaue Wiesen.
Der Gottesdienst war beendet, in großen Scharen kehrten die Kirchgänger heim. Als einer der letzten verließ der Förster Hubert mit seinem Weibe das Gotteshaus, ein eisgraues, ehrwürdiges Paar, das ebensosehr wegen seines großen Reichtums als wegen seiner Frömmigkeit und Wohltätigkeit weit und breit bekannt war und von den Bewohnern des Städtleins hoch geachtet und geliebt ward.
Von einer Schar Kinder und blühender Enkel gefolgt, schritten die beiden Alten die Dorfstraße entlang, dem efeuumsponnenen Forsthause zu, darin schon die Eltern und Großeltern gelebt halten. Als sie durch den Garten gingen, wo eben die Krokos und Primeln hervorkamen, hüpfte ein blondes Enkelein, das noch zu klein war, um zur Kirche mitgenommen zu werden, auf den Greis zu und hielt ihm eine schimmernde Münze entgegen. Ein graues Männlein sei bei ihm gewesen, berichtete das Mägdlein, und es solle den Großvater von ihm grüßen. Eine goldene Krone habe es über der Kapuze getragen und habe gar freundlich zu ihm geredet und ihm zum Abschied eine Münze geschenkt.
»Das ist der Hübich,« sprach Jürg Hubert zu seinem Weibe, während er das Kleinod mit dem Bilde des Berggeistes betrachtete. »Nach tausend Jahren ziehen die Zwerge bisweilen an einen anderen Ort – er hat den Felsen verlassen,« setzte er traurig hinzu.
Da rauschte es über ihnen, in raschem Fluge flatterten die weißen Falken des Zwergenkönigs vorüber.
Der alte Mann hob das Haupt und schaute den Vögeln nach, bis sie fern hinter den blauen Bergen verschwunden waren. Er faßte die Hand seines Weibes, eine Träne glänzte in den weißen Wimpern. »Komm,« sagte er, »wir wollen hinauf!«
Und die beiden Alten schritten hinauf in den Bergwald, wo das Kreuz im Felsenkar hing und der Quell sein Feierlied rauschte.
»Ich mußte noch einmal an dieser Stätte Gott danken für das, was ich hier oben erkannt und empfangen habe,« sagte der Greis, »vielleicht ist's unser letzter Gang auf diese Höhen, Anne-Marie, unser Haar ist weiß wie der Bergschnee, wir sind alt, und das Ende ist nahe.« Er schaute zum Hübichstein empor. »Eine kurze Wegstrecke noch, und wir sind oben angelangt, auf den ewigen Bergen, von denen uns die Hilfe gekommen ist!«
Die Greisin lächelte; aus dem milden Frauenantlitz grüßte ihn der Liebreiz vergangener Zeiten. »Du hast recht,« sagte sie, »es wird Abend, aber hinter den Höhen leuchtet schon das Morgenlicht der Ewigkeit!«
Er drückte die Hand der treuen Gefährtin und geleitete sie sorgsam den steilen Abstieg talwärts, warm und lind leuchtete die Sonne über dem greisen Paar, und die Frühlingslüfte, die die Veilchen unten im Grunde geweckt hatten, wehten um den Felsen, wo die Tannen rauschten und die Waldfrau ihre goldene Spindel drehte, wie vor tausend Jahren.
