
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es ist gesagt worden, daß eine einzige Monographie eines genialen Mannes, der wirklich geistig erkrankt gewesen wäre, hinreichend wäre, um meine Theorie von der Psychose des Genies aufrechtzuerhalten. Nun sind zu den zahlreichen Schilderungen, die ich gegeben habe, sehr viele sehr genaue und vollständige neue von seiten hervorragender Psychologen hinzugekommen, so daß gegen diese die früher veröffentlichten Skizzen in den Hintergrund treten, wie die Studien über Byron, Tasso, Zola und Leopardi.
Wenn es sich um Genies handelt, die psychisch völlig intakt zu sein scheinen, so liegt dies daran, daß genaue Daten über sie nicht vorhanden sind. Einen neuen Beweis hierfür liefert mir die Lebensgeschichte Beccarias, Cesare Beccaria, italienischer Staatsrechtslehrer, 1735-94. (Anmerk. d. Übers.) bei dem nur sehr wenige bis jetzt eine Neurose gemutmaßt hatten. Und dennoch, je mehr neue Einzelheiten über diesen Geist bekannt werden, mit so kränklicher, nervöser erscheint er uns.
Knabenalter, Verwandtschaft. Über seine Kindheit besitzen wir nur sehr wenig bemerkenswerte Daten. Er machte nicht den Eindruck sehr hoher Intelligenz. Er redete wenig und nichts Außergewöhnliches, war oft zerstreut und lernte nur schwer lesen und schreiben, derart, daß die Eltern ihn nicht für geeignet zum Studium hielten. Rücksichtlich der Erblichkeit ist bekannt, daß er einer alten Adelsfamilie angehörte, die indes in der Aszendenz viele Irre und Gleichgewichtsgestörte aufzuweisen hatte. Es genügt hierüber folgende bezeichnende Stelle aus Pietro Verri anzuführen:
»– Vater und Mutter sind ebenso schwach und inkonsequent wie der Sohn. Es ist eine Familie, die weder an Vergangenheit noch an Zukunft denkt und fast triebartig nach dem Eindrucke des Augenblicks handelt. Erkrankt die Tochter, so weinen sie um sie, als wenn sie schon tot wäre, und entrüsten sich gegen das grausame Schicksal, das es so bestimmt hat; wird sie wieder gesund, so ist alles wieder vergessen. Der Marquis selbst ist bald barsch zu seinem Schwiegersohn (Verri), bald sanft und liebevoll in einem Maße, als wenn er seine Protektion wünschte. Ein Mittelmaß gibt es nicht. Wenn man sie gut kennt, kann man merkwürdige Sachen erleben. Der Marquis, der Geld und Ansehen hat, hat sich gegen die Familie so benommen, daß keines seiner Kinder auch nur eine Spur von Respekt vor ihm hat und ihm bei Tisch nicht einen Teller voll übrig lassen würde. Meine Maddalena ist die einzige, die ihm seine Einfältigkeit nicht als Schuld anrechnet.«
Diese Schilderung läßt begreiflich erscheinen, was bei Beccarias erster Ehe vorfiel.
Beccaria hatte die Theresa Barbò gegen den Willen der Eltern geheiratet. Seine Mutter Ortensia Visconti di Saliceto war darüber so über alles Maß erzürnt, daß sie die ganze Familie veranlaßte, Trauer anzulegen, wie wenn der Sohn gestorben wäre. Der Skandal war außerordentlich und die Wiederaussöhnung erschien jedermann unmöglich, nur Verri nicht, der ein starker Psychologe war und die Achillesferse dieser Augenblicks- und Gefühlsmenschen wohl kannte und der den Freund ermutigte einen Streich zu wagen und sich eines Tages mit seiner Frau im Vaterhause einzustellen und um Vergebung zu bitten. So geschah denn die Versöhnung im Handumdrehen trotz aller Vaterflüche, Trauergewänder usw.
Diese Gefühlsschwankungen und Wechsel von Nachdruck und Schwäche, diese Neigung jeder Regung nachzugeben, die in der Familie erblich war, zeigten sich bei Cesare Beccaria so außerordentlich, daß seine aufrichtigsten Bewunderer darüber empört waren.
Halluzinationen und Illusionen. Es ist gegenwärtig sicher, daß er an Sinnestäuschungen litt. Auf der Reise erschienen ihm in den Konturen der öden, dürren Berglandschaft Phantasmen, die ihn erschreckten, wie Verri, der ihn öfter auf der Reise begleitete, mitgeteilt hat.
Beccaria zitterte außerdem, wie Cattaneo erzählt ( Scritti politici ed epistolari, I, S. 1l6) auch im reiferen Alter geradezu beim Gedanken an Fegefeuer, Hexen, Dämonen. Er soll in einem Korbe, der an der Zimmerdecke hing, geschlafen haben, damit die bösen Geister, die, wie er wahrscheinlich glaubte, am Boden sich herumbewegten, ihn nicht erreichen könnten (Cattaneo, Scritti II).
Eines Nachts weckte er Berri mit einem Schreckensrufe. »Im Halbschlafe,« berichtet Verri (Briefe I, S. 150), »glaubte er, daß jemand durch das Fenster in sein Bett steigen wolle und ich mußte genau nachsehen. Sein Schrecken vor der nächtlichen Finsternis war derartig, daß der Abbé Morellet ihn, wie dieser selbst erzählt, ganze Nächte hindurch beruhigen mußte. Im Finstern wollte er keinen Schritt tun.«
Eines Abends bildete er sich im Theater ein, der Kronleuchter müsse herunterstürzen und das ganze Parkett zerschmettern, nachdem er schon vorher immer Angst gehabt hatte, eine Kerze würde herabfallen.
Auf der Reise mit Verri setzte er sich in den Kopf, daß seine Frau erkrankt sei, und kein Vernunftgrund war stark genug ihn davon abzubringen. Einen Augenblick beruhigte er sich wohl, fing aber dann immer wieder von neuem an ängstlich zu fragen und wiederholte wie ein Geisteskranker den ganzen Tag fortwährend: »Wird meine Frau nicht krank werden?«
Entschlußlosigkeit. Außerordentlich war bei ihm seine Willensschwäche, seine Unfähigkeit, einen Entschluß herbeizuführen. »In Paris fragte er fortwährend,« erzählt Verri, »wie weit es mit der Post bis Mailand sei und er sprach von nichts anderem, als sogleich Tag und Nacht dorthin reisen zu wollen. Nachdem aber die Abreise festgesetzt war, will er sie drei Wochen lang aufschieben.«
Eine Stelle aus einem Briefe Verris lautet (Briefe II): »Meine Abreise ist verschoben. Beccaria, dessen Wünsche beständig wechseln, ist gegenwärtig der Ansicht, wir müßten noch den ganzen Monat hier bleiben.«
Frisi schreibt darüber au Alessandro Verri: »Am Dienstag habe ich Beccaria verlassen, als er eben Pferde bestellt hatte. Kurz nachher versprach er der Signora S. bis Mittwoch bleiben zu wollen und unmittelbar darauf war er wieder über das gegebene Wort ärgerlich und ist den ganzen Tag wütend gewesen. Dazu hat er dann Morellets Bruder gebeten, nachts im Nebenzimmer zu schlafen, da er sich im Dunkeln fürchtete, und so ist bekannt geworden, daß er auch die ganze Nacht förmlich getobt hat, wie die Irren im Tollhause.«
Seine Unfähigkeit sich zu entscheiden ging so weit, daß er einst, nachdem er beschlossen hatte, nach Versailles zu fahren, vier Stunden von Paris, sich über ein inzwischen eingetretenes Hindernis freute, da Versailles über Paris hinausliegt und er sich deshalb von seiner Frau hätte weiter entfernen müssen.
Manchmal hatte er noch merkwürdigere Einfälle.
Er war so mißtrauisch, daß er Verri, der ein absolut ehrenhafter Mensch war, der ihm den Weg zum Ruhme geebnet und sich seit Jahren als erprobter Freund gezeigt hatte, im Verdacht hatte, die Reisekasse anzugreifen.
Größenideen. Es scheint, daß er auch zuzeiten Größenideen gehabt hat, abwechselnd mit Perioden mit depressiven Stimmungen, wie es bei den Melancholikern und bei den »zirkulären« Geisteskrankheiten der Fall ist. So wiederholte er mehrmals: »Ich bin Europas Beistand sicher.«
Gewöhnlich sprach er bloß von sich selber. Als Verri einmal anfing in Gesellschaft von seinen Studien über die Verbrecher zu sprechen, schnitt er ihm das Wort ab.
»Er schätze mich zu hoch, antwortete er mir, als ich ihn deswegen zur Rede stellte,« sagt Verri, »als daß er nicht eifersüchtig deswegen auf mich sein könne. Wenn ich aber spreche, so hört er mir nicht zu – wenn er lustig ist, wird er unausstehlich; rühmt man ihn, so ist er toll vor Eitelkeit, spricht geistvoll und glänzend. Fängt man an ihn links liegen zu lassen, so ist es mit seiner Rolle aus dem gleichen Grunde zu Ende und er wird still und schüchtern wie ein kleines Kind.«
Gefühlsleben. Sein Gefühlsleben bewegte sich fortwährend zwischen Niedergeschlagenheit und Erregtheit.
»Ich schwanke beständig,« sagt er zu Verri, »zwischen Lustigkeit und Verstimmung. Meine Vernunft liegt beständig mit meiner Stimmung im Kampfe, mir ist mitten in Ehrungen und Vergnügungen sehr trübselig zumute, und ich fühle mich dann im Herzen tiefbedrückt.«
Diese seine beständige Unruhe und schwankende Stimmung waren Verri natürlich sehr lästig, weshalb er sich darüber in seinen Briefen oft sehr ungehalten äußert. So schreibt er das eine Mal: »Jetzt muß ich schon wieder seit vierzehn Tagen seine hochgradige, dumpfe Melancholie aushalten. Er ist mager geworden, sieht stumpf und starr zur Erde, stöhnt, vergießt Tränen; ich wiederhole, daß ich in Besorgnis war, er würde irre werden. Ich kann es wirklich nicht länger ertragen. Man kann die Freude und den Schmerz seines Nebenmenschen im Leben wohl teilen, aber den Jammer und Kleinmut eines weibischen und kindischen Toren kann man nicht nachfühlen.«
Um seine trübe Stimmung zu verscheuchen, trank Beccaria manchmal stark, aber der Wein vergrößerte, wie es gewöhnlich geht, seinen Kummer und machte ihn noch trauriger.
»Was hindert Beccaria eigentlich, es sich hier wohl sein zu lassen?« fährt Verri fort. »Wir wurden gleich nach unserer Ankunft bei Baron Holbach eingeführt, speisten bei ihm, begrüßten die bedeutendsten Männer der Stadt. Der Name Beccaria erklang von allen Lippen, man erwies ihm die größte Ehre, und so geschah es die folgenden Tage weiter bei den verschiedenen Empfängen seiner Person –
»Das sind doch Dinge, die der Eigenliebe gewiß schmeicheln müssen, und wie verhielt sich Beccaria bei diesen Auszeichnungen?
»Nichts war ihm recht, er ließ sich zwar davon etwas ablenken, aber bald beschlich ihn wieder sein Trübsinn und er fühlte von neuem den Wurm am Herzen nagen.«
Im Theater konnte er bei Rührszenen in Tränen ausbrechen und die höchste Bewegung äußern; waren solche Auftritte zu Ende, so verlor er alles Interesse an der Handlung und fing wieder an schmerzlich zu grübeln. Mitten in der anregendsten Unterhaltung der geistvollsten Männer, unter allen Tafelgenüssen, in Palästen und Bibliotheken, Dingen, von denen jedes einzelne genügt hätte, Hunderte mit Befriedigung zu erfüllen, bleibt er durchaus mißvergnügt.
»Heute sind wir in Versailles gewesen: ich kann nur sagen, daß es für jeden ein Vergnügen sein muß, und trotzdem ist unser Freund aus der tiefsten Verstimmung nicht herausgekommen« (Verri, Briefe).
Es war keine bloße Verstimmung, die ihn quälte, sondern gleichzeitig eine Veränderung des Denkens, eine Art Denkzwang mit raschem beständigem Ideenwechsel, dessen er sich nicht entledigen konnte.
»Er hat etwas förmlich Kindisches an sich,« sagt Verri, »das er mit einer Art forciertem Nachdruck zu verdecken bestrebt ist, man sieht aber leider, daß es gemacht ist.«
»Sein Hauptfehler ist, sich vom Gefühl hinreißen und leiten zu lassen. Er kalkuliert nie, genießt ohne Wahl, was sich bietet, sucht sich alles vom Leibe zu halten und da ihm die Berühmtheit, zu der er es gebracht hat, und die Überlegenheit, die ihm die Öffentlichkeit in seinem Kreise einräumt, Freude macht, so sucht er dies ganz auszukosten.
»Die ihm nahestehen, werden davon in Mitleidenschaft gezogen; daß es ihnen unangenehm ist, muß er sehen, dies schmerzt ihn wieder, er sucht ihnen deshalb auszuweichen.«
Affektleben. Die Widersprüchigkeit, die im Grunde seiner Seele vorhanden war, zeigt sich besonders deutlich in Affektleben und Leidenschaften. Er scheint eine doppelte Persönlichkeit zu besitzen, die von der äußersten Zärtlichkeit zur Gleichgültigkeit und von dort zu außergewöhnlicher Kälte sich zu bewegen scheint.
Seine Ehe mit der Barbò, die er trotz des Widerstandes seiner Eltern schloß – zu einer Zeit, in der dies doppelt schwer wiegt – und trotz der Vermahnung des Stadthauptmanns und des über ihn verhängten Stubenarrests, ist ein Beweis für die Gewalt seiner Leidenschaft.
Es scheint, als wenn dies auch später so geblieben wäre, denn auf der oben erwähnten Reise grämt er sich und beunruhigt sich, daß er seine Frau allein gelassen hat, indem ihm seine krankhafte Einbildung vorspiegelt, sie müsse erkrankt sein.
Trotz dieser starken Leidenschaft für seine Frau, zögerte er nicht, sich ganz kurze Zeit nach ihrem Tode von neuem zu vermählen.
Lo Monaco und Custodi, seine Biographen, erörtern mit Erstaunen diesen Widerspruch, und Custodi Custodi, Vita di Beccaria, 1790. meint, seine Philosophie hätte zuzeiten mit seiner Lebensführung im Widerspruch gestanden.
Dieses widerspruchsvolle Gebaren und seine Unberechenbarkeit in der Stimmung traten auch im Verkehr mit seinen Freunden hervor, die er sich stets zuletzt entfremdete. »Es war gut, daß er Paris schon nach kurzer Zeit verließ,« sagt Verri, »denn er fing schon an bittere und harte Worte zu gebrauchen, so daß sogar Morellet ärgerlich wurde.«
Gegen die beiden Verri, die ihm nicht nur sehr nahe standen, sondern ihn auch in der Arbeit voll Bewunderung eifrig unterstützten (Alessandro Verri stellte sogar seine einzelnen Notizen zusammen, auch gab er ihm die Anregung zu seinem Werke » Delitto e Pene«), benahm er sich geradezu unsinnig, nicht nur hinsichtlich seines Respektmangels, den man vielleicht auf Rechnung seiner Zerstreutheit setzen könnte, sondern gegen Pietro Berri, der ihn doch auf seinen Reisen begleitet und ihn stets zur weiteren Arbeit ermutigt hatte, zeigte er sich, wie es scheint, sogar eifersüchtig und nicht wohlwollend.
Morellet sagt: »als er bemerkte, daß sein persönlich sehr einnehmender und geistreicher Gefährte mehr Eindruck machte als er selbst, wurde er so ärgerlich, daß er gegen Ende des Pariser Aufenthalts das Hotel nicht mehr verlassen wollte, wo ich ihn mit meinem Bruder lange Gesellschaft leistete, ohne daß es uns gelungen wäre, ihn zu beruhigen. Er reiste dann ab und mein Vetter in Lyon nahm ihn auf und brachte ihn nach Pont-Beauvoisin, in nicht geringer Besorgnis, er könne unversehens geistig erkranken« ( Mémoires de Morellet, Bd. 1, S. 168).
Er muß mit Verri sehr unglimpflich umgesprungen sein, nach der Art und Weise zu urteilen, wie dieser sich darüber äußert, z. B. folgendermaßen: »wir können nicht mehr zusammen auskommen. Er wiederholt mir dies alle Tage mehreremal und ich finde, daß er ganz recht hat. Ich kann nicht mehr. Ich hege hohe Achtung und Freundschaft für ihn, beides gewiß mit guten Gründen. Er soll seine Bücher schreiben und ich werde ihn bewundern, Man vergleiche hiermit, was Georges Sand von den bedeutenden Männern gesagt hat: »Die großen Männer habe ich gründlich satt (» j'en ai plein le dos«), sie sollen ihre Bücher schreiben und mich zufrieden lassen.« aber ich werde immer einen großen Unterschied zwischen dem Autor und seinem Werk machen.«
»Vorgestern abend hat er mich bei der Heimkehr aus dem Theater hart angelassen, weil ich nach Hause gehen und ihn nicht mehr in eine öde Gesellschaft begleiten wollte, so unsinnig hart, als wenn ich ein widerspenstiges Haustier wäre, und ich sage euch, nur meine Besonnenheit hielt mich ab, ihm zu zeigen, wie unrecht er hatte, mich durch seine betrunkene und unsinnige Dummheit zu beleidigen.«
»Ich hätte aus dem Wagen springen mögen vor Verzweiflung, der fünfzigste Teil hätte bei einem anderen genügt, ich will nicht sagen, mich mit ihm zu schlagen, aber um ihn mit der Faust zurechtzuweisen.« –
Verri, dem Beccaria wie ein merkwürdiges Rätsel vorkam, hat verschiedene Male versucht ihn zu schildern und auf sein inneres Wesen eigentümliche Schlaglichter geworfen.
»Ich glaube nicht, daß er bei seinem Charakter sich eine große Verfehlung zuschulden kommen läßt, denn Kinder tun dergleichen nicht. Aber was Furcht, Undankbarkeit und literarische Eifersucht versündigen können, alles das würde mich von seiner Seite nicht in Erstaunen setzen.
»Was mir an diesem verschrobenen Menschen immer abscheulich gewesen ist, das ist, kann ich wohl sagen, seine Torheit im Verein mit einer sinnlosen Herzlosigkeit, er ist zerstreut bis zur äußersten Undankbarkeit, er sieht alles nur für sich, seine Selbstsucht macht ihn als Freund wertlos, ich glaube, er ist im Herzen habsüchtig und mitleidslos, wiewohl er ein ganz anderer Mensch zu sein scheint, wenn er schreibt! Mir ist der Kampf, den er gegen allen fremden Geist und gegen den Geist seiner ihn selbst so schätzenden Freunde führt, zuwider, auch der Firnis von Bonhomie, der die großen Flecken seines Herzens überzieht.«
Und, was schlimmer ist, er war nicht nur gegen seine bedeutenden Freunde, gegenüber denen seine Eifersucht und Ungerechtigkeit sich noch erklären ließe, sondern auch gegen die Schwachen schonungslos, und er zeigte sich so förmlich von einer ethisch defekten Seite.
»Er ist drakonisch gegen seine Diener, benutzt alle Gelegenheiten, um die Wehrlosen zu verletzen, wie der arme Teufel von Krüppel, der im Theater hausiert, und der arme Padella dei Bosinari bezeugen können, um nur zwei anzuführen, gegenüber denen er sich zu wilden Zornesausbrüchen hinreißen ließ.« (P. Verri, Briefe, Bd. II, S. 150.)
Sein Biograph Lo Monaco schreibt in seiner » Vita di Beccaria«:
»Seine Menschenliebe, die sich über das gesamte Menschengeschlecht ausgedehnt hatte, verlor, was sie an Breite gewonnen hatte, in der Tiefe. Als einst einer seiner Diener einen Diebstahl begangen hatte, verklagte er ihn nicht nur, sondern bat sogar, man möchte die (in der Theorie von ihm so sehr bekämpfte) Tortur in Anwendung bringen, um ihn zum Geständnis zu bringen.«
Das neuropathische Bild, das Beccaria bietet, wird von Lo Monaco ergänzt, der ihn als so habsüchtig schildert, daß er über seinen materiellen Interessen Vater und Bruder vergaß. Während er energisch war im Verteidigen der Sache des Menschengeschlechts im allgemeinen, war er furchtsam in seinen eignen vier Wänden; in der Jugend von strengem Lebenswandel, war er im Alter vergnügungssüchtig und besonders ein Feinschmecker geworden, wie ein Sybarit; schreiben konnte er vortrefflich, dagegen mangelte ihm die Rede.
Eine merkwürdige Ähnlichkeit mit Leopardi zeigt er hinsichtlich seines Trübsinns, seiner Weichlichkeit, namentlich der Neigung zur Feinschmeckerei, in seiner Undankbarkeit gegen seine Freunde, auch durch andere Züge.
Arbeitsweise. Zeigte Beccaria als Kind eine langsame Entwicklung der Intelligenz, so ließ er mit fünfundzwanzig Jahren das Genie bereits erkennen. Verri sagt von ihm, daß »Phantasie und glänzendes Begriffsvermögen im Verein mit einer außerordentlichen Seelenkenntnis ihm zu seltenen Verdiensten verhalfen.«
»Er kombiniert tief und ist ein guter Dichter, ein Kopf, geeignet neue Wege zu eröffnen. Wenn nur Trägheit und Kleinlichkeit ihn nicht lähmen« (P. Verris Brief vom 6. April 1762, Bd. I, S. 153).
Unter Verris Leitung begann er auch zuerst zu schreiben.
Es scheint, daß er auch beim Schreiben und Denken stoßweise arbeitete, daß die Gedanken bei ihm plötzlich kamen und gingen.
»Er strengt sich beim Schreiben so an, daß er sich nach einer Stunde hinlegen muß und sich nicht mehr rühren kann.«
Es scheint auch, daß er keinem festen Plan bei seinen Entwicklungen folgte, sondern alles so durcheinander niederwarf, wie es ihm einfiel.
»Er schrieb,« sagt Verri, »die einzelnen Gedanken auf Papierblätter, die er dann sammelte und untereinander in Verbindung brachte.«
»Er langweilte sich und andere, und deshalb gab ich ihm das Thema ›Verbrechen und Strafe‹.«
Verri gibt auch einen eingehenden Kommentar zu dieser seiner Idee.
Beccaria schrieb, ebenso wie auch Leopardi, nicht, wie er eigentlich dachte, sondern das, was ihm die Erregung eingab, wie wenn er Güte und Wohlwollen wirklich im Herzen hätte, aber »alles das geht ihm völlig ab,« fährt Verri fort, »daß er, wenn er etwas geschrieben hat, eine halbe Stunde verstreichen lassen muß und dann überwältigt von der Anstrengung und angegriffen und schlaff in seine gewöhnliche Verfassung zurücksinkt.«
Verri zeigt sich hier als kein guter Beobachter, denn er bringt zwei Dinge durcheinander, die nichts miteinander zu tun haben. Es geht aber aus der Schilderung deutlich hervor, daß die Produktion Beccaria Schwierigkeiten machte, und daß sie als Inspiration in einer Art zweiten Zustandes, der von seinem gewöhnlichen sehr verschieden war, vor sich ging. Verri selbst hat treffend von ihm gesagt: »Das Dichten ist ihm angeboren, das Logische findet er dann beim Ausdrucke.« Er schrieb also wohl auch seine Werke, wie wenn einer dichtet.
Dieser zweite Zustand, in den manche Genies im Augenblicke der Inspiration verfallen und aus dem sie, nachdem er vorüber ist, zur Norm oder sogar unter die Norm zurückkehren, wie dies bei Beccaria der Fall war, der von der Höhe einer der größten Synthetiker seiner Zeit zur Kindlichkeit sozusagen herabschritt, ist dasjenige, was die schärfsten Beobachter, wie eben auch Verri, in Verlegenheit setzen konnte, da sie nichts von dem epileptischen Einschläge des Genies wußten. Sie konnten sich die Vereinigung des Genies mit dem auch der Kindheit eigenen psychischen Komplex von Angstzuständen und Zwängen nicht erklären, der eben einen Charakterdefekt bedeutet.
»Manchmal hat er einfach geniale Züge an sich, die mir gefallen,« sagt Verri von ihm (Briefe, Bd. II, S. 26), »aber einen Augenblick darauf zeigt er wieder eines der anderen Gesichter und macht mir die ganze Freundschaft zuwider, die er mir eben eingeflößt hatte.« Verri begriff eben nicht, daß diese Mängel, die Schwächen seiner Organisation die Kompensation der Genialität darstellen und daß ohne jene auch diese nicht hätte existieren können.
Das Genie des Beccaria. – Daß Beccaria ein Genie war, ist nicht notwendig zu erweisen, er hat nicht nur auf die strafrechtlichen Fragen ein helles neues Licht geworfen, sondern auch besonders auf das Münz-, Handelswesen usw. (vgl. auch hierzu die auf S. 45 angeführte Stelle aus Verri).
Zu einer Zeit, da niemand etwas Schlimmes davon befürchtete, bekämpfte er schon das Lottospiel: er kommt nie zur Ziehung, trotzdem er persönlich amtlich dazu verpflichtet ist. Er erfand ein System von Gewichten und Maßen, das auf kosmische Größen zurückging, so wie es später auch eingeführt wurde.
Zweifellos haben wir hier ein echtes Genie vor uns, aber gleichzeitig einen an Halluzinationen leidenden Hysteroepileptiker, der Gefühlsdefekte, Infantilismen und selbst leichte Intelligenzstörungen aufwies.
Über diesen außerordentlichen Geist sind zahllose Abhandlungen und kritische Darstellungen geschrieben worden, aber mit Ausnahme einiger Stellen bei Magalhaes und Corradi ist niemand etwas von der Psychopathie des Dichters gewahr geworden. In den letzten Jahren hat sich indes Patrizi, N. L. Patrizi, Saggio psico-antropologico su G. Leopardi e la sua famiglia. Turin, 1896. Professor der Physiologie in Modena, der aus demselben Orte gebürtig ist wie Leopardi (Recanati) und der merkwürdigerweise nicht nur Physiologe, sondern gleichzeitig auch ein ausgezeichneter Literaturkenner und tiefer Denker ist, mit Leopardi beschäftigt, indem er genau die entgegengesetzte Methode eingeschlagen hat als die sonstigen Biographen und Kritiker, ihn als psychiatrischen Gegenstand betrachtend und neue Forschungsergebnisse, besonders die Mitteilungen der Landsleute und die Prüfung seiner Urschriften zur Analyse herbeiziehend.
Bei der Nachforschung über den Stammbaum des Dichters hat Patrizi bis zum Jahre 1500 zurückgehen können. Er ermittelte dabei, daß bei den Vorfahren Leopardis Heilige und Kriminelle, Irre und Geniale sich vorfinden. In der Stammtafel seines Vaters treten seit dem sechzehnten Jahrhundert religiös Irre auf (Piernicolò 1591, Paolo 1586, Francesco 1686, Paolo 1731, Carlo Orazio und Bernardino 1799), fünfzehn Mitglieder der Familie waren einmal gleichzeitig Klosterleute, ferner kam in der Familie vor Selbstmord (Pierleopardo 1614), und Körperverletzung (Piernicolò 1669). Einige zeichneten sich durch geistige Anlagen aus, so Piertoinmaso 1419, ein gelehrter Kriegsmann, Pierleopardo, ein vielleicht graphomanischer Schöngeist, Monaldo usw. Von den Vorfahren der Mutter bemerke man Auticì, einen Landesverräter (1349) und Giacomo und Pietro, seine Neffen, zwei Spitzbuben (1468), desgleichen Pietro Antonio, seinen Urenkel, und Nicola (1850).
Wir begegnen also hier im ganzen keinen Ehrenmännern, und zwischen diese Typen von Delinquenz oder Halbdelinquenz schieben sich wieder äußerst bizarre und merkwürdig habsüchtige Charaktere. Die Genialität ist im ganzen bei den Vorfahren Giacomo Leopardis spärlich vertreten, insofern, wie Renier ganz richtig bemerkt, manche geistliche Herren, die zu einer Zeit dichteten, in der das Versemachen beinahe von jeder Respektsperson verlangt wurde, und einige Kanzelredner oder Provinzdutzendliteralen diese Bezeichnung nicht genügend rechtfertigen dürften.
Die Familienabnormität aber ist nicht wegzuleugnen, denn unter den 120 Familiengliedern, von denen man weiß, finden sich 66 anormale und nur 54 normale.
Monaldo, Giacomos Vater, liebte besonders diesen Sohn, auf den er sehr stolz war. Er war aber ein Zweiseelenmensch, in ihm kämpfte der fanatische starre Reaktionär mit dem Vatergefühl. Bekam der erstere das Übergewicht, so hatte man einen bis zur Roheit unduldsamen Mann vor sich, er konnte dann, trotzdem er sonst gleichgültiger, willensschwacher, selbst ängstlicher Gemütsart war, wie seine Unterordnung unter seine Frau beweist, heftig und maßlos werden. Im übrigen besaß er eine hohe Bildung, war aber nicht fähig, sie zu übersehen. Er schrieb viel und unbedeutend, für Naturschönheiten hatte er wenig Sinn, ebenso für die Kunst, für Musik hatte er gar kein Verständnis.
Der Dualismus des Vaters und Reaktionärs ist nicht der einzige, den man bei ihm antrifft, die psychische Antithese geht bei ihm noch weiter. Fromm bis zur Bigotterie glaubt er dennoch nicht an die Überführung des heiligen Hauses in Loreto, und trotz seines Klerikalismus konnte er gegen den Papst in Zorn ausbrechen. Im Leben zeigte er sich bald mildtätig bis zur Aufopferung, bald geizig und schonungslos, das eine Mal ist er sehr empfindlich in seinem Ehrenpunkte, dann wieder ist ihm sein Wort gleichgültig und selbst Schlimmeres fiel vor. Im ganzen bietet er also das Bild eines Neuropathen mit wunderlichen und widerspruchsvollen Zügen.
Dagegen ist der Charakter Adelaide Antici Leopardis wie aus einem Stück gearbeitet, eisenhart wie der ihrer Vorfahren. Sie ist ein Mannweib: streng, ernst, verschlossen, prosaisch, unwissend, ohne Bildungsdrang, gedankenlos, religiös in starrer, unangenehmer Weise, ungroßmütig, habsüchtig über alles Maß. Sie sucht dem geschmälerten väterlichen Erbe durch rücksichtsloses Knausern wieder aufzuhelfen, ohne zu bemerken, daß die Familie darunter leidet. Sie liebt die Ihren nicht, ist hartherzig. Von ihren zwölf Kindern ist außer Giacomo nur noch Carlo gut begabt, wie dieser aber pessimistischer Gemütsart, dabei sehr geizig, apathisch, skeptisch, träge, voll Oppositionsgeist. Ihre Tochter Paolina ist zwar auch intelligent, aber wunderlich und geizig, und verwachsen. Es ist deshalb leicht erklärlich, wenn die bei den Irren und Kriminellen so häufigen Entartungszeichen bei dem Dichter so zahlreich vertreten waren. Patrizi gibt eine Aufzählung derselben:
»Er besaß eine vorstehende Mundpartie, Asymmetrie des Gesichts, Bartmangel, greisenhaften Gesichtsausdruck, dünne Lippen, sein Ohrläppchen war angewachsen.« Sexuell war er ein Schwächling und überempfindlich. – Seelisch zeigte er außergewöhnlich hohe Erreglichkeit des Gemüts, besonders nach der ästhetischen Seite neben ethischer und Gemütsabstumpfung, einseitigen Idealismus in der Liebe, kindlichmorbose Religiosität, Willensschwäche, Impulsivität, Selbstmordneigung, Abneigung gegen das Neue und gegen Gesellschaft, krankhafte Zweifel, Frühreife, übertriebenes Selbstgefühl, Idiosynkrasien, Neigung zur Ortsveränderung, ängstliche Zwänge, Verfolgungsideen, große Ablenkbarkeit, Wunderlichkeiten; am meisten quälte ihn auch besonders die Zweifelsucht, die seinen Großvater ebenfalls heimgesucht hatte und an der auch einer seiner Brüder litt.
Der Hang zum Zweifel zeigte sich bei den: Dichter das ganze Leben hindurch. Sein Oheim mütterlicherseits, der ihn in Rom bei sich aufnahm, bemerkte an ihm außerordentliche Furcht vor Krankheiten, und Ranieri erzählt von ihm, daß er aus Furcht vor Erkältung auf der Reise immer auf Schließung der Wagenfenster bestand und sich das Öffnen energisch verbat. Vor der Cholera hatte er eine solche Angst, daß in seiner Gegenwart niemand davon zu sprechen wagte.
Ranieri mußte sich bei seiner Heimkehr in seine eigne Villa in Neapel seinem Gaste zu Gefallen ungezählte Male desinfizieren. Wenn der Arzt sagte, er esse zuviel Fleisch oder die Fleischbrühe sei zu stark, so wollte Leopardi gar kein Fleisch mehr zu sich nehmen und nährte sich nur noch von Fischen und Gemüse; hieß es dagegen, Fleisch sei auch nötig, so nahm er wieder unverhältnismäßige Mengen Fleisch und die stärkste Bouillon zu sich. Sagte der Arzt, das Zimmer habe zuwenig Licht, so öffnete Leopardi das Fenster und hielt den bloßen Kopf in die Sonne. Wurde ihm bedeutet, daß mit der Empfehlung eines hellen Zimmers nicht das Herausstrecken des Kopfes aus dem Fenster in die heiße Sonne gemeint sei, so schloß er wieder alles ab und kehrte in sein tiefes Dunkel zurück.
Die Zweifelsucht war nicht die einzige nervöse Erscheinung, infolge deren er sich so exzentrisch zeigte. Er schrieb einst an seine Schwester (8. Februar 1830), daß sie laut auflachen würde, wenn er ihr sein Leben erzählen wollte, und die Mutter warnte er vor der Rückkehr eines Sohnes, der durch seine wunderlichen Lebensgewohnheiten die Familie so sehr inkommodieren müsse.
Dieses Zugeständnis und der an seinen Vater gesandte Bericht Gatteschis über die Extravaganz des Dichters in Florenz bestätigen die Angaben Ranieris, wie sehr man sie auch zu widerlegen gesucht hat. Eine seiner unangenehmsten Gewohnheiten war seine geradezu schreckliche Zeiteinteilung: beinahe sein ganzes Leben hindurch machte er die Nacht zum Tage und umgekehrt, und wo er sich einmal aufgehalten hatte, hinterließ er unerbauliche Erinnerungen hieran.
Mehreremal hatte er in den in Bologna verlebten Wintern den sonderbaren Einfall, der seinen Bekannten lange in der Erinnerung blieb, stundenlang in einen Sack mit Federn zu kriechen, den er dann wie in einem Pelze verließ, so daß er wie ein Waldmensch aussah. Seine Heimat verfolgte er mit einem Ingrimme, wie es niemand hätte in höherem Grade tun können, er haßte sie nicht in der Art anderer Denker, die von ihren Landsleuten nicht verstanden werden, sondern weil er überall Verfolger und Verkleinerer seiner Person sah, die nirgends existierten.
Die Liebe zum Weibe hätte bei dem Dichter stark sein können, blieb aber Abstraktion. Bei der Berührung mit der Wirklichkeit verflüchtigte sich das Gefühl. Das schützte ihn nicht vor wirklichen Leidenschaften, wie für Gertrude Lazzari, für die Targioni-Tozzetti (Aspasia), die Malvezzi, doch hinterließen diese überirdischen Gluten in Leopardis Geiste ein bitteres, feindliches Gefühl.
Die einseitige idealistische Beschaffenheit dieser Liebe hat nach Patrizi drei Ursachen gehabt: eine organische, die frühzeitige Impotenz, eine gefühlsmäßige, nämlich die Empfindung seiner psychischen Häßlichkeit und damit verbunden die Vorstellung des mangelnden Erfolgs (verletzten Stolzes, deshalb Mißachtung des Weibes, eine der Hauptursachen der Frauenfeindlichkeit mancher Geister), und eine mehr intellektuelle, nämlich das absolut Idealistische des Begriffs, den sich Leopardi vom Weibe gebildet hatte.
In seinem sonstigen Gefühlsleben war der Dichter unzugänglich. Er liebte weder Vater noch Mutter, wiewohl er sich bemühte, liebevoll zu scheinen.
Ohne Affekt war er auch gegen die andern Verwandten, ausgenommen die Brüder, mit denen er sich gut vertrug. Er hatte kaum das Gefühl der Dankbarkeit, auch gegen seine größten Wohltäter; Giordani beklagte sich bitter darüber, ebenso Ranieri, dessen » Sodalizio con Giacomo Leopardi« ohne Zweifel im Grunde wahr, wenn auch nicht vornehm ersonnen ist und fast den Wert einer Anklageschrift gegen Leopardi besitzt. Seine Feindschaft und Geringschätzung der Recanatesen und für Recanati überschritt jede zulässige Grenze und war ebenfalls sehr wenig edel, wie Patrizi bemerkt hat. Und wie jede natürliche Regung für sein Heimatland an den Widerständen seines feindseligen und trübsinnigen Naturells zerschellte, so ging auch die Liebe zu Italien ihrerseits im Skeptizismus und Pessimismus, im großen Hasse gegen alles zugrunde. Das Gefühl für Pietät mangelte bei Leopardi fast ganz.
Aus dem Briefwechsel und den Gedichten ersieht man an manchen Stellen seine Reizbarkeit, die ihn dazu brachte, mit dem Kopfe gegen die Wand zu rennen, sich auf die Erde zu werfen, zu schreien und zu stöhnen (An Giordani, 23. April 1820).
Seine Korrespondenz ist im ganzen unruhig und aufgeregt gehalten. Wenn er als junger Mensch im Vaterhause die oberflächliche und heitere Unterhaltung der anderen im Nebenzimmer hörte, brach er zuweilen in hellen Zorn aus, in welchem er sich dann unter unartikulierten Lauten in einen dunkeln Winkel zurückzuziehen pflegte.
Wenn er in Gedanken im Bibliothekzimmer einherschritt, sah und hörte er nicht, wenn er gerufen wurde. Bei Tisch schien er nichts von dem, was um ihn her vorging, zu gewahren. Dieses merkwürdige Verhalten wird von Leopardi selbst weiter illustriert: »Mein Leben ist einsam und wird es immer sein, auch mitten im Gespräch, in dem ich, englisch gesagt, mehr ›absent‹ bin als ein Blinder oder Tauber. Diese schlechte Eigenschaft der ›Absenz‹ ist bei mir unkorrigierbar und nicht auszurotten. Wer sich für meine in solchen Zuständen angerichteten Dummheiten interessiert, mag Giordani fragen.«
Das ist sehr wichtig, wenn man davon ausgeht, daß die »Absenz« ein epileptoides Zeichen ist, was nach meinen letzten Untersuchungen sogar dem Genie mit zugrunde liegt. (S. L'uomo di Genio, 6. Aufl. Tl. III.)
In seinen gesamten Schriften wird der Selbstmord verherrlicht. Eine seiner wichtigsten philosophischen Interessen ist, nachzuweisen, daß infolge der durch die Zivilisation in dem ursprünglichen Menschen gesetzten Veränderungen der Selbstmord nicht mehr wie in vergangenen Zeiten als widernatürlicher Akt angesehen werden kann. Den Beweis, daß Leopardi beständig die Idee des Selbstmords erwog, hat Patrizi erbracht, der Stellen aus seinen Schriften und Briefen zusammengestellt hat, in denen er hierzu inspirierte oder sich sonst darüber ausspricht.
1817 war er nahe daran, sich aus Liebesgram zu töten (Brief an Melchiorri, 19. Dez. 1823). Er hatte lange Zeit vor, sich im Teiche des Gartens zu ertränken (Ricordanze, 104-109). 1819 droht er, binnen kurzem »sein Leben wegzuwerfen« (Brief an Giordani, 29. Juli 1819). Auch in der »Vita solitaria« (1819) finden sich Anspielungen auf den Selbstmord.
1821-22 besingt er den Selbstmord im »
Bruto minore« und im letzten Liede Sapphos. 1824 finden sich wiederholte Auslassungen über den Selbstmord in der »
Storia del genere umano«, in der »
Scomparsa di Prometeo«, im »
Dialoge di un fisico e di un metafisico«.
1826 Anspielung auf den Selbstmord in »Epistola a l'epoli«.
1827 verfaßt er den Exkurs über den Selbstmord im »Dialoge di Plotino e Porfirio«.
1828: »Ich habe große Lust, ein für allemal dieses große Elend zu enden und mich noch vollkommener zu immobilisieren, denn wahrhaftig, manchmal wird der Widerwille in mir allzu mächtig, aber ihr braucht nichts zu fürchten, denn ich werde wohl die Geduld finden, dieses fluchwürdige Leben zu Ende zu führen.« (Brief an Adelaide Maestri, 24. Juni 1828.)
1831: »Das abscheuliche und unwirtliche Recanati erwartet mich, wenn ich nicht den Mut finde, den einzigen vernünftigen Entschluß zu fassen, der mir bleibt –« (Brief an De Sinner, 24. Dez. 1831). (Aus
Amore e Marte, 1831-33.)
Hatte er auch nicht, wie andere Apostel des Pessimismus, den Mut, sein Vorhaben auszuführen, so lag dies vorwiegend an seiner Willensschwäche. »Die ängstlichen und von Leiden gequälten Gemüter sind weniger geneigt, die Hand an sich selbst zu legen,« sagt er in der » Storia del genere umano«, zum Zeugnis der dem Schwermütigen eigenen Willensschwäche.
Ein weiteres pathologisches Zeichen ist der merkwürdige und vollständige Gegensatz seiner Handlungen. Wer würde nicht aus seinen Gedichten die Ansicht gewinnen, er sei der romantischste und philanthropischste Mensch auf der Welt?
Aus dem Briefwechsel erhellt indes seine Gemütskälte gegen Eltern und Heimat, aus den Schriften Ranieris ( Sette anni di sodalizio, 1870) erfährt man, wie undankbar er gegen seine Freunde war. Beständig wollte er sterben und dabei medizinierte er übermäßig und übertrieb jedes ärztliche Regime. Niemand haßte mehr als er den Landaufenthalt, trotzdem er ihn im Liede so sehr verherrlicht hatte. Kaum war er aufs Land gekommen, so wollte er schon wieder abreisen und selten blieb er einen ganzen Tag.
Mißtrauisch war er gegen jeden, und einmal hatte er sogar den Verdacht, man habe ihm eine Schachtel weggenommen, in der er seine gebrauchten Kämme aufbewahrte.
Über seine Sinnesempfindungen in Beziehung zur künstlerischen Produktion hat Patrizi sich in interessanter Weise geäußert.
Der Geruch war sehr fein, wie aus elf Stellen in seinen Werken hervorgeht, von Geschmacksempfindungen scheint nur diejenige des Süßen bei ihm bemerkenswert gewesen zu sein.
Rücksichtlich der Gesichtsempfindung ermittelte Patrizi eine geringe Intensität; in den Schilderungen des Dichters kommt die Farbe schlecht weg. Nur einmal wird Violett genannt, 9mal Blau, 17mal Grün, 9mal Gelb, 34mal Rot, 66mal werden gemischte und gedämpfte Nuancen erwähnt.
»Mehr als Maler und Plastiker war Leopardi Musiker in seiner Poesie. Er hörte mehr von der Natur, als er darin sah« (Patrizi, l. c.). Gleichwohl dient ihm auch der Ton nur zur Begleitung bei der Aufrollung seines philosophischen Gedankens. Leopardis Ästhetik geht nicht auf Beschreibung der Dinge, die er hört und sieht, sondern vorwiegend auf die Meditation. Man könnte sagen, es sei zentrale Poesie, nicht periphere, in höherem Grade Leistung der höheren Nervenzentren, als der äußeren Nervenendigungen und ihrer Tätigkeit. Als Dichter und Philosoph hallst er in seiner Idee des Weltschmerzes wie in einer Klause, die er nie verläßt und ohne nach den Dingen draußen zu blicken.
Aus diesem Verhalten ergeben sich die beiden wichtigen Merkmale der Leopardischen Kunst, die schon vielfach besprochen worden sind, die aber erst Patrizi mit der Psychopathie und dem dürftigen Gefühlsleben des Dichters in Verbindung gebracht hat: die große Einförmigkeit, in der acht oder neun Grundgedanken die gesamte Leopardische Dichtung und Prosa erfüllen, und sein schrankenloser Subjektivismus, sein sich in alles hineindrängendes Ich.
Die Selbsteinschätzung war, wie es bei so vielen Genies der Fall ist, bei Leopardi grenzenlos. (S. Appressamento delle morte, Canto V.) Angesichts dieser mußte ihm sein Geschick um so karger erscheinen und dies mußte wieder zum Pessimismus führen.
»Nie verschwindet in seinen Versen die Note der Verzweiflung und der Feindseligkeit,« bemerkt sein Biograph, »und unter dieser grollt der Stolz und pfeift der Hohn. Die Schönheit ist ihm langweilig, und die Ewigkeit der Natur erschreckt ihn.«
In dem berühmt gewordenen Briefe an seinen Vater vom Juli 1819, kurz vor der geplanten heimlichen Abreise, verglich er sich einem großen Geiste.
»Ich weiß es, man wird mich für irr halten, ebenso wie ich weiß, daß alle großen Männer so genannt worden sind. – Und da die Laufbahn beinahe aller großen Geister mit der Verzweiflung begonnen hat, so werde ich dadurch nicht mutlos, wenn auch die meine so beginnt.«
Er war noch mehr als Vater und Bruder zu gastronomischen Genüssen geneigt, »er aß Konfituren und Eis leidenschaftlich gern,« sagt Ranieri im » Sodalizio«, »ohne jede Vorsicht nahm er unglaubliche Mengen Kaffee, Kaffeesirup, Limonaden, Limonadensirup, Eis, Schokolade zu sich.« Besonders Eis war seine Leidenschaft. Sein Verlangen danach war so stark, daß im Café an den Nebentischen über ihn gelacht wurde. In Florenz hatte er sich wieder einmal in den Kopf gesetzt, daß ihm Fleisch nicht zuträglich sei, und er wollte deshalb nichts anderes mehr essen als gebratene Apfel, und an einem Tage (13. Juni), zwei Jahre vor seinem Tode, verzehrte er nach Mitternacht in wenigen Stunden etwa ein Kilogramm Konfekt und beim Essen zugleich mit der Suppe eine große Menge Eis.
Sein Krankheitsbild vervollständigt sich durch sein Bedürfnis nach häufiger Ortsveränderung. Er war beständig unterwegs: 1822 in Rom, 1823 in Recanati, 1825 in Mailand, dann in Bologna, 1826 in Recanati, 1827 in Bologna, dann in Florenz und Pisa, 1828 in Recanati, 1830 in Florenz, 1831 in Rom, 1832 wieder in Florenz, 1833 in Neapel. Unter jedem Himmel blieb er hochgradig unzufrieden. Selbst in Neapel, wo er gesundheitlich und materiell ohne jede Sorge hätte bleiben können, hatte er keine Ruhe; von dort schrieb er an De Sinner, daß er sein Leben in Paris beschließen wolle.
Wenn man Leopardis Leben verfolgt, so ist leicht zu beobachten, mit welcher Zähigkeit sein Kopf an der einmal aufgenommenen Idee festhielt, ein Zug, der ihm zur Quelle großen Ungemachs wurde.
»Das andere,« schreibt er an Giordani (28. Ang. 1817), »das mich unglücklich macht, ist der Gedanke. Ich glaube wohl, daß Ihr es wißt, aber hoffentlich nicht erfahren habt, wie der Gedanke jemanden martern kann, der im wesentlichen andere Ideen hat als andere, wie sehr er ihn im Banne hält, namentlich dann, wenn der Betreffende keine Ablenkung oder Zerstreuung hat, als eben das Studium, welches, indem es seinen Geist ununterbrochen in Fesseln hält, ihm mehr schadet als nützt. Mir verursacht der Gedanke zu jeder Zeit solche Qual, denn er läßt mich niemals los, er hat mir schon geschadet und er wird mich ins Grab bringen, wenn es nicht anders mit mir wird – Der Gedanke ist immer mein Todfeind gewesen, er wird mich vernichten, wenn ich mich nicht von ihm freimachen kann –«
Seine Lyrik ging wie Blüte und Frucht an warmen Frühlings- und Herbsttagen auf, oder auch zur heißen Sommerszeit, was, wie ich nachgewiesen habe, sehr häufig bei den Genies und den Irren der Fall ist (»Der geniale Mensch«, Teil II).
Seine dichterische Begeisterung regte sich jedes Frühjahr, sie übersprang den Winter, fast als wenn er die tote Jahreszeit auch für geistige Produktion wäre.
Aus Patrizis genauen Untersuchungen über die Zeit der Entstehung seiner hauptsächlichen Arbeiten erhellt in der Tat, daß von 48 nur zwei im Winter geschrieben sind, alle anderen im Sommer oder Frühjahr, und die besten in der früheren Zeit. In den ersten Jahren waren Sonnenlicht und Wärme dem Dichter zur Arbeit äußerst erwünscht. Als er nach Rom geht, sorgt er für ein warmes helles Zimmer, und dies legt nahe, daß er hauptsächlich am Tage arbeitete. Wir wissen aber, daß der Dichter später seine Arbeitsweise änderte, und so wurden die Nachtstunden dieser wohl günstiger als der helle Tag. Dieser Wechsel steht vielleicht mit Leopardis Nervenschwäche im Zusammenhang, die mit den Jahren immer größer wurde. Die Gehirntätigkeit mancher Nervenschwacher wird erst nach einer gewissen Häufung äußerer Eindrücke angeregt, und manchmal muß der ganze Tag vergehen, bevor die gedachte Reizschwelle erreicht ist.
»Beim Schreiben,« äußert er sich, »habe ich mich niemals nach etwas anderem gerichtet als nach der Inspiration. Trat diese ein, so konnte ich in zwei Minuten den Plan und die Einteilung des ganzen Werks entwerfen. Ist dies geschehen, so warte ich gewöhnlich auf einen zweiten glücklichen Moment, und sobald sich dieser einstellt (was meist erst nach Verlauf mehrerer Monate der Fall ist), dann setze ich mich hin und arbeite; aber dies geschieht so langsam, daß ich auch ein sehr kurzes Gedicht kaum vor Ablauf von zwei oder drei Wochen abschließen kann. Das ist meine Methode; wenn die Inspiration nicht von selbst eintritt, so könnte eher Wasser aus einem Holzklotz, als ein einziger Vers aus meinem Gehirn herauskommen.«
Diese Arbeitsweise, die Leopardi seine unglückliche Eigentümlichkeit nannte, teilte er mit vielen anderen Genialen. Merkwürdig ist die Übereinstimmung dieser Beschreibung des Dichters des Schmerzes mit derjenigen, die die Sand von der Arbeit des melancholischen Musikers Chopin gegeben hat, dessen seltsame, von selbst eintretende künstlerische Eingebungen, die er nie gesucht oder vorbereitet hatte und die sich am Klavier völlig unvorhergesehen einstellten, eine wochen- und monatelange nachträgliche Überarbeitung im einzelnen erforderten. Das Ausarbeiten verursachte dem Künstler unerhörte Anstrengungen, während deren er sich in seinem Zimmer einschloß, dort hin und her lief, oft weinte und seine Stifte zerbrach (Sand, Histoire de ma vie).
Ich glaube, dies ist genug, um zu zeigen, wie kranksinnig der große Dichter von Recanati gewesen ist. Es ist aber nicht richtig, was übrigens auch für viele andere bedeutende Geister behauptet wird, daß dies alles die Folge seiner Erschöpfung, der großen Abgabe an Energie gewesen ist, die eine so gewaltige Geistestätigkeit allerdings bedingen mußte. Wie unrichtig eine solche Ansicht ist, zeigt Giacomos Bruder Carlo, der nach Patrizi beinahe von gleicher Begabung wie jener, dichterisch auch hochbeanlagt, ebenfalls Pessimist war, auch viele sonstige Eigenheiten des Dichters besaß, sogar eine ähnliche Handschrift wie dieser, und der, weit davon entfernt sich zu überarbeiten, von einer so exemplarischen Trägheit war, daß er wochenlang nicht aus dem Zimmer oder aus dem Hause ging.
Aus Antoninis Antonini, Studio su Alfieri, Turin 1888. trefflicher Monographie über Alfieri entnehme ich einige Daten, die die pathologische Beschaffenheit seines Geistes erweisen.
Alfieris Vater war bei seiner Geburt 59 Jahre alt, ein neuer Beweis, daß Genies, wie auch andere Disäquilibrierte, oft von senilen Vätern stammen (Marro).
Im Alter von sieben Jahren verspürte der große Dichter eine merkwürdige krankhafte Zuneigung für seine Schwester Giulia und für einige Novizen des Klosters, so daß er fortwährend an diese denken mußte, seine Arbeit liegen ließ und anfing, sich mit Selbstmordgedanken zu tragen.
Von Kindesbeinen an zeigte er eine förmliche Unanpaßbarkeit an seine Umgebung, eine übermäßige Empfindlichkeit, weit mehr als andere Kinder. Zur Pubertätszeit unterlag er grundlosen schwermütigen Verstimmungen und Ausbrüchen des Schmerzes.
Früh trat ein großer Hang zur Bewegung bei ihm hervor, und er machte große Touren zu Fuß und zu Pferde.
Von Florenz geht er einst nach Lucca, der eine Tag in Lucca erscheint ihm endlos und er geht deshalb nach Pisa, woselbst es ihn, obgleich ihm der Kirchhof gefällt, ebenfalls nicht hält, so daß er sogleich nach Livorno weitergeht. Von Neapel will er nach Rom, von Venedig nach Genua, und so geht es drei Jahre lang durch Frankreich, England, Spanien usw. zu einer Zeit, wo das Reisen beschwerlich war.
Wie es bei ihm schon in früher Jugend gewesen war, so erging es ihm auch noch später als Achtzehnjährigem in Venedig, daß er tagelang zu Hause zurückgezogen grübelt, schläft, sich in Klagen ergeht, ohne zu wissen warum, und ebenso noch manches Jahr später: »als ich mich etwas besser beobachtete, bemerkte ich, daß dies bei mir ein periodischer Anfall sei, der jedes Jahr im Frühling wiederkehrte, manchmal im April auftrat, manchmal dann wieder bis zum Juni währte,« ein Verhalten, das an epileptische Zustände erinnert. Unter ähnlichen Umständen wollte er einmal einen Selbstmordversuch durch Öffnen der Adern verüben, was aber von seinem Diener Elias verhindert wurde.
Bertana ( Vittorio Alfieri, Turin 1902), der zwar die von Antonini gestellte Diagnose der Epilepsie bezweifelt, veröffentlicht indes einen Brief Alfieris an seine Schwester (20. September 1787), in dem dieser von der Heilung seiner »Galle und Konvulsionen« spricht, die ihn so lange Jahre gequält hätten.
Eine Augenblicksnatur, wie er war, empörte er sich bei jedem Widerstande. War ihm z. B. die Möglichkeit, zu seiner Geliebten nach London zu gehen, abgeschnitten, oder konnte er ihr nicht schreiben, so befiel ihn ein andauernder schwerer Aufregungszustand. Er stürzte dann blindlings auf die Straße. Wenn er sich dann zu Bett gelegt hatte, so wachte er oft plötzlich mit lautem Geschrei auf, lief im Zimmer umher, rannte weg oder ließ ein Pferd satteln oder anspannen; das eine Mal stürzte er bei einer solchen Gelegenheit mit dem Pferde und zog sich eine Verrenkung am Schultergelenk zu.
Seine, epileptoide Haltlosigkeit zeigte sich auch in einer schweren Mißhandlung seines Dieners Elias, der ihm einmal beim Frisieren weh getan hatte.
1773 hatte er einen ausgesprochenen hysterischen oder epileptischen Anfall. Dieser begann mit einem 36 Stunden langen Brechkrampfe, es folgten dann Konvulsionen und schwere Zuckungen an Kopf und Armen, so daß er fünf Tage lang im Bett gehalten werden mußte. Vorhergegangen war eine unwürdige Liebesaffäre, über die er großen Zorn und Beschämung empfand.
1786, nach seinem dritten Gichtanfall, bemächtigte sich seiner eine geistige Trübung, die ihn drei Monate lang nicht verließ, darauf erfolgte ein anderer epileptoider Anfall, der, wie er selbst sagt, jenem glich, in dem er den Diener verletzte, ein Anfall, bei dem er sein eben vollendetes Drama »Sophonisbe« ins Feuer warf.
Im »Genialen Menschen« habe ich bemerkt, daß viele seiner Stücke wie unter einem anfallartigen epileptoiden Impulse entstanden sind, oft förmliche »Äquivalente«, Ersatzerscheinungen für direkte Krankheitssymptome, darstellen.
»Wenn jemals einer, der Verse hinwirft,« sagt Alfieri selbst, »mit einigem Recht gesagt hat: Est deus in nobis, so kann ich es von mir behaupten in der Art wie ich ›Merope‹ konzipierte, ausarbeitete, in Verse brachte,« und das gleiche gilt für »Saul«, eine Dichtung, in der er alle Begeisterung niederlegte, die ihm beim Lesen der Bibel erwachsen war,
»Als derselbe fand ich mich eines Tages wieder, nachdem ich zwei Jahre lang nicht mehr ans Schreiben gedacht hatte, und faßte den Plan zu drei Tragödien, fast gegen meinen Willen.« Nach der Lektüre der »Alceste« des Euripides, beschloß er, selbst ein eigenes Stück mit gleichem Vorwurf zu schreiben, und legte diese Arbeit »in fieberhafter Aufregung und mit gar mancher Träne« in 21 Tagen nieder. Er sagt bei dieser Gelegenheit weiter: »Man sieht hier die Spontaneität der Dichter, und wie es manchmal geschieht, daß sie das, was sie wollen, nicht können, und das, was sie nicht wollen, doch können und tun. So stark und gebieterisch ist der natürliche Drang des Genius.«
Alfieris Geisteskräfte ließen früh nach, der »Misogallo« ist nach Antonini ganz die Arbeit eines Paranoikers, enthält symbolstrotzende Figuren, ist mit Assonanzen überladen und wimmelt im Text von Wortspielen, Neologismen und dergleichen, z. B. Coco-ptoco-ladro servo-crazia – emiodispsicici, Bildungen, in denen man wohl die Neologismen des Paranoikers erblicken darf.
Nach der ausgezeichneten Monographie von Roncoroni: Genio e Pazzia in Torquato Tasso. Turin 1896.
Wer Tassos Leben nicht kennt und nur aus seinen Hauptwerken, besonders dem »Befreiten Jerusalem« und »Amyntas« über seinen geistigen Zustand urteilen wollte, würde nicht glauben, daß der Dichter im eigentlichen Sinne des Worts ein Geisteskranker gewesen ist. Und dennoch findet man im Irrenhause nur selten eine Form der Geisteskrankheit, die so typisch und dem Krankheitsbilde getreu verläuft, wie den Fall Tassos. Die Belege hierfür sind außerordentlich reichlich. Man sieht, wie von der Pubertätszeit bis zum Lebensende die gleichen Wahnideen in verschiedenfacher Intensität ihn peinigten, dergestalt, daß man eine förmliche ausführliche Krankengeschichte, die wissenschaftlich völlig genügend beglaubigt wäre, daraus herleiten könnte. Es fehlten dabei nur der körperliche Untersuchungs- und der pathologisch-anatomische Befund. Es handelt sich indessen hier um eine Form von Geisteskrankheit, bei welcher bei dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft keinerlei wesentliche Einschränkungen gemacht zu werden brauchen, wenn man die seelische Verfassung des Kranken ins Auge fassen will.
Wäre ein täglich regelmäßig geführtes Journal über die psychopathischen Äußerungen des Zustandes des großen Dichters vorhanden, so würde dieses hauptsächlich an einer außerordentlichen Monotonie leiden. Bekanntlich sind die Wahngebilde vieler Irren nicht sehr wechselnd: es handelt sich immer um die gleichen Verfolgungsideen, die gleichen Vergiftungen, die gleichen Dämonen, die gleichen Größenideen, die mit geringen individuellen Schattierungen in den einzelnen Fällen wiederkehren. Hierin macht Tasso keine Ausnahme von seinen Unglücksgefährten.
Über Tassos Familie, die einem freien lombardischen – mailändischen – Geschlecht entstammt, weiß man sehr wenig; sie soll sich um Vervollkommnung des Postdienstes verdient gemacht haben. Der Vater, Bernardo Tasso, hatte das gleiche Ideal wie sein Sohn Torquato, »der vollkommenste Hofmann zu sein«, und denselben eitlen Egoismus. Als seine Tochter Cornelia die Bewerbung eines sehr braven, aber nicht adligen Mannes annahm, schreibt er: »Ich hoffe zu Gott, daß sie das einst bereut, und ich bin sicher, daß sie noch oft darüber Tränen vergießen und erkennen wird, wie schwer der väterliche Unsegen lastet.«
Auch in den ekstatischen Zuständen und Stimmungen, dem Rededrang, der Wehleidigkeit, der Entschlußlosigkeit, der trüben Grundstimmung, glichen sich Vater und Sohn. Auch Bernardo verherrlichte mit Vorliebe sein Fürstenhaus im Liede und hatte sich als dichterisches Vorbild Ariost (Torquato dagegen Homer) gewählt.
Wer mit Marro annimmt, daß das höhere Alter die Geburt von Degenerierten begünstigt, besonders von Melancholikern und ethisch Defekten, wird es bemerkenswert finden, daß Bernardo Tasso mit 43 Jahren geheiratet und erst in vorgerücktem Alter den großen Torquato erzeugt hat.
Wenn auch über des Dichters Vorfahren nichts weiter bekannt geworden ist, so weiß man indes über Tassos Persönliches genug und übergenug.
Es ist schon hinreichend, daß er dreißig Bände Prosa, Dichtung und Briefe hinterlassen bat, aus denen Solerti eine der gehaltvollsten Arbeiten unserer Literatur geschöpft hat.
So konnte Roncoroni, wenn er auch selbst diese Quellen nochmals studiert hat, doch leichter zur psychiatrischen und psychologischen Diagnose gelangen. Sobald als das Beiwerk entfernt war, ersah man, daß verschiedene Formen von Psychosen bei Tasso seit Kindesbeinen nebeneinander existierten: Paranoia, Verfolgungsideen, Größenideen, Zwangsimpulse, Epilepsie, untrennbar mit den genialen Zügen verbunden, dergestalt, daß letztere beinahe daneben verschwanden. »Hier in meinem Gefängnis bin ich ebensowohl von göttlicher Raserei wie vom Toben des Irren befallen worden.« (Brief aus Santa Anna.)
Camillo Ariosto schrieb hierüber an Annibale Ariosto: »Von Neuigkeiten weiß ich nur, daß Tasso in Santa Anna, wie ich schon schrieb, schlecht behandelt und von allen bemitleidet wird. Man weiß aber nicht, was zu tun ist. Abgesehen von diesem seinem Zustande, dichtet er gewöhnlich mit dem ihm eigentümlichen Schwunge, trotzdem manche behaupten, daß in seinen Gedichten etwas wie eine geistige Störung hindurchblickt, worüber ich nicht urteilen will. Zwar möchte ich im Gegenteil sagen, daß, je größer seine Aufregung wird, um so besser seine Verse werden müssen, denn, wenn es wahr ist, daß die Dichtkunst durch die Raserei entsteht, so glaube ich, daß ein Rasender daher besser dichten können muß, um so mehr, als ich in seinen Versen denselben Stil, denselben Geist, dieselben Gedanken zu gewahren glaube« (März 1579).
Vergleicht man die verschiedenen Bilder Tassos, die vorhanden sind, so kann man sagen, daß bei ihm mehr oder weniger folgende Anomalien vorhanden waren: vorstehende Jochbögen, starke Augenbrauenbögen, großer Schädel, große Stirnhöcker, schmale Lippen, frühzeitiger Haarschwund.
An der Schrift gewahrt man eine außerordentliche Menge von Streichungen und eine große Veränderlichkeit. Dieser Wechsel tritt oft rasch ein, meist ist die Schrift klein, manchmal in mehreren Kolumnen angeordnet, schon früh weist sie auf eine zitternde Hand. Die Menge der Schriftwerke ist so groß, daß man alsbald an Graphomanie denken muß.
Tasso war Stammler und körperlich sehr gewandt, er war sehr empfindlich gegen Witterungseinflüsse, seine dichterische Disposition war am größten im April, Mai und August (Renda).
Oft litt er an Kopfweh, er fieberte immer schwer.
Wenn auch Kinder sehr oft launenhaft und eigensinnig sind, so scheint Tasso in dieser Beziehung doch das Maß hierin sehr überschritten zu haben; nahm jemand ihm z. B. eine Frucht weg, so warf er auch alle anderen zornig zu Boden und war nicht zu besänftigen.
Mit acht Jahren bewies er bereits ein reifes Urteil, »denn abgesehen auch von der Gewandtheit seines Geistes, die im Gespräch und beim Fachlichen zutage trat, ferner auch beim schriftlichen Gebrauch von Prosa und Versen, der von dieser Zeit datierte, waren seine Schritte stets ernst und überlegt«. (Manso.)
Nicht nur intellektuell war er früh entwickelt. Manso sagt von ihm: »Die schwere Melancholie Torquatos war ihm von seiner Geburt an durchaus eigen und wurde ihm seitdem zur Gewohnheit. Von vielen glaubwürdigen Zeugen ist verbürgt, daß Torquato in seiner Kindheit niemals heiter, wie sonst die Kinder gewöhnlich sind, ausgesehen habe.«
Aber auch Tassos Gemütsleben ist nicht ohne Schatten. Es sieht in der Tat sehr merkwürdig aus, wie er seine Liebe zur Schwester dartut, als er sie 1577 in Sorrent als Hirt verkleidet aufsucht: »Er gab sich für einen Boten aus,« sagt Manso, »und überreichte ihr einige Briefe, die von ihrem Bruder seien und in denen geschrieben stand, Torquato befinde sich in großer Lebensgefahr, wenn sie in geschwisterlicher Liebe ihm nicht zu Hilfe komme. Seine Schwester war durch diese Nachricht sehr erschrocken und bekümmert, und als sie den angeblichen Boten genauer nach dem Vorgefallenen ausforschte, schilderte Torquato die Gefahr, in der er vorgeblich schwebte, immer eingehender, indem er ihr eine glaubhafte Geschichte erzählte, die er in bewegten Tönen vortrug, so daß seine Schwester davon so erschüttert wurde, daß sie zuletzt in Ohnmacht fiel.«
Das heißt doch, daß Torquato auch hochgradiges Mißtrauen gegen seine Schwester hegte, weshalb er nicht zögerte, sie dieser qualvollen Probe zu unterwerfen.
Auch in der sexuellen Liebe war er nicht beständig. Übrigens ist der Verdacht nicht ungerechtfertigt, daß Tasso an einer sexuellen Perversion gelitten habe, die übrigens zu seiner Zeit gewöhnlich gewesen ist; einige leidenschaftliche Verse deuten darauf hin. S. Roncoroni l. c. Auch sind Anzeichen dafür vorhanden, daß Tasso getrunken hat.
Manso sagt von ihm, daß er ein Todfeind der Tafelgenüsse gewesen sei und »daß ihm die Zeit nie verlorener erschien als bei Tische. Dies gilt aber nicht ebenso vom Trinken, worin er nicht so mäßig war, wie beim Essen, in dem er sich äußerst bescheiden zeigte, während er im Trinken manchem das Maß zu überschreiten schien. Deshalb konnten auch seine Feinde behaupten, er trinke«.
Der Dichter selbst gibt uns einen zweifellosen Beweis für seine Alkoholexzesse in folgenden Briefen:
(An Ascanio Mori): »Heute nacht ist mir sehr unwohl gewesen, ich weiß nicht, ob ich dem Weine oder dem Essen schuld geben soll, oder weil ich zuviel getrunken habe. Selten überschreite ich mein gewöhnliches Maß ein wenig, um die trübe Stimmung zu verscheuchen. In Zukunft will ich mäßiger sein, ich will sehen, daß mir die Mäßigung den Trunk bekömmlicher macht, wie es bei Sokrates der Fall war.«
Aber wie wir bereits gesehen haben, hatte das geistige Leiden bereits von ihm völlig Besitz ergriffen, und nicht nur um ein einziges Leiden handelt es sich hier, sondern es setzen sich, wie es so oft bei den Degenerierten ist, verschiedene Krankheitsformen und deren Äußerungen übereinander.
Betrachten wir zunächst den Verfolgungswahn.
Tasso war schon mit 26 Jahren der Ansicht, daß Kardinal Luigi d'Este gegen ihn weniger freigebig sei als gegen andere; dies war nicht zutreffend, denn seine Stellung war derartig, daß er niemanden am Hofe zu beneiden brauchte, im Gegenteil konnten andere auf ihn, der in jungen Jahren einen so glänzenden Posten erreicht hatte, mißgünstig sein (Solerti.)
Mit 31 Jahren war sein Wahn schon völlig ausgebildet. Scipio Gonzaga versicherte er, daß viele ihm nachstellten, daß man seine Briefe unterschlüge und öffnete, daß Unglück ihn beständig verfolgte. Mit 32 Jahren glaubte er sich so verdächtigt, daß »nicht einmal die Wahrheit ihm geglaubt werde«, und er fing bereits an zu argwöhnen, daß Verrat gegen ihn im Spiele sei. Später eröffnet er Scipio Gonzaga (Ferrara, 11. Juli 1583): »Ich bin nicht nur melancholischer Stimmung, sondern sogar fast irr, oder ich bin zu sehr verfolgt.« Die anderen »behandelten ihn hochmütig und herablassend in jeder Weise« (an Cornelia Tasso, Brief aus Ferrara, 4. Febr. 1581). Der Teufel stiehlt ihm sein Geld, nimmt es ihm im Schlafe weg, öffnet die Schlösser, ohne daß man es sehen könne (an Aeneas Tasso, 10. Nov. 1585, Brief aus St. Anna). »Die Kleider, die mir Pocaterra schickt, sendet er mir immer zur Unzeit und um mir Ärger zu machen.« (An den Verwalter Coccapani.)
An Christofano Tasso schreibt er: »Irrtum und Ahnungslosigkeit ist bei mir derart verbunden, daß keine Buße dort eintreten darf, wo Milde am Platze ist. Und wenn die strenge Vergeltung nicht gestatten würde, daß meine Schuld ungesühnt bliebe, so müßte ich doch hoffen, daß meine Sühne geringer ausfiele als die meiner Widersacher.«
Sinnestäuschungen. – »Ich will Euer Gnaden nur berichten von den Beeinflussungen, denen ich beim Schreiben und beim Studieren unterworfen bin. Diese sind von zweierlei Art: menschliche und teuflische. Die menschlichen bestehen in Schreien von Männern und besonders von Frauen und Kindern, in Hohngelächter, in tierischen Lauten, die nur zum Possen von Menschen ausgestoßen werden, in Geräuschen von allerlei Dingen, die von Menschenhand bewegt werden. Die teuflischen Einflüsse bestehen in Zauber und Hexerei; über den Zauber bin ich nicht ganz sicher, denn die Ratten, von denen es im Zimmer wimmelt und die mir besessen erscheinen, könnten auch durch Teufelskunst das Geräusch hervorbringen, das sie machen, und andere Laute, die ich höre, könnten auch durch menschliche Absicht hervorgebracht sein.«
Zweifelsucht. – Abgesehen von den Sinnestäuschungen bemerkt man bei dem Dichter die Anfänge der Folie du donte; so schreibt er bei Gelegenheit der Erörterung einiger Zwischenfälle seines Lebens: »– ich beichtete und kommunizierte zuzeiten, wie es die römische Kirche vorschreibt, und wenn ich manchmal glaubte, eine Sünde aus Unachtsamkeit ausgelassen zu haben oder aus Scham, wenn ich in einer geringfügigen Kleinigkeit etwa einmal unedel gehandelt hatte, so wiederholte ich die Beichte, und oft legte ich die Generalbeichte meiner Sünden ab, und unter den anderen Zweifeln, die ich hegte, war jener der hauptsächlichste, daß ich nicht zur Klarheit darüber kam, ob ich gläubig sei oder nicht und ob ich losgesprochen werden könnte oder nicht.«
Größenideen. – An Ascanio Mori schreibt der Dichter aus Mantua (1586): »Ich kann nicht in einer Stadt leben, in der die Nobili mir nicht den ersten Platz einräumen oder wo sie nicht dulden wollen, daß ich nicht gleichartig eingeschätzt werde rücksichtlich der äußeren Ehrenbezeigungen. Wenn ich danach gefragt werden sollte, so werde ich gern Antwort hierüber geben.«
Aus Mantua schreibt er an Scipio Gonzaga, daß er fürchtet, sterben oder irrsinnig werden zu müssen: »Ich wundere mich,« fährt er fort, »daß bis jetzt noch nichts von dem verlautet hat, was ich mir hier selbst sagen muß, von den Ehrenbezeigungen, der Gunst, der Gnade und den Geschenken des Kaisers, des Königs, der ersten Fürsten, welche ich mir nach Wunsch und Willen gefügig mache. Wenn es wahr wäre, daß ein jeder seines Glückes Schmied ist, so hätte ich es bis jetzt, wenn auch nicht aus Kalk, Erde, Gold oder Silber, so doch aus Holz machen können, aber es kann nicht wahr sein, denn ich kann auf keine Weise glücklich werden.«
An Antonio Costantini schrieb er aus Florenz am 23. Juli 1590: »Ich wünsche, daß der Herzog von Mantua mir die Gnade erweist, mich zu sich zu laden bei allen öffentlichen oder privaten Gelegenheiten und besonders bei feierlichen Anlässen oder öffentlichen Schauspielen in Florenz und in Rom, wenn seine Hoheit dorthin kommt. Sollte ich inzwischen sterben, so kann er mich durch diese Gunst nicht mehr erfreuen. Ich warte darauf, daß er mir die Gunstbezeigung in diesen Städten zuwendet, und würde mich einen ganzen Monat dortselbst zur Verfügung halten.«
Etwas später (18. August 1590): »Unter meinen vielen Wünschen steht obenan jener: in Ruhe zu leben, dann kommen die anderen: von den Freunden hoch angesehen, von den Dienern eifrig besorgt, von den Vertrauten liebevoll behandelt, den Herrschaften geehrt, den Bedeutenden gefeiert zu werden, und das Jauchzen des Volks zu ernten.«
Die Größenideen währten bei dem Dichter bis zu seinen letzten Lebensjahren. Am Karfreitag 1593 schrieb er aus Rom an Fabio Gonzaga: »Mein lästiges Leiden quält mich wie gewöhnlich, und im Verein mit meiner Armut ist es mir recht schwer zu ertragen, es wird nur durch die Hoffnung gemildert – Den Trost habe ich wenigstens in meinem Leiden, daß ich mir hier Gunstbezeigungen zugewendet sehe, die mir sonst überall vorenthalten worden sind. In der heiligen Woche bin ich oft mit vielen der vornehmsten Kardinale zu Tafel geladen worden, auch hier im Palast, und ich allein mit sehr wenigen Prälaten bin dieser Ehre für würdig gehalten worden. Die gleiche Höflichkeit habe ich bei den fürstlichen Personen dieser Stadt gewahrt, in der ich nur Genügen fühle, wenn ich meinen Ruhm vermehren und fester begründen kann.«
Hypochondrie. – In den Briefen des Dichters finden sich zahlreiche Stellen, die auf hypochondrische Wahnideen Hinweisen.
(An einen Kardinal): »Die Hauptursache meines Zögerns ist meine Kränklichkeit, die mich in allem, was ich tue, lähmt. Ich betrete jeden Tag wie ein Hektiker mein Badezimmer, außer daß ich aber hektisch bin, bin ich auch vielleicht noch wassersüchtig, beides sind alte Leiden. Von der trüben Stimmung will ich gar nicht reden, auch nicht von den Aufregungszuständen, bezüglich deren ich bei dem hohen Respekt für Eure Heiligkeit nur mich selbst anklagen kann, was ich auch häufig in lauten Selbstgesprächen tue. Von Heilmitteln verspüre ich keine günstige Wirkung noch sind mir Besuche irgendwelche Erleichterung; deshalb glaube ich auch, daß der Tod nicht mehr fern ist.«
An den Abbate Christofano Tasso schreibt er aus Ferrara: »Jeden Tag geht es mir schlechter, ich habe mein Gedächtnis in einer Weise verloren, daß ich mich an nichts mehr erinnern kann, was ich gelesen habe.«
Paranoisches Krankheitsbild. – Die Hauptmerkmale der zahlreichen Wahngebilde des Dichters stimmen, wie Roncoroni richtig bemerkt hat, mit dem Bilde der Paranoia überein. Sein Wahn ist systematisiert: die äußeren Eindrücke werden stets mit zur eigenen Persönlichkeit in Beziehung gesetzt, es handelt sich nicht um ein vorübergehendes täglich veränderliches Wahngebilde, sondern um einen seinem inneren Wesen nach konstanten tiefwurzelnden Ideenkomplex, von dem er sich bis zum Lebensende nicht zu befreien vermag, wiewohl dieser häufig das äußere Objekt wechselt, je nach dem Milieu, das den Dichter gerade umgibt. Seine krankhaften Ideen sind überdies egozentrisch: wo er hingeht, verschwört sich alles gegen ihn, alle müssen sich mit ihm beschäftigen, er verlangt beständig große und kleine, selbst lächerlich kleine Bevorzugungen und wird gereizt, wenn man ihm nicht den Gefallen tut.
Sogar wenn er für einen begangenen Fehler um Entschuldigung bittet, denkt er immer an seine eigne Person. In der Abhandlung über verschiedene dichterische Vorwürfe schreibt er: »– und sie (d. h. der Pontifex und seine Familie), die so gütig und großmütig sind, sollen nicht vergessen, daß die Fehler anderer eigentlich die Quelle und der Ausgangspunkt ihrer Großmut sind, und daß ich z. B. das Objekt der Betätigung ihrer Nachsicht bin. Sie können sich freuen, daß bei meiner Person der Umfang ihrer Vorzüge zutage tritt.«
Tasso bleibt in seinen Wahngebilden immer verständlich, erklärt immer logisch, warum man ihn verfolgt, warum er glaubt, mehr Ehre zu verdienen als andere, und ist vollständig von dem überzeugt, was er behauptet.
Insofern er strengkatholisch ist, drehen sich seine Wahnideen öfter um religiöse Dinge. Er hält sich zuletzt für einen Ketzer, wie aus einigen Briefen an den Herzog von Ferrara hervorgeht, beantragt seinen Prozeß bei der Inquisition, mutmaßt aber hinterher, daß der Urteilsspruch nicht gerecht ausfallen würde: »Die Ursachen, warum ich den Verdacht hege, es möge Verwirrung hinsichtlich der Fällung des Urteilspruchs eintreten, sind so zahlreich und wohlbegründet, daß, wenn Euer Gnaden sie anhören, Euer Gnaden der Ansicht sein werden, daß ich nicht über das richtige Maß mißtrauisch gewesen bin.«
Ein weiterer besonderer Zug des Wahns bei Tasso ist der Aberglaube. Er glaubte an Zauberkünste in der Natur und im Besitze von Dämonen und er hatte so viel Beweise dafür, daß er nicht mehr daran zweifelte. Er war überzeugt, daß seine Leiden von bösen Mächten sich herschrieben. Ein Geist stahl ihm das Geld, warf ihm seine Bücher durcheinander, öffnete Schlösser, nahm Schlüssel weg. Er hatte auch große Angst vor dem Teufel, wie aus einigen Sonetten hervorgeht.
Der Hauptinhalt seines Wahns war aber jener, die anderen beständig anzuschuldigen, daß sie ihn verfolgten, vergifteten, verkleinerten. Er trug auch dem Inquisitor Namen von Personen zu, die seiner Ansicht nach Ketzer waren. Spricht er dagegen von seinen eignen Mißgriffen, so sucht er im Gegensatz zu dem Verhalten der echten Melancholiker sich immer zu entschuldigen.
Haltlosigkeit. – Er bricht oft in heftige, triebartige Akte aus: 1572 wirft er ein Messer nach einem Diener; 1579, nach langer Abwesenheit nach Ferrara zurückkehrend, wurde er in der Ansicht, man ehre ihn hier nicht genügend nach seinen Verdiensten, im Palazzo Bentivoglio sehr heftig und beleidigend gegen den Herzog, seine Braut, die Fürsten von Este usw. Als er von St. Anna aus wieder zu Hofe geladen war, bekam er einen Wutanfall, der die Herzogin Lucrezia sehr erschreckte. 1586 wurde er neuerdings gegen Constantini tätlich, der später mitteilt, daß der Vorsicht halber zu dem Dichter, wenn er erregt war, nur durch ein Fenster gesprochen wurde, und einige Tage vor seinem Tode, am 8. April 1595, warf er in einem Zornesanfall den ihn besuchenden Arzt mit einem Pantoffel, ließ ihn nicht ins Zimmer und zwang seinen Diener, die Medizin zu trinken, die für ihn bestimmt war, am folgenden Tage aber versprach er ihm, ihn durch ein Gedicht unsterblich zu machen.
Unbesinnlichkeit. – Wie es vielen Genies im Augenblicke der geistigen Schöpfung geht, so verlor auch Tasso hier die ruhige Besinnung. Er bezeichnet den Dichter als »hinweggehoben von gottvoller Raserei über sich selbst, weit über das gewöhnliche Maß, fast anderen Sinnes geworden –«, so wie er selbst war.
Das Wesentliche an Tassos Abnormität ist nicht, wie auch Verga glaubte, das Daniederliegen des Gefühlslebens, welches zu mancher Zeit bei ihm nicht nur nicht herabgestimmt, sondern sogar sehr geschwellt war. Auch fehlen von der typischen Melancholie einige Symptome bei Tasso gänzlich, z. B. die Entschlußlosigkeit. Der Melancholiker arbeitet nicht, bleibt beständig untätig, Tasso dagegen war auch zur Zeit seiner schwersten Erkrankung ungemein fleißig. Die Zahl der uns überlieferten starken Bände Tassos beläuft sich auf ungefähr dreißig. Auch der Versündigungswahn des Melancholikers fehlt eigentlich bei Tasso. Er beschränkte seine Anklagesucht auch nicht auf seine Person allein, sondern er war vielmehr ein höchst gefährlicher Ankläger anderer, nicht öffentlich zwar, wohl aber im geheimen, dem Inquisitor gegenüber. Gegenwärtig ist es ziemlich sicher, daß eine Ursache, warum er so lange in St. Anna zurückgehalten wurde, darin zu suchen ist, daß er durch geheime Anklagen dem Herzog selbst und dem Bischof von Ferrara gefährlich geworden war. An den Abbate Christoforo Tasso schrieb er einmal: »Ich würde es nicht wagen zu schreiben, wenn ich nicht der Ansicht wäre, daß an meinem jahrelangen Unglück die Ungerechtigkeit und die Bosheit meiner Feinde mehr Anteil gehabt hat als meine eigene Schuld.«
In einem anderen Briefe schreibt er an denselben: »Wenn selbst die strenge Gerechtigkeit die Schuld nicht ungesühnt lassen wollte, so müßte ich doch hoffen, daß meine Buße geringer ausfiele als die meiner Feinde, da ihre mir zugefügten Übeltaten ohne Not geschehen, meine Mißgriffe aber beinahe geboten gewesen sind.«
Daß das Daniederliegen des Gefühlslebens bei Tasso nicht das Wesentliche seines Gemütszustandes war, läßt sich daraus entnehmen, daß, während alles Neue den echten Melancholiker um so mehr bedrückt, Tasso dagegen das Ungewisse liebte und, wenn er seinen Aufenthaltsort wechseln konnte, einige Zeit erleichtert war. Auch entsteht die echte Melancholie bei Erwachsenen mit Hilfe entsprechender äußerer Einwirkungen, erhaltener Verletzungen, Intoxikationen, akuter Infektionskrankheiten, Störungen der Verdauung, seelischer Schädlichkeiten u. a. Sie nimmt meist bis zu einem gewissen Grade zu und heilt dann ab. Bei Tasso dagegen ist die Krankheit angeboren und die außerordentliche Frühreife seines Geistes und die starke geistige Arbeit in der Jugendzeit waren nicht die Ursache seiner Krankheit, sondern die Folge seiner abnormen Organisation. Schon früh reagiert er übermäßig auf äußere Einwirkungen; auf den Vorwurf, der ihm einst in jungen Jahren gemacht worden war, er habe eine beleidigende Satire verfaßt, schreibt er einen von den heftigsten Ausdrücken strotzenden Brief.
Der Melancholiker ferner, der nicht gesundet, wird nach kürzerer oder längerer Zeit schwachsinnig, bei Tasso dagegen bemerkt man auch beim Absinken der künstlerischen Leistung nichts von Abnahme der geistigen Fähigkeiten, er bleibt mit relativ geringen Schwankungen, abgesehen von den großen Paroxysmen selbst, bis zu seinen letzten Lebenstagen in der gleichen seelischen Verfassung.
Wunderlichkeit. – Tasso war nicht nur eine disharmonische, sondern in Benehmen und Neigungen auch sehr wunderliche Natur.
Es heißt, daß er, als 1590 in Florenz mit großer Pracht der »Amyntas« aufgeführt wurde, zu dem Bernardo Buontalenti prächtige Dekorationen gemalt hatte, heimlich nach Florenz reiste, um diesen kennen zu lernen und, nachdem er ihn begrüßt und auf die Stirn geküßt hatte, ohne sich dem Großherzog vorzustellen, der sehr wünschte, ihn zu sehen und auszuzeichnen, wieder abreiste.
Trotz seines großen Ungemachs fühlt er den unwiderstehlichen Wunsch, eine silberne Trinkschale zu besitzen und bittet den Buchdrucker Vittorio Baldini in Florenz darum:
»Was soll das heißen, Baldini? Ihr habt die silberne Tasse, das Geschenk für mein Gedicht, und schickt sie mir nicht trotz Eurer Versprechungen und meiner Hoffnung und Erwartung? Was würdet Ihr tun, wenn es ein Beutel Seudi wäre? Warum schickt Ihr die Tasse nicht, die ich so sehr wünsche und brauche? Soll ich Euch einen guten, heilsamen Rat geben? Schickt sie mir aus Liebenswürdigkeit, Höflichkeit und Freundschaft.«
(An Antonio Costanzi): »Ich habe sehr große Lust, aus der silbernen Schale auf das Wohl der Großherzogin zu trinken« (9. Mai 1587). – »Der Esel Baldini rührt sich auf keinen Spornstoß. Ich muß die Tasse durchaus haben« (13. Mai 1587). »Ich bin immer noch krank und warte auf die Schale und den Druck des Floridante« (20. Mai 1587). – »Was soll ich von dem Esel Baldini sagen. Ich will die Geschichte mit der Schale oder Tasse, was es ist, durchsetzen und kann mir diese Schrulle nicht aus dem Kopfe schlagen« (3. Juni 1587).
Mangel an Selbstbeherrschung. – An Coccapani schreibt der Dichter aus St. Anna: »Seine Hoheit kann sich dabei beruhigen, und dies ist so wahr wie irgend etwas in der Welt, daß ich oft nicht Herr meiner selbst bin – ich glaube, man wird nicht wollen, daß irgendeiner meiner Mißgriffe meiner Absicht zugeschrieben wird.«
Mangel an Konsequenz. – Einer der grundlegendsten Züge der Lebensführung des Dichters ist der Mangel an Konsequenz; sein beständiger Domizilwechsel deutet darauf.
Die bei dem Dichter durch die Krankheit gesetzte Charakterveränderung erhellt aus der gewöhnlich stark übertriebenen Tonart in seinen Bittgesuchen an den Hof: manchmal erregt die Selbsterniedrigung des Dichters förmliches Mitleid. Er beschränkt sich nicht darauf, Beihilfe an Geld und Sachen zu verlangen, begnügt sich auch nicht mit einer einmaligen Anfrage, sondern wiederholt diese ohne Unterlaß, als wenn jeder Wunsch für ihn sofort ein Bedürfnis würde, das ihm das Leben unerträglich machte, sobald ihm nicht genügt wurde. Die Umsicht war bei ihm auch nicht stärker als Konsequenz und Charakter, wie Manso in folgendem erkennen läßt: »Er war so freigebig gegen andere, daß, wenn er mehr Geld hatte, als er im Augenblick brauchte, er es ohne weiteres den Armen gab; wenn er aber keine Bedürftigen in der Stadt antraf, ging er nach dem Gefängnis und verteilte dort alles an die Insassen.«
Epileptoide Erscheinungen. – Manso macht nicht mißzuverstehende Mitteilungen über epileptoide Zustände unseres Dichters:
»Ich habe an anderer Stelle ausführlich gezeigt, daß –, wenn ihm trübe Schwaden den Kopf einnahmen, diese ihm nur kurze Zeit den Sinn verdunkelten, Störungen, wovon er jedoch bald wieder völlig sich frei zu machen vermochte, wie es bei denjenigen der Fall ist, die an Schwindel und Epilepsie leiden, und auch bei den Schlaftrunkenen.«
Gewiß erinnern manche Eigentümlichkeiten Tassos an Epilepsie, so z. B. die geniale Frühreife, die Frühzeitigkeit der Erkrankung überhaupt, die degenerativen körperlichen Merkmale, die Empfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse (seine schlimmste Zeit fällt in die große Hitze), die große Beweglichkeit, der Schwindel, die Größenideen und der Pessimismus, die Hypochondrie, die Eitelkeit, die Unvorsichtigkeit, die Periodizität seiner dichterischen Fähigkeiten, die großen Ängste, denen er in krankhafter Weise unterworfen war, die große Gemütserregbarkeit, die Veränderung des Gefühlslebens, das Fehlen des Krankheitsbewußtseins, die Unbesinnlichkeit resp. die mangelhafte Erinnerungsfähigkeit, die plötzlichen Affektausbrüche, das beständige Bedürfnis nach oft zweckloser Ortsveränderung, die Plötzlichkeit mancher Entschlüsse, so wenn er z. B. auf einmal einen Ort verläßt, ohne daß jemand imstande ist, ihn zu halten.
Alles das zeigt uns, daß Tassos Krankheit nicht von seiner geistigen Arbeit herrührte oder von dem Unglück, das ihm beschieden war, sondern daß sie angeboren, daß er sicher ein Degenerierter war, gleichzeitig Epileptiker und Paranoiker, und daß dies ihn in Gegensatz zu seiner Umgebung brachte, nicht letztere etwa schuld war am Ausbruch der geistigen Störung.
Die Daten sind entnommen aus Jeafferson, Life of Byron, London 1895, und Mingazzini, Sullo stato mentale di Lord Byron, Reggio 1896. Der Sektionsbefund stammt aus Notizen von dal Cerro.
Es wäre schwierig, eine Familie ausfindig zu machen, in der mehr Degenerierte vorhanden gewesen wären, als jene, der Lord Byron entstammte.
W. Byron und Frances Berkeley waren seine Urgroßeltern. Die Berkeley stammte aus einer Familie, deren Eigentümlichkeit in Impotenz und Haltlosigkeit bestand. Frances Berkeleys Schwester Barbara hatte in der Ehe mit J. Cornwall eine Tochter, Sophie, die ihren Vetter, den Sohn der anderen Schwester, den Admiral Byron, heiratete. Der Bruder dieses letzteren, Lord V. Byron, verband mit der Heftigkeit der Berkeleys eine so merkwürdige und traurige Gemütsverfassung, daß er sich den Beinamen » The mad or wicked Lord« erwarb. Der Admiral scheint besser weggekommen zu sein; wenn man aber in Betracht zieht, daß mittels der Ehe mit einer Berkeley die Blutsverwandtschaft der Eltern sich zu der morbosen Heredität gesellte, so wird es nicht wundernehmen, daß das Produkt dieser Verbindung der unnütze Jack Byron, der Vater des Dichters, war. Man erzählt von ihm, daß er einst beim schwachen Scheine einer Kerze in einem Zimmer seinen Freund Chatworth ohne Sekundanten im Duell getötet habe. Er war so extravagant, daß er in der Familie » mad Jack« hieß. Haltlos und genußsüchtig von Jugend an, verführte er die Baronin Carmarthen, noch sehr jung heiratete er die Lady Conyers, die infolge seiner schlechten Behandlung zugrunde ging. Darauf heiratete er in zweiter Ehe die sehr reiche Miß Gordon, deren Mitgift er bis auf den letzten Pfennig durchbrachte. Noch nach der Scheidung von dieser hatte er den Mut, sie in einem Briefe um eine Guinee zu bitten. Aus Abneigung gegen seinen Sohn vernachlässigte er die Familie, auch verkaufte er widerrechtlich einen Teil seines Eigentums; er endete als Selbstmörder.
Ähnlich wie die traurige väterliche Ahnentafel war jene der Mutter, S. Mingazzini, l. c. wiewohl hier nur Nachrichten über die letzten zwei Generationen vorliegen. Vom Vater der Mutter weiß man, daß er melancholischen Anwandlungen unterworfen war und als Selbstmörder starb. Seine Tochter, Kate Gordon, die Mutter des Dichters, war so zornig, daß sie in der Aufwallung ihre Kleider zerreißen konnte. Bei einem ihrer Zornesanfälle fragte einmal ein Freund den Dichter, als sie noch Kinder waren, ob seine Mutter irrsinnig sei. Ihre Erreglichkeit war so groß, daß sie im Theater in Edinburgh einst beim Spiel der Mrs. Siddons in Krämpfe verfiel, auch war ihr ethisches Fühlen gering in Anbetracht dessen, daß sie sich häufig betrank und keinen Anstand nahm, ihren Sohn zu verspotten, weil er hinkte.
Unter Lord Byrons Vorfahren war also Selbstmord, moralischer Irrsinn, Haltlosigkeit und Genußsucht vielfach vorgekommen. In seiner Familie, sagt Ribot, war alles vorbereitet, um die Harmonie des Charakters und das häusliche Einvernehmen zu stören.
Byron hatte nicht viel äußere degenerative Merkmale. Er besaß einen schön geformten Schädel von großer Kapazität (Gehirngewicht 1600 Gramm) und schön geschwungene Nase, hatte aber keinen Bart und litt an einer angeborenen Kontraktur der Achillessehne, Mingazzini, Sullo stato mentale di Lord Byron, Rivista sperimentale di Freniatria, 1895. an sogenanntem Pes equinus, eine Störung, die man nur auf eine in der Kindheit überstandene Polioencephalitis oder Gehirnentzündung zurückführen kann, in deren Verlauf sich dieses Übel, eine der häufigsten Verbildungen der Glieder, einzustellen pflegt. Nisbel, The insanity of genius, London 1893.
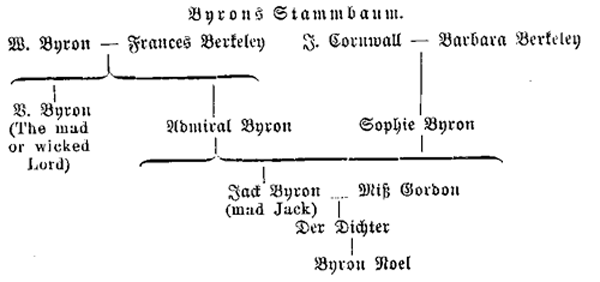
Wichtiger als die körperlichen degenerativen Stigmen waren die psychischen. Lord Byron zeigte bereits in früher Kindheit erotische Frühreife, er verliebte sich mit neun Jahren in Aberdeen in ein kleines Mädchen, Mary Duff, so daß er ganze Nächte nicht schlafen konnte, später, mit zwölf Jahren, schwärmt er für Margarete Parker, der er unter dem Pseudonym Thyrza mehrere Gedichte widmet, mit 14 Jahren liebte er Mary Chatworth, mit 15 Jahren erregt ihn die Nachricht der Verehelichung Mary Duffs, für die er seine Empfindung noch bewahrt hatte, so stark, daß er in Krämpfe verfällt. »Meine Mutter,« erzählt er in seinen Erinnerungen, »verspottete mich immer wegen dieser kindlichen Verliebtheit. Zuletzt sagte sie mir, als ich bereits das fünfzehnte Jahr überschritten hatte, eines Tages: ›Ich habe einen Brief von Miß Abercrombie aus Edinburgh bekommen; deine alte Liebe Mary Duff hat sich verheiratet.‹ Ich kann über meine Empfindungen in diesem Augenblick keine Rechenschaft ablegen, kurz, ich verfiel in Konvulsionen, und meine Mutter war davon so betroffen, daß sie, als ich wieder wohler war, jede Berührung der für mich so schmerzlichen Angelegenheit vermied und nur noch mit ihren Freundinnen darüber sprach.«
Die Abnormität des Gefühlslebens des Dichters geht auch aus feinem Verkehr mit seinen Kollegen hervor. Als er in Harrow studierte, äußerte er maßlose Schwärmerei für seine Freunde: » L'amitié, que dans le tuende est à peine un sentiment, est une passion dans les cloîtres,« einen Aphorismus Marmontels, hatte er in sein Notizbuch geschrieben, als er Harrow verließ. »Meine Schulfreunde,« schrieb er in sein Tagebuch, »sind Gegenstand heftiger Leidenschaft für mich gewesen, aber ich weiß nicht, ob eine davon noch bis heute sich erhalten hat, viele davon hat der Tod zerrissen. Ich weiß nur, daß jene für Lord Clark eine der ältesten ist, länger dauerte als alle und nur durch die Trennung unterbrochen wurde. Auch heute kann ich das Wort Clark nicht ohne Herzklopfen aussprechen hören und ich schreibe es › ad infinitum‹.« Die Haltlosigkeit, sein väterliches und mütterliches Erbteil, zeigt sich bei Byron ebenso früh wie die anderen merkwürdigen Züge seines Gemütslebens. Im Tagebuch des Dichters findet sich folgende Stelle darüber: »Ich unterschied mich in keiner Beziehung von den anderen Kindern, ausgenommen durch mein oft ärgererregendes Benehmen. Ich konnte ein Teufel sein. Einmal mußte mir in einem meiner Anfälle von stiller Wut ein Messer weggenommen werden, das ich vom Tische aufgegriffen und auf meine Brust gerichtet hatte, kurze Zeit vor dem Tode des verstorbenen Lord.« Ähnlich wie die Mutter zerriß er in zornigen Anwandlungen seine Kleider. Diese Zornausbrüche waren so häufig, daß sie ihm von seiner Schwester den Beinamen »Baby Byron« eintrugen.
Während in dieser stürmischen Weise und unter täglicher übermäßiger Anspannung der Gefühlstätigkeit Kindheit und Jugend verlief, stellten sich bei ihm im beginnenden Mannesalter im Trinity College bald auch schlimmere Neigungen ein. Die Leidenschaft für das Spiel beginnt bei ihm so mächtig zu werden, daß der Dichter jede Nacht bis ein Uhr früh Hasard spielt »ohne Überlegung, Vernunft und Ruhe«, wie er selbst sagt.
Allmählich wich diese Spielleidenschaft dem Alkoholmißbrauch, bann stellte sich auch Opium- und übermäßiger Tabakgenuß ein. Vom Alkohol bevorzugte Byron den Brandy, Laudanum nahm er in hohen Dosen. Der Opiummißbrauch hielt, wie es gewöhnlich ist, das ganze Leben lang an, so daß 1821 die Gewöhnung an das verhängnisvolle Narkotikum bereits einen solchen Grad erreicht hatte, daß er an Moore schreiben konnte, er könne viel davon nehmen, ohne irgendeine Wirkung zu verspüren.
Miß Milbanke heiratete er in enthusiastischer Bewunderung, aber schon kurze Zeit nach der Hochzeit bemerkte seine Frau eine tiefe Charakterveränderung bei ihm. Während er sich in den ersten Monaten sehr rücksichtsvoll gegen sie gezeigt hatte, schalt er sie jetzt täglich, trotzdem sie gegen ihn so liebenswürdig als möglich blieb. Der Zynismus des Dichters erreichte einen solchen Grad, daß er mit der größten Aufrichtigkeit versicherte, daß ihm seine Ehe zuwider sei und daß er seine Frau nur aus Rachsucht und Geldgier geheiratet habe.
»Juna Lucina,« rief er einst aus, » fac opera oder vielmehr opes.« Da, wie Jeafferson bemerkt, die Briefe vor und nach der Eheschließung, alles, worin er seiner Frau entgegenkam, die zweifellosen Beweise der Übereinstimmung ihrer Temperamente während der ersten Zeit ihrer Ehe seine Liebe zu seiner Frau genügend dartun, so ist klar, daß bei dieser, wiewohl sie der psychiatrischen Auffassung fernstand, der Verdacht rege wurde, es sei eine schwere Alteration seines Geisteszustandes eingetreten, so daß sie den Ärzten sechzehn Fragen über das geistige Verhalten ihres Mannes vorlegte, deren Inhalt nie bekannt geworden ist (Nisbet).
Besser kannte ihn seine menschenkundige Geliebte Lady Karoline Lamb, die ihn für »irre und einen schlimmen und gefährlichen Bekannten« erklärte.
Nach seiner Trennung von seiner Frau verfällt Byron der zügellosesten Ausschweifung. Wie ein fahrender Ritter findet er nirgends Ruhe und wandert unaufhörlich von Land zu Land. In der Schweiz erneuert er seine alten Beziehungen zu Jane Clermont, von der er eine Tochter hatte, die später in Bagnacavallo starb. In Venedig erkrankt er nach einigen Tagen an Malaria; das Hauptsymptom dieser Krankheit scheint aber in einer schweren nervösen Erschöpfung des Nervensystems bestanden zu haben, die im Gefolge des üppig verlebten Karnevals auftrat, in dessen Strudel er sich mit unsinniger Ausgelassenheit gestürzt hatte, so daß er an Murray schreiben konnte (1817): »Mein Leiden ist eine Art leichten Fiebers, verursacht durch das, was mein Lehrer und Meister Jackson nennen würde: sich zuviel zumuten.«
In Venedig erreicht die Libertinage des Dichters ihren Höhepunkt: er verliebt sich in eine so gewöhnliche Frau wie Maria Segati und sinkt dann im Liebesleben noch tiefer hinab.
Manche seiner Exzesse waren notorisch, andere waren nur Leuten bekannt, die, wie Fletcher und Hoppner, Gelegenheit hatten, aus der Nähe seinen Harem am Canale grande zu beobachten, wo er sich von leichten Frauen der niederen Schichten aus Venedig und Umgebung besuchen ließ. Da ihm der bloße Wein nicht genügte, so griff er zu stärkeren alkoholischen Getränken, die er in solchen Mengen zu sich nahm, daß er bald deutliche Zeichen von Alkoholismus aufwies. Seine psychische Erregbarkeit wuchs täglich mehr, sogar seine Stimme veränderte sich, seine Stimme, die, wie Jeafferson sagt, einst so hell war, daß man sie nur mit Vergnügen hören konnte. Auch seine Handschrift war so unleserlich geworden, daß die besten Schriftsetzer sie nicht mehr entziffern konnten. Gleichzeitig mit der inzwischen eingetretenen Fettleibigkeit litt er an solchen Verdauungsstörungen, daß ein Stück Brot oder Biskuit ihm Magenschmerzen und Magenkrampf verursachen konnte. Eine Kleinigkeit genügte, ihn in niedrige Schmähungen ausbrechen zu lassen. Damals warf er auch das eine Mal in der Wut seine Lieblingsuhr zu Boden, so daß sie in Trümmer zerschellte. Mit äußerster, wohl epileptoider Roheit insultierte er einen päpstlichen Offizier, der ihm ein schlechtes Pferd verkauft hatte, und forderte ihn auf Pistole und Degen. Ein echter epileptisch-alkoholistischer Anfall, der von Jeafferson als »hysterisch« bezeichnet wird, erfaßte ihn ebenfalls zu dieser Zeit, als er im Theater einer Aufführung von Alfieris »Myrrha« beiwohnte.
Wankelmütigkeit und ein gewisser Zug von Niedrigkeit bezeichnen auch seine letzte Liebe, die berühmte Leidenschaft zu der Gräfin Gamba-Gniccioli in Ravenna, die wenig besser ist als die vorangegangenen. Der Dichter verliebt sich heftig, stört dadurch das eheliche Einvernehmen zwischen Mann und Frau, will aber nach kurzer Zeit aus Überdruß heimkehren. Seine Unentschlossenheit verläßt ihn indes nicht. Hoppner sagte mit Recht, es hätte vielleicht von einem zu Boden fallenden halben Penny abhängen können, ob er der Komtesse nach Ravenna folgen oder nach England heimkehren würde: Byron ging nach Ravenna. In seinem Tagebuch von 1820 steht: »Die Gräfin möchte sich gegen den Willen dessen, der so viel gesagt und getan hat, um es zu verhindern, von ihrem Manne trennen,« was zur Genüge zeigt, daß der Einfluß Teresa Gnicciolis auf ihn gering war. Kaum sieben Monate waren feil der Scheidung der Gräfin von ihrem Manne verflossen, da bereute er schon, den Bund geschlossen zu haben; sein Tagebuch enthält Andeutungen, es sei ein Wahnwitz gewesen, sich gegen den Gemahl zu wenden; an die Gräfin richtete er, kurz bevor er sie verließ, einen warm empfundenen Brief. »Sie werden Hand und Feder Ihres leidenschaftlichen Verehrers erkennen und sich denken können, daß er über einem Buche, das das Ihre war, nur an seine Liebe denken konnte; in diesem in jeder Sprache schönen Worte, das es auch in der Ihrigen sein muß, meine Teure, geht mein Leben auf, jetzt und in Zukunft. Ich fühle, daß dies mein Leben ist und ich fürchte, daß in Zukunft das mit mir geschehen wird, was Sie für gut finden. Mein Geschick bleibt in Ihren Händen, Sie sind ein siebzehnjähriges Weib und seit zwei Jahren nicht mehr im Kloster. Ich wünschte von ganzem Herzen, Sie wären dort geblieben, oder ich hätte Sie wenigstens nicht in der Ehe angetroffen. Aber das ist alles zu spät, ich liebe Sie und Sie lieben mich, wenigstens sagen Sie es und handeln danach, und das ist ein großer Trost, was auch kommen mag. Ich aber liebe Sie mehr als je und kann nicht aufhören, Sie zu lieben. Denken Sie manchmal an mich, wenn Alpen und Ozean uns trennen, was nicht eintreten wird, wenn Sie es nicht wünschen.«
Die krankhafte Erreglichkeit auf der einen und die schwache Widerstandskraft auf der anderen Seite verliehen seiner Natur nicht nur etwas Weibliches, sondern machten ihn in seinem Liebesleben auch so schwankend, daß er, wie Jeafferson sagt, nie von einer Frau beherrscht worden ist. »Welche von den Frauen, die lange auf ihn einen starken Einfluß hatte, hat ihm auch längere Zeit angehangen? Karoline Lamb? Seine Freundschaft mit ihr bestand in einer Reihe Streitigkeiten, und zuletzt kam es zwischen ihnen zu denselben Zerwürfnissen wie mit seiner Cousine Jane Clermont. Mit aller seiner Ritterlichkeit und sentimentalen Korrespondenz konnte er sie nur wenige Monate länger fesseln, als Marianne Segati, die er gewiß ebenso liebte wie die Gräfin, von der er nach kurzer Zeit hintergangen wurde.« Seit seiner Jugend tritt der Zug zur Unaufrichtigkeit bei ihm hervor: »Wenn ich,« so sagt er selbst, »ehrlich zu mir sein wollte (übrigens fürchte ich, daß man sich leichter selbst belügt, als andere), so würde jede Seite meines Lebens die vorangegangene völlig widerlegen.«
Nicht nur im Bereich des Gefühlslebens, sondern auch in intellektueller Beziehung scheint er von Hause aus gestörten Gleichgewichts gewesen zu sein, wenn man seine übermäßige Eitelkeit in Betracht zieht, die eine einigermaßen vorhandene Kritik hätte unterdrücken müssen, und seinen maßlosen Stolz, der ihn verhinderte, sich innerhalb der ihm gebührenden Grenzen einzuschätzen. Der Ruhm Shakespeares erregte seine Eifersucht dergestalt, daß er behauptete, seine Popularität rühre zur einen Hälfte von seiner niedrigen Herkunft, zur anderen von der Entfernung, die ihn vom 19. Jahrhundert trenne, her, und er gelangte schließlich dazu, alle englischen Dichter mit Ausnahme Popes und natürlich seiner selbst für Barbaren zu erklären.
Opium- und übermäßiger Alkoholmißbrauch hatte seine schwache Willenskraft seit seinem 25. Jahre noch verringert. Das allmähliche Zurücktreten jedes altruistischen Gefühls, der Verlust jeder Rücksicht auf das Dekorum, die Erkaltung des Familiensinns, der beständige Stimmungswechsel ohne hinreichendes Motiv hatten während seines Aufenthalts in Venedig den Höhepunkt erreicht, als der Hang zum Trunk derart stark geworden war, daß er schwere Verdauungsstörungen, Kehlkopfbeschwerden und eine so unsichere Hand bekam, daß man seine Schrift nicht mehr lesen konnte. Jeafferson sagt von ihm: »Die Aufrichtigkeit war durchaus kein eigentlicher Charakterzug seines Lebens, aber auch sein Mangel daran war mehr scheinbar als wirklich. Seine natürliche Heftigkeit, die ihn zu ehrenhaft für eine Hypokritenlaufbahn machte, war mit einer Veränderlichkeit in Vorstellungen und Gefühlen verbunden, die oft den Anschein und die schlimmen Folgen von mangelnder Aufrichtigkeit im Gefolge hatten. So konnte Byron blitzschnell aus einem Freunde ein Feind werden, bald zornig sein, bald liebevoll, so konnte er sich abscheulich hart und herzlich fast zu gleicher Zeit zeigen. Seiner Frau gegenüber legte er zuerst Ergebenheit und Hochherzigkeit an den Tag, verfiel dann aber mit einemmal in niedrige und gehässige Feindseligkeit.«
Diese Verdoppelung der Persönlichkeit tritt immer beim Epileptiker und ethisch Defekten auf.
Nicht anders denn als epileptische Anzeichen lassen sich auch manche Handlungen des Dichters auffassen, die so abnorm sind, daß sie die Aufmerksamkeit seiner näheren Bekannten aus sich zogen und die Wechsel zwischen übermäßiger Gehobenheit der Stimmung und finsterer Melancholie. Jeafferson erzählt, daß der Dichter auf der Reise von Genua nach Griechenland zeitweise Heiterkeitsausbrüche hatte, die sich wie grelle Sonnenstrahlen im Aprilwetter ausnahmen, und daß er leicht in Schwermut verfiel. »Oft sah ich Lord Byron auf seiner letzten Reise von Genna nach Griechenland,« schrieb Hamilton Brown an Colonel Stanhope – »mitten in der größten Heiterkeit plötzlich nachdenklich und seine Augen feucht werden, zweifellos infolge einer schmerzlichen Erinnerung. Dann erhob er sich gewöhnlich, suchte seine Kabine auf und wollte niemanden sehen.« Die Epilepsie zeigte sich schließlich auch als konvulsiver Anfall und zwar eines Abends nach einem heftigen Streit mit den Sulioten, deren Chef er war. Fletcher sagt in einem seiner Briefe, daß der Anfall eine Viertelstunde gedauert habe. Der Dichter rief, nachdem er das Bewußtsein einige Minuten verloren und die Sprache wiedergefunden hatte, aus: »Lernt mich kennen, glaubt nicht, daß ich mich vor dem Tode fürchte, o, ich fürchte mich nicht,« offenbar in einer Art Verwirrtheit.
Um jedoch diese epileptische Veranlagung ganz zu würdigen, muß man sich erinnern, daß ein ähnlicher Anfall bei ihm bereits mit 15 Jahren aufgetreten war, als seine Mutter ihm die Heirat seiner Freundin anzeigte, daß ein zweiter während der Aufführung der »Myrrha« im Theater in Venedig zum Ausbruch kam, daß er nach der Geburt schwere Gehirnerscheinungen erlitten hatte, daß Zornmütigkeit und epileptische Haltlosigkeit, bei ihm ererbt, schon seinen Vorfahren eigentümlich waren, und daß sie seit früher Jugend sich gezeigt hatten.
Die Gleichgewichtsstörung im Affektleben erscheint schon vor seinem fünfundzwanzigsten Jahre, ehe abnorme chemische Reize sein natürliches Temperament umgeformt hatten. Maßlose, früh erwachte Leidenschaftlichkeit, zwangartige Handlungen, große Verliebtheit, ohne daß der neue Gegenstand seiner Liebe die früheren in Vergessenheit bringt, Neigung zu Ohnmachtheit bei geringfügigen Anlässen – dies sind nach Mingazzini die auffallendsten Eigentümlichkeiten Byrons in Kindheit und jüngeren Jahren; die Verkürzung der Achillessehne stammt der Entstehung nach aus sehr früher Zeit und ist, wie bereits bemerkt, offenbar der Überrest einer Gehirnentzündung.
Zieht man in Betracht, daß die Epilepsie häufig bei Genies anzutreffen ist, so ist auch dieses Zusammentreffen bei Byron nichts Wunderbares, und es bedürfte zur Erklärung seines abnormen Wesens nicht einmal des Vorhandenseins der erblichen Belastung und des Alkoholismus.
*
Bericht über die Autopsie des verstorbenen Lord Byron (nach E. del Cerro [N. Niceforo], Lord Giorgio Byron a Missolunghi).
»Aus diesem Befunde haben die Ärzte gefolgert, daß, wenn Lord Byron rechtzeitig Aderlässe hätte vornehmen lassen, wie sein Leibarzt Bruno geraten hatte, oder wenigstens im späteren Verlaufe des Leidens stärkere Blutentziehungen angewendet worden wären, Mylord am Leben hätte bleiben können; aus Nr. 1, 8 und 9 des vorliegenden Berichts läßt sich aber mit voller Sicherheit entnehmen, daß Mylord nur noch einige Jahre hätte leben können.«
Wenn es auch nicht leicht ist, aus diesen Daten ein vollständig zutreffendes Bild über den Gesundheitszustand des Dichters zu gewinnen, so ersieht man doch zweifellos daraus die frühzeitige Nahtverknöcherung, die Schädelverhärtung, die chronische Gehirnhautentzündung, die die schweren funktionellen Störungen, besonders die frühzeitig beginnende Epilepsie des Dichters, verständlich machen.
Dante Gabriel Rossetti S. Dante G. Rossetti, His family, letters, with a memoir by William Michael Rossetti, London 1896. wurde 1828 in London als Sohn des bekannten Revolutionsdichters Rossetti und der Francesca Polidori geboren, der Tochter und Schwester der Polidori, über die Alfieri, Foscolo und Byron so vieles Abfällige geäußert haben und die sehr verschroben, vielleicht gestört, wenn auch dichterisch veranlagt waren.
Von der Familie Rossetti, in der Literaturkundige und Verskünstler so stark vertreten waren, war Dante Gabriel zum Maler bestimmt, denn schon mit vier Jahren hatte er angefangen zu zeichnen, erst mit sechs Jahren versuchte er sich in Versen.
Mit 16 Jahren fing er an, Dante und Cavalcanti zu übersetzen und die Malkunst gründlicher zu studieren, aber auf eigne Art, indem er sich immer weigerte, nach dem Modell zu zeichnen, und lieber Ideen wiedergeben wollte, die ihm innerlich vorschwebten. In der Academy School, in die er 1847 eingetreten war, fiel er regelmäßig in allen Prüfungen durch, aber er tröstete sich mit dem Erfolge, den er durch seine Rede auf die andern ausübte, die ihn zwar bizarr fanden, aber ihm gern zuhörten und ihn anstaunten, von dem Blicke seiner großen graublauen Augen und von der starken, überaus biegsamen und wohllautenden Stimme begeistert.
Gabriels Charakter stand in merkwürdigem Gegensatz zu dein einfachen und derben englischen Milieu. Schon mit 20 Jahren war er eine wahre Verkörperung von Widersprüchen: er wollte gern herrschen, aber im täglichen Leben hatte er hundert Bedenken; leidenschaftlich und genußsüchtig, wie seit Keats nie ein englischer Dichter gewesen war, fühlte er in seiner Seele neben maßlosem sinnlichen Bedürfnisse eine mystische Liebe, ein reines Ideal. Er verabscheute den Durchschnitt bei allem, in der Kunst, in der Poesie, in der Liebe, er suchte stets das strahlendste Weiß, die leuchtendsten Farben, die erhabensten Ideen, die erlesensten Empfindungen, die es auf der Erde gibt, und daher rührt seine unnachahmliche Vornehmheit, die er immer bewahrte, auch mitten im tragischsten Geschick.
Seine erste Liebe war – er war damals 23 Jahre alt – Lizzie Siddal, eine schöne, selbstbewußte Modistin, die er aus niederer Umgebung emporgehoben hatte und in der Malerei unterwies.
Sie hatten sich verlobt, aber Rossetti verschob in seiner Unentschlossenheit die Eheschließung zunächst von Jahr zu Jahr.
Als ihm dann seine Frau starb, legte er, ehe die teuren Reste ins Grab gesenkt wurden, das einzige Manuskript seiner Gedichte, die niemand lesen durfte, neben die Tote in den Sarg.
Fünf Jahre lang verfaßte Rossetti nicht einen einzigen Vers; einem feinen Gefühl von Verehrung gegen die Tote folgend, vermied er auch die Züge einer anderen Frau, die ihn neuerdings begeistert hatte, auf die Leinwand zu bringen. Aber es ist nicht richtig, daß aus dieser Zeit seine Melancholie datiert, so schnell konnte der Kern seines so genußfreudigen Wesens nicht zerstört werden.
Fast unmittelbar nach dem Tode seiner Frau mietete Rossetti an der schönen Strandpromenade in Chelsea ein altes Schloß und nahm dort mit seinem Bruder William, mit dem Romanschriftsteller Georges Meredith und dem Dichter Swinburne Aufenthalt. In diesem glänzenden Heim lebte er viele Jahre und verdiente anfänglich mit seinen Bildern 40 000, später 80-100 000 Franken jährlich, aber das Geld zerrann ihm unter den Händen.
Nach 1859 hatte er sich fast ganz von den Präraffaeliten getrennt und sich dem Symbolismus eng angeschlossen.
»Ich kann nur Weiber und Blumen malen,« sagte er eines Tages selbst in einem Moment des »Spleens« zu einem seiner Bekannten.
Gegen Ende 1869 hörte er auf zu malen und fing wieder an zu dichten, und in der Nacht des 10. Oktober desselben Jahres wurde das Grab der armen Lizzie geöffnet, der Sarg aufgedeckt, und der Dichter nahm das kostbare Manuskript mit seinen Gedichten, auf welche er sieben Jahre vorher auf ewig hatte verzichten wollen, wieder an sich und ließ es desinfizieren.
Aber nicht nur das Grab, sondern auch das Andenken Lizzies sollte profaniert werden.
Während Rossetti sich immer weiter von seiner Schule entfernte, entstand eine neue Liebe in seinem Herzen. Diese neue Liebe besingt der Dichter in dem Buche » The house of life«, einer merkwürdigen Schrift, in der Zweifel, Angst und Genußsucht sich zu einem sonderbaren leidenschaftlichen, düster-quälenden Gemütszustände vereinigen. Dieser Zeit gehören einige der eigentümlichsten seiner Bilder und Zeichnungen an. Seine Gemütsart wird für die nächsten zwei oder drei Jahre verträglicher, er erzürnt sich nicht mehr mit seinen Freunden und bezieht zusammen mit Morris das alte Schloß in Kelmscott in Oxlandshire. Er zeigt sich jetzt sehr gütig, liebevoll und freut sich des glänzenden Erfolges seiner Gedichte.
Trotzdem litt er, wie der Verfasser des » Contrat social«, an vielen seelischen und körperlichen Gebrechen, an Schlaflosigkeit, Menschenscheu, langandauernder Niedergeschlagenheit, zwangartigem Mißtrauen, Überempfindlichkeiten, und auch er bewahrte mitten in diesem gesamten Zusammenbruch unversehrt den Genius.
Um die Schlaflosigkeit und die unangenehmen Empfindungen in Kopf und Augen loszuwerden, griff Rossetti 1870 zum Chloralhydrat; anfangs nahm er es nur in kleinen Dosen (0,6 Gramm), bald aber mußte er, um eine Wirkung des Mittels zu erzielen, die Gabe steigern, bis zu elf und zwölf Gramm pro Tag.
Anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung seiner Poesien hatte der Schotte Buchanan einen Artikel für die » Contemporary Review« verfaßt, der von übertriebenen und rohen Bissigkeiten strotzte, wie man bereits aus dem Titel »Die Schule des Fleisches in der Dichtung« entnehmen kann. Diese brutale Kritik war eine wahre Tortur für das empfindsame Gemüt Rossettis. Anfänglich kümmerte er sich nicht viel darum, später aber stellten sich infolge seiner hypochondrisch-sensitiven Anlage Selbstvorwürfe ein. Die Vorstellung, der Immoralität beschuldigt, eine Gefahr für die Gesundheit seiner Zeit zu sein, untergrub immer mehr sein seelisches Wohlbefinden; bald hielt er sich für schuldbeladen, bald glaubte er, Buchanan gehöre zu einer geheimen Verschwörung, die ihn seines Ruhms berauben wolle; offenbar war er bestürmt von Versündigungs- und Verfolgungsideen, wie sie bei der Melancholie so häufig vorkommen.
Diese verschlimmerte sich noch, als im Mai 1872 der Artikel Buchanans als Broschüre herauskam, und zwar in noch gehässigerer und bissigerer Form als anfänglich. Rossetti wurde nun von vollständigem Verfolgungswahn befallen, so daß er nur noch Verrat und Intrigen um sich erblickte.
Um seinem qualvollen Zustande etwas abzuhelfen, nahm er wieder mehr Chloralhydrat, eines Nachts nahm er auch noch eine größere Quantität Opium zu sich, so daß er ungefähr vierzig Stunden lang bewußtlos war.
Seine Freunde nahmen ihn nun auf eine Reise nach Schottland mit, auf der er sich etwas zu erholen schien und wieder zu malen anfing. Er kehrte dann Ende September nach Kelmscott zurück, verfiel aber hier aufs neue in die schwärzeste Melancholie.
Er wollte seine Freunde nicht mehr sehen, auch Morris und Swinburne nicht, ging tagsüber nicht mehr aus, sondern fuhr nur noch manchmal nachts mit seinem Sekretär spazieren, zu dem er Vertrauen hatte. Häufig brach er unter Zurücktreten des melancholischen Zustandsbildes in heftigen, sinnlosen Zorn aus. Allerdings war er auch jetzt noch manchmal gut und freundlich, und seine ihm ergebenen Freunde dankten es ihm immer, aber sein Wahn nahm ihn doch bald wieder gefangen, und Mißtrauen nagte an seiner Seele; sogar der Gesang der Vögel im Garten schien ihn zu verhöhnen; von den Nachbarn glaubte er sich grimmig gehaßt, und er ließ die Wände seines Arbeitszimmers mit Matratzen belegen, um vor ihren Beobachtungen sicher zu sein. Obwohl er sich aber sehr schlecht befand, fuhr er fort zu malen und zu dichten, und dieser Unglückszeit entstammen seine beiden Meisterwerke »Proserpina« und »Die römische Witwe«; von Gedichten ist hier anzuführen: »Das weiße Schiff«, eine vortreffliche Ballade, die »Königstragödie«, eine ergreifende Schilderung des schrecklichen Endes Jakobs von Schottland, und eine Anzahl von Sonetten. Die Sonette regten ihn immer sehr auf. An seine Schwester Christine schreibt er: »Wer mir von Sonett spricht, spricht von Schlaflosigkeit,« und er fuhr fort, diesen schrecklichen Feind mit Hilfe des Chloralhydrats zu bekämpfen, von dem er jetzt so hohe Dosen nahm, daß der Apotheker am 10. November 1879 voll Schreck über eine Bestellung von zwölf Flaschen für die Woche ihm sagen ließ, daß er ihm künftig nur eine Pro Tag liefern könne. Hierauf wandte sich Rossetti an eine andere Apotheke, und in den letzten Monaten des Jahres 1881 stieg die Rechnung für das Chloralhydrat auf ungefähr 2500 Franken.
Inzwischen wurden die beunruhigenden Erscheinungen immer stärker. Wiewohl er menschenscheu war, fing er doch an, Furcht vor dem Alleinsein zu empfinden, und seine Stimmung wurde immer trüber. Während er früher so empfänglich für den Beifall der Öffentlichkeit gewesen war, machte der Erfolg seiner neuen Gedichte nunmehr kaum einen Eindruck auf ihn. Ihn quälte beständig der reuevolle Gedanke an eine mögliche Verfehlung oder an Unvollkommenheiten überhaupt. Der Mangel an Entschluß und Nachdruck wurde immer ausgesprochener, und zu dieser seelischen Qual gesellten sich weiterhin ebenso aufreibende körperliche Leiden, nervöser Husten, Versagen der Körperbewegung, beständige Schlaflosigkeit.
Schließlich machte eine schwere Albuminurie in der Villa am Strande, wohin er gebracht worden war, im Verein mit Symptomen eines bestehenden Hirnleidens, seinem Leben am 9. April 1882 ein Ende.
Keine Betrachtung stützt meine anscheinend widersinnige Theorie, nach welcher die Epilepsie eine der Vorbedingungen der genialen Anlage ist, mehr, als die Lebensgeschichte Napoleons. Denn einmal war er sicher eines der ausgezeichnetsten Genies, die es gegeben hat, ferner zeigte er nicht nur die weniger bekannten Erscheinungen der psychischen Epilepsie, d. h. die momentanen Bewußtseinsverluste, die ungeheure, grundlose Heftigkeit, sondern auch, was sehr bekannt geworden ist, die epileptischen Krämpfe mit gleichzeitigem Schwinden des Bewußtseins und nachfolgender Benommenheit.
Erblichkeit. – Auch erblich belastet war er.
Bekanntlich wird die Epilepsie häufig von alkoholistischen Eltern vererbt. Nun war, wie er selbst Antonmarchi Antonmarchi, Mémoires, Bd. I, S. 268. gesagt hat, sein Vater Alkoholist. Dieser starb jung an einem Krebsleiden; er war hochbegabt, aber ein Intrigant und fast ethisch defekt zu nennen. So verließ er bekanntlich seinen Freund Paoli, dessen Anhänger er war, als dieser ins Exil ging, und schloß sich der französischen Regierung an.
Die Schwestern Napoleons, besonders Paolina, waren recht sittenlos. Paolina stand Canova ohne Scheu Modell, war auch hysterisch (Lévy, Napoleon intime, S. 317). Lucian Bonaparte war habsüchtig, selbstsüchtig und genußsüchtig. Napoleons Mutter hingegen war eine ernste, entschlossene, kluge und imponierende Frau.
Von physischen Merkmalen besaß Napoleon geringe Körperlänge (1,51 m), klafterte aber mit ausgestreckten Armen weit mehr (1,67 m), ein Verhalten, das der Psychiater als degenerativ bezeichnet. Sein Schädelumfang war 56,4, also nicht gering, aber nicht die Norm überschreitend. Der mesozephale Kopf, der in der Schläfengegend eingedrückt erschien, besaß mehrfache Anomalien, besonders die bekannten mächtigen Unterkiefer mit Halbaffenfortsatz, vorspringende Jochbeine und Augenbrauenbögen, wenig Bart, bedeutende Asymmetrie des Gesichts, wie man an den Bildern aus seiner Jugend ersehen kann, als die Schmeichelei Gesicht und Ausdruck noch nicht in den Augen der Welt umgestaltet hatte. Dem Körper fehlte das rechte Verhältnis zwischen Ober- und Unterleib, insofern die Beine im Verhältnis zum Rumpf zu kurz waren, der Kopf saß zwischen den Schultern, der Rücken war leicht gekrümmt. Er hatte merkwürdige Empfindungsstörungen, so daß er bis zum Juli heizen ließ, beklagte sich über Gerüche, die niemand wahrnahm, hatte sehr häufig Kopfweh, besaß auch eine sehr große Empfindlichkeit gegen Wettereinflüsse, so daß er die unvorhergesehenen Witterungswechsel sehr schlecht vertrug und besonders an feuchten Tagen sehr reizbar war.
Er hatte auch, wie die Epileptiker häufig, »Muskeltics«, namentlich wenn er erregt war. Im Zorn zog er die Waden zusammen. Wenn er sich mit etwas Neuem beschäftigen wollte, verfiel er in den sogenannten Jacksonschen Anfall, verdrehte den rechten Arm, hob die rechte Schulter und bewegte krampfhaft Lippen und Kiefer.
Seit seiner Jugend litt er an Konvulsionen. So wurde er, als er einst wegen Ungehorsams einen schlechten Rock anziehen und in kniender Stellung seine Mahlzeiten einnehmen sollte, von so schweren Krämpfen erfaßt, daß die Strafe eingestellt werden mußte (M. de Norvins, Histoire de Napoléon, Paris 1838, Bd. I, S. 11).
In dem Mainzer Reisetagebuche von 1804, das von einer ungenannten Hofdame verfaßt worden und in die Constantschen Memoiren aufgenommen ist, heißt es, daß Napoleon am 10. September von seinem epileptischen oder nervösen Leiden befallen wurde, daß Josephine die Adjutanten zu Hilfe rief und daß nach mehrstündiger Unbesinnlichkeit der Anfall sich legte, aber daß der Kaiser verbot, davon zu sprechen. Die mehrstündige Unbesinnlichkeit nach dem Anfall ist bezeichnend für Epilepsie.
Ein anderes Mal fand ihn Constant in einem Anfall zwischen Epilepsie und Alpdrücken im Bett aufgestützt schreiend und zuckend. Nachdem er mit vieler Mühe geweckt worden war, sagte er, er habe von einem Bären geträumt, der ihm die Brust zerrissen habe. Noch deutlicher war der Anfall, den Talleyrand zu sehen bekam. 1805 begleitete er den Kaiser nach Straßburg und sah, wie er nach der Abendmahlzeit in Josephines Zimmer trat, das er hastig wieder verließ, worauf er ihn am Arm nahm, ihn in eine benachbarte Kammer zog, und nachdem er ihn in kaum verständlicher Weise bedeutet hatte, die Tür zu schließen, wie tot zusammenbrach. »Er stöhnte, Schaum trat ihn vor den Mund, und Krämpfe fingen an ihn zu schütteln, die nach einer Viertelstunde aufhörten – Kurz darauf fing er wieder an zu reden kleidete sich wieder an, gebot Stillschweigen, und eine halbe Stunde später war er auf dem Wege nach Karlsruhe« (Constant, Mémoires, Bd. II, S. 16) Da auch Wolseley die für Napoleon so verhängnisvollen Zustände von Bewegungslosigkeit und Hemmung auf Rechnung von Blasenstörungen setzte, ist es am Platz, hier festzustellen, daß außer jenen und in noch höherem Grade als jene epileptische Störungen bestanden, die bekanntlich ebenfalls Abgeschlagenheit, Torpor usw. nach sich ziehen.. Wie viele Epileptiker hatte er einen sehr langsamen Puls, 48 in der Minute, später 60.
Weitere ausgiebige Beweise bietet seine häufige Geistesabwesenheit. So sagt Wolseley, daß der strategisch sehr richtige und glückliche Gedanke Napoleons bei Borodinó infolge einer förmlichen geistigen Lähmung fehlschlug. ( Revue bleue, März 1894.)
Auch bei Bautzen und an der Moskwa hinderte ihn eine plötzliche geistige Trübung, einen Entschluß zu fassen, so daß ihm das Ergebnis des Tages entging, an der Moskwa konnte er sich nicht entschließen, wie seine Generale verlangten, die fliehenden Russen durch seine Reserve verfolgen zu lassen.
War er bis zu seinem dreißigsten Jahre ein Genie gewesen, so hatten seine Geisteskräfte sicher nachgelassen, als er in Warschau sich vornahm, nur aus Verdruß über das Ausbleiben der Antwort Alexanders ein großes, kriegsgeübtes, von Steppe und Klima geschütztes und besonders durch glühenden Patriotismus ausgezeichnetes Volk anzugreifen, und als er dann fast ohne irgendwelche Vorbereitungen und ohne die einfachste Vorsicht, ohne Dolmetscher für die einzelnen Kolonnen anzunehmen, die er in Warschau so leicht hätte bekommen können, ohne für Pelze und Proviantstationen auf dem Rückmarsche zu sorgen, den Marsch antrat, wie Marbot in seinen Memoiren gerügt hat; dieser brachte, weil er jene einfachen Vorsichtsmaßregeln getroffen hatte, seine Kolonne heil zurück.
Ethisches Fühlen. Napoleon hatte mit dem Epileptiker das vollständige Fehlen des ethischen Gefühls gemein, und dies stellt ihn neben die großen mittelalterlichen Condottieri, wie Taine richtig bemerkt hat.
So sagte er bei Cheraseo zu dem savoyischen General, mit dem er über den Waffenstillstand unterhandelte: »Ich hätte Lust, in dem Vertrage, den wir eben geschlossen haben, das schöne Bild von Gerard Dow im Besitze des Königs, das eines seiner besten sein soll, zu verlangen, ich weiß aber nicht, wie ich das Bild in den Vertrag bringen soll, und ich befürchte, daß es sich als eine eigentümliche Neuerung besonders neben der Festung Coni ausnehmen wird.« (Coste de Beauregards Memoiren.) Dies ist die Redeweise eines Briganten, der eine Erpressung ausübt, und ähnlich ist die Äußerung gegenüber Metternich in Dresden, als dieser die Bemerkung fallen ließ, der letzte Krieg habe 200 000 Mann gekostet: »Was sind mir 200 000 Mann!«
Eine vollkommene Illustration dieser Abwesenheit des Sinnes für das Ethische liegt in der sogar offiziellen Wendung des Tagesbefehls Napoleons nach der Rückkehr von der schrecklichen russischen Tragödie: »die Gesundheit des Kaisers war nie besser.« Kein asiatischer Despot auch der ältesten Zeiten hätte sich diese Redensart erlaubt, die in allzu grellem Gegensätze zu der entsetzlichen Katastrophe stand, als deren Abschluß sie verfaßt war.
Madame Rémusat erzählt, daß Napoleon in einem Gespräch mit Josephine geäußert habe: »Ich bin nicht wie ein anderer Mensch, und die Gesetze der Moral und der Schicklichkeit können für mich nicht in Betracht kommen« (Madame Rémusats Memoiren).
Bei einer anderen Gelegenheit soll Napoleon zum Bischof von Gent, der einen Eid zu leisten verweigerte, welcher mit einem voraufgegangenen anderen im Widerspruche stand, und deshalb Gewissensbedenken empfand, gesagt haben: »Ihr Gewissen ist eine Dummheit« (d'Houssonville, zitiert von Taine, s. oben). Als er am Abend des 13. Vendémiaire den Vorbereitungen des Aufstandes der Sektionen zusah, sagte er zu Junot: »Wenn mich die Sektionen zum Führer machten, würde ich sie in zwei Stunden in die Tuilerien bringen und alle die elenden Konventsmitglieder davonjagen«, und fünf Stunden darauf führt er die Konventstruppe und bombardiert Paris wie ein echter Condottiere, der sich nicht untreu wird, sondern sich dem ersten besten zur Verfügung stellt.
Dieser Charakter war ihm angeboren und machte sich bereits in seiner Jugend bemerkbar. Seit seiner Schulzeit hatte er sich versteckt und falsch gezeigt. Ein seiner würdiger Oheim, ebenfalls ein Korse, hatte ihm einst eine glänzende Laufbahn prophezeit, denn er wäre ein Meister der Lüge; dieses Kompliment machte Napoleon übrigens später Metternich.
Was Wunder auch, sagt Taine, daß er auf den Ballfesten den Damen mit unpassenden Worten lästig fällt, sich in ihr Privatleben mischt und ihren eigenen Gatten dann von den Gunstbezeigungen Mitteilung macht, mit denen ihn diese mehr oder weniger freiwillig bedacht hatten.
Sein Zynismus ging so weit, daß er einst bei einem öffentlichen Feste einer verheirateten Dame, die von seinen Vertraulichkeiten gesprochen hatte, Öl auf das Kleid goß, wie es etwa ein Gasparone gemacht hätte.
Man muß die erst jetzt veröffentlichte, früher nicht zugängliche Korrespondenz lesen, um sich zu überzeugen, wie er neben seiner klassisch-monumentalen, cäsarischen Ausdrucksweise, die er in seinen Erlassen anzuwenden pflegte, eine zynische, koprolalische Art zu reden hatte, ähnlich wie die Banditen, eine Art Argot. Viele der schlimmsten Briefe sind übrigens verschwunden und werden wohl nie zum Vorschein kommen.
Noch schlimmer und gefährlicher war, daß er diese Manieren auch im Verkehr mit den Souveränen und den Ministern der fremden Staaten beibehielt und diese in den Proklamationen, Briefen und bei den Empfängen in niedriger Weise beschimpfte, ihre angeblichen oder wirklichen Liebesaffären öffentlich besprach usw. Auch erblickte er eine persönliche Beleidigung darin, wenn diese bei ihren Schritten diesem oder jenem Funktionär Aufträge gaben, ohne ihn in Kenntnis zu setzen, und er verlangte sogar, daß sie seinetwegen ihre Hausgesetze ändern sollten, indem er erklärte, er könne mit einer Regierung nicht gut im Einverständnis leben, die nicht imstande sei, Dinge zu unterdrücken, die einem befreundeten Staate nicht behagten.
Sein unermeßlicher Egoismus zeigte sich, als er in Ägypten und Rußland die Armee verließ, die ganz auf ihn angewiesen war, um sich selbst zu retten. Seine Brüder und Verwandten und viele seiner Generale zeichnete er nur deswegen durch Titel und Beförderungen aus, weil er sie dadurch gefügig machte und ihr Glanz um so stärker auf ihn zurückstrahlte, in Wahrheit benutzte er sie zur erbarmungslosen Durchführung seiner Interessen bei ihren Landsleuten. Als er das erstemal nach Italien kam, sprach er anfangs nur von »seinen Soldaten« und »seiner Armee«, später dagegen hieß es immer »meine Völker«, »mein Senat«, sogar »meine Bischöfe«, »meine Kardinäle«, als wenn dies alles sein Spielzeug wäre.
»Um im Sturme des Lebens so starke und verschiedenartige Leidenschaften zu bändigen, zu vereinigen und dienstbar zu machen,« sagt Taine, »bedurfte es einer Riesenkraft.« Diese Kraft fand Napoleon in seinem starken erobernden Egoismus, nicht in dem gewöhnlichen Trägheitsegoismus, und dieser aktive Egoismus war bei ihm so entwickelt, daß er ein maßloses Ich schaffen konnte, das in dem gewaltigen Betätigungsgebiete, das er sich angemaßt hatte, keine andere Existenz ertragen konnte außer als Folie oder Werkzeug der eigenen.
Dieser Egoismus bestand bei ihm schon als Kind: er war widersetzlich bei jeder Zurechtweisung, skrupellos, konnte keine Rivalität ertragen, wurde tätlich gegen den, der sich nicht unterordnete, dazu bezichtigte er seine Opfer gleichzeitig, sie hätten ihn angegriffen.
Er sah die Welt an wie ein großes Bankett, das jedem offen stand und zu dem, um recht satt zu werden, man recht lange Arme mitbringen, sich zuerst bedienen, den anderen nur lassen muß, was übrigbleibt.
»Der Mensch«, sagt er selbst, »wird beherrscht durch seine eigene egoistische Leidenschaft, durch Furcht, Habsucht, Eigenliebe, Eifersucht. Wer Widerstand leistet, wird vernichtet.«
Von dieser Anschauungsweise trennte sich Napoleon nie, er hätte es auch nicht gekonnt, denn es lag in seinem Charakter; er sah die Menschen so, wie es für ihn gut war.
Der Egoismus zeigt sich auch in feinem Ehrgeize, der ihn so beherrschte, daß er ihm schließlich zum Opfer fiel.
Erkenntlichkeit war ihm fremd, wenn eines seiner Werkzeuge ihm nicht mehr diente, warf er es weg.
Bei diesem Charakter war ein Zusammenleben mit irgendeiner Gesellschaft ausgeschlossen. Der Friede war für ihn ein Waffenstillstand, aus den ein neuer Krieg zu folgen hatte. Und aus diesem Grunde vereinigten sich nach 1809, nachdem diese Erfahrung feststand, allmählich alle europäischen Völker gegen ihn.
Napoleon war gewiß nicht der erste, der zeit seines Lebens die Menschheit mißhandelte, auch andere haben es getan, aber um eines nationalen oder dynastischen Interesses willen. Die Staatsraison rechtfertigt gewiß viele Eingriffe und Härten, ist jedoch, besonders in Beziehung auf das Ausland, ein notwendiges Prinzip. Statt daß aber Napoleon die eigene Person dem Staate untergeordnet hätte, ordnete er den Staat seiner Person unter, er blickte nicht in die Zukunft, er opferte die Zukunft der Gegenwart. »Wenn mein Nachfolger ein Tor ist,« sagte er, »so ist das eben schlimm für ihn.« Er knechtete die Presse durch die Zensur und verhinderte sogar das Erscheinen statistischer und ökonomischer Werke, wenn sie seine Unfehlbarkeit in Zweifel zu ziehen schienen. Was er von der Schule wünschte, ersieht man aus folgender Zuschrift an die Staatsräte: »Bei der Errichtung des Lehrkörpers ist mein Zweck, ein Mittel zu besitzen, die öffentliche Meinung in Politik und Moral zu leiten.«
»Die Schule«, sagt Renan richtig ( Revue des deux mondes, 1892), »war für ihn die Vorstufe zur Akademie.«
G. Giorio wurde verurteilt, weil er den Orden der Eisernen Krone mit einem Scherzwort belegt hatte, und Lattanzio kam ins Irrenhaus, weil er gesagt hatte, er würde König von Italien werden (Cantù, Cronistoria).
Sein Bruder Joseph sagte, Napoleon würde es keine Ruhe gelassen haben, wenn er sich hätte vorstellen sollen, daß nach seinem Tode alles ruhig und in Frieden ablaufen würde.
Er treibt Frankreich ins Verderben, indem er es durch einen Vertrauensmißbrauch zu täuschen weiß, der allmählich um so ärger wird, je mehr durch seine Schuld der Zwiespalt zwischen dem eigenen Interesse, wie er es verstand, und dem Interesse der anderen wuchs.
Im Testament von St. Helena vom 25. April 1821 drückt er den Wunsch aus, »am Ufer der Seine, inmitten des französischen Volks, das er so sehr geliebt habe«, begraben zu sein. Gewiß liebte Napoleon Frankreich, aber etwa so wie einer sein Pferd liebt; geht es ihm zugrunde, so bedauert er wohl den Schaden und den Spott und nur nebenbei das arme Tier (Taine).
Napoleon fiel als Sklave seiner monströsen Pläne und seines maßlosen Ehrgeizes. Auch wenn der Zug nach Rußland nicht fehlgegangen wäre, so wäre wohl ein anderes Unglück hereingebrochen. Um ein Gefüge wie das Napoleonische Reich zusammenzuhalten, bedurfte es einer außergewöhnlichen Kraftentfaltung, das Schicksal von Napoleons Untertanen beschränkte sich auf die militärische oder auf die Beamtenlaufbahn.
Vier Millionen Opfer, zwei fremde Invasionen, große Territorialverluste Frankreichs, seine Isolierung und Versetzung in eine mit Haß und vielfachen Verdächtigungen beobachtete, bedrohte Ausnahmestellung, das ist das politische Werk Napoleons, das Ergebnis seines vom Genie unterstützten Egoismus. Für den weiteren Aufbau Europas ebenso wie für den Frankreichs hat dieser souveräne Egoismus einen Konstruktionsfehler im Gefolge gehabt (Taine, Revue des deux mondes, 1896). Noch mehr: Mit seiner irregeleiteten Ruhmbegier hat Napoleon dasjenige verschuldet, was man die bureaukratisch-militärische Degeneration Frankreichs nennen kann, die schlimmste der Plagen, die einem Kulturvolke zufallen kann.
Haltlosigkeit. Der Mangel an Hemmung, der den Epileptikern eigentümlich ist, zeigte sich besonders auch in plötzlichen rohen Akten, die sehr häufig bei ihm waren. Man erzählt, er habe Volnay einen Fußtritt gegeben, als dieser sagte: »Frankreich will die Bourbonen,« und Berthier soll von ihm einen Faustschlag erhalten haben, als er ihn zur Unzeit »König der Franzosen« grüßte. Bonfadini sagt von ihm, er hätte seine Rücksichtslosigkeit für Würde, seine Laune für Moral, seinen Zorn für Gerechtigkeit und seine Impertinenz für die Wahrheit gehalten.
1812 schalt er den russischen Gesandten Belatschew einen Taugenichts. Während der Friedensverhandlungen mit dem Grafen Coblentz brach er eine wertvolle Vase entzwei und rief dabei: Ich werde eure Monarchie wie dies hier zerbrechen. Als vor Boulogne der Admiral sich weigerte, das Geschwader am Strande zusammenzuziehen, wie er verlangte, da Sturm drohte, eine Weigerung, die ihm die Flotte rettete, erhob er gegen ihn die Reitpeitsche, wie er es übrigens gegen seine Reitknechte öfter tat. Diese Haltlosigkeiten kamen auch in Verfügungen vor. So schrieb er an den Prinzen Eugen: »Von Seiner Majestät müssen Sie Order erwarten, wäre es auch nur, um die Decke in Ihrem Zimmer frisch anzustreichen, und wenn Mailand in Flammen stände, so müßten Sie Anweisung von dort erwarten, sollte auch die ganze Stadt während des Wartens abbrennen.«
Das eine Mal warf er seinen Bruder Louis in roher Weise zur Tür hinaus. 1813 richtete er an Metternich in Dresden in einem Augenblicke, wo er seiner sogar bedurfte, die brutale Frage, wieviel England ihm bezahlt habe, damit er seine Rolle in dieser Weise durchführe.
Er war so ungeduldig, daß er die Kleider, die ihm nicht sofort paßten, ins Feuer warf, seine Schrift war höchst flüchtig, er diktierte mit fabelhafter Geschwindigkeit: wehe dem, der nicht mitkam; statt sich zu wiederholen, brach er in Scheltworte und Schmähungen aus, was manchmal von seinen Sekretären absichtlich herbeigeführt wurde, um eine Ruhepause zu gewinnen.
Diese Hemmungslosigkeit und Gewalttätigkeit zeigte er von Jugend auf. Er rühmte sich Antonmarchi gegenüber (l. c. Bd. I, S. 352), daß er als Knabe sich vor niemandem gefürchtet, alle geschlagen und gekratzt habe, besonders seinen Bruder Joseph, den er so geschlagen und gebissen hatte, daß er das Bett hüten mußte, und den er bei den Lehrern denunzierte, noch ehe er sich erholt hatte.
Im ganzen, sagt Taine, war er ein »Condottiere« von hoher Begabung, der mit Völkern, Religionen, Regierungen in unvergleichlich geschickter und erbarmungsloser Weise sein Spiel trieb, trefflich zu verführen und einzuschüchtern verstand, aber auch wie ein losgelassenes Raubtier zu hausen imstande war.
Intelligenz. Seine Intelligenz war außerordentlich, aber zugleich abnorm bei ihrem Umfange. Der glaubwürdige Marbot ( Mémoires, Bd. III) erzählt, daß er außerordentliche Widerstandskraft des Nervensystems besaß, er vertrug unglaubliche Anstrengungen, war täglich zehn bis zwölf Stunden im Sattel, schlief kaum vier bis sechs, oft mit Unterbrechungen, indem er sich für die Unterschriften wecken ließ, worauf er sofort wieder einschlief, und dies in der Nacht vor einer Schlacht, die ihn den ganzen Tag im Sattel halten konnte. In Paris war er imstande, nach einem starken Arbeitstage mitten in der Nacht aufzustehen und mehreren Sekretären, die wie die Schildwachen wechselten, mit einer solchen Genauigkeit, daß nichts mehr verbessert zu werden brauchte, zu diktieren, dann erledigte er Beratungen mit Ministern, empfing Künstler, Schriftsteller usw.
Die Menge des Tatsachenmaterials, sagt Taine, das er gegenwärtig hatte, und der Ideenreichtum, der ihm zur Verfügung stand, scheint menschliches Fassungsvermögen zu überschreiten. Dabei dachte er immer praktisch, verlor nie das Wirkliche aus dem Auge, in lebhaftem Kontrast mit der theoretisch-klassischen, zu Abstraktionen verleitenden Ausbildung, Feind aller unnützen Theorienbildung. »Ich denke rascher als alle anderen Menschen,« sagte er selbst (Jung, Memoiren).
In der Art, andere zu beherrschen, war sein Genie unerreicht. Wie es die experimentelle Wissenschaft tut, pflegte er jede Voraussetzung und jede Schlußfolgerung durch genaue Ermittlungen in eigens dazu vorbereiteten Umständen zu prüfen. Seine Aussprüche sind oft äußerst packend. »Die Freiheit«, sagte er einst, und diesem Gedanken blieb er sein Leben lang treu, »ist das Bedürfnis einer kleinen Schar, die höher begabt ist als die gewöhnliche Menschheit, man kann sie also verringern oder ungestraft verletzen; was die Massen wünschen, ist die Gleichheit.«
Er besaß aber auch eine Eigenschaft, die eigentlich im Mittelalter zu Hause ist, eine mächtige, verblüffende Phantasie. Wie stark auch bei ihm die praktische Seite entwickelt war, diese sozusagen dichterische Begabung war noch größer, ihr Schwung wurde übermächtig, und das Übermaß wurde Wahnsinn. Er war wohl ein Großer, aber in seiner Größe plante er das Ungeheure. Wie gewaltige, wie riesige Entwürfe stiegen im Wettstreit in seinem wunderbaren Kopfe auf! »Europa«, sagte er wie ein größenwahnsinniger Irrer, »ist ein Maulwurfshaufen. Nur im Osten, wo sechshundert Millionen Menschen leben, kann man große Reiche gründen und große Revolutionen machen.« Von Ägypten aus wollte er Syrien erobern, in Konstantinopel ein orientalisches Reich begründen und über Adrianopel und Wien nach Paris zurückkehren.
Der Orient lockte ihn mit seiner Fata Morgana des Absolutismus, und im Orient suchte er auch die Möglichkeit, als neuer Mohammed eine neue Religion zu schaffen. Und während er in Europa das Reich Karls des Großen wieder aufzurichten strebte und Fürsten, Könige, Päpste als seine Vasallen in Paris als geographischem, religiösem und intellektuellem Zentrum Europas zu leben zwang, suchte er durch Rußland wieder nach dem Ganges und nach Indien zu gelangen.
»Aus der Hülle des Politikers erscheint also plötzlich ein Künstler, der im Gebiete des Idealen und des Unmöglichen schafft, man erkennt den Vogel sogleich an seinen Federn, es ist ein nachgeborner Bruder Dantes und Michelangelos, mit dem Unterschiede, daß diese beiden auf Papier und in Marmor, er am Lebenden, am fühlenden, duldenden Fleische arbeitete« (Taine), wie ich hinzufügen will, mit der Gleichgültigkeit des moralisch Irrsinnigen.
»Weder bei den Malatesta noch bei den Borgia findet sich ein so unruhiger Kopf, in dem der innere Sturm so unablässig, so gefährlich, so unvermittelt, so unabwehrbar getobt hätte. Bei ihm bleibt keine Idee bloßer Entwurf, eine jede ruft eine innere Spannung hervor, die sich plötzlich in eine Handlung umsetzt,« sagt Taine weiter und setzt hinzu, »und hierin zeigt er in merkwürdiger Weise ganz das Wesen der Intelligenz des Epileptikers auf ihrer höchsten Staffel.«
Aber wie die Epileptiker hat Napoleon Augenblicke stärkerer Abstumpfung, die ihn dem schwächst organisierten Durchschnittler unterordnen und ihn zu den schwersten Fehlern veranlassen, so, als er gegen den Rat aller und in völliger Blindheit gegen den einfachsten Sachverhalt der Dinge den Zug nach Rußland antrat.
Wiewohl er sich viel mit den Verhältnissen Europas beschäftigt hatte – bemerkt Ferrero ganz richtig –, so konnte er sich doch nie eine zutreffende Idee von der sozialen Lage seiner Völkerschaften bilden, daher die Trivialität seines Urteils: Konstantinopel als Weltreich, Europa wird in hundert Jahren russisch sein oder Republik. Niemals zog er eine Entwicklung ohne Krieg in Betracht, in der die Energie der Völker sich auf die inneren Verhältnisse wenden könnte, nie eine Entfaltung des Mittelstandes. Auf das Soziale verstand er sich eben nicht, denn sein Verstand war, wie Ferrero sagt, derjenige eines Gewaltmenschen, auf Augenblicke durchzuckt von einzelnen Erleuchtungen, aber er konnte kein ruhiges Licht verbreiten, das allen zugute kam: er erriet das Wahre in glücklichen Momenten, aber er vermochte es nicht, seine glücklichen Eingebungen in Verbindung zu bringen.
In den letzten Jahren fehlte es bei ihm nicht an Erscheinungen beginnender Geistesschwäche, so z. B. wenn er in Warschau, Wilna, Moskau immer wiederholt, er wolle Karl XII. nicht nachahmen, dessen Biographie er beständig las, und dessen Beispiel er doch vielfach folgte (Marbot), wenn auch mit Unglück. So wurde denn seine leichtsinnige Eroberungslust, die Unmöglichkeit für ihn, ein Gebiet, das er einmal okkupiert hatte, zu verlassen, von seinen Feinden geradezu benutzt, um ihn nach Moskau zu ziehen, wie Wereschtschagin Wassili Wereschtschagin, Napoleon I. en Russie, Paris. auseinandergesetzt hat, und als der Winter hereinbrach, wollte er nicht nur Moskau nicht verlassen, sondern sogar nach Petersburg gehen. Er schlief indessen wie ein Sybarit den ganzen Tag, so daß er korpulent wurde, ohne an die Armee zu denken, die in der abgebrannten Stadt statt nach Lebensmitteln nach Alkohol suchte, und schickte fortwährend Boten mit Briefen an Alexander, um Frieden schließen zu können, indem er nicht bedachte, daß dies nicht die richtige Art sei, ihn zu erhalten, und indem er seine Zeit damit verlor, die Tataren aufzuwiegeln, sich Verse vorlesen zu lassen und das neue Reglement der Comédie française abzufassen.
Widersprüchigkeit und Stimmungsanomalien. Mit dieser Anlage steht die merkwürdige Widersprüchigkeit in seiner Politik in Verbindung, die zuweilen zutage tritt, z. B. als er den katholischen Kultus in Frankreich wieder einführte und dabei den Papst gefangen setzte. Beständig hatte er die Engländer bekämpft, und als er niedergeworfen ist, ergibt er sich diesen und nicht den Amerikanern. Er verbietet der Gérardin den Zutritt zu Hofe, da sie sich hat scheiden lassen, und läßt sich doch selbst scheiden. Er erklärt, sein Ruhm und sein Geschlecht datiere von Marengo, und hinterher ahmt er alles überflüssige und pompöse dynastische und heraldische Beiwerk in sklavischer Art nach.
Eine seiner merkwürdigsten Eigenheiten ist die Leidenschaft, Ehen zu stiften. Aristide Provençal, Della gamomania di Napoleone il Grande, 1883. Tebaldi, Napoleone, 1885. Die Zahl der von ihm zusammengestellten und auferlegten Eheschließungen ist außerordentlich: schon in seiner ersten Garnison vermittelte er die Ehe zwischen der Tochter seines Portiers und einem jungen Manne seiner Bekanntschaft, später verheiratete er seine Brüder, Neffen, Schwestern und beinahe alle seine Generale. Will einer von diesen eine seiner Schwestern nicht ehelichen, so bietet er sie einem andern an, aber in zwei Tagen muß die Ehe geschlossen werden. Auch in St. Helena fuhr er noch fort, Ehen zwischen seinem Hauspersonal, den Generals- und Beamtensöhnen und -töchtern seines Gefolges zu stiften, und noch in seinem Testamente wollte er den Herzog von Istrien mit einer Tochter Durocs verheiraten.
Er hatte gar keinen künstlerischen Genuß an der Malerei; wie die römischen Feldherren taxierte er die Bilder nach der Größe. In seiner Korrespondenz findet sich die Bestellung von vier Gemälden von 3 Meter und 3 Dezimeter Höhe und 4 Meter Länge zum Preise von 12 000 Franken für jedes, und von vier anderen, je 1 Meter 8 Dezimeter hoch zum Preis von 600 Franken ( Correspondances, Bd. 12, S. 124).
Es hieß, und dies war wahr, daß er an seinen Stern glaubte. In St. Helena soll er Furcht vor einem Kometen geäußert haben. Den Freitag hielt er für einen Unglückstag, und einmal fürchtete er für Josephines Leben, als das Glas ihres Bildes entzweibrach, das er immer bei sich trug. Zu Schlachttagen wählte er die ihm günstig erscheinenden Wochentage aus und kam so auf den antiken Aberglauben wieder zurück.
Er hatte auch rudimentäre Zwangsvorstellungen, z. B. jene, die er selbst als Chef einer Truppenabteilung nicht loswerden konnte, beim Durchzug durch die Straßen die Fenster zählen zu müssen.
In dieser großen historischen Erscheinung haben wir also einen sehr deutlichen Beweis vor uns dafür, daß sich die Epilepsie nicht nur mit dem Genie zusammen vorfindet, sondern daß sie mit ihm verschmilzt, und zwar nicht nur die konvulsive, sondern auch die psychische, die sich in Hemmungslosigkeit, Geistesabwesenheit, Zynismus, exzessivem Egoismus und Größenwahn äußert, und von diesem Beispiel, welches, wie Julius Cäsars Betrachtung zeigt, nicht das einzige seiner Art ist, kann man auf die Möglichkeit schließen, daß die Epilepsie dem Genie zugrunde liegen könne.
Über Zola besitzen wir eine eingehende psychiatrische Studie nach dem Leben von dem ausgezeichneten Irrenarzte Toulouse, die uns hier um so mehr interessieren muß, da sie eigentlich die Ungegründetheit meiner Theorie nachweisen sollte und deshalb durchaus nicht parteiisch genannt werden kann. Toulouse, Emile Zola, Paris 1896. Vgl. auch meinen Aufsatz in der Semaine médicale, 1897.
Die Arbeit Toulouses war gegen mich gerichtet, aber in der Erfahrungswissenschaft gilt die Tendenz nichts, die Beobachtung dagegen alles. Diese hat sich indes gegen den Autor gerichtet, der sie nicht anerkennen wollte und manches nicht auf Grund, sondern trotz dieser Tatsachen gefolgert hat.
Wir haben also in diesem Falle nichts anderes zu tun, als von neuem das Tatsächliche anzuführen, bloße Meinungsäußerung würde zu nichts nütze sein. Schreiten wir also zur Nachprüfung!
Toulouse teilt zunächst mit, daß Zola der Sohn eines Italieners von guter Begabung und naturwissenschaftlicher Richtung (Ingenieur) und einer Französin war, und daß unter Zolas Vorfahren Slawen oder Dalmatiner und Griechen sich befunden haben. Was folgt, fragt Toulouse, aus dieser Ahnenschaft? Nichts Sicheres (S. 112).
Nun habe ich in meinem »Genialen Menschen« und im »Politischen Verbrechen«, ohne übrigens auf ein Verdienst Anspruch zu machen, da viele andere es bereits vorher ausgesprochen hatten, folgendes nachgewiesen: daß die Rassen und Familien, bei deren Entstehung die meisten ethnischen Kreuzungen vorgekommen seien, ein Maximum an Genialität und Revolutionen ergäben. Dies ist der Fall z. B. bei den Ioniern gegenüber den Doriern im alten Griechenland, bei den Japanern gegenüber den Chinesen, und auch die rasch emporgeschossene polnische Kultur beruhte auf dem germanischen Einschlage in eine eben erst sich konsolidierende slawische Völkerschaft; die großen wissenschaftlichen Geister Frankreichs wieder sind zum erheblichen Teil aus der Franche-Comté hervorgegangen, wo die Vermischung mit deutschem Blute besonders stark war (Nodier, Cuvier u. a.), und unter den Genies, die ähnliche Abstammung erkennen lassen, habe ich ausdrücklich neben Viktor Hugo, Graf u. a. auch Zola angeführt.
Aber auch eine andere Tatsache muß ich hier noch betonen, nämlich diejenige, die ich klimatische Überwanderung genannt habe, die Verpflanzung der Familie von Griechenland nach Italien, von Italien nach Frankreich. Diese Verpflanzung hat, wie ich am Beispiel der Nordamerikaner und Juden gezeigt habe, wunderbare Folgen rücksichtlich der Erzeugung von Genies und von Fortschritten des Menschengeistes gehabt, derart, daß z. B. die Juden in ihrem Stammlande oder dessen Nachbargebieten, wie Arabien und Abyssinien, nie die große Quote der Genies gegeben haben wie in Europa, obgleich hier allerdings der Verpflanzung bereits durch den ethnischen Faktor nachgeholfen war.
Bei Zola nun, sage ich hier nochmals, hat sich zum ethnischen Kreuzungs- noch der klimatische Überwanderungsfaktor gesellt.
Ferner ergibt sich aus Marros und Orschanskis sowie aus meinen eigenen Untersuchungen der Einfluß der Heredität: der Vater war relativ alt, 44 Jahre, so daß er bereits sieben Jahre nach seiner Geburt starb. Nun ist die Zahl der genialen Männer, die Väter in vorgeschrittenerem oder höherem Alter aufweisen, nicht gering: ich nenne Balzac, Burns, Israel, Bizzozzero, Schopenhauer, Friedrich II., Napoleon I., Jussieu, und Marro lehrte, daß das reifere Alter der Erzeuger bei den Kindern Entartung hervorbringt. Aber eine weitere erbliche Veranlagung tritt noch hinzu: die Mutter litt an einer Herz- und Gelenkaffektion, nervösen Krisen hystero-epileptischer Art, Zuckungen mit Starrheit der Glieder und Krämpfen, und manchmal auch an daran sich anschließenden sensiblen Störungen, aber nicht an ausgesprochenem Mangel an Erinnerung für diese krankhaften Vorgänge (also wohl doch teilweise?). Hier ist nicht alles klar. Was für Anfälle waren dies? Vielleicht Halluzinationen?
Dies ist um so wahrscheinlicher, als sie in den letzten Lebenstagen von einer delirösen Verwirrtheit, besonders nachts befallen wurde, was im Gegensatz zu der Behauptung Toulouses steht, daß die Nervenkrisen im Alter an Intensität abnahmen. Die Mutter litt also augenscheinlich wenigstens an Hysterie, wenn nicht an Epilepsie.
Bei den übrigen Verwandten, Großvater und Oheimen mütterlicherseits, scheint mehrfach Herzleiden vorgelegen zu haben.
Toulouse berichtet über die Kindheit Zolas, daß dieser im Alter von zwei Jahren von einem sehr heftigen Fieber befallen und während einiger Stunden für tot gehalten worden sei. Wie bedenklich dieser Anfall war, dem Toulouse keine Bedeutung beilegt, ergibt sich aus Fehlern der Aussprache, die beim Kinde zu bemerken waren und die ihm im späteren Alter noch anhafteten. Was aber noch wichtiger ist, ist der Umstand, daß bei Zola bereits vom sechsten Lebensjahre an, wie eines seiner Bilder zeigt, die rechte Augenlidspalte kleiner ist als die linke, und zwar zeigt sich dies auch noch auf seinen späteren Photographien. Ich möchte noch hinzusetzen, daß aus der Photographie aus dem Knabenalter die Stirn ein hydrozephales Aussehen zeigt, und daß sonst mächtige Unterkiefer, Jochbeine und sehr lange Oberlippe am Bilde auffallen; die Nase ist stumpf und etwas eingedrückt.
Mit 18 Jahren bekam Zola ein typhöses Fieber mit Schwindel und Delirien, in demselben Alter wurde er geschlechtlich reif; dies läßt auf eine langsame Entwicklung schließen, die vielleicht damit zusammenhängt, daß sein Vater nicht mehr jung war. Mit 20 Jahren mußte er darben, später (bis zu 40 Jahren) litt er an Verdauungsstörungen, dann an Brustbräune, Blasenleiden, Rippenneuralgien, Gelenkrheumatismus, hysterischen Erscheinungen (so fühlte er sein Herz im Arme pulsieren). Mit 30 Jahren entstanden die krankhaften Vorstellungen, mit denen wir uns besonders zu beschäftigen haben werden. Mit 35 Jahren etwa wurde er unförmlich dick, unterzog sich aber dann mit Erfolg einer Entfettungskur. In der Schule zeigte er nur im Aufsatz Begabung. Später fiel er im schriftlichen Examen im Deutschen, in Geschichte und Literatur durch, und bei der Wiederholung seines Examens in Marseille ging es ihm wiederum so. Das bestätigt, daß das Genie von der Umgebung nicht nur nicht begünstigt, sondern sogar benachteiligt wird, wenigstens auf der Schule. Im »Genialen Menschen« habe ich nachgewiesen, daß die größten Männer auf der Schule durchfielen, so Verdi und Rossini sogar in der Musik, und auch Klaproth und Newton wurden von ihren Lehrern für Dummköpfe gehalten.
Codridge hat gesagt, daß er auf der Schule geistig beengt gewesen und hinsichtlich seiner wissenschaftlichen Anschauungen nie richtig verstanden worden sei, Pestalozzi und Crébillon wurden beim Verlassen der Universität als » insignes nebulones« bezeichnet und Cabanès mußte sogar abgehen. Diderot galt für die Schande der Familie, und Balzac verbrannte ein Lehrer ein Manuskript über den »Willen«, ohne es vorher auch nur durchzulesen. Dies beweist, daß die Umgebung dem wahren Genie feindlich ist, und auch die Schule ist ein Durchschnitt der Umgebung.
Zola hat sich nach Toulouse nur deswegen der Literatur gewidmet, weil ihm der Zugang zu allen sonstigen geistigen Berufen verschlossen war, sein Unglück beim Examen wurde also hier sein Glück.
Zola maß 1,705 Meter Höhe, klafterte aber mit ausgestreckten Armen 1,77 Meter, ein um so größerer Unterschied, s als er als Kopfarbeiter doch die oberen Extremitäten nicht grob anzustrengen brauchte; wenn wir Lacassagnes und anderer Ansicht hier folgen, so findet sich dieses Verhalten häufig bei den Kriminellen und stellt einen degenerativen Zug vor.
Hinsichtlich der Schädelmessung sind Toulouses Angaben, der hier ganz besonders genau sein will, aber nur die Schädelkapselmaße anführt, völlig ungenügend.
| Zolas Kopfmaße waren: | Mittel von Frankreich | |
| Durchmesser von vorn nach hinten | 191 mm | 190,6 mm |
| Metopischer Durchmesser | 189 mm | 187,6 mm |
| Querdurchmesser | 156 mm | 164,4 mm |
| Höhendurchmesser | 143 mm | 134,0 mm |
| Kleinster Stirndurchmesser | 103 mm | 134,0 mm |
| Jochbeindurchmesser | 146 mm | 142,0 mm |
Wir sehen also, daß bei Zola der Durchmesser von vorn nach hinten im Vergleich zur Norm nur sehr wenig größer ist, der Höhendurchmesser ist ebenso wie der der Stirn bedeutend reichlicher, der kleine Stirndurchmesser ist nicht zu vergleichen; was den Jochbeindurchmesser angeht, so ist dieser beträchtlich größer als der Durchschnitt, wie es bereits aus der Photographie zu ersehen ist; dies ist ein degeneratives Zeichen (Eurygnathie) oder ein Zeichen niederer Rasse.
Wie stark die Schädelkapazität Zolas die mittlere überragt, ist aus diesen Ziffern nicht genau zu ersehen. Hätten sich der Schädelumfang und das Maß der Schädelkrümmung in Länge und Breite unter den von Toulouse vorgenommenen Messungen befunden, so würde man daraus haben einen Schluß ziehen können. Bei diesem Gegenstände möchte ich einmal (und in meinem Alter darf ich es wohl) gegen Bedeutendere den Lehrer spielen und zum Ausdruck bringen, daß viele deutsche und französische Anthropologen sich oft ganz unnütz in solchen Kleinigkeiten verlieren, ohne daß ich ein Gegner der Anthropologie oder Anthropometrie wäre, die ich doch selbst so vielfach angewandt habe, als sie noch wenig bekannt und beliebt war, und von der ich in der klinischen Untersuchung der Mikrozephalen, geborenen Schwachsinnigen usw. oft Gebrauch gemacht habe. (S. meine Klinischen Beiträge zur Psychiatrie, 1870.)
Als der Schöpfer der Anthropologie, Broca, gestorben war, dem man kleine Übertreibungen bei den Messungen wohl nachsehen konnte, da er letztere eingeführt hatte, übertrafen ihn seine Nachfolger, wie weiland jene des Alexander diesen, in seinen Fehlern, ohne ihm in den Vorzügen gleichzukommen, und überschütteten uns mit einer Unzahl unnötiger und unnötig genauer Zahlenmaße, die beim Kopfe, als einer nicht regelmäßigen Figur, besonders beim Lebenden, kaum irgendeinen Wert haben, auch wurden häufig aus Pseudo-Exaktheit gerade wichtige andere Maße vernachlässigt und außer acht gelassen, daß die verglichenen Mittel für verschiedene Staturen galten. Bei einem Durchschnitt von 1,65 Meter maß Zola 1,70 Meter, weswegen diese Zahlen streng genommen auch gar nicht verglichen werden dürfen. Weshalb benützt Toulouse in solchen Fällen nicht den Tachyanthropometer Anfosso, der das entsprechende Maß automatisch auf Papier bringt und genau abzulesen gestattet? Was das Ohr angeht, so finde ich eine Menge Daten. Ich glaube aber, mehr Einfachheit und Klarheit wäre besser gewesen; warum werden z. B. nur die Maße des rechten und nicht des linken Ohrs gegeben? warum wird nicht gesagt, daß das Ohr »angewachsen« und langer als in der Norm ist? Und warum heißt es bei Toulouse und Manouvrier von den vielen Hautfalten auf der Stirn, die doch seit dem siebenten Lebensjahre vorhanden waren, es seien Zeichen von Gemütserregbarkeit? Warum erinnert er sich nicht, daß ich und Ottolenghi C. Lombroso, Der Verbrecher, Bd. I, Hamburg, 1887. – Rughe anomale speciali ai criminali ( Archivio di Psichiatria, 1890, S. 90). – Ottolenghi, La canizie, la calvizie e le rughe nei criminali in rapportu ai normal!, agli epilettici ed ni cretini ( Archivio di Psichiatria, 1889, S. 41). Cognetti, Le rughe nei pazzi ( Archivio di Psichiatria, 1895, S. 552). diese als eines der hervorspringendsten Merkmale der atavistischen Degeneration, besonders beim Kriminellen, Epileptiker und Kretin nachgewiesen haben? Warum führt er nicht den Greiffuß oder wenigstens die größere Beweglichkeit der großen Zehe Zolas als Degenerationszeichen an Ottolenghi und Carrara, II piede prensile negli alienati, nei delinquenti e negli epilettici (Archivio di Psichiatria, 1892, S. 273). und warum untersucht er nicht den Puls mit Hilfe des Pletysmographen und Hydrosphygmographen, besonders in bezug auf die Vorstellungs- und Gefühlstätigkeit?
Warum untersucht er nur den Urin zweier Tage und nicht in bezug auf Stickstoffgehalt, Phosphate etc. an den Tagen der stärksten geistigen Arbeit? Und warum erhalten wir keine genaue quantitative Auskunft über die Nahrung in den wenigen Tagen, in denen die Analyse statthatte, besonders da schwere Abnormitäten des Harns, wie die Anwesenheit von Eiweiß, bestanden?
Die dynamometrische Prüfung mit der Methode Henri ist zweckmäßig. Es wurde ermittelt brüskes Nachlassen des Drucks, eine ausgiebige, kurzdauernde Bewegung und eine rasche Abnahme im Vergleich zur Norm.
Warum wird Zolas Zittern, das bei Gemütsbewegungen besonders stark ist, nicht mit der graphischen Methode untersucht, ehe ausgesprochen wird, daß es nicht organischen Ursprungs ist? Warum wird die Berührungsempfindung am Vorderarm, am Halse, am Nacken, an der Nasenspitze, an der Rückseite der Finger, wo die Empfindung bei allen Individuen eine gewaltige Variationsbreite ergibt und keine Sicherheit in der Vergleichung besteht, so eingehend studiert, und warum ist die Sensibilität der Zungenspitze nicht geprüft worden, wo sie am genauesten und gleichmäßigsten zu ermitteln ist?
Ferner irrt Toulouse sehr, wenn er, nachdem er festgestellt hat, daß die Sensibilität an der Spitze des rechten Zeigefingers 2 Millimeter, und am linken Zeigefinger 1 Millimeter beträgt, schließt, daß »zwischen rechts und links kein Unterschied sei und daß es scheint, daß Zola rechts besser fühlt«. Es ist unnötig, hier noch ein Wort hinzuzufügen, um zu beweisen, daß gerade das Gegenteil der Fall ist, d. h. daß er gerade links besser fühlt als rechts, ein Verhalten, das ich für degenerativ erklärt und mit dem Ausdrucke »sensorischer Mancinismus« belegt habe. C. Lombroso, Il mancinismo sensorio ed il tatto nei delinquenti e nei pazzi (Arch. di Psichiatria, 1883, S. 441). Sui mancinismo e destrismo tattile nei sani, nei pazzi, nei ciechi, nei sordomuti (Arch. di Psichiatria, 1884, S. 187).
Die allgemeine und die Schmerzempfindung hat Toulouse nicht wissenschaftlich genau gemessen. Er prüfte sie mit einem in der Wissenschaft nicht gebräuchlichen Instrumente, C. Lombroso, Algometria elettrica nei sani ed aberrati, 1867. De l'algométrie électrique chez les aliénés (Annales médico-psychologiques, 1867, S. 514). Tatto, sensibilità generale e dolorifica e tipo degenerativo in donne normali, criminali e alienate (Giornale dell'Accad. di med. di Torino, 1891, S. 79). Tatto e tipo degenerativo in donne normali, criminali e alienate (Archivio di Psichiatria, 1891, S. 1). das beim Normalen keine Vergleichsziffer ergibt; seit mehr als dreißig Jahren haben nun v. Leyden und ich beinahe gleichzeitig zu dieser Messung den Rhumkorfschen Schlitten verwendet, indem wir die Größe der Intensität der betreffenden Sensibilität durch die Zahl der Millimeterabstände der Rollen ausdrückten, und Roncoroni hat eine ganz genaue Messungsmethode angegeben, die in Volts die Stärke der Schmerz- und allgemeinen Sensibilität angibt, ein Verfahren, das für Normale, Irre und Kriminelle und von Ottolenghi für Kinder und Frauen zur Bestimmung angewendet worden ist. Roncoroni und Albertotti, La sensibilità elettrica generale e dolorifica eseminate col faradiometro in pazzi e normali (Archivio di Psichiatria, 1893, S. 423) und Il faradiometro applicato allo studio delle sensibilità elettriche generale e dolorifica (Annali di freniatria, 1894, S. 331). Ottolenghi, La sensibilità e l'età (Archivio di Psichiatria, 1895, S. 540) Lombroso und Ferrero, Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte, deutsch von H. Kurella, Hamburg 1894.
Hätte Toulouse bei einer so wichtigen Angelegenheit, wie die der Sensibilitätsbestimmung, nicht diese Methoden zu Rate ziehen müssen? Ich kann wohl den Chauvinismus verstehen, besonders, wenn ich mich in einen Franzosen hineinversetze, soweit es die Politik angeht, aber in der Wissenschaft führt das zu nichts, denn hier ist keiner Herr und keiner Diener und alle sind Kameraden.
Zola konnte kein eng anliegendes Kleidungsstück tragen, ohne Gefühl von Angst und Schwindel zu verspüren. Es handelt sich hier um eine jener besonders in Frankreich so genau untersuchten Ängste, die sich oft als »Klaustrophobie« äußern und deren degenerativen Ursprung Magnan nachgewiesen hat.
Rücksichtlich der spezifischen Sinnesempfindungen wird von Bemerkenswertem mitgeteilt, daß Phosphene nur an Zola wohlbekannten Orten auftauchen und vom Willen abhängen können. Weiter besteht Astigmatismus auf beiden Augen, Einengung des Gesichtsfeldes beider Augen im oberen Abschnitt (rechts gegen 30 Grad, aber auch links in wesentlicher Ausdehnung). Toulouse erklärt dies leichthin als Folge sehr stark entwickelter Augenbrauen und der Verengerung der Lidspalte (s. oben), doch sind die Augenbrauen, wenigstens nach der Photographie zu schließen, nicht so buschig, daß sie eine Verkleinerung des Gesichtsfeldes zur Folge haben könnten. Hätte Toulouse nur den wichtigen Befund gekannt, den ich ermitteln konnte, nämlich daß bei zwölf hochtalentierten Männern das Gesichtsfeld im oberen Teil eingeschränkt war, ohne gleichzeitige starke Entwicklung der Augenbrauen, und zwar bei vier bis 40 Grad und bei zwei zu 45 Grad, und daß auch hier die Asymmetrie häufig war! Uomo di genio, 6. Aufl. 1895, Bocca, Turin, S. 32, 50, 536, und Tafel 3.
Auch die Hörschärfe Zolas ist rechts um ein Drittel vermindert gewesen, links war sie normal, auf beiden Seiten hatte er Ohrgeräusche, rechts in stärkerem Grade.
Höchst interessant ist das Verhalten von Zolas Geruchssinn. Kampherlösung wurde von Zola erst in einer Stärke von 12 Hundertstel Milligramm wahrgenommen, während sie beim normalen schon bei dreifach schwächerer Einwirkung erkannt wird.
Es ist also klar, daß wenigstens für Kampher die Geruchsempfindung dreimal schwächer ist als beim Normalen.
Dies ist um so bedeutsamer, als, wie Toulouse richtig bemerkt, Zola ein zerebraler Geruchstyp war, d. h. für Geruchsempfindungen ein sehr gutes Gedächtnis und rasches Assoziationsvermögen besaß. Hier hätte Toulouse, was ich selbst schon gefunden hatte, zur Sprache bringen können, nämlich, daß die Sinnesempfindung beim Genie nicht stärker, sondern schwächer als beim Normalen ist, selbst das Gesicht beim Maler und das Gehör beim Musiker, daher Aristoteles nicht recht hat, wenn er sagt: nihil erit in intellectu, quod prius non fuerit in sensu, weshalb auch hier der Parallelismus fehlt, den wir zwischen Wahrnehmungsschärfe und Intellekt sonst so oft antreffen. Übrigens sind auch beim Tier manche Sinne schärfer als beim Menschen, z. B. das Gesicht beim Vogel und der Geruch bei vielen Quadrupeden.
Toulouse berichtet ferner, daß Zola an schweren nervösen Erscheinungen litt, an Krämpfen, Zittern, Herzvalpitationen, Harnbeschwerden, Darmleiden, Brustbeklemmungen, die bei der geringsten Veranlassung eintraten, bei Dynamometerversuchen, im Straßengewühl, beim Anlegen einer Weste, und daß ein Nadelstich in den Finger ihm stundenlange Schmerzen im Arm verursachte, Zufälle, die etwa mit 20 Jahren begannen und immer quälender wurden. Diese Erscheinungen sollen nicht Äußerungen einer besonderen Neurose, sondern lediglich subjektiver Art sein.
Aber ist nicht diese Beurteilung flüchtig und voreilig zu nennen? Bemerkt Toulouse nicht, daß z. B. Getast und Gehör rechts stumpfer ist als links, etwas, was mit den Augenbrauen sicher nichts zu schaffen hat, was aber: in vollem Einklang steht mit der Einengung des Gesichtsfeldes rechts und der Verengerung der rechten Lidspalte (Kontraktur) und mit den Krämpfen und Zitteranfällen, die zur Zeit der Ausbildung dieser Störungen zur Beobachtung kamen, als Folgen der Gehirnentzündung, die ihn mit zwei Jahren befiel (Polioencephalitis) und die oft derartige Überreste zurückläßt?
Psychologisches. – Rücksichtlich des Psychologischen finde ich, daß auch hier der ausgezeichnete Forscher bald zu viel, bald zu wenig getan hat.
Die Berührungs- und Druckuntersuchungen sind genau und sorgfältig durchgeführt, die Sehprüfungen dagegen sind unzureichend.
Zola besaß ein schlechtes musikalisches Gehör, wie übrigens viele Geistesgelehrte, dagegen ist sein Sinn für Rhythmus sehr ausgeprägt gewesen; er hatte auch gutes Merkvermögen für Geräusche und Klänge. 16 Geruchsbezeichnungen riefen bei ihm 6 Gesichts-, 1 Geruchs- und 1 Geschmacksvorstellung hervor. Die Sexualbezeichnungen riefen bei ihm meist Gesichtsvorstellungen hervor.
Ordnungsliebe war bei Zola sehr ausgeprägt und ein förmlicher Zwang; alles auf seinem Tische hatte seinen bestimmten Platz. Wenn er zu schreiben anfing, teilte er seine Notizen in mehrere Häufchen, er hob alle Briefe auf usw. Unordnung war ihm schrecklich. Außerdem litt er an verschiedenen Zwangsideen, so an Zweifelsucht, er fürchtete oft, er könne mit seinem täglichen Arbeitspensum nicht fertig werden, nicht die Rede zu Ende führen, die er gerade hielt. Unterwegs muß er die Anzahl der Haustüren zählen, nach den Nummern der Droschken sehen, er muß die Treppenstufen zählen, vor Schlafengehen mehrmals dieselben Möbelstücke berühren und dieselben Schubläden öffnen.
Manchmal mußte er die Tür ohne Ziel und Zweck öffnen und schließen. Neben diesen Zwangsideen saßen Phobien: so mußte er die Fiakernummern addieren und fürchtete dann, wenn eine bestimmte Zahl herauskam, die ihm von ungünstiger Vorbedeutung zu sein schien, es könne ein Unglück sich ereignen. Zuerst war es der Faktor 3, der ihm von ungünstiger Bedeutung erschien, dann die 7, und öfter stieß es ihm zu, daß er beim Erwachen siebenmal die Augen öffnen mußte. Die Zahl 17, die ihn an ein trauriges Datum erinnerte, war ihm von übler Bedeutung, und er glaubte wirklich, daß gewisse weitere Ereignisse auf dieses Datum fallen könnten. Er hatte Bewegungen an sich, die er mit dem Gedanken ausführte, ihr Unterlassen bringe Unglück. Deshalb faßte er auch die Gaslampen auf der Straße an, trat mit dem linken Fuß an, wenn er aus dem Hause ging, usw.
Toulouse meint, dies seien keine echten Zwangsvorstellungen, denn sie seien nicht mit der charakteristischen Angst verbunden. Aber dann spricht er wieder von gastrischen Krisen, nervösen Krisen mit Beklemmung, von Muskelkrämpfen, die ihn im Straßengedränge und beim Anlegen eines engen Kleidungsstückes befallen, und ich glaube, das ist doch etwas ganz Ähnliches wie die Angstanfälle der »Klaustrophoben«. Wenn er auch nicht häufig daran litt, so hing dies damit zusammen, daß er seine Zwangsbewegungen immer rasch ausführte und so die Krise koupierte.
Übrigens hatte er auch spezielle Zwangsbefürchtungen, z. B. diejenige, sofort sterben zu müssen, eine Phobie, die paroxysmatisch auftrat.
Erinnerungsvermögen, Vorstellungstätigkeit. – Zola reproduziert mit viel größerer Treue die Geruchsvorstellungen als die Gesichtseindrücke. So kann er sich z. B. ein rotes Kreuz nicht vorstellen, während er Gerüche, die er einmal wahrgenommen hat, ohne Mühe ins Gedächtnis zurückrufen kann.
Bei Versuchen mit den » Mental tests« (Vorsagen und Wiederholenlassen verschiedener Hauptworte) wurde ermittelt, daß er nur leicht wiederholen konnte, was für ihn von Interesse war, z. B. merkte er gut Bezeichnungen für Frauenwäsche.
Er besaß sehr feines Geruchsvermögen, insofern seine Unterscheidungsfähigkeit für Gerüche stark war und er längere Zeit den Sinneseindruck zurückbehielt, die Sinnesschärfe war sonst eher geringer. Sein Zeitsinn war gut entwickelt. Sein sexuelles Fühlen wurde durch große Ängstlichkeit allzusehr unterdrückt, war aber für sein ganzes Seelenleben von großer Bedeutung.
Die Treue seines Geruchs- und Tastsinnes, die Schärfe seines Blicks und sein Genauigkeitssinn sind offenbar für den Realismus seiner Darstellung mit maßgebend gewesen und für seinen Hang, besonders in bezug auf Farbe und Geruch, exakt zu schildern, während merkwürdigerweise die Erinnerungsfähigkeit für Abstraktes und Metaphysisches fast völlig bei ihm fehlte (Toulouse).
Das Wortgedächtnis, mit der Methode der » Mental tests« geprüft, ergab sonst ziemlich normales Verhalten. Er reproduziert am besten Verse, dann die »bunten Einzelheiten«, dann die kleinen Zwischenfälle des täglichen Lebens, weniger gut die Beschreibungen, die andere ihm von Gegenständen und dergleichen geben und besonders schlecht aus dem philosophischen Gebiet; während der Prozentsatz der reproduzierten Worte 77 beträgt, ergibt sich bei den Erinnerungsproben für ganze Sätze 65 Prozent, genau das Gegenteil von dem, was nach Binet und Henry bei den meisten Menschen der Fall ist, die ein besseres Gedächtnis für Sätze als für einzelne Worte haben. Oft erinnerte sich Zola an Stellen seiner eigenen Werke nicht. Bei der Wiederholung ausgesprochener Ziffern (2 pro Sekunde) kann er nur sechs behalten, weit weniger als die Norm ist. Im ganzen, sagt Toulouse richtig, ist sein »unwillkürliches« Gedächtnis schwächer als das »willkürliche«.
Die psychische Reaktionszeit erschien bei wahlweise ausgelöster Reaktion kürzer als beim Normalen, bei der gewöhnlichen Reaktion länger, auffallend regelmäßig und deutete auf eine konstant aufrechterhaltene Aufmerksamkeit. Dies bestätigt, was ich in meinem »Genialen Menschen« bereits bemerkt habe, daß die Reaktionszeit beim Genie bedeutend verlängert ist. Auch Ronianes hatte an der Lesegeschwindigkeit hervorragender Leute dasselbe ermittelt; jedenfalls ist hier die Anzahl der zuströmenden Gedanken größer, diese selbst sind komplizierter und deshalb wächst die Reaktionszeit.
In bezug auf den Vorstellungsablauf sind die Gesichtswahrnehmungen jene, die die meisten komplexen Ideen hervorrufen, die Geruchsvorstellungen veranlassen auch sehr viele solche, aber der Anteil der Gesichtsbilder ist für die Concreta bedeutender. Abstracta rufen kein Bild, sondern teils dunklere, teils deutlichere Ideengänge hervor.
Worte akustischen Inhalts riefen Gesichtsbilder hervor, nur einmal ein Gehörsbild. Die Erinnerung stellt sich nach Maßgabe der augenblicklichen Zweckmäßigkeit ein, was, wie ich mich ausdrücken möchte, ihm einen Vorteil aus einer Anlage verschafft, die eigentlich einen Defekt bedeutet. In der Darstellung benutzte Zola, obwohl er kein musikalisches Gehör hatte, vielfach Klangbilder, Wort und Satz sind bei ihm wie zum Vorlesen gebaut; dennoch ist im Grunde das Gesicht bei ihm Haupterinnerungsquelle, das Ohr ist ihm nur Mittel zum Festhalten. Er ist Augenmensch für die Erscheinungswelt, Gehörsmensch für die Rede.
Zola konnte nur drei Stunden gut arbeiten, ein Mehr an geistiger Leistung wurde ihm außerordentlich beschwerlich, bei der Arbeit schloß er sich so sehr wie möglich von der Außenwelt ab, hörte und sah nichts und wußte hinterher nichts von dem, was etwa vorgefallen war (epileptoide Amnesie): er hörte den Hund nicht bellen, die Glocke nicht läuten, wenigstens erinnerte er sich nicht daran.
Obwohl er seine festen Arbeitsstunden hatte, ist doch seine Schaffenskraft im ganzen nicht gleichmäßig gewesen; an guten Tagen hatte er Augenblicke außerordentlicher geistiger Spannkraft, seine Disposition wechselte nicht in raschem Tempo, er hatte gewöhnlich mehrere günstige Tage nacheinander, während welcher Korrekturen selten, die Schrift gleichmäßig und ruhig war. Toulouse widerspricht sich, wenn er sagt, daß Zola keine der stürmischen Erscheinungen der sogenannten Ekstase, die an eine vorübergehende geistige Störung erinnert, gehabt habe, und vergißt, daß er beim begeisterten Schaffen Hund und Hausglocke überhörte. Gleich dahinter sagt er wieder, daß er bei der Arbeit nicht einmal seine Schmerzen gewahr wurde. Zola soll keine Excitantien gebraucht haben, doch ist er ein starker Teetrinker gewesen.
Nach der Arbeit wurde der Kapillardruck schwächer und der Puls kleiner, rechts mehr als links, auch am Dynamometer war die Kraftleistung geringer.
Wenn Zolas Aufmerksamkeit nicht absichtlich angespannt war, wenn er nicht mit Fleiß etwas betrachtete, so sah er gar nichts, und auch wenn er sonst an nichts Besonderes dachte, so bemerkte er doch nicht, wenn Bekannte bei ihm vorbeigingen.
Im Zorn wußte er sich gut zu beherrschen trotz seiner großen Nervosität, die ihn zur Heftigkeit hätte veranlassen können.
*
Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß viele psychologische Züge Zolas von Toulouse meisterhaft gezeichnet worden sind, aber ich glaube, daß er auch hier in der Einschätzung nebensächlicher Einzelheiten zu weit gegangen ist, wie er dies denn auch bei den körperlichen Eigentümlichkeiten, für deren Beschreibung er so schwierige, seltene und schwer zu vergleichende Methoden benutzt hat, getan hat, während er die wichtigsten Resultate, die sich aus den Werken Zolas selbst für seine Psychologie ergeben (ein Briefwechsel des Dichters ist nicht vorhanden), ganz beiseite gelassen hat, Betrachtungen, die ihm Beziehungen hätten erschließen können, die niemand an sich selbst kennt, und über die niemand andern in sicherer Weise Auskunft geben könnte oder wollte. Dagegen haben Nordau und nach ihm Squillace auf Spuren der niederen Degeneration, die in Zolas Werken zutage treten, hingewiesen, so auf den Gebrauch von Argot, auf die Koprolalie und den Überfluß an Geruchsbildern. Man vergleiche hierzu die Szene zwischen Vimeux und dem Bauern in » La Terre«, die Figur dieses Bauern selbst, ferner die Mouquettes im » Germinal«, die Szene, in der das obszöne Wüten der Minenarbeiterinnen beschrieben wird, die Charakterisierung Renates in » La Curée«, wo auch »jedes Zimmer seinen eigenen Geruch« hat, und »die Treppe scharf nach Staub und Weihwasser riecht«.
Nordau hat mit Recht auf die Eigentümlichkeit Zolas hingewiesen, mit Wahrnehmungen Geruchsvorstellungen zu verbinden, wie es bei Psychopathen vorkommt. In der » Curée« heißt es bei der Beschreibung des Ballfestes bei Saccard: »In jenem eigenartigen Zusammenwirken der Geruchstöne war das stets siegreich wiederkehrende Hauptmotiv, das den weichen Duft der Vanille und die stechenden Dünste der Orchideen übertäubte, der durchdringende, sensuelle Hautgeruch –« Nordau, Entartung.
Im » Ventre de Paris« beschreibt er einen Käseladen und sagt: »In diesem anstrengenden Konzert griff der Parmesan ab und zu mit einem leisen ländlichen Flötenton ein –«
Besonders charakteristisch ist die sexuelle Assoziierung der Gerüche und eine merkwürdige Vorliebe für Frauenwäsche.
Diese hat Toulouse zwar gut zu erklären gewußt, aber er hat hierbei nicht in Betracht gezogen, was Krafft-Ebing und ich über diejenige Form der sexuellen Psychopathie gesagt haben, die darin besteht, daß die Vorstellung von Frauenwäsche erotisch wirkt, eine Abnormität, die nur bei Individuen mit anomaler Veranlagung eine solche Stärke annehmen kann wie bei Zola. Freilich hat der Dichter dies Toulouse gegenüber in Abrede gestellt, aber man kann sich das fortwährende Wiederkehren dieses Motivs in seinen Werken sonst nicht erklären. S. hierzu z. B. » Au bonheur des dames«.
Wir haben also gesehen, daß Zola an Angstanfällen verschiedener Art litt, Erinnerungslosigkeiten und Empfindungsausfällen unterworfen war, besonders während geistigen Arbeitens. Nimmt man dazu die Zwangsideen, die Zahlen- und Zählsucht, die nervösen Krisen, Beklemmungen und Befürchtungen, die Schwindelerscheinungen beim Beginn geistigen Arbeitens, ferner die Kontraktur des rechten Augenschließmuskels, die halbseitigen Empfindungsstörungen, die Sprachstörung, die Abstammung von im Alter vorgerückten Eltern, die nervöse Erblichkeit, so kann kein Zweifel sein, daß Zolas Neurose in der Hauptsache etwa als eine Art Hysterie oder Hysteroepilepsie aufgefaßt werden muß, um so mehr als bei Zola noch viele andere derartige Erscheinungen, wie Mancinismus, vorzeitige Faltenbildung, Greiffuß, Einengung des Gesichtsfeldes und dergleichen vorhanden waren.
Auf Poe bin ich schon ausführlich in den verschiedenen Auflagen meines »Genialen Menschen« eingegangen. aber das neu Beigebrachte hat wieder viele Einzelheiten über seine Abnormitäten aufgedeckt und auch den epileptischen Grundzug seines Wesens enthüllt, den ich bereits vermutet hatte, für dessen Annahme eben bisher kein genügender Anhaltspunkt vorlag, und der uns den Ursprung des Genies und der Krankheit gleichzeitig erklärt.
Ethnisch ist vor allein auf die Kreuzungen aufmerksam zu machen, die bei seinen Vorfahren, welche mehrfach ausgewandert und geistig nicht intakt waren, vorgekommen sind. Nach Ingrams Arbeit Ingram, Edgard Poe and his critics, Newyork, 1895. Woodberryd Artikel, Century, Newyork, 1891. Giulio Monti, E. Poe, Emporium, Bergan, 1897. Lanvière, E. Poe, Sa vie et son oeuvre, Wien, 1905. scheint es, daß die Familie, der er entstammte, etwa ums Jahr 1300 aus Italien ausgewandert und nach Irland gezogen ist, und daß sie schon damals Sonderlinge und forsche Ritternaturen aufgewiesen hat. Sir R. Arnold Poe opferte einst Freiheit und Leben, um eine Frau zu befreien, die als Hexe angeklagt war, und entfachte 1427 in Irland dadurch eine Fehde, daß er einen der Mitbarone des Landes, Desmon, beschuldigte, ein Dichter zu sein, etwas, das, wie es scheint, damals also für eine Schändlichkeit galt. Poes Großvater kam als Kind nach Amerika (man beachte die neue klimatische Überwanderung), er nahm teil am Unabhängigkeitskriege und wurde General. Sein Sohn, ein sehr großer Sonderling, der Jurist werden sollte, verliebte sich im Alter von 18 Jahren in eine englische Schauspielerin und entfloh mit ihr, weshalb er viele Jahre lang von der Familie geächtet war. Er starb, wie seine Mutter, an Schwindsucht und hinterließ drei Kinder, einen gleichgewichtslosen Alkoholisten, eine halb idiotische Tochter und als jüngstes den Dichter, der angesichts der elenden Lage der Familie von dem reichen Allan adoptiert wurde, welcher, ohne daß ihm Edgar Dank gewußt hätte, diesen mit Güte überhäufte, bis er ihn schließlich nach seiner Wiederverheiratung aus dem Hause jagte. Der Dichter war außerordentlich frühreif, sehr empfindlicher Natur, unberechenbar im Handeln, geistig geweckt, aber zur Zerfahrenheit neigend, träumerisch, unbeständig. Er trug oft ein geheimnisvolles Wesen zur Schau, mied die Gesellschaft und neigte sehr zum Genuß alkoholischer Getränke. Gegen Frauen war er sentimental.
Auf der Militärakademie und Universität, wo er sich in den physikalischen Fächern auszeichnete, galt er bei den Kollegen als ein überspannter Kopf, der geistig beständig in entlegenen Gebieten weile und unter dem Einflüsse rätselhafter Phantome stehe. Mit 18 und 21 Jahren hatte er bereits Gedichte herausgegeben, von denen Baudelaire sagte, sie enthielten »die Ruhe der Melancholie, eine sehr frühreife Menschenkenntnis und außermenschliche (!) Empfindungen«. Poe verließ schließlich seinen Adoptivvater und trat in die Armee, konnte aber mit Vorgesetzten und Kameraden zu keinem erträglichen Verhältnis kommen. Endlich gelang es Kennedy und anderen, nachdem er schwere Zeiten gesehen hatte, ihn in der Redaktion einer Revue unterzubringen, wo er von der Feder leben konnte. In dieser Stellung erfuhr er schwere melancholische Anwandlungen. »Ich leide jetzt«, schreibt er an Kennedy, »an einer Depression, wie ich sie nie gekannt habe; vergeblich habe ich gegen diese Melancholie gekämpft, glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, ich bin ein Unglücklicher. Mein Herz liegt offen vor Ihnen, lesen Sie darin, ich bin tief bekümmert und weiß nicht warum, trösten Sie mich, wenn Sie können, aber tun Sie es bald, denn sonst ist es zu spät, überzeugen Sie mich, daß das Leben der Mühe wert ist, daß es notwendig ist.« In dieser Zeit heiratete er seine Cousine Virginia Klemm, die wie seine Mutter und Tante schwindsüchtig war. Sie erwies ihm viele Liebe, aber nichtsdestoweniger erfuhr sie von ihm schlechte Behandlung und starb nach Grisvolds Angabe deshalb im psychischen Elend.
Zwangsvorstellungen und Zwangstriebe wechselten nun bei Poe mit Verfolgungs- und Größenideen, dann brach eine »zirkuläre« geistige Störung aus, deren Depressionsperioden durch schwere Alkoholexzesse bezeichnet waren, während die Exaltationsstadien mit fortwährender Ortsveränderung einhergingen.
Seit dieser Zeit ging es mit ihm unaufhaltsam bergab. Die einzige Stütze fand er in seiner Schwiegermutter, die für ihn betteln ging und ihn pflegte, ohne zu klagen und zu ermüden. Im Alter von 37 Jahren war er physisch so herabgekommen, daß bereits ganz wenig Wein genügte, ihn betrunken zu machen, und es zeigten sich Symptome von Delirium tremens, an dem er nach wiederholten Anfällen der Krankheit, 39 Jahre alt, starb.
Noch nach seinem Tode wurde ihm von der Welt eine unwürdige Behandlung zuteil, besonders von dem Theologen Grisvold, den er selbst zum literarischen Erben eingesetzt hatte, und der ihn an der Durchschnittselle maß, indem er Baudelaires treffendes Wort nicht gelten lassen wollte: »Das, wodurch uns Poe den größten Genuß gewährt hat, ist sein Tod gewesen.«
Poes Bild zeigt ein sehr abnormes Aussehen, unsymmetrisches Gesicht, großen, hydrozephalen Schädel, rechte Nasenlippenfalte tiefer stehend als linke, der rechte Mundwinkel war schief. S. G. Monti, E. Poe, Emporium, 1897.
Aber noch abnormer ist das biologische und psychische Bild, das er selbst von sich entwirft. »Jawohl, es ist wahr,« schreibt er in dem »verräterischen Herzen«, »ich bin nervös, äußerst nervös und ich bin es immer gewesen,« und an William Wilson schreibt er:
»Ich möchte meinen Rebenmenschen nur sagen, daß ich von Leiden heimgesucht bin, die kein menschliches Wesen aushalten kann. Ich wollte, es fände sich rücksichtlich dessen, was ich zu sagen habe, nur eine kleine Schicksalsoase in der Wüste des Irrtums. Ich wollte, man möchte einsehen, daß, wie große Versuchungen auch sonst in der Welt an den Menschen herantreten können, noch nie jemand in solcher Weise versucht worden ist und noch nie so hat unterliegen müssen. Und vielleicht hat deshalb auch noch nie jemand so gelitten wie ich – Ich stamme von einer Rasse, die sich von jeher durch ein phantastisches und leicht erregbares Naturell ausgezeichnet hat, und meine frühe Kindheit zeigte schon, daß ich diesen Familiencharakter geerbt hatte. In meinen späteren Lebensjahren prägte er sich dann stärker aus und wurde ein Gegenstand ernster Beunruhigungen für meine Lieben und mir selbst ein schwerer Nachteil. Ich war willenlos den schlimmsten Stimmungen überantwortet, der ungebändigtsten Leidenschaft ausgeliefert. Meine Eltern, die von schwankem Geist und mit denselben Gebrechen wie ich behaftet waren, konnten nichts tun, um meine krankhaften Neigungen zu bekämpfen. Einigemal machten sie schwache unzweckmäßige Versuche, die völlig fehlschlugen.
Meine ersten Schuleindrücke empfing ich in einem großen, wunderlichen Gebäude aus der Zeit der Königin Elisabeth, in einem entsetzlichen englischen Orte mit vielen riesigen, krummgewachsenen Bäumen, in dem alle Häuser aus fabelhafter Vorzeit zu stammen schienen. Das Aussehen der alten ehrwürdigen Stadt konnte den Geist nicht beflügeln.
In den massigen Mauern dieser verehrungswürdigen Anstalt verbrachte ich mein Leben vom zehnten bis zum fünfzehnten Jahre. Die lebhafte Phantasie des Kindes bedurfte nicht der Außenwelt, um sich zu beschäftigen oder abzulenken, und die Monotonie des Schullebens gab mir Anlaß zu größeren Erregungen, als ich später draußen in Leben und Luxus verspürt habe. Ich muß indes annehmen, daß meine erste geistige Entwicklung überaus frühreif war. Die Ereignisse der Kindheit hinterlassen im allgemeinen im reifen Manne keine deutliche Nachwirkung. Alles verschwindet in einem Halbdunkel, aus dem die Erinnerung an die dürftigen Freuden und die phantastischen Schrecken kaum hervortritt. Bei mir war das nicht der Fall. Ich muß schon als Kind alle Eindrücke mit der Energie des Erwachsenen verarbeitet haben, und deswegen finde ich diese jetzt auch mit so tiefen unauslöschlichen Zügen wie die Prägung einer karthagischen Münze in mir vor – Meine glühende, leicht begeisterte, anspruchsvolle Natur zeichnete bald meinen Charakter vor dem der Gefährten aus, und allmählich verlieh mir dies einen Einfluß auf sie.«
Dann spricht er von seiner ungeregelten Lebensführung.
»Die drei durchtollten Jahre hatten mir schlimme Lebensgewohnheiten hinterlassen. Eines Tages lud ich, nachdem ich die ganze Woche unter groben Ausschweifungen verbracht hatte, eine Anzahl der wüstesten Studenten zu einer Orgie ein. Wir kamen zu später Stunde zusammen, denn unsere Orgie sollte bis zum Morgen dauern. Der Wein floß in Strömen, und das Spiel erhitzte uns – Im wilden Taumel trat ich mit gedoppelter Leidenschaft im Sinnenrausche alle Rücksichten auf die Würde der Menschen nieder und bereicherte die Liste der Schändlichkeiten, die damals auf der wüstesten Universität Europas üblich waren, bedeutend –«
(Man bemerke hier den völligen Verlust des ethischen Gefühls.)
Mit dem Alkoholmißbrauch begannen alle Merkmale der Epilepsie sich einzustellen: der Schwindel, die Größen- und Verfolgungsideen, die Hypochondrie, die Unbeständigkeit, Eitelkeit, das gelegentliche Nachlassen seiner Schaffenskraft, große Angst und Furcht, außerordentliche Erregbarkeit, Störungen des Gefühlslebens, Augenblicksentschlüsse, das Bedürfnis nach fortwährendem zwecklosen Ortswechsel: »Meine Flucht war vergebens. Mein fluchbeladenes Geschick verfolgte mich siegreich und bewies mir, daß seine rätselhafte Macht eben nur angefangen hatte zu wirken –« (s. Ingram l. c.). An Gordon Pym schrieb er: »Je energischer ich kämpfte, um die Gedanken loszuwerden, desto lebhafter, deutlicher, schrecklicher traten sie hervor.« Auch im Schlafe quälten ihn schreckhafte Bilder. Ihm schien, daß alles Unglück der Erde sich über ihn ergossen hätte, er fühlte sich unter mächtigen Polstern von entsetzlich gestalteten Dämonen erstickt (epileptisch-alkoholistische Sinnestäuschungen). Ungeheure Schlangen hielten ihn fest umklammert und starrten ihn mit schauderhaft funkelnden Augen an. Endlose Wüsten von trostlosem Anblick umgaben ihn mit ihren Schrecken, mächtige, kahle, graue Bäume erhoben sich vor ihm wie eine Riesenprozession in endloser Reihe, die Wurzeln in unermeßlichen Sümpfen, deren erschreckend schwarzer und träger Schlamm unendlich weit reichte, sie erschienen belebt und bewegten ihre knochenähnlichen Armäste hin und her, schrien das schweigende Wasser mit vor Todesangst und Verzweiflung zitternder Stimme um Gnade und Erbarmen an. »Mein Leiden wuchs immer mehr und seine Qualen wurden durch den übermäßigen Opiummißbrauch immer stärker. Es nahm zuletzt die Form einer neuartigen merkwürdigen Monomanie an, stündlich, Minute um Minute nahm es an Gewalt zu und bald gewann es die unbegreiflichste Macht über mich. Die Monomanie bestand in einer krankhaften Erregbarkeit derjenigen Geistestätigkeit, die die Sprache Aufmerksamkeit nennt. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß ihr mich nicht verstehen werdet, und ich fürchte beinahe, daß es mir völlig unmöglich ist, euch eine genaue Vorstellung dieses nervösen Interesses zu geben, mit dem meine Denktätigkeit sich auf die Beobachtung der gleichgültigsten Dinge der Welt geworfen hatte. Stundenlang mußte ich unablässig über eine fade Stelle oder Anmerkung in der Lektüre grübeln, ganze Sommertage betrachtete ich die bizarr geformten langen, schiefen Schatten aller möglichen Dinge auf Wand und Fußboden, unverwandt blickte ich Nächte hindurch in die Flamme der Lampe, in das Feuer des Kamins, tagelang beschäftigte mich der Geruch einer Blume, unaufhörlich mußte ich in monotoner Weise ein gewöhnliches Wort wiederholen, solange bis es nach endloser Wiederkehr kein neues Echo in meiner Ideenwelt mehr auslöste, und alles physische Bewegungs- und Lebensgefühl verlor sich in einer nicht weichenwollenden Erstarrung. Solcher Art waren einige der gewöhnlichsten und harmlosesten Irrgänge meines Geistes.«
In der »Schwarzen Katze« beschreibt er die unwiderstehliche Neigung, das Unrecht zu tun aus Lust daran, die triebartige, primitive, elementare Regung, die er den »Dämon« der Perversität nennt. »Alles, was ich euch erzähle,« sagt er, »hat mich erschreckt, gemartert, vernichtet. Eines Tages wird ein Geist kommen, der alle diese Erscheinungen, die ich beschrieben habe, in einer nüchternen Tonart wieder behandeln wird, ein ruhigerer Kopf, der logischer und viel kühler als der meine, in den Dingen, die ich mit Entsetzen beschrieben habe, nur eine gewöhnliche, ganz natürliche Aufeinanderfolge von Ursache und Wirkung erkennen wird.«
Weiter berichtet er, wie man an ihm als Kind besonders seine Lenksamkeit und sein sanftes Wesen gelobt habe. Seine Gutherzigkeit hatte aus ihm den Liebling der Gefährten gemacht. Besonders war er auch für die Tiere begeistert. Er hatte fast stets ein Tier um sich, und er war voll Freude, wenn er ein solches liebkosen oder füttern konnte. Diese Eigentümlichkeit, die ich als besonderes Merkmal der ethisch Defekten und Epileptiker angesprochen habe, nahm mit den Jahren zu, und als er erwachsen war, wurde sie eine der hauptsächlichsten Quellen des Genusses für ihn.
Auch seine Frau teilte diese Tierliebe, und er war sehr glücklich darüber. Später aber setzte bei ihm das ein, was er seinen Dämon nannte, und gleichzeitig erlitt sein gesamter Charakter und sein gesamtes Naturell eine völlige trauervolle Umwandlung. »Ich wurde«, sagte er, »düster und reizbarer, gleichgültiger gegen die Meinung anderer. Ich fing an, harte Worte gegen meine Frau zu gebrauchen, und einigemal vergriff ich mich im Zorn an ihrer Person. Mein Leiden aber wurde immer größer, und welches Übel ist wohl dem Trunk vergleichbar?«
Er erzählt dann, wie er nachts aus den Vorstadtkneipen heimkehrte, wenn seine dämonische Leidenschaft ihn gepackt hatte, und welchen Abscheu er empfand, wenn er am Morgen erwachte und der Rausch verschwunden war. »Dieses Gefühl muß aber sehr schwach gewesen sein,« sagt er weiter, »denn ich stürzte mich sogleich wieder in den Taumel, und bald ertränkte ich im Wein die Erinnerung an mein Tun.« Und dann verfiel er dem Geiste des Verderbens, mit dem sich die Philosophie zu seinem Bedauern noch nicht genügend befaßt hätte. Dies war sein letzter unheilvollster Sturz. »Es war«, so sagt er, »der glühende Wunsch meiner Seele, sich selbst zu martern, ihre eigene Natur zu verleugnen, das Böse zu tun aus Lust am Bösen.« In einem solchen Momente hängte er eines Nachts seine Hauskatze auf. Die Erinnerung an diese Handlung sollte ihn nie wieder verlassen. Er hat die Empfindungen, die sich in der Folge bei ihm einstellten, in der Erzählung »Die schwarze Katze« geschildert.
Der Mißbrauch der geistigen Getränke machte sich immer stärker geltend. Er trank verzweifelt, als wenn er etwas in sich tottrinken wollte. Manchmal tauchte in seiner verirrten Phantasie der Gedanke an die herrliche Ruhe im Grabe auf. Dieser Gedanke schlich sich langsam und unbemerkt ein, und als er anfing, ihn näher zu erfassen, umdunkelte sich sein Geist immer mehr. Die Welt war nur noch Nacht für ihn, Erstarrung und Schweigen. Er sehnte sich nach dem Tode, und neue Furcht befiel ihn jetzt: weder im tiefsten Schlafe noch im Wahn noch im Tode noch im Grabe selbst sei Ruhe zu finden!
»Die Menschen«, hat der große Dichter in » Eleonora« gesagt, »haben mich irr genannt, aber die Wissenschaft ist uns noch die Antwort schuldig, ob der Irrsinn nicht eine verfeinerte Abstufung der Intelligenz ist, ob nicht alles das, was man Ruhm, was man Tiefe nennt, von einer Krankheit des Gedankens herrührt, von einem besonderen Aufschwung des Geistes auf Kosten des Intellekts.«
Poe war also geisteskrank, das ist gewiß; aber er war ein Kranker, der die Diagnose seines Leidens ebenso stellen konnte, wie es etwa ein Meister der Klinik getan hätte, er war gleichzeitig Beobachter und Objekt. Er hat auch den wissenschaftlichen Roman schaffen helfen, ebenso wie den spiritistischen und den metaphysischen.
Was indes für unsere Frage besonders in Betracht kommt, ist, daß seine Krankheit so völlig in seine Werke mit übergegangen ist, daß, wie er selbst sagt und wie auch Baudelaire ausdrücklich erklärt hat, wir ohne jene diese nicht besitzen würden. Und diese seine sicher auf erblicher Grundlage entstandene Krankheit datierte aus früher Kindheit und war vorhanden, noch ehe er ein literarisches Werk in Angriff genommen hatte. Der Alkoholismus steigerte sie lediglich und war nicht ihre Ursache, eher sogar bereits eine Folgeerscheinung davon.
Thomas de Quincey S. Arved Barine, Th. de Quincey, Paris 1897. wurde 1785 als Sohn eines schwindsüchtigen Vaters geboren. Von seinen sieben Geschwistern blieb nur eine Schwester am Leben, bei mehreren von diesen war, obwohl sie in frühem Alter starben, bereits eine schwermütige oder extravagante Anlage zutage getreten. Die Mutter war bigott und von übermäßiger Strenge. Thomas zeigte frühzeitig eine große Intelligenz: mit zwölf Jahren machte er bereits lateinische Verse, mit fünfzehn las er fließend Griechisch und kannte dank seines ausgezeichneten Gedächtnisses die alte und neue englische Literatur genau. 1804 begann er wegen starken Zahnwehs Opium zu nehmen, durch das er sich widerstandslos unterjochen ließ. Er begann damit, sich alle drei Wochen eine mäßige Dosis zu verordnen. Zuerst verspürte er davon eine große Erleichterung bei der geistigen Arbeit, wie aus folgender Stelle hervorgeht: »O schönes, edles, machtvolles Opium, du birgst im Grunde deines Dunkels Tempel und Städte, die den Glanz Babylons hinter sich lassen, aus dem Chaos des traumerfüllten Schlafs erweckst du zum Lichte der Sonne die so lange versunkenen Bilder der Schönheit, du bist der Schlüssel des Paradieses.«
Schon 1813 nahm er 10-12 000 Tropfen Laudanum, also mehrere Gläschen am Tage. Bald war er nicht mehr imstande, einen Brief zu schreiben noch sich mit irgendeiner geschäftlichen Angelegenheit zu befassen. Als er sich 1816 verheiratete, sah er sich als Vater von drei Kindern bald im Elend. Die Träume wurden unruhig und ängstlich, er sah ungeheure Bauwerke, die immer großer wurden, Massen von Bauten, die lebten, und sich unaufhörlich bewegten, den Himmel stürmten und sich in unergründliche Abgründe stürzten, Meere, auf denen zum Himmel gewandte Köpfe umhertrieben, grimmige, bittende, verzweifelte Gesichter, jahrhundertelang und zu Zehntausenden, Schlangen und Krokodile, die ihn nie verließen. Wenn er aufwachte, glaubte er jahrelang geschlafen zu haben. Sein Leben verfloß unter beständiger Angst, unter Furcht vor Irrsinn und Leiden und unter nächtlicher Illusion, lebendig zu verbrennen. Im Munde entstanden Geschwüre, er litt an Übelkeiten und furchtbaren Schmerzen im Leibe, eine schreckliche Überempfindlichkeit verhinderte ihn, Ruhe zu finden, und machte ihn schlaflos. Da entschloß er sich, die Opiumdosis herabzusetzen. Von dieser Zeit an verfloß sein Leben unter einem beständigen Kampf zwischen dem gebieterischen Bedürfnis des Gifts und der Furcht vor seinen Folgen. Einigemal gelang es ihm, die Dosis stark herabzusetzen, aber er hatte selbst die Überzeugung, daß er unmöglich lange widerstehen könne. In der Zeit, in der es ihm gelang, das Gift fernzuhalten, verspürte er einen neuen starken Aufschwung seines Geistes: »Ich schwöre euch,« sagte er, »daß ich jetzt in einem Augenblicke mehr Gedanken habe, als in einem Jahre unter der Herrschaft des Opiums. Es ist eine wahre Flut; man könnte meinen, daß alle Gedanken, die seit zehn Jahren erstarrt gewesen, auf einmal sich über mich ergössen, ich bin unglücklich, daß auf eine Idee, die ich entwickeln und die ich schriftlich ausarbeiten kann, immer fünfzig kommen, die ich nicht weiter zu verfolgen vermag.«
Aber ungeachtet dieser häufigen Besserungen ging die mächtige Intelligenz De Quinceys dennoch zugrunde. Die geistige Schwäche machte es ihm zuletzt unmöglich, die einzelnen Probleme im besonderen zu übersehen, die Ideen auseinanderzuhalten und ihre Wechselbeziehungen zu sichten. Dazu gesellte sich eine Unfähigkeit zu handeln, an einem einmal angefangenen Werke fortzufahren, er mußte alles aufschieben, nur das Gedächtnis blieb gut, so solid war dieses von Natur angelegt. So sind seine literarischen Arbeiten zwar zahlreich (seine gesammelten Werke füllen 14 Bände), sie bilden aber eine Reihe von Bruchstücken, deren Inhalt oft sehr wenig dem Titel entspricht, z. B. die Arbeit über Hamilton, in der von allem möglichen die Rede ist, nur nicht von dem Philosophen. Hier und da erscheint freilich ein geniales Streiflicht, so z. B. sagt er in der » Philosophy of Roman history« (1839) sehr schön, »daß das Römerreich nicht von den Barbaren zerstört worden ist, sondern sich durch die Schäden seiner Überkultur von selbst aufgelöst habe, und daß die Goten und Vandalen, weit entfernt, sich seiner Zerstörung schuldig gemacht zu haben, die Retter des Okzidents gewesen wären: sie hätten den morsch gewordenen römischen Geist neu belebt und befruchtet, ohne ihr Eingreifen wäre die einheimische italienische Bevölkerung im sechsten oder siebenten Jahrhundert an Skrofeln, Irrsinn und Aussatz zugrunde gegangen, das heutige Europa wäre ohne Goten und Vandalen weit weniger vorgeschritten.« Diese neue und kühne Idee ist freilich durch die bloße Behauptung durchaus nicht erwiesen, es hätte ihm auch völlig der geistige Nachdruck, um dies im einzelnen durchzuführen, gemangelt. Auch das Gefühlsleben stumpfte sich ab, und er scheute sich nicht, über seine beiden Freunde, die großen Dichter Coleridge und Wordsworth, die mit ihm eng verkehrten, ohne Not sehr Nachteiliges zu reden.
Merkwürdig sind einige seiner Tics und krankhaften Ängste, so konnte er z. B. kein Geldstück ausgeben, das nicht blank gewesen wäre, er putzte deshalb sein Geld fortwährend und packte es in Papier, und nach seinem Tode fand sich eine ziemlich große Summe geputzten Geldes an den verschiedensten Stellen des Hauses verborgen vor. Sein Zimmer und alle Gegenstände darin bedeckte er buchstäblich mit bedrucktem und beschriebenem Papier. War alles unter dem »Schneefall« verschwunden, so schloß er das Zimmer zu und »begrub« ein anderes in derselben Weise. Er war sehr zornig, wenn jemand diese Papiere anrührte, mitunter zündete er sie aus Versehen mit der Kerze an, und das eine Mal lief er dann schnell zur Haustür, um diese abzuschließen, damit niemand mit Wasser käme, um zu verhüten, daß seine Blätter und Schriften naß würden. Das Feuer löschte er schließlich selbst mit seinem Mantel.
Trotz des hochgradigen Opiummißbrauchs wurde er 74 Jahre alt. Von seinem zwanzigsten Jahre ab hatte er sich der Krücken des Narkotikums bedient und schon auf der Universität nicht ohne Opium arbeiten können. So hochgesinnt er auch sonst stets war, in diesem Belang blieb er ein Sklave.
Comte G. Dumas, L'état mental d'Auguste Comte, Revue philosophique, 1898. Roubaud ( Revue d'Ecole d'Anthropologie, 1905) wirft mir vor, ich hätte Comte unter die irren Genies gezählt, während er doch nur acht Monate irre gewesen sei, und weiß nicht, daß er in diesen Monaten lediglich manisch war (sonst ein Paranoiker). Auch hier hält man mir entgegen: er erschien nur größenwahnsinnig, da er sich seiner eigenen Höhe bewußt war. Aber kein großer Geist schafft eine neue Religion aus sich heraus, besonders nicht, wenn er Atheist ist. starb mit 60 Jahren, nachdem er in seinem Testamente seiner Frau Hausrat, Manuskripte usw. und 2000 Franken vermacht hatte. Dieses Testament war von dreizehn, sage dreizehn Testamentsvollstreckern auszuführen und im Falle, daß seine Frau die Annahme verweigere, sollten diese ein geheimes versiegeltes Schriftstück verbreiten, in welchem geschrieben stand, daß sie eine öffentliche Person sei. Dies hatte er getan in der Hoffnung, daß sie gegen das Testament keinen Einspruch erheben würde, aber selbstverständlich war dies der Fall, seine Frau wandte sich an Littrè, und dieser erklärte vor Gericht den Testator für irre.
Vor und nach seiner Geisteskrankheit litt er an Hirnkongestionen, wenn seine geistigen Anstrengungen sehr stark wurden.
Mit 23 Jahren, im Beginn seiner philosophischen Laufbahn, erkrankte er geistig an allgemeinen Aufregungszuständen und Gefühls- und Vorstellungsstörungen, bestehend in Verwirrtheit auf Grund allzu starker geistiger Arbeit und aus Kummer über die Flucht seiner Frau mit ihrem Liebhaber, besonders aber auf Grund der Erblichkeit. Die Mutter war bizarr bis zum Wahnhaften, der Vater war mittelmäßig begabt.
1824 sagte er gelegentlich eines Gesprächs über seine Gesichtsrose: »Diese Krankheit ist eine Folge der intensiven geistigen Anstrengung, mit der ich mein neues philosophisches Werk vorbereite, denn die geistige Geburt ist ein ebenso mühsamer Vorgang als die körperliche und hat wie diese stoffliche Begleiterscheinungen. Alle die neuen entscheidenden Schritte, die ich in meinen philosophischen Werken vollzogen habe, haben zu einer entsprechenden pathologischen Krisis Anlaß gegeben, und meine neue Arbeit macht keine Ausnahme.«
1839 hatte er, als er an dem vierten Bande des »Abrisses der positiven Philosophie« arbeitete, eine geistige Krise, ähnlich der im Jahre 1826. Er spricht davon mit seinem Freunde Valabe wie über ein heftiges Unwohlsein, das etwas länger gewährt habe als jenes zu Beginn des Frühlings.
Im Dezember 1834 schreibt Frau Comte in der Besorgnis vor einem Rückfall an Blainville von den Charakterveränderungen, die er wieder zeige. »Arge Vorwürfe, Scheltworte, unverhältnismäßige Rücksichtslosigkeiten wegen Kleinigkeiten, ein kindisches und absichtliches Hervorkehren des Übergewichts dessen, der das Geld verdient, alle diese Erscheinungen, die ich schon seit einem Jahre an ihm bemerkt habe, sind in den letzten zwei Monaten deutlicher geworden.«
Im Jahre 1842, als Frau Comte ihren Mann wiederum verließ und dieser am sechsten Bande seines »Abrisses« arbeitete, hatte er wieder einen Rückfall und ebenso 1845, wobei er an Schlaflosigkeit und Melancholie litt. Sowohl vor als nach seiner Geisteskrankheit lebte er in beständiger Erwartung einer neuen Hirnkongestion, die übermäßige geistige Anstrengung löste immer die ersten Symptome aus.
Die Krisen wurden immer von gewissen Charakterveränderungen eingeleitet, die seine Frau bemerken konnte.
1845 erschienen die Krisen erledigt, wenigstens ist keinerlei Anzeichen davon mehr an den Werken und im Leben Comtes nachzuweisen. Die Krisen bestanden in einer allgemeinen Erregung oder Herabstimmung der Gefühls- oder Vorstellungswelt, in der er selbst mit Recht die möglichen Vorboten einer Manie oder Gehirnkongestion sah. Es ist wichtig, daß alle diese Krisen im Frühjahr eintraten, die erste im April 1826, die zweite im Frühjahr 1838, die dritte im Juni 1842, die vierte in der zweiten Hälfte des Mai 1845.
Ihre Ursachen waren immer die gleichen, gleichzeitig dem Vorstellungs- und Gefühlsleben entstammend. Die erste wurde durch die Flucht seiner Frau und durch geistige Überarbeitung hervorgerufen, die zweite durch die Arbeit am vierten Bande seiner »Positiven Philosophie«, die dritte durch eine neue Flucht seiner Frau und durch neue geistige Exzesse, die vierte schließlich durch seine Leidenschaft für Klothilde und durch seine Arbeit am »System der positiven Politik«.
Comte blieb bis zu 47 Jahren in beständiger Befürchtung von Rückfällen. Er konnte sich nicht starken geistigen Anstrengungen unterziehen, durfte keine starken Gemütsbewegungen erfahren, ohne von Aufregungszuständen und Hirnkongestion bedroht zu werden. Er wußte es selbst und beizeiten rüstete er sich gegen diesen Feind, indem er seiner Lebensweise und Ernährung große Beachtung angedeihen ließ und Kaffee, Wein und Tabak mied.
Comte behauptete, die Krise von 1838 habe einen günstigen Einfluß auf sein ästhetisches Fühlen ausgeübt. »Das Hauptergebnis«, schreibt er an Klothilde, »bestand in einer andauernden lebhaften Anregung meines natürlichen Geschmacks für die verschiedenen schönen Künste, besonders für Poesie und Musik.«
Von seiner Jugend bis zum Alter dachte Comte an nichts Geringeres, als die Welt zu reformieren, und er besaß auch den Stolz aller Reformatoren. Dieses Gefühl hat seine Geschichte. Es ist mit dem Anwachsen der Menge des Wißbaren, mit den Fortschritten der Wissenschaft immer stärker geworden, es hat sich mit dieser entwickelt, und so ist sein Einfluß auf Theorie und Praxis bei Comte zu verstehen. Diese Auffassung erklärt uns den fraglichen Zug seines Charakters. Seine Ursache ist nicht fernliegend; Comte hat auf seine Kompetenz vertraut vom ersten Tage an, als er einen Gedanken hatte, aber seine Zuversicht ist niemals die naive Selbstüberschätzung eines vom Erfolge geblendeten Neulings gewesen, sondern der überzeugte Reflex seines Könnens und dessen, was er für seine Pflicht hielt. Er glaubte an seine Aufgabe und bekannte seinen Glauben im Kampfe gegen alle Leiden und Enttäuschungen, die ihm das Leben beschert hatte.
Als die Regierung Napoleons seine Vorlesungen im Palais Royal schließen ließ, hoffte er zuerst erzwingen zu können, daß die Verfügung zurückgenommen würde, später tröstete er sich damit, daß die Regierung weiter schaue als er und nur ihre Pflicht erfülle: für ihn als den großen Priester der gesamten Menschheit zieme es sich nicht, von einem Katheder aus zu seinen Hörern zu sprechen. Dafür wußte er dann alles, was er für sein System und seine Lehre verwenden konnte, maßlos zu übertreiben.
Einmal schrieb ihm eine Engländerin, daß sie seinen Gedanken über die Frauen beistimme, und bemerkte dazu: »Außer Ihnen gibt es niemanden.« Comte sprach von dieser nichtssagenden Redensart mit großer Genugtuung.
Einer seiner Anhänger in Spanien stellte einmal eine Sammlung spanischer Theaterstücke zusammen und schickte ihm diese mit der einfachen Widmung: »Dem sympathischen Philosophen.« Comte findet in diesen zwei Worten den Altruismus, den humanitären Positivismus und seine gesamte Philosophie wieder und hinterläßt dem Spanier in seinem Testamente seine Cervantes-Ausgabe mit dem Zusatze: »Ich bedaure es, meine Erkenntlichkeit dem ausgezeichneten Schüler nicht ausdrücken zu können, der mein gesamtes Wesen so vollständig gekennzeichnet hat durch seine Anrede ›sympathischer Philosoph‹.«
Stendhal – Berlioz – Konrad Ferdinand Meyer – Gérard de Nerval – Fürstin Belgioioso – E. T. A. Hoffmann – Lucrez – Victor Hugo – Cardanus – Blake.
An dieser Stelle seien noch einige weitere biographische Einzelheiten zusammengestellt, die in der letzten Zeit erschienenen Veröffentlichungen über die Neurose des Genies entnommen sind.
Stendhal. – Stendhals Seillière, Pathologie de Stendhal (Revue des Deux Mondes, 1906). Großmutter und Tante waren hysterisch, auch er selbst war in der Jugend Hysteriker. Seine Eitelkeit war besonders merkwürdig, er wollte nicht nur ein großer Schriftsteller, sondern auch ein großer Komiker und großer Diplomat sein. Er war oft gezwungen, gegen seinen Willen Beleidigungen auszustoßen, und litt an einer Art »schwarzen Teufels«, der ihn zu den bissigsten Bemerkungen gegen seine besten Freunde anstachelte. Er hatte ein Vergnügen daran, seinen Namen zu entstellen, Buchstaben dabei wegzulassen oder hinzuzusetzen, sich einen imaginären Titel oder ein solches Prädikat beizulegen, besonders wenn er seinen Bekannten oder Tischgenossen imponieren wollte. Nur ausnahmsweise gab er seinen wahren Namen an, Schneider und Schuhmacher suchten jedesmal Herrn Bel, Bell, Beil, Lebel auf. In Mailand trat er als höherer Dragoneroffizier auf, der 1814 verabschiedet worden sei und Sohn eines Artilleriegenerals wäre. Auch andere Wunderlichkeiten wies er auf: auf seine Hosenträger oder seinen Leibgurt schrieb er Notizen über seine Herzensangelegenheiten, in seinen privaten Manuskripten gebrauchte er kindliche Silbenumstellungen: » cainerepubli« für » républicaine«, »gionreli« für » réligion«, » sraip« für » Pairs« von Frankreich. Diese seine Verstecktheit weist auf Hang zur Intrige, ist jedoch wenig geeignet, die Leser zu täuschen, die sein schwaches Urteil über Welt und Leben ihm einfältiger vorspiegelte, als sie in Wirklichkeit waren.
Berlioz. – F. Herslouine Essai de critique musicale, 1896. erwähnt von Berlioz: seine Exzentrizität im gewöhnlichen Leben, seine Neigung zum Selbstmord, seine Furcht vor Verfolgungen, seinen Mangel an ruhiger Überlegung, die Tatsache, daß er vielen geringfügigen Dingen eine außergewöhnliche Bedeutung und Wichtigkeit beimaß, die Leichtgläubigkeit, die er gegenüber dem Swedenborgianismus an den Tag legte, sein trauriges Verhalten infolge seiner Willensschwäche bei einem Auftritte, der seiner kranken Frau gemacht wurde. Alles das weist auf einen Mann, dem die Psychose nahe war.
Berlioz selbst erzählt, daß er eines Tages, als er einen Artikel schreiben sollte und nichts aus seiner Feder herausbrachte, von einem Anfalle von Verzweiflung erfaßt wurde. Mit einem Fußtritt zerschmetterte er seine Gitarre und ergriff eine Pistole, in der Absicht, sich zu töten. Das zufällige Erscheinen seines Sohnes hinderte ihn an der Ausführung der Tat. Er ergriff nun ein anderes Instrument und begann zu spielen, was ihm große Erleichterung gewährte.
Mayer. – Der berühmte Dichter Konrad Ferdinand Mayer war infolge Erblichkeit seit seiner Kindheit sehr kränklich, und es schien ein Defektmensch aus ihm werden zu sollen. In späteren Jahren wurde er schwer nervös und menschenscheu, auch stellte sich bei ihm Neigung zum Selbstmord ein. Erst mit 30 Jahren schöpfte er Mut und wurde der große Dichter. In seinem 60. Lebensjahre wurde er wieder melancholisch (Heß, Über Konrad Ferdinand Mayer, Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, LVIII).
G. de Nerval. Gérard de Nerval, französischer romantischer Schriftsteller, 1808 bis 1855, in welchem Jahre er sich nach einem abenteuerlichen Leben erhängte. Anmerkung des Übersetzers. – Gérard de Nerval war nach Cabanès Essais de Litératur Pathologique, 1897. von Jugend auf unstet und zum Trunke neigend und halluzinierte. So sah er Fische aus dem Wasser springen, um ihm den Weg zu weisen, und hörte flüstern: »Die Königin von Saba erwartet dich.« Eines Tages schleppte er einen Krebs an einem Strick auf die Straße und machte, nachdem er sich entkleidet hatte, Flugversuche, so daß er verhaftet wurde. Er behauptete, Einfluß auf die Mondbahn zu haben. Wie Lamb war er beim Verlassen des Irrenhauses der Ansicht, durch die Heilung verloren zu haben. Offenbar litt er an » Dementia paranoides«, unter deren Symptomen besonders Erinnerungstäuschungen hervortreten sollen, mit Hilfe deren er in den Sängerinnen der Cafés chantants historische Persönlichkeiten wiedererkannte und in sich selbst einen Nachkommen Nervas.
Fürstin Belgioioso. – Christine Belgioioso, Barbiera, La principessa di Belgioioso, Mailand. – A. Luzio, Il romanzo della Principessa. Archivio di Psichiatria, Bd. XXIII, 1902 die eine ausgezeichnete Literaturkundige war und ausgebreitete Kenntnisse in Geschichte und Theologie und auch politische Begabung besaß, war seit ihrer Jugend epileptisch und litt an Halluzinationen, Ängsten und Zwangstrieben. Nach starken Erregungen und nach Ruhme dürstend durchkreuzte sie ohne Ziel und Zweck Asien und Europa, nirgends Ruhe und Rast noch ein Heim findend. In vielen Männern erregte sie das Feuer der Leidenschaft, das sie nur selten teilte. Sie hatte die merkwürdigsten und schrecklichsten Einfälle, hielt in ihrer Villa den einbalsamierten Leichnam ihres Sekretärs heimlich verborgen, ging als Graue Schwester gekleidet ins Theater, ließ ihr Zimmer als Sterbekapelle einrichten. Von der Schule des Rationalisten Ferrari ging sie zu der des Abbé Coeur und von dieser zu den St.-Simonisten und Kommunisten über, gleichwohl weiter zeichnend: »Wir, Prinzessin Belgioioso« und von dem Wunsche beseelt, im Kriege ein Bataillon zu kommandieren.
In dieser Frau schienen sich zu vereinigen: Sinnlichkeit und Mystik, Aristokratin und Revolutionärin, Verschwendungssucht und Häuslichkeit. In den heterogensten Unternehmungen hatte sie Glück, sie verfaßte Geschichtswerke, gründete Zeitungen, trieb Landspekulation im großen, lebte als Näherin, Schriftstellerin, Landarbeiterin und Amazone. Der Gegensatz, das Unvorhergesehene, Unvereinbare ist das beständige Charakteristikum ihres Lebens.
E. T. A. Hoffmann. – Heine sagte von Hoffmann: »Seine Poesie ist eine Krankheit.« Nach Aureville hörte er auf eine Stimme, die ihn aus der Wirklichkeit abrief.
Er war der Sohn einer strengen, ernsten, schwermütig veranlagten Mutter und eines verschrobenen Vaters mit heiterem Temperament, der die gesellschaftlichen Konventionen für närrisches Zeug hielt, über die ein gescheiter Mensch zu lachen habe.
Die Mutter, die es als ein Unglück betrachtete, wenn eine Stecknadel auf die Erde fiel, lebte, nachdem der Vater sie verlassen hatte, mit ihrem Sohne allein, blieb zeitlebens trüben Gemüts und starb früh.
Der Sohn wurde dann von der Großmutter aufgezogen, die ebenfalls eine strenge und zielbewußte Frau war. Viele der Verwandten waren merkwürdige Leute, von Zwergwuchs, rachitisch, verschroben, heftiger Gemütsart, eine der Tanten war gutherzig und ebenfalls musikalisch, aber auch von kleiner Statur. Sein Oheim Otto, ein pedantischer Beamter, war sein Vormund.
Zunächst wollte Hoffmann das Porträtmalen erlernen, aber es wurde immer Karikaturenhaftes aus seinen Bildern. Erst später widmete er sich der Musik.
Er ließ sich vom Alkohol anregen und bekam dann »szenische« Halluzinationen, die er hinterher in wundervoller Weise wiederzugeben verstand.
Er hatte Synästhesien des Geruchs und Gehörs, z. B. nahm er im Moment des Einschlafens ein Gemisch von Farben, Klängen und Düften wahr, in einer Art von Zusammenwirkung. Der Duft des roten Lauchs machte auf ihn den Eindruck ferner Hornklänge.
»Man sagt vom Dichter,« schrieb er, »daß er sich allein beim Wein inspiriert. Das ist nicht richtig, aber es ist gewiß, daß, wenn er gut disponiert ist, wenn der Geist von der Idee zur Ausführung schreitet, etwas Alkohol das Rad der Mühle schneller laufen läßt. Es beruht alles darauf, daß man versteht, sich gut anzutrinken.
»Für die Kirchenmusik sind z. B. die alten französischen Weine gut, für die große Oper Burgunder, für die komische Oper Champagner.«
Infolge dieser merkwürdigen Verhaltungsmaßregeln nahm das Übel immer mehr zu und wurde schließlich so stark, daß eine alkoholistische Psychose einsetzte, aber je mehr die Halluzinationen überhandnahmen, um so größere Gestaltungskraft glaubte er zu gewinnen.
Hugo. – Mabillaud Victor Hugo, Paris 1893. schildert Victor Hugo als von unermeßlichem Ehrgeiz im Bewußtsein einer göttlichen Mission, ein lebendiger Altar zu sein, auf dem die Flamme der Idee lodere, weshalb er auch mitten in den größten Mißerfolgen seiner Jugend seine pontifikate Ruhe bewahrte.
Seine Mutter war nervös, sein Vater hatte einen Schlaganfall erlitten, unter seinen Geschwistern und Kindern kamen Geistesstörungen vor.
Sein Grimm gegen Napoleon war förmlich der eines »Manischen«. Er lief am Strande des englischen Jersey umher und ballte im Winde die hocherhobenen Fäuste.
Er war ein »Augenmensch«, hatte aber für die Farben nicht sehr viel Sinn. In seinen Schilderungen spielt das Bunte keine Rolle, sein Auge war nicht für die eigentliche Farbe geschaffen, er liebte ganze Lichtkomplexe, auffallende Gegenstände, Kirchtürme, Klippen, Spitzenbildungen.
In seinen Versen und Darstellungen finden sich:
68 Bemerkungen über Gesichtsausdrücke,
an 17 Stellen spricht er von hellem Licht,
an 18 Stellen spricht er von Schwarz und Grau,
an 16 Stellen spricht er von Weiß.
Seine Vergleiche waren plastische Umformungen. Er gab den widerstrebendsten Abstraktionen konkrete, fast halluzinatorische Form. Das Unendliche ist ein »schreckensvoller endlos sich dehnender Säulengang«, das Nichts eine »Hydra, deren Rückgrat die Nacht ist«.
Er übertrieb alle Bilder in wunderlicher Weise: der Pflanzenwuchs des Gestades wurde zum entsetzlichen Polypen, die Berge zu kropfigen, buckligen Riesen.
Lucrez. – Stampini E. Stampini, Il suicidio di Lucrezio (Rivista di storia antica e scienze affini, Messina 1896). hat alle geschichtlichen Notizen gesammelt, die den von Hieronymus 1922 nach Abraham (= 95 v. Chr.) in der Chronik des Eusebius mitgeteilten Bericht stützen: »Der Dichter Lucrez wurde irrsinnig, nachdem er einen Liebestrank zu sich genommen hatte. In den freien Zeiten seiner Krankheit schrieb er mehrere Bücher, die später von Cicero durchgesehen worden sind; im 44. Jahre seines Lebens legte er Hand an sich.«
Stampini zeigt, daß diese Nachrichten aus Suetons Werk über die hervorragenden Männer entnommen sein können, und zwar aus der Abhandlung über die Dichter.
Das Gerücht von dem Selbstmorde des Lucrez erhält mehr Wahrscheinlichkeit, wenn man in Betracht zieht, daß sich bei ihm vielerlei Stellen vorfinden, die vom Selbstmord handeln, z. B. folgende: »Wenn der Mensch, der sich bedrückt am Herzen fühlt, wissen könnte, welchem Leide er erliegen würde und zu erkennen vermöchte, woher es stammt, und wie ihm diese Last des Schmerzes die Brust beengen werde, so würde er sein Leben nicht fortführen. Und zumeist sehen wir, daß keiner weiß, was er soll. Er geht von Ort zu Ort und stets ist er auf der Suche, fast als ob er irgendwo seine Last niederlegen wollte.«
Der Lebensüberdruß zieht sich fast durch das ganze Gedicht, »einem Flusse mit tiefem Bett zwischen zwei felsigen Ufern vergleichbar, der auch in seinen Ausbuchtungen stets einen kräftigen und bemerkbaren Wellenschlag unterhält« (Trezza).
Lucrez' Irrsinn, eine intermittierende Form, könnte nach Stampini, der das seltene Beispiel eines italienischen Literaturkundigen liefert, der es nicht verschmäht, bei der Psychiatrie Aufklärung zu suchen, eine Form der sogenannten psychischen Epilepsie gewesen sein. So würden sich die lange Zeit des freien Intervalls, die Potentialität der Leistung, der Vorwurf des Gedichts, die geniale Größenidee, die Halluzinationen, auch der Selbstmord, der bei den Epileptikern häufig ist, erklären.
Zur Erklärung zieht Stampini den erwähnten Liebestrank herbei. Wie aus vielen Dichterstellen hervorgeht, wären solche Tränke im augusteischen Zeitalter üblich gewesen und hätten Wahnbildung und Amnesie im Gefolge gehabt (Juvenal); vielleicht enthielten sie Opium.
Cardanus. Cardanus (Geronimo Cardano), italienischer Mathematiker, Arzt, Naturforscher und Philosoph, 1501-1576. Anm. d. Übers. – Von Cardanus habe ich ausführlich schon früher »Der geniale Mensch« und » Nuovi Studii sul Genio.« gesprochen und nachgewiesen, daß er seit Kindheit geisteskrank war. Neuerdings hat Rivari Rivari, La mente di G. Cardano, Bologna 1906. gezeigt, daß er von Geburt an ein sehr schwächliches Kind gewesen ist und bis zu drei Jahren gesäugt werden mußte; er war Stammler, schielte und litt an psychischer Verdoppelung. Er sagte von sich in seiner Autobiographie, er sei zu jedem Laster geneigt, nur nicht zum Ehrgeiz, vergaß aber dabei, daß er sich als den siebenten Genius der Schöpfung bezeichnet hatte, wobei er zugleich gesagt hatte, daß ein solcher Genius nur alle zehn Jahrhunderte geboren werde. Er hatte die Schrulle, öfter in einer Kutsche auszufahren, der er eines der Räder hatte abnehmen lassen. Er wollte Latein und Griechisch in drei Tagen erlernt, 40 000 Probleme gelöst und 200 000 kleine Erfindungen gemacht haben, die, wie er sagte, sich unter seinen Schriften finden würden.
Er litt an Empfindungsumkehrung und preßte aus Freude am Schmerz oft seinen Daumen zusammen, wenn er die Gicht darin hatte. Er konnte es ohne Schmerz nicht aushalten, und wenn er keinen Schmerz verspürte, so verschaffte er sich solchen. Wahrscheinlich hat er auch hysterischen Transfert gehabt, denn als er einst infolge einer Verletzung eine Lähmung am rechten Ringfinger hatte, sah er diese nach einigen Tagen auf den linken übergehen und an dem rechten schwinden, an dem sie nach neun Jahren wiederkehrte.
Er hatte viele Zwangsvorstellungen, z. B. Höhenschwindel, und die Furcht, vergiftet zu werden. Wegen letzterer kleidete er sich wohl auch in der merkwürdigen Weise vieler Paranoiker, um sich vor seinen Feinden zu schützen. Er bedeckte sich nämlich Kopf, Gesicht und Rumpf mit Leder, und zwar mit dickem Leder, ging am Tage mit acht Pfund schweren Bleisohlen aus und nachts mit einem schwarzen Wolltuch über dem Gesicht, auch bis an die Zähne bewaffnet, trotz des Verbots der Regierung (Rivari).
Er ging in diesem Aufzuge ganze Nächte hindurch spazieren, wahrscheinlich auf Grund epileptischen Bewegungstriebs, der im Alter von 18 Jahren sicher bereits mit einer akuten Steigerung vorhanden gewesen war, denn damals war er unter fieberhaften Zuständen mit Schlaflosigkeit und Nahrungsverweigerung einmal eine Zeitlang beständig in den Vorstädten und Gärten umhergelaufen.
Über alle seine Abnormitäten ragt aber seine Großmannssucht hervor. »Den 24. September,« schreibt er, »den Tag, an dem ich geboren bin, wurde auch Augustus geboren.« An anderer Stelle schreibt er: »Cäsar wurde Herr der Welt, und auch ich habe mit meinen Schriften die Unsterblichkeit erreicht.« Er behauptete, daß, wenn er bei einer Prügelei anwesend wäre, niemand verletzt würde. Er schwört, der Besitz gewisser Eigenschaften an ihm sei ihm lieber als alles in der Welt. Er machte auch in Wissenszweigen auf Gelehrsamkeit Anspruch, in denen er sich nicht unterrichtet hatte.
Dies ist nach seiner Aussage darauf zurückzuführen, daß in ihm einige wunderbare Gaben erwachen, wenn es Zeit sei und nicht, wenn es ihm gefällig ist; spricht man z. B. von ihm mit Anerkennung, so hört er auf dem rechten Ohre einen Laut, und wenn ihm eine Gefahr bevorsteht, hört er auf dem linken Ohre einen anhaltenden Ton, und sobald dieser aufhört, erscheint ein Bote derjenigen Personen, die zu ihm gesprochen haben. Ganz sicher hatte er Traumahnungen. Ferner sei er wie die Heiligen von einem Lichtschein umflossen, der ihm im Beruf und bei seinen Studien helfe und ihn zu allem geeignet mache. Endlich will er nach seinem Tode (oder als er beinahe schon tot war) auferstanden sein, und zwar bei Gelegenheit seiner Erkrankung an Eingeweidebruch, die von selbst abheilte, ohne daß er etwas dazu getan hätte.
Ich glaube, das ist genug.
Blake. William Blake, englischer Maler und Dichter, 1757-1827. Anmerkung des Übersetzers. – Gozinger hat gesagt: »Ich habe in London viele Männer von Talent gesehen, aber nur drei Genies: Coleridge, Oxanam und Blake.« Von diesen war Blake das bedeutendste oder vielmehr, er war zu gleicher Zeit ein Geisteskranker. Seine Erziehung war dürftig. Er lernte kaum Lesen und Schreiben, aber er fing früh an zu zeichnen, und er war, wie Cunningham sagte, mit zehn Jahren ein Künstler und mit zwölf ein Dichter. Einer seiner Altersgenossen sagt, daß er auch mit eigener Veranlagung treffliche Musik komponiert habe. Mit zwölf Jahren begann er seine » Poetical Sketches«, die später veröffentlicht wurden, zur selben Zeit trat seine zeichnerische Begabung hervor, und schon mit fünfzehn Jahren wurde er als Lehrer in einer Zeichenschule angestellt.
In demselben Alter liebte er ein Mädchen, das seine Liebe nicht erwiderte. Er heiratete hierauf die Tochter eines Gärtners. Blake war hundert Jahre vor dem modernen Spiritismus ein Spiritist. Er behauptete, Homer und Dante zur Porträtierung zitieren zu können,
Es besuchten ihn oft Milton und Moses und die Propheten, die er als majestätische graue oder leuchtende Schatten, größer als die gewöhnlichen Menschen, beschreibt.
Alle Gedanken Blakes und sein ganzes Leben sind von Visionen und Erscheinungen jeder Art beeinflußt. Bald erblickt er einen Baum, auf dem Engel sitzen, bald prophezeit er, daß ein Mann, der ihm auf der Straße begegnet, gehängt werden wird, eine Prophezeiung, die viele Jahre später einmal eintrifft. Er hält sich selbst für Sokrates »oder so etwas wie seinen Bruder«, und es scheint in der Tat, als wenn er ihm in den Halluzinationen geglichen hatte.
Seine nächtlichen Visionen waren so schrecklich, daß er, während er als eine »Beute seiner Dämonen« schrieb oder zeichnete, in Stücke gerissen zu werden befürchtete. Seine Frau mußte sich inzwischen, ohne Hände und Füße zu rühren, stundenlang schweigend und unbeweglich verhalten und dies manchmal mehrere Nächte lang nacheinander.
Seine Gedichte hielt er für Offenbarungen und Botschaften, von denen er nicht der Schöpfer, sondern nur der Vermittler war: »Ich bin der Sekretär, die Autoren sind in der Ewigkeit.« Er schrieb seine Verse wie unter Diktat, oft zwanzig, dreißig Zeilen auf einmal, ohne rechte Aufmerksamkeit, »oft,« sagt er selbst, »gegen meinen eigenen Willen« (Muther, Geschichte der Malerei im 19. Jahrhundert, Bd. III, S. 466). Er war also ein paranoischer Halluzinant.
Schumann. – Im »Genialen Menschen« habe ich des weiteren über Schumanns Irrsinn gesprochen. Vor kurzer Zeit hat nun Möbius P. J. Möbius, Über Robert Schumanns Krankheit, Halle 1906. eine interessante Studie veröffentlicht, in welcher er zeigte, daß der Komponist an Dementia praecox gelitten hat.
Von Schumanns Vater weiß man, daß ihn die Werke Youngs und Miltons so begeisterten, daß er außer sich geriet, und daß er immer Neurastheniker war. Auch Schumanns Mutter war neuropathisch, die Schwester litt an Dementia praecox.
Schumann war von Kindheit an gutmütigen Sinnes, auf der Schule lernte er indes nur mittelmäßig, er zeigte schon zu sehr früher Zeit künstlerische Neigungen; mit sieben oder acht Jahren fing er an zu komponieren. Er war auch schriftstellerisch und als Dichter und geschätzter Kritiker tätig. Bis zu 23 Jahren blieb er frei von Beschwerden, nach dieser Zeit setzte bei ihm in schleichender Weise ohne erkennbare Ursache ein anscheinend grundloses Angstgefühl ein, das ihn bereits damals mehrfach zum Selbstmord durch Ertränken antrieb. Später wird er nach seiner Angabe von Tönen und musikalischen Noten verfolgt. Doch besserte sich sein Befinden zeitweise, die Krankheit trat dann 1833, 1842 und 1844 wieder mehr auf. Stärkere Beschwerden beginnen 1852 und dauern mit verschiedenen Schwankungen bis zu seinem Tode (1856).
Zuerst wurde nichts von geistigem Rückgange gewahrt. Dieser machte sich 1844 nur unbedeutend bemerkbar und trat erst in den letzten Jahren deutlich hervor.
Er hatte Depressionsperioden und besaß eine außerordentliche Erregbarkeit: er glaubte an den bösen Blick der Leute und hatte Gehörshalluzinationen und starke Schwindelanfälle. Später traten manieriertes Wesen, bizarre Haltungen dazu, Symptome, die wir als für die Dementia praecox fast charakteristisch betrachten können. Die Krankheit schritt dann unter mannigfachen Remissionen vorwärts, die Halluzinationen wurden allmählich häufiger, zur geistigen Entkräftung gesellte sich die körperliche und Energielosigkeit trat ein. Seine künstlerische Gestaltungskraft schwand zusehends. Zuletzt bekam er Sprachstörungen, die immer stärker wurden. Er wurde also in den besten Lebensjahren von einer Geisteskrankheit befallen, die langsam mit zeitweise eintretender Besserung und Pausen ablief, zunächst stellten sich Angst und Depression, später Manieriertheit, Mißtrauen, absurde Verfolgungsideen, Halluzinationen, Sprachstörung und langsamer seelischer Verfall ein. Dieser Verlauf spricht nach Möbius für die Dementia praecox.
Gewiß widerstrebt es uns, einen Mann für vorzeitig schwachsinnig zu halten, der bis fast zum letzten Moment geniale Leistungen vollbracht hat, ein ausgezeichneter Familienvater, Freund und musterhafter Gatte gewesen ist. Die Diagnose wird aber annehmbar erscheinen, denn es ist bekannt, daß es Fälle von vorzeitigem Schwachsinn gibt ohne jede oder mit nur sehr geringer intellektueller und affektiver Beeinträchtigung. Gewiß ist, daß der sehr langsame chronische Verlauf mit Remissionen und Intermissionen, das lange Verschontbleiben des Kerns der seelischen Tätigkeiten, die chronische Halluzinose (nach Kraepelin machen deutliche Gehörstäuschungen im Verein mit der Ausbildung von stehenden Manieren die Dementia praecox sehr wahrscheinlich), das Auftreten und Verschwinden merkwürdiger und absurder Verfolgungs- und Selbstmordideen für die Diagnose der Dementia praecox sprechen.
Venezuelanische Genies. – Alvarado gibt im Archivio di Psichiatria, Bd. XV, S. 280 eine Liste großer venezuelanischer Politiker, die irre gewesen oder es geworden sind: Cajigal litt an Größen- und Verfolgungswahn, Aquinagald und Austo an Gehirnerweichung, Paez an Epilepsie und Halluzinationen (das Fleisch auf dem Teller verwandelte sich in Schlangen), Blanco war ethisch defekt, Michelines litt an Sinnestäuschungen.