
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
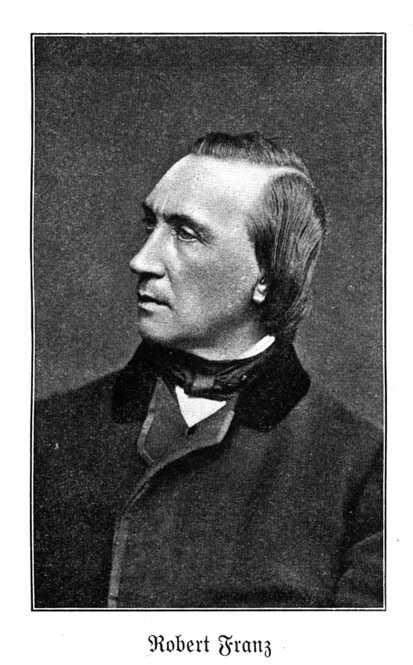
Bevor im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts mit den Musikdramen Wagners die epischen Tonschöpfungen Liszts sich allmählich Raum und Geltung gewannen, haben wir in Deutschland jahrzehntelang in einer vorwiegend lyrischen Periode musikalischer Entwicklung gelebt. Naturgemäß zog die durch Goethe herbeigeführte dichterische Blüte des Liedes die musikalische nach sich. Die in schöner Form sich offenbarenden Empfindungen des Poeten weckten ein Echo in der Seele des Tonkünstlers und begeisterten ihn, was jener gesungen, in seiner Sprache nachzudichten. Die Beziehungen zwischen beiden knüpften sich inniger, wie die Beziehungen des Künstlers zu dem von ihm behandelten Stoff überhaupt engere, intimere wurden. Immer subjektiver gestaltete sich dementsprechend auch die lyrische Tonpoesie. Von der Objektivität Mozarts, seiner künstlerischen Selbstlosigkeit, wenn wir so sagen dürfen, sind wir weit abseits gekommen. Ein Stück seiner selbst, ein mehr oder weniger vollständiges Bild seiner eigenen Individualität begehrt der Tonschöpfer der Neuzeit in seinem Werke niederzulegen. Schon Beethoven hatte in seinen späteren großen Werken subjektive Bahnen eingeschlagen. Die Einigung zwischen Wort und Ton, die er vollbewußt anstrebte und die in der Missa solemnis zu überwältigendem Ausdruck gelangt, erzielt bereits in dem unvergänglichen Liederkreis: »An die ferne Geliebte« ungleich tiefergehende Wirkungen als ein lyrisches Gesangstück sie vordem erreicht hatte. Und doch bezeugte sich sein Genius im Liede weniger neuschöpferisch, als in jeder anderen von ihm behandelten Kunstform; noch äußert die italienische Arie hier und da auf ihn ihren Einfluß. Seiner auf das Erhabene gerichteten Natur lag überhaupt die engumgrenzte Lyrik ferner.
Auch Carl Maria von Weber, obwohl manche seiner Gesänge als Volkslieder im Munde der Deutschen fortleben, gewann für die Entwicklung des Liedes nur insofern nachhaltigere Bedeutung, als er die ihm eigentümliche Grazie und reizvolle Rhythmik, den schmeichelnd süßen Wohllaut, der allem, was er schrieb, eignet, auch dieser Kunstgattung einbildete, hiermit für seine Nachfolger eine dem Liedcharakter wesentliche Anforderung feststellend.
Zu höherer Vollendung führte Franz Schubert das Lied, ja man hat ihn als den Schöpfer des Liedes bezeichnet. Gewiß ist, daß seine Lieder vor allem ihn zum Liebling des deutschen Volks gemacht haben, daß er durch sie demselben ans Herz gewachsen ist. Wo auch fände sich ein Lied, das sich an Popularität mit dem »Erlkönig« oder dem »Wanderer«, dem »Ständchen« oder den »Müllerliedern« messen dürfte? Mit unerschöpflicher Sangeslust begabt, über einen Melodienschatz verfügend, dem sich an Unversieglichkeit kaum ein anderer als derjenige Mozarts vergleichen läßt, flossen seine Lippen über von Liedern ohne Ende. Jeder Vers, den seine Hände berührten, verwandelte sich zum fertigen Tongebild. Fast wahllos gestaltete er aus der Überfülle eines nahezu unbegrenzten Vermögens heraus, das ihn nirgends an Beschränkung mahnte. Nicht Reflexion oder ästhetische Spekulation führte ihn dazu, das Wesen des Liedes zu vertiefen, seinen Inhalt geistig zu erweitern, es nach Seite der Charakteristik und lyrischen Dramatik hin auszubauen: ihn leitete dabei einzig der ihm eingeborene künstlerische Instinkt. Eine unglaublich üppige, leidenschaftlich erregte Phantasie, eine eigentümlich malerische Gestaltungsgabe drängten zum Ausfluß; sie verlangten sozusagen die Inszenierung jedes Sujets: das Lied erweiterte sich ihm unwillkürlich zur Szene, ohne darum doch seines lyrischen Grundcharakters verlustig zu gehen. So schuf er auf inneres Geheiß, voll jener Naivität und Unmittelbarkeit, die den Genius unbewußt das Rechte treffen, ihm Glück und Schmerz zum künstlerischen Segen, zum Gewinn für sich und die Nachwelt gedeihen läßt.
Viel reflektierter, moderner Art gemäß schufen Mendelssohn und Schumann ihre Lieder. Standen bei Schubert Text und Musik nicht immer im rechten innerlichen Verhältnis zu einander, ja erscheint der erstere von der letzten oft himmelweit überragt, also daß das Wort nur zur Folie dient für das zum Hauptfaktor erhobene rein Musikalische, so verfuhren die späteren Meister ungleich sorglicher in der Wahl ihrer dichterischen Grundlagen. Während aber Mendelssohn, im Aufblick zu Reichardts und Zelters Vorbild, sich begnügte, der gesungenen Melodie durch das Klavier das notwendige Geleit zu geben, ohne die Begleitung jemals das absolut musikalische Gebiet überschreiten zu lassen, ordnet Schumann das Akkompagnement dem Gesang als ein Gleichberechtigtes bei. Er erstrebt die sich zur Aufgabe gestellte Einheit zwischen Dicht- und Tonwerk weniger auf melodischem als rhythmischem, harmonischem Wege durch erhöhte Feinheit der Charakteristik, die sich hauptsächlich in der Behandlung des Pianofortes kundgiebt. Letzterem übertragt er die individuellere Auslegung und Ergänzung des Textes, den die Stimme in ausdrucksgemäßer Deklamation vermittelt. Seinem durchaus dichterisch angelegten Naturell gilt im Gegensatz zu Schubert die poetische Intention als Hauptsache, der gegenüber er der rein musikalischen Form minderes Gewicht beilegt. Bei gleicher Gemütsfülle und Tiefe ist Schumann bei weitem geistreicher als sein großer Vorgänger Schubert; dieser dagegen naiver, ursprünglicher, melodisch reicher. Er ist ein reines, gottbegnadetes Naturkind neben jenem, der ihm verglichen, ernst und tiefsinnig, ein stiller, in sich versunkener Denker und Träumer erscheint. Darum entscheidet auch individuelle Neigung allein die müßige, wiewohl häufig aufgeworfene Frage, wer der größere sei von beiden Großen? Ihnen aber, den vornehmsten Förderern des Liedes, schloß sich in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ein anderer an, dessen Name oft und mit Recht in engster Verbindung mit jenen genannt wird: Robert Franz.
Er durfte als der eigentliche Liedersänger seiner Zeit gelten. Wenn andere, wie Liszt, Rubinstein, Brahms, Grieg, Wolf, Strauß, sich inmitten einer vielseitigen künstlerischen Wirksamkeit auf zeitweise lyrische Spenden beschränkten und noch beschränken, so hat Franzens Schaffen ausschließlich in dieser einen Sphäre Bedeutung gewonnen. Der Kunstart, die seinen Namen zuerst der musikalischen Welt bekannt machte, ist er mit seltener Beharrlichkeit treu geblieben; denn mit Ausnahme dreier Kompositionen für Kirchenchor, einer Anzahl Vokalquartette und Bearbeitungen älterer, namentlich kirchlicher Werke, hat er uns nur Lieder geschenkt. Diese kleinen Gaben – 279 in ihrer Gesamtzahl – freilich umschließen eine Perlenreihe von so hohem Wert, daß sie ihrem Schöpfer einen Platz im Kreise der edelsten Genien der Tonkunst zu erwerben vermochten.
Neben Franz Schubert und Robert Schumann, die deutschen Meistersänger, aus deren Vornamen sich durch ein wunderliches Spiel des Zufalls sein eigner Name zusammensetzt, darf Robert Franz sich als würdiger Genosse stellen. Der Erbe und Nachfolger beider, schlug er nichtsdestoweniger selbständige Bahnen ein. Im Gegensatz zu der überwiegenden Entwicklung der Musik nach der instrumentalen Seite hin, die sich seit Beethoven im Tonleben geltend macht, griff Franz zur großen Vokalperiode der Längstvergangenheit zurück und fand in dem uralten Ausgangspunkte unserer musikalischen Lyrik: dem altdeutschen Volkslied und dem aus ihm hervorgegangenen protestantischen Choral die Basis seines Schaffens. Einflüsse, die von frühester Kindheit an auf ihn einwirkten, sowie innerste Neigung zur Beschäftigung mit alter Musik, wie sie sich durch seine Bearbeitungen älterer Tonwerke betätigte, leiteten ihn zuerst instinktiv auf diesen Weg. Weiterhin vertiefte und befruchtete die Bekanntschaft und steigende Vertrautheit mit Bach und Händel seine Richtung, während Schubert und Schumann ihm moderne Elemente zuführten und ihn mit dem künstlerischen Empfinden seiner Zeit in lebendigem Zusammenhang erhielten.
Die Wiederaufnahme jener alten lyrischen Formen vollzog sich übrigens durch Franz keineswegs unvermittelt. Bei Schubert und Schumann bereits taucht hier und dort die dem Kunststil seit langem abhanden gekommene Volksweise von neuem auf. Gleicherweise besann sich die neuere Zeit in Mendelssohn zuerst wieder auf den Choral, der einst Bach und Händel als Grund- und Eckstein ihrer erhabenen Tongebäude gedient hatte. Nur vereinzelt jedoch und wie zufällig kommt bei diesen seinen drei Vorgängern zur Erscheinung, was sich bei Franz als fundamental für seine Entwicklung darstellt. Nicht allein bestimmend wirkten Volkslied und Choral auf seinen Kunstausdruck, sie haben denselben, seiner eigenen Überzeugung zufolge, geradezu hervorgerufen. Das Schlicht-Volkstümliche einerseits, das Übersinnliche, resigniert von der Welt Abgewandte der Empfindung andererseits, das Ethische und Maßvolle, das das alte, unserem heutigen Geschlecht fast entfallene Kunstgesetz: Ruhe in der Bewegung, als Kardinalgebot zu predigen scheint – all' diese Züge, die seine Kompositionsweise kennzeichnen, führen in direkter Linie auf jene Einflüsse zurück. Nicht minder die Art seines formalen Ausdrucks, wie die Konstruktion der Kantilene, die Behandlung der Tonarten und deren Harmonie, der Strophenbau, die Vor- und Zwischenspiele, die Tonschlüsse, die polyphone Stimmführung, das Vokale des ganzen Tonsatzes, wo jede einzelne Stimme am Gesang beteiligt und ein wesentlicher Träger des Ganzen ist.
Selbstverständlich mußten seine von denen der Kunstgenossen verschiedenen Ausgangspunkte auch verschiedene Ergebnisse bedingen. Der dramatischen Auffassungsweise Schuberts, wie dem deklamatorischen Pathos Schumanns hält Franz sich gleicherweise im Liede fern, Lyriker im engsten und eigentlichsten Sinne, setzt er das Wesen desselben mehr noch in die innerste Tiefe der Empfindung, er verinnerlichte es in einem Grade, der eine Steigerung nach dieser Seite hin kaum noch zuläßt. Nennt er selbst doch seine Lieder sehr bezeichnend Monologe, die die Empfindung mit sich selber hält.
Fast spröde und schmucklos stellen sie sich, trotz des ihnen innewohnenden Kunst- und Gefühlsreichtums, zuerst dem Blicke dar. Es bedarf eines sicheren, am Kunststudium geschärften Auges, um ihren Wert allsogleich zu erkennen. Erst nach und nach erschließen sich dem Hörer wie dem Sänger diese tiefen Herzenslaute, diese träumerischen Stimmungsbilder, die nicht minder der frischen Sinnlichkeit Schuberts entbehren wie des berückenden Zaubers Schumannschen Tongewebes. Was dem Kunstwerk im Publikum unwiderstehlich Eingang verschafft: der breite, fortreißende Gefühlsstrom, das geht ihnen ab. Beobachtet doch der Komponist in seinem Kunstausdruck eine merkliche Zurückhaltung. Dem Erfahrungssatze gemäß, daß, je feingebildeter Geist und Herz des Menschen sind, sich um so feiner und mystischer die Kreuzungslinien der Empfindung gestalten – so daß die Freude einen leisen Beigeschmack von Wehmut annimmt, den Schmerz ein sanfter Strahl der Hoffnung durchzieht – treten auch bei Franz die Stimmungen mehr gemischt auf und scheinen an erschütternder Gewalt zu verlieren, was sie an intensiver Eindringlichkeit gewinnen. Nicht jeglichem enthüllen seine Lieder ihre zarte keusche Seele: nur poetischer Sinn, künstlerische Feinfühligkeit, oder zarte Herzenseinfalt vermögen ihnen gerechte Richter, dankbare Empfänger zu sein. Er selbst sagt: »Wer hier nicht zur musikalischen Tüchtigkeit ein lebhaft sich hingebendes poetisches Auffassungsvermögen, das im Herzen und nicht im Verstande wurzelt, mitbringt, dem wird das Beste in meinen Liedern stets ein mit sieben Siegeln verschlossenes Geheimnis bleiben.«
Mehr im engeren Freundeskreis als vor dem großen Konzertpublikum entfalten sie ihren wahren Reiz. Ihre Zeichnung ist zu detailliert, ihr Kolorit zu fein, um gegenüber den größeren Dimensionen des Konzertsaales und einer aus ungleichartigsten Elementen gemischten Zuhörerschaft nicht einen guten Teil ihres Eindrucks einzubüßen. So ist auch die ihnen eigene mehr stille als begeisternde Wirkung ihrer Popularität nicht förderlich gewesen. Der Kreis derer, die sie nach ihrem wahren Wert zu würdigen wissen, blieb ein verhältnismäßig beschränkter. Fürwahr, belehrte uns nicht der alte und doch immer neue Erfahrungssatz, daß gerade dem Besten hienieden sich am schwersten und letzten das Verständnis öffnet, wir würden befremdet vor der Tatsache stehen, daß diese einer spezifisch deutschen Kunstart zur unvergänglichen Zierde gereichenden Tongebilde unserem Volke nicht schneller eingegangen, nicht tiefer ans Herz gewachsen sind. Seit dem Hinscheiden ihres Schöpfers und den Wandlungen, die sich neuerdings im Musikgeschmack vollzogen, trat ihre schlichte Weise zurück hinter lauteren glänzenderen Erscheinungen. Verklingen aber werden sie nicht; denn Ewigkeitswerte wohnen ihnen inne.
Franz selber sah in ihnen den Abschluß einer Kunstperiode. »Ich erblicke,« schrieb er uns am 9. Februar 1872, »in der Kunst einen in sich abgeschlossenen Organismus, dessen Entwicklungsstadien mit innerer Notwendigkeit einander folgen. In der Poesie wie in der Musik ging der Prozeß von naiv-lyrischen Elementen aus, erhob sich später zu dramatischen und epischen Formen, um schließlich wieder zu den Anfängen, die jedoch nun von bewußteren Grundlagen getragen werden, zurückzukehren. Hiermit scheint mir der Kreislauf vollendet und das Kunstschaffen vor der Hand zu einem bestimmten Abschluß gekommen zu sein – es wird erst neuer, die bisherige Weltanschauung umgestaltender Ideen bedürfen, bevor die Künste wieder zu selbständigerem Leben erwachen. Wer dieser Ansicht beipflichten kann, wird notwendig in der modernen Lyrik, namentlich im Liede, ein sehr ernstes Moment erblicken müssen. Sie spiegelt gewissermaßen die Vergangenheit im kleinen Rahmen noch einmal wieder: wie in schimmernder Abendröte scheidet die holde Kunst von der trauernden Erde und wirft noch einen letzten schmerzlichen Blick auf sie zurück. – An meinen Liedern z. B. läßt sich diese Erscheinung ganz ungezwungen beobachten: die Anklänge an das uralte Volkslied und seine Naturlaute, die Beziehungen auf die große altitalienische Schule mit ihren tiefsinnigen Kirchentönen, die geheime Wahlverwandtschaft zu Bachs und Händels Musik, die lebhafte Hinneigung zu dem in Schubert und Schumann kulminierenden modernen Ausdruck – von alle diesem finden Sie deutliche Spuren in meiner Lyrik, die sich sowohl neben- als ineinander verfolgen lassen.
Wer in dem Menschen einen Mikrokosmus erblickt, wird sich über dergleichen vor Augen liegende Tatsachen, die übrigens in Heines Lyrik geradezu ihr entsprechendes Seitenstück finden, durchaus nicht wundern. Das moderne Lied auf diese Basis gestellt, gewinnt aber eine Bedeutung, von der man sich seither nur wenig träumen ließ.«
Robert Franz wurde im Jahre 1815 am 28. Juni in Halle an der Saale geboren. Er entstammte einer alten Halloren-, das ist Salzarbeiter-Familie. Sein Vater hieß eigentlich Knauth, nahm aber, da sein Bruder gleich ihm selber Speditionsgeschäfte betrieb und durch Verwechslung der Geschäftsbriefe vielfache Mißhelligkeiten entstanden, im Geschäftsleben den Namen »Christoph Franz« an, worauf die feindlichen Brüder nun in Frieden lebten. Sein Sohn wurde Robert Franz getauft und wuchs als solcher auf, wie er selber in einem Brief vom 9. Januar 1890 an Otto Leßmann schrieb »Allgemeine Musik-Zeitung«, 18. Nov. 1892.. Die legitime Führung des Namens wurde später beim König von Preußen »beantragt und durch Kabinettsorder gut geheißen«.
An seiner Wiege ward dem Knaben nichts gesungen von dem dereinstigen Künstlertum, und keinerlei Vorspiel kündigte seiner Kindheit die spätere klangreiche Zukunft an. In der schlicht bürgerlichen Sphäre des Elternhauses galt nur das Nützliche als das Rechte, die Welt des Schönen hatte in der Enge derselben nicht Raum: ja der Vater bekannte sich offen als einen abgesagten Feind aller sogenannten unnützen Dinge und brotlosen Künste. Gleichwohl kann er selbst nicht ohne musikalische Befähigung gewesen sein. Wenigstens erzählt Franz, wie der Vater an Tagen, wo er sich besonders dazu aufgelegt fühlte, seinen Kindern eine Menge schöner Choräle vorsang, und diese ihre höchste Lust darin fanden, den frommen Weisen andächtig zu lauschen. Seine ersten musikalischen Eindrücke empfing der Knabe somit durch eins der edelsten Erzeugnisse des deutschen Kunsttriebes: das kirchliche Volkslied; denn auch seine allerfrüheste klangliche Erinnerung führt er auf Luthers Choral »Ein' feste Burg« zurück, den er gelegentlich der 300jährigen Gedächtnisfeier der Reformation, im Posaunenchor von den Hausmannstürmen seiner Vaterstadt herabtönen hörte. Später beim Schulbesuch zog ihm die »unwiderstehliche Lust, den einzuübenden Choralmelodien eine zweite Stimme aufzudrängen, manch' harte Züchtigung von der wuchtigen Hand des Singmeisters zu.« Im übrigen jedoch mangelte es der musikalischen Begabung des Knaben an jedweder Gelegenheit sich zu betätigen; ungeahnt schlummerte sie, bis er sein vierzehntes Jahr erreicht hatte, und nur einer zufälligen Veranlassung durfte er es danken, daß sie endlich geweckt ward. Er entdeckte nämlich bei einer Verwandten ein uraltes »Pantalon«, ein spinettartiges Möbel, nicht beledert, sondern bekielt und ohne Dämpfung, das sein kindliches Interesse in höchstem Maße erregte. »Damit war mein Schicksal entschieden«, erzählt Franz selbst in biographischen Mitteilungen, die sich in der »Deutschen Musikzeitung« von 1860 veröffentlicht finden.
Unaufhaltsam brach nun die Liebe zur Tonkunst in ihm hervor. Sich selbst überlassen, bemühte er sich, die Geheimnisse der Notenschrift auf eigene Hand zu entziffern. »Mit der rührendsten Ausdauer«, sagt er, »plagte ich mich tapfer mit Hindernissen herum, über die glücklich hinausgekommen zu sein mir heute noch ein wahres Rätsel ist.« Als seine Neigung immer offenkundiger hervortrat, ließ der Vater sich nach langem Widerstand durch die Fürsprache der Mutter endlich bestimmen, das oben erwähnte »Pantalon« käuflich zu erwerben. Des Sohnes unermüdlichen Bitten gelang es sogar durchzusetzen, daß, freilich mit möglichster Beobachtung von Billigkeitsrücksichten, ein einigermaßen musikkundiger Verwandter als Klaviermeister für ihn engagiert ward. Nur zu bald jedoch hatte der talentvolle Schüler diesem die ganze Summe seines Wissens abgelauscht, und ein Wechsel im Unterricht machte sich nötig. Dies wiederholte sich öfter, dergestalt, daß binnen einer Zeit von vier Jahren der junge Franz bei sämtlichen Musikpädagogen in Halle studiert und von jedem sein Bestes profitiert hatte, ohne darum doch über ein nennenswertes, oder nur irgend geordnetes Kapital von Kenntnissen verfügen zu können. In dem fortgesetzten Verkehr mit künstlerischen Mittelmäßigkeiten weder Genüge noch den gehofften Nutzen findend, gewöhnte er sich frühzeitig daran, seinen eigenen Weg zu gehen und, wie Liszt in seinem schönen Aufsatz über den Künstler Zuerst »Neue Zeitschrift für Musik«, Bd. 43, Nr. 22 u. 23, dann als Broschüre (1872), schließlich Ges. Schriften, Bd. IV., Leipzig, Breitkopf & Härtel, erschienen. sagt, »in der Wahl der Stoffe wie der Form seiner Gedanken nur den individuellen Trieb entscheiden zu lassen, statt, wie so manche Talente, seinen Geist der Nachahmung zu bequemen.« Alsbald machte sich auch wieder die alte Neigung zur Beschäftigung mit Chorälen bei ihm geltend, ja selbst für seinen Umgang ward dieselbe bestimmend, insofern er sich unter Freunden und Bekannten behufs gemeinsamer Übung diejenigen auswählte, die eine gleiche Passion beseelte. Voll lebhaften Eifers warf er sich auf das Orgelspiel und »lief des Sonntags von einer Kirche zur andern, um die Organisten für einzelne Choralverse abzulösen«. Als eine hohe Vergünstigung besonders empfand er es, als Abela, der Kantor des Waisenhaus-Gymnasiums, das er, nachdem er die Bürgerschule absolviert, besuchte, um sich daselbst für ein Fachstudium vorzubereiten – ihn zum Akkompagnateur ernannte. Zu ihm, der eine wöchentliche Chorstunde für die begabteren Zöglinge eingerichtet hatte, fühlte sich Franz dankbar hingezogen, froh, in ihm wenigstens einen Beschützer seiner von allen Seiten nur mit mißbilligenden Blicken betrachteten Kunstleidenschaft zu finden. Er bekennt, daß diese Chorübungen auf seine spätere Entwicklung einen wesentlichen Einfluß geübt haben. »Mozart- und Haydnsche Kantaten, Händelsche Oratorien und Psalmen konzentrierten meine auseinanderfahrenden Interessen und bildeten einen haltbaren Kern für ein zukünftiges Wachstum. Zwar blieb ich nach wie vor Autodidakt, aber doch jetzt in einer Form, die mich vor einem lächerlichen Ende bewahren mußte.«
Durch diese klassischen Tonschöpfungen entzückt und zu eigenem Schaffen begeistert, wagte er nun auch, wiewohl ohne alle theoretischen Vorkenntnisse, ja selbst ohne das Bewußtsein von der Notwendigkeit derselben, seine ersten Versuche in der Komposition. Kein Lehrer und Berater stand ihm dabei zur Seite und half ihm die Wirrnis seiner Ideen ordnen und lichten: wiederum mußte er auf eigene Gefahr und Verantwortung experimentieren. »Meine Kompositionsversuche«, lautet sein eigenes Urteil, »trugen alle Mängel der törichten Selbsthilfe, verrieten weder formales Talent, noch idealen Gehalt. Stellte sich mir heute ein junger Mensch, der das nämliche leistete, was ich damals vermochte, mit dem Wunsche vor, daß ich ein entscheidendes Wort über seine Zukunft spräche: ich würde ihm eher zu allem anderen raten, als zu einem künstlerischen Beruf.« Nichtsdestoweniger trat der Drang zur Produktion fortan bei ihm derart in den Vordergrund, daß er, ungeachtet ernstester Vermahnungen, selbst häufigen Spottes von Eltern, Lehrern und Genossen, seine Gymnasialstudien darüber zu vernachlässigen begann. Harte Kämpfe zwischen kindlichem Gehorsam und zwingendem Naturgebot, zwischen der ihm angebornen Schüchternheit und dem sich immer lauter kundgebenden Künstlerberuf durchkämpfte er in seinem Innern, und »nur dem naiven, aber unerschütterlichen Glauben an seine Bestimmung war es möglich, in dieser Misere auszuharren.« Am Ende aber trug doch seine unüberwindliche Liebe zur Tonkunst den Sieg über die Einwände und Bedenken der Eltern davon. Man willigte, wenn auch mit Widerstreben, ein, daß der nun zwanzigjährige Jüngling das Gymnasium und damit zugleich seine Vaterstadt verließ und sich nach Dessau begab, um unter Friedrich Schneiders Leitung eine neue, künstlerischen Zielen zugewandte Studienzeit zu beginnen.
Was er gesucht: eine freie, ideale Kunstauffassung, eine unbeengte, poesiegetränkte Atmosphäre, wie sie ihm Bedürfnis war, das fand er freilich auch in Dessau nicht. Die Regeln und Theorien, die man ihm in trockner Weise vermittelte, gaben seinem Verstande vollauf zu tun; sein Phantasie- und Empfindungsleben aber darbte dabei. Genug, es währte nicht lange, so verfolgte er, seiner Art und Gewohnheit getreu, auch hier unter den Augen des Meisters selbständige Bahnen. Hatte er den Schülerpflichten nur halbwegs genügt, so hielt er sich schadlos, indem er seinen eigenen Eingebungen Gehör gab und nach Herzenslust seine gestaltende Kraft erprobte. Die Frische und Anregung, die er im Verkehr mit dem Lehrer entbehrte, fand er in einem Kreise jugendlicher Gesinnungsgenossen, der sich behufs freierer Kunstübung unter dessen Jüngern gebildet hatte. Hier auch erschlossen sich ihm die Sympathien, die Schneider seiner eigentümlichen, unabhängig gearteten Individualität versagte. Franz selbst bekannte, daß die unter jenen Mitstrebenden eingeatmete Luft das einzige, seinem wahren Fortschritt günstige Element gewesen sei, und nachdrücklich betont er insbesondere die Anregung, die er durch einen in der Kunst der Orgelimprovisation und Choralbehandlung außergewöhnlich begabten Mitschüler, namens Reupsch, empfangen habe. Was er im übrigen in Dessau erlernt, alle harmonische und kontrapunktische Weisheit, die er daselbst in sich aufgenommen, ward ihm erst später flüssig, nachdem sein Genie sein natürliches Fahrwasser gefunden hatte, das allerdings weit abseits leitete von den dort sanktionierten Zielen, Einstweilen komponierte er vielerlei: Klaviersonaten, eine vollständige Messe usw., was über den Charakter von Versuchen nicht hinauskam, aber, wie Liszt in dem erwähnten Aufsatz über Franz bemerkt, das mühsame Winden einer jugendlichen Phantasie unter dem Schulzwang und dem Bedürfnis, denselben abzuschütteln, in interessanter Weise verfolgen läßt.
Nach zweijährigem Aufenthalt in Dessau 1837 in das elterliche Haus zurückgekehrt, begann für ihn erst seine eigentliche Prüfungszeit. Da man handgreifliche Erfolge seiner bisherigen Studien sich noch nicht einstellen sah, wurden in seiner nächsten Umgebung die alten Zweifel an seiner künstlerischen Begabung und rücksichtslos geäußerte Vorwürfe laut; um so empfindlicher für ihn, als er ein ziemlich entwickeltes Selbstvertrauen aus der Fremde mit heimgebracht hatte. Der Versuch, sich demzufolge anderwärts – in Schönebeck – eine wenn auch noch so bescheidene Stellung zu gründen, scheiterte an seinem Unvermögen, sich in den dasigen kunstwidrigen Verhältnissen zurechtzufinden. Er mußte, so schwer es ihm auch ankam, im Vaterhause ausdauern, wo er von allen, nur nicht von seiner guten, sanften Mutter, als verlorener Sohn betrachtet ward. Einzig ihrer liebevollen Weise gelang es, ihn zu trösten und zu stützen, wenn Leid und Unmut ihn zu übermannen drohten. Denn auch eine Periode künstlerischen Zweifels an sich selber blieb ihm nicht erspart. Durch einen ihm befreundeten Musikkreis – im Hause des Landgerichtsdirektor Schröner in Halle – lernte er um jene Zeit eine ihm bis dahin fremde Art des Kunstkultus kennen. Die Dilettanten, auf deren Treiben er im Bewußtsein seiner musikalischen Gelehrsamkeit vornehm herabblickte, öffneten ihm zuerst die Augen für das geistige Wesen der Kunst. Sie belehrten ihn, daß alle Kenntnis der Formen und Gesetze nur Mittel zum Zweck sei, daß es »auf die Erkenntnis des idealen Gehaltes eines Kunstwerks, nicht auf dessen formalen Wert ankomme, welcher letztere sich bei einem wirklichen Kunstwerk ganz von selbst versteht«.
Gleichzeitig ward ihm auch das Bekannt- und Vertrautwerden mit altitalienischen Meistern, mit Bachs und Händels, wie Franz Schuberts Genius vermittelt. Ganz erstaunt schaute er plötzlich in eine Welt, von der seine Seele sich nichts hatte träumen lassen, und einen »erschütternden Eindruck« brachte vor allem Schuberts »Feuerseele« auf ihn hervor; ja die leidenschaftliche Beschäftigung mit dessen Schöpfungen machte sein Nervensystem dermaßen reizbar, daß es nur zu empfänglich für ein Gehörleiden wurde, dem Franz nachmals mehr und mehr zur Beute verfiel. Eben diese Bekanntschaft mit den großen Meistern aber wurde für seine Meinung von den eigenen Leistungen verhängnisvoll. Der an jenen gewonnene Maßstab wollte für diese letzteren nirgends passen. Was er selber zu sagen hatte, schien ihm von ihnen schon vieltausendmal besser gesagt: kurz er zog einen Strich durch seine Vergangenheit und gab alles, was er bis dahin geschaffen, unerbittlich der Vernichtung preis. Damit zugleich aber schwand auch sein Mut, der Glaube an die eigene Produktionsfähigkeit.
Fünf Jahre lang ungefähr enthielt er sich jeglichen Schaffens. Keine Note ward in dieser Zeit von ihm geschrieben. Er war einzig auf die Erweiterung seines Ideenkreises, auf Förderung seiner allgemeinen Bildung bedacht, vermöge deren er seiner Mission als Künstler um so mehr gerecht zu werden hoffen durfte.
Die damalige Atmosphäre in Halle war dieser Bildungsarbeit überaus günstig. Lag auch das öffentliche Musikwesen daselbst ziemlich im Argen, so bot doch die Universität um so mannigfaltigere Elemente geistiger Nahrung dar. Der frischen Bewegung wissenschaftlichen Lebens, wie sie, von der Philosophie ausgehend, sich zunächst an den Begründer der berühmten Halleschen Jahrbücher, den Hegelianer Ruge, und dessen Anhang knüpfte und allmählich alle Gebiete geistigen Lebens durchdrang, blieb auch Robert Franz nicht fern. Seiner Natur nach ohnehin zu ernstem Sinnen, zum Analysieren und Reflektieren, zum philosophischen Denken geneigt, ward er in Gemeinschaft mit seinem nachmaligen Schwager, dem Juristen Friedrich Hinrichs, dem Theologen A. Ritschl, dem Musiker Julius Schäffer, dem Philosophen Rudolf Haym, dem Dichter Wilhelm Osterwald, der später ein treffliches Lebensbild von Franz Leipzig, Gebrüder Hug, 1886. entwarf, ein eifriger Teilnehmer an den verschiedenen Debatten und Untersuchungen. Die gewonnenen philosophischen, ästhetischen und kritischen Resultate fanden auf seine künstlerischen Interessen Anwendung und trugen zur Klärung seiner Kunstprinzipien wesentlich bei. Insbesondere ging ihm die Erkenntnis auf von der Notwendigkeit der Einwirkung der herrschenden Temperatur der Ideen auf die Kunst, des Zusammenhangs dieser letzteren mit dem großen Ganzen, in dessen Mitte wir leben; zugleich aber auch von der Berechtigung der Individualität, dem Kunstwerk ihr Wesen und ihre Eigenart aufzuprägen.
Und seine Individualität suchte nicht lange nach der ihr gemäßesten Form. Eine Herzenserfahrung süßschmerzlicher Art rührte die lang verstummten Saiten seiner Seele zu neuem Klange und entlockte ihm seine ersten Gesänge, die Robert Schumann mit so warmer Anerkennung 1843 in die Öffentlichkeit einführte. Eine längere Reise nach Salzburg und Tirol, die er aus Gesundheitsrücksichten für sein leidendes Gehör unternommen, wirkte heilend und kräftigend auf sein ganzes Wesen: genug, seine so lange zurückgehaltenen Fähigkeiten kamen jetzt um so stürmischer zum Durchbruch. Er mußte komponieren, weil er nicht anders konnte. Von da an datiert er seine eigentlichen Studien: er lernte den Kunstausdruck an sich selbst. Mit jedem neuen Lied wuchs sein Vermögen und er gewann in Formen Gewandtheit, die ihm bis dahin weit ab lagen.
Indessen hatten seine sich auf das Allgemeine beziehenden Studien ihn der musikalischen Gegenwart keineswegs entfremdet. Wie er einst von Bach und Schubert das seinem Naturell Zusagende in sich aufnahm, so hatte er inzwischen auch den hervorragenden Zeitgenossen seine Aufmerksamkeit zugewandt. Vorzüglich Schumann brachte vieles in ihm zur Reife, was bisher nur dumpf in ihm gärte; an ihn zunächst schloß er sich auch im eigenen Schaffen an. Dem seine schöpferischen Leistungen im hohen Maße fördernden Bedürfnis, sich stets über sich selbst klar zu werden, verband sich eine natürliche scharfe Beobachtungsgabe, die ihn nie blind genießen ließ; so daß er sich immer über die Gründe seines Behagens oder Mißbehagens an den Objekten selbst Aufschluß zu geben suchte. »Diesem harmonischen Gleichgewicht zwischen Verstand und Gefühlsleben« dankt er, seinen eigenen Worten zufolge, zumeist, was er geworden. »Dazu kommt«, fügt er hinzu, »noch ein gesunder Instinkt, mich nur mit Dingen befaßt zu haben, die meinem Sinn und Wesen entsprachen, und absolut liegen zu lassen, was sich im Widerspruch zu meiner Persönlichkeit befand. Im Genießen habe ich stets gelernt, und das ist bis auf den heutigen Tag meine Lebensweisheit geblieben.«
Fern von dem Gedanken an Veröffentlichung, nur zur Befreiung seiner selbst schrieb Franz seine ersten Lieder, »seine kleinen Leiden und Freuden im echten Künstleregoismus darin abschüttelnd«. Die Herausgabe derselben erschien ihm zwar zuerst wie eine Profanation seiner heiligsten Gefühle, endlich aber gab er dem Drängen seiner Freunde nach und sandte einige Hefte an Schumann, der sich auf das lebhafteste dafür interessierte und sofort auch für einen Verleger sorgte.
Diesem ersten Schritte schloß sich ein zweiter und dritter an: Mendelssohn und Gade folgten Schumanns Beispiel und vertraten Patenstelle an seinen nächsten Werken. Der persönliche Verkehr mit ihnen gewann Franz das wankend gewordene künstlerische Selbstvertrauen zurück und bestärkte ihn in der Überzeugung, mit der eingeschlagenen Bahn die seiner Begabung angemessenste in der Tat ergriffen zu haben. Die Besten seiner Zeit hießen ihn freudig willkommen auf dem begonnenen Wege. »Mögen Sie sehr, sehr viele Werke, ebenso schön gefühlt, ebenso fein ausgeführt, ebenso eigentümlich und so reich an Wohlklang diesem folgen lassen!« schreibt Mendelssohn 1844 in einem Briefe, darin er dem Komponisten für das ihm gewidmete Liederheft op. 3 dankt, und Schumann rühmt den »Fleiß der Auffassung, der den Gedanken des Gedichtes bis auf das Wort wiedergeben möchte«, das Charakteristische der Lieder, »deren einzelne seine Züge anzuführen man nicht fertig werden könne«.
Auch Wagner schätzte Franzens Lyrik hoch und die sechs Gesänge op. 20 wurden ihm zugeeignet. Als Franz ihn 1857 in Zürich besuchte, zeigte er ihm seinen Notenschrank und sagte, auf dessen Inhalt deutend: »Das ist alles, was ich an Musikwerken besitze.« Vor Franzens Augen standen da Bach, Beethoven und seine eigenen Lieder.
Liszts warmherzige Anerkennung des Halleschen Meisters ist bekannt. Doch blieb seine Meinung, daß dieser auf jeglichem Gebiete Ausgezeichnetes zu leisten imstande sei, ebenso wie Schumanns Mahnung, sich »durch Ergreifen neuer Kunstformen vor Einseitigkeit und Manier – der Gefahr der Erfolge in kleineren Genres – zu schützen« und sein »reiches Innere auch anders auszusprechen als durch die Stimme«, fruchtlos gegenüber der Überzeugung des Künstlers, daß gerade in der Liedform »sein eigentlichster Inhalt kulminiere«. Grundsätzlich verließ Franz diese Bahn nicht wieder. »Richard Wagner«, meint er, »ist der Mann weiter Würfe; ich verschmähe solche Schleuder und gehe lieber mit dem Spitzhammer auf einen Fleck los.« »Meine Anschauungen sind so mit mir verwachsen, daß ich sie nur mit dem Leben aufgebe. Irrte ich – so war meine Existenz verfehlt«, schreibt er einem Freund, und anderwärts: »Sie kennen meinen Grundsatz, nichts zu machen, was ich nicht machen muß, und ich glaube, daß alles so Entstandene die Garantie innerer Notwendigkeit in sich trägt.«
So blieb es denn dabei: Franz verharrte in den sich freiwillig auferlegten Schranken. Außer einem vierstimmigen Kyrie op. 15, einem doppelchörigen Psalm op. 19, einer Liturgie für gemischten Chor op. 29, sechs Gesängen für gemischten Chor op. 24, sechs für Männerchor op. 32, die, sämtlich a cappella, nur mit Ausnahme der zwanzig Jahre später veröffentlichten Liturgie, in den fünfziger Jahren erschienen und denen er 1887 noch einen Trinkspruch folgen ließ, hat seine Muse nur in Liedern zu uns geredet Als op. 45, 46 und 49, sowie in einem bei Whistling (jetzt Peters) in Leipzig erschienenen Heft ohne Opuszahl, gab er auch einige seiner einstimmigen Gesänge in einer Bearbeitung für Chor heraus. Op. 53, drei Chorlieder (nach op. 27) erschien nach seinem Tode..
Welch ein Lieder- Segen aber ist von ihren Lippen geflossen! In seinen die bescheidene Zahl 53 nicht übersteigenden Werken halten wir einen Schatz von 279 einstimmigen Gesängen in den Händen. Was der Komponist mit einer derartigen Vertiefung in eine einzige Kunstgattung erreichte, ist im wesentlichen die Vertiefung und Verinnerlichung dieser Kunstgattung selbst. Wenn Schubert und selbst der träumerisch in sich versenkte Schumann in der Wahl des Stoffs wie des Ausdrucks direkter mit der Außenwelt in Beziehung treten; wenn – wie die überwiegenden Situationsbilder des einen und die vorherrschend deklamatorisch-pathetische Weise des andern dies mit sich bringen – wir bei beiden häufigen Tonmalereien begegnen, so eignet Franz, bei dessen Kunstausdruck es sich fast ausschließlich um innere Prozesse handelt, ein mehr psychisches Kolorit. Selbst die der Natur entnommenen Bilder führt er uns mehr im Reflex seiner Dichterseele als im lebendigen Schein der Wirklichkeit vor Augen. Äußerst sparsam verwendet er den tonmalerischen Apparat. Nur vereinzelt läßt er uns einmal »Im Walde« lustigen Hörnerklang hören; oder er deutet hier in wogenden Sechzehnteln auf die Wellenbewegung des Meeres ( op 9, Nr. 6), oder in weitgriffigen Akkorden auf die majestätische Größe und unendliche Weite desselben hin ( op. 36, Nr. 1, op. 39, Nr. 2 und 3). Sehr sinnig und für seine Weise charakteristisch verdolmetscht uns die eigentümlich schaukelnde, zwischen Dur und Moll schwankende Begleitung in »Wasserfahrt« op. 48, Nr. 3), zugleich mit der Situation, die zwischen Lust und Leid schwebende Empfindung des Scheidenden. Mehr um Wiedergabe der Gesamt- als der Einzelstimmung ist es ihm zu tun, wie schon aus der fast durchgängigen Anwendung der Strophenform erhellt. Gleichwohl bekunden charakteristische Modifikationen bei Wiederkehr der verschiedenen Strophen und wirkungsreiche Steigerungen der harmonischen Beleuchtung, auch ausnahmsweise einmal die Einfügung eines Rezitativs, wie in »Frühlingsklage« op. 50, seinen feinen Sinn auch für detaillierten Ausdruck. Bezeichnend spricht er sich selbst seinem Freund, Dr. Erich Prieger in Bonn, gegenüber aus Über Dichtung und Musik. Drei Briefe von Robert Franz. Mitgeteilt von Erich Prieger. Sonderabdruck aus der Festschrift zum 10jähr. Bestehen der Literaturarchiv-Gesellschaft in Berlin, 1901.: »Die modernen Texte erheben, wie Sie richtig bemerken, einen größeren Anspruch, auch in den Einzelheiten erfaßt zu werden, wie die der Alten, bieten mithin Schwierigkeiten, an denen die Einheit der musikalischen Ausführung oft genug scheitert. Die Gefahr liegt in dem Nebeneinander der poetischen Momente, die sehr häufig unter sich kontrastieren. An dieser fatalen Klippe scheitert Schubert in vielen Fällen – auch Mendelssohn, von Löwe ganz zu schweigen. Alles kommt hier darauf an, das Einzelne einer Gesamtstimmung unterzuordnen, ohne es dabei zu vernachlässigen. Dieser Forderung glaube ich ziemlich nahe gekommen zu sein. – Liszts Broschüre spricht sich über meine Relationen zu den Dichtern eingehend aus und drängt diese Untersuchungen in den Worten zusammen: ›Besonders eigentümlich ist Franz die Fähigkeit des Zurückbiegens der dichterischen Pointe, die ihn stets vor einem Nebeneinander bewahrt.‹ Demnach komponiere ich den Text nicht, wie er sich in der Zeit entwickelt, sondern beleuchte ihn von jenem Kernpunkte aus. Ist dieser erst entdeckt und hat er seine musikalische Formel, die sich als Motiv darstellt, gefunden, dann macht sich alles Übrige wie von selbst«. »Wagners Lyrik«, heißt es an selber Stelle, »fußt nicht nur auf der Schubertschen und der meinigen, sondern ist mit letzterer in einzelnen Fällen, wo er von ihr gar nichts wissen konnte, wahlverwandt. Mein Sohn machte mich neulich auf eine Stelle in meinem op. 51 aufmerksam, die fast Note für Note dem Motiv der Walkyre gleicht. Das Lied im op. 51 wurde aber im Jahre 1844 geschrieben, wo an diese Schlachtenjungfrau noch gar nicht zu denken war ... Daß mein künstlerischer Stil eine ganz andere Richtung verfolgt, wie der seinige, kann mich nicht abhalten, dem seltenen Manne Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.«
Ersichtlich gefällt Franz sich mehr in der Wahl gedämpfter als glänzender Farben. Blendende Lichteffekte verschmäht er, und mehr an die Dämmerung der Nacht, an den sanftern Glanz des Mond- und Sternenhimmels als an die sonnige Helle des Tages gemahnen seine Gebilde. Dem Glutstrome der Leidenschaft, wie er uns bei Schumann oft überwältigend berührt, gestattet die fast weibliche Zartheit und Keuschheit seines Empfindens nur selten Durchbruch; ohnehin ist er der Ansicht, daß dieser ins Drama, nicht in die Lyrik gehöre. Als derlei Ausnahmserscheinungen nennen wir beispielsweise: »Er ist gekommen« op. 4, »Gewitternacht« op. 8, »Traumbild«, »Es treibt mich hin« op 34. Er deutet meist nur an mit leisem, geheimnisvollen Finger und überläßt uns selber die Ergänzung, wie der Dichter uns die ganze Fülle der Empfindung oft nur ahnen läßt.
Tritt bei dem ältesten unserer drei großen Liedermeister das rein Musikalische, bei seinem Nachfolger die poetische Intention in den Vordergrund, so erstrebt der jüngste derselben vielmehr ein vollkommenes Gleichmaß zwischen Poesie und Tonkunst, derart, daß nirgend ein Übergewicht der einen über die andere fühlbar und eben so wenig der musikalische Ausdruck als solcher dem des Wortes aufgeopfert werde, als dieses letztere zur Folie des ersteren herabsinke. Daher auch sein sorgfältiges Vermeiden von Textwiederholungen und eine epigrammatische Kürze der Fassung, die der Musik wenig Spielraum zur Entfaltung eigener Selbständigkeit gönnt. Man könnte bei Franz' Liedern von konzentrierter Musik sprechen, so tief und bedeutsam ist ihr Gehalt, so gedrängt ihre äußere Form. »Illustrationen des dichterischen Wortes«, wie er selbst voll Bescheidenheit dieselben nennt, sind sie es eigentlicher im bildlichen als im buchstäblichen Sinne. Eher als feinsinnige tondichterische Auslegungen denn als malerische Beigaben möchten sie uns erscheinen. Sagt aber schon Schumann in seiner Besprechung der ersten Franzschen Gesänge: »Er will mehr als wohlklingende oder übelklingende Musik, er will uns das Gedicht vielmehr in seiner leibhaftigen Tiefe wiedergeben«, so bezeichnet er damit den Gesichtspunkt, von dem aus der Komponist selbst seine Darbietungen betrachtet wissen will. Ihm sind sie einfach nur » Produkte der Poesie«; »ein erweitertes Leben« dem Worte durch den Ton in ihnen gewonnen zu haben, ist alles, darauf er Anspruch macht. »Zur vollen Blüte soll das Wort im Tone ausbrechen«, lautete einer seiner schönen Aussprüche bei einer unserer Begegnungen mit ihm, wie sie uns in der Erinnerung immer teuer bleiben werden.
Ist es nur dem Geweihten, dem Tondichter von Gottes Gnaden gegeben, jenen gewissen musikalischen Keim, die geheime Melodie, die in jedem rechten Gedicht – es ist hier selbstverständlich nur von dem lyrischen die Rede – schlummert, zu wecken und künstlerisch zu verkörpern, so dürfen wir Robert Franz unter diese Begnadeten zählen. Wie unwillkürlich nimmt die Poesie ihm Tongestalt an und weckt ihm eine Welt des Klanges, wenngleich seine Erzeugnisse keineswegs den Anschein tragen, als seien sie leichte Ausgeburten eines flüchtigen Schaffensprozesses. »Musterhaft«, sagt Liszt, »ist Franz in der wahrhaft keuschen, innig hegenden Aufnahme des dichterischen Wortes an das musikalische Herz.« »Wagner«, schreibt Franz an Prieger, »faßt das Verhältnis zwischen Poesie und Musik wie das zwischen Mann und Weib auf – ganz meine Ansicht!« In ähnlicher, weiblich selbstloser Weise hat sich wohl kein Komponist dem Dichter angeschmiegt als er. Eben in diesem seinem Verhältnis zu jenem hauptsächlich wollte Franz als eine neue, eigentümliche Erscheinung betrachtet sein. So völlig weiß er sich der Individualität desselben anzupassen, daß beispielsweise seine Goethelieder sich bestimmt und klar von den Heineschen und diese wiederum von denen Lenaus usw. unterscheiden; so daß eine jede dieser Gruppen im ganzen den Stempel ihres dichterischen Ursprungs trägt, während den Liedern im einzelnen zugleich ihr besonderer Charakter aufgeprägt bleibt. Ein feiner, divinatorischer Instinkt läßt ihn, wie Ambros in seiner interessanten Studie Robert Franz. Leipzig, Leuckart. 1872. nachweist, bei Volksliedern die verschiedensten, ihm selbst ganz unbekannten Nationaltypen richtig treffen; hatte er doch auch die altdeutschen Lieder, an welche die seinen so seltsam anklingen, erst in den siebziger Jahren im sogenannten Freylinghausenschen Gesangbuch kennen gelernt und die alten Weisen wieder erkannt, die er in seiner Kindheit vom Vater singen hörte und damals unbewußt in seine Seele aufnahm.
So ganz sich Franz aber unter den Einfluß des Dichtergeistes stellt, Spur für Spur diesem nachgehend, nie sehen wir ihn darum doch der angeborenen Eigenart Gewalt antun oder die geringste Untreue gegen sie verschulden. Im Gegenteil: sein eignes Angesicht blickt allenthalben hervor, auch wo es sich hinter dem Poeten zu verstecken meint. Franz bleibt immer er selbst, und wir danken es ihm. Gern sehen wir durch seine Dichteraugen und lassen uns seine Lieblinge von ihm deuten; verfährt er doch in der Auslese seiner poetischen Bundesgenossen so wählerisch, daß man seine Texte als eine Mustersammlung moderner deutscher Lyrik bezeichnen durfte. Trivialitäten, wie sie sich vielfach bei Schubert, Sonderbarkeiten, wie sie sich hier und dort selbst bei Schumann, dem feinen Ästhetiker, einschlichen, schlüpfen bei ihm nirgends mit unter. Im ganzen herrschen die schwermütigen Stoffe vor. Tas Still-Träumerische – wie »Aus meinen großen Schmerzen«, »Die Höh'n und Wälder« op. 5, »Treibt der Sommer seinen Rosen« op. 8, »Wasserfahrt« op. 9, »Ein Friedhof« op. 13, »Widmung« op. 14, »Herz, ich habe schwer an dir zu tragen« op. 27, »Es hat die Rose sich beklagt« op. 42, »Die Perle«, »Ich bin bis zum Tode betrübet« op. 48, »Tränen« op. 51, – klingt am ehesten mit seiner Natur zusammen. Weniger steht ihm die jubelnde Lust der Lenzverkündigung zu Gesicht, da seine Freude mehr nach innen als nach außen strahlt; doch geht auch ihm, wie jedem rechten Sänger, das Herz von Liebes- und Lenzesglück über. (»Ach wenn ich doch ein Immchen wär« op. 3, »Frage« op. 14, »Die Harrende« op. 35, »Norwegische Frühlingsnacht« op. 48, »O Herz in meiner Brust« op. 51.) Ihm gelingt auch köstlich Naives, wie »Ihr Auge« op. 1, »Liebchen ist da« op. 5, »Ich habe mir Rosmarin gepflanzt« op. 13, und das entzückende »Gleich und gleich« op. 22; ja selbst zu Humoristischem (»Nun hat mein Stecken gute Rast« op. 36) fühlt er sich vereinzelt gestimmt. Auch auf Erzählendes treffen wir ab und zu (»Romanze« op. 35, »Childe Harold« op. 38); freilich hält sein durchaus undramatisches Genie sich auch hier an die lyrischen Momente und geht aller szenischen Behandlung sorglich aus dem Wege.
Am liebsten sucht er sich bei Heine, Lenau, Eichendorff, Osterwald, Burns seine Texte. Ihren Namen begegnen wir vorwaltend, treffen aber auch auf Goethe, Geibel, Rückert, Waldau, Mörike, Roquette u. a. Heines Anregung danken wir z. B. das ganze opus 34, das Franz selbst zu den ihm liebsten seiner Werke zählte. Seinen Liedern – oft nur »ein Hauch«, wie Goethe will, mehr halbzuerratende Rätsel als klar ausgesprochene Empfindungen, oft wieder trüb resignierte, oder tieferregte, schmerzdurchzitterte Stimmungen – schmiegt sich die zarte Weise des Sängers unsäglich innig an. Auch Lenaus stille Melancholie, Eichendorffs träumerische Romantik berühren verwandte Saiten seines Gemüts. Es sei nur an die »Schilflieder« op. 2, »Bitte« op. 9, oder an »Stille Sicherheit« op. 10, »Ich wand're durch die stille Nacht« op. 35 erinnert! – Seiner Neigung zum Volkstümlichen hinwiederum kommen Burns und Osterwald entgegen; darum wählt er mit Vorliebe ihre Dichtungen, wenn er nicht gleich zum wirklichen oder bearbeiteten Volkslied ( op. 23 und 27, »Herzigs Schätzle« op. 50) greift, dessen schlichten, eigentümlich innerlichen Ton er wie kein anderer anzuschlagen weiß. Hat doch August Saran in seiner für das Verständnis unsres Meisters sehr wichtigen, auch im Vorliegenden mehrfach benutzten Broschüre: »Robert Franz und das deutsche Volks- und Kirchenlied« Leipzig, Leuckart, 1875. das Resultat seiner Untersuchungen geradezu dahin formuliert, daß »das Franzsche Lied im tiefsten Grunde nichts anderes sei, als das mit den Mitteln moderner Kunst bereicherte und idealisierte deutsche Volkslied«. In eingehender Darstellung weist er die ideelle und formelle Verwandtschaft der Franzschen Lyrik mit jenen ältesten Musikäußerungen unsres Volkes nach, aus denen auch Bachs und Händels Größe sich einst entfaltete, und begründet die schon oben von uns angedeuteten Einflüsse und Beziehungen des näheren und ausführlicheren.
Begreifen sich aus eben diesen von Franz zunächst rein instinktiv aufgenommenen Einflüssen die wesentlichsten Eigentümlichkeiten seines formalen Ausdrucks in der Architektonik der Melodie – prägnant konstruiertes Hauptmotiv mit streng thematisch daraus entwickeltem Nachsatz, Umkehrung, Verkürzung und sequenzenartige Verwendung beider Sätze etc. – so ergibt sich aus ihnen auch seine häufige Anwendung der Strophenform, im Gegensatz zu dem »durchkomponierten« Lied der Neuzeit. In überaus sinniger Weise versteht er den poetischen Grundgedanken des Ganzen auch musikalisch einheitlich zusammenzufassen, bei den Wiederholungen im Anschluß an den Text scheinbar geringfügige, in Wahrheit aber bedeutsame und überraschende Veränderungen anbringend. Um sich die poesievollen Wirkungen zu vergegenwärtigen, die Franz oft vermöge der einfachsten Modifikationen der Melodie oder Begleitung zu erzielen weiß, nehme man beispielsweise eins seiner schönsten Lieder, »Herbstsorge« op. 4, zur Hand, wo, nur vermittelst einer feinen Umgestaltung des Motivs und Einführung eines A statt As im Begleitungsakkord, inmitten der schwermutsvollen Klage plötzlich der helle Hoffnungsglanz eines neuen Frühlings aufblüht. Oder man vergleiche das volksliedartige »Die Sonn' ist hin« op. 35, wo in die trüb resignierte Stimmung, bei der aus einer geringen Veränderung des Themas unerwartet hervorgehenden Wendung nach dem lichten B-dur, der Aufblick zu dem reichen Gott, der Trost zu geben vermag, wie eine Friedensverkündigung hereintritt. Oder auch »Bei der Linde« op. 36, wo der träumerische Rückblick auf vergangenes Glück sich am Ende zum schmerzvollen Aufschrei betrogener Hoffnung gestaltet! – Eine eigentümliche Elastizität seiner Themen, unbeschadet der Prägnanz derselben, erleichtert es ihm zudem, sie den verschiedenen Nüancen der Stimmung dienstbar zu machen, und die Polyphonie seines Klaviersatzes mit ihrem zarten, sich verschlingenden Geäder erweist sich als besonders geeignet, auch die geheimsten Empfindungen zum Ausdruck zu bringen.
Gerade der polyphone Charakter der Franzschen Melodie berührt sich mit einer Grundeigentümlichkeit der älteren deutschen Melodik und stellt sie in erkennbaren Gegensatz zu der durch die klassische süddeutsche Schule, namentlich Mozart und Schubert, zur Herrschaft gelangten modern homophonen Gesangsweise. »Die Franzsche Melodie«, sagt Saran, »schreitet frei auf sich selbst stehend und doch streng gebunden an ihre harmonische Unterlage, ruhig und gemessen einher, allen äußeren Schmuck und Zierrat ebenso verschmähend, wie auf alle gesuchte Charakteristik, auf jegliches ›packende‹ rhythmische Kolorit verzichtend, nur durch ihre innere Wahrhaftigkeit und Tiefe, wie durch ihre einfach edle und schöngeformte Haltung ergreifend – ein treues Abbild deutscher Weiblichkeit.« – Nicht minder gemahnt des Meisters Behandlungsart der Harmonie an die ältere norddeutsche Tradition. Er bewegt sich, bei aller Freiheit im Einzelnen, durchschnittlich im Kreise der leitereigenen Intervalle und seine Ausweichungen erstrecken sich mit Vorliebe auf die nächsten Verwandtschaftsgrade. Bezeichnete er sich doch selbst seinem Biographen Procházka gegenüber Rud. Frhr. Procházka, Robert Franz. Leipzig, Reclam 1894. als einen »eingefleischten Diatoniker«. Äußerst charakteristisch ist ferner, namentlich bei volksmäßigen Texten, sein Zurückgehen auf die alten Kirchentonarten, mit denen er der modernen Musik eine nahezu vergessene Tonwelt wieder neu entdeckte und ihr insbesondere ein zur Darstellung gemischter Seelen- oder kontemplativer Naturstimmungen vorzüglich geeignetes Material zuführte. Wie Franz sich dasselbe für seine Lyrik fruchtbar zu machen versteht, lassen z. B. die schönen Volkslieder op. 23, oder »Zu Straßburg an der Schanz« op. 12, oder »Es klingt in der Luft« op. 13 klar ersehen.
Der musikalische Kern eines jeden Liedes ist einfach; um so größer die Feinheit und Sorgfalt der künstlerischen Ausführung. Sie zog dem Tonsetzer sogar den Tadel allzu komplizierten, ja raffinierten Schaffens zu, während man sich von anderer Seite bemühte, ihn als Naturalisten hinzustellen. Die Schlichtheit seiner Natur, wie die universelle Bildung seines Geistes haben ihn indessen, allen gegenteiligen Meinungen zum Trotz, glücklich vor beiden Extremen bewahrt; wiewohl bei der ihm eigenen philosophischen Richtung ein bestimmter Einfluß der Reflexion auf seine schöpferische Tätigkeit um so weniger ausgeschlossen bleiben konnte, als die Art der letzteren ihm ohnedies anhaltende Selbstvertiefung zur Aufgabe machte. Wer auch wollte dem heutigen Geschlecht die Reflexion nehmen? Genug, wenn sie sich nicht auf Kosten der Inspiration im Kunstwerk fühlbar macht! Für Franz' eigene Anschauung des Künstlerberufs ist übrigens der Ausspruch charakteristisch: »Dem Künstler soll die Musik nicht Beschäftigung, sondern Bedürfnis sein; er soll sie erleben, nicht machen«.
Nur in ihrer Totalität – es kann dies nicht oft genug wiederholt werden – in engster Beziehung zur dichterischen Grundlage, als ein unteilbares Ganzes mit dieser betrachtet, können Franz' Lieder allein gewürdigt werden. Das ist's, was ihnen neben ihrem wenig entgegenkommenden, das Konventionelle eher meidenden als suchenden Charakter, den Eingang im Publikum von jeher erschwerte. Man hatte sich seit langem gewöhnt, den Text als eine ziemlich überflüssige Zugabe zu betrachten. Allem voran stand das melodische Begehr. War dieses befriedigt, war das Ohr mit Wohlklang gesättigt, ja trug man gar eine melodische Erinnerung mit davon, so hatte man seinem musikalischen Bedürfnis genug getan. Anderes fordert Robert Franz. Seine Melodien sind nicht um ihrer selbst willen da – das melodische Interesse tritt in seinen Liedern eher hinter dem modulatorischen, harmonischen zurück –, nicht vom Worte losgelöst offenbaren sie ihre Wirkung; wir genießen sie nur als den verklärten Ausdruck des letzteren, und ohne dichterisches Verständnis bleibt uns ihre eigentlichste Schönheit unerschlossen.
Nimmt Franz demnach die Bedeutung eines Dichterinterpreten, nicht mehr und nicht weniger, in Anspruch, so geschieht dies keineswegs in der Meinung, Neues, nie Dagewesenes hiermit zu geben. Was seine musikalischen Ideale Händel und Bach vor nahezu zwei Jahrhunderten auf kirchlichem Gebiet vollbrachten, das trachtete er auf die weltliche Lyrik zu übertragen. Und ist es nicht in der Tat, als ob nicht nur in dem reinen, Wort und Ton ineinander webenden Geiste, dem ethischen Zug, sondern auch in der strengen Art der Faktur, der maßvollen Haltung, der Kunst der polyphonen Arbeit die ehrwürdigen Züge dieser seiner Vorbilder uns aus Franz' Schöpfungen entgegenblickten? Als ob dieselbe Keuschheit, die Frömmigkeit und Herzensandacht, die diese erfüllten, auch in den Werken des Jüngeren atmete? Freilich schöpften sie alle aus der gleichen Quelle. Der protestantische Choral, der sich als Lebensstrom von unversieglicher Frische durch Bachs und Händels Entwicklung zieht, ward eben auch inmitten einer von kirchlichen Elementen minder durchdrungenen Zeit die geheime Pulsader der Franzschen Lyrik. Solchergestalt aber an das Zeitlose, ewig Dauernde anknüpfend, hat diese selbst sich ihren unvergänglichen Wert, ihre klassische Bedeutung gewonnen.
Ein neuer, auf völlig anderen Grundlagen fußender Dichtergeist war freilich inzwischen, während die erhabenen Werke Bachs und Händels, mit denen die norddeutschprotestantische Musikrichtung ihren End- und Höhepunkt erreichte, für die Kunst ungenutzt lebendig begraben lagen, vornehmlich mit Beethoven in die Tonwelt eingezogen. Er war am energischsten unter seinen Nachfolgern zunächst von Schumann aufgenommen worden: oder hat nicht er die innigere Annäherung der Schwesterkünste Musik und Poesie zuerst vermittelt? Wie dann Neuere – vor allen Liszt – weiterschritten, die Konsequenzen seiner Prinzipien immer schärfer ziehend – so ist auch Robert Franz zu einem seiner Erben geworden. Sein ungleich weniger expansives Genie freilich wählte sich nur einen Teil von Schumanns Lyrik: das Stimmungslied, zu seiner Domäne. Was er hier erreicht, dessen wurde bereits gedacht. Es gab, so lange wir Franz besaßen, im Bereich des Liedes keinen größeren als ihn, den Liszt als »einen Fixstern der deutschen Lyrik« bezeichnet.
»Zum Vortrage dieser Lieder gehören Sänger, Dichter, Menschen«, sagt schon Schumann von ihnen. Die Forderung der Nachdichtung wird überhaupt bei den neueren Meistern: Liszt, Brahms, Wolf, Strauß zur unerläßlichen Bedingung, Franz schmeichelt Sängern und Spielern nie absichtsvoll durch die äußere Brillanz seiner Aufgaben – er ehrt sie vielmehr durch die Tiefe derselben.
Technische Schwierigkeiten gibt es dabei mehr für den Klavierspieler als den Sänger zu überwinden. Als Grundstock seiner Begleitungen dient ihm, zumal in seinen späteren Gesängen, in denen seine Eigenart sich immer präziser herausgestaltet, die vierstimmig gesetzte Melodie, Das Figurenwerk bildet nur das Kolorit, das Licht und Schatten in die Grundstimmung hineinträgt. Eben das Vokale seines Klaviersatzes ist ein entscheidendes Merkmal seiner Originalität. Übrigens findet sich auch eine reiche Anzahl kurzer Stimmungslieder, die selbst für mäßige, nur einigermaßen mit polyphoner Schreibart vertraute Spieler zugängig sind und sich besonders zum Selbstakkompagnieren eignen. Hinreichende Gelegenheit ist auch dem Begleiter – namentlich in den die Rundung eines jeden Liedes harmonisch vollendenden Vor-, Zwischen- und Nachspielen – geboten, poetischen Sinn und warmes Gefühl zum Ausdruck zu bringen.
Leider hat die Kritik, die erwähnten Koryphäen der Tonkunst und eine Anzahl Kenner und Freunde des Meisters ausgenommen Wir haben hier, nächst den obengedachten Arbeiten Liszts, Ambros', Galans, Osterwalds und Procházkas, namentlich noch diejenigen von Julius Schäffer (»Zwei Beurteiler von Robert Franz«) und Franz Hüffer (»Die Poesie in der Musik«; beide Leipzig, Leuckart) hervorzuheben. Als neuere Erscheinung sind Wilhelm Waldmanns »Gespräche aus zehn Jahren« (Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1894) zu nennen., diesem gegenüber, dafern sie überhaupt von ihm Notiz nahm, – denn lange versuchte sie ihn totzuschweigen – mit Vorliebe ihre negativen Rechte geübt. Sie machte ihm seine Beschränkung auf ein engeres Kunstgebiet zum Vorwurf und ließ dabei Chopins im Bereich der Klaviermusik nicht minder exklusive und dennoch laut anerkannte Erscheinung außer acht. Überdies haben Franzens schon erwähnte Bearbeitungen älterer Vokalwerke den Beweis erbracht, daß sein künstlerisches Können nicht, wie man meinte, an enge Grenzen gebunden war, sondern vielmehr zur Behandlung breiter umfangreicher Formen wohl ausreichte.
Einen bedeutenden Teil seines Lebens und seiner Kraft hat Franz dem Bestreben geopfert, die uns in unvollendeter Gestalt überkommenen Meisterschöpfungen Bachs und Handels dem Geiste jener wie den modernen Bedürfnissen entsprechend zu ergänzen. Bekanntlich befinden sich in den Originalpartituren der genannten Meister viele nicht völlig ausgeführte, sondern bloß skizzierte Teile, die auf die Mitwirkung des Akkompagnements, das die Orgel oder das Cembalo auszuführen hatten, berechnet waren. Da die Komponisten die Aufführung ihrer Werke persönlich von einem dieser Instrumente aus zu leiten pflegten, genügte ihnen ein bezifferter Baß, die kurze Andeutung eines musikalischen Stichwortes für den eigenen Gebrauch. Das Übrige konnten sie der Eingebung des Moments und ihrer sicheren Kunstfertigkeit überlassen. An dem tausendstimmigen Rieseninstrument der Orgel sitzend, mit ihrer eigenen künstlerischen Riesenperson – wir bedienen uns hier eines Ausdrucks des geistreichen A. W. Ambros – allenthalben mächtig eingreifend, beherrschten sie die ganze Musik als deren Seele. Ihr Akkompagnement, der Hauptträger des Ganzen, unterstützte den Sänger, ergänzte den mangelhaften Klangkörper des ihnen zu Gebote stehenden Orchesters, verlieh dem Werk erst die notwendige Abrundung und Vollendung. Die Sorge, einem späteren Geschlecht ihre Schöpfungen in fertiger Form zu bequemem Genusse zu hinterlassen, lag den alten Meistern fern. Nicht für den Druck bestimmten sie dieselben, sie blieben ihrer Außengestalt nach eben nur Skizzen, zu deren jedesmaliger Ausführung und Verlebendigung es ihrer eigenen nachschöpferischen Hand bedurfte: einer Improvisationskunst, die uns Gegenwärtigen eben so verloren gegangen ist, als die lebendige Tradition, die der Praxis zu Hilfe kommen könnte. Sind doch zumal die Bachschen Werke, unter hundertjährigem Staub verborgen, erst allmählich nach Wiederbelebung der »Matthäuspassion« durch Mendelssohn gewissermaßen neu entdeckt worden.
Daß die uns überlieferten Partituren Bachs und Handels, und zwar in erster Linie die Solonummern, demnach nicht so, wie sie vorliegen, zum Erklingen zu bringen sind, sondern, sollen sie lebendig wirken, eine Ergänzung fordern, ist eine allseitig zugestandene Tatsache. Nur über das Maß und die Methode dieser Ergänzungen gehen die Meinungen auseinander.
Hatten schon Mozart und Mendelssohn in vereinzelten Fällen mit nachhelfender Hand eingegriffen, so folgte Franz ihrem Beispiele. Durch eine Fülle kontrapunktistischen Wissens ausgezeichnet, so daß Bach und Händel sich seiner als eines Zeitgenossen schwerlich zu schämen gebraucht hätten, ohnedies im gleichen Boden mit jenen beiden wurzelnd und ihnen in innerer Wahlverwandtschaft verknüpft, schien er mehr als andere zu der gewählten Aufgabe berufen. Mit der polyphonen Schreibart vertraut wie wenige, fand er, nachdem er zuerst durch akkordische Ausführungen sein Ziel vergeblich zu erreichen gestrebt hatte, in ihr das Mittel, das ihn zum Zwecke führte. Dabei wählte er die Motive seines Tonsatzes nicht willkürlich, sondern er verstand sie sinnreich aus dem in den behandelten Stücken gebotenen Material (der Struktur des Basses, dem Figurenwerk der Kantilene) zu formen. Er selbst berichtet in interessanter Weise über die angestellten Versuche in dem »Offenen Brief an Eduard Hanslick über Bearbeitung älterer Tonwerke«, den er 1871 veröffentlichte, wie er schon 1863 wertvolle »Mitteilungen über Joh. Seb. Bachs Magnificat« herausgegeben hatte. Hier legt er die Grundsätze dar, die ihn bei seinen Ergänzungen leiteten, und weist u. a nach, wie die Rücksicht auf unser durch das moderne Orchester verfeinertes Ohr neben anderen praktischen Gründen ihn bestimmte, das eigentliche Akkompagnement, also den aus den Baßsignaturen gezogenen Tonsatz, statt der bisher gebräuchlichen Orgel oder dem alten Cembalo, vielmehr dem Orchester zu übertragen. Als Hauptmaterial verwendet er ein Bläserquartett von Klarinetten und Fagotten (in der Saba-Kantate statt Klarinetten Oboen), die, wie er sagt, »ein treffliches Mittel zur Ausführung des vierstimmigen Satzes abgeben, der sich in ungezwungener Natürlichkeit überall einlegen läßt«. Die Orgel, die bei den gegenwärtig mehr im Konzertsaal als in der Kirche stattfindenden Aufführungen älterer Vokalwerke selten zur Hand ist, fällt dabei entweder ganz weg, oder sie dient, wofern sie zur Verfügung steht, nur als »Verstärkungsmittel bei entscheidenden Stellen«. Seinen letzten Bearbeitungen hat Franz aber auch außer dem orchestralen Satz eine durchgehende Orgelstimme zu beliebigem Gebrauch beigegeben.
Gerade gegen seine, wie man sagte, »das Originalkolorit der Werke zerstörende« Orchesterübertragung richtete sich ebenso wie gegen seine als zu weitgehend angefochtene Aussetzung des Generalbasses eine Polemik, der er selbst in seinem »offenen Briefe« mehrfach zurechtweisend begegnete. Dieser letztere wurde aber erst recht zum Ausgangspunkt lebhafter Debatten betreffs der Bearbeitungsfrage. Als Gegner der Franzschen Prinzipien ließen sich in erster Linie Chrysander und Spitta, die Biographen Händels und Bachs, vernehmen. Zugunsten des Franzschen Standpunktes trat Julius Schäffer namentlich in den beiden Broschüren: »Chrysander in seinen Klavierauszügen zur deutschen Händel-Ausgabe« und »Seb. Bachs Kantate: Sie werden aus Saba alle kommen« etc. Beide Leipzig, Leuckart 1876 und 1877, woselbst auch vom gleichen Verfasser zuvor erschienen: »Rob. Franz in seinen Bearbeitungen älterer Vokalwerte« und »Entgegnung auf Spittas Artikel: »Über das Akkompagnement« usw. auf. Auch der hervorragende englische Theoretiker Ebenezer Prout sprach gelegentlich einer gründlichen Untersuchung der Bearbeitungsfrage » Additional accompaniments« in George Groves Dictionary of music and musicians. London. die Ansicht aus, daß Franz' Genius mehr noch als der Mozarts und Mendelssohns in dieser Richtung das Rechte getroffen habe. Neuerdings hat jedoch die sogenannte Renaissancebewegung, die den Charakter der alten Meisterwerke in möglichster historischer Treue gewahrt wissen und demnach die Ausführung des Akkompagnements der Sologesänge nur auf das Notwendigste beschränkt und dem Cembalo vorwiegend übertragen sehen will, die Franzschen Bearbeitungen vielfach verdrängt, und Chrysanders Restaurierung Händelscher Oratorien hat diesen den Rang abgelaufen.
Werfen wir einen Blick auf die von Franz bearbeiteten Werke, so gewahren wir, außer einem Stabat mater und Magnificat der italienischen Meister Astorga und Durante, von Bach zehn Kantaten im Klavierauszug, acht Kantaten in Partitur und Klavierauszug, desgleichen das Magnificat, die Matthäuspassion, die Trauernde, das Weihnachtsoratorium, dazu eine Anzahl Arien, Duette, geistliche Lieder, zwei Suiten, eine Sonate und eine Neuausgabe des Wohltemperierten Klaviers. Sodann von Händel zwölf Opernarien für Sopran, zwölf für Alt und zwölf Duette aus verschiedenen Opern und den Kammerduetten, das Jubilate, das Oratorium L'Allegro, il Pensieroso ed il Moderato und den Messias. Hierzu kommen noch die »Hebräische Melodie« für Klavier mit oder ohne begleitende Instrumente, zwei Quintette von Mozart, zwei Quartette und ein Rondo von Schubert, eine Sonate von Tartini für Klavier, sowie sechs Choräle für gemischten Chor, sechs altdeutsche Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte und zwölf Choräle für Männerstimmen zum liturgischen Gebrauch. Auch eine Auswahl Grimmerscher Balladen und Romanzen wurde von ihm herausgegeben.
Dies alles ward unter den Hemmungen eines Nervenleidens vollbracht, das sich mit den Jahren immer grausamer fühlbar machte und im Herbst 1879 eine Lähmung mehrerer Finger der rechten Hand herbeiführte, nachdem es ihn schon zuvor des dem Musiker unentbehrlichsten Sinnes, des Gehörs, gänzlich beraubt hatte. Seine anhaltende Beschäftigung mit Bach, sein inniges Hineinleben in dessen kompliziertes, vielstimmiges Tongewebe beförderte ohne Zweifel mehr noch als das eigene freie Schaffen die Entwicklung des Übels, So fand sich denn Franz gezwungen, seiner praktischen Tätigkeit zu entsagen und die Ämter niederzulegen, mit denen seine Vaterstadt, nachdem ihr die Erkenntnis seiner künstlerischen Bedeutung allmählich aufgegangen, ihn betraut hatte. – Er war nach und nach zum Organisten an der Ulrichskirche, zum Dirigenten der Singakademie und der »Berg- und Museumskonzerte« und später zum Universitäts-Musikdirektor ernannt worden, wie die philosophische Fakultät, die ihm einen Lehrstuhl für Musik übertrug, ihn in Anerkennung seiner Verdienste um Bach und Händel auch durch Verleihung des Doktortitels auszeichnete.
Konnte es ein herberes Geschick geben als das seine, das den reichen Geist in der Fülle der Manneskraft zwar nicht völlig, wie seine letzten, nach langem Stillschweigen erklungenen herrlichen Lieder op. 48, 50, 51 und 52 bezeugten, aber doch vielfältig zur Tatlosigkeit verdammte und ihm Feierabend gebot, noch bevor die Stunde der Ruhe für ihn gekommen? Selbst auf sein häusliches Glück drohten die Schatten dieses Leides zu fallen. In das Haus, das er sich im Jahre 1848 durch seine Verheiratung mit Marie Hinrichs begründete und das seither Kunstfreunden und Gefährten von fern und nah freundlich geöffnet war, begann der finstere Gast der Sorge einzukehren, als er mit der Ausübung seiner Tätigkeit zugleich auf seine gesicherte Lebensstellung verzichten mußte.
Er vereinsamte mehr und mehr. Seinen großen künstlerischen Zeitgenossen sich anzuschließen hatte ihm seine Eigenart, sein Einspinnen in die ihm ureigene Welt verwehrt. Die Ziele Wagners und Liszts deuchten ihm irrige, so sehr er den Weimarer Meister, einen seiner treuesten und hilfreichsten Förderer, als Mensch verehrte. Das ihm »schwülstig« erscheinende Schaffen »des heiligen Johannes«, wie er Brahms gern nannte, war und blieb ihm unsympathisch. Isoliert stand er im Musiktreiben seiner Tage. »Die Historiker, die Mendelssohnianer, die Schumannianer, die Neudeutschen – alle saßen sie mir auf dem Dache«, heißt es in einem seiner Briefe an Freund Osterwald.
Eine überaus zart empfindende Musikseele, ein edler, durch und durch lauterer Charakter, war er doch von Ecken und Schroffheiten, in späteren Jahren auch von Bitterkeit nicht frei. Er konnte sarkastisch, konnte sehr derb sein und die Dinge ohne Umschweif beim Namen nennen. Dadurch minderte sich freilich die Zahl seiner Freunde eher, als daß sie sich mehrte. Auf eine diesbezügliche Klage entgegnete ihm Freiherr Senfft von Pilsach einmal freimütig: »Nur etwas Wohlwollen und Menschenfreundlichkeit und statt Hohn ein wenig Erkenntlichkeit, so wären Ihnen die Herzen der Menschen zugeflogen und treu verbunden geblieben«. Worauf die Erwiderung lautete: »Meine ganze Existenz ist ja nur mit Fußtritten gepolstert, die man mir direkt und indirekt, ohne daß ich meist zu reagieren imstande war, unausgesetzt gab«.
Er schrieb dies demselben tatkräftigen Freund, der sich nicht allein damit begnügte, als ausgezeichneter Sänger für die Franzschen Lieder im Konzertsaal und Salon erfolgreiche Propaganda zu machen, sondern auch den Gedanken ins Werk setzte, durch Sammlung eines Ehrenfonds den Lebensabend des großen Liedermeisters vor Not und Sorge zu sichern. Dank der eifrigen Mithilfe Liszts und Baron von Keudells, des nachmaligen deutschen Botschafters in Rom, sowie Otto Dresels in Amerika, gelang es den vereinten Bemühungen den edlen Zweck zu erreichen, sodaß Franz an seinem 58. Geburtstag eine Summe von 30 000 Talern eingehändigt werden konnte. In das Zustandekommen dieses erfreulichen Ergebnisses, wie in das schöne Freundschaftsverhältnis, das Franz und Arnold von Senfft verband, gewährt der von Professor Wolfgang Golther herausgegebene Briefwechsel beider Berlin, Alexander Dunker, 1907. fesselnden Einblick.
Den letzten Lebensjahren des Tondichters fehlte es nicht an weiteren Zeichen der Anerkennung. Als seine Vaterstadt Halle am 23. Februar 1885 das 200jährige Geburtsfest ihres großen Sohnes Händel feierlich beging, ernannte sie Franz, um der »unvergänglichen Verdienste« willen, »welche er sich in reicher schöpferischer Tätigkeit, wie in liebevoller Förderung des Verständnisses unserer klassischen Meister um die deutsche Musik erworben hat«, zu ihrem Ehrenbürger.
Sein siebzigster Geburtstag zeigte ihm im selben Jahre, in wie ungezählten Herzen seine Kunst Wurzel geschlagen hatte. Auch der deutsche Kaiser schmückte seine Brust, die schon seit einigen Jahren der Maximiliansorden des Königs von Bayern zierte, mit seinem Kronenorden.
Seine letzte Originalarbeit: einen Trinkspruch für Männerchor, veröffentlichte Franz im Januar 1887, seine letzte Bearbeitung: eine Neuausgabe von Bachs »Wohltemperiertem Klavier«, an der sich Dresel beteiligte, 1890. Dann ward es still in ihm und um ihn. Seine nächsten Freunde starben ihm hinweg. Am 5. Mai 1891 wurde nach langer Leidenszeit auch die Gattin von seiner Seite abberufen. Seine zwei Kinder, eine Tochter und ein Sohn, hatten sich längst den eigenen Herd gebaut. Einsam ging er, der von je ein Freund der Natur gewesen war, nun seinen täglichen Weg das Saaletal entlang, bis er am 24. Oktober 1892 nach kurzem Krankenlager von hinnen ging. Halloren trugen ihn unter allgemeiner Teilnahme am 27. Oktober zu Grabe, wo er neben seiner Gattin ruht.
Seine Geburtsstadt blieb ihm die gebührenden Ehren nicht schuldig. Mitten im Grünen, an der alten Promenade, hat sie ihm ein am 28. Juni 1903 enthülltes Denkmal errichtet, das die Züge des edlen Sängers auf die Nachwelt bringt. Mit ihm zugleich aber auch die Erinnerung an eins seiner schönsten Lieder. Auf dem Notenblatt, das die Muse des Gesangs in der Hand hält, lesen wir:
Es hat die Rose sich beklagt,
Daß gar zu schnell der Duft vergehe,
Den ihr der Lenz gegeben habe –
Da hab' ich ihr zum Trost gesagt,
Daß er durch meine Lieder wehe
Und dort ein ew'ges Leben habe.