
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
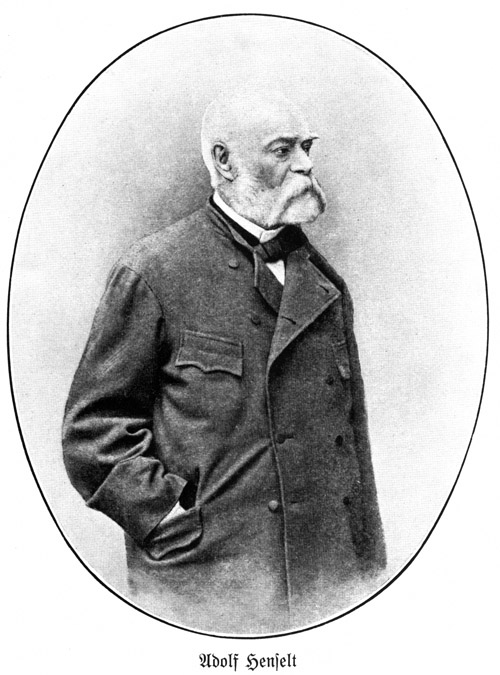
Wenn Carl Maria von Weber behauptet: »Das Genie ist universell; wer es hat, kann alles leisten«, so lehrt die Erfahrung dem entgegen, daß es nur gewissen auserwählten Genien gegeben ist, auf jedem von ihnen betretenen Gebiete Großes zu leisten, während andere sich von Natur darauf hingewiesen sehen, den Kreis ihres Schaffens auf engere Grenzen zu beschränken. Universelle Begabungen, wie sie die Natur in Leonardo da Vinci, in Michel Angelo und Rafael, in Goethe, Mozart und Beethoven gebildet, zählen nicht nach Hunderten, sondern nach Einzelnen nur; sie erscheinen zu den Höhezeiten künstlerischer Blüte, den Ausdruck und Gehalt ganzer Jahrhunderte in idealer Weise in ihren Leistungen zusammenfassend. Unsere Gegenwart ist der Bildung und Betätigung solch' universeller Erscheinungen nicht eben günstig. Zu weithin haben Kunst und Wissenschaft im Laufe der Zeit ihr Bereich ausgebreitet, als daß dies nicht eine Teilung der Kraft und Arbeit von Seiten derer bedingte, die sich ihrem Dienst widmen. Ein einziger Blick auf das in reichster Blüte stehende, unendlich vielfältig bebaute Feld der Naturforschung beweist dies zur Genüge, und auch auf künstlerischem Gebiet können wir Ähnliches beobachten. Wo wäre heute der Meister, der, gleich den Wundergestalten des cinque cento, Bildhauer, Maler und Architekt in Einem vereinte, der neben dem Riesenbau eines Sankt Peter die Deckengemälde einer Sixtina, die Marmorgebilde des Moses, des Medicäer-Denkmals der Nachwelt als sein unsterbliches Vermächtnis zu hinterlassen vermöchte? Und wer auch wagte es heutzutage die Beherrschung aller drei Schwesterkünste vom bildenden Künstler zu fordern, wo allein schon die Malerei sich in eine Reihe verschiedener Zweige sondert, deren einen nur sich der Künstler in der Regel als Aufgabe zu erwählen pflegt?
Gleicherweise verhält es sich auf dem Gebiet der redenden Künste. Wer gewohnt ist dem Einzelleben der Empfindung nachzugehen, eine Stimmung zum vollen Ausklingen zu bringen, dem wird es selten gelingen, uns im Drama ein raschbewegtes Bild des Lebens vor Augen zu führen, wie es die Bühne fordert. In der Wort- wie in der Tonpoesie gehen Lyriker und Dramatiker nun einmal selten zusammen: denn was der eine als Gebot erkennt, muß der andere als Verbot meiden. Unsere besseren lyrischen Dichter haben sich demgemäß auch nur ausnahmsweise durch nennenswerte dramatische Schöpfungen hervorgetan, wie die Meistersänger des deutschen Liedes: Franz Schubert und Robert Schumann, durch dieses, nicht durch ihre Opern, sich den immergrünen Lorbeer gewannen. Hinwiederum ist Richard Wagner ein spezifisch dramatisches Genie; denn was er uns an lyrischen Gesangstücken gegeben, fällt seinen epochemachenden Bühnentaten gegenüber nicht ins Gewicht.
Einige unter unsern neueren Tonsetzern, die von Haus aus innerhalb einer engen lyrischen Sphäre ihren Beruf erkannten, zogen es darum vor, dauernd in derselben zu verharren, und verzichteten freiwillig darauf, ihre Tätigkeit auf weitere Gebiete auszudehnen. Nur in Liedern hat der eine, ausschließlich am Klavier haben andere zu uns geredet. Aber ob auch das Genre, das sie sich erwählten, klein war, sie selbst wuchsen darin zu einer Größe empor, die – da in der Kunst nicht der äußere Umfang, sondern die innere Bedeutung eines Werkes über dessen Wert entscheidet – ihnen einen Platz neben den besten ihrer Kunstgenossen erwarb. Es waren und sind ihrer begreiflicherweise nicht viele. Selbsterkenntnis und Selbstbeschränkung, an und für sich schon schwer zu übende Tugenden, reifen sicherlich am schwersten beim Künstler, den ein reges Phantasieleben beherrscht. Unter diesen Wenigen aber steht neben Robert Franz und Frédéric Chopin der Name Adolf Henselt oben an. Wie jene war auch er ein echtes Kind seiner subjektiv gearteten Zeit, eine Spezialität für sich; ja wir erkennen in ihm eine der eigenartigsten Erscheinungen, die das neunzehnte Jahrhundert überhaupt hervorgebracht hat.
Ein Zeitgenosse Chopins und Liszts, wie diese ein unvergleichlicher Bemeisterer seines Instruments und Held des jungen romantischen Virtuosentums; ein gefeierter Komponist, dessen Weg man mit Blumen und Gold freigebig zu bestreuen bereit war, hat er gleichwohl kurz nach Beginn seines Ruhmeslaufs der Welt, die ihn feierte, den Rücken gekehrt und seine Gaben mehr und mehr von ihr zurückgezogen. Was sie bietet: Ruhm und Gold – mag es andern noch so begehrenswert dünken – schätzte er gering. Ihm gefiel es, die glänzend begonnene Laufbahn eines schaffenden und reproduzierenden Meisters gegen die dunklere und entsagungsvollere eines lehrenden und erziehenden zu vertauschen. Nur als solcher noch ließ er der Kunst sein Wirken zugute kommen; denn auch die Bearbeitungen fremder Werke, auf die er innerhalb der letzten Jahrzehnte seines Lebens seine Herausgaben fast ausschließlich beschränkte, dienen zum großen Teil pädagogischen Zwecken. Im übrigen verstummte er allgemach so völlig für die Öffentlichkeit, daß die Mitwelt die Fühlung mit ihm verlor. Wenige Auserwählte nur durften sich rühmen, Zeugen der pianistischen Meisterschaft Adolf Henselts zu sein, an deren immer höherer Vollendung er, ob auch seit Dezennien jeglicher äußeren Anregung entbehrend, allein sich selbst zur Genugtuung und Lust, sein Lebenlang unablässig arbeitete. Die russische Nation, in deren Mitte er mehr denn fünfzig Jahre lebte, wußte ihn uns abzugewinnen. Nur als Gast kehrte er alljährlich in sein Vaterland zurück, ohne auch dann aus der Stille und Zurückgezogenheit herauszutreten, die ihm Bedürfnis geworden war.
Laut Angaben, die wir von ihm und seiner Gattin empfingen (ein ziemlich mühseliges Unternehmen bei der Abneigung des Meisters gegen die Öffentlichkeit!) ward Adolf Henselt am 12. Mai 1814 zu Schwabach bei Nürnberg als Sohn protestantischer Eltern geboren. Sein Vater, Ph. E. Henselt, ein aus Sachsen eingewanderter Kattunfabrikant, war zurzeit an der Stirnerschen Manufaktur daselbst beteiligt; seine Mutter, Caroline geb. Geigenmüller, hatte in der Gegend von Weimar ihre Heimat. In seinem dritten Lebensjahr siedelten die Eltern mit ihm und seinen fünf Geschwistern nach München über. Dort starb die Mutter bald darauf, während der Vater durch Pachtung einer Fabrik sich und den Seinen ein ziemlich kümmerliches Brot erwarb. Der innere Beruf zur Musik tat sich schon in aller Frühe mit Entschiedenheit bei dem Knaben kund: eine Ausnahmserscheinung in der Familie, in der keinerlei musikalische Begabung heimisch war. Von seinem sechsten Jahre an unterwies man ihn bereits auf der Geige, während seine Schwester Klavierstunden empfing. Als er aber einst, dem Einstudieren eines Weberschen Klavierstücks beiwohnend, über dessen Schwierigkeiten seine Schwester nicht hinwegzukommen vermochte, zuversichtlich ausrief: »Ich werde es spielen!« und auch, obwohl nicht einmal mit den Elementen des Pianofortespiels vertraut, die Aufgabe wirklich löste, begann man alsbald auch mit ihm den Klavierunterricht. Es ist bezeichnend für Henselts künstlerische Richtung, daß gerade Webers Genius, dem er sich mit so viel Liebe und innerer Verwandtschaft zuneigte, den seinen zuerst erweckte und in seine eigentlichen Bahnen lenkte.
Das musikalische Talent des Knaben gewann sich bald Freunde und eröffnete ihm den Zugang zu mehreren Familien der Stadt. Ein nachmals in Hamburg lebender Musiklehrer Konrad Dinkler, ein Neffe des Etüden-Komponisten Alois Schmitt, nahm sich seiner an und ließ ihn, solange er sich in München aufhielt, viel bei sich spielen. Von unberechenbarem Vorteil für seine weitere musikalische Entwickelung aber wurde es, daß sich ihm, nachdem er eben sein dreizehntes Jahr erreicht hatte, die Gunst einer edelsinnigen und einflußreichen Kunstkennerin, Frau Geheimrätin von Fladt in München, zuwandte. In ihr fand er nicht allein eine verständnisvolle Führerin in tonkünstlerischer Beziehung, sondern zugleich eine zweite Mutter, die den völlig Unbemittelten in ihr Haus und an ihr Herz nahm. Den größten Teil des Tages brachte er, ihren Unterricht genießend, bei ihr zu. Selbst eine tüchtige Klavierspielerin und Schülerin des Abt Vogler – bezüglich dessen sich Henselt einen Enkel Voglers nannte –, leitete sie seine Klavier- und Kompositionsstudien fortan in eigener Person und mit soviel Sorgfalt und Erfolg, daß ihr Zögling sich schon nach Verlauf von nur zwei Jahren vor die Öffentlichkeit wagen durfte. Am 12. März 1829 gab der vierzehnjährige Adolf Henselt in einem Saale des Odeon in München sein erstes Konzert. Er spielte das einleitende Allegro aus Mozarts C-dur-Konzert, eine freie Phantasie mit Variationen über Themen aus dem »Freischütz« und schloß mit einem Rondo von Kalkbrenner. Das erste Debüt, darin er auch seinem Liebling Weber die erste öffentliche Huldigung darbrachte, gelang; denn Publikum und Kritik ließen sich beifällig vernehmen. In einer Münchener Korrespondenz der Leipziger »Allgemeinen musikalischen Zeitung« vom selben Jahre (Jahrgang 31, Nr. 26) heißt es: »Ermunterung, Unterstützung und fortgesetzter Fleiß unter bisheriger und weiterer Anführung werden ihn bald dem Ziele näherbringen.« Wie er, dank teilnehmenden Freunden und seiner eigenen energischen Ausdauer, die ausgesprochenen Erwartungen tatsächlich erfüllte, beweist, daß ihm der kunstliebende König Ludwig I. von Bayern, zufolge Frau von Fladts Fürsprache, seine Gnade zuwandte und es ihm ermöglichte, nach dem Rat seiner Lehrerin sechs Monate lang in Weimar Hummels Unterricht zu genießen.
Den eigentlichen Bedürfnissen seiner Natur freilich tat der alternde, ganz in der Vergangenheit wurzelnde Virtuos, bei aller Anerkennung seiner Verdienste, nicht Genüge. Hatte Carl Maria von Weber bereits im April 1814 in einem Brief an Rochlitz seine Meinung über Hummel, der dazumal noch allgemein als der erste aller Klavieristen galt, dahin ausgesprochen, daß »das eigentliche tiefere Studium der Natur des Instrumentes ihm ganz fremd geblieben sei«, und sein Spiel als die »mechanische Vollendung in der flacheren Spielart« bezeichnet, so darf es nicht Wunder nehmen, wenn dieser um fast zwei Jahrzehnte später noch weiter hinter dem Ideal zurückblieb, dem Adolf Henselts jugendlich feurige Seele nachstrebte. Er ward nur der Ausgangspunkt für jenen, der mit Chopin und Liszt im Bunde die Hummel-Fieldsche Periode zu Grabe trug und das romantische Virtuosentum mit seinen subjektiveren, poetisierenden Intentionen, seiner souveränen Herrschaft über das Material in erster Linie repräsentierte. Die solide klassische Grundlage blieb die einzige Mitgabe, auf die sich Hummel bei seinem genialsten Jünger beschränkte. Im übrigen ward dieser gar bald sein eigener Meister; denn seine eigentümliche Klaviertechnik verdankte er – von gewissen Thalbergschen Einflüssen abgesehen – dem selbstgegebenen Zeugnis zufolge, nur sich allein.
Noch bevor Henselt im Hochsommer 1832 Weimar verließ, präsentierte Hummel seinen Schüler in einem dortigen Hofkonzert, wo er das As-dur-Konzert seines Lehrers nach dem Urteil der Kritik »mit höchster Nettigkeit und großem Ausdruck vortrug«. Bald darauf kehrte er nach München zurück und betätigte bei seinem öffentlichen Auftreten am 29. November im Odeonsaale vor den Musikkundigen nicht allein seine mittlerweile gereiste Virtuosität: er pflückte daselbst auch seine ersten Lorbeeren als Komponist. Ein von ihm in Musik gesetztes »Gedicht an Hellas im vierten Jahre seiner Befreiung« von seinem hohen Gönner König Ludwig, das von einem Sänger-Quartett vorgetragen ward, sowie ein von ihm selbst gespieltes, samt allen übrigen Erstlingswerken später aber vernichtetes Klavierkonzert in F-moll nannten zum erstenmal seinen Namen als Tonschöpfer. Dem »ungewöhnlich ernsten« Charakter des letzteren widerfuhr nun zwar, ebenso wie seinen pianistischen Leistungen, von seiten der Presse alle Anerkennung; doch unterdrückt der Berichterstatter des Leipziger Musikblattes nicht den wohlgemeinten Rat, daß er »noch tiefer in das Wesen des Satzes eingehen und sich an größere Muster halten solle, um seinen Werken mehr Kraft und Ordnung einzuhauchen.«
Henselt selber war indessen weit entfernt, sich mit den bisherigen Resultaten zufrieden zu geben; zum Freund einer künstlerischen Bequemlichkeitstheorie hatte ihn die Natur nicht erschaffen. Ein in ihm nie rastender Vollendungsdrang trieb ihn unablässig aufwärts, zeigte ihm nur immer neue höhere Ziele. Er trieb ihn nach kurzem Aufenthalt in München auch wieder von dannen, um in Wien fortgesetzten Studien obzuliegen. Wider Wissen und Willen seiner Gönnerin Frau von Fladt verließ er seine Vaterstadt, nunmehr dem eigenen Genius folgend und die Richtung, die sie ihm gegeben, verwerfend. Erst sechzehn Jahre später sah er München wieder, nach dem Tode seiner Lehrerin, die, so dankbar er ihrer Verdienste um ihn eingedenk blieb, es ihm nicht vergeben konnte, sich von ihr emanzipiert zu haben.
Zwei Jahre lang ging er in Wien bei Simon Sechter, dem berühmten Theoretiker und Kontrapunktisten, in die Lehre, sich in der Komposition zu vervollkommnen, während er sich gleichzeitig den angestrengtesten pianistischen Übungen hingab. Durch das Beispiel des in Wien konzertierenden Thalberg begeistert, setzte er all' seine Kräfte ein zum Erreichen einer ähnlichen Meisterschaft und übte manchen Tag zwölf bis sechzehn Stunden lang. Es war ihm – da ihm gesangliche Schönheit und Ausdruckswahrheit mehr als blendende Bravour galt – weniger um Brillanz als um Größe und Fülle des Tons, weniger um Sprung- und Lauffertigkeit als um Elastizität und Spannungsfähigkeit der Hand zu tun, vermöge deren er jene eigentümlich weiten Akkordlagen und vollstimmigen Harmonien im gebundenen Spiel ausführte, die er in seinen Kompositionen vorschreibt und die ein mit Henselts Technik nicht vertrauter Spieler nicht ohne vorbereitende Dehnungsstudien wiederzugeben vermag. Mußte er selber doch, um seiner verhältnismäßig klein gebauten Hand jene außergewöhnliche Dehnbarkeit abzuzwingen, seine Finger jahrelang eigens zu diesem Behuf dressieren und hielt er doch, wohl eben weil diese Spannungen das natürliche Maß überschritten, an der Gewohnheit fest, sich vor seinem jedesmaligen Auftreten viele Stunden lang bis zum unmittelbaren Beginn seines Vortrages vorzubereiten. Je länger er spielte, um so sicherer fügten sich seine Finger seinen Anforderungen, um so mehr genügte er sich selbst. Um seine Nerven möglichst zu schonen, bediente er sich bei seinen Übungen meist einer stummen Klaviatur, die er auch auf Reisen beständig mit sich führte. Mit eiserner Beharrlichkeit und einer Geduld ohne gleichen nahm er auf ihr all' jene trockenen Fingerkasteiungen vor, denen seine Hand ihre staunenswerte Kraft und Gleichmäßigkeit der Durchbildung dankte. Er übte immer, gleichviel ob am Tag oder in der Nacht, ob in Gesellschaft oder allein; auf dem Bett liegend, ja sogar zwischen jeder im Konzert von ihm vorgetragenen Nummer hatte er sein saitenloses Instrument vor sich.
»Ich kann nicht vergessen«, erzählt W. von Lenz Die großen Pianisten-Virtuosen der Gegenwart, N. Berliner Musikzeitung, 1871, Nr. 32 u. ff., »wie ich wenige Minuten nach einem der glänzendsten Triumphe des Künstlers, in einem Konzerte des Adels, ihn mit dem Grafen Wielhorski im Künstlerzimmer aufsuchte und wir ihn, inmitten der Fluten einer Konzertbewegung, mit seinem stummen Klavier bereits still beschäftigt fanden. Es war etwas vom Hoffmannschen Kreisler darin, es war das Glaubensbekenntnis des Künstlers, wie er eben nur Künstler sein, nur sich in seiner Sache angehören wolle: wie er sich in seinen Grenzen wisse. Bedauert hab' ich es oft für ihn, es aber immer als eine seltene Überzeugungstreue, als eine Übertreibung des Pflichtgefühls gegen die Aufgaben der Kunst verstanden, als eine Ausdauer und Charakterstärke, wie sie nur der germanischen Natur eigen ist. Nicht von allen wurde der Künstler so verstanden, und es war doch nur sein Streben, den immer wieder fliehenden Horizont rein ideal ersehnter Vollendungen so zu sagen mit Händen zu greifen!«
Als fertiger Meister, die Mappe von Manuskripten gefüllt, schied Henselt von Wien, ohne zu einem eignen Konzert daselbst gekommen zu sein. Nur in fremden Akademien hatte er einige Male mitgewirkt. So hatte man ihn 1836 in einem der concerts spirituels Beethovens C-moll-Konzert, in einer Wohltätigkeitsakademie das Es-dur von Moscheles spielen, sich auch bei den Konzerten des Violinisten Jansa und des Cellisten Merk je mit einem Duo beteiligen hören. Dies Wenige war alles, was Wien an öffentlichen Gaben von ihm empfing. Freigebig im Konzertieren war Henselt eben zu keiner Zeit, und die Gesamtsumme seiner Konzerttaten übersteigt wohl kaum die in einem Virtuosenleben gewiß beispiellos geringe Zahl eines Viertelhunderts.
Im Sommer 1836 ging er, Gesundheitsrücksichten halber, von Wien zuvörderst nach Karlsbad, wo er mit Chopin zusammentraf; spielte später in Pillnitz vor dem sächsischen Hofe und ließ sich, nachdem er auf einem Streifzuge durch Deutschland auch Berlin berührt, ohne sich jedoch zum Konzertieren daselbst entschließen zu können, mehrere Monate lang in Weimar, das er um Hummels willen besuchte, fesseln. In der Gattin des dortigen Geheimrat Vogel, des Leibarztes von Carl August und Freundes von Goethe, lernte er seine spätere Gemahlin, Rosalie geb. Manger, kennen, mit der er sich ein Jahr darauf, am 24. Oktober 1837, zu Salzbrunn in Schlesien verheiratete. Ihr ist sein berühmtes » Poème d'amour« gewidmet, das ihm, wo es immer gehört oder gespielt wurde, die Sympathien aller im Sturm eroberte. »Darauf können Sie reisen!« hatte schon Hummel gesagt, als er es ihm zuerst vorspielte, – ein Wort, das sich in der Folge glänzend bewahrheitet hat.
Mit Staunen erkannte der alte Lehrer die nun gereifte Größe dessen, der, noch vor wenigen Jahren zu seinen Füßen sitzend, sich kühn auf seine Schultern emporgeschwungen hatte und neuen, selbständigen Bahnen folgte, »Bei mir können Sie nichts mehr lernen«, bekannte er ihm ehrlich und gestand ihm damit sein freies Meisterrecht zu.
Die Bestätigung dessen ließ nicht lange auf sich warten. Ein lauter Entzückungsruf über seine Leistungen am Klavier drang, sobald man den Künstler öffentlich und bei Hofe bewundert hatte, von Weimar nach Leipzig herüber, auch in der alten Musikstadt höchste Erwartungen erregend. »In den letzten Monaten«, schreibt man der Schumannschen »Neuen Zeitschrift für Musik« am 7. Dezember 1836, »war das Losungswort unserer musikalischen Welt, zumal der Klavierspielenden, der Name Henselt. Dieser gewaltige Klavierheros scheint uns in der Tat alle anderen, welche wir bisher gehört, zu verdunkeln. Er hat sich im Technischen zu schwindelnder Höhe emporgeschwungen. Wenn sich dieser reichbegabte Künstler künftig noch ebenso herrlich in umfassenderen musikalischen Schöpfungen bewährt, wie er es bereits ganz unverkennbar in den vorhandenen, leider noch ungedruckten getan hat, so hat die deutsche Kunst in ihm einen Jünger gewonnen, der ihr neuen glänzenden Ruhm im Fache der Klaviermusik bereiten wird.«
So proklamiert man mit einem Mal als Meister unter seinesgleichen den Namen dessen, von dem die Welt bisher wenig oder nichts erfahren, dessen kaum die Berichte der Fachzeitungen von München, Weimar, Wien her vorübergehend und ohne auf Außergewöhnliches hinzudeuten, gedacht hatten. Denn auch aus Jena und Dresden, wo Henselt inzwischen erschienen, klang nun begeisterte Kunde von der »an Zauberei grenzenden Besiegung ungeheurer Schwierigkeiten«, dem »seelenvollen Vortrag« und der »Tiefe und Originalität« der Schöpfungen des Künstlers, der urplötzlich aufgegangen war als leuchtendes Gestirn am deutschen Kunsthorizonte. Nur in Berlin verhielt man sich kühler und fand, als er im Mai 1837 öffentlich dort auftrat, seine Darbietungen hinter den hochgespannten Erwartungen zurückbleibend.
Endlich kam er nach Leipzig, von den ersten seiner mitlebenden Genossen, Mendelssohn und Schumann, auf das wärmste begrüßt und dem dasigen Kunstleben zugeführt. Mendelssohn selbst übernahm die Direktion des von dem gefeierten Gast veranstalteten Extrakonzertes mit Orchester und Gesang, während Schumann, nachdem Henselt im engeren Musikerkreise bei Wieck Proben seines wunderbaren Spiels gegeben hatte, das Publikum auf den zu erwartenden Genuß mit den im Tageblatt vom 29. Dezember 1837 erscheinenden Worten vorbereitete: »Einer der gewaltigsten Klavierspieler unserer Zeit, dazu ein Komponist voll großer schöpferischer Kraft, tritt heute abend zum erstenmal öffentlich in Leipzig auf. Es ist bereits so viel über ihn gesprochen und geschrieben worden, er hat sich in so unerhörter Schnelligkeit einen Ruhm gemacht, daß seine Leistungen allerdings die außerordentlichsten sein müssen, wie sie es auch wirklich sind. Wir zweifeln nicht, daß Leipzigs Publikum die angeregten Erwartungen vollständig befriedigt, wenn nicht übertroffen und das ausgesprochene Urteil bestätigt finden wird, welches der Einsender niederschrieb, nachdem er des Künstlers herrliches Talent in engeren Kreisen bewundert hatte.«
»Ein hunderthändiges Salve« empfing am Abend – der denkwürdigsten einem in Leipzigs Konzertannalen – den hervortretenden Meister. Er begann mit Webers F-moll-Konzert, einem Glanzstück seiner Virtuosität, das von ihm gehört zu haben Lenz geradezu als ein Ereignis im Leben eines Menschen bezeichnet. Es gab auch kaum etwas Geeigneteres für Henselts heroisches Spiel und gehörte zu seinen Lieblingsaufgaben am Klavier. Im übrigen standen eine Etüde von Chopin und eigene Kompositionen auf dem Programm, darunter die Vöglein-Etüde, das Liebeslied, das Poème d'amour und die Variationen op. 11, sämtlich zur Zeit nur im Manuskript vorhanden, da erst sein opus 1, Variationen über ein Thema aus dem »Liebestrank«, kurz zuvor (im November 1837) im Stich erschienen war. Hier gab er sich ganz und gar in seiner eigensten Sphäre als Sänger auf seinem Instrument, und die »seelenvolle Naivität« seines Spiels, der liebessehnsüchtige Zug seiner Individualität gelangten zu berückendem Ausdruck.
Nichtsdestoweniger hielt sich der Beifall in mäßigen Schranken – der Bedeutung des Gastes entsprach er nicht. Mochte das Urteil des Kenners immerhin seine Leistungen für »ungeheuer und einzig in ihrer Art« erklären und der Berichterstatter der Schumannschen Zeitschrift (Wl.) auch in beredtester Weise auf den poetischen Wert des von Henselt Dargebotenen hinweisen »Neue Zeitschrift für Musik« 1838, Nr. 2 und 1842, Nr. 32. Hinter der Chiffre Wl. verbarg sich der geistreiche E. F. Wenzel, der zu Leipzigs besten Musikern gehörte. – der Mehrzahl einer selbst durch Mendelssohn herangebildeten Zuhörerschaft fehlte doch für das Außerordentliche seiner Erscheinung das rechte Verständnis. Es war eben eine Eigentümlichkeit von Henselts Spiel, daß es mehr für den Kenner als für die große Masse geschaffen schien; ihm fehlte das Blendende, Hinreißende, was jene willenlos packt und in den Bann nimmt. Eine so enorme Virtuosität dasselbe absorbierte, diese ward – da seine Technik dem gebundenen Stil angehörte – nicht allzusehr augenfällig und ging ganz in solider Klaviermusik auf, die mehr in die Nähe als in die Ferne wirkte.
Es blieb dies das einzige Mal, daß Leipzig den seltenen Künstler öffentlich bewunderte. Wenige Tage später nahm er in Dresden, wohl ohne es selber zu ahnen, für immer vom deutschen Kunstleben Abschied. Das Geschick hatte in der Fremde eine andere Heimat für ihn bereit, und ein Besuch Rußlands, obwohl nur als ein vorübergehender beabsichtigt, entschied über seine weitere Zukunft, brachte sein Leben in andere Gleise.
Über Warschau, woselbst er mit Vieuxtemps gemeinsam dergestalt begeisterte, daß er in seinem graziösen Walzer » Souvenir de Varsovie« dankbar ein Erinnerungsblatt zurückließ, traf er in den ersten Wochen des Jahres 1838 in Petersburg ein. »Wie ein Sturm«, so wird uns berichtet, »verbreitete sich die Nachricht seiner Ankunft. Auf der Höhe der öffentlichen Meinung, bevor ihr noch Gelegenheit gegeben war zu prüfen, stand hier noch niemand.« Und die Erwartung, so hoch sie gespannt war, ward nicht Lügen gestraft; denn was von keinem hier gleicherweise gegolten hatte, das galt von ihm: er kam, spielte – und siegte. So ungeheuer aber war der Erfolg des von ihm im großen Theater veranstalteten Konzerts, so jeglichen Maßstab im Auslande überragend, daß der Gefeierte den ihm einstimmig ausgesprochenen Wünschen nachgab und von Deutschland nach der Zarenstadt übersiedelte. Er wurde so bald in derselben heimisch, daß er sie seitdem nur zeitweilig verließ. Die russische Gesellschaft vergötterte ihn und unter ihren ersten, angesehensten Namen fand er seine Freunde und Schüler. Wie er sich schon in München als vierzehnjähriger Knabe, um seiner in dürftigen Verhältnissen lebenden Familie willen, vielfach mit Unterrichtgeben beschäftigt hatte, so ergab er sich jetzt von neuem und in ausgebreitetster Weise dem Lehrberuf. Nur von ihm, bezeugt Lenz, ging fortan am Klavier noch die Rede; in allen maßgebenden Kreisen und bei Hofe konzentrierte er den Unterricht in seiner Person und die Kaiserin ernannte ihn zu ihrem Hofpianisten.
Mit seiner Virtuosenkarrière schloß er leider kurze Zeit darauf völlig ab. Nur im philharmonischen Verein zu Petersburg, in Moskau, Riga und Dorpat hörte man ihn noch während des nächstfolgenden Jahres – dann verstummte der Gesang seiner Finger, und in seinem Virtuosenleben ward es still, ganz still. Vier kurze Jahre des öffentlichen Pianistentums, die, wie erwähnt, die unglaublich geringe Zahl von fünfundzwanzig Konzerten kaum übersteigen, hatten hingereicht, den Weltruhm Henselts zu begründen und seinen Namen für alle Zeiten den ersten Meistern seines Instrumentes beizugesellen. Sein heißes Wünschen von ehemals hatte sich erfüllt. Vor Thalberg, seinem einstigen Vorbild, hatte man ihm fast allseitig den Vorrang zugesprochen und ihm die edlere, innerlichere Kunstnatur zuerkannt. Nur einen Größeren noch kannte die Welt als ihn: den Einzigen, Franz Liszt, der eben zu jener Zeit den Händen Thalbergs die Palme entwunden hatte und als Sieger und Beflügler durch Europa zog. Als Nebenbuhler von ihm ist Henselt niemals in die Schranken getreten; er war zu verschieden geartet, um sich mit ihm messen zu wollen oder zu können. Dem universellen Genius Liszts trat in ihm eine energisch ausgeprägte Individualität durchaus deutscher Bildung entgegen, der, während dieser in kosmopolitischer Gewandtheit alle Stile beherrschte, nur die heimischen Laute der Muttersprache geläufig von den Lippen gingen. Zur wunderbaren Vielseitigkeit Liszts stand Henselts Exklusivität in auffälligem Gegensatz. Er war zu deutsch, um sich einer fremden Nationalität vollkommen anschmiegen, zu subjektiv, in sich selber abgeschlossen, um anderes als Nächstverwandtes in sich aufnehmen und aus sich zurückstrahlen zu können. So blieb er eine Spezialität am Klavier, während Liszt als allumfassender Musikgeist waltete. Seine Technik, seine ganze künstlerische Art behaupteten standhaft ihre Besonderheit. Nicht eine absolute Herrschaft über das gesamte virtuose Material, wie sie Liszt gegeben, sondern eine relative vielmehr war ihm zuteil geworden, und nicht wie jenem aus einer nie zuvor erlebten Kühnheit und Genialität der Bravour, aus einer unerhörten Ausdrucksgewalt, sondern aus der Harmonie und Ebenmäßigkeit, aus der Vollendung der Leistung in sich erwuchs ihm sein eigentlicher Ruhm. Das alte geflügelte Wort von der »flüssigen Architektur« dürfte vornehmlich aus Henselts Spielweise Anwendung leiden, so plastisch und solid, so fest und sicher gefügt baute sich das von ihm dargestellte Kunstwerk auf. Die Höhe, die Henselts künstlerischen Standpunkt bezeichnet, ob sie auch um ein gutes Stück überragt wurde von dem gewaltigen Piedestal, auf dem sich Liszts einsame Größe erhob, ließ keine weitere Steigerung offen, ihr Gipfel ist erreicht – Henselt, der Virtuos, ist eine in ihrer Art vollendete Erscheinung.
So auf der Höhe der Künstlerschaft, dem Gipfel virtuoser Triumphe angelangt, nachdem ihm Ehren geschehen, deren sich nach Schumanns Worten kein Mozart zu schämen brauchte, trat Henselt zurück vom Schauplatz, freiwillig ferneren Siegen und dem schönen Vorrecht des ausübenden Meisters entsagend, das reine Wesen des Kunstwerks der Menschheit zu deuten und an der Flamme der eigenen Begeisterung tausend und abertausend Seelen zu entzünden. Zehn Jahre später überraschte Liszt die Welt durch einen gleichen Schritt. Aber er tat ihn siegesmüde, nach einem fünfundzwanzigjährigen Ruhmeslauf, während Henselt noch im Beginn desselben stand.
Alle wiederholten Versuche, den Ruhmgekrönten zu erneutem Hervortreten zu vermögen, scheiterten an seinem hartnäckigen Widerstand; selbst das denkbar glänzendste Anerbieten wies er unentwegt von sich. Es war nicht seine Art, einem einmal gefaßten Entschluß untreu zu werden; er blieb fest im Beharren wie nur irgend einer. Gleich Chopin, dem ihm in vieler Beziehung verwandten Künstler, erfüllte ihn der Gedanke, mit seiner Kunst vor ein großes Publikum zu treten, von jeher mit einer nervösen Abneigung, die sich allmählich bis zu einer unüberwindlichen steigerte. Er wußte, daß der Konzertsaal weniger als der Privatkreis, das Zimmer der für ihn geeignetste Schauplatz zur Entfaltung seiner ganzen Überlegenheit war. Erst wenn die Rücksicht auf Programm und Zeitmaß, ja selbst auf die Zuhörer ihn nicht beengte, schwang er sich zu seinem höchsten Können auf. Je mehr er gab, desto höher nur wuchs ihm die Kraft und »sein Letztes war stets sein Gewaltigstes«. Erst wenn er der Außenwelt und seiner selbst vergaß, wenn seine künstlerische Seele allein tätig war und gleichsam einem höheren Geheiß zufolge ihr Innerstes ausströmte, gab er sein Bestes, Ureigenstes. In solchen Momenten höchster Extase, wo er sich seinem Ideale näher fühlte, geschah es oft, daß er das eben Gegebene wie traumverloren, unbewußt wiederholte, oder auch leise zu singen anhob, die gespielte Melodie mit seiner Stimme verdoppelnd. Zu solcher Stunde mußte man ihn hören, um den rechten Maßstab für seine Größe zu finden. Er selber freilich war auch dann noch nicht befriedigt; wann wäre er es überhaupt je gewesen? Ein Faustischer Zug seines Wesens, der verzehrende Drang seiner Seele nach idealer Vollendung raubte ihm selbst inmitten des höchsten Triumphes die Krone des Augenblicks, ließ ihn seiner Taten nie froh werden. Dem gleichen verhängnisvollen Zug fiel einer unserer besten späteren Musiker zum tragischen Opfer: mit seinem Herzblut und Leben hat ihn Carl Tausig bezahlen müssen. Wem er zur Mitgabe geworden, scheint eben berufen mehr Dornen denn Rosen auf seinem Pfade zu pflücken, und jeder Schritt vorwärts bezeichnet nur neuen Kampf, neues Entsagen.
Nur im engsten Kreise noch, als sein Freund oder Schüler, fand man hinfort Gelegenheit Henselts Spiele zu lauschen. Man drängte sich zu den Matinéen, die er allsonntäglich zur Winterzeit in seinem Hause veranstaltete. Da spielte er stundenlang, oft ohne Unterbrechung, wie für sich selbst, ohne von seinen Zuhörern sonderlich Notiz zu nehmen. Er gab stets viel, wenn auch nicht vielerlei. Am liebsten spielte er Weber, dem er sich unter allen musikalischen Genien am befreundetsten fühlte. Mit keinem andern hatte er ein so inniges Herzensbündnis geschlossen als mit ihm, dessen romantischer Geist und durch und durch melodische Weise seinem eigenen Naturell entsprach. Ihm war die Musik ganz Kunst des Gefühls, die von Seele zu Seele geht. Wo sie über die Grenzen der Empfindung hinweg in das Bereich des spekulativen Gedankens hinübergreift, betritt sie Bahnen, mit denen die seinen nichts gemein hatten. Darum stand er auch Beethoven, der den Gedanken in der Musik entfesselte und das Unendliche in ihre Sphäre hereinzog, ferner, und zu den Werken seiner letzten Periode hat er nie in ein näheres Verhältnis zu treten vermocht. Sie erschienen ihm »gemacht«, im Gegensatz zu den frühesten (den Klaviertrios op. 1), die seiner Ansicht nach »geworden« sind.
Sein tägliches Brot war ihm Bach, der Alte und doch »nie Veraltende.« Bei dessen Fugen holte er sich Tag für Tag für Finger und Gemüt die nötige Kräftigung. Der alte Sebastian und die Bibel – er las die eine nicht minder eifrig als er den andern spielte –, sein stummes Klavier und die konsequent betriebene schwedische Heilgymnastik erhielten ihm Leib und Seele gesund. Er liebte nur das Gesunde, Naturgemäße, allem krankhaften, sentimentalen oder maßlosen Wesen war er Feind. Trotz des mild elegischen Grundtons seiner künstlerischen Persönlichkeit und einem deutlich ausgeprägten Zug Weberscher Gefühlsromantik und Schwärmerei war keine Ader von Sentimentalität in ihm. Er war eine Kernnatur voll Kraft und Saft und schlichter Lauterkeit des Empfindens. Nichtsdestoweniger legte er seit jeher eine tiefe Vorliebe für Chopin an den Tag, mit dessen zarter, vorwiegend melancholisch gestimmter Gefühlsrichtung er sich so nahe berührte und für dessen Einfluß als Komponist er sich so zugänglich erwies, daß Louis Köhler ihn treffend geradezu als den »deutschen Chopin« bezeichnete. Wie dieser war auch er Romantiker und Minnesänger am Klavier. Er sang den Inhalt seiner eigenen Schmerzen und Wonnen, und seine Gesänge sind der Liebe und Hingebung voll; ist doch, meint Schumann, sein ganzes Wesen in Liebe aufgegangen.
Glühender und träumerischer, wilder und zugleich zarter, graziöser, koketter und pikanter als die seines deutschen Kunstgenossen, geben sich, seiner Art und Abstammung gemäß, die Tondichtungen Chopins. Halb Pole, halb Franzose, gestaltet er aus einem leidenschaftdurchzuckten Herzen und feinem, glänzenden Esprit heraus, während Henselt echt deutsch aus der klaren Tiefe seines Gemütes schöpfte. Von Chopins geistreichen Extravaganzen und Kaprizen weiß der bei aller Anmut doch schwerer angelegte Henselt nichts; er ist maßvoller, gehaltener auch im bewegtesten, leidenschaftlichen Ausdruck; bei ihm ruht alles auf gesünderer Basis. Da ist keine Spur von dem nervösen rhythmischen Pulsschlag, dem Tempo rubato, den harmonischen Härten und unvermittelten Sprüngen, den von Schumann als »Häkelperioden« bezeichneten Dunkelheiten, die Chopin charakterisieren. Klar und breit fließt der Strom seines Gesanges; seine Weise ist herzlich, offen und einfach, wo jener mehr andeutend, versteckter aber auch sprühender, hinreißender spricht. Gemeinsam ist ihnen beiden eine aristokratische Vornehmheit, eine innere und äußere Eleganz des Wesens und der Manier, die nichts Vulgäres in ihrem Kreise aufkommen läßt und alles, was sie berühren, adelt. Ferner die Schönheit und Wohllautsfülle der Melodie, eine natürliche Grazie, die selbst das herbste Weh salonfähig macht und der Liebenswürdigkeit nicht entkleidet. So wurden sie beide die Lieblingskomponisten des Salons, die Günstlinge der Frauen insbesondere, die sich am Duft ihrer blumengleichen Gewinde ergötzten und berauschten.
Rasch, wie die Kunde seines unvergleichlichen Virtuosentums, durchflogen Henselts Kompositionen die Welt. Sie würden sich, meint Schumann, wäre die Notenschrift noch nicht erfunden gewesen, wie die Homerischen Gedichte von Mund zu Mund, oder Hand zu Hand fortvererbt haben, in so vieler Hände waren sie schon vor ihrer Veröffentlichung. Namentlich Clara Wieck erwarb sich durch Vorführung derselben noch als Manuskript in ihren Konzerten große Verdienste. Der ihnen eigene romantische Glanz, der Wohllaut und Klangzauber, in dem Schumann den Widerhall einer inneren Liebenswürdigkeit erkennt, wie er ihm »in höherem Grade noch nie bei einem anderen Komponisten vorgekommen«, nahm alle gefangen, die seine Weisen hörten. Soll doch sein opus 1, die Variationen über ein Motiv aus dem »Liebestrank«, allein in zehntausend Exemplaren verkauft worden sein, und dennoch gehört es nicht zu dem Ursprünglichsten, was er geschaffen. Chopinsche, Thalbergsche und Webersche Einflüsse halten darin noch die Entfaltung seiner eigenen Individualität in Schranken, ob diese auch hier und dort zum Durchbruch gelangt. Ungleich reifer ist sein späteres Variationenwerk op. 11 (mit Orchester), das, bei noch gesteigerten Anforderungen an den Spieler, Eigentümlicheres und Wechselvolleres bringt. Hinwiederum verrät ein als » La premiére composition d'Adolphe Henselt« viel später erschienenes Rondoletto in D-moll in den Passagen nicht nur die sich auch andernorts kundgebende Hinneigung zu Weber, sondern auch die Schule Hummels, des Meisters, für den er – ob die eigenen Bahnen ihn auch von den seinen abseits führen mochten – sein Lebenlang dankbare Pietät bewahrte. Nur die plastische Gestaltung des Ganzen, der schöne Fluß der Kantilene, die Art, wie er mit vollem Brustton zu singen pflegt, gehören schon durchaus ihm selber an, wie sie für sein ganzes späteres Schaffen bezeichnend bleiben. Und es war dies das erste selbständige Werk des Künstlers, das er als achtzehnjähriger Jüngling, während der allerersten Zeit seines Wiener Aufenthaltes, 1832 schrieb. Er hatte die Existenz desselben bereits völlig vergessen, als er viele Jahre später das Manuskript durch eine Münchener Freundin zurückempfing, und ohne daran sonderlich zu ändern, gab er es nachmals noch in den Druck. Die liebenswürdige Frische seiner Jugendarbeit muß ihn, ebenso wie die seines demselben Jahre entstammenden, aber erst spät veröffentlichten »Frühlingsliedes«, selber angemutet haben, obwohl er die Erstlinge seiner Phantasie meist erbarmungslos der Vernichtung preisgab. Er übte allezeit strenge Selbstkritik, und nur das wirklich Ausgereifte, in seiner Weise Vollendete ließ er heraustreten. Die gleiche skrupulöse Sorgfalt im Detail, die seine virtuosen Leistungen kennzeichnete, fehlte eben auch seinen schöpferischen nicht. Mit deren Ausarbeitung pflegte er sich nicht zu übereilen. »Nie« – so schrieb uns die verstorbene Schriftstellerin Clara Bauer (Carl Detlef), eine seiner zahlreichen russischen Schülerinnen und Freundinnen – »wird er mit einem Musikstück fertig; immer glaubt er der Exekution noch etwas schuldig zu sein. Eine Passage verändern, einen Akkord vervollständigen kann ihn wochenlang beschäftigen – und doch klingt nie etwas pedantisch.«
Es wäre somit ein müßiges Beginnen, wollte man seinen künstlerischen Fleiß und den Wert des von ihm Geleisteten nach der Zahl der von ihm veröffentlichten Werke bemessen. Dieselbe hat keine beträchtliche Höhe erreicht. Seine mit Opuszahlen versehenen Herausgaben, die mit Ausnahme einiger Transkriptionen ausschließlich Originalkompositionen umfassen, sind über 40 nicht hinausgekommen Wenigstens nicht innerhalb des deutschen Musikhandels. Die in Rußland bei Stellowsky in Petersburg erschienene Ausgabe seiner Werke nennt zwar 51 opera; aber sie entfernt sich mehrfach von der in Deutschland gültigen Reihenfolge und führt manches auf, was bei uns ohne Angabe einer Opuszahl veröffentlicht wurde.. Alles Übrige beschränkt sich in der Hauptsache auf Pädagogisches, einiges wenige Vokale, das Henselt selber später verleugnete, und Bearbeitungen verschiedener Klavier- und Orchesterwerke.
Die Mehrzahl des von ihm Geschaffenen umschreibt nur knappeste lyrische Formen, in denen Henselt Meister ist. Allem voran stehen seine Etüden op. 2 und 5 (zu je 12 Nummern). Sie behaupten einen ersten Rang in der einschlägigen Literatur und sind den Chopinschen, ohne deren Vorgang sie auch kaum vorhanden wären, ebenso wie den gleichartigen Arbeiten Liszts vollkommen ebenbürtig. Über den Standpunkt der Cramerschen Etüde, die mehr das Technische als das rein Musikalische ins Auge faßt, erscheinen sie weit emporgehoben; sich an den fortgeschrittenen Spieler wendend, setzen sie ein schon vollbrachtes Studium voraus. Es sind Gedichte, Lieder ohne Worte, mannigfaltige Stimmungs- und Charakterbilder. Die Passage ist in ihnen zum ideellen Ausdruck verwandt, wie es überhaupt als eine Errungenschaft der großen Virtuosenepoche zu betrachten ist, daß sie das Figurenwerk poetisierte, die moderne Passage aus der Leere bloßen Tonspiels oder gymnastischer Übungen in die Sphäre der Idee erhob. Ein Vergleich zwischen der älteren Passage Hummels beispielsweise und der neueren Henselts, Chopins und Liszts wie ihrer Nachfolger ergibt, daß jene durch Fertigkeit und Geschmack in der Ausführung vollkommen gedeckt wird, wogegen diese noch das Hinzutreten eines geistigeren Elementes verlangt und, wie sie im Gefühle ihre Wurzel hat, zugleich eine gefühlvolle poetische Darstellung – nicht lediglich eine korrekte – bedingt. Mit der bloßen Bravour – mochte sie auch noch bei dem in der Mechanik stehenbleibenden Thalberg ausreichen – ist es hier nicht getan. Um Henselt zu spielen, wie er gespielt sein will, muß man mit den Fingern singen, den Tasten ihr ganzes schwellendes Tonvermögen entlocken können; herrscht doch bei ihm, dem die Musik aus dem Herzen herausquillt, das melodische Prinzip allenthalben wahrnehmbar vor. Wie Weber, an dessen Harmonik auch seine zerstreuten Tonlagen, Septimen, häufigen Vorhalte erinnern, ist er ganz Melodie. Aber seine an und für sich schon reizvollen Gesangsthemen gewinnen noch an Anmut durch das heimliche Figurenwerk, in das er dieselben hüllt. »Seine gebundenen Exercices«, bemerkt Louis Köhler treffend, »sein klangspinnendes Legato, sein weicher und doch markvoller Anschlag bei stiller Hand, alles ist nicht von Henselt gewählt, sondern entquillt seiner eigensten Natur, die überall für das Melodische disponiert erscheint, selbst in der Bravourpassage. Auch im kühnen Modulationszuge bewahrt er noch immer etwas Musikalisch- Dezentes, das nicht die Virtuosität an und für sich grassieren läßt, sondern sich an die eigentliche Sache hält: die Musik.« Und Schumann hebt in seiner Besprechung des ersten Studienwerkes »des gottbeseelten Sängers«, wie er ihn nennt, den sorgsamen Fleiß hervor, mit dem er die Bässe und Mittelstimmen behandelt; die Gewissenhaftigkeit, mit der er alles anordnet, daß sich das Ganze vorteilhaft ausnehme und dabei das Einzelne sich fein und gehörig unterscheide. Allüberall bezeugt sich der große Meister und Kenner seines Instrumentes, der dasselbe auf das ausgibigste zu behandeln, ihm neue Effekte abzuzwingen weiß und uns, vermöge seiner Herrschaft über das Material, auch da fesselt, wo er uns ein minder gewichtiges Geschenk darreicht. Kein Klavierspieler höherer Ausbildung darf demnach billigerweise an Henselt vorübergehen, dessen eigentümliche Technik ein besonderes Studium verlangt. So geben schon seine Etüden für Herz und Hände vollauf genug zu tun. Enthalten die ersten Hefte derselben, op. 2, eine Reihe köstlicher Liebeslieder – darunter die berühmte Vöglein-Etüde in Sexten und das innige Repos d'amour –, so spiegeln die späteren, op. 5, objektivere Stimmungen und Bilder wieder. Ein »Elfenreigen« und »Nächtlicher Geisterzug«, ein »Ave Maria« und »Danklied nach dem Sturm«, ein »Hexentanz« und »Eroica« u. a. m. schließen sich hier in bunter Folge aneinander. Am liebsten aber vernehmen wir ihn doch in seinem ureigensten Genre: im »Liebeslied« und der »Romanze«; wie immer, wo er von Liebeslust und -leid erzählt, ist hier seine Sprache am beredtesten, greift sie am allerunmittelbarsten an unser Herz. Darum ist auch sein Poème d'amour op. 3 allen in die Seele hineingeklungen, die es hörten; seine sehnsuchtbeflügelten Klänge haben sich auch die sprödesten Gemüter aufgetan. Erzählt man sich doch sogar, daß sie einem unglücklichen Duellanten – einem russischen Studenten in Dorpat, der einen andern im Zweikampf getötet und sich jahrelang zu verbergen gewußt hatte – das reuige Bekenntnis seiner Tat auf die Lippen zwangen, indem er, von Henselts Vortrag gerührt, sich freiwillig dem Gerichte stellte.
Selbst wenn Henselt nichts weiter geschrieben hätte als dies eine Stück, er würde sich damit das Recht erworben haben, in den Kreis unserer besten Lyriker am Klavier einzutreten. Aber er hat uns außer dem bisher Erwähnten noch eine Reihe von Kabinettstücken geschenkt, kleine, fein und liebevoll ausgeführte Tonbilder im engen Rahmen. Sein »Frühlingslied«, op. 15, das »Wiegenlied«, die Romanze in B-moll, op. 10, die er selber gern als Einleitung zu seiner Vöglein-Etüde spielte, das Notturno »Schmerz im Glück«, »Fontaine«, op. 6, die Romanze von Thal blühen, trotz ihres nahezu siebzigjährigen Alters, noch im Jugendglanz, ob auch an manchen seiner späteren Gelegenheitskompositionen, Tänzen und Salonpiècen die Zeit minder spurlos vorüberging. Ebenso vermag seine Toccatina, op. 25, mit ihrem kunstvollen Detail, der schönen Rundung ihrer Form und der ihr innewohnenden Lebensfrische, den Klavierspieler dauernd zu fesseln. Auch einige seiner letzten Originalwerke: das kleine Morgenlied in G-dur, das ein Uhlandsches – nicht, wie auf dem Titel angegeben, ein Müllersches – Gedicht in Tönen illustriert, »Sehnsucht«, »Abschiedsklage« etc. bekunden die vornehme Henseltsche Haltung und Liebenswürdigkeit. Eine Folge stimmungsvoller, wenn auch ganz anspruchsloser, mehr angedeuteter als ausgeführter Miniaturen enthalten wiederum seine nur in russischer Ausgabe veröffentlichten » Préambules dans tous les tons majeurs et mineurs». Für die Schülerinnen der unter seiner Leitung stehenden Anstalten geschrieben, geben sie sich in knappester Fassung, sie wollen nichts weiter sein, als ihr Name sagt. Neben dem praktischen Wert aber wohnt ihnen ein poetischer Gehalt inne, und ob auch den Umfang einer, zweier oder dreier Zeilen nicht überschreitend, hat in ihnen allen doch, neben kurzen Imitationen, Passagen u. dergl., jene graziöse Melodik Raum, die den sangreichen Meister charakterisiert.
Die gleiche Sorgfalt der Arbeit bei aller Unmittelbarkeit der Empfindung und Erfindung zeichnet auch seine drei umfänglichsten Arbeiten aus, mit denen er, Schumanns Mahnung Gehör gebend, aus dem engeren Gebiet der Salonmusik in das der Kammer- und Konzertmusik hinüberschritt. Das Duo in H-moll, op. 14, für Pianoforte und Horn (auch Violine oder Cello), das, in einem Satz geschrieben, laut Henselts eigener Mitteilung, seiner Entstehung nach in dessen neunzehntes Lebensjahr zurückfällt, wirkt in Stimmung und Durchführung anziehend und interessant und zeigt in seiner üppigen Melodienfülle, die namentlich in der schönen H-dur-Kantilene eine der glücklichsten Eingebungen des Künstlers umschließt, die ihm eigene Noblesse der Gestaltung. Bedeutender noch ist das Klaviertrio in A-moll, op. 24, ein geist- und poesiereiches Musikstück von echt Henseltscher Plastik der Bildung und Gesangsfrische. Verrät auch das erste Thema eine gewisse Hinneigung zu Mendelssohn, so redet der Autor doch im weiteren Verlaufe seine eigenste Sprache. Vom Blatt spielen läßt es sich übrigens nicht; es hat seine eigenen Figuren, die gekannt und geübt sein wollen.
Höchste Anforderungen an pianistische Kräfte stellt vollends das Konzert für Piano und Orchester in F-moll, op. 16, das, wiewohl schon früher in Deutschland entworfen, zu Beginn der vierziger Jahre in Petersburg vollendet und herausgegeben ward. Es gehört zum Schwersten, was überhaupt für Klavier existiert. »Es ist«, meint Lenz, »wie eine Apotheose der alten Schule in neuer Zeit«. Als klavieristische Leistung freilich und nicht im Vergleich zu Beethovens Werken gleicher Gattung will es betrachtet werden; es will ein Virtuosenkonzert sein, darin das Klavier dominiert, nicht ein symphonisch behandeltes. Das Orchester spielt eine untergeordnete Rolle: es begnügt sich, in der Einleitung der verschiedenen Sätze ausschließlich das Wort zu führen, dann aber dem Soloinstrument die Stimme zu überlassen und nur dann und wann sein Ja und Amen zu sprechen. In naher verwandtschaftlicher Beziehung steht das Henseltsche Werk zu den beiden Konzerten Chopins, als deren dritter Bruder es leicht angesehen werden könnte, so sehr erinnern sowohl die Kantilene als das feine, filigranartige Schmuckwerk an die Hand des polnischen Meisters, ohne daß sein deutscher Wahlverwandter darum an seiner Selbständigkeit Einbuße erlitte. Das Konzert zeigt Henselts eigenen Stil und Ausdruck, ist das Resultat seines eigenen großen Pianistentums. Die Passagen darin sind selbst erlebt und erdacht; sie wachsen auch meist aus dem thematischen Kern heraus, sind eben fast nirgend leere Passagen sondern figurierter Gehalt. Als eigentümlich fällt die von der üblichen Form abweichende Gestalt des ersten Satzes auf, wo, an Stelle des fehlenden Durchführungsteils, in allerdings nicht ganz legitimer Weise, ein von schönen Figuren umspielter Choral eingeführt wird, während die beiden übrigen Sätze sich in den gewohnten formellen Schranken halten und keinerlei ähnliche Freiheiten zu Schulden kommen lassen, wie sie das Bedenken des Kritikers von Profession erregen.
Nichtsdestoweniger hat das hervorragende, heute leider selten mehr gehörte Werk seiner Zeit unter den ersten musikalischen Autoritäten seine wärmsten Freunde gefunden. Robert Schumann sprach sich in einem Brief an den Künstler auf das anerkennendste darüber aus, und seine Gattin Clara beeilte sich, dasselbe kurz nach seiner Veröffentlichung im Leipziger Gewandhaus zu Gehör zu bringen. Auch Liszt und später Hans von Bülow haben es mit Vorliebe gespielt; ja der erstere soll es bei seinem Erscheinen sogar als das Einzige bezeichnet haben, was ihn von neueren Werken seit langem interessierte. Noch im Mai 1883 um einen Beitrag für ein Henselt zu seinem Jubiläum zu überreichendes Album gebeten, schrieb Liszt das Anfangsmotiv des köstlichen Larghetto aus dem Konzert nieder, dem er die Worte »Je weiter, um so herrlicher« neben der Widmung an den »seit 40 Jahren verehrten Komponisten« hinzufügte. »Ein bekannter Diplomat sagte mir«, heißt es in den begleitenden Zeilen, »daß man fürstlichen Personen nur Blumen aus ihren eigenen Gärten übergeben müsse, und ich hoffe daher, daß Henselt, als Fürst im Reiche der Töne, dieses Andenken an eins der bezauberndsten Erzeugnisse seines reichen Blumengartens entgegennehmen wird.«
Darauf erwiderte ein Brief Henselts:
»Mein unvergleichlicher Freund! Ich habe keine Worte! Nur das Gefühl: Möchte Alles, was Dir am Herzen liegt, dafür in Erfüllung gehen!
»Deine liebe Aussprache ist bei der Feier öffentlich vorgelesen worden und bildete eigentlich den Schwerpunkt.
Dieselbe ist bis auf das letzte Wörtchen in allen Zeitungen aufgenommen worden. Gott nehme Dich in Seinen gnädigen Schutz auf jedem Deiner Tritte.
Dich herzlich umarmend
Dein Adolf Henselt.
St. Petersburg, 15. Mai 1883.«
Liszt vollbrachte auch das Unerhörte, in einer Leipziger Konzertprobe das F-moll-Konzert aus dem Manuskript vom Blatt zu spielen, was, nach Henselts darin zur Erinnerung vermerkten Worten, kein anderer ihm jemals gleichgetan hat, noch jemals gleichtun wird. Ist doch die Wiedergabe desselben so schwierig, daß der Autor selber sich nie mit der eigenen zufrieden geben wollte und es wirklich auch niemals öffentlich vorgeführt hat. Im Gegensatz zu so vielen seichten Bravourkompositionen, die, auf Blendung des Hörers ausgehend, ungleich schwerer klingen, als sie in Wahrheit sind, verstecken sich in Henselts Werke vielmehr ungeahnte Schwierigkeiten. Manches – wie beispielsweise nur zweistimmige Stellen im dritten Satz – ist abnorm schwer, ohne daß man es heraushört, und dennoch ist es keineswegs unpraktisch, sondern völlig klaviermäßig.
Erklärt sich, bei unserem doch nicht übergroßen Reichtum an guten und lebensfähigen Klavierkonzerten, das seltene Erscheinen des in Rede stehenden in erster Linie aus Schwierigkeitsgründen, so können wir uns andererseits nicht verhehlen, daß Henselt in Deutschland leider aus der Mode gekommen ist. Zu zahm sind seine Tongebilde für das Zeitalter der »Salome« und »Elektra«. Schnell wandelt sich in unseren raschlebenden Tagen der Geschmack auch im Reich der Töne. Die Klänge, die unsere Eltern und Voreltern entzückten, wecken die gleichen Empfindungen in uns nur, wenn ihnen ein zeitloses Wesen innewohnt. Tonstücke, deren Gefühlskreis über den ihrer Zeit nicht hinaus geht, gehen auch mit dieser Zeit dahin, denn fort und fort wechseln die künstlerischen Ideale und Ausdrucksformen. Nur die Künstler, denen es gegeben ist, nicht nur den Inhalt ihrer Zeit und der ihr vorausgegangenen Entwicklung im Kunstwerk zusammenzufassen, sondern zugleich vorahnend in die Zukunft hinauszugreifen, um deren Dichten und Trachten den Mitlebenden prophetisch zu deuten und künstlerische Möglichkeiten zu verkünden, die erst sehr allmählich vollkommen in die Erscheinung zu treten vermögen, spotten der Flucht der Zeit. Freilich müssen sie die längere, die vielleicht unvergängliche Dauer ihres Ruhms und ihrer Einwirkung erkaufen um den hohen Preis, der Mehrzahl ihrer Zeitgenossen, so lang sie unter ihnen weilen, unverstanden zu bleiben und meist erst nach ihrem Tode zu voller Würdigung zu gelangen. Solch' seherische Genien weist die Musikgeschichte in Bach, Gluck, Beethoven, Wagner auf, wogegen z. B. Mendelssohn mehr rückwärts in die Vergangenheit schaut. Auch Weber – es bezieht sich dies selbstredend nur auf den Instrumental- und Vokal-, nicht auf den Opernkomponisten – und Henselt, sein Nachfolger und Fortsetzer am Klavier, denen beiden, unbeschadet ihrer romantischen Tendenz, ein klassischer Zug anhaftet, sind in der Mehrzahl ihrer Schöpfungen nicht über die Grenzen ihrer Zeit hinausgeschritten. Leider hörte ja der letztere, während sein Vorbild Weber immer ausschließlicher seinem dramatischen Beruf Gehör gab, freiwillig mehr und mehr auf sich in Fühlung mit der Zeit zu erhalten und begab sich am Ende aller Wechselwirkung mit derselben. Ging doch die Zurückgezogenheit Henselts so weit, daß er, wie er selbst ganz dem Konzertieren entsagte, auch den Konzerten anderer, den Opernaufführungen und überhaupt jeder öffentlichen tonkünstlerischen Betätigung aus dem Wege ging. Das rächt sich am Künstler, der, wenn er auch zeitweiliger Einsamkeit bedarf, doch der Berührung mit dem herrschenden Kunst- und Ideenleben auf die Dauer nicht entraten kann, soll nicht sein Schaffensquell in sich selbst versiegen.
Ganz allein auf sich gestellt, allen anregenden Kunstverkehr von sich weisend, mußte in Henselt allmählich der Drang ersterben, von dem, was in ihm war, nach außen hin Kunde zu geben. Die Scheu vor der Öffentlichkeit trieb ihn immer mehr in sich selbst zurück, und er, der anfangs so froh und freudig aus sich herausgesungen hatte, der, um zu schaffen nur die Hand auf die Tasten zu legen brauchte und über einen unerschöpflichen Melodienschatz zu verfügen schien, versank in tiefes Schweigen. Von jeher an eine wohl überstrenge Selbstkritik gewöhnt, war er wenig geneigt, seinen schöpferischen Leistungen die ihnen gebührende Bedeutung zuzuerkennen. Nicht selten klagte er sich an, daß, was er auch in seiner Jugend versprochen habe, späterhin zu halten von ihm versäumt worden sei. Wenn er jedoch mit Hans von Bülow die Ansicht teilte, daß der Virtuos dem Komponisten feindlich sei und beide nicht Arm in Arm eine ernste Kritik in die Schranken zu fordern vermögen, so bekennen wir uns vielmehr zu der Meinung, daß mit Henselts Pianistentum zugleich sein dauernder Aufenthalt in Rußland seinem schöpferischen Wirken zum Nachteil gereichte. Die dortige Luft war zu materiell für seine feinorganisierte Künstlernatur, so gut sie ihm äußerlich gedieh. Mochte die Gesellschaft, in deren Mitte er lebte, ihn vergöttern, seinen geistigen Bedürfnissen blieb doch die nötige Nahrung versagt. Was hätte er, wäre er Deutschland, dem Mittelpunkt tonkünstlerischer Bewegung, nicht dauernd ferngeblieben, uns nicht alles noch geben können! Zwar ob seine schöpferische Kraft noch weiterhin eine aufsteigende Linie verfolgt und er, über das von ihm beherrschte enge Ausdrucksgebiet hinausschreitend, uns in der Tat den »Löwen« gebracht hätte, den Schumann nach den Frucht- und Blütenspenden, mit denen er begonnen, erwartete – wer will es sagen? Genug, wir haben uns mit dem zu bescheiden, was er geleistet. Innerhalb der ihm eigensten Kunstsphäre, das ist gewiß, hat er mit der Vollkraft schöpferischen Vermögens gewaltet und den Gehalt, den seine Welt in sich barg, in so schönen Werken dargetan, daß man die ihm zugefallene Aufgabe als gelöst betrachten darf. Fortan erwählte er sich eine minder glänzende, wenn auch nicht minder segensreiche Tätigkeit. Statt wie zuvor in die Weite zu wirken und die ihm verhaßte Öffentlichkeit mit seinem Ruhm zu erfüllen, erkannte er seine fernere ausschließliche Lebensaufgabe in dem selbstverleugnungsvollen Beruf eines Lehrers, in der Mission, die edlen und reinen Prinzipien, denen er selber in seinem Schaffen nachgelebt, dem jüngeren heranwachsenden Geschlecht zu Nutz und Frommen seiner Kunst zu vererben. Zum Lehrer – bezeugte seine Gattin – war er geboren, er blieb sich dieser Bestimmung klar bewußt und übte sie mit Freude und Befriedigung.
Als er 1838 nach Petersburg übersiedelte, kannte man dort Weber und Chopin kaum. Seine eigene hohe Meisterschaft entwickelte erst das Interesse und bildete den Geschmack während eines halben Jahrhunderts. Sein Verdienst ist es, wenn jetzt in der Petersburger Gesellschaft meistens künstlerisch Klavier gespielt wird; er verstand die frivolste Weltdame mit Ernst zu erfüllen und ihr Achtung vor der Kunst einzuflößen. Bei Wahl eines Lehrers oder einer Gouvernante war es bestimmend, ob sie seinen Unterricht genossen; selbst der Gehalt richtete sich darnach, und so gründete er auf diese Weise oft das Glück von Familien. Intime Beziehungen zum Hof und der höchsten Aristokratie während der Regierung dreier Kaiser – Prinz Peter von Oldenburg, der 1881 verstorbene musikliebende Onkel Alexanders II., war sein bester Freund und dessen Familie stand ihm wie die eigene nahe – erhöhten die Macht seines Einflusses.
Von dem von Anton Rubinstein gegründeten Petersburger Konservatorium hielt Henselt, im Bewußtsein der Gegensätze ihrer künstlerischen Richtung, sich abseits. Erst als Rubinstein nach Jahren des Fernseins 1887 wieder die Leitung der Anstalt antrat und zufolge der von ihm eingeführten Neuerungen viele Lehrer ihre Stellung niederlegten, erbot Henselt sich in edler Kollegialität aus eigenem Antrieb, zwölf Stunden wöchentlich unentgeltlich Unterricht zu erteilen.
Dreißig Jahre bekleidete er die Stelle eines General-Musikinspektors der kaiserlichen Erziehungshäuser in Petersburg, Moskau, Charkow, Kiew, Kasan, Odessa. In diesem Wirkungskreise hat er Großartiges geleistet. Er hat den Unterricht musterhaft organisiert, ganze Generationen tüchtig geschulter Lehrer und Lehrerinnen (er zog die letzteren ihrer größeren Gewissenhaftigkeit wegen vor) herangebildet. Allwöchentlich besuchte er je eine Anstalt in Petersburg; die auswärtigen inspizierte er ein- bis zweimal jährlich, wo ihm dann eine bestimmte Anzahl Schülerinnen vorspielen mußten. In diesen zur Erziehung der Töchter des Adels und der Beamten der verschiedenen Rangstufen bestimmten Instituten, in denen Musik immerhin ein Nebenzweig ist, wird fast durchgängig besser, gediegener gespielt als auf unsern Konservatorien. Gleichwohl erklärt er selbst in den als »Richtschnur für Lehrer und Schüler in den mir anvertrauten kaiserlichen Instituten« von ihm herausgegebenen »Bemerkungen und langjährige Erfahrungen über den Klavierunterricht«: »Unsere Anstalten sind keine Konservatorien und sollen keine sein. Unsere Schülerinnen sollen meist als Lehrerinnen wirken, sind bestimmt, die musikalischen Autoritäten ganzer Familien, ja ganzer Landstriche zu werden. Darum ist Gründlichkeit des Spiels und Lehrens wesentlichstes Erfordernis«. Und »es kömmt bei uns weniger auf glänzendes Vorspielen als auf gründliche Schule an; denn im Besitz der letzteren erwirbt sich das glänzende Vorspielen, sowie auch das prima vista-Lesen durch eigenen Fleiß ohne Lehrer.«
»Eine Leistung kann noch so elementar sein«, heißt es anderwärts, »so darf sie doch nie der Richtigkeit entbehren«, und »als heilige Pflicht« galt es ihm, »unsere Jugend vor Oberflächlichkeit zu bewahren«. Dabei hielt er sich, obwohl selber in der strengen alten Schule aufgewachsen und erzogen, von jedem engherzigen Standpunkt sorgfältig fern. »Obschon es gewiß ist«, sagte er, »daß klassische Kompositionen unbedingt die Grundlage alles korrekten, soliden und geschmackvollen Spieles bleiben müssen, so bin ich doch keineswegs der Meinung, uns nur einzig und allein auf den Klassizismus zu beschränken und das Moderne gänzlich zu verbannen. Im Gegenteil, eine Abwechselung des Klassischen mit dem Modernen zur rechten Zeit ist sowohl belehrend als anregend; nur muß die Wahl der modernen Klavierkompositionen mit Verstand und Umsicht besorgt werden.«
Besonderen Nachdruck legte er auf eine gewissenhafte Theorie des Klavierspiels, auf gebundenes und polyphones Spiel, auf den Fingersatz und die elastische Spannungsfähigkeit der Hand. Fünffingerübungen, Skalen, langsame Oktavengänge und seine eigentümlichen Dehnungsstudien (sämtlich zuvörderst mit einer Hand ausgeführt) machte er zur täglichen Aufgabe. Er hat auch eine Anzahl mechanischer Fingerübungen: » Exercices préparatoires«, (in Petersburg und bei Schlesinger in Berlin 1856) veröffentlicht, die, charakteristisch für seine eigene Technik, nicht auf Geläufigkeit, sondern auf Fingerkräftigung in gebundener Anschlagfolge abzielen. Er selbst spielte dieselben mit tief und stark in die Tasten fallendem Anschlag, in schwerer, gemessener Tonfolge und zwar – um nicht jede Hand allein zu üben und doch jede für sich zu hören – synkopiert. Der ganz eigene Henseltsche Anschlag, so wuchtig und doch duftig und zart gebunden, mit breitem orgelartigen Tone, erklärt sich zum Teil aus diesen Studien.
Pädagogischen Zwecken zu Liebe auch entstanden seine Bearbeitungen Cramerscher, Moschelesscher und Bertinischer Etüden für zwei Klaviere. Außerdem noch vollendete er an Bearbeitungen für ein und zwei Pianoforte: eine Sammlung »berühmter Ouvertüren« von Beethoven und Weber, mehrere Beethovensche Sonaten, pathétique op. 13, D-moll op. 31 und C-dur op. 53 (bei Forberg in Leipzig), As-Dur op. 26, Cis-moll op. 27, appassionata op. 57 und E-moll op. 90 (bei Stellowsky in Petersburg erschienen), das Rondo aus Hummels Konzert » Les Adieux«, zwei Walzer und eine Etüde von Chopin, das Rondo capriccioso op. 14, von Mendelssohn, sowie das Momento capriccioso, die Sonaten op. 24, 39 und 49, die »Aufforderung zum Tanz«, die Es- und die E-Dur-Polonaise, das Konzertstück und das Duo concertant op. 48 von Weber und Mendelssohns G-moll-Konzert (letzteres noch unveröffentlicht). Ein größeres von ihm begonnenes Werk ist die bei Hofmeister in Leipzig erscheinende »Hochschule des Klavierspiels«. Im Anschluß an die unter Mitwirkung Henselts herausgegebene treffliche »Rationelle Klavierlehre« von Ryba, welche, eine echt künstlerisch-musikalische Erziehung anstrebend, den Schüler von Grund aus bilden soll, bietet sie dem fertigen Klavierspieler Material dar und zwar eine Auswahl von Kompositionen der größten klassischen und modernen Meister, die Henselt, »da, wo es ihm nötig schien, mit den Fortschritten des heutigen Klavierspiels und des heutigen Pianoforte in Einklang setzte.« Mit dem ersten Satz von Hummels H-moll-Konzert wurde sie im März 1878 eröffnet.
Mit Webers Kompositionen hat Henselt, ähnlich wie Liszt, Bülow und Tausig, ein dankenswertes Verjüngungswerk vorgenommen, das nicht virtuosen Gelüsten, sondern der Liebe zum Meister, dem vertrauten Umgange mit ihm seine Veranlassung dankt. Was zeitlich an ihnen ist und unsern modernen Ohren in ihnen dünn und verblaßt klingt, hat er durch harmonische Füllung und Hinzufügung einzelner Klanglichter in einer Weise retouchiert, wie Weber, mit Benutzung der neueren Fortschritte in der Klavierbehandlung, es heute etwa selber tun würde. In der Hauptsache beschränken sich seine Änderungen nur auf das Formelle, den Satz; den gedanklichen Inhalt lassen sie nahezu unberührt. Auch hat er die Originallesart seinen Varianten durchgehends vorangestellt und zwar in großem Notendruck, während er die letzteren bescheiden in kleinerem ausführen ließ. Das gleiche Prinzip verfolgte er auch bei Beethovens D-moll-Sonate, wo er durch Verdoppelung von Stimmen, akkordische Erweiterungen etc. eine Steigerung der Wirkung erzielte.
Seit vielen Jahren schon lagen diese Bearbeitungen in Henselts Pult fertig vor; er ließ sie auch einzelnen Bevorzugten zu deren hohem Genuß eigenhändig am Klaviere hören; dennoch bedurfte es fortgesetzter und dringlichster Aufforderung, bis er sich endlich 1873 zur Herausgabe entschloß. Die Scheu, für einen »Verbesserer« Webers – mit dem sein Herz doch eine Art von Kultus trieb – angesehen zu werden, hielt ihn Jahrzehnte lang davon zurück. Bescheidenheit und fromme Pietät bildeten eben seine hervorragenden Charakterzüge. Mit ihnen gingen eine seltene Wahrhaftigkeit, Treue und skrupulöse Gewissenhaftigkeit Hand in Hand, die ihn zum geschworenen Feind jeder Übertreibung, jeder Maßlosigkeit machten. Seine Achtung vor Tatsachen war unbegrenzt; nur sie erkannte er an. Das beeinträchtigte sein Verständnis für Poesie, für andere Künste. Von der Literatur nahm er wenig Notiz. Seine Lieblingslektüre war charakteristisch der »Pitaval«, weil das darin Erzählte Fakta enthält. Er war nüchtern und praktisch im täglichen Leben, in allem, was nicht Musik ist, – poetisch, leidenschaftlich am Flügel. Gewissermaßen isoliert in der Welt, ohne sich geistig zu zersplittern, ergoß er seine volle Kraft, seine ganze Empfindung in die Musik, in das Instrument. Das war es, was seinem Spiel einen so unvergleichlich überzeugenden, unmittelbaren Eindruck verlieh. Seine praktische Sicherheit freilich kam ihm abhanden, sobald er aus seiner gewohnten Sphäre heraustrat. Trotz seines ausgeprägten Sinnes für Tatsachen konnte er sich dann nur schwer zurecht finden. Darum haßte er das Reisen und hatte nur das Endziel vor Augen, was ihn nicht verhinderte ein großer Naturfreund zu sein. Er war eifriger Spaziergänger und legte täglich, auch im Winter in Petersburg, stundenlange Strecken Weges zu Fuß zurück, indem er sich dabei häufig von seiner Equipage begleiten ließ. Körperliche Strapazen taten ihm wohl, waren seiner kraftvollen, hünenhaften Natur Bedürfnis. Demzufolge hielt er mit eiserner Konsequenz an den allabendlich gewohnten Übungen in der schwedischen Heilgymnastik fest, wie er sie früher in Gemeinschaft mit Kaiser Nikolaus, Prinz Peter von Oldenburg, dem Großfürsten Thronfolger und Herzog von Leuchtenberg betrieb. Er blieb der einzige unter ihnen, der dies beständig fortsetzte; aber er hatte es nun einmal für heilsam erkannt – und »Henselt kommt nie von einer Meinung zurück«, wie Lenz behauptet.
Das Gepräge eines festen, bewußten Charakters war schon seiner äußeren Erscheinung eigen. Seine Gestalt war imposant, sein Kopf geist- und ausdrucksvoll, sein Wesen schlicht, von urdeutscher Art. »Als er in Petersburg erschien« – so schildert ihn Lenz als Augenzeuge – »war er ganz und gar der germanische Jüngling, der Hüne, der seines Erfolges gewisse Lebensheld (germanischen Zeichens, ohne fremdländische Glätte). Etwas Siegfriedisches lag in seinem Wesen. In seinen sprechenden, immer tiefblickenden Augen las sich etwas von den Nibelungen. Männlein und Fräulein haben sich in dieser Lektüre hüben und drüben berauscht.«
Allen Ehrenbezeigungen, so viele er deren erhielt, legte er wenig Wert bei. Er wurde 1876 zum kaiserlich russischen Staatsrat ernannt, sah sich mit zahlreichen Orden geschmückt und zur Exzellenz erhoben. 1883 feierte er sein 25jähriges Jubiläum als General-Musikinspektor, 1888 den fünfzigsten Gedenktag seines ersten Auftretens in Petersburg unter allseitigster Teilnahme. Der Vorrechte des Adelstandes, den ihm der Kaiser von Rußland mit dem Wladimirorden verlieh, bediente er sich nicht; er beschränkte sich darauf, sie auf seinen einzigen, ihm 1878 durch den Tod entrissenen Sohn zu vererben.
Dem russischen Klima, das sich schwächeren Naturen meist gefährlich erweist, leistete die seine kräftigen Widerstand. Er fühlte sich vollkommen behaglich in demselben, während seine Gattin sich schon seit einer Reihe von Jahren gezwungen sah, dasselbe zu fliehen. Sie bewohnte zunächst ihr Rittergut Gersdorf in Schlesien, bis er es nach vierzehnjährigem Besitz verkaufte, und wählte dann Warmbrunn – in dessen Umgegend die angesehene schlesische Familie, der sie entstammte, zum großen Teil ansässig ist – zu ihrem Aufenthalt. In der stattlichen Villa, die Henselt sich daselbst erbaute, brachte er, mit ihr vereint, allsommerlich seinen dreimonatlichen Urlaub zu, im Genusse herzlicher Familienbeziehungen sich von den Ermüdungen des arbeitsvollen Winters erholend und für neue Mühen neue Kräfte sammelnd. Einige wenige nächste Freunde nur fanden Zutritt in dem engen Bann, den er hier wie in Petersburg um sich zog. Aber auch während dieser Ruhezeit rastete er nicht. Da sann er auf neuen Lehrstoff, neue Bearbeitungen, wie sie seinen Schülern frommen könnten, – und wann wäre ihm ein Tag vergangen, wo er der altgewohnten Übungen aus einem fast bis zur Unhörbarkeit abgedämpften Klavier, mit dem er die früher benutzte stumme Klaviatur vertauschte, und seiner musikalischen Andacht bei Sebastian Bach vergessen hätte, die ihm so unentbehrlich geworden war, wie die Luft zum Atmen? Lehren und üben, das waren die beiden Pole, um die sich seine tonkünstlerische Existenz bewegte, das waren die Freuden und Genüsse des Meisters, der so oft als der melodiereichste Sänger seiner Epoche, als der »tonwollüstigste« aller Virtuosen genannt worden ist.
Als er im Mai 1889, wie alljährlich, von Petersburg nach Warmbrunn kam, begann ein Herzleiden den Starken niederzuwerfen. Es entwickelte sich, während seine Gattin gleichzeitig schwer krank lag, unaufhaltsam und bezwang seine hünenhafte Natur. Wassersucht trat hinzu und ließ ihn an schwerer Atemnot leiden. Mit Webers, seines Lieblings, Tönen nahm er Abschied von seiner Kunst. Nach dem Vortrag der »Oberon«-Ouvertüre befiel ihn eine Ohnmacht. Aber noch an dem Sterbenden bewährte die Musik ihre Kraft. Das einzige Mittel, ihn zu beruhigen, war, ihm leise vorzuspielen.
»Nach langen in Geduld ertragenen Leiden und in seinen Gott ergeben«, wie es in seiner Todesanzeige heißt, schied Adolf Henselt am Vormittag des 10. Oktober 1889 in Warmbrunn aus dem Leben. Auf dem alten evangelischen Friedhof daselbst ward ihm im Juli 1890 ein Grabmal errichtet.
Die Geschichte der Kunst kennt keine ihm ähnliche Erscheinung. Gewiß, sie darf es beklagen, daß er aus der Reihe der schaffenden und ausübenden Musiker vorzeitig sangesmüde heraustrat; doch wenn sie die Summe seines Tagewerks wägt, dann wird sie auch seinem stillen gesegneten pädagogischen Wirken die gerechte Schätzung angedeihen lassen und ihn höher zu werten wissen als manchen, der seine innere Befriedigung dahingab für äußere Vorteile und Ehren und in den Kränzen, die die Mitwelt windet, seinen höchsten Lohn erblickt.