
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
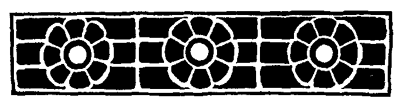
13. Dezember mittags.
Die Nacht über an Bord der ›Yumuri‹ auf der Reede von Progreso; dann um sechs Uhr früh die Anker gelichtet und westwärts am palmenbestandenen Küstensaum hinausgefahren. Das Land war bald unter dem Horizont versunken. Die See ist bis an den Himmelsrand ein Glanz und eine Glätte, das Wasser klar und blau wie Eis in einem Gletscherspalt. Nirgends Leben; alles regungslos: nur Licht und Blau. Diese tropischen Lichtwüsten sind die einsamsten aller Meere. Es ist, als hätte auf sie nie ein Auge geblickt. Sie ruhen selbstgenügsam in unberührter Herrlichkeit. ›Was schön ist, selig scheint es in ihm selbst.‹
Veracruz, den 15. Dezember 1896.
Heute in der ersten Morgenhelligkeit stieg ganz fern die mexicanische Küste auf, der Häusersaum von Veracruz, und über einem Wolkenstreifen, durchsichtig wie ein Phantom, die weiße Spitze des Orizaba.
Leider haben wir den Zug verfehlt und mußten hier bleiben. Ich habe die Zeit benutzt, um das alte Konquistadoren-Kastell San Juan de Ulua zu besuchen. Es liegt auf einer Insel vor der Hafeneinfahrt; die weißen Bastionen steigen an der Hafenseite steil aus dem Wasser auf; die Barken segeln bis heran an die Kasematten. – Am Meere schützt den Wall ein schmaler Sandsaum, auf dem einige wild zerzauste Kokospalmen im Winde hin und her wehen. Gräber von französischen Soldaten, die hier während des Krieges am Fieber starben, verfallen langsam auf der Düne.
Die Festung dient als Gefängnis. Sie hat einen düsteren Ruf; Diaz soll die Verliese am Meer benutzt haben, um Oppositionspolitiker von der steigenden Flut ertränken zu lassen. Inquisitionsgeschichten entsprechen dem südlichen Sensationsbedürfnis. Die Qualen, die man sieht, sind andrer Art. Hierher verschwindet, was an politischer Opposition nicht der ›Ley Fuga‹ zum Opfer fällt; Verdächtige oder vielleicht bloß Mißliebige mit gemeinen Verbrechern zusammen. Die Gefangenen sind untergebracht in Kasematten, kellerartigen Steingewölben, in die nur durch Schießscharten ein schwacher Lichtschein dringt. Die Luft unten ist dick und feucht. Jeder Raum ist belegt mit einer Herde von Gefangenen; wenn man durchgeht, drängen sie sich beiderseits eng an den Wänden zusammen. Der Lichtmangel hat ihre Haut entfärbt, alle sind verblaßt zu einer Art von Larven; man kann die einzelnen kaum auseinanderkennen; die Reihen aschgrauer Gesichter, deren Augen in den zu tief gewordenen Augenhöhlen unsichtbar sind, gleichen einander wie Totenschädel an Katakombenwänden. Für was für verschiedene Taten oder Worte die einzelnen auch hier sein mögen; jetzt gleichen sich die Gesichter und auch die Gedanken; alle, die noch so viel Kraft haben, strecken die Hände vor und betteln. – Das Gelbe Fieber erlöst jährlich einen starken Prozentsatz.
Auf dem Grund, auf dem die Festung steht, hat Cortez zum ersten Male am 21. April 1519 auf mexicanischem Boden das Kreuz gepflanzt.
Córdoba, den 16. Dezember 1896.
Den Tag in Córdoba am Fuße des Orizaba verbracht. Der Ort liegt bloß sechshundert Meter hoch; an den 17 000 Fuß des Berges sieht man fast von unten bis oben empor. Rings im Umkreis der Stadt, die in Wirklichkeit bloß ein großes Gebirgsdorf ist, liegen Kaffeeplantagen, auf denen zum Schutz der jungen Pflanzen zwischen den Stauden möglichst dicht großblätterige oder immergrüne Bäume: Steineichen, Bananen und Orangen, gepflanzt werden. Das gibt um den Ort einen künstlichen Urwald, durch den Grenzwege stundenweit zwischen blühenden Hecken führen. Brotfrüchte und reife Orangen hängen in den Ästen, die Tulipane strecken ihre schwachduftenden Blüten vor, und ihren Riesenkelch öffnet blutrot die Weihnachtsblume. Durch die Zweige glänzt überall der ungeheure weiße Vulkan; und der ferne Schnee wirkt paradiesisch inmitten des blühenden Tropengartens.
Orizaba, den 17. Dezember 1896.
Orizaba liegt unter dem Orizaba-Vulkan an einem laut zwischen Bananendickicht niederrauschenden Gießbach. Die grüne Schlucht schneidet die Stadt entzwei. Zu beiden Seiten steigen ihre bunten, hellrosa oder lila gestrichenen Häuser empor und zwischen ihnen gotische Kuppeln und Glockentürme, zierlich geschmückt mit leichten Pilastern.
Zur Abendandacht habe ich das mexicanische Weihnachtsmysterium, das Posada-Spiel, in der Kirche der Schmerzensmutter gesehen. Am Hauptaltar stellte eine lebensgroße Papiermasse-Gruppe Marie und Joseph dar, auf der Wanderung gen Bethlehem: Joseph in einem Mantel aus grüner Seide, Maria elegant im Strohhut und Reiseschleier. Sie durchschreiten einen Wald, der durch echte Brotbäume markiert wird. Zuerst spielt die Orgel ein weiches Präludium, zu dem Kinder auf Wasserpfeifen den Gesang von Waldvögeln nachahmen. Dann trägt eine Prozession, der sich die ganze Gemeinde anschließt, eine zweite Darstellung derselben heiligen Personen zur Sakristeitür, die das Tor einer Herberge bedeuten soll. Die Tür ist verschlossen; Maria und Joseph begehren Einlaß, werden aber mit rauhen Worten zurückgewiesen; da fällt die Gemeinde ein und begleitet das Pfeifen noch mit Trommeln und dann mit Schnarren, bis in einem betäubenden Lärm sich schließlich die Herbergstür den Reisenden öffnet. Das ist der Schluß des Weihnachtsmysteriums. In den Zwischenpausen dieser Katzenmusik wird gebetet und gepredigt! Man muß wieder dumpfere, dämpfende Sinne annehmen, um zu begreifen, wie jemand in Andacht solche Erschütterungen ertragen kann.
Abends waren wir auf dem Platz bei der Musik. Ringsherum stehen Hasardbuden für das Volk, in denen um Centavos eine Art von Lotto gespielt wird. Alle Buden waren brechend voll. Die Spielenden saßen gebeugt über ihre Karten an langen, schmalen Holztischen und pointierten mit Maiskörnern. Das Merkwürdigste war ihrer aller Ruhe und Gleichgültigkeit; von Aufregung keine Spur. Aus der Ferne sahen sie aus wie eine Abendklasse von fleißigen Schülern.
Von Orizaba nach Mexico, 18. Dezember 1896.
Die Fahrt die Kordilleren hinauf nach Orizaba übertrifft die Erwartungen. Das Gebirge steigt in Stufen auf. Dazwischen führen Schluchten empor. Wilde Gewässer rauschen talwärts oder stauen sich in der Enge zu grünen Weihern. Weiter unten bedeckt der Wald den Talboden wie ein tiefer Teppich. – Aber die Kraft des Lichts ist zu groß; die Stärke des Eindrucks wirkt brutal auf die Sinne und die Phantasie. Die Schneegipfel versengen die Augen oder verschwimmen in lauter Licht; das Laub steht ohne Farbe – nur Schatten, nur Schwarz – am blendenden Himmel.
Guadalajara,Sprich Gwadalahára 24. Dezember 1896.
Nach zwanzigstündiger Fahrt von Mexico heute abend hier angekommen. So habe ich meinen ersten Eindruck vom Dom nachts bei der Weihnachtsmesse empfangen. Ich weiß noch nicht, wie er bei Tage wirkt; im Kerzenglanz ist sein Inneres das fremdartigste in Mexico; im Stil eine Mischung von Flamboyantgotik und Empire: die Säulen der Schiffe antik mit dorischen Kapitälen, die aber gotische Rippen palmenartig emporsenden. Die Wände und Pfeiler weiß lackiert. Die gotischen Rippen vergoldet. Goldene Kronleuchter an goldenen Ketten leuchten in langen Reihen mit Hunderten von Kerzen die Schiffe entlang. Die Lichter vervielfältigen sich im Golde und blanken Lack zu zahllosen Feuerreflexen: die Kirche gleicht beim zitternden Spiegelschein einem unermeßlich großen Ballsaal, wirkt aber infolge ihrer erhabenen Maße nicht frivol. Der matte Glanz der Lackwände und der Schimmer des Goldes verschmelzen im Kerzenlicht zu zartester Farbigkeit; den ganzen Raum erfüllt ein mildes Leuchten und Wogen, das im Chor allmählich in Nacht verlischt.
Dieser blasse Akkord von Weiß und Gold mit Flammenrosa umspielt heute nacht den gewaltsamen Farbenmißklang der Gemeinde, die, dichtgedrängt vom Hauptportal bis zum Gitter des Hochaltars, blau, schwarz, knallrot, wie ein großes Beet greller Papierblumen das Parkett bedeckt. Die meisten hocken seit Stunden auf dem Boden; die Frauen betend tiefverschleiert und in sich zusammengesunken, die Männer schlafend oder stoisch gleichgültig und unbeweglich ihre Gesichter aufstützend in kupferbraunen Händen, über die das Haar in langen, schwarzen Strähnen niederfällt. Weihrauchdunst, vermischt mit Atemqualm, schwebt in den Kirchenschiffen wie eine bläuliche Lichtwolke zwischen der Menschenmenge und den hoch darüber brennenden Kerzenkronen.
Seit elf Uhr läuten die Weihnachtsglocken. Von allen Kirchen strömen die Klänge, nahe und ferne, dunkle und helle, im Rhythmus majestätisch oder hastig, in der Farbe rein oder wie durch einen Riß getrübt, in ihrer Gesamtheit ein erzenes Dröhnen, ein Brausen wie von vielen Menschenstimmen, durch die offenen Portale zum Dom herein. Das Ohr ermattet in der Klangfülle, die in langgezogenen Riesenwellen, gleichmäßig im mächtigen Takt heranschwellend und wieder abebbend, wie ein Ozean nach dem Sturme brandet. Die Nerven werden durch sie für den Tonzauber der spanischen Weihnachtsmesse vorbereitet.
Um Mitternacht verstummen die Glocken; die Domportale fallen zu, und in der plötzlichen Stille beginnt Musik, kaum hörbar, und doch sanft und voll, heranwallend aus dem dunklen Chor wie aus einer weiten Ferne: Orgelakkorde verschmelzen mit hohen Kinderstimmen und leisem Vogelgezwitscher zum zartesten Nervenzauber; dann fallen Knaben und Frauen leise ein. Anschwellend scheint der Klang jetzt aus den Höhen der Kuppel herabzuschweben, voller und doch noch gedämpft, als ob durch dämmernde Nacht ein Sternensang nahte, Auge und Ohr durch leise Lockungen schmerzhaft-selig spannend. Sanfte Melodien tragen, von Stimmen aus der Höhe gesungen, die Weihnachtsbotschaft durch die weißen Hallen zur morgenländisch bunten Menge hinunter. – Dann, nach diesem Vorspiel, beginnt die Liturgie. Priester in Weiß und Gold treten in den Kerzenglanz des Hochaltars wie in einen Glorienschein. Das tiefe Baß des Offizianten wechselt mit den Frauen- und Knabenstimmen aus der Kuppel; und immer wieder erhebt sich eine einsame Stimme, die Stimme des Menschen, als Antwort auf die Responsorien, die wie Weltenharmonien millionenfach verschlungen rauschen und schwellen.
Ein großer spanischer Dichter, Bécquer, hat in Worte gekleidet, was spanische Gemeinden während der Liebesekstasen dieses mystischen Hochamts fühlen. Der sterbende Meister Perez berührt mit den Fingern die Tasten seiner Orgel: »Ein Ton entschwebte ihren hundert Metallrohren, verbreitete sich erhaben und langsam und verging dann in Nichts, als habe der Wind ihn verweht. Diesem ersten Ton, der einer Stimme glich, die von der Erde zum Himmel stieg, antwortete wie aus der Ferne ein zweiter, zunächst sanft, dann mit rasender Schnelligkeit zu Fluten donnerähnlicher Harmonie anschwellend: die Stimme der Engel, die durch den Weltenraum zur Erde tönte. Man begann ferne Gesänge zu hören von himmlischen Heerscharen, tausend Gesänge zugleich und doch nur einen, wogende Umrankungen einer Wundermelodie, die auf dem Ozean jener geheimnisvollen Chöre wie ein Nebelstreif auf Meereswellen heranschwebte. Und schon sangen einzelne Chöre leiser, verrauschten, verstummten; das Klanggewirr wurde einfacher, nur noch zwei Stimmen waren es, die nebeneinander hinschwebten; und dann blieb nur eine einzige übrig, ein einziger schriller Ton, der wie ein Licht glänzte. Der Priester verneigte sich tief, und über seinem greisen Haupte erschien der Gemeinde, eingehüllt in blauen Weihrauchdampf wie in einen dünnen Schleier, die Hostie. Der schrille Ton, den bis dahin ein Triller hielt, zerging jetzt, wurde voller und immer voller; bis eine Explosion gewaltiger Klänge den Dom erschütterte, so daß in seinen Winkeln die zu dicht gewordene Luft summte und die Glasfenster in ihren Spitzbogen zitterten. Aus jedem Einzelton jenes machtvollen Akkordes brach eine Melodie hervor: die eine nah, die andere fern, die eine glänzend, die andere dumpf, ganz so, als wollten Gewässer und Vögel, Winde und Wälder, Menschen und Engel, Erde und Himmel, jede in ihrer Sprache, die Geburt des Heilandes preisen. Der Priester fühlte, wie seine Hände zitterten: denn der, den sie emporhielten, den Menschen und Erzengel grüßten, war Gott, war sein Gott. Er sah den Himmel offen und berührte in der Hostie des lebendigen Gottes Leib.«
Gewiß sind nicht dieses die Träume, die die Indianermenge hier träumt. Aber was hier diese Musik weckt, die die Seele bis in ihre letzten Tiefen aufwühlt, wer will es sagen? Sind es Bilder von entthronten Göttern oder solche von blutigen und perlenglitzernden Heiligen? Sind es düstere Gefühlsnachklänge orgiastischer und grausamer Riten? Ist es Sehnsucht, die nur durch feierliche Reigen um Menschenopfer auf Bergspitzen befriedigt werden könnte? Speist diese göttliche Musik naive Grausamkeit, tierische Brunst, plumpe und urweltliche oder zarte und märchenhafte Vorstellungen? Die Menge verharrt schweigend und unbeweglich, undifferenziert trotz der bunten Lappen, die die einzelnen grellverschieden auszeichnen; während über ihre Köpfe wegbrausend die Orgel noch einmal den alten, reinen, jungfräulichen, weißen Dom mit Jubel und Sieg erfüllt. Und dazu noch immer, jetzt nur noch ganz leise, die süßen Stimmen der Heiligen Nacht, das Vogelgezwitscher bei den Hirten auf dem Felde und die sanften Engelchöre, die, fern entschwebend, die alte Weihnachtsbotschaft weitertragen: Fürchtet euch nicht! Siehe ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren . . . Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen! Gloria Patri, Laetentur coeli et exsultet terra ante faciem Domini, quoniam venit . . . Als die Domportale auffliegen, strömt in den Weihrauch die Weihnachtsnacht warm und blütenduftend herein.
Guadalajara, 25. Dezember 1896.
Nachmittags hinaus zur indianischen Weihnachtsfeier in einem der Dörfer nahebei; sie besteht in dem Pastores-(Hirten-)Spiel. Ein Mysterium wird im Freien gegeben, ohne Bühne. Die Zuschauer sitzen um die Spieler im Kreise auf der Erde herum. Vier Teufel treten auf; dann der Erzengel Michael, der Greis Winter und Hirten, die zum Jesuskinde gen Bethlehem fahren. Winter ist die komische Person und belustigt das Publikum; die Teufel sind als Indianer ausstaffiert mit Stirnreifen, gewaltigen Federkronen und roten Mänteln; die heiligen Pilger dagegen spanisch in Kniehosen, kurzen, ärmellosen Torero-Jacken und weißen, reichgestickten Hemden. Es wird abwechselnd zu monotoner Musik getanzt und rhythmisch rezitiert: die Verse schildern die Höllenqualen der Ungläubigen, die Tänze bestehen aus langsam schreitenden Reigenbewegungen, die an das Relief von Chichén-Itzá erinnern. Vielleicht ist das Ganze ein altes, vorspanisches Sonnenwendfest der Indianerstämme. Aber jeder Zug des Spiels, wie es jetzt ist, die verschiedene Tracht der Teufel und Hirten, die Betonung der Strafe für die Ungläubigen, die geschickte Umdeutung alter Bräuche, lehren, wie die Kirche sich in Mexico die Herrschaft erkämpft hat; und zugleich, wenn man an die spanische Weihnachtsmesse denkt, mit wieviel einfacheren und naiveren und daher blutfreudigeren und grausameren Vorstellungen sich hier noch ganz natürlich das religiöse Gefühl verbindet. Es ist ein Beispiel der moralischen Eroberung, der Art, wie Glaube und Kultur einer Rasse scheinbar zum Eigentum einer anderen werden.
Guadalajara, 26. Dezember 1896.
Die innere Stadt ist eine Folge von Arkadengängen und Gärten, denen allzu süße, betäubende Düfte entströmen. Rosen und Tuberosen, Narzissen, Orangen und Tulipane blühen jetzt. Inmitten der Blumen und Blütenwolken stehen Türme von fensterlosen, gewaltigen Kirchen; gotische Strebepfeiler treten aus dem kahlen Steinmauerwerk wie Bastionen hervor, so daß man Kanonen dort erwartet, wo groteske Wasserspeier, Drachen, Adler, Ungeheuer, das Steinwerk bekrönen. Überall tragen die Mauern dieser kirchlichen Zwingburgen noch Spuren der früheren Kriege und Revolutionen: Einschläge von Granaten und Gewehrkugeln. Bis auf Diaz herrschten wie im Mittelalter hier fortwährend kleine Fehden. Losada, der sogenannte Banditenkönig, ist noch vor achtzehn Jahren mit einer Brigantenarmee von zehntausend Mann gegen Guadalajara marschiert: ›Dem Gouverneur, der die Barbaren geschlagen hat‹, hat die Stadt vor San Franzisco ein Denkmal gesetzt.
Auf den meisten Plätzen ist in der Mitte ein Brunnen, an dem abends Weiber Wasser holen; ihre Tonkrüge, die sie auf einer Schulter oder an der Hüfte tragen, sind rot und dickbäuchig wie antike Amphoren, bizarr verziert mit Weiß und Gold nach altindianischen Mustern. Diese Frauen sind kräftiger gewachsen und schöner als die von Mexico, von hellerer Haut und lieblicherem Gesichtsausdruck; die ernste und herbe Schwermut der mexicanischen Augen weicht bei ihnen einem halben Lächeln. Ihre Liebe zur Musik ist eine Leidenschaft. Des Nachts hört man überall, aus allen Fernen Gesang und Gitarrenspiel, schwermütige oder schalkhaft-heitere Liebeslieder, von sanften und warmen Frauenstimmen gesungen.
In den Volksvierteln, außerhalb der inneren Stadt, haben die Häuser nur ein Stockwerk und wie in Puebla flache Dächer; Fenster sind nach maurischer Art selten, und die wenigen, die die Straßenmauern durchbrechen, dicht vergittert. Aber innen ziehen sich die Wohnungen der Armen klosterartig um große, mit Orangen und Blumen bepflanzte Höfe. Die Zimmertüren öffnen sich nach dem Hofe zu; und auf diesem spielt sich am Tage das ganze Wirtschaftsleben ab. Materiell leidet der Arme unter seiner Armut hier weniger als im Norden: Sonne und Blumen kann ihm der Reiche nicht rauben; der Ärmste hat eine gewisse Anzahl von angenehmen Empfindungen, also von Luxus, umsonst. Dieses noch mehr als die größere Leichtigkeit, die Bedürfnisse des Lebens zu erlangen, macht die Kluft zwischen Reichen und Armen hier weniger empfindlich als bei uns. In Geld gemessen, wäre sie größer als im Norden. –
Heute nachmittag waren Stierkämpfe; Blut und Blechmusik als Nervenkitzel; aber selbst hierbei sind die Ruhe und Gleichgültigkeit erstaunlich. Einmal entstand unter dem zuschauenden Militär, das auf der Arena saß, eine Prügelei: einige Sergeanten kugelten mit Mannschaften zusammen die Stufen hinunter. Die Leute, die unten saßen, Volk und meistens Männer, rückten nur etwas zur Seite, fast ohne sich umzusehen. Als ein Stier einen Pikador warf und aufspießen wollte, stand das bessere, weißere Publikum, die Schattenseite der Arena, auf; das Volk gegenüber in der Sonne blieb sitzen; die mexicanische Menge reagiert auf Reize ebenso träge wie der einzelne Mexicaner. Erst ganz zuletzt, nachdem zwei ungewöhnlich wilde Stiere mehrmals über die Brüstungen gesprungen waren, wurde die Bewegung auch unter den billigeren Plätzen stärker und lauter. Aber selbst dann war die Aufregung mit der bei englischen oder deutschen Rennen oder mit dem frenetischen Geschrei bei einem Stierkampf in Sevilla oder Madrid nicht zu vergleichen; namentlich fehlen die große, atemlose Stille und das jähe Losbrechen des Jubels, die das tiefbrandende Innenleben der europäischen Menschenmenge bezeugen.
Das Gedränge in den Straßen hier ist größer als selbst in unseren Millionenstädten. Aber still und lautlos wogt die dunkle, schillernde, massenhaft flutende, fremdartige, bunte Menge überallhin: auf die Märkte und Plätze, durch die Gärten und Höfe; in die Kirchen und Theater, in die Kneipen und Spielhöllen, in die entlegenen Straßen und die schlechten Viertel, dort, wo die Häuser nicht mehr vergittert sind, sondern nachts lichtstrahlend offenstehen und ihre ausgekleideten geschminkten Insassen ohne Scheu zeigen. Alles umflutend, alles füllend, fließt der wimmelnde, endlose Menschenstrom. Am Tage bunt: Männer im Farbenkaleidoskop ihrer roten und weißen und regenbogenartig gestreiften Ponchos; juwelenbehangene, reitende, rauchende Weiber, Viehhirten, die in den Pulquekneipen mit silbernen Sporen und silbergestickten Filzsombrero am Schanktisch zu Pferde halten, Frauen, die, sich in den Hüften wiegend, ihren Krug zum Brunnen tragen, Packträger, denen die Lasten an Stirnreifen wie an Diademen hängen und die spät im roten Sonnenstaub durch die Tore der Stadt einziehen. Des Nachts dieselbe stumme Menge schwarz, als bestünde sie aus wallenden Scharen phantastischer Schatten, als sei sie bloß bewegte Dunkelheit: außer wo unter einer einsamen Bogenlampe ein Teil durch das Licht leise hindurchflutet und beständig aus Nacht auftauchend auf Augenblicke farbig wird; oder noch phantastischer draußen bei der Weihnachtskirmes, wenn ein Binsenfeuer im Aufflackern das Gesichtermeer der wimmelnden, weiten, schwach bewegten Volksmassen plötzlich rot erleuchtet. Überall, in der Dunkelheit wie in der Helle, dieselbe Ruhe; gedämpfte Schritte; gedämpfte Gespräche; man ahnt bloß in der fast geräuschlosen Stille das Treten und Flüstern von Tausenden. Die kraftvolle Lautheit, der Reichtum an Einzelphysiognomien, die trotzdem feste Geschlossenheit der nordischen Menge kommen nirgends so stark ins Bewußtsein wie hier, wo man sie mit der stummen, trägen, monotonen und innerlich doch lose gefügten Masse eines tropischen Volkshaufens vergleicht. Diese südliche Menge steht der blonden, nordischen ebensosehr an sozial wertvollen Trieben nach wie der tropische Einzelmensch dem Europäer an Charakter: an Willensstärke und innerem Reichtum; beides erklärt den Sieg des Nordens.
Guadalajara, 27. Dezember 1896.
Früh hat mir G. das Armen- und Waisenhospiz gezeigt, das die Regierung hier unterhält. Die Anstalt dehnt sich einstöckig um siebenundzwanzig mit Blumen und Palmen bepflanzte Arkadenhöfe. Die Reinlichkeit ist musterhaft; die Küche, die Schlafräume, die weißen Betten und Tischtücher, die Kleider der Leute peinlich sauber; und weil alle Türen immer offenstehen, ist nirgends der fade europäische Anstaltsgeruch. Es gibt Krippen für Säuglinge; und Säle, wo Greise ihr Leben beschließen; Schulen, wo Kinder Volksschulbildung erhalten, Lesen, Schreiben und Geographie, und praktische Kurse, in denen Knaben ein Handwerk und Mädchen haushalten und kochen lernen. Die Pflegerinnen sind weltliche Diakonissinnen in sauberen, einfachen Kleidern, die geräuschlos und pünktlich ihre Pflicht tun. Durch diese Anstalt werden über fünfhundert Arme versorgt, Findlinge aufgezogen, Bettler von der Straße gerettet . . . und heute morgen stand in der Zeitung folgendes: »Ley Fuga: Am Ende der vorigen Woche wurden durch einige Feldgendarmen an einem Punkte, der Cerro Alto (Hoher Berg) heißt, zwei gut beleumundete Köhler festgenommen, während sie gerade Holzkohle brannten. Kaum waren sie an den Fuß des Berges angekommen, als der eine von beiden ohne weitere Umstände erschossen wurde. Der andere floh, als er das grauenhafte Schicksal sah, das seiner wartete, in der Hoffnung, sich vor dem sicheren Tode zu retten. Dieselben Gendarmen arretierten in seinem Hause in Ixtlahuacan del Rio den José Rodriguez, der nur dadurch vom Tode gerettet wurde, daß er telegraphisch vom Distriktsrichter dieser Stadt einen Strafaufschubbefehl erlangte. – Die Festnahme der Köhler soll ihren einzigen Grund in einer böswilligen Denunziation durch Knechte der Hazienda von Astillero und Ocotengo gehabt haben, die daran interessiert waren, daß niemand ihnen im Brennen von Holzkohle Konkurrenz mache.« – Man erstaunt in Mexico immer wieder über den Kontrast zwischen der Art der Erfolge, die die Diazregierung zeitigt, und der Gemeinheit der Mittel, durch die sie sich erhält. Das Befremden, das die Ley-Fuga-Exekutionen uns Europäern auch in anderen, hierzulande nicht als außerordentlich empfundenen Fällen verursachen, ist kaum zu überwinden. Seitdem der alte, notwendige Selbsterhaltungsinstinkt der Gesellschaft, kraft dem sie den Einzelnen dem Ganzen auch gegen sein ›Recht‹, gegen ›Billigkeit‹ und ›Humanität‹ opfert, durch Rousseau zu etwas, dessen man sich schämt, geworden ist, fühlen wir Europäer uns selber fast verletzt, wenn jenes Prinzip einmal ohne Verhüllung hervortritt, wie hier, wo noch die Geburtswehen einer Gesellschaft Anstandsrücksichten nicht erlauben.