
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
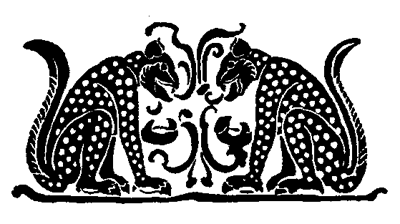
Mexico, November 1896.
Die ersten Tage habe ich es dem Zufall überlassen, mich zu führen. Aus Gelegenheitseindrücken bildet sich langsam ein Instinkt für das, was am neuen Lande dem eigenen Ich von Wert sein kann, für die Art der lebendigen Berührung, die zwischen beiden möglich ist.
Das Auge empfindet zuerst von der Stadt nur die Gewalt der Farben und des tropischen Lichts in der Höhenklarheit. Daneben verschwindet die Eintönigkeit des Stadtplans, den noch die vizeköniglich spanische Beamtenschaft im papierenen Stil geradwinkelig reguliert hat; und auch die nordamerikanische Häßlichkeit der Telegraphenstangen auf den Trottoirs und der Trambahnen, die hier nicht nur den Verkehr des Publikums vermitteln, sondern es unternommen haben, in besonderen, schwarz gestrichenen Wagen zu billigen Preisen Leichen zu befördern. Die Menschenmenge, die alles farbig umflutet, die helle, rosenrote oder zartblaue Tünche der Häuser, um die das Licht beständig vibriert, die fernen Gletscher mit ihren bald mächtiger, bald nur blaß leuchtenden Firnen, und darüber ein Himmel, dessen Ton und Tiefe fortwährend wechseln, schaffen eine Bewegung von Farben und Reflexen, die wie ein Spiel das Auge beschäftigt.
Diese Macht des Lichts könnte an den Gebäuden die Architektur fast ersetzen; sie gliedern sich selbst durch den Färbungsgegensatz ihrer oberen Teile zu den unteren. Unten grenzen die Schatten, weil wenig indirektes Licht sie trifft, an stechend Hellem tiefschwarz; oben, wie mit der wachsenden Höhe Reflexe und diffuse Helligkeit sich mehren, zerfließen sie zu durchsichtiger Farbigkeit. So bauen sich nach oben zu die Töne immer unbestimmter und zarter auf; fast Immaterielles ruht auf Massivem. Die Betonung des Baugerippes, die im blassen nordischen Tag des Architekten Hauptsorge ist, weil dort nichts anderes den Aufbau verdeutlichen kann, tritt hinter der Kunst zurück, die Lichtfülle in ihrem natürlichen Spiel zu unterstützen. Der Lichtton wird an Stelle von Linie und Masse zum Ausdrucksmittel des Architekten, die Architektur malerisch statt konstruktiv.
Die Möglichkeiten, die die einzig umfangreiche Skala von Brechungstönen des tropischen Höhenlichts bietet, haben die spanisch-mexicanischen Architekten mit dem Raffinement der Dekadenz ausgenutzt. An den Kirchen, die ihre Hauptaufgabe waren, genießt man dank ihrer Kunst das Licht, das auf den Gebirgen so machtvoll wandelt, in zarten und reizenden Harmonien, für die diese Lichtvirtuosen das Auge noch empfindlicher machen durch den Gegensatz, in den sie das luftige Farbengewebe ihrer Ornamentik zum kräftigen Hell und Dunkel von schmucklosen Flächen bringen. Die Gotik, die sich, wahrscheinlich aus Routine, weil konstruktive Probleme gleichgültig ließen, bis in dieses Jahrhundert als Norm des Bauorganismus im Entwurf des Höhen- und Grundrisses, der Gewölbe und der Stützen gehalten hat, bietet an den kahlgelassenen Seitenmauern und inneren Gewölben Flächen, auf denen Licht und Schatten in großen Massen ruhig abwechseln. Im Gegensatz zu diesen breiten Steinflächen tritt an einem willkürlich begrenzten Ausschnitt der Fassade und in den Innenkapellen die Ornamentik hervor; und diese bevorzugt die wirren Formen des späten Barock. Hier verschwindet der Bauorganismus unter Prunkverzierungen, nicht, wie bei Bach ein Thema in die Polyphonie einer Fuge aufgeht, sondern spurlos, wie die Melodie von einer Koloratur unterbrochen wird; und der phantastische Reichtum dieses Beiwerks legt vom Geiste der Kirche um den Ausgang der Gegenreformation Zeugnis ab. Leisten und Säulchen, Girlanden und Linienverschlingungen steigen, von unten nach oben immer zahlreicher, über den Portalen auf. Steinknaufe hängen reich ziseliert in Reihen wie Stalaktiten herunter. Dazwischen aber blicken Engelsköpfe lächelnd empor und öffnen sich Nischen, in denen verzückte Heilige himmelwärts schauen. Zweideutige Attribute, die ebensogut Symbole der weltlichen wie der himmlischen Liebe sein könnten, mischen sich in das nervöse Gewirr der Verzierungen; Tauben und Herzen, Amoretten und Rosen überziehen die Fassade im Netze der Arabesken, fein gemeißelt und im Lichte fast durchsichtig wie die Spitzenschleier, die zur selben Zeit in Mecheln und Venedig für Kurtisanenschleppen und Prälatengewänder geklöppelt wurden. Fliesenhöfe, die als Reflektoren wirken, verstärken die Kraft des auf die Fassade fallenden Lichtes. Die Bauglieder und die Zieraten sind mit elfenbeinfarbenem Stuck überzogen: der Akkord wechselt mit den Tageszeiten vom Nebeneinander von leuchtendem Weiß und sammetartigem Schwarz zum zartesten Verschwimmen von blaßgelben in bläuliche Töne. – Drinnen überschüttet dieselbe Üppigkeit an Schnörkeln und Emblemen, an Blumen und Flügelfiguren wie aus Füllhörnern die Kapellen und die Altäre: aber hier vergoldet. Mit der wachsenden Tageshelligkeit geht der kühle und gleichmäßige Schein des alten Goldes in metallisch blanke, gelbe und falbrote Reflexe über. – Und diese raffinierte Kleinpracht, die noch das Parfüm des Liebes- und Hoflebens der großen, verzärtelten Kirchenfürsten des achtzehnten Jahrhunderts bewahrt, wird von gotischen Bauformen kraftvoll und altväterisch getragen. Wie ein Rahmen umgeben ihre breiten Licht- und Schattenflächen das verzwickte Gewirr von Reflexen und Halbtönen. Nicht der Flamboyant- und nicht der Tudor-Stil, sondern diese subtile und fast pervers reizende Zwitterkunst ist die letzte Dekadenz des großen nordischen Stils gewesen. – Das Bild, das ein alter Künstler Vilalpando vom Innern der Bethlehemiterkirche gemalt hat, bezeugt, wie raffiniert die Zeitgenossen die blitzende Unruhe des Goldes inmitten der großen und ernsten gotischen Steinformen empfanden. Es war eine Kunst für farbensatte und müde Augen, verwandt mit der von Coello und Velasquez.
Mexico, den 13. November 1896.
Wir sind heute morgen zum Blumenmarkt am Vigakanal hinausgefahren. Hier legen die Landleute an, die auf dem Wasserwege ihr Gemüse und ihre Blumen zur Stadt bringen; die schwimmenden Gärten, die Mexico mit Blumen versorgen, die Chinampas, liegen draußen im See, der zu Cortez' Zeiten die Stadt zur Insel machte, jetzt aber zum größten Teil trockengelegt ist. Man fährt auf der Viga in flachen, mit Sonnendächern versehenen Gondeln zu ihnen hinaus. Eine Weidenallee läuft am Kanal entlang; jenseits sind grüne Wiesen und die zerzackten Züge des Hochgebirges. Das Wasser steht bis an den Rand der Uferböschungen, von alten niedrigen Steinbrücken überspannt, an denen noch Reste von spanischen Wappen stehen; beim Durchfahren klappt man das Schutzdach nieder und streckt sich lang hin, um nicht anzustoßen. Bananendickichte, die die Hütten der Eingeborenen umgeben, beschatten bei den Dörfern, die am Wege liegen, den Wasserspiegel.
Die Chinampas waren ursprünglich bewegliche, mit Erde bedeckte Flöße: der ganze Garten fuhr morgens zu Markte; jetzt liegen sie auf dem Boden des Sees fest verankert. Schmale, labyrinthartig sich kreuzende Kanäle trennen die kleinen Schlammparzellen. Auf jedem Stückchen wird in winzigen Beeten nebeneinander verschiedenes buntes Kraut gebaut; und am Wasserrande wachsen wild Veilchen, Iris und roter Mohn.
Die Blumenliebe ist in Mexico fast so groß wie in Japan; selbst die Armen schmücken ihre Kammern mit Blumen und streuen Blüten ihren Schutzheiligen. Die Chinampas sind vielleicht zum Teil aus diesem Grunde das Ausflugsziel des niederen Volkes von Mexico geworden. Im Dörfchen Santa Anita legen die Gesellschaften an. Der Ort besteht zum größten Teile aus Pulque-Wirtschaften und offenen Rasthütten aus Bambus unter Palmen und Nopalsträuchern. Hier wird tagsüber Ball gespielt und Pulque, das fade, seimige Nationalgetränk, gezecht. Des Abends aber, in der Dunkelheit, fahren die Boote zu Dutzenden, mit Lampions behängt, den Kanal hinunter zur Stadt zurück. Männer lachen in den Gondeln oder singen mit weicher, tiefer Stimme schwermütige Lieder, und Mädchen mit hellen Blumenkränzen im Haar lehnen sich über den Bootsrand hinaus und lassen die Hand in den lauen Wellen nachschleifen.
Mexico, den 22. November 1896.
Was hier interessiert, ist der tropische Mensch und die tropische Menschengesellschaft: die Psychologie des einzelnen und des Volksganzen in einem heißen Lande; kulturell, auch das Widerspiel der gegenseitigen Veränderung und Anpassung zwischen einem Volk und einer fremden, ihm aus allen Stücken aufgezwungenen Zivilisation; und schließlich das Rassenproblem, die Mischrasse.
Heute nachmittag beim Korso habe ich mir die Frauen der Gesellschaft angesehen. Der Typus ist nicht hübsch, keine Figur und kein Teint; aber viel Schminke, die Kleider bunt, und Hüte, die in Paris nur Kokotten tragen. Man fühlt, daß hier die, die etwas gelten wollen, aufzufallen suchen; sie scheinen zu fürchten, daß man sie übersehen könnte. Was für Brillanten ausgegeben wird, ist unglaublich, und auch die Art der Anschaffung; ein großer Juwelier in der San-Francisco-Straße ist an den Abzahlungsgeschäften, die er mit Frauen aus der Gesellschaft macht, reich geworden. – Die Rasse ist bei diesen oberen Vierhundert noch ziemlich rein, aber überzüchtet. Die Männer werden früh schwerfällig: kleine Knochen und viel Fett; als junge Herren sind sie schmächtig und parfümiert.
Im Volk überwiegt indianisches Blut; reines und gemischtes. Die reinen Indianer gleichen mit ihren großen vorstehenden Backenknochen dunklen Mongolen. Bei den Mischlingen, namentlich bei den Frauen, ist der Gesichtsschnitt oft vornehm, fast römisch; eine kleine, edel gebogene Adlernase, hochgewölbte Augenbrauen und unter langen Wimpern dunkle Augen; die Haut ist ambrafarben und fest und trocken wie schwere Seide; der Körper schlank und von zierlichen Gliedmaßen.
Der Mensch ist hier kräftig, aber nicht gesund. – Ein Packträger läuft dreiviertel Stunden lang einem fahrenden Wagen nach; die Lastenträger im Gebirge leisten fast Wunderbares; Kraft und Gewandtheit sind auch die Eigenschaften, die das Nationalspiel, Peloto, vor allem erfordert. Und doch sind Blutarme und Lungenkranke abnorm zahlreich. In der Hauptstadt werden neun Zehntel der Kinder kein Jahr alt. Der Weltreisende einer nordamerikanischen Lebertranfabrik sagt mir, daß er nirgends bessere Geschäfte mache als in Mexico; in einem Jahre eine Absatzsteigerung von fünfundzwanzig Prozent. – Man muß bedenken, daß das tropische Klima in jedem Individuum gleich in den ersten Lebensjahren wie in einer Treibhauspflanze alle Kräfte und Triebe mit der größten Gewalt entwickelt und dadurch schnell erschöpft. Jede neue Generation fängt mit einem geringeren Grundkapital an, weil mehr verbraucht als ersetzt worden ist. Die Folge ist eine Art von zugleich angestammter und in jedem einzelnen wieder neuentwickelter physiologischer Trägheit, die mit dem Einfluß des Klimas wächst, in den heißen Strichen an der Küste am stärksten sein soll. Der Körper widersteht den Krankheitskeimen schwerer, weil die Reaktion dagegen, wenn sie eindringen, ausbleibt oder zu schwach ist.
Psychologisch entspricht diesem Körperzustand eine Schwächung des Willens und der Nervenempfindlichkeit. Die Freiheit von Nervosität, die jeder unentwickelten Rasse eigen ist, steigert sich bis zur Stumpfheit, selbst dem Schmerz gegenüber. B. hat, wie er mir sagt, vor einigen Tagen einen Arbeiter, der auf einem Rancho verunglückt war, mit zerschlagenen Gliedern vierundzwanzig Stunden auf einem federlosen Karren zum nächsten Arzt über Land gefahren; und der Mann hat dabei weder geklagt noch die Besinnung verloren. Kranke lassen hier lautlos die schmerzhaftesten chirurgischen Eingriffe ohne Chloroform an sich vollziehen und werden dabei nicht einmal ohnmächtig. Sie leiden weniger als Europäer und bleiben bei Besinnung.
Ich glaube, daß diese Trägheit des Nervensystems eine von den Tatsachen ist, die die Psychologie des Mexicaners am meisten beeinflussen; man kann ihre modifizierende Wirkung durch alle Gebiete des individuellen und des gesellschaftlichen Lebens verfolgen, von dem Geschmack der Speisen und den Farben der Kleidung an bis zu den Bedingungen, unter denen hier die menschliche Gesellschaft besteht, und bis zu der Art von Symbolen, die in Mexico von der Kunst und den Religionen zu allen Zeiten bevorzugt worden sind. Obgleich es wahrscheinlich innerlichere Unterschiede gibt, erscheint mir diese Nerventrägheit vorläufig wie ein Leitmotiv, das, immer wieder transponiert, am auffälligsten die Verschiedenheit des tropischen vom europäischen Menschen zugleich ausdrückt und begründet.
Die Sinne des Mexicaners vibrieren unter Eindrücken schwächer und pflanzen Empfindungen gedämpfter fort als die des Europäers; seine Kleider sind grell, seine Gebärden eindringlich, das Essen besteht aus faden Abkochungen von Bohnen oder Mais mit den schärfsten Knoblauch- oder Pfefferzutaten. Zwischen den verschiedenen Gesellschaftsschichten bemerkt man in der Nervenstumpfheit keinen Unterschied. Der Opernzettel zeigt nicht einfach an, daß die und die Oper aufgeführt werden soll, sondern heute wird la grandiosa opera in cuatro actos del sublime maëstro Billini ›I Puritani‹ gegeben. Das ist für die oberen Klassen. Für die unteren zeugen die Reklamen, die Namen und Schilder der Butiken und Kneipen. Diese wenden sich nicht wie in Nordamerika an den Verstand und den Geldbeutel – das würde den Mexicaner nicht schnell genug packen –, sondern vertrauen auf Buntheit der Farben und auf pomphafte Inschriften, in denen die Liebe abwechselnd mit zweideutigen und sensationell aufgedonnerten Literaturreminiszenzen zum Scharfmachen dient. Eine fürchterlich bunte und schmutzige Spelunke, in der, Gott weiß, was getrieben wird, heißt »al Recreo de Fausto«: zu Faustens Erholung; draußen ist Gretchen als Gounodsche Primadonna abgemalt, wie sie Faust, einen süßlich blonden Jüngling, dessen Vollbart üppig gelockt ist, hingegeben umarmt; beide Figuren überlebensgroß und in stechenden Farben. Der symbolische Sinn dieser Freske ist nicht mißzuverstehen.
Die Heftigkeit der Erschütterungen, denen die Sinne beständig künstlich und natürlich hier ausgesetzt sind, vor allem die Gewalt des Lichts, verstärken noch die Wirkungen der immanenten Trägheit, indem sie die Sinne fortgesetzt noch mehr ermüden. In ihrer Abgespanntheit lernen die Nerven alle normalen Eindrücke mißachten und wenden sich nur noch solchen zu, die durch Ungewohntes ihre Aufmerksamkeit reizen. Anormal sind aber nicht nur ungewöhnlich starke, sondern auch ungewöhnlich leise Eindrücke. So mag es sich erklären, daß man hier nebeneinander Dinge findet, die auf die beiden Extreme der Sinnenempfindlichkeit berechnet scheinen: auf die äußerste Reizbarkeit der Nerven, die nur im Wahrnehmen der feinsten Schattierungen des Tones, der Farbe und des Lichtes noch Genüge findet, ebenso wie auf die äußerste Stumpfheit der Empfindung, die durch die heftigsten und rohesten Stöße erweckt werden will; die Zwillingserscheinungen der Dekadenz treten hier als Folgen des Klimas und des Sonnenlichts ein. Die feinorganisierten Naturen lassen sich nur durch die ungewohnten ganz zarten und leisen Berührungen noch reizen, während die gröberen, widerstandsfähigeren eine Steigerung der gewohnten Eindrücke verlangen; es ist, wie in der Musik der Geschmack, je nachdem, von Wagner zu Mascagni oder zu Mozart, wenn nicht zu Bizet übergeht. Welches bevorzugt wird, entscheidet vielleicht nicht immer einmal die psychologische Grundanlage, sondern wie beim Kulturdekadenten oft die Stimmung, der momentane Grad der Ermattung oder auch ganz einfach die Qualität des Eindrucks, wenn nur seine Stärke anormal ist.
In der Kunst, der Urkunde, die von den Sinnen eines Volkes immer am unzweideutigsten Rechenschaft gibt, erscheint diese Nerventrägheit aktiv als Ursache dürftiger Naturbeobachtung und passiv als Grund für die Art der bevorzugten Reize. – Die mexicanischen Urrassen sind trotz ihrer Technik nie dazu gelangt, den menschlichen Körper proportioniert und organisch zu bilden – der Begriff des Organismus scheint ihnen gefehlt zu haben –, und von den Späteren habe ich nicht eine Landschaft gesehen, die das Land hier charakteristisch erfaßt; mit Palmen und Bergen ist alles getan. – Die Wirkungsmittel entsprechen nur in den vorspanischen Ornamenten einem normalen Empfinden; bei diesen tritt die Nervenstumpfheit weniger zutage; wahrscheinlich weil Muster nicht durch Farbe oder Lichtwirkungen reizen, sondern wie der Anblick von Tanzbewegungen Genuß durch eine rhythmisch raffinierte Gymnastik der Augenmuskeln verschaffen, also auf denjenigen Bestandteil des Gesichtssinnes berechnet sind, dessen Empfindungsvermögen von der Sonnenstärke am wenigsten beeinflußt werden konnte; sie sind in den Linien und Umrissen zart und zugleich mächtig durch die sicher berechnete Flächenwirkung; insofern psychologisch mit denen Japans verwandt; die Phantastik, in ein rhythmisch geregeltes Spiel von Linien und Flecken aufgelöst, hört auf, den Geist zu verwirren, weil sich sein Vorstellungsinhalt nach den Gesetzen des Auges ordnet. – Alles andre in der mexicanischen Kunst wendet sich an die beiden Pole der dekadenten Empfindlichkeit, ist überleise oder überlaut. Die architektonischen Ornamente, die ja nicht Muster sind, sondern Mittel, um das Licht zu brechen, gehen in spanischer Zeit auf Reize allerfeinster und zartester Art; die Malerei verliert sich, seitdem die ersten Eroberer sie eingeführt haben, immer mehr in wüste und abgeschmackte Farbendissonanzen. Nichts gibt in den Mangel an normaler Sinnenfeinheit des Mexicaners einen klareren Einblick als die Geschichte der Malerei hier, wie sie die Bildersammlung der Akademie lehrt. Die frühesten Werke, die des siebzehnten Jahrhunderts, sind gut, weil sie noch europäisch und wenig selbständig sind; und unter diesen die besten die des Luis Juarez, dessen naiv treuherzige und dabei in spanische Farbenglut gekleidete Darstellungen durch den Zauber, den ihr Zwiespalt ausübt, an die Arbeiten erinnern, die Florentiner Quattrocentisten spät unter des Sarto Einfluß schufen. Schon Miguel Cabrera im achtzehnten Jahrhundert, ein Vollblutindianer, der hier als Hauptmeister gilt und zwischen Murillo und Guido Reni hin- und herschwankt, hat das koloristische Gefühl fast verloren, ist akademisch, ohne zivilisiert zu sein. Die Werke des neunzehnten Jahrhunderts sind nicht zu beschreiben; in der ersten Hälfte in den Farben düsseldorfisch platt und zusammenhanglos; später frei nach Delaroche historisch-realistisch und kraß: Cortez vor Montezuma, die Folterung Guatemocs, Pinselpatriotismus in Farbendissonanzen. Eine des Velasquez würdige Doña Maria de Austria von Carreno und ein »Ave, gratia plena!« von Overbeck, ein Jugendwerk von bestrickender Frische und Anmut, wiegen den ganzen mexicanischen Tand der Galerie bis auf einiges von Juarez auf.
Wie baut sich auf solchen Sinnen die Phantasie auf? – Bis zu einem gewissen Grade lehrt auch dieses die Kunst. Man sieht gleich, daß die altmexicanischen Künstler, wo sie zur Phantasie reden wollen, die Reize so stark und so zahlreich wie möglich wählen; Grimasse und Wiederholung sind ihre beliebtesten Ausdrucksmittel; man darf daraus schließen, daß der natürliche und einmalige Ausdruck für die, zu denen geredet werden sollte, nicht stark genug war. Infolgedessen sind die mythologischen Bildwerke, wo man sie nicht als Ornamente, sondern als Schilderungen anschauen muß, so überladen, solche Gewirre von Menschen- und Tierleibern, von symbolischen Zeichen und einzelnen Gliedmaßen, daß, was schrecklich und erhaben gemeint war, nur grotesk oder als Parodie wirkt. Die Verwandtschaft zwischen diesen Werken und den modernen mexicanischen Heiligen- und Märtyrerbildern, die durch ein möglichst reiches Gemisch von scheußlichen Wunden und billigem Flitter zu erschüttern versuchen, beweist, daß hier ein Rassenbedürfnis vorliegt. Man fühlt, daß die Unempfindlichkeit gegen Phantasievorstellungen und ihre Dissonanzen ebenso groß ist wie die gegen Farben und Farbenkontraste und wahrscheinlich aus demselben Grunde, das heißt, weil die Phantasiegebilde ebenso wie die Bilder der Außenwelt nur blaß ins Bewußtsein dringen oder, richtiger, nur widerwillig von trägen Nerven geschaffen werden. – Man möchte von der Kunst auf diejenigen Gebiete der Phantasie schließen, welche von den Sinnen und der Außenwelt unabhängiger als die Kunst sind. Ich fühle selbst, wie unsicher jeder Versuch ist, dieses ausschließlich innere Leben zu erraten. Am deutlichsten noch müßte den Einfluß der Nerventrägheit auf diese rein innere Phantasie das zeigen, was der Mann der Frau und dem Tode gegenüber empfindet, weil die Liebe und die Todesfurcht von der Phantasie, wenn sie entwickelt ist, am meisten abhängig sind und daher am hellsten das innere Gesicht der Seele beleuchten. Doch wie in Ermangelung einer modernen urwüchsigen, von Europa und Bourget unbeeinflußten Literatur über dieses Intimste in so kurzer Zeit mehr als Fragmente sammeln? Mir scheint es, als bringe der Mexicaner der Frau mehr Leidenschaft als Liebe, also mehr Instinkt als Phantasie entgegen. Er vergleicht in seinen Liebesliedern wie der Orientale ihre Schönheit eher mit äußeren, sinnlichen Dingen, als daß er sich wie der Nordeuropäer an Seelenreichtum, den er ihr andichtet, zu berauschen suchte. Und dem Tode gegenüber sind ebenso die Roheit wie die Gleichgültigkeit überraschend. Die mit Leichen besetzten Pferdebahnwagen stimmen zum übrigen. Neulich spielte O., ein bekannter Weltmann aus guter Familie, während wir wußten, daß seine Frau im Sterben liege, eine Partie Peloto zu Ende; niemand schien daran Anstoß zu nehmen. Nicht selten kommt es vor, daß im Volk eine Mutter sich beim Totenmahl ihres Kindes betrinkt. Und die Regierung hat auf dem Kirchhof von San Fernando dem Präsidenten Juarez unmittelbar neben den Gräbern seiner Opfer, der mit Maximilian erschossenen Generale Mejía und Miramón, ein Prunkgrabmal errichten lassen. Ein neues Regime würde bei uns eine solche Taktlosigkeit scheuen. Hier hat sie niemand bemerkt. – Vielleicht folgt auch der Mangel an Humor aus der Armut des Innenlebens; Phantasievorstellungen fehlen, die zum bittersüßen Verschmelzen mit der Wirklichkeit auftauchen.
Es ist leicht einzusehen, wie der Wille, ganz abgesehen von seiner direkten Schwächung durch das Klima, von dieser Stumpfheit der Sinne und der Phantasie sowohl in der Motivierung seines äußeren Handelns wie in seinem inneren Selbstbewußtsein beeinflußt werden muß.
Wunschlosigkeit und Leidenschaft wechseln hier jäh, weil nur wenige Ziele im Bewußtsein bis zu der Deutlichkeit anwachsen, daß sie wirklich gewünscht werden; diese dann aber in der Seele keine oder nur wenige Rivalen in Gestalt von anderen Zielen finden, die ihnen das Gleichgewicht halten könnten; fast die ganze Kraft des Wollens fließt jedesmal einem Wunsche zu. Die größere Leidenschaftlichkeit beruht nicht auf stärkeren Trieben, sondern auf einem geminderten inneren Gleichgewicht infolge der geringen Zahl von Vorstellungen. Aber dieses heftige Wünschen überdauert nicht lange den Eindruck, der es hervorgerufen hat; es schwindet schnell, als ob Gedächtnis und Phantasie zu träge wären, um die Vorstellung in ihrer ersten Deutlichkeit festzuhalten. – Und aus denselben Gründen richtet sich das Wünschen in den meisten Fällen auf Vorteile in der unmittelbaren Zukunft; entfernte Ziele sind am wenigsten geeignet, zum deutlichen Bewußtsein durchzudringen, weil ihr sinnlicher Eindruck gewöhnlich nur schwach ist und weil Phantasie gebraucht wird, um sie deutlich zu erfassen. Während der Mexicaner sich also nahen Befriedigungen zügellos hingibt, lassen ihn entfernte Vorteile meistens kalt. Typisch für diese Willensanlage ist sein Verhalten zum Gelde. Um geringe Lohnerhöhungen laufen Dienstboten, die zwanzig Jahre in einer Familie gedient haben, ohne Kündigung plötzlich davon. Ein Politiker, der zur Macht gelangt, versucht, wenn die Verhältnisse es gestatten, das heißt seit achtzig Jahren fast immer, möglichst schnell möglichst viel zusammenzuerpressen, obgleich er weiß, daß er sich dadurch sogar hier eine dauernde Karriere abschneidet; der vorige Finanzminister konnte in acht Jahren bei achttausend Talern Gehalt sechs Millionen beiseite bringen, und der vorige Präsident hat die Barbestände der staatlich garantierten Sparkassenbank so lange als Taschengeld verwendet, bis das Institut verkrachte. Studenten, die keine Aussicht hatten, bald als Politiker durchzudringen, pflegten, wenn sie körperlich und geistig gut veranlagt waren, die Brigantenlaufbahn einzuschlagen, und erreichten so ebenso schnell wie die Politiker die Macht, eine Zeitlang das Publikum zu plündern. Folgerichtig ist das Hasardspiel in jeder Gestalt eine Nationalleidenschaft, vom Bakkarat bis zum Lotto hinab. Und doch zeigt der Durchschnittsmexicaner eine große Gleichgültigkeit gegen jeden Verdienst, der über das hinausgeht, was er in der nächsten Zeit verwenden kann. Ihm fehlt zum Kapitalisten, umgekehrt wie dem Juden, das Ausharren im Wollen, eine gewisse Fähigkeit der Selbstverleugnung und die vorweggenießende Phantasie.
Das Selbstbewußtsein leidet unter der Schwäche der inneren Vorstellungswelt dadurch, daß, auch wenn der Instinkt noch intakt ist, die Persönlichkeit sich doch selber schwächer sieht, schwächer empfindet. Eine von den Folgen ist, daß die Eitelkeit häufiger als der Stolz zum Motiv des Wollens wird. Denn der Stolz ist der zum Genuß gewordene Abschluß der Persönlichkeit gegen die Außenwelt, die Eitelkeit die zum Bedürfnis gewordene Bejahung und Unterstützung der Persönlichkeit durch die Außenwelt. Während dem Stolzen als Motive oder als Lohn seiner Handlungen seine selbstgeschaffenen Vorstellungen und Phantasiegebilde genügen, bedarf der Eitle der Reize von außen, der Belohnung und Bewunderung durch andere; sein Ich hat Krücken nötig. N., ein europäischer Arzt, der die Feldzüge Maximilians mitgemacht hat, hält daher trotz körperlicher Ausdauer und Disziplin vom mexicanischen Soldaten nichts; er sei zu schwer ins Feuer zu bringen, aber nicht aus Feigheit, sondern weil der Tod im Gliede, wie er meint, ihm keinen Ruhm bringe. Derselbe Mann, der im Gliede kneift, ist einzeln in der Erregung oder als Brigant, oder wenn er zum Tode verurteilt ist und erschossen wird, tapfer. Wenn es geht, hält er vor dem Sandhaufen noch eine Ansprache an die Exekutionsmannschaft. Er stellt sich dann vor, daß er als Held fällt, und vergißt über die momentane Befriedigung seiner Eitelkeit sogar halb den Tod.
*
Was der einzelne will, und wie stark er es will, das hauptsächlich bestimmt den Aufbau der Gesellschaft und ihre Seele. Da der Mexicaner andres und dieses andre anders als der Europäer will, so sind auch Körper und Seele der mexicanischen Gesellschaft von denen einer europäischen Volksgesamtheit verschieden.
Dem Körper fehlt, was die Grundlage der modern-europäischen Gesellschaftsform ist, die wirtschaftliche Einheit, das heißt der Stamm gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen und der Umlauf von Wert- und Subsistenzmitteln, der wie die Blutzirkulation ein Volk zu einer Art von materiellem Organismus verbindet. Der Mexicaner läßt sein Leben nicht durch den weitsichtigen Egoismus bestimmen, der den Nordeuropäer antreibt, nach ruhigem und sicherem Erwerb zu streben, bei stetiger Arbeit auszuharren, seine Solidarität mit andren zu erkennen und der Achtung den Vorzug vor dem Ruhme zu geben. Weil also der Einheimische mit wenigen Ausnahmen weder den Wunsch noch die Gabe besitzt, einen komplizierten, auf langsamen und dauernden Erwerb gerichteten Betrieb zu leiten, liegen der Handel im großen und alle wichtigen Unternehmungen in der Hand von Ausländern, die mit ihrer eigenen Heimat in näherer wirtschaftlicher Verbindung als mit Mexico stehen. So fließt der größte Teil des Kapitals, das sich aus den Hilfsquellen des Landes bildet, nach außen ab, ohne daß das rasche Wachsen der Faktoren, die Reichtum schaffen, in irgendwelchem Verhältnis stünde zu der überaus langsam steigenden Kraft der Einheimischen, einen Teil dieses Reichtums für sich zu behalten; es ist fast, als ob die mexicanische Gesellschaft an den auf ihrem Gebiet sich abspielenden wirtschaftlichen Vorgängen gar nicht beteiligt wäre; Mexico ist darin noch heute typisch ein Kolonialland.
Aber der Mangel an einheimischem Kapital hat auch den Mangel an einheimischen Fabriken zur Folge; und da mexicanische Fabrikate fast fehlen, so tauschen entfernte Provinzen weniger Waren untereinander als mit Europa oder den Vereinigten Staaten aus; das Land fällt wirtschaftlich auseinander. Die besseren inneren Verbindungen allein können daran wenig ändern; die nordamerikanischen Einwanderer, die anfangen, Großbetriebe innerhalb des Landes hervorzurufen und für sich Eisenbahnen und Telegraphen, Bergwerke und Fabriken zu gründen, sitzen in Mexico nicht als Mitglieder der Volksgemeinschaft, sondern als mächtige mit allen Hilfsmitteln des neunzehnten Jahrhunderts ihre eigene Bereicherung verfolgende Einzelmenschen; sie sind eine Art von wirtschaftlichen Übermenschen inmitten einer Gesamtheit, die in ihrer Struktur vielleicht am meisten den Volkskörpern unseres Mittelalters gleicht; eine innere Einheit geben sie dem Volksganzen, das sie umspannen, vorläufig nicht. So besitzt das Wirtschaftliche für die Erkenntnis des Innenlebens der mexicanischen Gesellschaft eigentlich nur negativen Wert, und es sind fast ausschließlich Bande nicht naturalökonomischer, sondern ideeller und gewaltsamer Art, auf die die Aufmerksamkeit sich richten muß, um den Bau und den Geist des mexicanischen Volks zu erkennen. Unter diesen sind die, die es am kräftigsten kitten, die Kirche, das Nationalgefühl und die politische Gewaltherrschaft.
Die Macht der Kirche beruht hier auf anderen Grundlagen als dort, wo sie in Nordeuropa, etwa unter Flamen oder Westfalen, eine ähnlich große Gewalt wie hier ausübt. Ihre stärksten Stützen sind einerseits die nichtchristlichen, urindianischen Glaubenselemente, die von den alten vorspanischen Religionen übernommen worden sind, und andererseits der von ihr sorgfältig unterhaltene Glaube an ihre eigenen übernatürlichen Wirkungsmittel.
Die ersten Missionare haben nicht die Menschen allein, sondern auch deren Götter getauft, die nationalen Mythologien ins Christliche umgedeutet, die Tempel zerstört und die Kulte erhalten. Das vielleicht nur selten mit Berechnung, öfter – gerade weil sie die äußeren Zeichen des Heidentums so schonungslos vertilgt hatten – gedrängt durch das Volk, das dort, wo es einen Tempel gewohnt war, eine Kapelle verlangte, und wo es einem Gott geopfert hatte, wenigstens zu einem Heiligen beten wollte. Immer dasselbe naiv-schlaue Legendenschema ist es, nach dem sich hier die Tragikomödie allen Bekehrungswesens abspielt, die Geschichte, wie eine verehrungsbedürftige Madonna auf der verwüsteten Stätte eines alten Tempels einem frommen Indianer immer wieder so lange erscheint, bis der Bischof dort ein Gotteshaus zu bauen erlaubt. Weil die Kirche nur die äußeren Religionssymbole, aber nicht zugleich auch die religiösen Gewohnheiten des Volkes zerstören konnte, traten wie von selbst an die Stelle der vernichteten Andachtsobjekte christliche. Das Bedürfnis schuf sich das Symbol. Die Kirche hatte durch die Wandlung nur nackte Macht, das Christentum höchstens eine Anwartschaft auf späteres Eindringen gewonnen. Es ist typisch eine Bluttransfusion von einem Glauben zu einem anderen, ein Gleichbleiben der Substanz bei wechselnder Form, bis schließlich unter gewissen Umständen die Form wieder langsam auch die Substanz etwas verändert; eine Wandlung, die auf den Vorgang bei der Unterwerfung einer Rasse unter das Ideal eines anderen und auf die Möglichkeit, ein Volk zu ›bekehren‹, ein eigentümliches Licht wirft. Die Inbrunst aber, mit der die Eingeborenen an ihren nationalen Göttern hingen, ist dadurch dem Christentum gerettet worden.
Die Furcht, die die Kirche einflößt, besteht zum Teil aus der von den Priestern in Predigten und Gesprächen unterhaltenen abergläubischen Scheu vor geheimnisvollen und unwiderstehlichen, übernatürlichen Wesen und zum Teil aus der lebendigen Erinnerung an die sehr konkrete Macht der Inquisition, die noch in diesem Jahrhundert ihre Autodafés hier abgehalten hat. Der Gläubige hier unterscheidet nicht einmal, wenn ich richtig beobachtet habe, zwischen jener behaupteten übernatürlichen und dieser ihm fühlbaren weltlichen Macht und empfand so früher den äußeren Zwang zum Glauben zugleich innerlich als ein Argument für die Wahrheit des Glaubens. Der Glanz der Kirche, der ihm wie ein sichtbares Stück der Herrlichkeit Christi erscheint, und ebenso alle anderen Beweise von der weltlichen Kraft der Kirche, der Reichtum und die Latifundien, die sie jahrhundertelang zur größten wirtschaftlichen Persönlichkeit Mexicos gemacht haben, die Gelehrsamkeit, die sie fast allein dem Lande vermittelt hat, die Stetigkeit, die sie im Gegensatz zu den wechselnden Regierungen bewahrt, sind ihm Beweise für die Wahrheit ihrer Lehre und unterhalten seine Furcht vor ihren Drohungen. – Das ethische Bedürfnis, das den westfälischen Katholiken oder den Puritaner religiös macht: der Wunsch, für sein Leben eine Leitung und eine Tiefe zu entdecken, fehlt hier.
Diese Unterschiede in den Grundlagen des Glaubens stehen in Wechselwirkung mit Unterschieden in seinem Inhalte oder, genauer, in der Art, wie der Gläubige sich seinen Inhalt vorstellt.
Die Ethik tritt hinter der Metaphysik zurück; und die Metaphysik ist in diesem Falle hauptsächlich Mythologie: Legendenglaube und Heiligenverehrung. – Zum Teil sind es historische, zum Teil psychologische Gründe, die der Mythologie den Vorrang sichern. Die indianischen Kulte, die die Kirche übernommen hat, fanden für ihren mythologischen Inhalt im metaphysisch angelegten spanisch-maurischen Christentum schon an sich einen günstigen Boden. Noch mehr begünstigten das Mythologische die Umstände der Übernahme, indem gerade die neuen konkreten Symbole, an die sich die alten beibehaltenen urindianischen Zeremonien anknüpften, die Heiligenbilder, Reliquienschreine, Wallfahrtskirchen, in gleich hohem Maße für das Volk und für die Kirche wichtig wurden, für das Volk als neue Mittelpunkte seines alten Kultus, für die Kirche als die sichtbaren Zeichen ihrer Herrschaft inmitten halbheidnischer Zeremonien. – Psychologisch wurde die Mythologie von der besonderen Geistesbeschaffenheit und wie in Südeuropa von der Kulturstufe des Mexicaners begünstigt. Der wichtigste von diesen psychologischen Gründen ist die Sichtbarkeit oder leichte Vorstellbarkeit, die den metaphysisch-mythologischen Wesen zukommt. Denn nur vor dem Vorstellbaren, also nur vor der Außenwelt, zu der für ihn auch die metaphysischen Wesen gehören, empfindet der Naturmensch Scheu; und je nachdem die Furcht den Menschen stärker vor den dunklen Mächten des eigenen Innern oder vor den feindlichen Gewalten der Außenwelt packt, steht auch der ethische oder der mythologische Inhalt seines Glaubens im Vordergrunde seines Bewußtseins. – Die Frömmigkeit stellt sich der Mexicaner also nicht so vor, daß er sein Leben nach dem Gebote Gottes richte und sich dazu im Gebet Kraft und Heiligung hole, sondern so, daß er Gott und den Heiligen zu Willen sei und ihnen in der Kirche so oft wie möglich den Gruß entbiete. Die Heiligenbilder, an denen er dieser mythologischen Frömmigkeit genügen kann, werden seinen Augen in allen Kirchen mit möglichstem Nachdruck vorgeführt, nach spanischer Art barbarisch gekleidet und mit falschen Juwelen herausgeputzt, die Gekreuzigten außerdem noch bluttriefend, mit Knien, die bis auf die Knochen durchgeschunden sind, und grünlich verwesendem Fleisch, Greuelgestalten, die fast physiologisch-schmerzhaft wirken, der Stumpfheit der mexicanischen Sinne angepaßt. Denn eine gewisse Gefühlsstärke bei der Begrüßung gehört sozusagen zur Höflichkeit, da der Heilige auch die Herzen erkennt; daher das Reizbedürfnis und unter gewissen Umständen das Kunstbedürfnis, das der mythologisch-religiöse Südländer in der Kirche empfindet; daher aber auch die ekstatischen und manchmal ergreifenden Mienen, die man hier vor fratzenhaften Bildwerken erlebt. Die Gemütsbewegung, die in der Kirche so stark sein kann, überdauert aber nur selten den Augenblick, weil selbst der bigotte Mexicaner gar nicht den Wunsch hat, sich hier, wie etwa der germanische Christ, eine dauernde Stärkung für den Tag zu holen. Die Andacht hat ihren Zweck, den mächtigen Heiligen günstig zu stimmen, durch ihre Inbrunst selbst erreicht, da sie dem Andächtigen für die Tagesarbeit nicht eigene Kraft, sondern bloß einen Bundesgenossen sichern soll.
Die Gewalt, die die Kirche auf Grund dieser Geschichte und dieser Psychologie hier ausübt, ist ungeheuer. Sie nimmt unter den lebendigen, schaffenden und erhaltenden Kräften des mexicanischen Volkskörpers die erste Stelle ein und übertrifft an Macht in materiellen und geistigen Dingen den Staat und selbst das Geld. Wo ein Plantagenbesitzer durch Lohnerhöhungen nichts erreichen kann, genügt ein Wort des Priesters, um die Bauern zur Überschicht zu bestimmen; Bestohlene wenden sich, wenn sie einen Verdacht in betreff des Täters haben, nicht an den Richter, sondern an den Beichtvater des gemutmaßten Diebes. So tun die Priester mehr als die Polizei, um Vergehen zu verhüten, um Streitigkeiten beizulegen, um äußerlich die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und auch innerlich ist ihr Wort für die meisten die einzige tiefer dringende geistige Anregung und deshalb der Hauptinhalt ihrer geistigen Gemeinschaft mit ihren Landsleuten. – Mehr noch fast als in Rom erfüllt daher hier die Gotteshäuser beständig das leise Gemurmel der Betenden. Scharen von Männern und Weibern knien immer vor den Heiligenbildern, und gerade die Männer überwiegen: Leute aus dem Volk, deren Ponchos in dunklerem Rot neben dem Scharlach der Chorknabengewänder im Weihrauchnebel um den Altären leuchten. Das Nationalheiligtum von Guadalupe ist der Rückgrat der mexicanischen Nationalität, das, was alle Provinzen und Stämme des Landes am stärksten zusammenhält. Bis in die entfernten Gebirgstäler, bei Stämmen, die kein Spanisch verstehen und kaum zum Christentum bekehrt sind, soll man Kopien der blassen, von einem mandelförmigen Glorienschein ganz umrahmten Madonna antreffen; und seitdem sie Hidalgo, der erste Held der Befreiungskriege, auf seinen Fahnen den mexicanischen Freiheitsscharen vorantrug, ist sie auch für die liberale Partei das höchste Symbol des mexicanischen Patriotismus. Der Dom, in dem das Wunderbild steht, liegt vor den Toren der Hauptstadt, auf dem Boden, den früher ein weitberühmter indianischer Tempel, der Göttermutter der Azteken geweiht, einnahm. Schon jetzt, da kein Fest ist, füllt die Kirche eine beständig wechselnde Menge. Fortwährend rutschen neue Prozessionen von dunklen, inbrünstig blickenden Männern und Weibern, Kerzen haltend und wie im Takte Gebete murmelnd, auf den Knien die Schiffe hinauf bis ans massiv silberne Gitter, das den Hochaltar und das heilige Bild vom Volke trennt. Wie Gesumm von Bienen schweben die Gebete über dem Pilgerschwarm, der sich langsam vorwärtsbewegt. Am 12. Dezember aber, am Tage von Guadalupe, versammeln sich hier jedesmal an die hunderttausend Indianer aus allen, auch den fernsten Teilen von Mexico und führen in den alten heimischen Federtrachten, von den katholischen Priestern unbehelligt, ihre eigenen Riten und Tänze in dem Heiligtume und um dieses auf.
Das Nationalgefühl besteht zum Teil in dieser gemeinschaftlichen, von der Kirche geförderten Verehrung der Madonna von Guadalupe; zum Teil ist es seinem Ursprunge nach der Haß gegen das Aussaugungssystem der spanischen Beamtenschaft, ein Ressentiment, dem das Volk und seine Führer einen idealen Grund in ihrer, den Spaniern fremden Stammeszugehörigkeit und Heimat erfanden. Es fußt also mit allen Wurzeln im indianischen, nicht im spanischen Blut, das der Mexicaner in den Adern hat. Cortez hat hier kein Denkmal, nicht einmal eine Straße; nur ein einziges armes Erinnerungszeichen: eine Zypresse in einer staubigen Vorstadt, inmitten von elenden Baracken und Pulquewirtschaften. Unter diesem Baume saß der Eroberer in der Nacht vom 1. Juli 1520, besiegt durch Montezuma und bitterlich weinend. – Das Denkmal des letzten, von Cortez grausam gefolterten Aztekenkaisers Guatemoc steht an der schönsten Stelle der Stadt, in der großen Allee nach Chapultepec hinaus, die als Korso dient. Und das Standbild gehört zu den wenigen modernen Denkmälern, die nichts Kleinliches oder Theatralisches an sich haben. Der Kaiser schreitet, den Speer offenbar gegen seine spanischen Bedränger leicht erhebend, ruhig vorwärts; der Blick ist fest in die Ferne gerichtet, den Kopf bedeckt der mächtige, gefiederte Helm der Aztekenkrieger. Ringsum weitet sich die Allee zum Kreise; zwischen den Stämmen der alten Akazien erscheint in der Ferne der Grat der Kordilleren; und dahinter geht abends in flammender Pracht die Sonne unter.
Den Abfall vom Mutterlande empfindet der Mexicaner nicht wie der Nordamerikaner als Absplitterung von seinem Stammvolk, sondern als Befreiung vom Joche eines fremden Volkes oder sozusagen als den Anfang der Wiedereroberung seiner Heimat durch die dunkle Rasse. Vielleicht ein Traum! da der romanische Geist den Mexicanern doch so tief eingeprägt ist, daß sie nie wieder dem Volke, das Cortez vorfand, gleichen könnten; aber kein gleichgültiger, weil gerade die Sehnsucht bestimmt, welche von den Realitäten, die ein Volk unsichtbar umschweben, zur Entladung und Wirksamkeit kommt.
Der mexicanische Staat ist seit dem Befreiungskriege, was er den Verhältnissen und dem Volkscharakter nach sein muß, das heißt brutal, auf die Kirche als mächtigere Nebenbuhlerin neidisch und selber dabei ohne selbständige innere Kohäsionskraft; die Beamtenschaft zum großen Teil bestechlich und erpresserisch, weil die geistigen Voraussetzungen und das Milieu für eine aus persönlichen Gründen festgehaltene Ehrlichkeit fehlen; die Politik außer in ihrer Kirchenfeindschaft rein persönlich, weil Ideen ja hier nie zu Motiven breiterer Volksschichten werden können und auch den natürlichen Volksgruppierungen das gesellschaftliche Gefühl fehlt, um die Interessen ihrer Gruppe zu erkennen oder geltend zu machen. Da der jeweilig bestehenden Regierung jede ernsthaft zu nehmende Sanktion, außer der durch Gewaltstreiche erlangten und zu persönlichen Zwecken ausgebeuteten Macht fehlt, unterschied sie sich bis vor kurzem, trotz einzelner für ihre Person dem Stehlen abholder Männer, von den Brigantenassoziationen, die über das ganze Land hin bald hier als kleine Räuberbanden die Chausseen unsicher machten und bald dort als Gewaltherrschaften ganze Provinzen aussogen, eigentlich in nichts außer darin, daß sie unter diesen Banditengesellschaften die mächtigste war, der nach innen das ausgedehnteste Plünderungsgebiet und von außen diplomatische Anerkennung, Ordensauszeichnungen und Freundschaftsverträge von fremden Souveränen zuteil geworden waren.
Diaz aber, das Haupt der zuletzt an die Staatskassen gelangten Politiker und Soldatenbande, ist jetzt schon zwölf Jahre Präsident der Republik. Als soldatisch gedrillter und mit den reicheren Grausamkeitsmitteln des neunzehnten Jahrhunderts arbeitender Ludwig XI. oder Cäsar Borgia dient er, geschickter als seine Amtsvorgänger, zu gleicher Zeit seinem Ehrgeiz, seinem Bankkonto und seinem spätestens am eigenen Wirken erwachsenen Patriotismus. Er unterdrückt die unabhängigen Briganten im Lande und das offene Plündern der vom Staate Angestellten und verbindet damit ein Geschäft für sich, indem er Gewinnbeteiligungen an den zahlreichen Unternehmungen annimmt, die infolge seines Regiments aufzublühen anfangen. Das Land macht, während es früher bei den fortwährenden ›Revolutionen‹ nicht zur Ruhe kam und verarmte, jetzt Fortschritte, durch die es zur zweiten wirtschaftlichen Großmacht Amerikas werden muß, falls Diaz am Ruder bleibt. Es fragt sich nur, wem dieser Aufschwung frommen wird, ob den Mexicanern oder fremden Kapitalisten. Diaz aber hat seine bei einem Jahresgehalt von fünfzehntausend Talern verdienten Millionen in englischen Banken in Sicherheit gebracht.
Seine Ziele hat Diaz erreicht, weil er seine Mittel dem Charakter des Volks anpaßte. Daß aber solche Mittel, wie er sie gebraucht, nötig und sogar daß sie anwendbar sind, kennzeichnet noch einmal dieses Volk Mexicos und seine Befähigung zum Gesellschaftsleben. – Nominell ist Mexico eine Föderativ-Republik mit Zweikammersystem und einem alle vier Jahre vom Volke zu wählenden Präsidenten; und die gegenwärtige Regierung nennt sich liberal. Allerdings heißt liberal hier nicht etwa wie in England oder bei uns wirtschaftlich und politisch individualistisch, sondern nach Art von Frankreich, Spanien, Italien und von allen andern katholischen Ländern antiklerikal; nach Geist und Geschichte sind ja die nordeuropäischen und die katholischen Liberalen andere Parteien, haben andere Fehler, und wenn sie Vorzüge haben, andere Vorzüge.

Präsident Porfirio Diaz (um 1890)
Aber die mexicanischen Liberalen schikanieren nicht nur die Kirche, sondern haben dem Volke selbst und jedem einzelnen im Volke seine Rechte genommen. Zunächst das Wahlrecht. Wo noch Wahlen markiert werden, sind es Scheinzeremonien, und in vielen Provinzen geben sich die Gouverneure nicht einmal mehr die Mühe, ein erdichtetes Wahlresultat zu verkünden. Diaz wählt alle vier Jahre feierlich sich selber wieder zum Präsidenten; und in der Zwischenzeit ernennt er auch, sooft es nötig ist, die Mitglieder der Volksvertretung und die verfassungsmäßig vom Volk zu erwählenden Provinzgouverneure. Die ›liberale‹ Regierung hat aus der konstitutionellen Republik eine unumschränkte Monarchie gemacht. Wer protestiert, kommt um; das heißt: er fällt der ›Ley Fuga‹ zum Opfer, der geistvollen Handhabung der Polizeibefugnis, auf fliehende Arrestanten zu schießen. Mißvergnügte Personen werden arretiert, fliehen und werden erschossen. Prozesse werden dadurch vermieden und die Entscheidungen Gerichten entzogen, die trotz des Regierungsdruckes auch für Privatbestechungen nicht unzugänglich sein könnten. Namentlich aber erschüttert solch plötzlicher Tod die Phantasie des Volkes viel stärker als gesetzmäßige Hinrichtungen. Wie Kunst und Religion in Mexico greller Farben und hyperphantastischer Darstellungen bedürfen, so soll Schrecken nach der Meinung aller kompetenten Beurteiler das einzige Mittel sein, hier staatlich einen Eindruck zu machen. Das Volk wehrt sich nicht, erstens weil der einzelne sich bei dem so hergestellten Frieden wohler und vielleicht sogar sicherer fühlt als bei den Bürgerkriegen früher; zweitens weil das einzige gesetzliche Mittel dagegen die gerichtliche Klage der Verwandten des Toten gegen den Todesvollstrecker wäre und die Gerichte die Sache dann so lange verschleppen würden, bis die Verwandten und die Mörder ebenfalls gestorben wären; und schließlich weil zu Revolutionen, eben infolge der Handhabung der ›Ley Fuga‹, vorläufig der Mut fehlt. Zur Zeit erfolgt auf dem Ley-Fuga-Wege hauptsächlich die Beseitigung von unbequemen Generalen, Briganten und Politikern, so unter anderem vor einiger Zeit die des Gouverneurs der Provinz Zacatecas. Aber manchmal sind doch die Folgen auch tragisch. Vor einigen Jahren entdeckte der Gouverneur von Veracruz angeblich eine Verschwörung, deren Hauptmitglieder die Söhne von Männern sein sollten, die ihm politisch verfeindet waren. Er telegraphiert das nach Mexico und bittet um Instruktionen. Diaz depeschiert zurück: ›Matanlos todos‹, d. h. ›Alle töten‹. Noch in derselben Nacht ließ der Gouverneur neun junge Leute von neunzehn und zwanzig Jahren in ihren Wohnungen überfallen und auf der Stelle unter ihrem eigenen Dache umbringen. Die Leichen wurden den Eltern, durch den Rücken geschossen, zur Verfügung gestellt. – G., der selber Parlamentarier, also Diaz-Anhänger ist, sagte neulich zu mir: »Nous ne sommes pas en république, nous sommes en Russie, et encore . . .! Wir genießen umgekehrt wie Rußland eine republikanische Staatsverfassung, die durch den Mord von oben gemäßigt wird.«Leider haben wir in Deutschland nach der Revolution Ähnliches, und insbesondere auch die ›Ley Fuga‹, erlebt. (Anmerkung zur Auflage 1921.)
Mexico, den 22. November 1896.
Nachmittags zum letzten Male mit C. in seinem Tilbury zum Korso. Die Wagen sind tadellos, Kutscher und Geschirr wie in Rom oder Madrid, beste Londoner Imitation, und schnell und hoch trabende Pferde. T., der Schwiegersohn des Präsidenten, hat eine Mailcoach, die selbst in England Figur machen würde. Der Jockey-Klub an der Calle San Francisco ist der alte Palast der Familie Cortez; außen ganz mit bunten Majolikakacheln inkrustiert; das Treppenhaus ein Juwel von vornehm-heiterer Eleganz; oben die Räume nach Art englischer Klubs eingerichtet, Speisezimmer in dunklem Mahagoni und Lese- und Spielräume mit niedrigen, tiefen Ledersesseln. Ich bin für die Dauer meines Aufenthaltes Mitglied gewesen. Abends ist viel Verkehr: Gutsbesitzer, große Unternehmer, Politiker, im Smoking, rauchend und hoch spielend; alle nach südlicher Art mehr als liebenswürdig. Man glaubt es kaum, daß diese Mailcoachfahrer und Ekartéspieler nach den Grundsätzen der Malatesta und Borgia regiert werden. C. versichert, daß gerade sie, diese oberen Klassen weißen oder gemischten Blutes, welche die Politiker-Kaste bilden, die ›Ley Fuga‹ unentbehrlich machen.