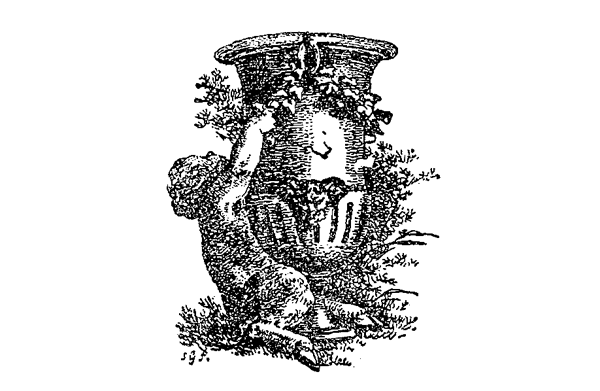|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
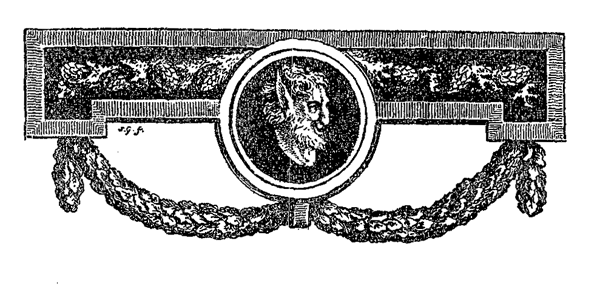
»Der Kuß, der letzte, grausam süß, zerschneidend
Ein herrliches Geflecht verschlungner Minnen.
Nun eilt, nun stockt der Fuß, die Schwelle meidend.
Als trieb ein Cherub flammend ihn von hinnen.«
(Goethe, Elegie.)
Es war Herbst geworden in Sesenheim, bunter, leuchtender Herbst unter tiefblauem Himmel. Die Heimkehrenden hatten das Haus voll Besuch gefunden, Schwester und Schwager Marx und zwei Brionsche Neffen, wilde Knaben, die überall Unfug anrichteten. Die Frauen hatten alle Hände voll zu tun. Dazu kam die bevorstehende Einsegnung von Sophie und Christian, für die eine kleine Aussteuer beschafft werden mußte. So lebte man in Arbeit und Unruhe. Überall da, wo der junge Goethe Festtag geschaffen hatte, war nun Alltag. Der setzte sich breit in die Jasminlaube zu Gemüseputzen und Küchengesprächen, sammelte und trocknete eifrig allerhand Blättertees im Garten; bestieg wohl auch mit Strickstrumpf in weiten Tantenkleidern und Fliegenklatsche das Hügelchen mit der Buchenbank, und betrachtete den eingeschnittenen Namen des jungen Goethe, der sich ein wenig in Friederikens hineingezogen.
Friederike sah es lächelnd. Überhaupt ließ sie das Leid keine Macht über sich gewinnen. Ihre innerste Natur war Fröhlichkeit und Klarheit.
Aber selbst anders geartet, hätte sie sich jetzt zur Helligkeit gezwungen. War es doch von Anfang an ihre Vernünftigkeit gewesen, die er in ihr liebte. Er floh vor allem Lebenlähmenden. Ein grämliches Mädchen wäre ihm zur Last geworden. Ihr Instinkt wußte das.
Trotz alles Arbeitens auf beiden Seiten gingen doch viele Briefe zwischen ihnen hin und her. Goethe sandte nicht mehr, wie früher, seine kurzen Zettelchen mit ein paar stürmenden Worten; seine Briefe waren jetzt ausführlicher. Sie begnügten sich nicht mit der Schilderung eigener Empfindung. Es war, als versuche er, sie immer besser teilnehmen zu lassen an seiner Geisteswelt. Er sprach mit ihr von Götz, von Faust, sandte ihr das Fragment eines Entwurfs, ein paar Zeilen aus einer Szene, die ihm vorschwebte. Friederike lag dies alles fern. Und sie bekannte das ehrlich. Die Aufrichtigkeit und Naivität ihrer Antworten entzückte ihn. Manchmal schien es beiden, als seien sie jetzt wesentlicher verbunden, als in der Zeit ihres körperlichen Beisammenseins.
Goethe nannte sich jetzt in seinen Briefen »der Wanderer«, so wie ihn seine Straßburger Freunde getauft hatten. Etwas entschlossen Schreitendes lag auch in den Gedichten, die er in jener Zeit schrieb und sandte. Auch sie die Lieder eines Wandernden. Friederike nahm jedes einzelne erwartungsvoll auf. Und ließ es sinken. Nein, sie war nicht mehr in allen seinen Liedern. Nicht mehr die brausende Seligkeit der ersten Zeit. Ein andres Höheres sprach jetzt aus seinen Versen. Mit ihrer hellen Mädchenstimme sagte sie sich seine starken Worte vor und fühlte sich fremd in ihnen:
»Den du nicht vorlässest, Genius,
Wirst ihn heben über Schlammpfad
Mit den Feuerflügeln;
Wandeln wird er
Wie mit Blumenfüßen
Über Deukalions Flutschlamm,
Leicht, groß,
Pythios ApoIlo.«
Aber dann kam ein Zettel, in dem er den Abschluß seiner Promotion meldete, Es sei alles nach der Schnur gegangen und habe ihm viel Spaß gemacht. Nun aber komme das Bittere: der Abschied. Das war das unglückselige Wort. Zum erstenmal. In seiner gleichmäßigen Schrift mit den rhythmischen Schwingungen sah es sie höhnisch an.
Und plötzlich, eine Stunde später, war er da. Saß mitten zwischen Alten und Jungen, hatte tausend hübsche Sachen mitgebracht, für jeden ein Geschenk besonderer Art. Auch das Bärbel war nicht vergessen. Er ging im Dorf umher, besuchte alle Leute, die ihn kannten, den Amtmann, den Lehrer, den lahmen Korbflechter, bei dem er Körbeflechten gelernt hatte, den Falkenwirt. Christian wich ihm nicht von der Seite. Sophie, inzwischen mädchenhaft geworden, hielt sich zurück. Ihr erstes Übelwollen gegen ihn war wieder wach geworden. Sie fühlte, daß Friederike um ihn litt. Das wollte sie nicht. Er war nur für wenige Stunden gekommen. Ungewohnte Unruhe war in ihm. Auch sah er blaß und magerer aus als sonst.
Salome zog ihn in das Sälchen. Wann er wiederkehre, wollte sie wissen. Und was für eine Stellung er sich verschaffen würde bis dahin? Friederike schlüge die besten Partien aus um seinetwillen. Sie sprach leidenschaftlich und unüberzeugt, und fühlte selber, wie unmöglich es sei, diesen stürmenden Jüngling mit Seilen zu binden. Ohne daß er selber nur ein Wort gesagt hätte, machte sie sich zuletzt zu seinem Anwalt, sagte von Friederike, daß sie durchaus in keiner andern Welt leben könnte, als in ihrer eigenen. Eine Trennung vom Elsaß, von ihren Verwandten und Freunden würde sie kaum überleben. Sie, Salome, wäre darin ein ganz anderer Mensch. Aber so sei es ja immer in der Welt: der Kräftige, der sich nach Abwechslung und neuen Eindrücken sehne, müsse zu Hause hocken. Und den andern, der sich nichts Lieberes wisse als im Regelmäßigen und Kleinen froh zu sein, den wolle man hinausreißen in die große Welt. Neid, Besorgnis um Friederike und ihre Neigung zu Goethe schwangen dabei durcheinander. Zum Schluß küßte sie ihn heftig auf beide Wangen. »Leben Sie wohl und vergessen Sie uns nicht.«
Es war ein stillschweigender Beschluß, daß Friederike ihrem Freunde das Geleit geben sollte. So ertrugen sie geduldig all das gesprächige Durcheinander der Familie, das sie von dem letzten bitteren Auseinandergehen trennte.
Und dann kam die Stunde. Vater Brion unterließ es zum erstenmal, die Uhr zu ziehen und zu mahnen. So ungern ließ er Goethe ziehen.
Goethe küßte der Mutter die Hand, wollte etwas Liebenswürdiges sagen von Dankbarkeit und Wiedersehen – da verließ ihn die Fassung. Er brachte nur ein schluchzendes »Verzeihen Sie es mir« heraus, hielt die Hand vor die Augen und stürzte hinaus. Christian lief ihm nach. Das Drusenheimer Pferd war im »Anker« eingestellt. Aber Goethe stieg nicht auf. Er führte den Falben am Zügel, kam noch einmal, gefaßter, zum Pfarrhaus und gab jedem still die Hand. Friederike ging wortlos mit ihm. Sie hatte ein dunkles Tuch um die Schultern getan, ihr Haar glänzte gegen das Blau des Himmels. Fr hatte den Arm um sie geschlungen, sobald sie in den Waldpfad einbogen. Das Pferd steckte sein langes Gesicht neugierig zwischen sie. Unter seinen langen Wimpern hatte es einen fast menschlichen Blick. Dazu fiel es plötzlich in Paßgang, wie um sich dem Rhythmus der Schreitenden anzupassen.
Die achteten auf nichts, sahen starr vor sich hin. Jetzt ging's über den Bach. Und jetzt die Wiese entlang. Goethe blickte zurück. Zum Hügelchen hinauf.
»Wer mir gesagt hatte – damals, dort oben – als ich zum erstenmal den Wegweiser sah, nach ›Friederikens Ruhe‹ – –, wer mir gesagt hätte, daß ich gekommen bin, diese Ruhe zu stören – –!« Seine Stimme brach, er wandte sich ab.
Sie blieb stehen, weil ihr der Atem fehlte.
»Und nun ist unsere Buche schon ganz mit Purpur behängt«, sagte sie endlich. So früh im Jahre.«
»So früh im Jahre«, wiederholte er mechanisch. Sie sahen einander nicht an.
»Freust du dich auf zu Haus?« fragte Friederike wieder.
»Noch nicht.«
Er hatte den Falben losgelassen, der jetzt ruhig graste, während ihm die Steigbügel klirrend an die Bäume schlugen.
Friederike mühte sich, noch etwas zu sagen. Aber plötzlich küßten sie sich, weinten und nannten sich tausendmal bei Namen.
Friederike löste sich endlich aus seinem Arm.
»Ich will nun zurück.« Ihre zitternden Finger tasteten seinen Rock entlang, als müsse sie den bitten, ihren Liebsten gut vor Kälte zu schützen; sie streichelte das Pferd, das ihn wegtragen sollte. Dann schüttelte sie sich die Tränen vom Gesicht.
»Jetzt gehe ich. Und komm gesund wieder.«
Sie erschrak. Nein, davon hatte sie nichts sagen wollen. Nichts davon, daß sie auf ihn wartet. In Angst vor sich selber, unfähig, sich länger zu beherrschen, floh sie davon.
Sie hatte sich nicht umgesehen, war nur immer weiter gelaufen, weit über den Fußpfad hinaus, der zum Dorfe führte. Jetzt blieb sie stehen. Sie hatte Hufschlag gehört. Kehrte er um?
Sie empfand mehr Abwehr dabei als Freude. Sollte denn die Qual von neuem anfangen zwischen ihnen? Nichts als gleichgültige Worte würde man noch finden, die ihrer beider Wunden verdecken sollten. Denn er litt ja wie sie. Mehr vielleicht, weil man ja immer vom Manne erwartet, er solle lieben und zugleich Vernunft zeigen. Sie – ach nein – von ihr verlangte das niemand. Sie durfte lieben, glücklich sein und leiden nach eigenem Maß.
Aber kam denn nicht der Hufschlag ihr entgegen? Sie horchte. Ja, er kam nicht hinter ihr her, sondern von der anderen Seite. Jetzt tauchte ein Reiter auf.
»Das Riekele!« Gottlieb sprang vom Pferde. »Lieberes hätt' mir gar nicht geschehen können!«
Sie gab ihm die Hand. Reden konnte sie noch nicht.
Er sah ihr besorgt ins verweinte Gesicht. »Sie müssen nämlich wissen, Bäschen, ich hatte hier herum zu tun, Saatkartoffeln und Dünger. Und weil ich grad noch ein bissele Zeit hab', hab' ich mir gedacht – –«
Sie sah, daß er log. Es rührte sie.
Er ging jetzt neben ihr. Wie eben noch der Liebste, führte nun auch er das Pferd am Zügel, das sich an ihn drängte.
»Riekele«, begann Gottlieb und sah sie bittend an. »Sie wissen, wie's mir ums Herz ist, und was ich mit Ihnen reden möchte. Denn seit Sie damals bei mir waren mit der Tante – – Ich hab' gut sehen können, daß es Ihnen gefällt da bei mir. Ach Riekele – Sie hätten sollen gar nicht erst wieder fortgehen an dem Tage.« Er hielt Friederike am Kleide fest, als wolle sie ihm entfliehen.
»Guter Gottlieb!« sagte sie still. Sie hatte Lust, ihn zu streicheln. Da stand nun dieser gute, prächtige Mensch, bereit, ihr seine Hände unter die Füße zu legen sein lebelang. Was konnte sie ihm sagen? Was versprechen?
»Ich hänge so an dir«, sagte er leise. Das brach ihr das Herz. Sie setzte sich ins Moos und weinte laut.
»Magst du mich nicht? Sag's, magst du mich nicht?« Er hielt ihre Hand.
»Wir zwei, wir wollen uns immer gut sein«, sagte sie schluchzend. »Gelt?«
Er stand auf. »Das sind so Reden, Friederike, das hilft mir nicht. Und ich weiß –« Ein böser Zug geriet in sein Gesicht. »Ich weiß bestimmt schon heute –, dieser Goethe paßt nicht für Sie. Und Sie nicht für ihn. Er wird Sie unglücklich machen. Sie armes Riekele. So oder so.«
Da hob sie ihr Gesicht. »Nein, Gottlieb, ein Mädchen, das einmal den Goethe geliebt hat, kann nie ganz unglücklich werden.«
Er wandte sich ab. Sie erhob sich, legte ihm schwesterlich den Arm auf die Schulter. »Sei doch nicht traurig. Sei nicht bös. Wir wollen immer zusammenhalten, einander helfen und trösten. Und weißt, Gottlieb, wenn du erst einmal deine leeren Stuben da unten voll kleiner lieber Kinder hast, dann kommt das Tantele zu ihnen. Und wir machen Festtag miteinander. Weißt, dazu pass' ich gut. Das wirst du schon merken. Ein Täntele werd' ich abgeben, wie kein besseres ist im Elsaß auf und ab. Ich seh' mich schon!«
Warum hab' ich nur vorhin meinen Goethe nicht so trösten können? dachte sie verstört.
Der Wunsch in ihr, ihm noch nachträglich zu zeigen, daß sie keine Zukunft fürchtete, wurde seltsam stark in ihr, schien alle ihre Kräfte aufzusaugen. Sie fühlte sich entwandern, hin zu ihm, ihm sagen, zeigen, Trost zusprechen.
»Was ist dir, Riekele?« rief Gottlieb ganz entsetzt. »Deine Hände werden kalt, du bist ja ganz entrückt?«
Ein Augenblick noch, dann ging ihr Atem wieder.
Gottlieb, der erst hatte gehen wollen, führte sie noch sorglich bis nach Haus. Da verabschiedete er sich. Sie küßte ihn. »Auf bald, Gottlieb. Sei mir nicht bös. Es ist halt so.«
Er nickte still und treu. Dann ging er.
An der Türe stand der Vater. Er nahm sie in den Arm.
»Ist mir gar zu viel Geschwätz bei den Weibsleuten da unten; laß uns lieber ein wenig hinaufgehen zu mir. Die Mutter hat uns zweien den Kaffee aufgetan. Er wartet auf uns.«
Friederike sah umher wie erwachend, sah altvertraute liebe Sachen, die Blumen in den Beeten, die Räume, Vaters alte Bücher und sein liebes, unschuldiges Gesicht, das über allem Alltag kindlich weise glänzte.
Unverlierbares war ihr geschehen und geworden. Nun war Alltag. Und sie liebte wieder ihren Alltag.
Goethe hatte Friederike fortgehen lassen, ohne auch nur eine Bewegung zu machen. Sie lief nicht, er hatte sie mit einem Sprunge noch erreichen können. Aber er blieb wie gebannt und sah ihr nach.
So hatte er ihr nachgesehen an jenem strahlenden Maimorgen, da sie, den sonnengelben, großen Hut am Arm, mit fliegenden Zöpfen durch das regenfeuchte Wäldchen lief wie ein Märchenkind. Jetzt glitt sie langsam durch die bunte Welt, in ihr dunkles Tuch gewickelt wie eine Fröstelnde.
Eine wütende Reue fiel ihn an. Aber er regte sich nicht. Doch als sie ganz verschwunden war, warf er sich auf die Erde, grub sein nasses Gesicht in die Gräser, die schon voll Samen hingen, und stopfte sich die Faust in den Mund, um nicht aufzubrüllen wie ein wundes Tier.
So lag er lange.
Er fühlte heißen Atemstrom in seinem Nacken. Das Pferd war herangekommen und beschnupperte ihn. Er stand auf, klopfte das sanfte Tier, säuberte sich den Anzug vom Gräserstaub, bog auf die Landstraße zurück und stieg auf.
Trübsinnig sann er im langsamen Reiten vor sich hin. In alle Schmerzen hinein wiederholte er sich immerfort: Weiter, weiter! Nicht umkehren! Wie einen Befehl.
Immer klarer wurde es ihm: Er durfte dieses liebliche, zarte Geschöpf nicht hineinnehmen in sein wanderndes Leben. Hier war ihr Boden, hier blühte sie. Und wußte denn er überhaupt nur, wohin er gehörte? Wo ist das Land, das seine Sprache spricht? Wo würde er schaffen, lernen, sich betätigen? Alles war noch dunkel. »Ich bin ein Fremdling überall«, sagte er vor sich hin. Nein, er durfte niemand an sich fesseln. Durfte auch sich selbst von keinem fesseln lassen. Unaufhörlich dachte er an Friederike.
Er empfand sich tiefschuldig und ohne die Möglichkeit, es wieder gutzumachen, was er ihr an Zukunftshoffnung geraubt hatte.
Wie er weiter ritt, dichtete er an ihrem Schicksal. Eine Verlassene! Er wurde zerrissen von den Schmerzen all dieser Frauen, die sich nun in seiner Phantasie drängten und gestaltet werden wollten von ihm. Mädchenschicksale dichteten sich in ihm, bald ins Hoffnungslose gewendet, in Schuld und Tod endend, dann wieder ins Heldische, Erhabene, den Geliebten mit sich emporziehend in ihre Verklärung. Auch stille Dulderinnen waren unter ihnen, fromme, sanfte Seelen, die sich in ihrem Kreise neues Glück suchten. Immer aber waren es Enggebundene, neben denen der Strebende, Unruhige stand, der ihr Schicksal wurde. Sie jubelten, klagten, rangen die Hände und starben vor ihm hier im Walde. Ein Grauen faßte ihn an. Schon hatte er das Pferd gewendet, wollte zurück, zu Friederike, sie mit sich nehmen, schützen – da stutzt er: Was war das, drüben unterm Vogelbeerbaum?
Da steht Friederike. Aber nicht in dem Kleide, in dem er sie eben gesehen. Sie hat ein weißes Gewand an, schlicht und eng, wie man es damals noch nicht trug, eng unter der Brust gegürtet. Ihr Haar ist gestutzt. Es hat etwas von seinem Goldschimmer verloren und umgibt jetzt in kurzen Locken, die im Nacken länger hängen, ihr Gesicht. Ein blaues Band ordnet die Locken tief hinein in die Stirn. Sie ist ihm fremd und dennoch ganz vertraut. Die Wangen sind voller geworden, das alte Lächeln strahlt ihr aus den Augen. Nur um die Lippen liegt ein Zug von Erfahrung.
Jetzt wendet sie den Kopf. Sie beugt sich zu Kindern herunter, die vorhin nicht da waren, oder er nicht gesehen hat. Ihr Lächeln wächst, wird froher. Sie faßt die jungen Mädchen bei der Hand. »Täntele, Täntele«, glaubt er's leise in der Luft zu hören. Er streckt die Arme nach ihr aus. Gelassen und in ihrer leichten, anmutigen Art schreitet sie weg von ihm. Und verschwindet.
Ein Zittern überfiel ihn. War sie tot? Er riß sich gewaltsam aus der Erstarrung aller Gedanken. Das fremde Kleid, die fremde Haartracht – –. Nein, er hatte eine Vision erlebt. Hatte Friederike gesehen, wie sie in Zukunft war.
Ein himmlischer Trost ging aus von dieser Erscheinung. Antwort hatte sie ihm gesandt auf seine Reue, seine Ängste. Sie verzieh. Sie überwand. –
Der Falbe, der unruhig gestanden hatte, setzte sich jetzt in Trab. Goethe atmete freier. Sein Blut ging rasch und leicht.
So ritt er hinweg von dem Idyll seiner ersten Jugend, das er nicht herübernehmen durfte in sein neues, weites Leben. Das uns allen gehört.