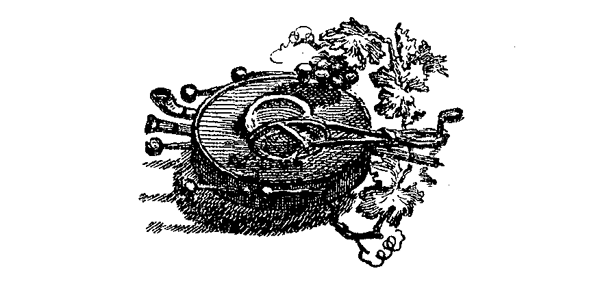|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Diese Stube, dieses Haus ist ein Himmel,
Seit Egmonts Liebe darin wohnt.«
(Goethe, Egmont.)
»O Lieb, o Liebe, So goldenschön,
Wie Morgenwolken Auf jenen Höhn.«
(Goethe, Mailied.)
Es war wundervoller Sommer geworden. Der Juni hatte alles doppelt entfaltet, was der kühle, regnerische Mai in der Knospe zurückgehalten. Die kleinen Gehölze und Gärten, zwischen denen die braune Häuserzeile der Sesenheimer Dorfstraße eingebettet lag, waren eine einzige Woge von Blüten. Und eine warme Bläue in der Luft, die trunken machte! Friederike ging durch ihren Garten, wie durch ein Fest, das man ihr bereitet hätte, strich dankbar über die Malven, die ihre rosa Rosetten so lustig rund um den hohen Schaft gesteckt hielten, roch an den weitoffenen Jasminblüten, die sich den Bienen bereithielten, und jagte sich mit dem alten, zottigen Fideel, in dessen alte Glieder neue Lebenslust gefahren schien.
War denn Sommer früher je so schön gewesen?
Und heute war Freitag. Heute kam Bibiane Ziez, die Botenfrau.
Friederike flog ins Haus zurück. Im Töchterzimmer, auf dem ausgeblaßten Nähtischchen, lag die Schreibmappe, die sie für Goethe gestickt hatte: ein Kranz von goldfarbenen Blumen, die sie ihm mit ihrem eigenen Haar gestickt und im Innern des Deckels befestigt hatte. Sie hätte ihm gern Mairosen hineingestickt. Aber ihr Haar war ja nicht rosa!
Als sie mit dem Päckchen ins Wohnzimmer ging, dort einen Bindfaden aus dem alten Sekretär zu holen, wäre sie fast über Christian gefallen, der auf dem Bauche am Boden lag und mit einem langen, beweglichen Zollstab, der immer einknickte, die Fensterhöhe maß. Im nächsten Augenblick stand er auf dem Ofensims, gleich darauf hing er an einem Schrank, schwitzend vor Eifer. Nie früher hatte er für eine Aufgabe soviel Geduld aufgebracht. Und soviel Anstrengung. »Es ist Freitag,« sagte er zu Friederike erklärend, »Bibiane kommt. Ich will dem Monsieur Goethe doch die Maße mitschicken.«
»Seid doch still, ich dichte!«
Sophie saß am Eßtisch und schrieb. Sie hatte sich die Zöpfe aufgeflochten, um den Kopf frei zu haben, und hielt sich die Ohren zu. Mit den unordentlichen Strähnen um das vom Nachdenken ganz verrunzelte Gesicht sah sie komisch aus.
»Was dichtest du denn?« fragte Friederike möglichst ernsthaft.
»Oh, der Goethe hat dir doch das Gedicht geschickt, was er auf deine Buche gemacht hat. Ich will auch auf deine Buche dichten. Zuerst habe ich mir die Reime aufgeschrieben, das ist natürlich das Schwerste.« Und sie las: »Buche, Tuche, Sturm, Turm. Fee – eine Fee muß vorkommen, das ist poetisch – also Fee. Da habe ich nur ›Schnee‹ gefunden. So wird es nun ein Wintergedicht werden. Das ist ja ganz gut. Dann hast du für jede Jahreszeit eines.«
Friederike hob das Schulheft auf, in dem mit langen Buchstaben stand:
»Im Wäldle an der Buche
steht eine Fee,
Bedeckt sie mit dem Tuche
von weißem Schnee.
Es läuten die Glocken vom Kirchturm – –«
»Die Zeile mit dem Sturm fehlt noch. Ich will fertig werden, ehe die Botenfrau kommt. Ich schicke das Gedicht nämlich dem Goethe.«
Die Mutter kam herein und suchte im Nähkorb. Sie hatte ihre neueste Haube auf der Faust. »Weißt, Riekchen, das graue Band gefällt mir nicht. Ich will der Bibiane eine Seidenprobe für Veilchenblau mitgeben. Veilchenblau hat mir früher so gut gestanden. Man vernachlässigt sich viel zu sehr hier auf dem Lande. Und wenn dann Besuch kommt –«
Friederike lachte hell. Überall kam ihr Der entgegen, an den sie selber unaufhörlich dachte.
Eine Stunde später ging sie zur Jasminlaube, dem Vater, der dort seine Predigt für den nächsten Sonntag durchlas und neu lernte, das Zehn-Uhr-Brot zu bringen. Sie fand ihn mit gespannter Miene vor sich hinstarrend, als lausche er einer Stimme. »Weischt, Riekchen,« sagte er und streckte ihr die Hand entgegen, »wie ich mir die Predigt wieder durchlese, die ich seit zwanzig Jahren am vierten Sonntag nach Trinitatis zu halten pflege, kommt mir die Lust, in diesem Jahre eine neue zu machen. Es ist so eine Sommerherrlichkeit heuer! Und da hab' ich mir den Text gedacht aus dem Lukas: ›Selig sind eure Augen, daß sie sehen, und eure Ohren, daß sie hören.‹ Und, siehscht du, Riekchen, ich habe eine Entdeckung gemacht: Es ist ein großer Irrtum des Mittelalters gewesen, daß man die Erde nur als Jammertal betrachten wollte. Und daß man behauptete, die Bibel erlaube keine Sinnenfreuden, verlange nur immer Reue und Buße. Denke doch an den Spruch: ›Sehet die Lilien auf dem Felde.‹ Und man kann eine Menge anderer finden, die Sorglosigkeit und Freude predigen, Es wird einem so froh dabei.«
Friederike fiel dem Vater um den Hals. Der gute Mann hatte vergessen, wem er diese Gedanken entlieh, die ihn beglückten. Friederike aber wußte es. Ergriffen sah sie in das Gesicht ihres lieben Väterchens, das auf einmal so apostelmäßig dreinschaute. Und blickte dann hinüber nach der Seite, wo sie die silberne Silhouette des Münsterturms in schwachem Umriß erkannte. Ob er jetzt dort oben stand?
In diesem Augenblick erschien Salome im Garten mit Marx, der gestern abend zu Besuch gekommen war. Er schleppte halbverdrossen einen Korb voll Erde, während das Sälmel allerlei Farnpflanzen, in ein Tuch geknüpft, trug. »Sie will durchaus den ›Berg‹ zur Alpenwelt machen«, klagte er zu Friederike. »Der Monsieur Goethe verlangt's – da tut sie's eben. Und ich muß dabei helfen!«
Vater Brion achtete nicht auf seine Worte, hielt ihn am Rockknopf und sagte ihm ungefähr das gleiche, was er eben Friederike gesagt.
Salome lachte. »Aha, der Goethe hat dich angesteckt!«
Da setzte Marx seinen Korb nieder und schnitt ein bitterböses Gesicht. »Das Pfarrhaus zu Sesenheim hat einen neuen Herrn bekommen«, sagte er beleidigt. »Er logiert in Straßburg, aber hier im Hause führt er Regiment. Ein reiches Herrchen, das mit seinem Mummenschanz die Köpfe verdreht, während ernsthafte Leute, die nicht so gut hopsen und schwadronieren können wie der, über die Achsel angesehen werden. Und Pfarrer Brion hat es wahrlich doch nicht nötig, sich seine Predigten aus dem Hirn eines Zweiundzwanzigjährigen zu leihen!«
Vater Brion sah betroffen drein wie ein gescholtenes Kind. »Man wird eben selber wieder Zweiundzwanzig«, sagte er leise. »Und das tut gut.«
Marx wollte erwidern. Da sah er, daß aus Garten, Hof und Haus Herrschaft und Gesinde auf die Straße lief. »Bibiane kommt! Die Botenfrau ist da!« Friederike, leichtfüßig wie ein Reh, war schon am Gatter, Salome, den Kopf reumütig zurückgewandt, folgte ihr langsamer. Und selbst der Alte nahm den langen Schlafrock auf und lief mit seinem Altmännerschritt dem Hoftor zu.
Marx blieb allein. Er stieß den Korb mit Erde, der jetzt am Boden stand, mit einem Fußtritt um.
Er wenigstens wollte nicht mittun bei dem »Goethzendienst«. Der Worteinfall machte ihm Spaß und tröstete ihn ein bißchen.
Es war ein großer Wäschetag gewesen im Pfarrhause. Die Frauen der Familie hatten rechtschaffen mitgearbeitet. Nun saß man abends auf den Bänken nahe dem Hause. Die Mutter war über einer Filetarbeit eingeschlafen, Salome lehnte schläfrig, die Hände im Schoß, neben ihr, der Vater las beim Scheine des Windlichts in einer Übersetzung Ossianscher Gesänge, die Goethe gemacht und ihm geschickt hatte. Er fand wenig Geschmack daran. Wozu all das Traurige und Dunkle? Das Alter will Helligkeit, weil es selber trübe ist.
Friederike hatte das Kästchen vorgeholt, in dem unter Noten, Kochrezepten und Häkelmustern allerhand Zettel und Briefe von dem neuen Freunde lagen. Auch Gedichte. »Ihr goldenen Kinder«, schrieb er manchmal. Aber der Inhalt – der war für sie allein. Da war eine Stelle in seinem allerersten Briefe, die sie immer wieder las:
»Es ist ein gar zu herziges Ding um die Hoffnung wiederzusehn. Und wenn uns das Herz wehtut, gleich sind wir mit der Arzenei da und sagen: Liebes Herzchen sei ruhig, du wirst nicht lange entfernt bleiben von den Leuten, die du liebst. Sei ruhig, liebes Herzchen! Und dann geben wir ihm inzwischen ein Schattenbild, daß es doch was hat. Und dann ist es artig und still wie ein Kind, dem die Mama eine Puppe statt des Apfels gibt, wovon es nicht essen soll.«
Friederike erhob sich plötzlich. Sie ging in die Küche, in der die Magd vom »Anker« heute dem Bärbele half.
»Ist noch Hefe da zum Kuchenbacken?« fragte sie. »Wir bekommen Besuch. Heute abend noch!« fügte sie hinzu.
Nachdem sie das gesagt hatte, stand sie verstört. Was fiel ihr nur ein? Es war ja gar kein Mensch angekündigt?
Aber die Gewißheit in ihr war stärker. Sie streifte sich die Ärmel auf, band eine große Schürze um und begann in einer großen irdenen Schüssel Mehl und Butter anzurühren. Nach einer Weile kam Salome, nach ihr zu sehen. Die Eltern seien schon schlafen gegangen, was denn Friederike da noch treibe? Ob sie nicht müde sei vom Schaffen heute?
»Es kommt Besuch heut abend!« sagte Friederike ruhig und gewiß.
»Ach, Unsinn!« Sie lachte. Aber sie half doch, ganz munter geworden und wie erfrischt, der Schwester eifrig bei ihrem Werke. Bald war der Ofen frisch geheizt, die Backsteine erhitzt. Und es dauerte nicht allzulange, da saßen die beiden Mädchen wieder auf der Bank vor dem Hause, sich zu kühlen. Und zu warten. Der Tisch war neugedeckt, am Fenster stand ein kaltes halbes Huhn bereit, der Kohl von heute mittag in der Ofenröhre.
»Länger als bis zehn bleibe ich nicht auf«, sagte Salome, deren Aufschwung sich schon wieder verlor. »Es ist ja närrisch, so aufs Geratewohl zu backen und zu brauen.«
Friederike antwortete nicht. Sie hatte Hufschlag gehört. Aber der Reiter war von der Dorfstraße ausgebogen. Wahrscheinlich im Wirtshaus geblieben.
»Jetzt geh' ich aber«, sagte Salome und stand auf. »Man muß sich ja schämen, sich von deinen Einbildungen anstecken zu lassen!«
Da kamen Schritte. Die Mädchen liefen ums Haus herum. Und sahen nun den späten Gast, hochgewachsen, im kavaliermäßigen Reiserock und Stulpenstiefeln, wie er am Gattertor herumgriff.
Goethe!
Er stieß einen Freudenruf aus, als er die beiden freundlichen Gestalten aus dem Schatten heraustreten sah. Salome küßte ihn ohne Umstände, wie einen alten Bekannten, auf beide Wangen. Friederike reichte ihm eine heiße Hand, die er zärtlich in der seinen behielt. Plötzlich aber ließ er sie fallen. »Ich störe? Im ›Anker‹ sagte mir die Magd, man erwarte im Pfarrhaus noch Besuch heute abend?« Er blickte argwöhnisch umher, als vermute er einen Versteckten in den dunkeln Büschen.
»Nun, und was weiter?« fragte Friederike begütigend, denn Ton und Gebärde des jungen Mannes war zornig gewesen.
»Was weiter?« Er nahm sich zusammen. »Nun, da hat ein gewisser Monsieur ein wenig den Kopf verloren, ist hergelaufen, gestiefelt und gespornt, wie er vom Pferd gestiegen, um wenigstens noch der erste am Platze zu sein. Ich war recht eifersüchtig«, fügte er sanfter, fast abbittend, hinzu.
»Dazu haben Sie die wenigste Ursache, Sie Unband!« Salome lachte unbeherrscht. Friederike legte bittend den Finger an die Lippen, sie möge schweigen. Aber Salome lachte fort. »Ich lache nur,« erklärte sie endlich, »weil man Sie heute so höfisch vor sich sieht. Ich mußte dabei an den Kandidaten und den Bauernburschen denken. Auch Vetter Gottliebs Pekesche war nicht elegant.« Sie lief ins Haus, den bereitgestellten Imbiß herauszubringen. Dabei legte sie sich schon die Worte zurecht, mit denen sie Marx die ganze Begebenheit schreiben würde. Sie hatte ihn von Herzen lieb, aber seine trockene, schwerfällige Art ärgerte sie oft. Und es machte ihr Spaß, ihn ein wenig eifersüchtig zu machen auf diesen jungen Mann, der ja wirklich ein ganz goldiger Geselle war mit all seinen Unarten.
Ob er wohl Friederike heiraten wollte? Sie konnte ihn sich nicht als Hausvater vorstellen. Und Friederike liebte das Stadtleben nicht. Nein, es war schon das beste, das Riekchen heiratete einmal den getreuen Gottlieb. Bei dem würde sie es gut haben. Und man kannte die Verhältnisse!
Friederike hatte den Gast an den gedeckten Tisch geführt und das Windlicht wieder entzündet. Als er nun das weiße Brot, den Wein, den Käse und das blitzende Gedeck sah, stieg der Unmut wieder in ihm auf. »Und darf man wissen, wer der Undankbare ist, den man so liebevoll empfangen wollte, und der nun die unbegreifliche Nachlässigkeit begeht, nicht zu kommen?«
»Ein Undankbarer wirklich«, sagte Friederike lächelnd. »Sie haben recht. Ich rate Ihnen, sich recht gründlich an seine Stelle zu setzen und alles aufzuessen, was für ihn bestimmt war.«
Ihr Ton beruhigte ihn.
»Das soll geschehen!« Er lachte übermütig. »Ich hasse diesen Mann schon recht von Herzen. Und bin bereit, es auf einen Wettkampf mit ihm ankommen zu lassen.«
In Wahrheit aber aß er dann sehr wenig, blickte immer nur Friederike an und atmete ein paarmal tief wie ein Erlöster. Salome fand ihn blaß aussehend. Er gestand, er sei die ganze Zeit her nicht gesund gewesen, habe gehustet, schwer atmen können, und sein Professor selber habe ihm geraten, eine kleine Erholungsreise zu unternehmen. Da habe er sich denn noch am späten Nachmittag aufgemacht, sei im Dunkeln ein paarmal in die Irre geraten, aber die Sommernacht sei wunderschön gewesen. Und der Gedanke an das Wiedersehen morgen früh – –! Er endete nicht.
»Wir werden Sie schon heilen!« sagte Friederike zuversichtlich. »Sesenheim liegt so gesund. Sie sollten eine Weile hierbleiben, viel spazierengehn, kräftig essen, rudern – was Sie wollen.«
»Und meine Arbeit?«
»Die holen Sie sich her. Jeder hier hat seine Beschäftigung, und kommt man dann zusammen, ist's ein Fest.«
Man blieb noch eine Weile beisammen und machte Pläne. Dann schlug die Uhr vom Kirchturm elf. Goethe stand auf. »Wie schwer das Weggehn ist!«
Sie waren jetzt alle drei blaß und sahen übermüdet aus. Wäschetag und Ritt machten sich geltend. Trotzdem zögerte man den Abschied hin.
Fideel in der Hundehütte klopfte freundschaftlich mit seinem Schwanz das Holz. Er erkannte den Besucher wieder. Und genehmigte ihn. – – – –
Es war gekommen, wie die Mädchen geplant hatten: aus dem beabsichtigten Tagesbesuch war eine Sommerkur geworden. Die Mutter hatte erst allerlei Einwände gehabt: Der Gast würde sich auf die Dauer langweilen. Oder stören. Und wenn er ernstlich krank würde? Er sah so angegriffen aus. Und wenn es etwa die ganze Zeit über regnete? Was dann? Auch stand die Heuernte vor der Tür.
Aber das Wetter blieb schön, der Gast langweilte sich nicht im geringsten und störte auch niemanden. Der Vater war entzückt von dem Besuch. Der französische Brief war geschrieben, der Bauplan von dem Architekten angefertigt. Und der junge Gast half ihm auch, seine Bücher ordnen. Im übrigen saß er oft stundenlang auf dem jetzt wohlbepflanzten »Berge« und arbeitete. Oft wurden Ausflüge gemacht. Man besuchte die Rheininseln, fischte, tanzte, ruderte und sang. Und ließ sich nur von den blutgierigen Rheinschnaken verjagen, von denen die Einheimischen freilich weniger geplagt wurden als der Besuch. Goethe dichtete allerhand Trutzliedchen, die dann im Chorus gesungen wurden. Und von denen Christian felsenfest glaubte, sie verjagten die Plage.
Unter diesem heitern und unschuldigen Treiben besserte sich Goethes Gesundheit rasch. Und als die Heuernte kam, war er einer der eifrigsten bei der Arbeit, stand neben dem Knecht und sah ihm ab, wie er das Heu auf die blitzende Gabel spießte und dann mit kräftigem Schwung die duftende Wolke auf den Wagen schleuderte, daß die Mägde droben fast nicht schnell genug die Menge unterbringen konnten. Salome, die droben mithalf, spuckte unaufhörlich trockene Grasblumen aus und behauptete, der mutwillige Studiosus ziele extra auf sie; wolle sie verschütten. Harmlose Scherze flogen hin und her. Man spürte die Hitze kaum, solange man sich bewegte. Erst als Friederike mit dem Bärbele kam und das Mittagessen brachte, war allgemeines Ausruhen und Schweißwischen. Man suchte den Schatten der Kirschbäume auf, die, nun schon blütenlos, voll kleiner grüner Fruchtkelche standen. Friederike teilte aus. Die Zinnteller blitzten, der Wein leuchtete, die Männer mit ihren aufgestreiften Hemdsärmeln, die Frauen, mit Hüten und hellen Brusttüchern gegen die Sonne geschützt, die Blätterschatten über den erhitzten Gesichtern – alles gab ein Bild wohligen Ruhens und Genießens. Man sprach nicht viel. Ermüdet lagerte man am Wiesenrain, ganz körperliche Zufriedenheit, ganz Gegenwart. Auch Goethe, sonst beredt, lag still, an einen kühlen Wegstein gelehnt. Ihm war nichts Lieberes, als zuzusehen, wie zierlich Friederike ging und kam und holte, ordnete und zuletzt der Magd half, die am Bach die gebrauchten Teller und geleerten Schüsseln reinigte. Jeder einzelne, der zu ihr herantrat, um seinen Löffel, seinen Teller zu bringen, erhielt von ihr ein freundliches, vertrautes Wort, eine Frage. Jedes Gesicht, auf das sie blickte, entfaltete sich. Zu Goethe sprach sie kaum. Auch verlangte er nicht danach. Sie wußten beide, jeder still für sich, daß sie einander das Liebste auf der Welt geworden waren. Sich das laut zu sagen – dessen bedurfte es noch nicht für sie in diesen Tagen.
Und der Sommer ging weiter. Ein rechter Sommer für Liebende. Nichts mehr von Rheinnebeln und feuchten Schleiern. Klar und wie in Blau gemalt lag das fruchtbare Land und sandte seine warmen Düfte in die Dörfer. Die Aufregung des Frühlings war still geworden, die Bäume blühten nicht mehr, die Vögel hatten aufgehört zu jubilieren. Man hörte Nestgezirp und sah Früchte reifen. Die Tage waren hell und heiß, ohne Schwüle, und nachts schickten die Gebirge abkühlende Gewitter ins Tal hinab, den nächsten Morgen der Seligkeiten vorzubereiten.
An Schlaf dachte man kaum. Schon die frühsten Morgenstunden, in denen noch Tau auf Wiesen und Sträuchern blitzte, wurden zu Spaziergängen benutzt, an denen jeder nach Laune und Muße teilnahm. Meist aber waren es nur der Vater, Goethe und Friederike, die sich zusammentaten. Und zuletzt kehrte der Vater um. Dann fand sich unwillkürlich Hand in Hand. Meist war zuerst ein Schweigen zwischen ihnen. Sie pflückten Sträuße aus dem Feld heraus, suchten nach Beeren und lachten, wenn sie sich mit blaugefärbten Mündern gegenüberstanden. Dann ruhten sie im Tannenschatten. Und dort war es meist, wo sich ihnen die noch ungeborenen Helden von Goethes späteren Werken zugesellten. Die lieblichen blauen Kuppen der Schwarzwaldberge verwandelten sich ihnen in steile, unzugängliche Felsen, bekrönt von den Burgen der Raubritter. Bauern mit Mistgabeln und Erdhacken stürmten gegen ihre Zwingherren an. Die eisenumklirrte Gestalt des Götz von Berlichingen trat zu ihnen, streckte seine erzene Hand wie schützend über die deutschen Dörfer und Felder. Seine großen blauen Augen blickten suchend umher nach einem treuen Freunde.
Und Faust tauchte auf im schwarzen Talar des Gelehrten, dann im Weltmannskleide, und neben ihm der Teufel, der ihm alle Freuden der Erde anbietet. Faust aber trägt die dunkle Angst im Herzen: »Ich darf mich nicht am Augenblick verlieren. Meine Kraft gehört dem Kampf, dem Werke.«
Es waren nur unzusammenhängende, ungeformte Bilder, die da im elsässischen »Wäldle« vor dem jungen ländlichen Mädchen sich offenbarten, aber die Stimme, die, bebend vor Schaffensleidenschaft, vor ihr redete, der geheimnisvolle Glanz der dunkeln Augen, aus denen die Gestalten – wie aus heiligen schwarzen Seen – sich zu erheben schienen, füllte die Lauschende mit Andacht; fast mit Schrecken. Ein Strom aus anderm Lande stürzte sich da brausend in ihr friedliches Gebiet, riß sich Weg durch stilles Land, sprengte Felsgestein. Und floß zum großen Meere. Und Friederike, deren ganzes Dasein im Heitern, Anmutigen und Wirklichen eingesichert lag, atmete schwer in solchen Augenblicken. Fast wie in Furcht.
Einen Augenblick darauf aber rollte sich der eben noch Gottbesessene, jauchzend wie ein Kind, den Abhang hinunter, daß Friederike ihn tröstend zwischen Brombeerdornen und Nesseln aufsuchen und ihn mit allerlei alterprobten elsässischen Zaubersprüchen »heile, heile« sagen mußte.
So lebten sie. In den heißen Stunden ging dann ein jeder im möglichst kühlen Zimmer eigener Beschäftigung nach.
Friederike hatte ein paarmal in der Woche kleine Mädchen um sich, die bei ihr spielten, nähten, plauderten. Sie war die Vertraute von allen, das »Täntele«.
Goethe, wenn er sie so beschäftigt wußte, schlich sich gern in das Nebenzimmer und horchte auf das Durcheinanderschwatzen und auf ihre Stimme, die bald ein Liedchen sang, bald beschwichtigende Worte redete, bald schalt. Und oft von Herzen lachte. Sie schien ihm plötzlich zeitlos. Kindlich noch und weise Lenkerin zugleich.
Wenn dann zuletzt die Tür aufgeschmettert wurde und die Maidele unter großem Gekrach die Treppe hinuntersausten, lärmte das ganze Haus von »Täntele, grüß Gott, au revoir, auf Wiedersehen, lieb Tantele«. Es klang ihm lange noch im Ohr. – Im übrigen arbeitete der junge Doktorand leidlich fleißig zur Promotion. Er hatte im Herbst ein Vorexamen gut bestanden, das ihn von der Pflicht entband, Vorlesungen zu hören. Nun hatte er einen dicken Band mitgebracht, eine Sammlung von Pandekten, die er gewissenhaft durchstudierte, sich Notizen machte, lernte, schrieb.
Viel lieber aber als die Juristerei studierte er sein geliebtes Deutsch. Nicht nur aus den gelehrten Büchern. Hier auf dem Lande behorchte er die Alten und Jungen; machte sich lieb Kind bei den Spittelweibern, die ihm mit ihren welken oder vertrunkenen Stimmen die Liedchen ihrer Jugend vorsangen. Er spielte auf dem Anger mit den Kindern und lernte ihre kauderwelschen Abzählverschen kennen, aus denen er sich das alte, unverwischte Alemannisch mit Entzücken herausschälte. Jeder kannte ihn. Er wurde die Wichtigkeit und der Liebling des ganzen Dorfes. Und wo sich »der Mamsell Riekchen ihr Hochzeiter« blicken ließ, war er lustig umringt.
Abends dann, nach dem Nachtessen, kam man in der hoch und leidlich kühl gelegenen Jasminlaube zusammen. Goethe las vor. Heiteres und Ernstes, Altes und Neues. Alles, was die besten Geister der Gegenwart und der Vergangenheit bewegte, trug er zusammen hier für sein kleines liebes Nest auf dem Lande. Oft erzählte er auch. Erlebtes und Erfundenes durcheinander. Oder sie lasen, miteinander ins Buch sehend, kleine Dramen, Lustspiele. Auch einige, die Goethe selbst früher gedichtet hatte, und die besonders dem Vater gefielen, weil sie noch im Stil der französischen Schäferspiele geschrieben waren, die er aus seiner Jugend kannte.
Das Sälmel, das nicht gern still saß, schlief manchmal verstohlen ein, und die übermüdete Mutter schlich sacht zu Bett. Der Vater aber und Friederike hätten am liebsten die ganze Nacht gesessen und zugehört.